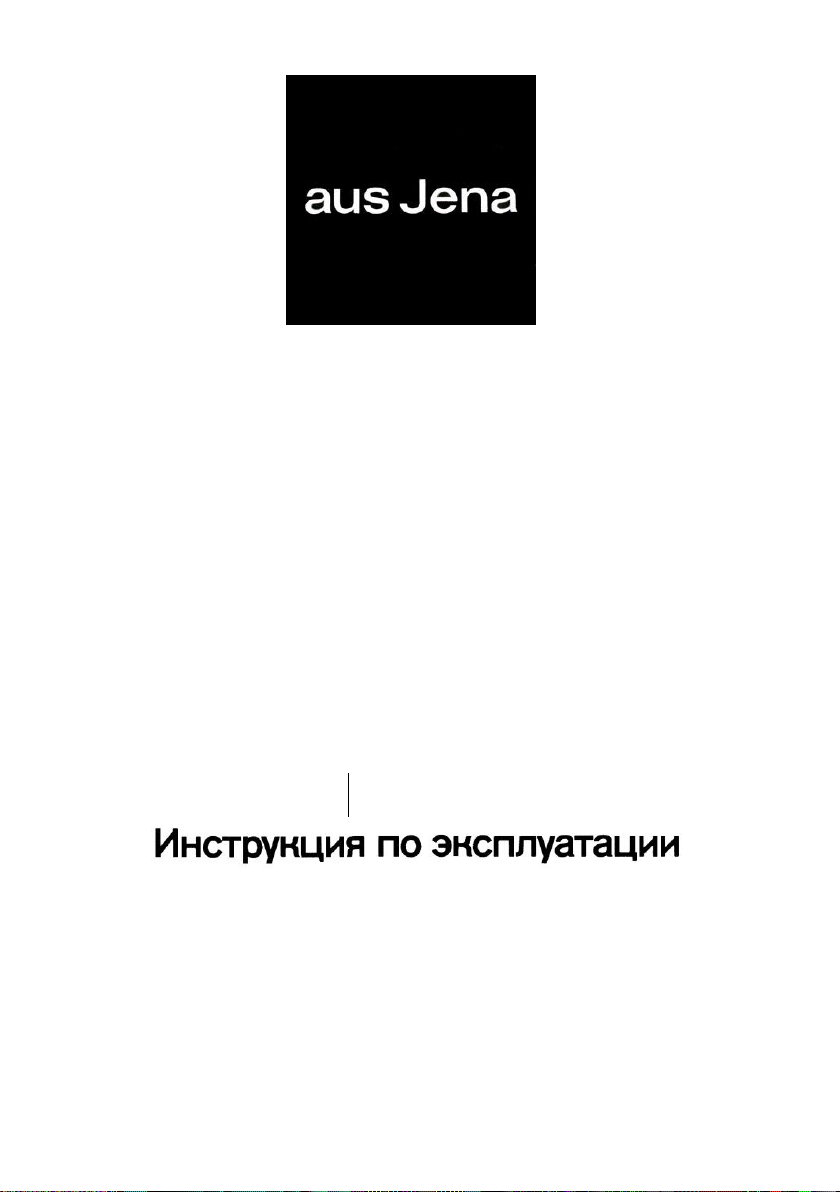
RETARMET 2
Gebra uchsanleitung
Operating instructions
Mode d'emploi
Instrucciones para el uso

ACHTUNG!
Ergänzungshinweise zum Auspacken und Betrieb von Präzisionsgeräten in
Ländern mit feuchtwarmem Klima siehe Seite 121.
Durch ständige Weiterentwicklung unserer Erzeugnisse können Abweichungen
von den Bildern dieser Gebrauchsanleitung auftreten. Die Wiedergabe — auch
auszugsweise — ist nur mit unserer Genehmigung gestattet. Das Recht der
Übersetzung behalten wir uns vor. Die Gebrauchsanleitung ist nicht verbindlich
für den Lieferumfang.
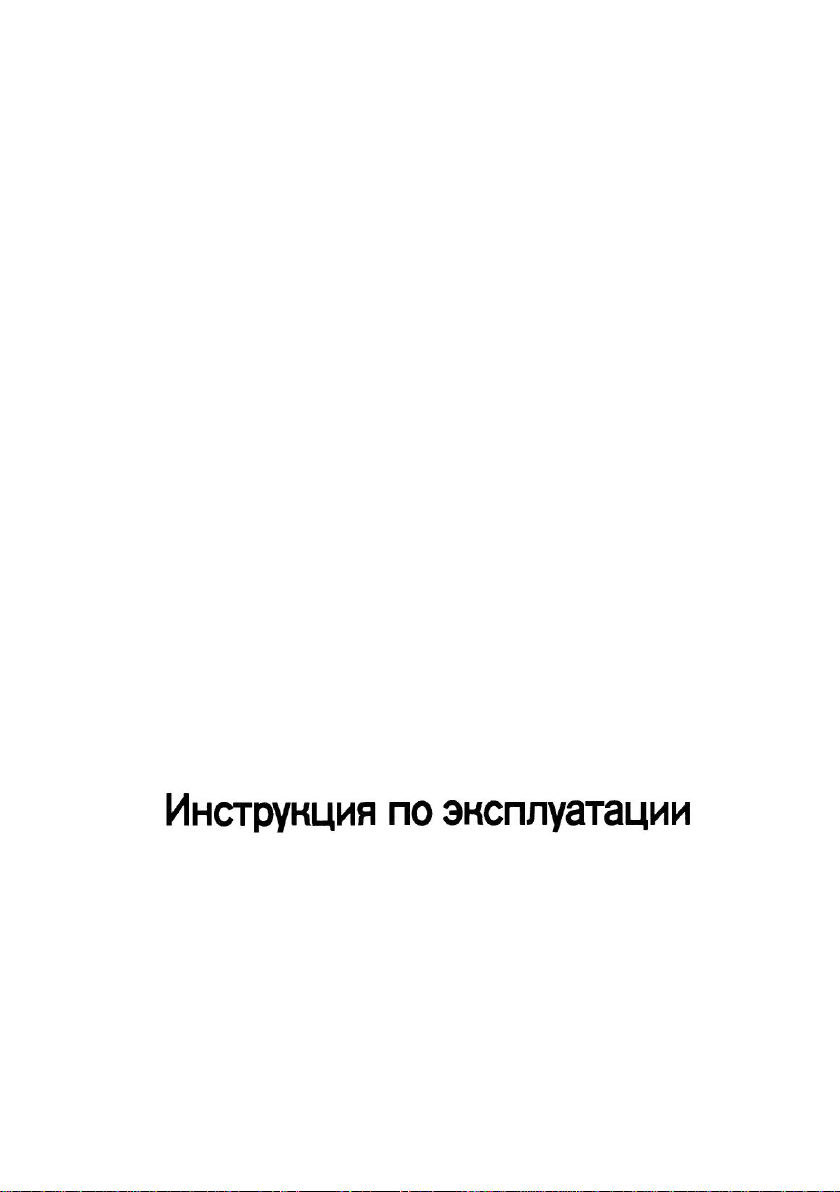
ZEISS
RETARMET 2
Gebrauchsanleitung
Operating instructions
Mode d'emploi
Instrucciones para el uso

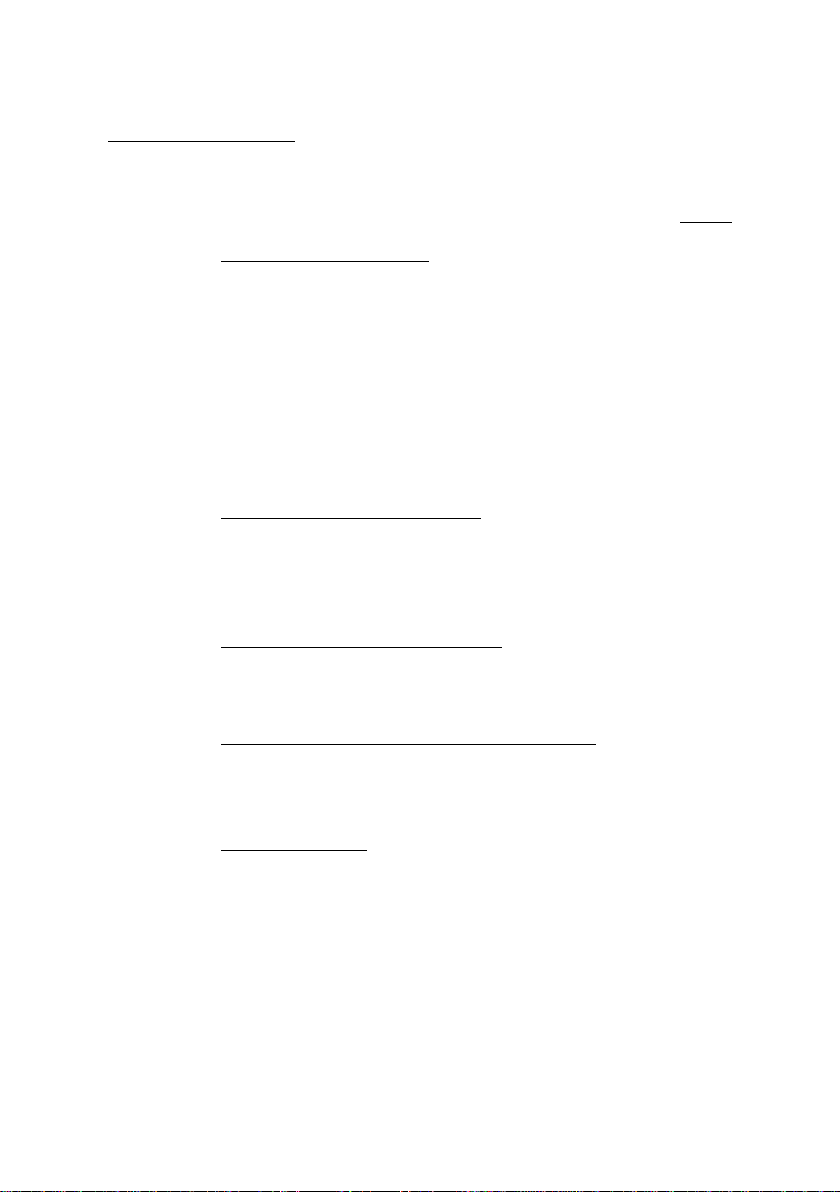
Inhaltsverzeichnis
Seite
1. Einsatzmöglichkeiten 9
1.1. Polarisationsoptische Kompensationsmethoden 9
1.1.1. Drehkompensatoren 9
1.1.2. Digitalanalysator am JENAPOL b 9
1.1.3. Kippkompensatoren 10
1.2. Längenmessung 10
1.3. Doppelbrechung 10
1.4. Interferometrische Kompensationsmethoden 10
1.5. Photometrie 11
2. Die RETARMET 2-Konzeption 11
2.1. Gerätegestaltung 11
2.2. Anzeigeeinheit 11
2.3. Tastatur 12
3. Bedienkomfort am RETARMET 2 15
4. Hohe Bediensicherheit am RETARMET 2 16
5. Anschlußmöglichkeiten am RET."RMET 2 18
5.1. Elektrischer Anschluß 18
5.2. Mechanischer Anschluß der Geber 18
6. Inbetriebnahme 19
7. Programmierungen für den Meßbetrieb
notwendige Vereinbarungen mit dem Rechner
über den Meßablauf 20
7.1. Vorbemerkung 20
7.2. Erläuterung zu den einzelnen Memory-Anzeigen 21
7.2.1. Abfrage der Druckerinitialisierung 2l
7.2.2. Abfrage der Umgebungstemperatur 23

7.2.3. Abfrage zur Datumangabe 23
7.2.4. Abfrage zur Meßmethode und den
zugehörigen Parametern 24
7.2.4.1. Wahl der Meßmethode 24
7.2.4.2. Wahl der Zusatzparameter 25
7.2.4.2.1. Meßwellenlänge
für die Meßmethoden /E6/,/E13O/ und /R:L/ 26
7.2.4.2.2. Meßwellenlänge, incl. einer frei wählbaren
für die Meßmethode /SEN/ und /R:L/ 26
7.2.4.2.3. Meßwellenlänge und die Kompensatorkonstante
für die Meßmethoden /B-K/ und /B-S/ 27
7.2.4.2.4. Skalenkonstante bzw. die Photometrie-Standards
für die Meßmethoden /L/,/R:L/ und /PHOT/ 28
7.2.4.2.5. Gerätekonstante
für die Meßmethode /INT/ und /VEL/ 29
7.2.5. Abfrage zur Auswertung der Meßergebnisse 31
7.2.5.1. Operationsmode 31
7.2.5.2. Statistik in übergeordneten Speicherebenen 35
7.2.5.3. Verfahrenskonstante
für die Meßmethoden /INT/ und /VEL/ 36
7.2.6. Abfrage zur Klassierung der Meßergebnisse 37
7.2.6.1. Klassierstart 39
7.2.6.2. Klassenbreite 39
7.2.6.3. Übernahme der Meßergebnisse in das
Klassierprogramm 40
7.2.6.4. Abruf der Datenklassierung im Meßbetrieb 41
7.2.6.5. Histogramme zur Datenklassierung bei
Verwendung eines Druckers 42
7.2.7. Abfrage zur Objekt-Kennzeichnung
Codierung 46
7.3. Übergang zum Meßbetrieb 46
7.3.1. Entscheidung über die Datenprotokollierung
im Meßbetrieb 47
7.3.1.1. Ausdruck der Betriebsbedingungen
Protokollkopf 47
7.3.1.2. Varianten der Datenprotokollierung 48
7.1.3.3. Ausdruck eines Tabellenkopfes 49

8. Messung mit Kippkompensatoren nach
EHRINGHAUS 5l
8.1. Mehrfaches Messen an einem Objekt
Serienmessung 52
8.2. Bestimmen aktueller Einzelergebnisse
Meßfolgen 54
8.2.1. Bestimmung der Kompensator-Nullage 54
8.2.2. Durchführung einer Meßfolge 55
8.3. Erfassen dynamischer
Gangunterschiedsänderungen 55
9. Messung mit dem Digitalanalysator nach
DE SENARMONT 58
9.1. Meßvorbereitungen 58
9.1.1. Justieren des λ/4-Kompensators 58
9.1.2. Bestimmung des Meßwinkels 59
9.1.3. Mehrfaches Messen an einem Objekt
Serienmessung 60
9.3. Eliminieren geräteinterner Fehler 62
9.4. Bestimmen aktueller Einzelergebnisse
Meßfolgen 62
9.5. Erfassen dynamischer
Gangunterschiedsänderungen 63
10. Messung mit Drehkompensatoren nach
BRACE-KÖHLER 64
10.1 Meßvorbereitung 65
10.2. Mehrfaches Messen an einem Objekt
Serienmessung 67
10.3. Eliminieren geräteinterner Fehler 68
10.4. Bestimmen aktueller Einzelergebnisse
Meßfolgen 68
10.5. Erfassen dynamischer
Gangunterschiedsänderungen 69
11. Messung mit Drehkompensatoren nach
BEAR-SCHMITT 70
11.1. Anmerkung zur Meßmethode 70
11.2. Mehrfaches Messen an einem Objekt
Serienmessung 70
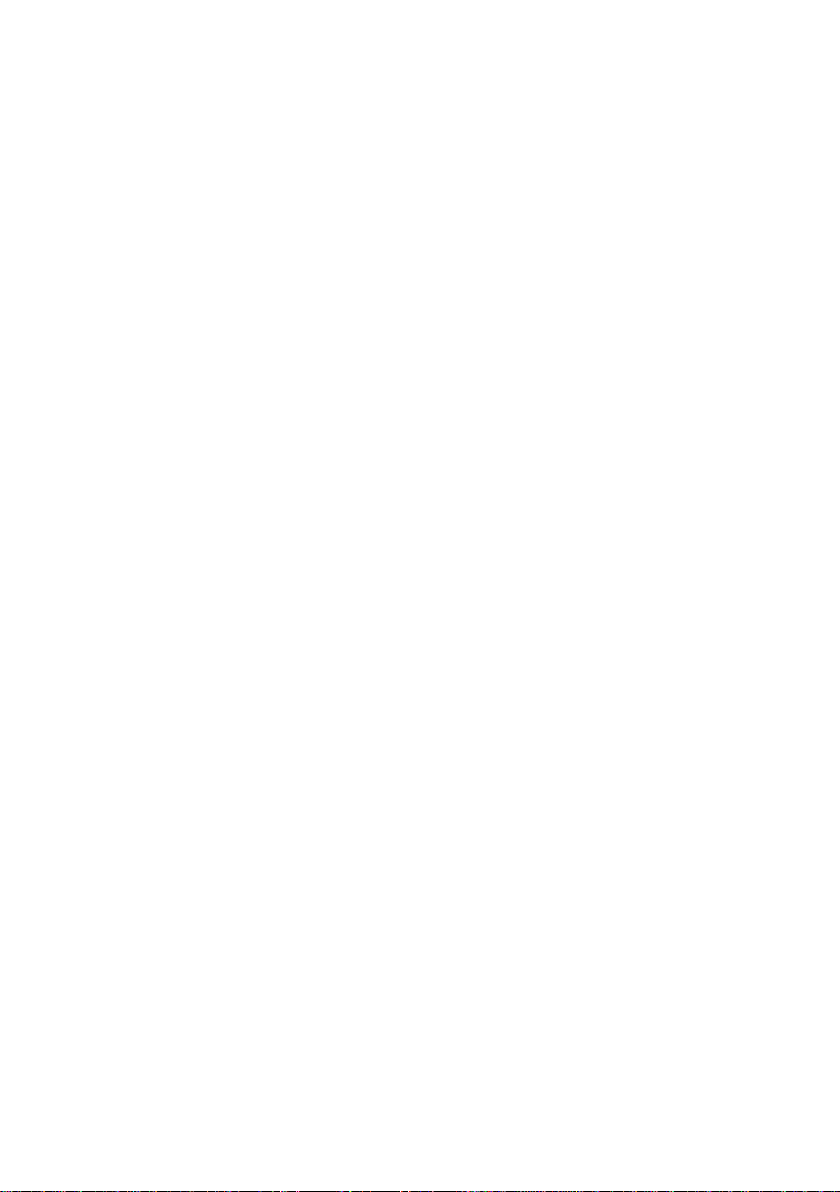
11.3. Bestimmen aktueller Einzelergebnisse
Meßfolgen 71
11.4. Erfassen dynamischer
Gangunterschiedsänderungen 71
12. Längenmessung mit binokularen
Meßeinrichtungen 71
12.1. Bestimmung der Skalenkonstante
Kalibriervorgang 72
12.2. Vorbemerkung zur Meßmethode 75
12.3. Mehrfaches Messen einer Struktur
Serienmessung 75
12.4. Bestimmen aktueller Einzelergebnisse
Meßfolgen (1. Version) 77
12.5. Bestimmen aktueller Einzelergebnisse
Meßfolgen (2. Version) 78
13. Messung der Doppelbrechung 79
13.1. Meßvorbereitung 80
13.2. Mehrfaches Messen an einem Objekt
Serienmessung 80
13.3. Bestimmung aktueller Einzelergebnisse
Meßfolgen 82
14. Subjektive interferometrische Messung 83
14.1 Vorbemerkung 84
14.2. Bestimmung der Gerätekonstante
Kalibriervorgang 85
14.3. Mehrfaches Messen an einem Objekt
Serienmessung 87
14.4. Bestimmen aktueller Einzelergebnisse
Meßfolgen 90
15. Objektivierte interferometrische Messung 91
15.1 Bestimmung der Gerätekonstante
Kalibriervorgang 92
15.2. Mehrfaches Messen an einem Objekt
Serienmessung 95
15.3. Bestimmen aktueller Einzelergebnisse
Meßfolgen 97
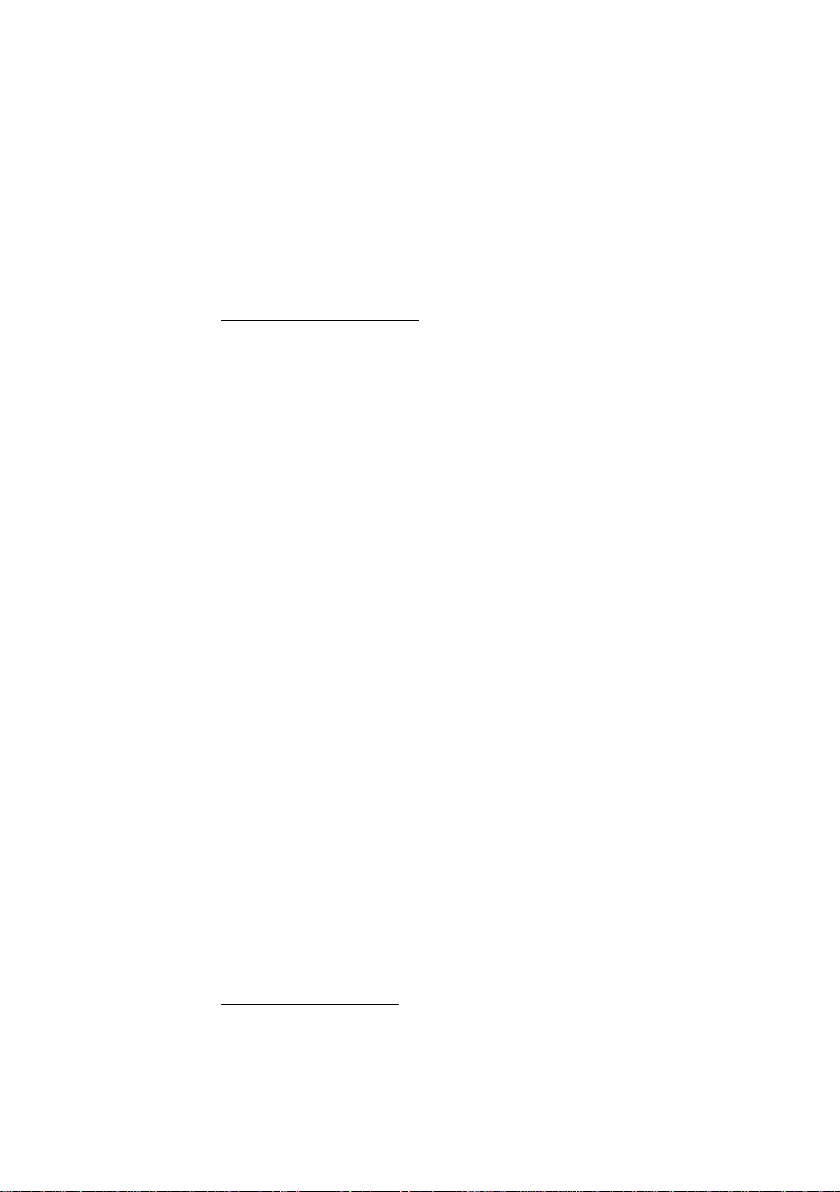
16. Photometrie mit dem VELOMET 2 99
16.1 Kalibriervorbereitungen 100
16.2 Kalibrieren der Photometereinrichtung 101
16.3. Mehrfaches Messen an einem Objekt
Serienmessung 103
16.4. Bestimmen aktueller Einzelergebnisse
Meßfolgen 105
17. Temperaturmessungen mit dem RETARMET 2 106
18. Wartung des Gerätes 108
18.1. Kriterien für den Batteriewechsel 1ß8
18.2. Batterietypen 109
18.3. Wechsel der Batterie 109
18.4. Eingabe des Datums nach Batteriewechsel 110
19. Betriebsstörungen 110
19.1. Geräteeigentest (Einschalttest) 110
19.2. Kontrolltests 112
19.2.1. Test Batteriedatum 112
19.2.2. Test Datenspeicher 112
19.2.3. Test Tastatur 112
19.2.4. Test Analogsignalabgleich 112
19.2.5. Test Druckerinterface 114
20. Anschluß- und Betriebsbedingungen
peripherer Einheiten 114
20.1. Drucker-Interface 114
20.1.1. Elektrische Anschlußbbedingungen V24
(RS-232-C) 115
20.1.2. Elektrische Anschlußbedingungen
20 mA-Stromschleife (IFSS) 115
20.1.3. Übertragungsbedingungen 116
20.2. Analogeingang für externes Photometer 117
20.3. Analogeingang zur Temperaturmessung 117
21. Technische Kennwerte 119
22. Bilderläuterungen 120

Anhang
Tabelle 1. Programmierschema
Tabelle 2. Arbeitsregeln
Tabelle 3a. Schematischer Meßablauf für EHRINGHAUS-Kompen satoren 0 ... 6 λ, 0 ... 130 λ
Operationsmodus "σ'√X " und "s√X"
Tabelle 3b. Schematischer Meßablauf für EHRINGHAUS-Kompen satoren 0 ... 6 λ, 0 ... 130 λ
Operationsmodus "x" und "dyn"
Tabelle 4. Schematischer Meßablauf für Messungen nach
DE SENARMONT mit dem Digitalanalysator
Tabelle 5a. Schematischer Kalibrierablauf für Messungen
nach BRACE-KÖHLER und BEAR-SCHMITT
Tabelle 5b. Schematischer Meßablauf für Messungen nach
BRACE-KÖHLER und BEAR-SCHMITT
Tabelle 6a. Schematischer Kalibrierablauf für die Be stimmung der Skalenkonstante im Längenmeß
programm
Tabelle 6b. Schematischer Meßablauf für die Längenmessung
Tabelle 7a. Schematischer Meßablau£ für die Meßmethode R :
L Operationsmodus "σ'√X " und "s√X"
Tabelle 7b. Schematischer Meßablauf für die Meßmethode R :
L Operationsmodus "x"
Tabelle 8a. Schematischer Kalibrierablauf für die Be
stimmung der Gerätekonstante im Programm für
subjektive interferometrische Messung
Tabelle 8b. Schematischer Meßablauf für das Programm
"Subjektive interferometrische Messung"
Tabelle 9a. Schematischer Kalibrierablauf für die Be stimmung der Gerätekonstante im Programm für
objektivierte interferometrische Messung
Tabelle 9b. Schematischer Meßablauf für das Programm
"Objektivierte interferometrische Messung"
Tabelle 10a. Schematischer Kalibrierablauf für die Photo
metrie
Tabelle 10b. Schematischer Meßablauf für die Photometrie
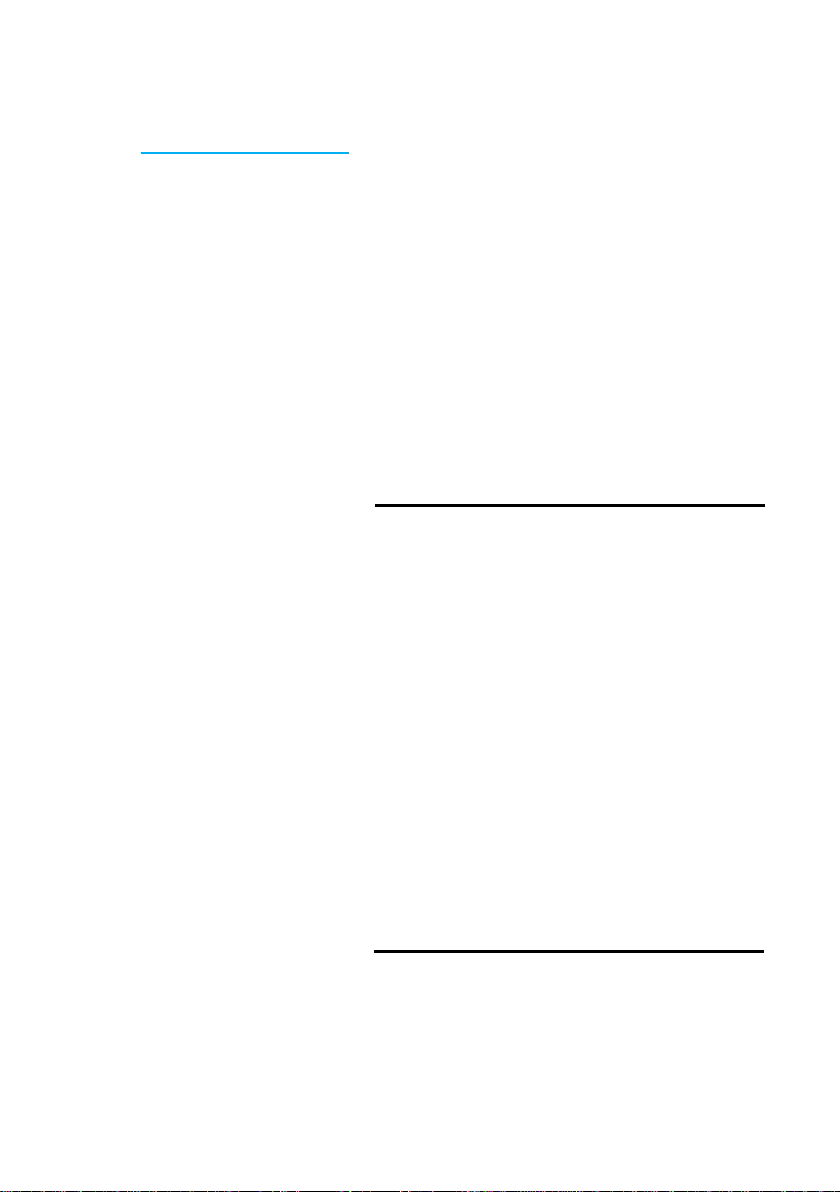
9
1. Einsatzmöglichkeiten
Das RETARMET 2 dient zum quantitativen Erfassen und Auswerten polarisationsoptischer und interferometrischer
Gangunterschiede sowie zur photometrischen Auswertung und
zur Längenmessung am Objektdetail.
1.1. Polarisationsoptische Kompensationsmethoden
Das RETARMET 2 ist verwendbar für alle gebräuchlichen Meßkompensatortypen und deren Meßverfahren.
Je nach Applikation stehen folgende Kompensatoren zur Wahl:
1.1.1. Drehkompensatoren
Meßbereich Auf- Reprodu- Symbol
lösung zierbar- für die
keit σ' Meßmethode
λ/32-Kompensator 0... λ/32 0,06° 0,4 nm
nach 30 59 52:519.26/7
λ/8 –Kompensator 0... λ/8 0,06° 1 nm
nach 30 59 52:516.26/4
Anwendbare Meßverfahren: 1. BRACE-KÖHLER 1) /B-K/
1)
Zum Erzielen fehlerfreier Absolutwerte wurde erstmals die
2. BEAR –SCHMITT
2)
/B-S/
exakte Funktion für das Verfahren BRACE-KÜHLER angewandt.
Zur Gewährleistung o.g. Reproduzierbarkeit kann nur maximal 2/3 des Meßbereiches genutzt werden. (Weiteres siehe
Abschnitt 10.)
2)
Mit der Meßmethode BEAR-SCHMITT kann der o.g. Meßbereich
verdoppelt werden.
1.1.2. Digitalanalysator am JENAPOL b
Meßbereich Auf- Reprodu- Symbol
lösung zierbar- für die
keit σ' Meßmethode
0. . .1λ 0,05° 0,2 nm
Anwendbares Meßverfahren: DE SENARMONT /SEN/
mit Halbschattenmeßeinrichtung
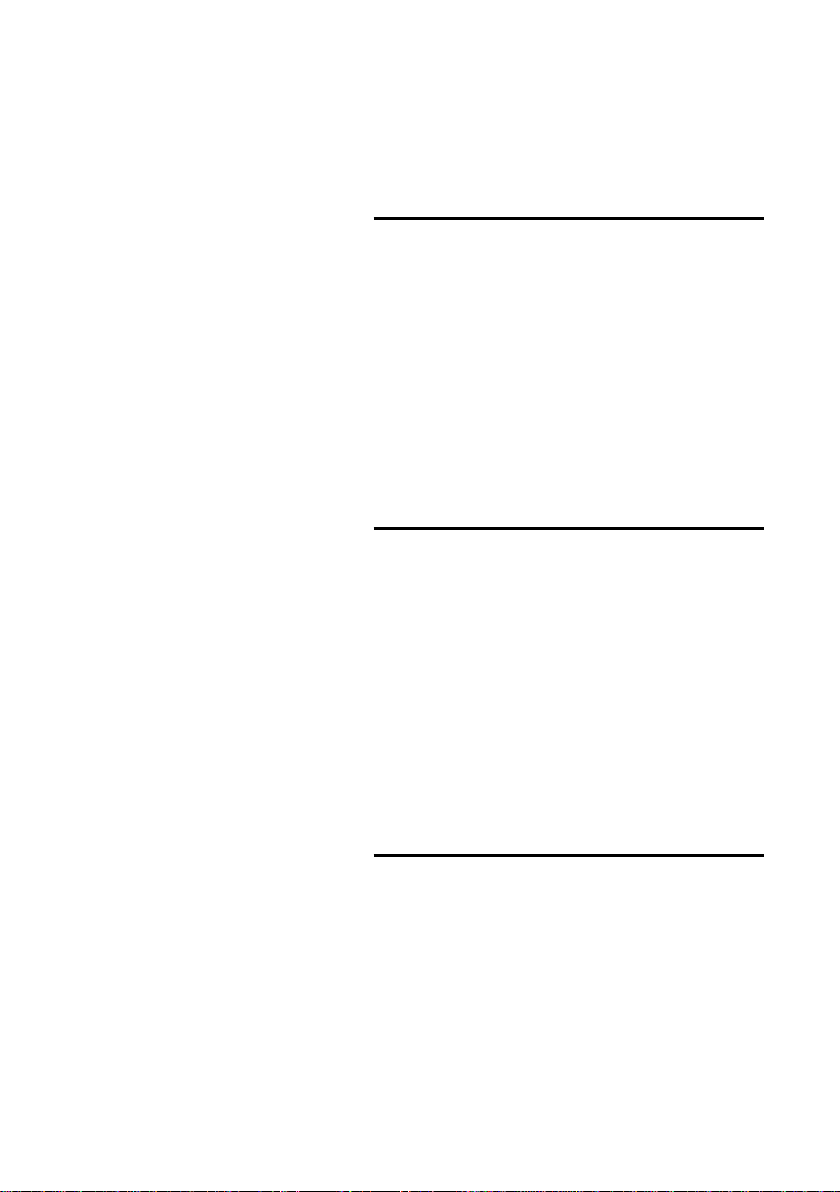
10
1.1.3. Kippkompensatoren
Meßbereich Auf- Reprodu- Symbol
lösung zierbar- für die
keit σ' Meßmethode
EHRINGHAUS 0...6λ 0...6λ 0,01° 1 nm /E6/
nach 30 59 52:511.26/8
EHRINGHAUS 0...130λ 0...130λ 0,01° 3 nm /E130/
nach 30 59 52:514.26/2
1.2. Längenmessung
Das Längenmeßprogramm gestattet effektive Serienmessungen
an einzelnen Objekten, sowie Populationsuntersuchungen am
Präparat unter Verwendung einer binokularen Meßeinrichtung
an Routine-und Forschungsmikroskopen.
Meßbereich Auf- Reprodu- Symbol
lösung zierbar- für die
keit σ' Meßmethode
10 000 µm 0,lµm
2)
Mit Objektiv lO;
bis max.
2)
1.0 µrn 2) /L/
Objekt mit guter Kantendefinition, gemessen in Feldmitte
1.3. Doppelbrechung
Das Programm zur Bestimmung der Doppelbrechung Δn, vorrangig für Fasern oder Kristallindividuen (bei Verwendung der
Kristalldreheinrichtung), basiert auf einer Kombination von
Kompensator-und Längenmeßprogrammen.
Meßbereich Auf- Reprodu- Symbol
lösung zierbar- für die
keit σ' Meßmethode
ab ca. etwa
0,001 0,0005 /R:L/
1.4. Interferometrische Kompensationsmethoden
An den Mikroskopen JENAPOL interphako, JENAVAL interphako
und JENAVERT interphako dienen die Meßmethoden /INT/ und
/VEL/ zur subjektiven interferometrischen Messung bzw. mittels VELOMET 2 zur objektiven Meßwerterfassung.
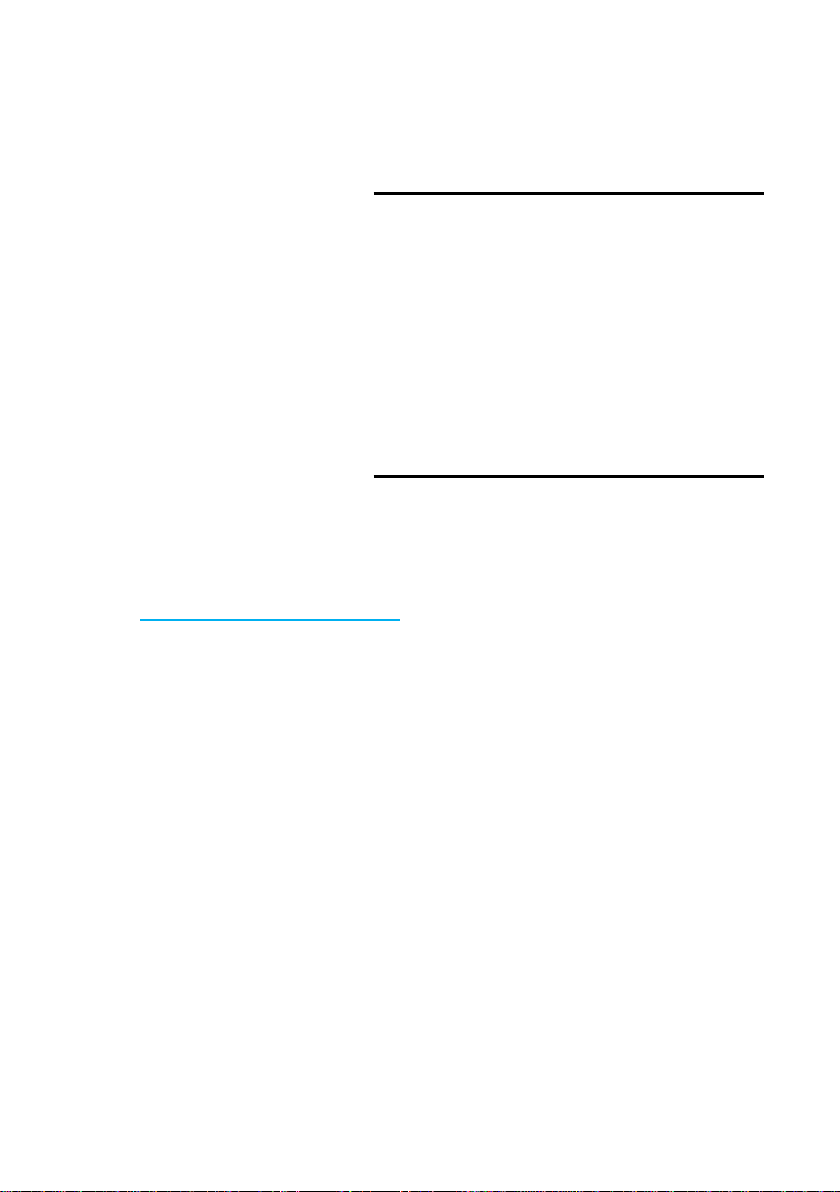
11
Meßbereich Auf- Reprodu- Symbol
lösung zierbar- für die
keit σ' Meßmethode
bis 5000 nm 0,5 nm ca. 3 nm /INT/
(mit Grob
phasenschie
ber bis 45λ) bis 0,5nm /VEL/
1.5. Photometrie
Ein Programm /PHOT/ gestattet einen hohen Auswerteservice
für photometrische Meßaufgaben über die Einrichtung VELOMET
2 an den unter Punkt 1.4. genannten Geräten.
Meßbereich Auf- Reprodu- Symbol
lösung zierbar- für die
keit σ' Meßmethode
1...100% 0,155 ca.0,1%
1)
bei entsprechender Kalibrierung und begrenzter Meßzeit
1)
/PHOT/
2. Die RETARMET 2-Konzeption
2.1. Gerätegestaltung
Das RETARMET 2, ein handliches Tischgerät, enthält Tastatur, Anzeige und als Kernstück ein Mikrorechnersystem sowie
die Hardware zur Signalaufbereitung. Verschiedene Eingänge
dienen dem Anschluß von Analogsignalquellen, wie optoelektronischer Geber, Temperaturgeber und photometrische Einrichtungen. Ein serielles Interface (wahlweise V24/RS-232-C
oder 20mA Stromschleife) dient der Ausgabe von Daten an einen Drucker bzw. zur weiteren Datenverarbeitung durch zentrale Rechner- und Steueranlagen.
Alle Anschlüsse sind in Steckerschächten im Gerät versenkt
angeordnet, so daß eine Aufstellfläche von 230 x 250 mm genügt.
2.2. Anzeigeeinheit
Das Display besteht aus einer Anzeigezeile von 16 alpha-
numerischen Einheiten.

12
Jede dieser 5 x 7 mm großen Leuchtflächen besitzt ein Raster aus 35 Leuchtpunkten, so daß neben Zahlenwerten auch
Buchstaben oder Symbole darstellbar sind.
2.3. Tastatur
Das Keyboard ist dem Anwendungszweck angepaßt.
Die Übersichtlichkeit wird durch Zusammenfassen von Tasten
gleichrangiger Bedeutung in Blöcke erleichtert. Bild 1
zeigt die Anordnung der Tasten.
Erläuterung zu ihrer Funktion:
/RESET/: Rücksetzen des Rechners im Havariefall
/CLEAR/: Löschtaste bei fehlerhafter Eingabe über die
/INIT/: Dient während der Rechnerprogrammierung zur
/OUT/: Dient zum Ausdruck einzelner, in der Anzeige
/0...9/: Tasten zur Eingabe von Zahlenwerten (Betriebs-
/ . /: Dient zur Kommasetzung bei o.g. Zahlwert-
(Schaffen des Ausgangszustandes, analog einer
Tastenbetätigung "Netz-ein").
Tasten /0...9/, zum vollständigen Löschen von
Meßreihen, Kalibrier-Meßreihen, der Speicher
SM 1 und SM 2 sowie von Klassierdaten.
Wahl der Druckerinitialisierung (s. 7.2.1.).
Im Meßbereich kann über diese Taste ein automatischer Ausdruckbetrieb (s. 7.3.1.2. b) ausgelöst bzw. abgebrochen werden.
dargestellter Meßergebnisse (s. 7.3.1.2. a).
parametern) während der Programmierungsphase
(s. 7.2.4.2.) bzw. im Meßbetrieb zur Eingabe
von Ergänzungsparametern (s. 7.3.1.2.).
Eingaben und während der Programmierung "Druckerinitialisierung" (s. 7.2.1.) zur Wahl der
Sonderfunktion "Grafik-Mode".
/ 2 /: Dient während der Programmierung zur Drucker-
initialisierung zur Wahl der Sonderfunktion
"Rechtsdruck von Histogrammen (s. 7.2.1.).

13
//: Diese "Enter"-Taste dient zur Rechnerübernah-
me, z.B. für Betriebsbedingungen (Abschnitt
7.2. ff), oder von Eingaben bzw. kalibrierten
Werten im Programmierteil).
/MM/: Dient im Programmierabschnitt 7.2.4.1. zur
/MV/: Dient bei der Meßmethode R:L zur Wahl einer
/λ/ST/: Dient im Programmierteil zur Festlegung auf
/OM/: Dient zur Wahl eines Operationsmodes für die
/TEMP/: Dient zur Temperaturanzeige während des Meßbe-
/S/S/: Für die Meßmethode /VEL/ dient diese Taste
/SM1/: Dient zum Abspeichern oder Abrufen der Ergeb-
Vorwahl einer Meßmethode bzw. im Meßbetrieb
zum Rücksprung in den Programmierteil, entspr.
7.3.
untergeordneten Meßvariante (s. 10.).
eine Meßwellenlänge bzw. zur Wahl einer, in
Arbeitsspeichern zugeordneten Betriebskonstanten bzw. Standards (7.2.4.2. ff.)
gewählte Meßmethode (s. 7.2.5.1.).
triebs für ein externes Thermoelement bei entsprechender Initialisierung (siehe Abschnitte
7.2.1. und 17.).
während des Meßbetriebs zum Starten und Stoppen des Modulatorschwingers (s. 15.1.) und bei
der Meßmethode R:L zum Umschalten der Geber
für die Gangunterschieds- und Längenmessung
(s. 13.2.1.).
nisse in dem übergeordneten Speicher SM 1
(7.2.5.2.).
/SM2/: Analog /SM1/, hier für den Speicher SM 2 (Ab-
/CE/: Dient zum Löschen einzelner Fehlmessungen in
/o/: Dient während der Programmierung zur Einlei-
schn. 7.2.5.2.).
Meßreihen oder Meßfolgen, vorausgesetzt der
Fehler wurde im Meßbetrieb unmittelbar erkannt.
tung von Kalibriervorgängen (Abschnitte
7.2.4.2.4., 7.2.4.2.5.) und im Meßbetrieb zum
"Null-setzen" des Geberstandes.

14
/MESS/: Diese Taste löst die Ergebnisberechnung, ent-
sprechend der gewählten Meßmethode und der Geberwerte aus, bzw. startet oder stopt den
Zeittakt im Operationsmode "dyn".
Weiterhin werden nachstehende Tastenfolgen (Tastenkombinationen) verwendet:
/RESET/,/7/: Diese Kombination bewirkt das Rücksetzen des
Rechners und löscht aber gleichzeitig sämtliche im RAM-Bereich gespeicherten Informationen!
Achtung !
Diese Tastenkombination sollte überlegt und nur in Ausnahmefällen angewendet werden, da hier der gesamte Datenerhalt, d.h. neben den Betriebsbedingungen auch alle Konstantenvorgaben für die einzelnen Meßmethoden gelöscht werden.
/RESET/,/8/: Diese Tastenfolge dient zum Testen der AD-
/RESET/,/9/: Diese Kombination dient zum Testen der fehler-
/RESET/,/./: Die Tastenfolge führt zur Anzeige des Datums
/SM1/,/OUT/: Mit dieser Tastenkombination kann der Inhalt
/SM2/,/0UT/: Analog zu /SMl/,/0UT/ zum Ausdruck des In-
/MM/,/OUT/: Diese Kombination führt zum Ausdruck der Be-
/MM/, 2x/0UT/:Diese Kombination ermöglicht den Druck eines
Wandlerabstimmung an den Signaleingängen (s.
19.2.4.).
freien Funktion der Tasten selbst (s.
19.2.3.).
für den letzten Batteriewechsel (s. 18.4.).
des Speichers SM 1 ausgedruckt werden (s.
7.3.1.2.).
halts in SM 2.
triebsbedingungen in einem Protokollkopf (s.
7.3.1.1.).
Protokoll- und Tabellenkopfes bei einem Einzelergebnisausdruck (s. 7.3.1.3.).
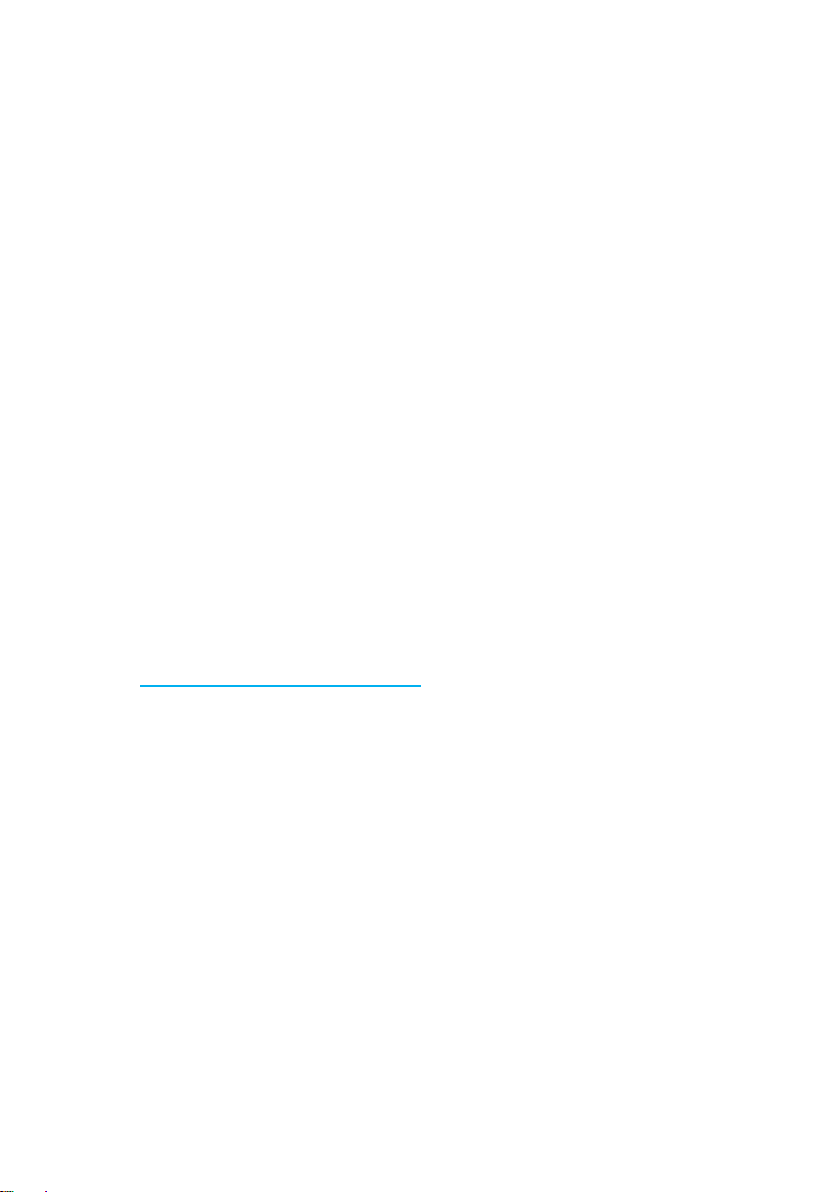
15
oder
//,/OUT/ : Die Tastenfolge ermöglicht den Ausdruck von
Histogrammen (s. 7.2.6.5.).
/MM/,/MV/ : Diese Kombination, angewandt im Msßbetrieb bei
/MM/,/o/ : Diese Tastenfolge löscht durchgeführte Kali-
/TEMP/, /INIT/: Dient zur Korrektur der Temperaturanzeige bei
/TEMP/,// : Führt im Meßbetrieb bei Einsatz eines Thermo-
/TEMP/,/0…9/: Beide Kombinationen führen zum Löschen o.g.
Raumtemperatur-Eingabe und zur Korrektur des
/TEMP/,/CLEAR/ Wertes durch erneutes Eingeben (s. 17.).
3. Bedienkomfort am RETARMET 2
den Meßmethoden /B-K/ oder /B-S/ führt unmittelbar zum Wechsel dieser beiden Arbeitsvarianten, ohne andere Betriebsparameter zu beeinflussen (s. 10.2.1. ).
brierungen für den Meßbetrieb (Anwendbar in
den Abschnitten 8.2.1., 9.2.1., 10.1., 11.1.
und 16.2. ).
Darstellung genauester Absolutwerte (s. 17.).
elements nach Abschnitt 17. zur Anzeige der
dafür notwendigen Raumtemperatur-Eingabe.
Ein erheblicher Teil der Rechnerkapazität wurde aufgewendet, um eine anwenderfreundliche Bedienung zu erreichen.
• Das Gerät arbeitet in einem einfachen Dialogbetrieb mit
dem Anwender.
Eine "Symbolsprache" macht den Bedienablauf verständlicher
und schnell beherrschbar.
Die dazu erforderlichen Kenntnisse sind in den Bedienregeln der Tabelle 2 zusammengefaßt.
Der Rechner steuert damit auch die für jeden Arbeitsschritt notwendigen und erwarteten Reaktionen des Anwenders.
• Weiterhin wurde der Programmierablauf für die verschiede-
nen Meßmethoden nach Abschnitt 1 weitestgehend identisch
gestaltet.
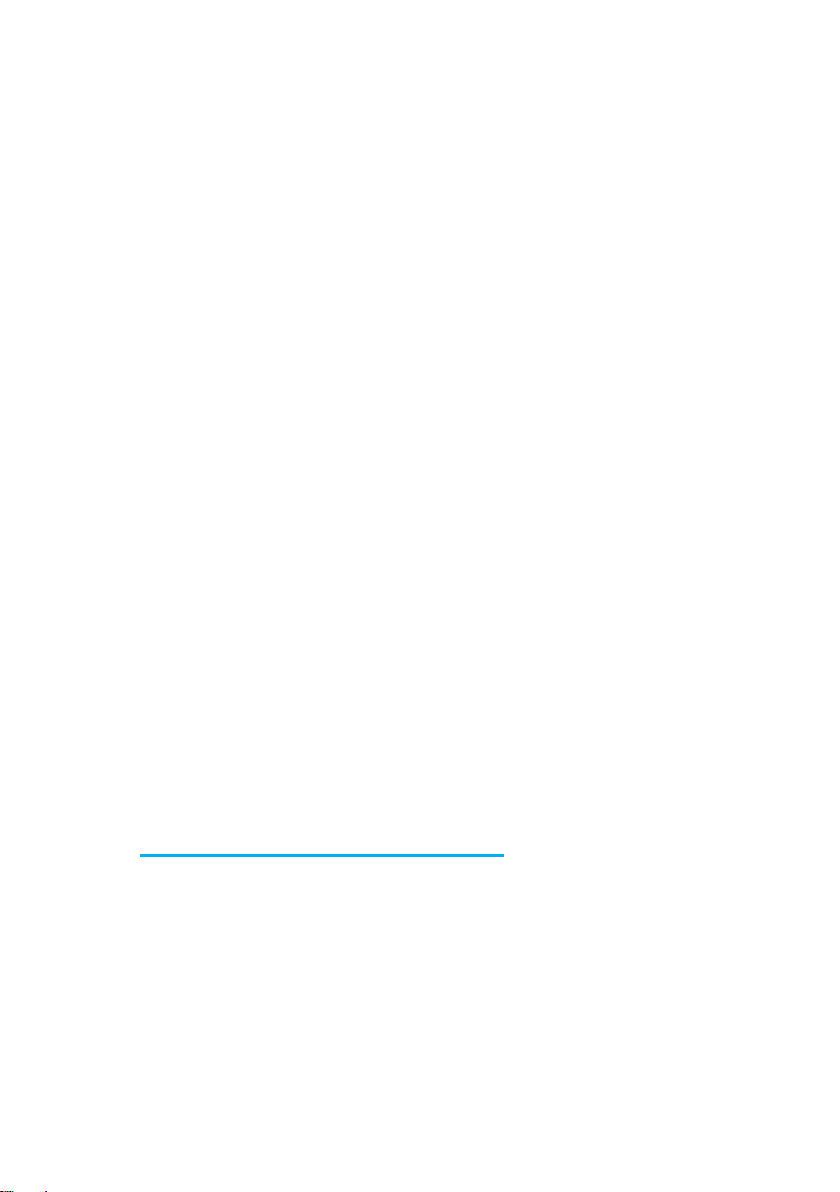
16
Das Kennenlernen des Programmierablaufes für eine Meßmethode genügt zum prinzipiellen Verständnis des Programmierweges auch für die anderen Methoden.
Dargestellt wird der Rahmenablauf zur Rechnerprogramnierung in Tabelle 1.
• Das RETARMET 2 verfügt über einen batteriegestützten RAM-
Bereich und ermöglicht damit einen Datenerhalt für alle
wesentlichen Betriebs- und Meßdaten.
Im Rechner werden folgende Informationen dauerhaft festgehalten:
1. Die Daten zur Druckerinitialisierung
2. Die Meßmethode, inclusive der Meßwellenlängen bzw. des
gewählten Arbeitsspeichers sowie dort enthaltene und
alle weiteren zusätzlichen Betriebsparameter, wie Kompensator-, Skalen-, Geräte- und Verfahrenskonstanten
und eingegebene Photometriestandardwerte
3. Zusatzinformationen, wie z.B. die Umgebungstemperatur-
eingabe, das Protokolldatum und die Objektcodierung
4. Die Klassierdaten, wie Klassierstart und Klassenbreite
5. Im Meßbetrieb, die Daten der übergeordneten Speicher SM
1 und SM 2 und die Ergebnisse im Klassierspeicher.
6. Das Datum des letzten Batteriewechsels
Der Datenerhalt ermöglicht so z.B. das Fortsetzen zeitaufwendiger Meßaufgaben, die über einen Arbeitstag hinausreichen, da sämtliche Betriebs- und Meßbedingungen
sowie die statistischen Daten der Meßreihen auch bei abgeschaltetem Gerät erhalten bleiben.
4. Hohe Bediensicherheit am RETARMET 2
Weitere Programmteile dienen dazu, Fehler im Programmierund Meßablauf zu erkennen bzw. auszuschließen.
• Mit jeder Inbetriebnahme über die Netztaste oder mit Be-
tätigung der Taste /RESET/ führt das Gerät selbständig
einen Eigentest des Rechners durch.
Sollten mährend des Tests die im Abschnitt 19.1. näher
beschriebenen Anzeigen auftreten, so liegt ein Gerätefehler vor. Das Gerät ist in diesem Fall, möglichst mit Abgabe des Fehlerbildes unserem Service vorzustellen.

17
• Durch eine rechnergesteuerte Tastenfreigabe sind nur die
für den einzelnen Programmabschnitt benötigten Tasten aktiviert, d.h. alle weiteren Tasten werden elektronisch
verriegelt.
• Die Übernahme von Betriebsparametern (z.B. Meßkonstanten)
wird vom Rechner verweigert, wenn diese außerhalb eines
für die Meßmethode sinnvollen Wertebereiches liegen.
• Jede Tastenbetätigung wird durch ein akustisches Signal
quittiert. Dies ist ein besonderer Vorteil für Blindbedienung der Tasten /o/ und /MESS/.
• Bei Inbetriebnahme wird durch ein gesondertes Anzeigebild
darauf hingewiesen, ob durch den Datenerhalt noch Ergebnisse in den übergeordneten Speichern vorhanden sind.
• Die Verrechnung falscher Informationen infolge unmittel-
bar zweimaliger Betätigung der Taste /MESS/ ist ausgeschlossen.
• Das Anzeigebild wird erst nach dem 3. Geberimpuls (oder
für Analogsignale bei einer Pegeldifferenz von 10 mV)
verändert, um das unbeabsichtigte Löschen einer Ergebnisanzeige durch Erschütterung oder versehentliches Berühren
der Geber zu vermeiden
• Unmittelbar erkannte, grobe Meßfehler ("Ausreißer") las-
sen sich innerhalb einer Meßreihe oder in einer Folge von
Einzelmessungen über die Taste /CE/ löschen, ohne das Gesamtergebnis (Mittelwertbildung, statistische Berechnung
oder Datenklassierung) zu beeinträchtigen.
Diese Aufzählung ist nicht vollständig; sie umfaßt lediglich die wichtigsten Maßnahmen für einen fehlerfreien Arbeitsablauf.
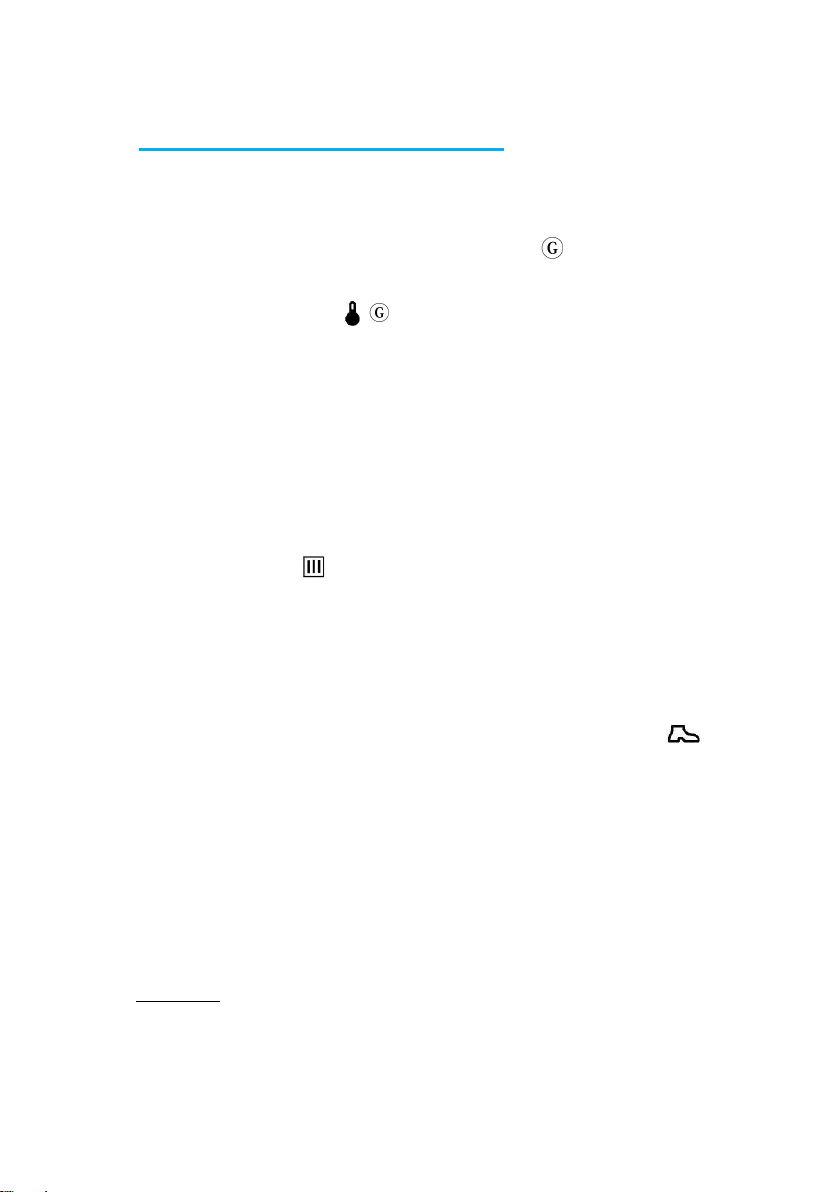
18
5. Anschlußmöglichkeiten am RETARMET 2
5.1. Elektrischer Anschluß (Bild 2)
Alle Kabelverbindungen erfolgen an der Geräterückseite.
Der Steckerschacht mit der Bezeichnung (1) dient zum
Anschluß diverser inkrementaler Geber (2).
Der Steckerschacht / L (3) daneben wird nur belegt:
a) zum Anschluß eines zweiten Gebers (zur Längenmessung)
für die im Abschnitt 13. beschriebene Meßmethode /R:L/
b) in Verbindung mit dem Heiz- und Kühltisch -20...+80 °C
zum Anschluß eines Thermoelements (4) über Adapterkabel (5).
Beim Anschluß der Steckverbinder weist die grüne Markie-
rung stets nach oben.
Die Entrieglung rechts und links am Steckverbinder ist zu
drücken.
Der Druckeranschlüß erfolgt über die BNC-Buchse (6) mit
der Bezeichnung
Der BNC-Stecker am Adapterkabel (7) ist dabei aufzuschie-
ben und die Überwurfmutter im Uhrzeigersinn bis zum Einrasten zu drehen.
Ein Fußschalter (8), der die Funktion der Taste /MESS/
übernimmt, erleichtert in bestimmten Anwendungsfällen eine gleichzeitig notwendige Mikroskopbedienung.
Er kann durch die gleiche Handhabung wie der BNC-Stecker
des Druckerkabels an die Buchse (9) mit dem Symbol
angeschlossen werden.
5.2. Mechanischer Anschluß der Geber (Bild 3)
Für den mechanischen Anschluß des Gebertyps IGR-M3 an den
Kompensator bzw. das Meßschraubenokular ist nachfolgendes
zu beachten:
- Abnehmen der Teilungstrommel vom Kompensator/Meßschrau-
benokular durch Lösen der Überwurfmutter (12) im Uhrzeigersinn.

19
- Achse des IGR—M3/250 verdrehen, so daß die Spreizfeder
(13) und der Schlitz (14) in der Drehachse des Kompensators/Meßschraubenokulars die gleiche Lage aufweisen, dabei zeigt der Lagesicherungsstift (15) und die Orientierungsnut (16) am Kompensator/Meßschraubenokular nach
oben.
- IGR-M3/250 ansetzen und die Überwurfmutter (12) entgegen
dem Uhrzeigersinn anziehen.
- Bei Schwergängigkeit des Getriebes ist der IGR-M3/25O
nochmals abzunehmen und die Spreizfeder (13) um 180° zu
drehen, danach wie oben beschrieben anzusetzen und zu arretieren.
6. Inbetriebnahme
Vor Inbetriebnahme des Gerätes sollte sich jeder Benutzer
davon überzeugen, ob sein Betriebsnetz (Spannung und Frequenz) den auf der Geräterückseite eingerahmten elektrischen Anschlußbedingungen entspricht!
Den landesspezifischen Gegebenheiten wird in der Regel ab
Werksauslieferung entsprochen. Sollten dennoch Abweichungen zwischen dem Betriebsnetz und den eingerahmten
elektrischen Daten vorhanden sein, ist über unseren Service eine Korrektur zu veranlassen.
Die Stromversorgung des RETARMET und aller weiteren, zur
Lösung der Meßaufgaben erforderlichen zusätzlichen (peripheren) Geräte, inclusive des Mikroskops selbst, muß von
einem Netzknotenpunkt aus, über entsprechend parallel geschaltete Anschlußdosen oder Verteiler, erfolgen.
Nach Netzanschluß des RETARMET ist der Netzschalter
/'O/(10, Bild 2) zu drücken. Die grüne Leuchtanzeige
/~/, links neben der Anzeigezeile ist ausgeschaltet. Das
Gerät durchläuft einen Geräteeigentest, gekennzeichnet
durch zwei aufeinanderfolgende Punktmuster auf allen alphanumerischen Anzeigesegmenten, gefolgt von einem Tonsignal bei Testende und dem Übergang zum ersten Anzeigebild.
(Eine Erläuterung von Fehleranzeigen im Falle von Be-
triebsstörungen erfolgt im Abschnitt 19.1.).

20
7. Programmierungen für den Meßbetrieb - notwendige Vereinbarungen mit dem Rechner über den Meßablauf
7.1. Vorbemerkungen
Durch den Datenerhalt des Gerätes erscheinen mit Inbe-
triebnahme in der Regel die Betriebsbedingungen (Vereinbarungen) zur vorangegangenen, letzten Meßaufgabe in Form
von Anzeigebildern.
Um die Vielfalt der Meß- und Betriebsbedingungen darstel-
len zu können, ist eine Reihe aufeinanderfolgender Anzeigen (kurz: Memory-Anzeigen genannt) notwendig.
Allgemein ist die Reihenfolge dieser Memory-Anzeigen für
alle Meßmethoden gleich gestaltet.
Deren Bedeutung und Abfolge ist in Tabelle 1 zusammenge-
faßt. Gemeinsam mit der Zusammenfassung von Bedienregeln
aus Tabelle 2 dient Tabelle 1 zum Verständnis des Dialogs
zwischen Benutzer und Rechner und damit als Leitfaden zum
Programmieren.
Entsprechen die ausgewiesenen Meß- und Betriebsbedingun-
gen der zu lösenden Meßaufgabe, erfolgt durch Tastendruck
// deren Bestätigung, und der Rechner wechselt automatisch zum nächsten Memory-Anzeigebild über.
Sind Änderungen der angezeigten Bedingungen erforderlich,
dienen die in Tabelle 1 rechts beschriebenen Tasten oder
Tastenfolgen dazu.
So werden zum Beispiel im ersten Memory-Bild auf mehrfa-
chen Tastendruck /INIT/ die verschiedenen Varianten zum
Druckerbetrieb nacheinander angezeigt.
Das Blinken der Symbole weist darauf hin, daß die ange-
zeigten Betriebsbedingungen noch nicht vom Rechner übernommen sind. Auch hier wird abschließend mit Taste //
eine dieser Möglichkeiten für den Druckerbetrieb ausgewählt und damit dem Rechner vorgeschrieben.
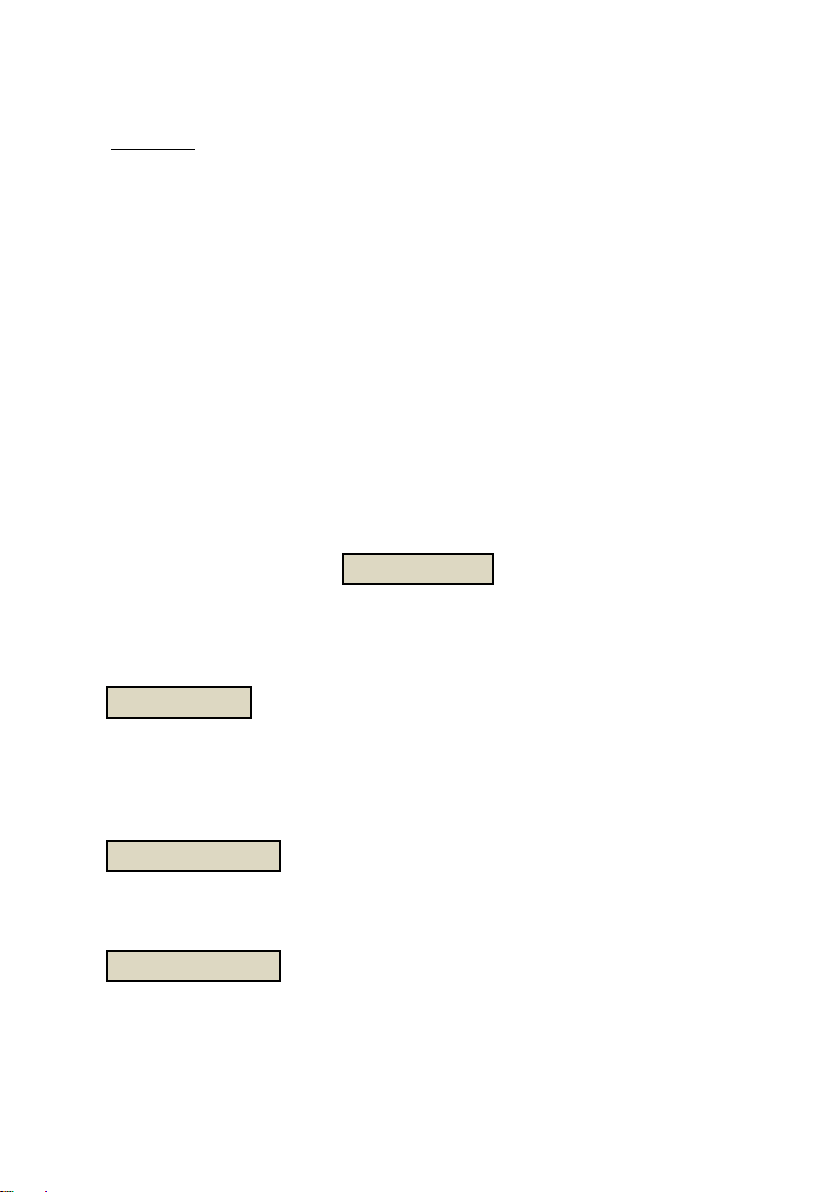
21
print XX
print INIT
Print off line
Print -
Hinweis:
Die in den Tabellen und den nachfolgenden Abschnitten
eingerahmten Bilder stellen Anzeigevarianten dar.
Neben der Darstellung und Erläuterung konkreter Symbole,
die das RETARMET-Programm enthält, werden in dieser Anleitung auch für zusammenfassende Darstellungen Symbole
mit folgender Bedeutung verwendet:
Großbuchstaben, wie XXX, YYY
... kennzeichnen Zahlenwerte oder Symbole, die im RETARMET
fest einprogrammiert, d.h. vom Gerät vorgegeben sind.
Kleinbuchstaben, wie xxx, yyy, zzz ...
... kennzeichnen vom Benutzer selbst bestimmbare bzw. von
ihm eingebbare Daten (Zahlenwerte).
7.2. Erläuterung zu den einzelnen Memory-Anzeigen
7.2.1. Abfrage der Druckerinitialisierung
Anzeigebild:
Die dazu gehörenden Anzeigebilder können auf mehrfachen
Tastendruck /INIT/ aufgerufen und mit Tastendruck // ausgewählt werden.
Sollte stattdessen die Anzeige
(blinkend)
erscheinen, ist dies die direkte Aufforderung zur Tastenbetätigung /INIT/.
Für den Druckerbetrieb sind nachfolgende, in der Anzeige
rechts dargestellte Varianten wählbar:
: Interface ist inaktiviert. Der
: Druckeranschluß ist aktiv. Der Druck
von Zusatzparametern ist nicht vorge-
Druckeranschluß ist nicht vorgesehen.
(Bei dieser Variante entfallen einige
nachfolgende Abfragen: Sie werden vom
Rechner automatisch übersprungen).
sehen.
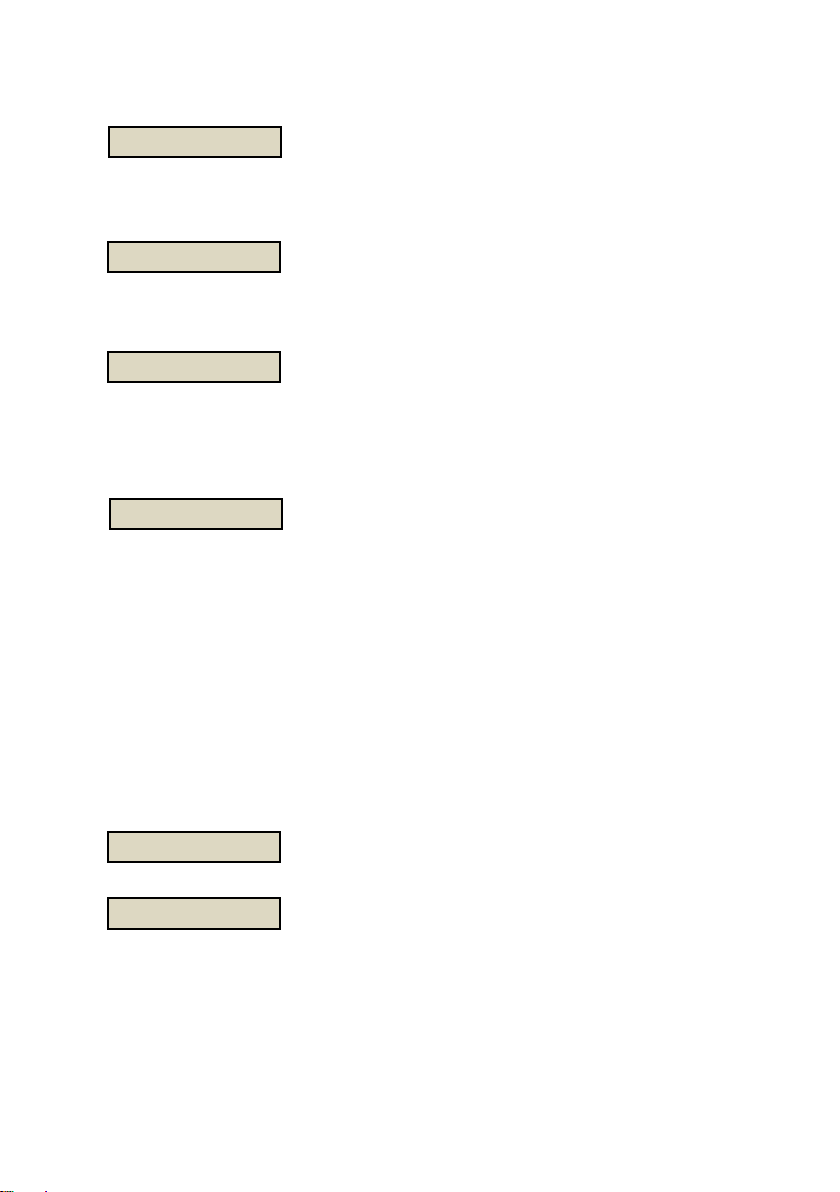
22
Print temp/°C
Print time/h
Print t/°C t/h
Pr-gr XX
Print r XX
Pr-gr r XX
oder
: Druckeranschluß ist aktiv. Als Zu-
satzparameter kann der Temperaturwert
eines Thermoelements zusammen mit den
Meßergebnissen automatisch ausgedruckt
werden.
: Druckeranschluß ist aktiv. Als Zu satzparameter kann die fortlaufende
: Druckeranschluß ist aktiv. Beide o.g.
Parameter können zusammen mit den Meß-
Eine spezielle Vereinbarung enthält die Anzeigevariante:
: Zur Darstellung der Meßwertklassierung
in Form eines Säulendiagramms (Näheres
Meßzeit mit Beginn der ersten Messung
zusammen mit den Meßergebnissen automatisch ausgedruckt werden.
ergebnissen automatisch ausgedruckt wer
den.
am Beispiel im Abschnitt 7.2.6.5.) kann
ein vom RETARMET gesteuerter Grafikdruck mit einem Befehlscode ESC-K (s.
20.1.3.) aktiviert werden. Im o.g. Anzeigebild wird dieser Mode auf Tastendruck /./, d.h. mit Erscheinen des
Kürzels "gr" gewählt oder gelöscht. Für
Drucker ohne entspr. Befehlscode wird
das Druckzeichen "m" mit zeichenbreiter
Auflösung zur Histogrammdarstellung benutzt. Das Symbol "gr" für den speziellen Grafikmode muß dabei aus der PrintAnzeige gelöscht sein.
: Unter der Voraussetzung, daß eine Meß-
wertklassierung mit Histogramm erfolgt
und daß dazu ein 80 Zeichen-Drucker
verwendet wird, besteht die Möglichkeit,den Histogrammdruck rechts neben
der Wertetabelle wiederzugeben.
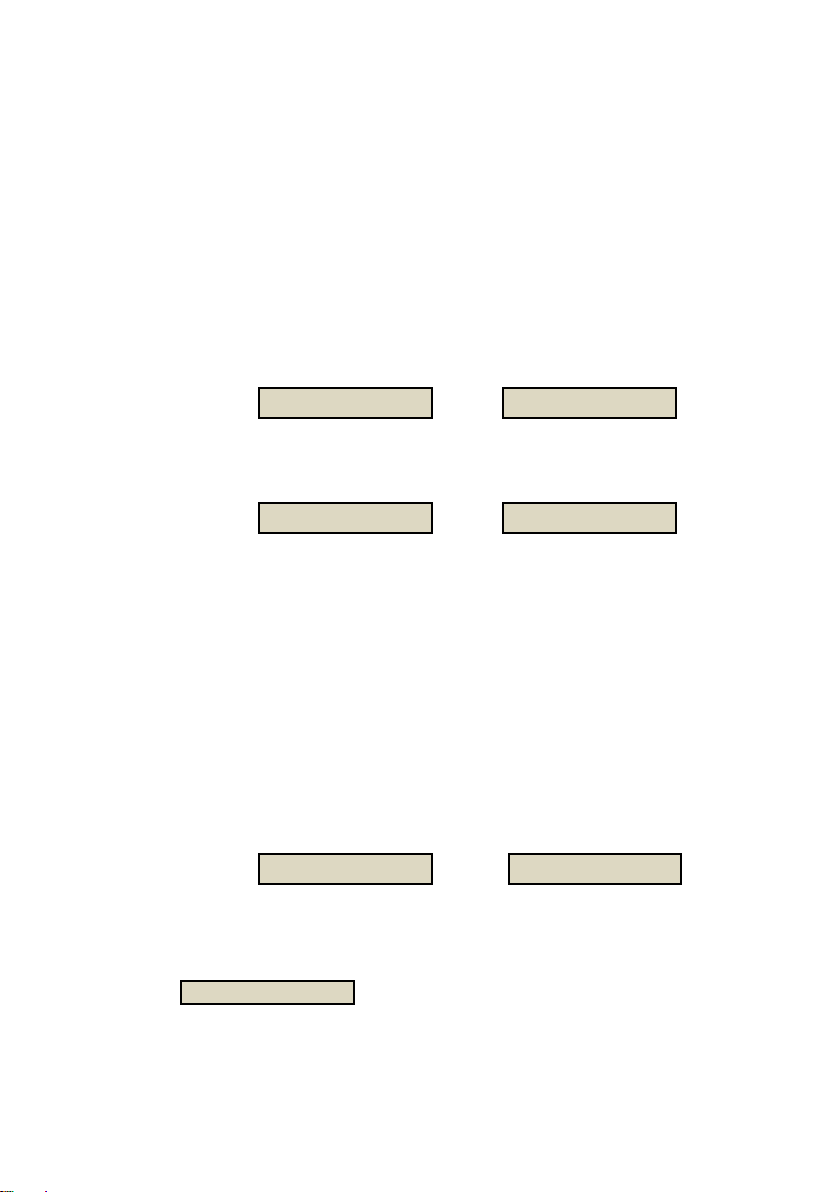
23
Date --.--.----
temp.u xx.x °C
temp.u --.- °C
Date xx.xx.xxxx
Print t/°C t/h
Print temp/°C
Print off line
Die Vorwahl (und auch die Zurücknahme)
des Rechtsdrucks für Histogramme erfolgt auf Tastendruck /2/ im neben-
stehenden Anzeigebild durch Erscheinen
des Symbols "r".
Achtung !
Der Rücktransport des Druckerpapiers
zum Anfang der Wertetabelle muß jedoch
vor jedem Histogrammdruck manuell erfolgen.
7.2.2. Abfrage der Umgebungstemperatur
Anzeigebild: bzw.
Anmerkung:
Diese Anzeige erfolgt nur mit Wahl der Druckervarianten
und .
Abgefragt wird mit dieser Anzeige die für Messungen mit
Thermoelementen notwendige Vorgabe einer Bezugstemperatur,
welche im allgemeinen der Raumtemperatur entspricht.
Über Temperaturmessungen mit dem RETARMET und über die Arbeitsweise mit Thermoelementen informieren gesondert die
Abschnitte 17. und 20.3.
. Die Übernahme einer noch aktuellen Anzeige erfolgt mit
Tastendruck //.
. Neueingaben und Korrekturen bestehender Anzeigen ge-
schehen über die Tastenfolge /0...9/,//
7.2.3. Abfrage zur Datumangabe
Anzeigebild: bzw.
Anmerkung:
Dieses Memory-Bild ist vorgesehen, wenn für Meßprotokolle,
ein Vermerk des Erstellungsdatums notwendig wird. Diese Abfrage wird automatisch übersprungen mit Wahl der Druckervariante , d.h. wenn kein Druck von Meßprotokollen vorgesehen ist.
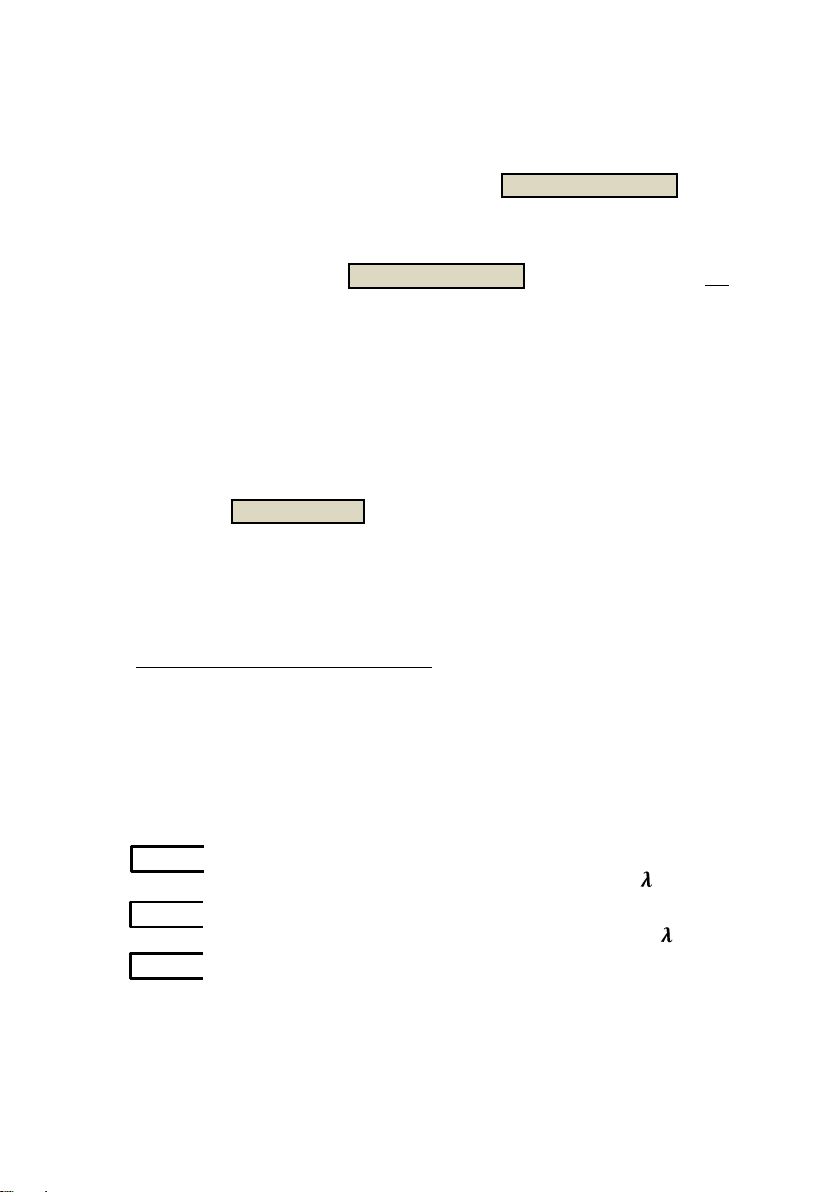
24
Date --.--.----
Date --.--.----
MM
Ist eine bestehende Datumangabe noch aktuell, kann sie
durch Tastendruck // übernommen werden.
Für eine Neueingabe im Anzeigebild oder
für die Abänderung des Datums (überschreiben) wird die
Tastenfolge /0...9/,// angewendet.
Ist keine Datumangabe auf dem Protokoll erforderlich, ge-
nügt im Anzeigebild die Taste // oder
/CLEAR/. Bei bereits vorhandenen Angaben ist zuvor mit
separatem Tastendruck /CLEAR/ die Eingabe zu löschen.
Die Eingabe des Datums kann in beliebiger Schreibweise
erfolgen (so z.B. 12.10.1986 oder 86.10.12).
7.2.4. Abfrage zur Meßmethode und den zugehörigen Parametern
7.2.4.1. Wahl der Meßmethode
Die Meßmethode wird stets links im Anzeigebild dargestellt.
Die Anzeige (blinkend)
erscheint, wenn dem Rechner noch keine Meßmethode vorgege-
ben wurde. (Erstinbetriebnahme, Löschen oder Verlust des
Datenerhalts). Diese Anzeige weist direkt auf die Tastenbe-
tätigung /MM/ hin, um eine der nachfolgenden Meßmethoden
auszuwählen.
Die Übernahme der Meßmethode, inclusive aller in der An-
zeige ausgewiesenen Parameter, erfolgt auf Tastendruck //.
Ein Wechsel der Meßmethoden wird in dieser Anzeige auf
mehrmaligen Tastendruck /MM/ und anschließender Rechnerübernahme durch Taste // erreicht.
Für die einzelnen Meßmethoden werden folgende Kürzel verwendet:
• E6 : Polarisationsoptische Kompensations-
methode nach EHRINGHAUS 0...6 .
• E130 : Polarisationsoptische Konpensations-
methode nach EHRINGHAUS 0...130 .
• SEN : Polarisationsoptische Kompensations-
methode nach DE SENARMONT (anwendbar
am JENAPOL b zusammen mit dem Digi talanalysator)
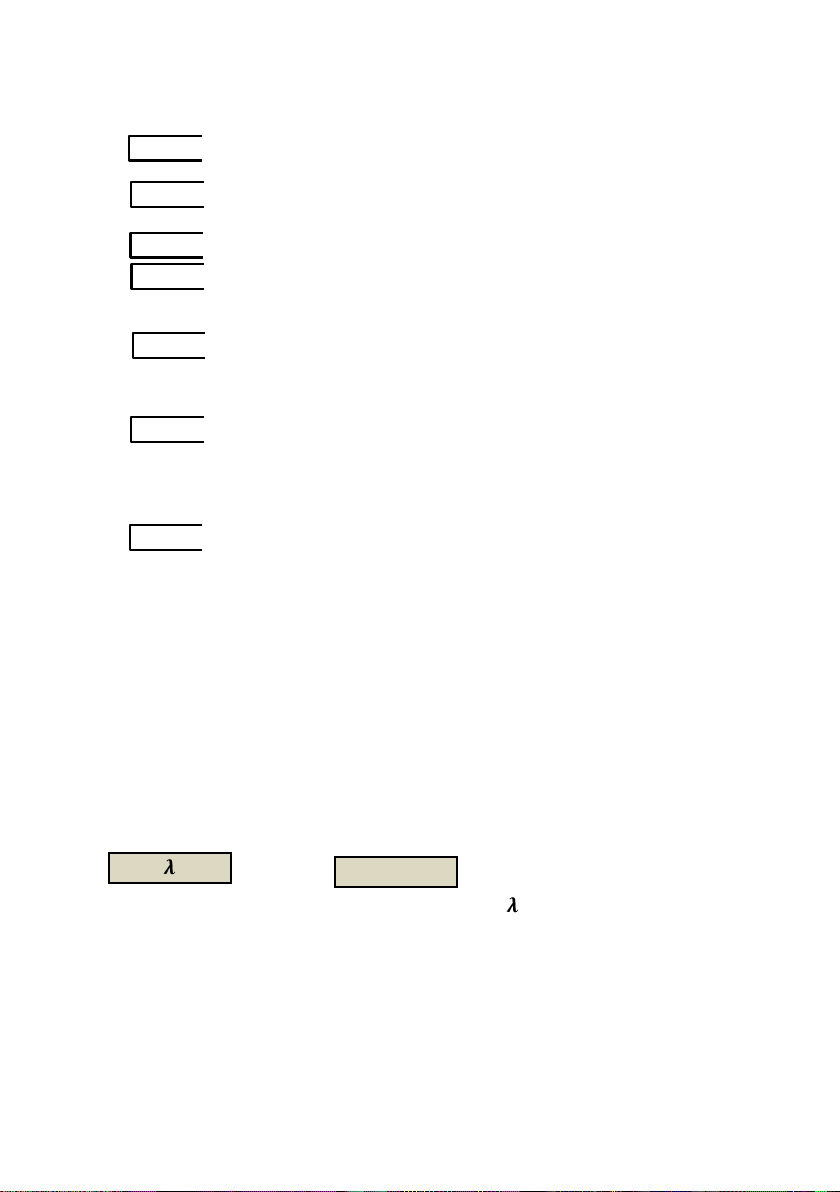
25
. . . ST
. . .
• B-K : Polarisationsoptische Kompensationsme-
thode nach BRACE-KÖHLER
• B-S : Polarisationsoptische Kompensationsme-
• L : Längenmessprogramm
• R:L : Programm zur Bestimmung der Doppel-
brechung (Kombination von Kompensa-
• INT : Messprogramm zur subjektiven Bestim-
• VEL : Messprogramm zur objektivierten Be-
stimmung interferometrischer Gangun-
• PHOT : Messprogramm zur Bestimmung photome-
thode nach BEAR-SCHMITT
tions- und Längenmessprogrammen).
mung interferometrischer Gangunterschiede (für die Geräte JENAPOL-,
JENAVAL-, JENAVERT interphako)
terschiede an o.g. Geräten unter Verwendung des Kompensationsindikators
VELOMET 2
trischer Messwerte mittels VELOMET 2
oder anderer Routinephotometer.
7.2.4.2. Wahl der Zusatzparameter
Mit Festlegung der Meßmethode werden in der gleichen Anzeige weitere, für diese Meßmethode notwendige Parameter abgefragt. Diese Vorgaben stehen stets in der Mitte und ggf.
rechts in diesem Memory-Bild.
• Sind noch keine Parameter dem Rechner vorgegeben, fordert
er mit den Anzeigen
bzw. (blinkend)
dazu auf über die Tastenbetätigung / /ST/ eine Vorwahl
zu treffen.
Entsprechend Ihrer Entscheidung für eine der o.g. Meßmethoden lesen Sie nachfolgend den zutreffenden Unterabschnitt.
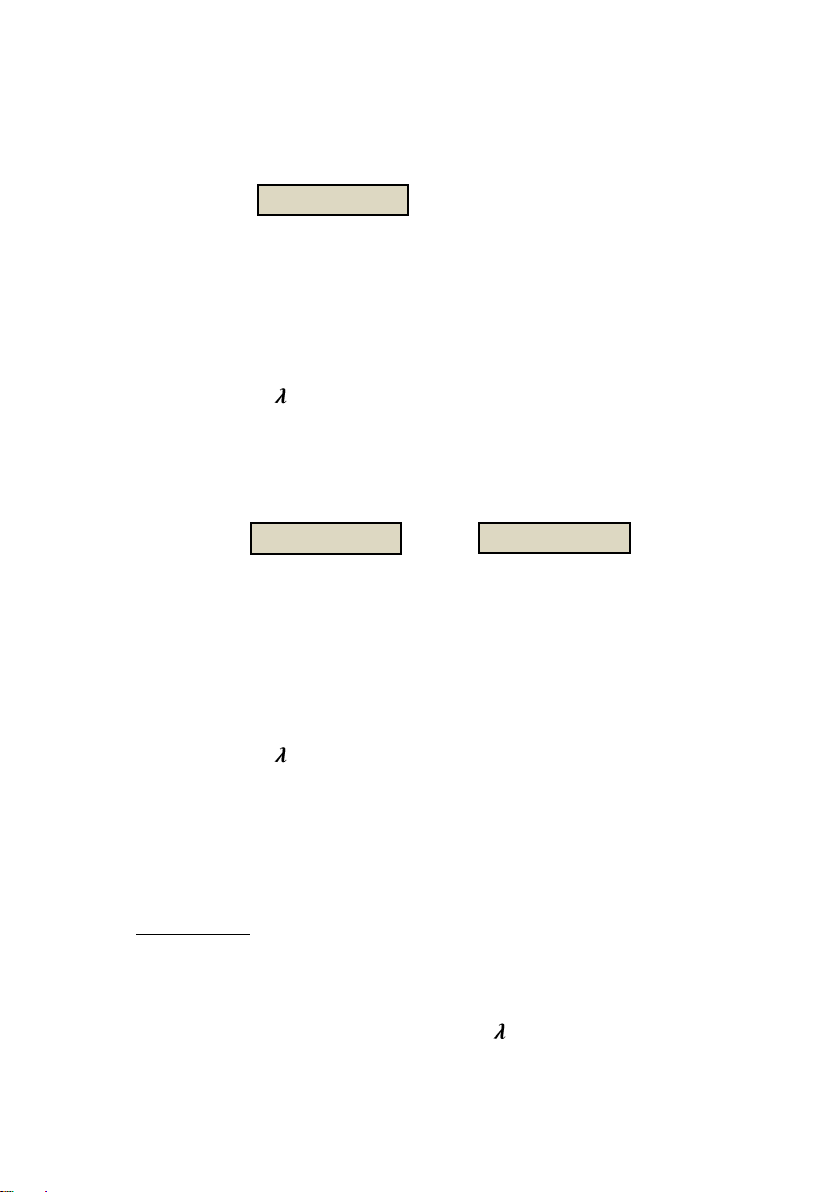
26
. . . XXX.X
SEN ---.-
SEN xxx.x
7.2.4.2.1. Meßwellenlänge für die Meßmethoden
/E6/ , /EJ3O/ und /R:L/ (Programmteil R)
Anzeigebild:
Für "XXX.X" stehen vier fest gespeicherte StandardMeßwellenlängen zur Wahl: 486,1 nm (F); 546,1 nm (e); 589,3
nm (D), 656,3 nm (C)
• Die Übernahme einer angezeigten Wellenlänge erfolgt, ge-
meinsam mit der ausgewiesenen Meßmethode, durch den Tastendruck //.
• Ein Wechsel der Meßwellenlänge erfolgt auf mehrmaligem
Tastendruck / /ST/, gefolgt von //.
7.2.4.2.2. Meßwellenlänge, incl. einer frei wählbaren für die
Anzeigebild: bzw.
Neben den vier, bereits unter 7.2.4.2.1. genannten, fest
programmierten Standard-Wellenlängen besitzt o.g. Meßmethode die Möglichkeit, eine weitere, frei wählbare Meßwellenlänge einzugeben .
• Die Übernahme der angezeigten Wellenlänge erfolgt, ge-
meinsam mit der Meßmethode, durch Tastendruck //.
• Der Wechsel der Wellenlängen erfolgt durch mehrfachen
Tastendruck / /ST/ mit anschließender Rechnerübernahme
durch //. Eine bereits vorgenommene Eingabe für die frei
wählbare Wellenlänge bleibt gespeichert.
Sie wird im Anzeigezyklus für die zur Wahl stehenden Wel-
lenlängen als fünfte ausgewiesen.
• Die Neueinqabe oder die Änderung der frei wählbaren
Wellenlänge erfolgt durch die Tastenfolge /0...9/,//.
• Das Löschen der frei wählbaren Wellenlänge erfolgt bei
ihrer Anzeige auf Tastendruck /CLEAR/.
Durch anschließenden Tastendruck / /ST/ ist eine andere
Wellenlänge auszuwählen und mit // zu übernehmen.
Meßmethoden /SEN/ und /R:L/ (Programmteil R ≙ SEN)
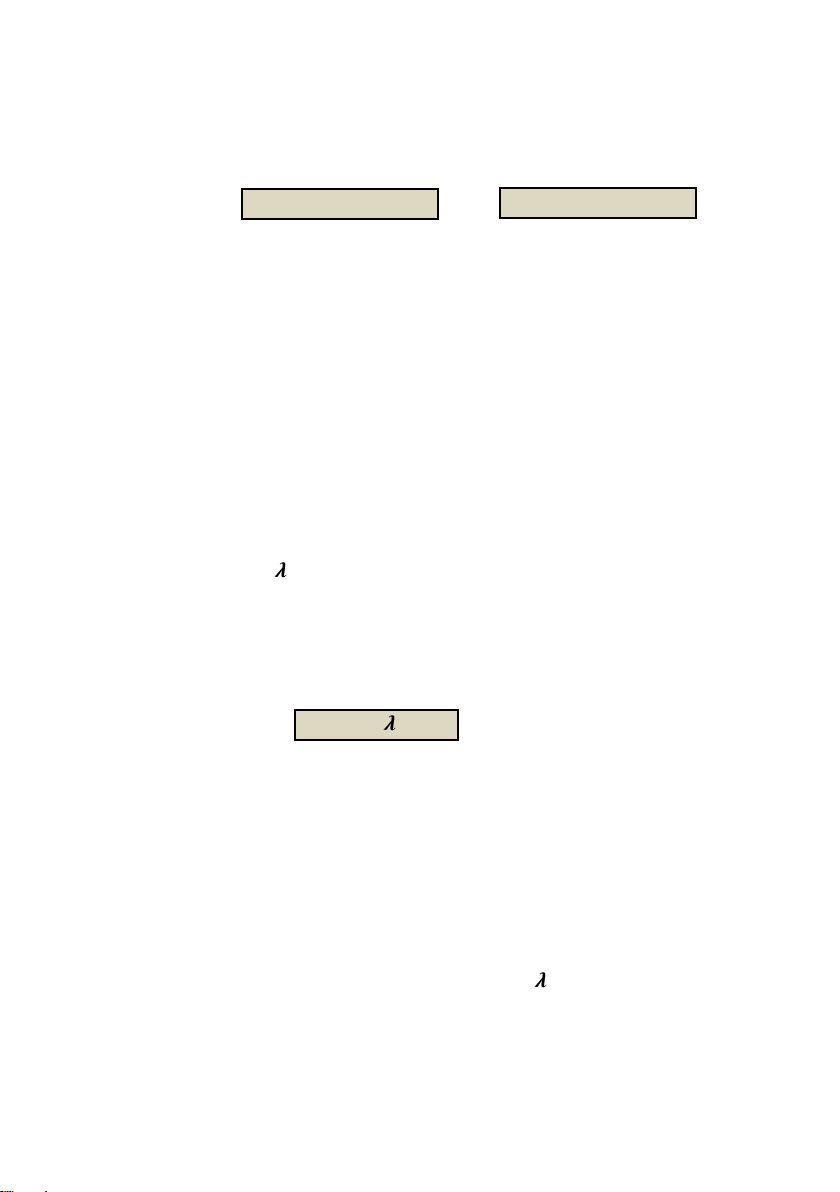
27
. . . XXX.X yy.y nm
. . . XXX.X --.- nm
. . . /
7.2.4.2.3. Meßwellenlänge und Kompensatorkonstante für
die Meßmethoden /B-K/ und /B-S/
Anzeigebild: bzw.
Zu den im Gerät gespeicherten Standard-Wellenlängen
"XXX.X", mit 486,1 nm (F), 546,1 nm (e), 589,3 nm (D) und
656,3 nm (C) -Anzeigemitte- ist bei diesen Meßmethoden die
Eingabe einer Kompensatorkonstanten (sie ist meßbereichsund ggf. wellenlängenabhängig), entsprechend dem vom Werk
mitgelieferten Kompensator-Prüfschein erforderlich.
Diese in der Anzeige rechts dargestellte Eingabe erfolgt in
Nanometern (nm).
Die Übernahme dieser kompletten Memory-Anzeige, d.h.
der Meßmethode plus Meßwellenlänge und zugehöriger
Konstante erfolgt auf Tastendruck //.
Der Wechsel der Meßwellenlänge, inclusive der Konstanten
erfolgt innerhalb dieses Anzeigebildes auf mehrfachen
Tastendruck / /ST/, gefolgt von //.
Eine Neueingabe oder eine Korrektur der Eingabe für die
Konstante ermöglicht die Tastenfolge /0...9/, //.
Mit Abschluß dieser Eingabe (d.h. auf //) erscheint das
Anzeigebild
(blinkend)
Diese Anzeige fordert auf, darüber zu entscheiden, ob die
Messungen mit einer Meßwellenlänge durchgeführt werden
können, oder ob ein häufiger Wechsel der Wellenlänge während des Meßbetriebs zu erwarten ist (z.B. für Messungen
der Dispersion des Gangunterschieds).
Falls für die Messungen nur eine Wellenlänge verwendet
wird, sollte unmittelbar zur nächsten Memory-Anzeige
durch erneuten Tastendruck // übergegangen werden.
Falls die Meßwellenlängen aber häufig zu wechseln
sind,ist es ratsam durch Tastendruck / /ST/ die nächste
Wellenlängenangabe aufzurufen, um für diese ebenfalls die
Eingabe der Kompensatorkonstante durchzuführen.
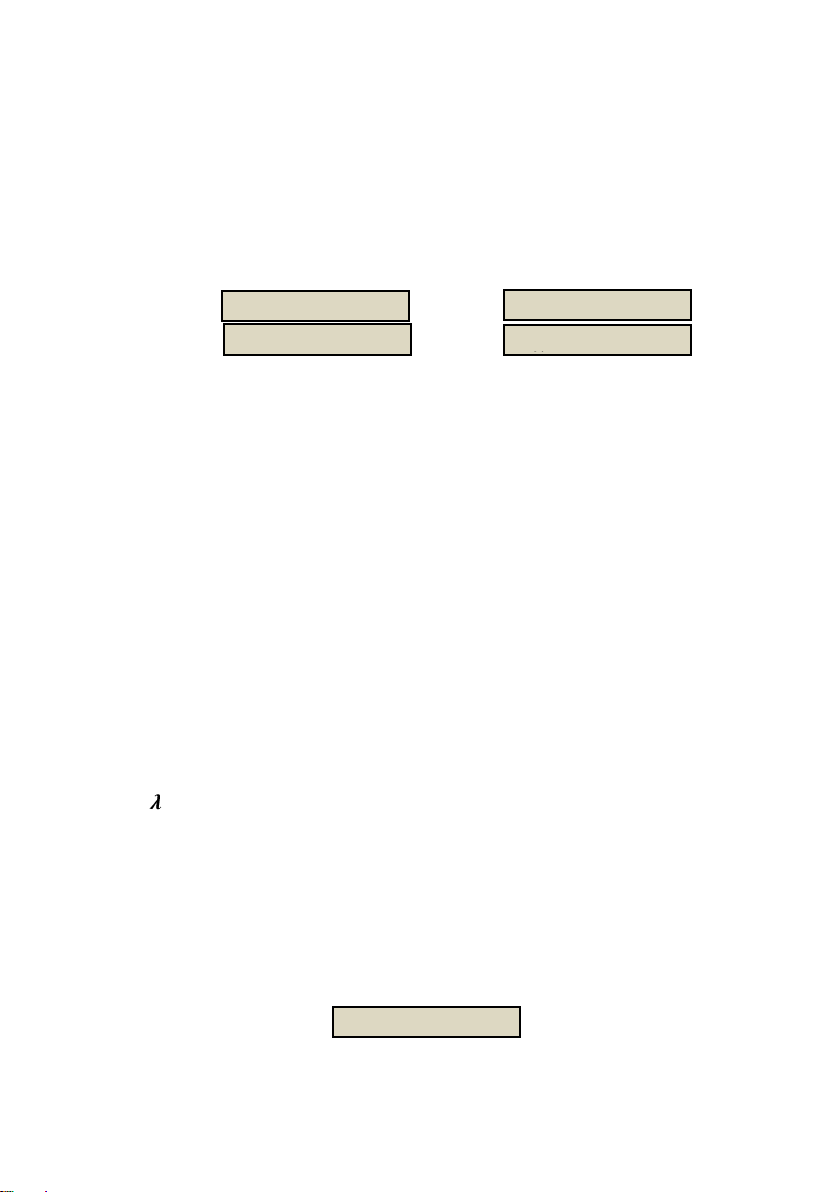
28
... ST X y.yyy
PHOT ST X yy.y%
... ST X -.---
PHOT ST X ---
... MD ----- µm
Erst nachdem alle vier Standard-Wellenlängen mit ihren
Konstanten komplettiert sind, wird dann mit Taste // zum
nächsten Memory-Bild übergegangen.
7.2.4.2.4. Skalenkonstante bzw. Photometrie-Standards für die
Anzeigebilder:
/L/,/R:L bzw.
/PHOT/ bzw.
Die Messung lateraler Größen (Längenmessung) im Zwischenbild des Mikroskops setzt für unterschiedliche Objektivvergrößerungen die Bestimmung mehrerer Skalenkonstanten voraus.
Um bei verschiedenen Vergrößerungen unmittelbar messen zu
können, stehen maximal vier Arbeitsspeicher "ST X" (X von 1
bis 4, Anzeigemitte) zur Belegung mit unterschiedlichen
Skalenkonstanten y.yyy (in der Anzeige rechts) zur Verfügung.
Gleichermaßen können für die Meßmethode /PHOT/ die Arbeitsspeicher 1 bis 4 verwendet werden, um Werte unterschiedlicher Standards oder verschiedene Kalibrierwerte eines Standards bei vier Meßwellenlängen zu speichern.
Die Übernahme des kompletten Anzeigeinhalts, d.h. der
Meßmethode des ausgewiesenen Arbeitsspeichers und der
darin enthaltenen Angabe erfolgt auf Tastendruck //.
Der Wechsel des Arbeitsspeichers, inclusive des darin
enthaltenen Wertes erfolgt durch die Tastenfolge
/ /ST/,//.
Neueingaben (im Anzeigebild oben rechts) bzw. Änderungen
von Standardwerten oder von Skalenkonstanten, die bereits
durch eine zurückliegende Bestimmung bekannt sind, erfolgt in dem vorgewählten Arbeitsspeicher durch die Tas-
tenfolge /0...9/ , //.
Zur Bestimmung unbekannter Skalenkonstanten wird auf Tas-
tendruck /o/ ein Kalibriervorgang mit dem Wechsel zur Anzeige
Meßmethoden /L/,/R:L/ (Programmteil L) und /PHOT/
eingeleitet.

29
... ST/
... xxx,x y.yyy
... xxx.x .---
(Der weitere Ablauf des Kalibriervorganges ist im Abschnitt 12.1. ausführlich beschrieben).
Mit dem Abschluß der Neueingabe, Änderung oder Kalibrierung
folgt die Anzeige
(blinkend)
- Auf erneuten Tastendruck // kann so unmittelbar zum
nächsten Memory-Bild übergegangen werden.
• Der Tastendruck / /ST/ ermöglicht es, weitere Arbeits-
speicher mit Daten zu belegen, bevor abschließend durch
// das nächste Memory-Bild ausgewiesen wird.
Für Längenmessungen bedeutet es konkret zu entscheiden,
ob routinemäßig bei einer Vergrößerung gleichartige Objekte vermessen werden, dann ist die Vorgabe einer Skalenkonstanten ausreichend (Taste //),oder ob ein Wechsel
der Vergrößerungen zur Anpassung an verschiedenartigste
Objekte notwendig ist (Taste / /ST/).
Gleiches betrifft auch die Photometrie.
Auch hier ist abzuwägen zwischen Messungen bei einer Wel-
lenlänge (Taste //) oder spektralen Untersuchungen bei
aufeinanderfolgendem Wechsel mehrerer Wellenlängen (Taste
//ST/).
7.2.4.2.5. Gerätekonstante für die Meßmethoden
Anzeigebild: bzw.
Bei interferometrischen Untersuchungen ist für genaue Messungen die Bestimmung gerätespezifischer Konstanten y.yyyAnzeige rechts unumgänglich.
Die Dispersion des verwendeten Glases für den Phasenschieber im Interferometer verursacht eine Abhängigkeit der Konstante von der Meßwellenlänge xxx.x. Dies bedeutet, daß für
jede Meßwellenlänge eine unterschiedliche Konstante angewendet werden muß. Neben der im Gerät fest gespeicherten
Standard-Wellenlängen 486,1 nm (F), 546,1 nm (e), 589,3 nm
(D) und 656,3 nm (C) kann eine Meßwellenlänge nach eigener
Wahl verwendet werden.
/INT/ nach /VEL/

30
... MD -
... /
• Die Übernahme des gesamten Anzeigeinhalts, d.h. der Meß-
methode, der Meßwellenlänge und der zugehörigen Konstanten erfolgt auf Tastendruck //.
• Der Wechsel der Wellenlängen, inclusive der zugeordneten
Konstanten erfolgt innerhalb dieses Anzeigebildes auf
wiederholten Tastendruck / /ST/, gefolgt von //.
Die frei wählbare Wellenlänge ist als 5. Angabe dem An-
zeigezyklus F, e, D, C nach "C" angegliedert und wird
durch den Datenerhalt gespeichert.
• Die Neueingabe der frei wählbaren Wellenlänge erfolgt im
Anzeigebild oben rechts durch die Tastenfolge /0...9/,//.
• Zur Änderung der frei wählbaren Wellenlänge ist die bis-
herige Angabe durch Taste /CLEAR/ zu löschen. Voraussetzung ist jedoch(daß keine Gerätekonstante angezeigt wird.
Ist eine Konstantenangabe vorhanden, wird die Taste
/CLEAR/ zweimal hintereinander gedrückt.
Die Neueingabe erfolgt durch /0...9/,//.
• Die Neueingabe (im Anzeigebild oben Mitte) bzw. Änderung
von Gerätekonstanten, die bereits durch eine zurückliegende Bestimmung bekannt sind, erfolgt für die ausgewählte Meßwellenlänge durch die Tastenfolge
/0...9/,//.
• Zur Bestimmung unbekannter Gerätekonstanten wird auf Tas-
eingeleitet.
Der weitere Ablauf des Kalibriervorgangs ist im Abschnitt
• Mit dem Abschluß der Neueingabe, Änderung oder Kalibrie-
Diese Anzeige fordert zur Entscheidung auf, entweder mit
tendruck /o/ in diesem Anzeigebild ein Kalibriervorgang
mit dem Wechsel zur Anzeige
14.2. ausführlich beschrieben.
rung einer Gerätekonstanten folgt die Anzeige
(blinkend)
erneutem Tastendruck // unmittelbar zum nächsten MemoryBild überzugehen oder auf Tastendruck / /ST/ für weitere
Meßwellenlängen die Gerätekonstanten zu bestimmen bzw.
einzugeben, falls bekannt.

31
1
1
n
j
j
xx
n
2
1
1
()
1
n
j
j
s x x
n
ts
n
... OM
... dyn xx s
... x
... s/
x
... σ'/
x
Die Entscheidung ist davon abhängig, ob die Brechzahlbestimmung des Meßobjekts bei einer Wellenlänge genügt
(Taste //), oder ob die Dispersion des zu untersuchenden
Materials und damit der ständige Wechsel der Wellenlängen
von Interesse ist - Taste / /ST/ -.
7.2.5. Abfrage zur Auswertung der Meßergebnisse
Je nachdem, welchen Zweck die Messungen verfolgen, wird mit
diesem Memory-Bild - Anzeigemitte - eine bestimmte Arbeitsweise (hier Operationsmode genannt) festgelegt. Die Wahl
einer der angebotenen Varianten bestimmt auch wesentlich
die vom Rechner durchgeführte statistische Bearbeitung
(Auswertung) der Meßergebnisse.
Ggf. bei der ersten Inbetriebnahme, aber generell mit jeder
neuen Wahl einer Meßmethode ,fordert der Rechner mit der
Anzeige ( im Blinkmode) auf, durch Tastenbetätigung /OM/
einen "Arbeitsmodus" für den Meßbetrieb festzulegen.
7.2.5.1. Operationsmode
Anzeigebilder bzw.
oder ,
Den anschließenden Operationsmode-Varianten werden folgende, an den Meßergebnissen vorgenommene Statistikberechnungen zugrunde gelegt:
Mittelwert der Meßergebnisse
Standardabweichung
"Halber" Vertrauensbereich
• Die Übernahme eines ausgewiesenen Operationsmodus erfolgt
durch Tastendruck //.
• Der Wechsel zwischen den Operationsmoden wird in dieser
Anzeige auf wiederholten Tastendruck /OM/ und anschließender Rechnerübernahme durch // erreicht.
mit t=f(P,n)>1,96

32
x
... dyn xx s
... σ'/
x
n σ'
x
• Bei Wahl des Modus ist vor Übernahme
durch // die Vorgabe eines Meßzeit-Intervalles in Sekun-
den durch die Tasten /0...9/ erforderlich.
Die Änderung eines angezeigten Meßzeit-Intervalls in o.g.
Modus erfolgt durch Überschreiben mit der Tastenfolge
/0...9/, gefolgt von Taste //.
Ein Wechsel des Operationsmodes, bzw. eine Änderung des
Zeitintervalls oder das Löschen der Meßfolge über den Tastendruck /CLEAR/ im dynamischen Mode ist nur bei abgeschaltetem Meßtakt (Meßanzeige ohne Sternsymbol, siehe andere
Seite) möglich!
Die anschließend beschriebenen Operationsmode-Varianten
sind für folgende Meßstrategien zu verwenden:
(Die eingerückten Bilder sind charakteristisch für die Ergebnisanzeigen des Meßbetriebs)
Operationsmode-Varianten
• : Anwendung für Serienmessung, d.h. zur
wiederholten Messung an einem Objektde-
tail. Die Serienmessung dient zur vollen
Ausschöpfung der Meßgenauigkeit (Reprodu-
Deren Einzelergebnisse werden automatisch
zierbarkeit).
statistisch verarbeitet und gemittelt. Das
Ergebnis wird im Meßbetrieb wie folgt dargeboten:
n = Anzahl der Messungen
σ'= halber Vertrauensbereich
des Mittelwertes x mit einer statistischen Sicherheit von 95 %, d.h. der
wahre Wert liegt mit 95%
Sicherheit in einem Bereich
von x ± σ'.
= Mittelwert der Messreihe

33
x
n s
x
n x
M * xx
... s/
x
...
x
... dyn xx s
... dyn --- s
: Anwendung für Serienmessungen, analog oben.
Die Ergebnisse werden im Meßbetrieb wie
folgt dargeboten:
n = Anzahl der Messungen
. . . x : Anwendung für Einzelmessungen (Meßfolgen)
Eine Folge von Einzelmessungen ist zum Erfassen sich zeitlich und/oder örtlich ändernder Meßwerte in der Probe (Gangunterschiede oder Brechzahlen etc.) geeignet,
wie z.B. bei Objektprofildarstellungen, bei
Phasenübergängen bzw. Modifikationsänderungen oder für Populationsuntersuchungen mehrerer Objekte im Präparat. Der Meßbetrieb
ist durch folgende Merkmale charakterisiert;
n = Anzahl der Einzelmessungen
s = Standardabweichung
(Streuung) des Mittelwertes x
= Mittelwert der Meßreihe
x = aktuelles Einzelergebnis
jeder Messung
oder :
Anwendung für dynamische Meßabläufe, d.h.
zum Erfassen sich dynamisch, speziell zeitund/oder temperaturabhängig ändernder Meßwerte vorzugsweise in Verbindung mit Temperiereinrichtungen wie steuerbarer Heizkammern bzw. Heiz- und Kühltische. Vorgegeben wird hierfür ein Meß-Zeit Intervall
(Meßtakt) von 2...999 Sekunden. Im Abstand
dieser Vorgabe wird mit Starten des Meßablaufes durch Taste /MESS/ (Sternsymbol im
Meßbild: ) ein Meßwert automatisch
vom Gerät erfaßt und verrechnet.

34
M xx
n x
END
Der Meßablauf wird durch nochmaligen Ta
stendruck /MESS/ gestoppt (Meßtakt abgeschaltet; gekennzeichnet durch das Anzei
gebild -ohne Sternsymbol-).
Die Anzeige im Meßbetrieb weist das Ergebnis wie folgt aus:
n = Anzahl der Einzelmessungen
x = aktuelles Einzelergebnis
abgefragt im vorgegebenen
Zeit-Intervall
Anmerkung:
Ein Geberwert wird nur dann automatisch
übernommen, wenn zum vorangegangenen Wert
eine Differenz besteht, d.h. die Meßwerterfassung ruht für den Zeitraum, in dem
keine Änderung der Meßgröße auftritt; der
Zeittakt läuft natürlich weiter! Für die
Auswertung des dynamischen Verlaufes von
Meßwerten ist die Benutzung eines Druckers
Voraussetzung, um die Ergebnisse automatisch dokumentieren zu können.
Es können bis 1000 Messungen durchgeführt
werden.
Mit überschreiten dieser Wertegrenze erscheint die Überlaufanzeige
,begleitet von einen Tonsignal
Ist der Abstand zwischen zwei Messungen
entsprechend der Meßtaktvorgabe größer als
64 Sekunden gewählt, so erfolgt eine akustische Vorwarnung über die bevorstehende
Meßwerterfassung durch das RETARMET. Ein
Doppelton, 16 Sekunden vor Ablauf des Zeittaktes, und ein weiteres Signal, unmittelbar (0,5 s) vor der Messung, informieren den Benutzer über den zeitlichen
Meßablauf.

35
... σ'/
x
n'' s
x
n' s
x
7.2.5.2. Statistik in übergeordneten Speicherebenen
Die Handhabung (Resultatseingabe und Rückruf) einer statistischen Weiterverarbeitung von Ergebnissen in übergeordneten Speichern wird beeinflußt vom gewählten Operationsmode.
Für die anschließend genannten Operationsmode sind folgende
Datenaufarbeitungen möglich:
(Die eingerückten Bilder sind charakteristisch für Ergebnisanzeigen der Statistikspeicher)
Operationsmode-Varianten
: Es können die Endergebnisse von Serienmes-
sungen bei Erreichen einer gewünschten statistischen Fehlergröße (σ' oder s) für Po-
pulationsbetrachtungen in übergeordneten
Speichern SM 1 oder SM 2 erneut zusammengefaßt werden.
• Ohne Datenklassierung stehen zwei unabhängig wirkende
Speicher SM 1 oder SM 2 zur Verfügung.
• Mit Datenklasierung (s. 7.2.6.) ist nur der Speicher SM 1
verfügbar.
• Die gezielte Übernahme der Resultate erfolgt stets nach
dem Abschluß der Meßreihe, d.h. mit letztmaligem Tastendruck /MESS/ und anschließender Betätigung der Tasten
/SM1/ oder /SM2/.
Mit dem Tastendruck /SM1/ oder /SM2/ werden sofort die
verrechneten Meßergebnisse wie folgt ausgewiesen:
n' = Anzahl der verrechneten
Meßserien im Statistik-
Speicher SM1
n'' = Anzahl der verrechneten
Meßserien im Statistikspeicher SM2
(Die Endergebnisse der
Serienmessungen an einem
Objektdetail gelten nun
als Einzelereignisse)

36
x
n‘ s x
... dyn xx s
... x
... x*yyyy
... x*----
s = Standardabweichung
(Streuung) der Ergebnisse
um den Mittelwert x
x = Mittelwert der Enderegeb nisse von Serienmessungen x
: Es werden die Einzelergebnisse von Meßfolund gen für Populationsbetrachtungen im
übergeordneten Statistikspeicher SM 1 über-
nommen und verrechnet.
(SM 2 ist in diesem Mode nicht aktiviert!)
Anmerkung:
• Im dynamischen Operationsmode ist eine Datenklassierung
nicht sinnvoll. Demzufolge werden die Abfragen unter
7.2.6. zur Klassierung vom Rechner übersprungen.
• Die Übernahme der Meßresultate erfolgt automatisch mit
dem Tastendruck /MESS/ bzw. bei der dynamischen Meßweise
im vorgegebenen Zeit-Intervall.
Mit dem Tastendruck /SM1/ können die verarbeiteten Ergeb-
nisse abgerufen, d.h. wie folgt zur Anzeige gebracht werden: (Für den dynamischen Mode ist zuvor der ZeittaktBetrieb durch Tastendruck /MESS/ anzuschalten Sternsymbol in der Anzeige ist gelöscht-.)
n' = Anzahl der verrechneten
Einzelergebnisse im Statistikspeicher SM 1
s = Standardabweichung
(Streuung) der Ergebnisse
um den Mittelwert x
= Mittelwert der Einzeler-
gebnisse einer Meßfolge
7.2.5.3. Verfahrenskonstante für die Meßmethoden /INT/ und /VEL/
Anzeigebild: bzw.
Diese Eingabe bewirkt, daß Meßergebnisse vor ihrer Anzeige
mit einem Faktor multipliziert werden.

37
Die Faktorvorgabe dient zur Anpassung meßverfahrensbedingter Unterschiede für die Ergebnisberechnung, z.B. bei
Durchlichtmessungen von Objekt zu Umgebung (Faktor 1x) oder
für genauere Untersuchungen (mit doppelter Meßsicherheit)
durch Messung von Teilbild 1 zu Teilbild 2 (Faktor 0,5x).
Auch für eine Profilhöhen-(Schichtdicken-) Bestimmung im
Auflicht ist der Faktor 0,5x zu wählen.
• Die unveränderte Übernahme eines angezeigten Faktors er-
folgt auf Tastendruck // in diesen Bild.
• Die Neueingabe (im Anzeigebild oben rechts) oder Änderung
einer vorhandenen Angabe erfolgt durch die Tastenfolge
/0...9/,//.
• Der Faktor 1x wird automatisch vom Rechner gewählt, wenn
im Anzeigebild oben rechts die Taste /CLEAR/ oder // betätigt wird.
• Werden Betriebsbedingungen entsprechend der Abschnitte
7.2.4.2.5. und 7.2.5. geändert, setzt der Rechner automatisch eine Verfahrenskonstante 1.00 ein, d.h. andere
Vorgaben als 1.0 werden überschrieben und müssen ggf. erneut eingegeben werden.
7.2.6. Abfrage zur Klassierung der Meßergebnisse
Die Klassierung dient dazu, die Häufigkeitsverteilung einer
Anzahl von Meßwerten festzustellen.
Es kann damit geprüft werden, wieviel Prozent der Meßergebnisse bestimmten, vorgegebenen Wertebereichen (Klassen) angehören.
Voraussetzung für den Klassierbetrieb ist die Festlegung
von zwei Parametern durch den Benutzer.
1) Der Klassierstart (Kürzel Kls)
Er bezeichnet den Anfangswert, ab dem die Klassierung
vorgenommen wird.

38
x < Kl
x < Kl
2) Die Klassenbreite (Kürzel Klb)
Sie beschreibt den Wertebereich der Klassen.
Die Anzahl der Klassen ist im Programm mit 20 festgelegt und
damit nicht variabel.
Die Klassenbreite ist frei wählbar, aber dann für alle 20
Klassen gleich.
Die Arbeitsweise des Klassier-Programms wird durch nachfol-
gendes Beispiel deutlich:
Es sei angenommen, es sind Meßergebnisse x1 bis x12 in einem
Bereich von 20 bis 2500 gemessen worden und für den Klassen-
start der Wert 50, für die Klassenbreite der Wert 100 vorge-
geben, so bildet der Rechner die Klassen wie folgt:
Klasse 1: von 50 bis < 150
Klasse 2: von 150 bis < 250
Klasse 3: von 250 bis < 350
..
..
Klasse 20: von 1950 bis < 2050
Der Rechner prüft bei jedem Meßergebnis in welchen Wertebe-
reich (Klasse) es gehört und addiert in dieser Klasse ein
Ereignis.
Meßergebnisse mit kleinerem Wert als die Vorgabe zum Klas-
senstart sowie Ergebnisse mit einem größeren Wert als die
obere Wertegrenze der 20. Klasse (am Beispiel x > 2050) werden durch eine Fehleranzeige gekennzeichnet.
Am Beispiel bedeutet dies für die Einzelergebnis8e x1... x12:
x1 = 55 eingeordnet in Klasse 1 als erstes Ereignis
x2 = 270 eingeordnet in Klasse 3 als erstes Ereignis
x3 = 20 nicht klassierbar ! Anzeige:
x4 = 360 eingeordnet in Klasse 4 als erstes Ereignis
x5 = 1998 eingeordnet in Klasse 20 als erstes Ereignis
x6 = 2500 nicht klassierbar ! Anzeige:
x7 = 1930 eingeordnet in Klasse 19 als erstes Ereignis
x8 = 300 eingeordnet in Klasse 3 als erstes Ereignis

39
... Kls xxxxx
... Kls -----
... Kls -----
... Klb xxxxx
... Klb -----
x9 = 1949 eingeordnet in Klasse 19 als zweites Ereignis
x10 = 249 eingeordnet in Klasse 2 als zweites Ereignis
x11 = 270 eingeordnet in Klasse 3 als zweites Ereignis
x12 = 150 eingeordnet in Klasse 2 als drittes Ereignis
7.2.6.1. Klassierstart
Anzeigebild: bzw.
Mit diesem Memory-Bild wird der Benutzer aufgefordert, darüber zu entscheiden, ob die Meßergebnisse klassiert werden
sollen.
• Wird die Klassierung gewünscht,
genügt bei vorhandenen und noch aktuellen Angaben zur
Übernahme der Tastendruck //,
bei der Neueingabe und bei Änderung nicht aktueller Anga-
ben die Tastenfolge /0...9/,// zum Ein- bzw. Über-
schreiben.
Die Vorgabe für den Klassierstart ist in der Regel so zu
wählen, daß der voraussichtlich niedrigste Meßwert mit
erfaßt werden kann.
Sollte keine Abschätzung zum Meßergebnis möglich sein,
ist die Klassierung ab Null mit der Eingabe "0.0" vorzuziehen.
• Wird keine Klassierung von Meßdaten gewünscht
ist im Anzeigebild
der Tastendruck // oder /CLEAR/ erforderlich.
Sind bereits Angaben in der Memory-Anzeige vorhanden,
müssen diese durch separaten Tastendruck /CLEAR/ vorher
gelöscht werden.
7.2.6.2. Klassenbreite
Anzeigebild: : bzw.
Anmerkung:
Dieses Memory-Bild wird nur angezeigt, wenn eine Datenklassierung entsprechend 7.2.6.1. gewünscht wurde.
Die Eingabe legt die Wertespanne von Klasse zu Klasse
fest (Näheres siehe am Beispiel unter 7.2.6.).

40
. . . σ'/
x
und
. . . s/
x
. . . x
n' s x
• Die Übernahme noch aktueller Werte erfolgt auf Tasten-
druck //.
• Neueingaben oder Korrekturen an ausgewiesenen Angaben er-
folgen durch die Tastenfolge /0...9/,//.
7.2.6.3. Übernahme der Meßergebnisse in das Klassierprogramm
Wie Meßergebnisse in das Klassierprogramm übernommen werden,
ist vom gewählten Operationsmode abhängig. Mit Datenklassierung werden die Ergebnisse gleichzeitig im Statistikspeicher
SM 1 aufgenommen und entsprechend dem Abschnitt 7.2.5.2.
ausgewertet.
• Die Übernahme der Meßergebnisse erfolgt bei den
OperationsmodeVarianten
: gezielt nach dem Abschluß einer Meßreihe am
Einzelobjekt, d.h. mit letztmaligem Tastendruck /MESS/, durch anschließende Betätigung
der Taste /SM 1/.
Ausgewiesen wird der Inhalt des Speichers SM
1 mit:
(Erläuterung siehe 7.2.5.2.).
: automatisch mit dem Tastendruck /MESS/.
Auf Tastendruck /SH 1/ kann der Inhalt des
Speichers SM 1 abgerufen werden(s.7.2.5.2.).
Ein unmittelbar erkannter, grober Meßfehler
(z.B. durch Kontrolle des Speicherinhalts SH
1) kann durch den Tastendruck /CE/ sowohl aus
dem Speicher SH 1 wie auch aus dem Klassierspeicher beseitigt werden.
Bei Anzeige der Resultate im Speicher SH 1 erfolgt auf
Tastenbetätigung /CLEAR/ das Löschen dieses Speichers,
aber auch des Klassierspeichers!

41
KL xx Y.YYSS ZZ
KL --
. . . σ'/
x
. . . s/
x
. . . x
Kl --
KL xx Y.YYSS ZZ
M .*
7.2.6.4. Abruf der Datenklassierung im Meßbetrieb
Anzeigebild: bzw.
Der Abruf des Klassierspeichers kann nach Übernahme beliebig
vieler Meßwerte erfolgen.
• Der Übergang zur Klassierspeicher-Anzeige erfolgt durch
den Tastendruck //, d.h.
in den Operationsmoden und
im AnschluB auf die Tastenbetätigung /SM 1/ bzw.
im Operationsmode
im Anschluß auf die Tastenbetätigung /MESS/.
Die Anzeige der aktuellen Meßwerte wechselt damit zum Bild
über.
• Abgefragt werden können:
a) gezielt der Inhalt bestimmter Klassen durch Eingaben der
jeweiligen Klassennummern mit der Tastenfolge /0...9/,//.
b) die Inhalte aller 20 Klassen nacheinander auf mehrfachen
Tastendruck //.
Dabei werden die Ergebnisse (Inhalte) der einzelnen Klassen
wie folgt dargeboten:
Kl xx = jeweilige Klassennummer xx
Y.YYS = prozentualer Anteil der Er-
ZZ = Anzahl aller klassierten
eignisse der Klasse xx, bezogen auf die Gesamt zahl
ZZ aller klassierten Ergebnisse
Meßwerte
• Die Anzeige der Klassierdaten wird abgebrochen durch eine
Betätigung des Gebers oder beendet mit dem Tastendruck
// nach Anzeige der 20. Klasse (es erfolgt mit der Anzeige der Rücksprung zum Meßbetrieb). Weitere
Messungen können ohne Beeinträchtigung angeschlossen werden.

42
10 836 753.l
KL 1 10.0 % 10
KL 2 20.0 % 10
KL 3 30.0 % 10
KL 4 10.0 % 10
KL 19 20.0 % 10
KL 20 10.0 % 10
Um den Vorteil der Datenklassierung deutlich zu machen, soll
auf das Meßbeispiel in Abschnitt 7.2.6. zurückgegriffen werden.
Die Anzeige des Statistikspeichers SM 1 liefert für dieses
Beispiel das Ergebnis:
Die ausgewiesene Streuung der Meßergebnisse -Anzeige Mittezeigt im Vergleich zum Meßmittelwert -Anzeige rechts-, daß
hier keine Beziehung der Meßwerte untereinander erkennbar
wird.
Erst die Möglichkeit zur Datenklassierung erschließt weitere
Zusammenhänge.
Der Abruf der Datenklassierung ergäbe am konkreten Beispiel
nach 7.2.6. folgendes Bild:
KL 5 ... KL 18 = .0%
Hier wird die Häufung von Meßergebnissen in den Klassen
1...4 und 19, 20 erkennbar.
Augenscheinlich noch besser läßt sich dieses Ergebnis durch
einen Histogrammausdruck darstellen, worauf im nächsten Abschnitt näher eingegangen werden soll.
7.2.6.5. Histogramme zur Datenklassierung
Durch den Anschluß eines Druckers (Betriebsbedingungen siehe
Abschnitt 20.) wird nach dessen Initialisierung gemäß 7.2.1.
(zweiter Anstrich) die grafische Darstellung der Klassierergebnisse eröffnet.
bei Verwendung eines Druckers

43
Kl --
• Der Ausdruck eines Histogrammes wird eingeleitet durch
die Tastenfolge // - Anzeige zum Abruf der Datenklassierung gefolgt von der Taste /OUT/.
Der grafische Ausdruck (hier am Beispiel der Meßreihe unter 7.2.6.) enthält folgende charakteristische Angaben:
Druck im Grafik-Mode
(siehe Abschn. 7.2.1.)
L Kls 50.0000 Klb 100.000 10
=======================================
1 10.0% ■■■■■■■■
2 20.0% ■■■■■■■■■■■■■■■■
3 30.0% ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
4 10.0% ■■■■■■■■
5 .0%
6 .0%
7 .0%
8 .0%
9 .0%
10 .0%
11 .0%
12 .0%
13 .0%
14 .0%
15 .0%
16 .0%
17 .0%
18 .0%
19 20.0% ■■■■■■■■■■■■■■■■
20 10.0% ■■■■■■■■

44
Druck ohne speziellen
Grafik-Mode
L Kls 50.0000 Klb 100.000 10
=======================================
1 10.0% :mmmmmmmm
2 20.0% :mmmmmmmmmmmmmmmm
3 30.0% :mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
4 10.0% :mmmmmmmm
5 .0%
6 .0%
7 .0%
8 .0%
9 .0%
10 .0%
11 .0%
12 .0%
13 .0%
14 .0%
15 .0%
16 .0%
17 .0%
18 .0%
19 20.0% :mmmmmmmmmmmmmmmm
20 10.0% :mmmmmmmm
• Im Kopfausdruck stehen: . Links die Meßmethode
. Mitte der Klassierstartwert Kls
und die Klassierbreite Klb
. Rechts die Anzahl der klassier-
ten Meßergebnisse
• Die grafische Darstellung enthält:
. Links die Klassiernummer
• Rechts daneben den prozentualen
Anteil dieser Klasse
• Im Sinne einer deutlichen Profilierung ist die grafische
Darstellung normiert, d.h. der Klasse mit dem prozentual
größten Inhalt wird automatisch die maximal mögliche Säulenlänge zugeordnet. Die Säulendarstellung aller weiteren
Klassen ist im richtigen Längenverhältnis dazu abgestuft.

45
Hinweis:
Die Druckdarstellung im Grafik-Mode als echtes Säulendiagramm setzt voraus, daß der verwendete Drucker über einen
Befehlscode nach Abschn. 20.1.3. verfügt!
Ist diese Voraussetzung erfüllt, muß am RETARMET der GrafikModebetrieb (siehe 7.2.1.) zugeschaltet werden.
Die Histogrammdarstellung zum Meßbeispiel im Abschnitt
7.2.6. macht das Ergebnis der Datenklassierung sehr anschaulich. Durch die Möglichkeit, die Messungen uneingeschränkt
fortzusetzen, kann das Ergebnis weiter ausgeprägt werden.
Nach dem Anschluß weiterer Messungen entsteht für 50 klassierte Ergebnisse eine repräsentative Häufigkeitsverteilung:
L Kls 50.0000 Klb 100.000 50
=======================================
1 2.0% ■■■■
2 4.0% ■■■■■■■■
3 16.0% ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
4 18.0% ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
5 10.0% ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
6 6.0% ■■■■■■■■■■■■
7 4.0% ■■■■■■■■
8 2.0% ■■■■
9 2.0% ■■■■
10 .0%
11 .0%
12 .0%
13 2.0% ■■■■
14 .0%
15 4.0% ■■■■■■■■
16 8.0% ■■■■■■■■■■■■■■■■
17 10.0% ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
18 6.0% ■■■■■■■■■■■■
19 4.0% ■■■■■■■■
20 2.0% ■■■■

46
Code xxxxx
. . . x
Code -----
Print off line
Code -----
M .*
C .*
M .*
7.2.7. Abfrage zur Objekt- Kennzeichnung –Codierung
Anzeigebild: bzw.
Anmerkung:
Dieses Memory-Bild ist vorgesehen, wenn für Meßprotokolle
ein Vermerk über das Meßobjekt, d.h. objektcharakterisierende Daten in codierter Form durch Zahlenwerte notwendig wird.
Diese Abfrage wird mit Wahl der Druckervariante
, d.h. wenn kein Druck von Meßprotokol-
len vorgesehen ist, übersprungen.
• Eine angezeigte, noch aktuelle Codierung kann durch Tas-
tendruck // unverändert übernommen werden.
• Für eine Neueingabe oder für die Abänderung der Codierung
wird die Tastenfolge /0...9/,// zum Ein- bzw. Überschrei-
ben benutzt.
• Ist keine Objekt-Kennzeichnung (Codierung) erforderlich,
genügt im Anzeigebild der Tastendruck //
oder /CLEAR/.
Sind bereits Angaben in der Memory-Anzeige vorhanden,
müssen diese zuvor durch einen separaten Tastendruck
/CLEAR/ gelöscht werden.
7.3. Übergang zum Meßbetrieb
Anzeigebild: bzw. (blinkend)
Spätestens mit der Abhandlung des Memory-Bildes "Objekt-
Kennzeichnung" wurden alle notwendigen Betriebsbedingungen
für den Meßbetrieb dem Rechner vermittelt.
Der Rechner signalisiert nun seine unmittelbare Meßbereitschaft mit dem Kürzel "M" im Anzeigebild und
fordert gleichzeitig durch das blinkende Sternsymbol zur Betätigung des entsprechenden Gebers auf.
Für das Arbeiten nach den Kompensationsmethoden /B-K/, /B-S/
und /E6/ , /E130/ bei Wahl des Operationsmodes

47
. . . dyn xx s
C .*
Print XX
B-K xxx.x y.yyy
bzw. wird für den Meßbetrieb eine KompensatorKalibrierung, gekennzeichnet durch das Kürzel "C" im Anzeigebild eingeleitet.
Eine ausführliche Abhandlung dieser Kalibriervorgänge wird
in den Abschnitten 8.2.1., 8.3.1. oder 10.1. vorgenommen.
• Zur Überprüfung oder gezielten Abänderung der vereinbar-
ten Betriebsbedingungen kann im Meßbetrieb entweder die
Tastenfolge /RESET/, n-mal //, mit Anzeige des MemoryBildes
oder
der einmalige Tastendruck /MM/, gefolgt von n-mal // mit
Anzeige des Memory-Bildes 2.0 in Tabelle 1, wie z.B.
genutzt werden.
(Achtung! Ein mehrfacher Tastendruck /MM/ leitet den
Wechsel der Meßmethode ein!)
7.3.1. Entscheidung über die Datenprotokollierung im Meßbetrieb
Voraussetzung für ein Protokoll ist die Verwendung eines ge-
eigneten Druckers (siehe hierzu Abschn. 20.1.) und dessen
Anschluß entsprechend Abschnitt 5.1.
Mit Entscheidung zur Datenprotokollierung sollte bei Anzeige
der Meßbereitschaft zuerst ein Protokollkopf ausgedruckt
werden.
7.3.1.1. Ausdruck der Betriebsbedingungen - Protokollkopf
Zu kompletten Datenprotokollen gehören in der Regel auch die
Betriebsbedingungen, unter welchen die Meßergebnisse gewonnen wurden.
• Zum Ausdruck eines Protokollkopfes dient die Tastenfolge
/MM/ , /OUT/.
Dabei werden die Meßparameter wie folgt dargeboten:
Beispiel: VEL 546 0.54487 x * 1.00000
Code 10.25..0.5 12.05.1987

48
n σ'
x
n x
n s
x
M .*
1. Zeile: links die Meßmethode,
daneben rechts die Meßwellenlänge bzw. der Ar-
beitsspeicher und ggf. diverse Zusatzparameter, wie Meßkonstanten
2. Zeile: links die Codierung zum Objekt,
daneben rechts das Protokoll-Erstellungsdatum.
7.3.1.2. Varianten der Datenprotokollierung
Prinzipiell besitzt das RETARMET zwei Möglichkeiten zur Meßdaten-Protokollierung:
a) Die Dokumentation bestimmter Resultate per Einzelaus-
druck (vorzugsweise für Endergebnisse von Meßreihen).
. Dazu dient die Taste /OUT/, die nach einem Tastendruck
/MESS/, also je nach Operationsmode, in der Meßergebnisanzeige
benutzt werden kann.
b) die automatische Dokumentation aller Meßergebnisse, aus
gelöst durch den Tastendruck /MESS/ selbst.
. Die Vorwahl zum automatischen Ausdruckbetrieb erfolgt
auf Tastendruck /INIT/ im Anzeigebild
oder bzw.
Die rote LED, links neben der Anzeige, unterhalb der
grün leuchtenden Netzkontrolle signalisiert den automatischen Ausdruckbetrieb. Durch wiederholten Tastendruck
/INIT/ kann dieser Ausdruckbetrieb abgebrochen werden
(rote LED ist dunkel).
Für beide Varianten werden die Ergebnisse in Tabellenform
wiedergegeben. Die prinzipielle Spaltenaufteilung ist dabei
wie folgt (siehe auch 7.3.1.3.):
- Die Anzahl der Messungen steht links.
- Ggf. eine statistische Auswertung steht rechts daneben.
- Das Meßergebnis steht etwa in der Mitte des Druckerstreifens
- Der restliche Raum, rechts daneben, ist dem Druck von Er-
gänzungsparametern, wie Temperatur und Meßzeit, vorbehalten.

49
x-----
M .*
Das Drucken der Speicherinhalte in SM 1 und SM 2 ist nur im
Einzelausdruckbetrieb möglich.
• Der Druck dieser Daten erfolgt stets über die Tastenfolge
/SM 1/ , /OUT/ bzw. /SM 2/ , /OUT/.
Zur Kennzeichnung wird dem Ausdruck das Symbol "SM 1"
bzw. "SM2" vorangestellt (siehe Beispiel Pkt. 7.3.1.3.).
Weiterhin können frei eingebbare Ergänzungsparameter dem
Druck der Meßdaten beigefügt werden.
• Dazu ist nach Anzeige des Meßergebnisses auf Tastendruck
/MESS/ die Tastenfolge /0...9/ , // anzuschließen.
Der Rechner wechselt dabei zum Anzeigebild über.
Der Druck dieser Eingabe erfolgt automatisch im rechten
Teil des Druckerstreifens mit Betätigung von //.
Bei Fehleingaben ist die Taste /CLEAR/ vor // zur Kor-
rektur möglich.
Das Drehen am Geber löscht automatisch diese Zusatzinformation und gibt den Meßvorgang wieder frei.
7.3.1.3. Ausdruck eines Tabellenkopfes
1) Für den automatischen Ausdruckbetrieb (7.3.1.2. b) wird
mit Protokollierung des ersten Meßergebnisses selbsttätig
ein Tabellenkopf vorangestellt, der den darunter folgenden Tabelleninhalt näher kennzeichnet.
Beim Löschen einer abgeschlossenen Meßreihe durch die
Taste /CLEAR/ erfolgt für jede neue Meßreihe automatisch
auch der Ausdruck eines neuen Tabellenkopfes.
2) Für den Einzelausdruck von Ergebnissen 7.3.1.2. a) muß
der Tabellenkopf separat ausgedruckt werden.
- Gemeinsam mit einem Protokollkopf erfolgt dies durch
die Tastenfolge /MM/ , /OUT/ 2x!
- Nach dem Löschen einer abgeschlossenen Meßreihe durch
die Taste /CLEAR/ muß für einen neuen Tabellenkopf die
Taste /OUT/ im Anzeigebild betätigt werden.

50
Für den Tabellenkopf und in der Tabelle selbst werden folgende Symbole auf dem Ausdruck verwendet:
Nr. - Anzahl der Messungen n
S - Standardabweichung s
Si' - halber Vertrauensbereich σ'
dyn - dynamische Meßweise (in der Tabelle
Rm - Mittelwert der Meßergebnisse (in der Tabel-
R - aktueller Einzelmeßwert
Im - Mittelwert der Meßergebnisse, speziell zur
L - aktueller Einzelmeßwert zur Längenmessung
R:L - aktuelles Endergebnis der Doppelbrechung
Bei entsprechender Druckerinitialisierung nach Abschn. 7.2.1.
temp/'C - Zusatzparameter Temperatur (in °C)
time/h - Zusatzparameter Meßzeit, in der Tabelle selbst
selbst steht dann das Sternsymbol)
le selbst mit der Dimension nm)
Längenmessung (in der Tabelle selbst mit der
Dimension µm, dargestellt durch "um")
im Programm R:L
ausgegeben als:
XXh YY:ZZ XXh - Stunden h
YY - Minuten
ZZ - Sekunden
Einen vollständigen Protokollauszug mit Meßdaten und Ergänzungsparametern zeigt abschließend dieses Beispiel:
L ST1 0.58823
Code 20.07..0.9 Date 12.02.1987
Nr. Si' LM temp/'C time/h
===========================================================
1 74.1 um 21.9 00h00:02
2 112 65.3 um 21.8 00h00:07
3 22 66.1 um 21.9 00h00:ll
4 14 68.4 um 21.9 00h00:16
5 11 70.5 um 22.1 00h00:21
6 8.7 71.6 um 22.0 00h00:27
7 11 68.2 um 22.0 00h00:34
8 9.1 68.8 um 22.0 00h00:39
9 7.9 69.3 um 22.1 00h00:45
10 7.1 69.9 um 22.1 00h00:52
SM 1 1 69.9 um

51
. . . σ'/
x
. . . s/
x
8. Messung mit Kippkompensatoren nach EHRINGHAUS
Für den Meßbetrieb sind folgende Voraussetzungen zu schaffen:
. Kopplung des Meßkompensators mit dem inkrementalen Ge-
ber IGR-M3 (s. 5.)
. Vereinbarungen
- Druckerinitialisierung (s. 7.2.1.)
- Wahl der Meßmethode /E6/ oder /E130/ entspr. dem
verwendeten Meßkompensator (s. 7.2.4.1.)
- Wahl der Meßwellenlänge (s. 7.2.4.2.1.)
- Datenklassierung (s. 7.2.6. ff)
Der schematische Meßablauf ist in den Tabellen 3a und 3b zusammengefaßt.
8.1. Mehrfaches Messen an einem Objekt - Serienmessung
• Wahl des Operationsmodes oder
(s. 7.2.5.1.)
Für Serienmessungen wird die klassische Arbeitsmethode
bei Kippkompensatoren, das Einmessen der zwei Kompensationsstreifen symmetrisch zur Nullage des Kompensators verwendet. Der Meßwinkel (a + b) / 2 aus den in den Kompensationslagen vorhandenen Winkelpositionen a und b wird
vom Mikroprozessor selbsttätig gebildet, wobei die erste
Winkelposition als Ausgangswinkel = 0 gesetzt werden muß.
Durchführung einer Meßreihe
1. Mikroskop entsprechend Gebrauchsanleitung einrichten.
2. Präparat auflegen; Objektstelle aufsuchen und in Faden-
kreuzmitte bringen, Aperturblende auf Meßapertur 0,12...
0,15 schließen.
3. Objektstelle in Auslöschungslage drehen (Meßstelle dun-
kelgrau); 45° - Rast am Objekttisch setzen. Objekt um 45°
(einmal rasten!) in beliebiger Richtung drehen.
4. Kompensator in Kompensatorschlitz einführen.
5. IGR-M3 drehen, dabei Objekt beobachten; es wandert ein
Streifenfeld durch die Meßstelle:

52
M .00
a) Ist die Farbfolge der aufeinanderfolgenden Streifen im
Objekt bei Drehung fallend, d.h. bei hohem Gangunterschied zunehmende kräftigere Farbtöne über grün, blau,
rot, gelb bis dunkelgrau, so stehen Präparat und Kompensator in der richtigen, der Subtraktionslage zueinander.
b) Ist die Farbfolge bei Drehung steigend, d.h. bei nied-
rigem Gangunterschied zunehmend flauere Farben über
rot, blau, grün, hellrot, hellgrün, so stehen Präparat
und Kompensator in Additionslage. Bei dieser Stellung
ist der Objekttisch um 90° durch zweimaliges Rasten in
beliebiger Richtung zu drehen ═══► Erreichen der Sub-
traktionslage.
6. Ausgehend von der Grobskala am Kompensator in Stellung
90° wird der IGR-M3 z.B. solange nach rechts gedreht, bis
der dunkelgraue Streifen bei Beobachtung des Präparates
in der Meßstelle sichtbar wird.
7. Es wird das Metallinterferenzfilter entsprechend der
gewählten Meßwellenlänge durch Drehen am Filterrevolver eingeschaltet bzw. auf die Lichtaustrittsöffnung
des Mikroskops gelegt.
Der dunkle Streifen über der Meßstelle ist mit seinem
Intensitätsminimum genau mittig zum Fadenkreuz durch
Drehen an IGR-M3 einzustellen.
8. Die gefundene Winkelstellung am IGR-M3/250 wird durch die
Taste /o/ dem Rechner vermittelt. Anzeige:
9. Das Metallinterferenzfilter wird entfernt, der IGR-M3 wird
nach links gedreht, bis der zweite dunkelgraue Streifen
über der Meßstelle sichtbar wird. Punkt 7 wird hier in
analoger Arbeitsweise wiederholt.
Durch Tastendruck /MESS/ ermittelt der Rechner den Gangunterschied der Meßstelle.
In der Anzeige erscheint rechts der ermittelte Gangunterschied R in nm und links die Anzahl der Messungen n. Das
Ausmessen der Präparatstelle kann beliebig oft wiederholt
werden. Wurde z.B. der linke Kompensationsstreifen
exakt genug symmetrisch zum Fadenkreuz eingedreht, kann
nun ohne Betätigen der Taste /o/ sofort wieder der rechte
Kompensationsstreifen durch Betätigen des IGR-M3 eingestellt werden.

53
M 0! xx*
(Ab n = 1 automatische Nullpunktfixierung!) Auf Tastendruck /MESS/ ermittelt der Rechner nun den Mittelwert des
Gangunterschieds aus den bisherigen Messungen (Anzeige
rechts) sowie den halben Vertrauensbereich des Mittelwertes σ'R oder die Standardabweichung s, (Anzeige Mitte) je
nach Operationsmode-Vorgabe.
10.Das Auftreten grober Meßfehler wird durch sprunghaft gro-
ße Werte oder bei Anzeigeüberlauf durch "xxx" im mittleren Anzeigeteil erkennbar.
Unmittelbar erkannte grobe Meßfehler lassen sich durch
die Taste /CE/ aus einer Meßreihe eliminieren.
11.Das Löschen von Meßreihen, der Speicherinhalte SM1 und
SM2, ggf. von Klassierdaten geschieht durch den Tasten
druck /CLEAR/ nach den Regeln 5.1.2., 5.1.4., 5.1.5.
Anmerkung!
- Neben der automatischen Nullpunktfixierung (Punkt 9) be-
steht weiterhin die Möglichkeit der manuellen Nullpunktfixierung für nicht sichere Kompensationseinstellungen
durch erneute, exakte Gebereinstellung, gefolgt vom Tastendruck /o/.
- Bei Wechsel der Wellenlänge werden nicht abgeschlossene
- Für spezielle Applikationsprobleme, z.B. Untersuchungen
Meßreihen, Statistik- und Klassierspeicher automatisch
gelöscht. Nach IGR-Betätigung fordert die Anzeige
, die Arbeitsschritte ab Punkt 6 zu wiederholen .
über den Orientierungsgrad gleichartiger Objekte in einem
Präparat, können Endergebnisse mehrerer Meßreihen in zwei
unabhängige Speicher SM1 , SM2 erneut statistisch verrechnet oder klassiert werden (s. 7.2.5.2. und 7.2.6.).

54
. . . x
C .*
M 0! xx*
M xx/2*
8.2. Bestimmen aktueller Einzelergebnisse - Meßfolgen
• Wahl des Operationsmodus (s. 7.2.5.1.).
Für diesen Operationsmodus wird vor der Messung eine Kom-
pensatorkalibrierung erforderlich.
8.2.1. Bestimmung der Kompensator-Nullage
- Kalibriervorgang, eingeleitet durch die Anzeige
1. Nach dem Einrichten des Mikroskops entsprechend seiner
Gebrauchsanleitung werden nachfolgende Kalibrierschritte
durchgeführt.
2. Die Kalibrierung erfolgt ohne Objekt bei einer beliebig ge-
wählten Meßwellenlänge (vorzugsweise 546 nm oder 589 nm).
3. Bei 90°-Stellung des Kompensators ist die Feldmitte zu
beobachten.
Es ist ein mehr oder weniger breites, verwaschenes Aus-
löschungskreuz sichtbar. Interferenzfilter einschalten.
Der Kompensator wird z.B. nach rechts gedreht, bis der
erste, ggf. zweite oder dritte dunkle Streifen erscheint;
der jeweils ausgewählte Streifen wird genau symmetrisch
zum Fadenkreuz durch Betätigen am IGR-M3 eingestellt.
(Bei den Kompensator EHRINGHAUS 0...6 λ ist eine Genauig-
keitssteigerung beim Ermitteln des Bezugswinkels durch
Verwendung des zweiten oder dritten Streifens rechts bzw.
links des Auslöschungskreuzes möglich und ratsam).
4. Anzeige:
Die gefundene Winkelstellung am IGR-M3 wird durch Taste /o/ dem Rechner vermittelt.
5. Den IGR-M3 solange nach links drehen, bis nach dem Durch-
6. Die Taste // schließt den Kalibriervorgang ab; der Rech-
7. Das Löschen der Kalibrierung erfolgt auf die Tastenfolge
wandern des Auslöschungskreuzes jeweils der erste, ggf.
zweite oder dritte dunkle Streifen erscheint; der gewählte Streifen wird symmetrisch zum Fadenkreuz ausgerichtet.
ner ermittelt aus den Winkelwerten den Bezugswinkel für
alle nachfolgenden Messungen und weist diesen in der Anzeige aus.
/MM/, /o/, n-mal //.

55
M xx*
n xxx nm
Achtung!
Bei o.g. Kalibriervorgang ist keine Serienmessung für die
Ermittlung des Bezugswinkels möglich!
Um möglichst genaue Absolutwerte im Meßprogramm zu erhalten,
ist einer exakten Ermittlung der Winkelpositionen unter
8.2.1./3. und 8.2.1./4. besondere Aufmerksamkeit zu schen-
ken.
8.2.2. Durchführung einer Meßfolge
- Meßvorgang, eingeleitet durch die Anzeige
1. Für diesen Meßmodus wird der Meßwert nur durch Drehung
des IGR-M3 in einer Richtung erfaßt. Ausgangspunkt ist
die 90°-Lage des Kompensators (Grobskala).
Zum Ermitteln der Auslöschungslage des Präparates wird
der Kompensator aus dem Kompensatorschlitz zunächst ent-
fernt und, analog der Arbeitsschritte 1...5 Abschn. 8.1.,
das Objekt in Subtraktionslage gebracht.
2. Meßwertgeber IGR-M3 bis zum Erscheinen des schwarzen Kom-
pensationsstreifens drehen; Meßstellung nach Auflegen des
Metallinterferenzfilters korrigieren, bis Streifen symmetrisch zum Fadenkreuz steht.
3. Durch Tastendruck /MESS/ ermittelt der Rechner den ak-
tuellen Gangunterschied an der Meßstelle.
In der Anzeige erscheint nur der Gangunterschied R und die Anzahl der Messungen n (keine σ'/sAngabe).
4. Die Veränderung des Gangunterschieds an der Meßstelle
wird durch Auswandern des Kompensationsstreifens sichtbar.
Zur Ermittlung der Änderungen wird der Kompensationsstreifen durch Drehen am Geber nachgeführt, sein Intensitätsminimum genau über der Fadenkreuzmitte gehalten und
danach die Taste /MESS/ erneut betätigt.
5. Eine statistische Bearbeitung der Ergebnisse erfolgt auto-
matisch im übergeordneten Speicher SM1 (siehe 7.2.5.2.).
6. Das Löschen der gesamten Meßfolge oder einzelner Meßer-
gebnisse erfolgt nach den Regeln 5.2.2., 5.3. über die
Tasten /CLEAR/ bzw. /CE/.

56
. . . dyn xx s
. . . x
M * .*
Anmerkung!
- Bei Wechsel der Meßwellenlänge über Tastenfolge /MM/,/ λ/ST/,
n-mal // kann unmittelbar eine neue Meßreihe begonnen
werden. Die einmal vorgenommene Bezugswinkelmittlung ist
für alle Meßwellenlängen gleichermaßen gültig.
- Das Arbeiten mit diesem Operationsmode ist vorzugsweise
in Verbindung mit dem Thermodrucker vorzusehen. Damit ist
eine Ein-Mann-Bedienung zum Bestimmen von Gangunterschiedsänderungen voll gewährleistet.
- Ein gleichzeitiges Dokumentieren von Zusatz- oder Ein-
flußparametern ist möglich (siehe Abschnitt 7.2.1. und
7.3.1.2.).
8.3. Erfassen dynamischer Gangunterschiedsänderungen
• Wahl des Operationsmodus nach Abschn. 7.2.5.1.
Das Auslösen einer Messung wird nach einem vorgebbarem
Zeittakt zwischen 1...999 sek. vom Gerät selbständig
durchgeführt. Die erforderliche, exakte Einstellung der
Konpensation und die Kompensationsnachführung analog dem
Meßmode (siehe 8.2.2./4.) ist durch den Benutzer
manuell vorzunehmen.
Durchführung einer Meßfolge
1. Auch für diesen Mode ist die Kompensatorkalibrierung Vor-
2. Mit Tastendruck /MESS/ erscheint die Anzeige: .
Das Symbol in der Anzeigemitte signalisiert, daß die in-
aussetzung, d.h. es sind zunächst die Arbeitsschritte
1...6, Abschn. 8.2.1. - Kalibriervorgang - und 1,2 nach Ab-
schn. 8.2.2; - Meßvorgang - durchzuführen.
Das blinkende Sternsymbol, rechts, fordert auf, entspr.
B.2.2./4. durch Geberbetätigung eine Veränderung des
Gangunterschieds zu kompensieren.
terne Zeituhr läuft und im Takt der Vorgabe der Geberwert
abgefragt wird.
3. Ergibt diese Abfrage eine Differenz des aktuellen Geber-
standes zur letzten Position, so wird automatisch eine
Gangunterschiedsberechnung ausgelöst.

57
n xxx nm
4. In der Anzeige erscheint nur der Gangun-
terschied R und die Anzahl n der Messungen.
5. Der Zeittakt wird durch nochmaligen Tastendruck /MESS/
abgebrochen. (Sternsymbol in Anzeigenitte ist gelöscht).
Erst danach ist das Löschen der Meßfolge über /CLEAR/,
der Kalibrierung (analog 8.2.1./7.), oder der Wechsel von
Meßwellenlänge, Operationsmode bzw. Meßmethode möglich.
6. Eine statistische Bearbeitung der Ergebnisse erfolgt im
Speicher SM1 mit jeder Meßauslösung (s. 7.2.5.2.). Der
Abruf ist erst nach Taktstop (Punkt 5.) über die Taste
/SM1/ möglich.
Anmerkung!
• Mit Taktstop wird die interne Uhr angehalten.
Mit erneutem Taktstart läuft die Uhr von 0.00 erneut
an; die Meßfolge wird fortgesetzt und erst mit Taste
/CLEAR/ nach Taktstop gelöscht.
• Für eine rationelle Ein-Mann-Bedienung ist der Druckeran-
Schluß Voraussetzung. Die Initialisierung für den automatischen Ausdruck der Meßzeit und ggf. des Parameters
"Temperatur" ist Abschn. 7.2.1. zu entnehmen. Die Datenprotokollierung erfolgt entspr. 7.3.1.2. automatisch.

58
180
Rx
9. Messung mit dem Digitalanalysator nach DE SENARMONT
Für die Messung nach DE SENARMONT ist die Verwendung monochromatischen Lichtes, eines λ/4-Kompensators ,dessen
Schwingungsrichtung nγ parallel zu den Polaren ausgerichtet
werden kann, und ein drehbarer Meßanalysator notwendig.
Diese Voraussetzungen besitzt das JENAPOL b. Ein ringförmiger rotatorisch inkrementaler Geber, der fest mit dem drehbaren Analysator verbunden ist, liefert Winkelwerte, die im
RETARMET 2 direkt zur Gangunterschiedsberechnung nach DE SENARMONT über die Funktion
λ[nm] = Meßwellenlänge
α[°] = Analysatordrehwinkel
R[nm] = Gangunterschied
genutzt werden.
Für den Meßbetrieb sind folgende Voraussetzungen zu schaffen:
• Anschluß des Digitalanalysators an das RETARMET 2 (5.1)
• Vereinbarungen
- Druckerinitialisierung nach 7.2.1.
- Wahl der Meßmethode /SEN/ (s. 7.2.4.1.)
- Wahl der Meßwellenlänge (s. 7.2.4.2.2.)
- Wahl des Operationsmodes (s. 7.2.5.1.)
- Datenklassierung (s. 7.2.6. ff)
Der schematische Meßablauf ist in Tabelle 4 zusammengefaßt.
9.1. Meßvorbereitungen
Unabhängig vom Operationsmode sind nachfolgende Arbeitsschritte durchzuführen:
9.1.1. Justieren des λ/4-Kompensators
Die Meßmethode erfordert ein genaues Ausrichten der
Schwinggungsrichtung nγ des Kompensators zur Analysatorschwingungsrichtung durch nachfolgenden Arbeitsablauf:

59
M 00°
M .*
• Einrichten des Mikroskops für Gangunterschiedsmessungen
entsprechend der Gerätegebrauchsanleitung.
• Einschalten des Interferenzfilters entspr. der gewählten
Heßwellenlänge nach 7.2.4.2.2.
• Objekt entfernen; RETARMET 2 einschalten (Netztaste / 0/).
Nach Abschluß der Eingabevereinbarungen erscheint das Anzeigebild .
• Digitalanalysator drehen, bis statt der Aufforderung zur
Geberdrehung (blinkendes Sternsymbol) rechts ein Winkelwert angezeigt wird.
Anmerkung:
Mit jeder Inbetriebnahme fordert o.g. Anzeigebild dazu auf,
einen werksjustierten, elektronischen Nullpunkt als Ausgangsort für die Analysator-Winkelzählung zu erfassen. Dies
kann bei der vorliegenden, starken Untersetzung des Analysatorgetriebes bis zu 7 Umdrehungen am Getriebeknopf bedeuten !
. Analysator bis zur Anzeige drehen, jetzt Ge-
triebe arretieren.
. Prüfen, ob der Polarisator auf Raststellung/Anschlag "0"
steht.
. Schwingungsrichtung nγ des λ/4-Kompensators entspr. Ab-
schn. 6 der Gebrauchsanleitung 30-G0061-1 für JENAPOL b
oder bei Verwendung des achromatischen SENARMONTKompensators entsprechend Einlage zur GA 30-G0060 (JENAPOL) bzw. GA 30-G0062-1 (JENAPOL interphako) ausrichten.
9.1.2. Bestimmung des Meßwinkels
Bei Messung nach DE SENARMONT treten mit 360°-Drehung des
Analysators zwei Kompensationsstellungen über der Meßstelle
auf. Für eine fehlerfreie Messung ist daher die Bestimmung
des richtigen, dem Objektgangunterschied zugehörigen Meßwinkels notwendig. Dazu wird wie folgt verfahren:
• λ/4-Kompensator ausschalten.
• Präparat auflegen;
Objektstelle aufsuchen und über Fadenkreuzmitte bringen,
Aperturblende auf Meßapertur 0,12...0,15, schließen

60
SEN σ'/
x
SEN s/
x
• Objektstelle in Auslöschungslage drehen (Meßstelle dun-
kelgrau), 45°-Rast am Objekttisch setzen und Tisch bis
zur nächsten Rast drehen.
Die Bestimmung des Analysatordrehwinkels erfolgt
a) bei Objekten mit kleinem Gangunterschied (R < λ/4) durch
langsames Drehen in beiden Richtungen um die Nullage
des Analysators .
In einer Drehrichtung tritt im monochromatischen Licht
über der Meßstelle eine kontinuierliche Abdunklung auf;
dies kennzeichnet den Meßwinkel.
b) bei Verwendung achromatischer λ/4-Kompensatoren ist die
Farbfolge mit Analysator-Drehung (steigende Winkelwerte!)
zu beachten (Farbfolge siehe Einlage zu GA 30-G0060 bzw.
GA 30-G0062-1).
c) am JENAPOL b, besonders für Gangunterschiede R > λ/4, ist
eine Vorprüfung mit einem λ-Kompensator vorzusehen. Prä-
parat und Kompensator sind in Subtraktionslage zu bringen. Nach Entfernen des Kompensators ist der Analysator
in Richtung steigender Winkelwerte bis zur Kompensation
der Objektstelle zu drehen.
9.2. Mehrfaches Messen an einem Objekt - Serienmessung
• Wahl des Operationsmodes oder
(s. 7.2.5.1.).
Durchführung einer Meßreihe
1. Mit dem Abarbeiten der Meßvorbereitungen unter 9.1. ff.
kann der Objektgangunterschied, für die gewählte Wellenlänge durch Drehen am Analysator in Richtung des Meßwinkels kompensiert werden (Objektstelle ist abgedunkelt
oder bei Verwendung einer Halbschattenplatte wird gleiche
Dunkelheit der aneinandergrenzenden Halbschattenplattensegmente erzielt).

61
M .*
2. Dieser Winkelwert wird durch Tastendruck /MESS/ dem Rech-
ner vermittelt, wodurch der Gangunterschied im Anzeigeteil rechts in nm ausgewiesen wird.
3. Das Ausmessen der Objektstelle kann durch Pendeln der
Analysatoreinstellung mit erneuter Kompensation am Objekt
beliebig oft wiederholt werden.
Der Tastendruck /MESS/ schließt jedesmal eine Messung ab,
wobei der angezeigte Wert rechts nun den Mittelwert des
Gangunterschieds aus den bisherigen Messungen repräsentiert. Im mittleren Anzeigeteil wird der statistische
Fehler der Meßreihe, entweder als Vertrauensbereich σ'
oder als Standardabweichung s, je nach Operationsmodewahl
ausgewiesen; links wird die Anzahl der Messungen angezeigt.
4. Die Datenklassierung und/oder das Abspeichern in überge-
ordnete Speicher erfolgt nach den Ausführungen der Abschnitte 7.2.6.3. und 7.2.5.2.
5. Für das Eliminieren grober Meßfehler, das Löschen der
Meßreihe und/oder der übergeordneten Speicherinhalte,
ggf. auch von Klassierdaten werden die Regeln 5.2.1.,
5.1.2., 5.1.4. und 5.1.5. angewendet.
Anmerkung:
• Für die Messung wird nur bei Inbetriebnahme der elektro-
nisch fixierte Analysator-Nullpunkt neu erfaßt.
Ist ein Zweifel an der korrekten Nullpunktfixierung gege-
ben, kann durch die Tastenfolge /MM/ , /o/ , // n-mal
eine Erneuerung dieser Ausgangsposition mit dem Anzeigebild erfolgen, ohne die bisherigen Ergebnisse in den übergeordneten Speichern zu beeinflussen.
• Bei Wechsel der Meßwellenlänge ist mit Verwendung achro-
matischer λ/4- Kompensatoren darauf zu achten, daß der
Arbeitsgang 9.1.1. erneut durchgeführt werden muß!

62
1‘ xxx nm
SEN x
9.3. Eliminieren geräteinterner Fehler
Für hochgenaue Messungen, besonders kleinster Gangunterschiede sollte das Meßergebnis auf eventuelle geräteinterne
Fehler überprüft werden.
1. Dazu wird zunächst eine Meßreihe wie unter 9.2.1. durch-
geführt, bis die gewünschte statistische Fehlervorgabe
erreicht wird.
2. Das Endergebnis wird gezielt im übergeordneten Speicher
SM1 durch Tastendruck /SM1/ (Anzeige )
aufbewahrt.
3. Das Präparat wird um 90° gedreht (2x Rasten am Objekttisch).
4. Die Kompensation des Objektgangunterschieds erfolgt nun
bei entgegengesetztem Drehsinn des Analysators wie bisher
über die Analysator-Null hinweg.
5. Es wird eine zweite Meßreihe durchgeführt, wobei als Ab-
bruchkriterium die gleiche statistische Fehlervorgabe anzustreben ist.
6. Das Endergebnis dieser Meßreihe weicht bei geräteinternen
Fehlern vom Endwert der 1. Meßreihe geringfügig ab.
Der gerätefehlerfreie, gemittelte Wert aus beiden Meßreihen ist durch Eingabe der zweiten Meßreihe in SM1 auf
Tastendruck /SM1/ im Anzeigefeld rechts dargestellt.
Anmerkung:
Es wird darauf hingewiesen, daß der berechnete statistische
Fehler in SM1 hierbei keine Aussagekraft besitzt.
9.4. Bestimmen aktueller Einzelergebnisse – Meßfolgen
• Wahl des Operationsmodus (s. 7.2.5.1.)
Durchführung einer Meßfolge
1. Mit Abarbeiten der Meßvorbereitungen nach Abschn. 9.1. ff.
2. Der Analysatorwinkel wird auf Tastendruck /MESS/ verrech-
kann der Objektgangunterschied im monochromatischen Licht
durch Drehen am Analysator in Richtung des Meßwinkels kompensiert werden. Die Abgleichkriterien sind analog 9.2.
net und ergibt stets den aktuellen Gangunterschied der
Meßstelle

63
SEN dyn xx s
3. Die Veränderung des Gangunterschieds ist durch Änderung
der Abdunklung oder durch Helligkeitsunterschiede der
Sektoren der Halbschattenplatte gekennzeichnet. Er kann
durch Nachführen des Analysatordrehwinkels erneut kompensiert, auf Tastendruck /MESS/ berechnet und als aktueller
Wert angezeigt werden.
4. Eine automatische statistische Verarbeitung der aktuellen
Meßwerte erfolgt im Speicher SM1 und kann über die Taste
/SM1/ abgerufen werden (s. 7.2.5.2.).
5. Das Löschen der gesamten Meßfolge erfolgt auf Tastendruck
/CLEAR/, einzelner Meßwerte durch die Taste /CE/.
6. Soll eine neue Nullpunktfixierung vorgenommen werden,
gilt die Regel 5.3., bzw. die Anmerkung unter 9.2.
9.5. Erfassen dynamischer Gangunterschiedsänderungen
• Wahl des Operationsmodus
(nach Abschn. 7.2.5.1.
Durchführung einer Meßfolge
1. Mit Abarbeitung der unter Abschn. 9.1. ff. genannten Meß-
vorbereitungen kann das Ausmessen des Objektgangunterschieds im monochromatischen Licht unmittelbar durch Drehen des Analysators in Meßwinkel-Richtung bis zur Kompensation der Meßstelle erfolgen.
2. Die Änderung des Gangunterschieds macht sich, analog der
Ausführung unter 9.4./3., durch Helligkeitsänderung der
Sektoren einer Halbschattenplatte bzw. ohne dieses Hilfsmittel durch Aufhellung der Meßstelle bemerkbar.
Die Änderung wird durch Nachführen des Analysatordrehwinkels unter Beobachtung des Meßobjekts ständig kompensiert.
3. Das Auslösen der Messungen geschieht automatisch im vor-
gegebenen Zeittakt und entspricht im weiteren den Ausführungen unter S.3./2...6, sowie den anschließenden Anmerkungen.

64
Obj Komp
R = - R × sin 2u
Komp
Obj
RK
1
R = arc tg 2 sin 2u tg
K2
2
K=
u
10. Messung mit Drehkondensatoren nach BRACE - KÖHLER
Die hohe Rechnerkapazität ermöglicht es, statt der Näherungsformel
nun die exakte Kompensatorfunktion für das Verfahren BRACEKÖHLER mit
λ = Meßwellenlänge in nm
= mittlerer Meßwinkel in Grad
R
= Kompensatorkonstante in nm
Komp
anzuwenden.
Ein Vergleich beider Funktionen ergibt im sinnvoll nutzbaren
Meßwinkelbereich von 0°… ca. 25° bei Verwendung der Nähe-
rungsformel eine Abweichung bis zu 6 % vom realen Wert.
Für den Meßbetrieb sind folgende Voraussetzungen zu schaffen:
• Kopplung des verwendeten Meßkompensators mit dem inkre-
mentalen Geber IGR-M3 nach Abschn. 5.2.
• Vereinbarungen
- Druckerinitialisierung (s. 7.2.1.)
- Wahl der Meßmethode /B-K/ (s. 7.2.4.1.)
- Wahl der Meßwellenlänge und der
zugehörigen Kompensatorkonstante (s. 7.2.4.2.3.)
- Wahl des Operationsmodus (s. 7.2.5.1.)
- Datenklassierung (s. 7.2.6.)
Der schematische Meßablauf ist Tabelle 5 b) zu entnehmen.
Zur Durchführung von Messungen ist eine Kompensatorkalibrierung Voraussetzung.
Der Kalibrierablauf selbst ist in Tabelle 5 a) zusammengefaßt.

65
C .*
1 .00°
n x.x nm xxx.x°
10.1. Meßvorbereitung
Nach Eingabe der Kompensatorkonstanten für die Meßwellenlängen entsprechend dem Kompensatorprüfschein sind unabhängig
vom gewählten Operationsmode nachfolgende Arbeitsschritte
zur Kompensatorkalibrierung, d.h. zur Bestimmung der Auslöschungslage des Kompensators erforderlich.
Der Kalibriervorgang wird eingeleitet durch die Anzeige
1. Bei den Meßverfahren /B-K/ und /B-S/ benötigt der Rechner
einen Bezugswinkel zur Ermittlung der Gangunterschiede.
Seine Bestimmung erfolgt ohne Präparat vor der eigentlichen Messung.
2. Dieser Kalibriervorgang kann bei einer beliebigen Wel-
lenlänge (vorzugsweise 546 nm oder 589 nm) durchgeführt
und falls vorhanden mit Hilfe einer Halbschattenplatte in
der Objektebene präziser gestaltet werden.
3. Dazu wird der Kompensator in den Kompensatorschlitz ein-
geführt, danach am IGR-M3 gedreht, bis das gesamte Sehfeld bei einer der vier Dunkelstellungen des Kompensators
maximal dunkel ist. (Bei Verwendung einer Halbschattenplatte bis zur gleichmäßigen Dunkelheit aller Sektoren).
4. Durch Tastendruck /o/ wird der angezeigte Drehwinkel = 0
gesetzt und dem Rechner als erstes Resultat vermittelt
(Anzeige ).
5. Durch "Pendeln" der Einstellung am Kompensator um die ge-
wählte Dunkelstellung und wiederholte Einstellung auf das
Intensitätsminimum kann die Genauigkeit der Position des
Bezugswinkels erheblich verbessert werden.
Auf Tastendruck /MESS/ wird nach Durchführung jeder weiteren Kalibrierung dieser Winkel gemittelt und die Anzahl
der Kalibriervorgänge n ausgewiesen.
Anzeige:
Im mittleren Anzeigefeld errechnet der Prozessor, je nach
Wahl des Operationsmodus, einen Vertrauensbereich σ' oder

66
M xxx.x°
eine der Streuung s der Winkelwerte entsprechende Gangunterschiedsgröße (in nm).
Diese Angabe entspricht dem Einfluß der Kalibrierung auf
das Meßergebnis für einen angenommenen (mittleren) Meßwinkel von 20°.
6. Die Anzeige gestattet eine Aussage über die maximal er-
reichbare Genauigkeit der anschließenden Objektmessung.
Grund dafür ist, daß die Streuung des Meßwinkels und die
Streuung im Kalibriervorgang (Ausgangspunkt dieses Meßwinkels im Rechner) durch eine Fehlerfortpflanzungsfunktion miteinander in Beziehung gesetzt werden.
Der Aussagegehalt der Anzeige soll an einem Beispiel er-
läutert werden.
Wurde der Ausgangspunkt (durch die Kalibrierung) mit ei-
ner Genauigkeit von 1 nm (mittlere Anzeige) bestimmt und
läge der Meßwinkel bei etwa 20°, so kann das Meßergebnis
auch für beliebig viele und genaue Meßeinstellungen einen
statistischen Fehler von ± 1 nm nicht unterschreiten.
7. Die Größe des Fehlers ist aufgrund der Tangensfunktion
von der Größe des Meßwinkels selbst abhängig, so daß diese Angabe streng genommen nur für einen Meßwinkel von 20°
exakt gilt.
Als Abbruchkriterium für die Kalibrierung ist zu empfeh-
len, die Meßreihe fortzusetzen, bis die Angabe des Kalibrierfehlers 1/3 besser, 1/2 mal kleiner ist als die angestrebte Genauigkeit der Objektmessung.
8. Ist der Bezugswinkel ausreichend genau, wird mit Tasten
Anzeige:
9. Fehlerhafte Kalibrierungen müssen während des Kalibrier-
druck // die Kalibrierung abgebrochen. Der Rechner setzt
den Mittelwert des Bezugswinkels gleich Null und korrigiert die zuletzt ausgewiesene Geberposition nun bezogen
auf diesen Meßwinkel-Ausgangspunkt.
vorganges mit Taste /CLEAR/ bzw. nach Übergang zum Meßbetrieb durch die Tastenfolge /MM/ , /o/ , // n-mal gelöscht werben.

67
B-K σ'/
x
B-K s/
x
10.2. Mehrfaches Messen an einen Objekt - Serienmessung
• Wahl des Operationsmodus oder
(s. 7.2.5.1.)
Durchführung einer Meßreihe
1. Der Kompensator wird, ohne den Geber zu drehen, aus dem
Kompensatorschlitz so weit herausgezogen, daß der Kompensatorschaft den Strahlengang nicht mehr vignettiert.
2. Objektstelle auswählen, in Auslöschungslage drehen (Meß-
stelle dunkelgrau) und 45°-Rast am Tisch setzen. Objekt
um 45° (einmal rasten!) in beliebiger Richtung drehen.
3. Einschalten des Interferenzfilters, entsprechend der ge-
wählten Meßwellenlänge. Kompensator einschieben.
4. Der Geber wird nach rechts oder links gedreht, bis die
Objektstelle maximal abgedunkelt ist.
Auf Tastendruck /MESS/ errechnet der Prozessor den Gangunterschied (Anzeigefeld rechts).
Das Einmessen des Gangunterschieds durch wiederholtes
Einstellen am Geber bis zur Dunkelstellung kann beliebig
oft durch Tastendruck /MESS/ wiederholt werden, bis die
gewünschte Meßgenauigkeit (je nach Operationsmodewahl der
halbe Vertrauensbereich oder die Standardabweichung im
mittleren Teil der Anzeige) erreicht wird. Auf wiederholten Tastendruck /MESS/ berechnet das RETARMET hierbei den
Gangunterschiedsmittelwert R.
5. Grobe Meßfehler lassen sich durch die Tastenbetätigung
/CE/ aus einer Meßreihe eliminieren.
6. Bei Wechsel der Meßwellenlänge über die Tastenfolge
/MM/,/λ/ST/ n-mal, // kann eine neue Meßreihe unmittel-
bar angeschlossen werden, da der ermittelte Bezugswinkel
für die Messungen erhalten bleibt.
7. Ein Löschen der Meßreihe, ggf. der Speicherinhalte in SM1
bzw. SM2, oder von Klassierdaten erfolgt entsprechend der
Regeln 5.1.2., 5.1.4. und 5.1.5. durch den Tastendruck
/CLEAR/ nach Anzeige dieser Werte.

68
B-K x
8. Ein Übergang der Meßverfahren /B-K/ nach /B-S/ oder umge-
kehrt ist unmittelbar, d.h. ohne Neukalibrierung durch
die Tastenfolge /MM/,/MV/, n-mal // möglich.
10.3. Eliminieren geräteinterner Fehler
1. Da mit Drehkompensatoren Objekte mit sehr kleinen Gangun-
terschieden ausgemessen werden, bekommen geräteinterne
Gangunterschiedsanteile eine nicht mehr vernachlässigbare
Größe in Bezug auf den Objektgangunterschied.
Die das Meßergebnis beeinflussenden geräteinternen Gang-
unterschiedsanteile lassen sich mit einer zweiten Meßreihe am gleichen Objekt unter Verwendung der übergeordneten
Speicherebene SM1 wie folgt eliminieren:
2. Nach Abschluß der ersten Meßreihe wird der Mittelwert im
Speicher SM1 durch den Tastendruck /SM1/ aufgenommen.
3. Das Meßobjekt wird über die 45°-Rast durch zweimaliges
Rasten um 90° gedreht.
4. Eine zweite Meßreihe wird analog der ersten mit gleichem
Kompensatordrehsinn angeschlossen und nach Erreichen der
gleichen statistischen Genauigkeit im mittleren Anzeigeteil durch den Tastendruck /SM1/ in dieser Speicherebene
verrechnet.
Der ausgewiesene Mittelwert beider Meßreihen im rechten
Teil der Anzeige ist frei von geräteinternen Fehlergrößen.
Anmerkung: Es wird darauf hingewiesen, daß der berechnete
statistische Fehler in diesem Speicher in diesem Zusammenhang keinen Aussagewert besitzt.
10.4. Bestimmen aktueller Einzelergebnisse - Meßfolge-
• Wahl des Operationsmodus (s. 7.2.5.1.)
Durchführung einer Meßfolge
1. Nach dem Abarbeiten der Anweisungen unter 10.1. kann
ebenso wie im Abschnitt 10.2./l. bis 4. beschrieben der
Meßablauf erfolgen.

69
B-K dyn xx s
2. Auf Tastendruck /MESS/ errechnet der Prozessor den aktu-
ellen Gangunterschied (Anzeige rechts) und weist die Anzahl der Messungen aus (Anzeige links).
Gangunterschiedsänderungen werden durch Aufhellen der
Meßstelle ersichtlich und können durch Nachführen der
Konpensatorstellung kompensiert werden.
3. Eine automatische statistische Verarbeitung der aktuellen
Meßwerte erfolgt im Speicher SH1 und kann für Populationsbetrachtungen über die Taste /SM1/ abgerufen werden.
4. Das Löschen der Meßfolge erfolgt auf Tastendruck /CLEAR/;
das Eliminieren einzelner, fehlerhafter Meßwerte aus der
Meßfolge über die Taste /CE/.
Die Inhalte des Speichers SM1 und der Klassierspeicher
werden gelöscht nach dessen Abruf durch die Taste /CLEAR/.
10.5. Erfassen dynamischer Gangunterschiedsänderungen
• Wahl des Operationsmodus (s. 7.2.5.1.)
Durchführung einer Meßfolge
1. Voraussetzung für die Messung ist die Kompensatorkali-
brierung nach 10.1. und die Einstellung der Subtraktionslage zwischen Objekt und Kompensator entspr. 10.2./l. bis 4.
2. Die Änderung des Gangunterschieds wird durch die Aufhel-
lung an der Meßstelle ersichtlich und muß durch Nachdrehen am Kompensator kompensiert werden.
3. Das Auslösen einer Messung erfolgt automatisch im vorge-
gebenem Zeittakt, entsprechend der Eingabe nach Abschnitt
7.2.5.1.. Der Meßablauf ist analog zu den Ausführungen im
Abschnitt 8.3./2…6. und berücksichtigt die darauffolgenden Anmerkungen.
4. Der Anschluß eines Druckers zum Registrieren der Meßwerte
ist für die dynamische Meßweise eine Voraussetzung für
die Einmannbedienung.

70
B-S σ'/
x
B-S s/
x
11. Messung mit Drehkondensatoren nach BEAR - SCHMITT
Für den Meßbetrieb sind folgende Voraussetzungen zu schaffen:
• Kopplung des verwendeten MeGkompensators mit dem inkre-
mentalen Geber IGR-M3 nach Abschn. 5.2.
• Vereinbarungen
- Druckerinitialisierung (s. 7.2.1.)
- Wahl der Meßmethode /B-S/ (s. 7.2.4.1.)
- Wahl der Meßwellenlänge und der
zugehörigen Kompensatorkonstante (s. 7.2.4.2.3.)
- Wahl des Operationsmodus (s. 7.2.5.1.)
- Datenklassierung (s. 7.2.6.)
Der schematische Meßablauf ist in Tabelle 5 b) wiedergegeben. Zur Durchführung der Meßmethode ist eine Kompensatorkalibrierung erforderlich.
Der Kalibrierablauf ist in Tabelle 5 a) zusammengefaßt.
11.1. Anmerkung zur Meßmethode
Das Meßverfahren nach BEAR - SCHMITT ist für kleinste Objekte in einem objektfreien Umfeld vorteilhaft anwendbar. Hierbei wird der Kompensator über Drehung am IGR-M3 in eine solche Position gebracht, daß Umfeld und Präparat gleiche Helligkeit (Grauton) aufweisen.
Der Meßbereich des verwendeten Drehkompensators ist bei diesem Meßverfahren doppelt so groß, wie der angegebene Wert
der Kompensatorkonstanten.
Das Arbeitsprogramm nach BEAR - SCHMITT ist bis auf die o.g.
Besonderheiten des Einstellkriteriums während des Meßvorgangs in seiner Meßstrategie (Eingabe der Kompensatorkonstanten nach 7.2.4.2.3., Kalibriervorgang nach 10.1.,
Eliminierung geräteinterner Fehler nach 10.2.2.) mit dem
Verfahren nach BRACE -KÖHLER identisch.
11.2. Mehrfaches Messen an einem Objekt - Serienmessung
. Wahl des Operationsmodus oder
(s. 7.2.5.1.)

71
B-S dyn xx s
B-S x
Durchführung einer Meßreihe
Es gilt der Abschnitt 10.2./l. bis 8. mit o.g. Einstellkritrium.
11.3. Bestimmen aktueller Einzelergebnisse - Meßfolgen
• Wahl des Operationsmodus (s. 7.2.5.1.)
Durchführung einer Meßfolge
Es gilt der Abschnitt 10.3./l. bis 4. mit o.g. besonderem
Einstellkriterium.
11.4. Erfassen dynamischer Gangunterschiedsänderungen
• Wahl des Operationsmodus (s. 7.2.5.1.)
Durchführung einer Meßfolge
Es gilt der Abschnitt 10.4./1.... 4. mit dem genannten, be-
sonderen Einstellkriterium.
Anmerkung:
Der Übergang der Meßmethoden BEAR - SCHMITT nach BRACE - KÖHLER
(und umgekehrt) ist, da es sich eigentlich nur um zwei Meßverfahren einer Arbeitsmethodik handelt, unmittelbar, d.h.
ohne Neukalibrierung des Bezugswinkels durch die Tastenfolge
/MM/ , /MV/, n-mal // möglich.
12. Längenmessung mit binokularen Meßeinrichtungen
Dieses Programm dient zusammen mit der binokularen Meßeinrichtung oder der binokularen Meßeinrichtung pol zum digitalen Auswerten lateraler Objektgrößen.
Die Druckschrift 30-G0510 beschreibt die binokulare Meßein-
richtung und ihren Gebrauch.
Im mikroskopischen Zwischenbild wird die Meßmarke des Meßschraubenokulars vom Anfangs- zum Endpunkt der vergrößerten
Objektstruktur verschoben. Der IGR-M3 liefert eine der
Verschiebestrecke proportionale Impulszahl, die, mit der
Skalenkonstanten multipliziert, den Meßwert im Objektraum
in Mikrometern (µm) ergibt.

72
L MD ---- µm
L ST X y.yyy
L ST X-.---
Für den Meßbetrieb sind folgende Voraussetzungen zu schaffen:
• Kopplung der verwendeten binokularen Meßeinrichtung mit
dem inkrementalen Geber IGR-M3 nach Abschn. 5. ff.
• Vereinbarungen im Eingabeteil
- Druckerinitialisierung (s. 7.2.1.)
- Wahl der Meßmethode /!_/ (s. 7.2.4.1.)
- Wahl eines der Optikkombination
zugeordneten Arbeitsspeichers (s. 7.2.4.2.4.)
- Wahl des Operationsmodes (s. 7.2.5.1.)
- Datenklassierung (s. 7.2.6.)
Der schematische Meßablauf ist in Tabelle 6b zusammengefaßt.
Als Voraussetzung für die Längenmessung muß die genaue Skalenkonstante für die gewählte Optikkombination (Objektiv,
Tubuslinse) durch eine Kalibriermeßreihe bestimmt sein.
Das experimentelle Ermitteln der Skalenkcnstante berücksichtigt die unvermeidlichen Fertigungstoleranzen der verwendeten Optik- und Mechanikeinheiten.
Den schematischen Kalibrierablauf gibt Tabelle 6a wieder.
12.1. Bestimmen der Skalenkonstante - Kalibriervorgang
Der Kalibriervorgang wird eingeleitet durch den Tastendruck
/o/ im Anzeigebild oder
bei bereits vorhandenen aber nicht mehr aktuellen Werten y.yyy.
Der Tastendruck /o/ führt zum Anzeigebild ,
d.h. zur Aufforderung, eine Kalibrierstrecke (Meßdistanz)
festzulegen. Zur Kalibrierung selbst schließt sich nachfolgender Arbeitsablauf an:
1. Am Mikroskop ist die für die Messungen vorgesehene Kombi-
nation Objektiv - Tubuslinse herzustellen. Die Kalibrierstrecke wird zwischen zwei Teilstrichen einer Objektmeßplatte (dazu s. Druckschrift 30-0510) gewählt. Die beiden
Teilstriche sollten etwa bei den Teilungswerten 2 und 8
des Meßschraubenokulars liegen. Die Zahl der Skalenteile
zwischen den beiden ausgewählten Teilstrichen multipliziert mit dem Teilstrichabstand (z.B. 0,01 mm = 10 µm bei
den Objektmeßplatten 1/0,01) ergibt die Länge der Meßdistanz MD.

73
C .*
2. über die Zifferntastatur ist diese Strecke in Mikrometer
einzugeben. Fehleingaben können mit der Taste /CLEAR/ gelöscht werden.
3. Der Tastendruck // speichert die Meßdistanzvorgabe und
eröffnet die Kalibrierung mit Übergang zum Anzeigebild
.
Bei IGR-Betätigung zeigt das Zahlenfeld rechts die aktuelle Impulszahl i.
4. Durch Drehen am IGR-M3 wird entweder der Doppelstrich oder
die senkrechte gestrichelte Linie auf den Anfangsteilstrich der Kalibrierstrecke eingestellt.
Der Tastendruck /o/ setzt dort die aktuelle Impulszahl
gleich Null.
5. Durch Drehen am IGR-M3 wird die Meßmarke in gleicher Weise
auf den Endteilstrich der Kalibrierstrecke eingestellt.
Durch Tastendruck /MESS/ wird eine der Kalibrierstrecke
proportionale Impulszahl festgehalten und die aktuelle Impulszahl automatisch Null gesetzt.
6. Während der Kalibriermeßreihe können der Anfangs- und
Endteilstrich im Wechsel angefahren und jeweils die Taste
/MESS/ betätigt werden. Die automatische Nullung des Impulszählers erspart den Tastendruck /o/, wenn der Endpunkt einer Messung als Ausgangspunkt der nächsten, gegenläufigen Messung dient.
Der Anfangspunkt der nächsten Messung kann selbstverständlich auch frei eingestellt und durch den Tastendruck /o/
definiert werden.
Auf Tastendruck /MESS/ erscheinen im Zahlenfeld links die
Anzahl der Kalibriermeßwerte n, in der Mitte der prozentuale Vertrauensbereich und rechts der Impulsmittelwert i.
Bei Abwesenheit von systematischen Fehlern liegt die wah-
re Impulszahl mit einer statistischen Sicherheit von 95 %
um weniger als den angezeigten Prozentwert vom Impulsmittelwert entfernt.

74
L ST/
L ST Y -.---
L ST Y z.zzz
7. Die Skalenkonstante selbst wird automatisch im Speicher
SMl berechnet und kann zur Kontrolle abgerufen werden.
Auf Tastendruck /SM1/ zeigt das Zahlenfeld rechts diese
Konstante (Quotient aus Eichstrecke und Inpulsmittelwert
mit der Dimension Mikrometer im Objektraum pro Impuls),
in der Mitte den prozentualen Vertrauensbereich und links
die Nummer des benutzten Arbeitsspeichers.
8. Der letzte Kalibriermeßwert kann durch Taste /CE/ elimi-
niert werden. Liegt ein falscher Meßwert weiter zurück,
muß die laufende Kalibriermeßreihe durch einen Tastendruck /CLEAR/ gelöscht werden, wonach eine neue Kalibriermeßreihe mit der gleichen Meßdistanz zu beginnen ist
(s. weiter unter 12.1./ 4. ff.).
9. Durch Tastendruck // wird die Kalibriermeßreihe abge-
schlossen, wenn der prozentuale Vertrauensbereich dieser
Meßreihe für die Meßaufgabe ausreichend klein erscheint.
10. Mit Abschluß der Kalibrierung erscheint das Anzeigebild
. Es ist die Aufforderung zu entscheiden, ob
mit der soeben durchgeführten Kalibrierung für eine Optikkombination allein gearbeitet werden kann, oder ob
für weitere (bis zu 4) Optikkombinationen eine Kalibrierung durchgeführt werden muß.
Je nach Beantwortung dieser Frage durch entsprechende Ta-
stenbetätigung (siehe Regel 4.1.) wird mit // zu weiteren Abfragen des Eingabeteils übergegangen ,oder es erfolgt auf /λ/ST/ der Rücksprung zur Anzeige
bzw.
zwecks weiterer Kalibrierungen oder Eingaben .

75
L σ'/x
L s/x
12.2. Vorbemerkung zur Meßmethode
Abhängig von Ziel der Längenmessung ist zwischen 2 Meßpro-
grammen zu wählen: Wünscht man statistisch gesicherte Aussa-
gen über die einzelne Struktur (12.3.), so wird an jeder
Struktur eine Meßreihe ausgeführt.
Wünscht man dagegen vorrangig Aussagen über eine Population
gleichartiger Strukturen (12.4.), so wird an jeder Struktur
ein einziger Meßwert ermittelt und angezeigt. Der aktuelle
Mittelwert und die Standardabweichung als Kenngrößen der Po-
pulation sind jederzeit abrufbar.
12.3. Mehrfaches Messen einer Struktur - Serienmessung
• Wahl des Operationsmodus oder
nach Abschn. 7.2.5.1.
Voraussetzung für fehlerfreie Messungen ist, daß die richtige der aktuellen Vorwahl des Speichers ST X zugeordnete
Optikkombination verwendet wird.
Liegen noch keine Erfahrungen zur Meßaufgabe vor, werden Pro-
bemeßreihen empfohlen.
Anhand der Probemeßreihen lassen sich der mit vertretbarem
Aufwand erreichbare Vertrauensbereich bzw. die Mindestanzahl
von Meßwerten zum Erreichen eines geforderten Vertrauensbe-
reiches abschätzen und die Meßstrategie festlegen.
Durchführung einer Meßreihe
1. Durch Drehen am IGR-M3 wird eine geeignete Meßmarke auf
den Anfangspunkt der zu messenden Struktur eingestellt.
Der Tastendruck /o/ setzt die aktuelle Länge gleich Null.
2. Durch Drehen am Geber wird die Meßmarke zum Endpunkt der
Struktur verschoben, wobei das Zahlenfeld rechts die aktuelle Entfernung vom Anfangspunkt in Mikrometer anzeigt.
Deckt sich die Meßmarke mit dem Endpunkt, wird mit Tastendruck /MESS/ die aktuelle Länge als erster Meßwert
übernommen und dann die aktuelle Länge automatisch Null
gesetzt.

76
3. Während der Meßreihe an einer Struktur können der Anfangs
und Endpunkt im Wechsel angefahren und jeweils die Taste
/MESS/ oder die Fußtaste betätigt werden. Das automatische "0" - Setzen der aktuellen Länge erspart den Tastendruck /o/, wenn der Endpunkt einer Messung als Anfangspunkt der nächsten, gegenläufigen Messung dient.
Der Anfangspunkt der nächsten Messung kann selbstverständlich auch frei eingestellt und durch Tastendruck /o/
definiert werden.
Auf erneuten Tastendruck /MESS/ erscheinen im Zahlenfeld
links die Anzahl der Messungen n, in der Mitte der Vertrauensbereich σ' oder die Standardabweichung s (je nach
Operationsmodewahl) und rechts der Mittelwert x der Messungen in µm.
4. Die Messung an einer Struktur kann beliebig oft wieder-
holt werden.
Als Kriterium für das Ende der Meßreihe kann das Erreichen einer gewählten Anzahl von Meßwerten oder das Unterschreiten eines geforderten Vertrauensbereiches dienen.
5. Liegt eine Population gleichartiger Strukturen vor, wobei
statistische Aussagen zu dieser interessieren, so lassen
sich der Mittelwert x und die Standardabweichung s der
Strukturen durch Eingabe der Meßreihe in die übergeordneten Speicher SM1 oder SM2 bestimmen (s. 7.2.5.2.ff.)
6. Sind alle Strukturen einer Population vermessen und mit
Taste /SM1/ bzw. /SM2/ die Populationsdaten, bei Druckeranschluß ggf. durch Tastendruck /OUT/, registriert,
löscht der Tastendruck /CLEAR/ bei Anzeige des Speicherinhalts SM1 oder SM2 die Populationsdaten.
7. Für das Eliminieren grober Meßfehler durch /CE/, das Lö-
schen der Meßreihe und/oder der Speicherinhalte SM1 bzw.
SM2 über /CLEAR/ ggf. auch von Klassierdaten werden die
Regeln 5.2.1., 5.1.2., 5.K4. und 5.1.5. angewendet.

77
L x
12.4. Bestimmen aktueller Einzelergebnisse - Meßfolgen
(1. Version)
• Wahl des Operationsmodus
nach Abschn. 7.2.5.1.
Durchführung einer Meßfolge
1. Durch Drehen am IGR-M3 wird eine geeignete Meßmarke
auf den Anfangspunkt der ersten Struktur eingestellt. Der
Anzeigeaufforderung "o!" gemäß setzt der Tastendruck /o/
die aktuelle Länge gleich Null.
2. Durch Drehen am IGR-M3 wird die Meßmarke zum Endpunkt
der Struktur verschoben, wobei das Zahlenfeld rechts die
aktuelle Entfernung vom Anfangspunkt in Mikrometer anzeigt.
Deckt sich die Meßmarke mit dem Endpunkt, wird durch Ta-
stendruck /MESS/ die aktuelle Länge als erster Meßwert
festgehalten.
Achtung!
In dieser Version der Längenmessung erfolgt kein
automatisches Nullsetzen der aktuellen Länge
durch Taste /MESS/. Eine Ausweichlösung bietet
die 2. Version (s. 12.5.). Die Version 1 bietet
die Möglichkeit, mehrere aufeinanderfolgende Meßwerte auf den gleichen Anfangspunkt zu beziehen.
Unmittelbar nach Tastendruck /MESS/ ist das Nullsetzen der aktuellen Länge nicht möglich. Zwischen /MESS/- und /o/-Befehl muß der IGR-M3
betätigt werden.
3. Bei räumlich isolierten Strukturen muß nach der Messung
einer Struktur die Meßmarke auf den Anfangspunkt der
nächsten eingestellt und dort durch Tastendruck /o/ die
aktuelle Länge gleich Null gesetzt werden. Die Verschiebestrecke der Meßmarke zwischen Anfangs- und Endpunkt der
Struktur wird dann durch Tastendruck /MESS/ als Einzelwert in Mikrometer übernommen.
4. Der letzte Meßwert kann durch die Taste /CE/ eliminiert
werden.
5. Alle Meßergebnisse werden automatisch in den Speicher-
bereich SM1 übernommen.
Der Tastendruck /SM1/ ruft die Populationsdaten in die

78
L x
Anzeige. Das Zahlenfeld zeigt links die Anzahl der Ein-
zelmessungen n, in der Mitte die Standardabweichung s und
rechts den Mittelwert x aller Einzelmessungen.
Die Populationsdaten sind bei DruckeranschluB nach Tastendruck /SM1/ über /OUT/ zu registrieren.
6. Das Löschen der gesamten Meßfolge oder der Populationsda-
ten in SM1 erfolgt auf Tastendruck /CLEAR/ nach den Regeln 5.1.6.1. und 5.1.4..
12.5. Bestimmen aktueller Einzelergebnisse - Meßfolgen
(2. Version)
• Wahl des Operationsmodus
nach Abschn. 7.2.5.1.
Speziell für Routinearbeiten bringt die Bedienung der Tasten
/o/ und /MESS/ im ständigen Wechsel neben der Mikroskophandhabung und der Geberbetätigung Nachteile. Einen Ausweg bietet diese Version.
Voraussetzung ist die Benutzung eines Fußschalters am entsprechenden Eingang nach Abschn. 5..
Durchführung einer Meßfolge
1. Durch Drehen am IGR-M3 wird die Meßmarke auf den An-
fangspunkt der ersten Struktur eingestellt.
Der Aufforderung "0 !" gemäß wird nun per Fußschalter-
druck die aktuelle Länge gleich Null gesetzt.
2. Durch Drehen am Geber wird die Meßmarke zum Endpunkt der
Struktur verschoben.
Deckt sich die Meßmarke mit dem Endpunkt, wird erneut der
Fußschalter betätigt und die aktuelle Länge wird als erster Meßwert festgehalten.
3. Die Meßmarke kann nun mit dem Anfangspunkt eines weiteren
Meßobjekts zur Deckung gebracht werden.
Der nächste Fußschalterdruck wird wieder wie ein Tasten-
druck /o/ interpretiert.
Wenn sich nach erneuter Geberbetätigung die Meßmarke mit
dem Endpunkt der Struktur deckt, dann ergibt ein weiterer
Fußschalterdruck das Ergebnis des Objekts.
4. Die Ergebnisbehandlung und Auswertung ist analog dem Ab-
schnitt 12.4. Punkt 4 bis 6.

79
Anmerkung:
Die softwareseitige Sonderbehandlung für die Arbeitsweise
des Fußschalters, speziell für die Längenmeßroutine, ermöglicht es, beide Hände für Bedienvorgänge frei zu haben.
Das Null-Setzen des Geberwertes per Fußschalter ist durch
ein akustisches Signal gekennzeichnet.
Ein zwischenzeitliches Betätigen der Taste /o/ stört nicht
den Arbeitszyklus des Fußschalters. Der nachfolgende Fußschalterdruck wird logisch als "MESS" interpretiert.
13. Messung der Doppelbrechung
Diese Meßmethode ist eine Kombination von Gangunterschiedsund Längenmessung.
Mit verschiedenen Kompensatortypen kann der Gangunterschied
R des Meßobjekts erfaßt werden. Durch eine elektronische Umschaltung zum Längenmeßprogramm wird die Dicke L des Objekts
in Durchstrahlungsrichtung gemessen.
Der Rechner ermittelt aus beiden Meßergebnissen die Doppelbrechung des Objekts über die Beziehung R:L.
Notwendig für diese Meßmethode ist das Vorhandensein eines
Kippkompensators (oder des Digitalanalysators), einer binokularen Meßeinrichtung und bei Verwendung mit Kompensatoren
ein zweiter Geber IGR-M3. Für den Meßbetrieb sind folgende
Voraussetzungen zu schaffen!
• Bei Verwendung eines Kippkompensators Kopplung mit dem
Geber IGR-M3 nach 5.2.
• Kopplung der binokularen Meßeinrichtung mit einem zweiten
Geber IGR-M3 wie oben.
• Vereinbarungen
- Druckerinitialisierung (s. 7.2.1.)
- Wahl der Meßmethoden /R:L/ (s. 7.2.4.1.)

80
R:L STXX -.-----
R:L ST X y.yyyy
R:L σ'/
x
R:L s/
x
- Wahl einer Gangunterschiedsmeßvariante auf wiederholten
Tastendruck /MV/ mit Abschluß durch //.
(Symbolik analog 7.2.4.1. )
- Wahl der Meßwellenlänge
(s. 7.2.4.2., 7.2.4.2.1. oder 7.2.4.2.2.)
- Wahl eines der Optikkombination zugeordneten Arbeits-
speichers (s. 7.2.4.2. bzw. 7.2.4.2.4.)
ggf. Bestimmung der Skalenkonstante nach 13.1.
- Wahl des Operationsmodus (s. 7.2.5. bzw. 7.2.5.1.)
- Datenklassierung (s. 7.2.6.)
Der schematische Ablauf ist in Tabelle 7a) bzw. 7b) enthal-
ten. Der Kalibrierablauf zur Längenmessung ist der Tabelle
6a) zu entnehmen.
13.1. Meßvorbereitung
Zur Durchführung des Programmteils "Längenmessung" muß die
genaue Skalenkonstante für die gewählte Optikkombination
(Objektiv, Tubuslinse) bekannt sein.
Ist dies nicht der Fall, erfolgt deren Bestimmung durch eine
Kalibrierung, die eingeleitet wird durch den Tastendruck /o/
im Anzeigebild
oder
(bei nicht mehr aktuellen Werten y.yyy).
Der weitere Ablauf entspricht den Ausführungen unter 12.1.;
es ändern sich lediglich in den Anzeigebildern die Symbole
"L" in "R:L" und "C" in "C-L".
Wird zur Gangunterschiedsbestimmung die Meßmethode nach DE
SENARMONT angewendet, ist neben der Benutzung eines Digitalanalysators (nur am JENAPOL b vorhanden) die Justierung des
λ/4-Kompensators (Abschnitt 9.1.1.) und die Bestimmung des
Meßwinkels nach 9.1.2. Voraussetzung.
13.2. Mehrfaches Messen an einen Objekt - Serienmessung
• Wahl des Operationsmodus oder
nach Abschn. 7.2.5.1.

81
M .*
M-L .*
1 # .00xxx
Durchführung einer Meßreihe
1. Die Messung beginnt stets mit der Gangunterschiedsbestim-
mung über das Anzeigebild
2. Je nach verwendeter Meßvariante (MV) wird der weitere Ar-
beitsablauf für Kippkompensatoren entsprechend Abschn.
8.1. bzw. für SENARMONT-Messungen nach 9.1.2. und 9.2./1.
... 3.5 bestimmt.
3. Besitzt die Serienmessung die angestrebte Genauigkeit
(s oder σ')wird der Gangunterschiedsendwert auf Tasten-
druck /S/S/ gespeichert, und der Rechner gibt mit dem Anzeigebild den Geber an der binokularen Meßeinrichtung zur Längen- oder Dickenbestimmung frei.
4. Bei Fasern als Untersuchungsobjekte kann die Längen-
(Dicken-) Messung aufgrund des kreisförmigen Querschnitts
unmittelbar begonnen werden.
Kristallindividuen (an der Kristalldreheinrichtung) sind
zur Dickenmessung in Durchstrahlungsrichtung um 90° zu
drehen.
5. Die Serienmessung zur Bestimmung der Objektdicke erfolgt
nach den Anweisungen im Abschnitt 12.3./1. … 4. bis die
angestrebte Genauigkeit (σ' oder s) erreicht wurde.
6. Ein zweiter Tastendruck /S/S/ verrechnet die Endwerte
In der Anzeige erscheint rechts die Dop-
pelbrechung, gekennzeichnet durch das Symbol "#" und
links die Anzahl der ausgemessenen Objekte.
Mit dieser Berechnung sperrt der Rechner automatisch den
Längenmeßgeber und gibt den Kompensatorgeber wieder frei
zur erneuten Bestimmung der Doppelbrechung an weiteren
Objekten bzw. Objektstellen.
(Auf dem Ausdruck wird diesem Ergebnis ein "R:L" vorangestellt, und für den automatischen Ausdruckbetrieb nach
7.3.1.2. b erfolgt eine Trennung durch Leerzeilen zu den
Ergebnissen der Serienmessungen). Für spezielle Auswertungen werden die Ergebnisse aller Doppelbrechungsbestimmungen sowie die Endergebnisse der Dickenmessungen in
den Speichern SM1 und SM2 gemittelt und statistisch bearbeitet.
beider Meßreihen.
Diese Resultate können an beliebiger Stelle des Meßprogramms über die Tasten /SM1/ bzw. /SM2/ abgerufen werden.

82
R:L x
M .*
M-L .*
Anmerkung:
Für Serien mit über 99 Meßergebnissen reicht der Anzeigebereich für die Anzahl der Messungen in SM1 nicht mehr aus. In
der Anzeige werden dann nur die zwei rechten Stellen wiedergegeben.
Bei Datenprotokollen wird wieder die korrekte Anzahl der
Messungen ausgedruckt.
13.3. Bestimmen aktueller Einzelergebnisse – Meßfolgen
• Wahl des Operationsmodus nach 7.2.5.1.
Speziell für die Forschung und Produktionsüberwachung in der
Faserindustrie wurde die Bestimmung der Doppelbrechung modifiziert.
Zur Ermittlung der Eigenschaften entlang der Faserachse ist
jeweils eine Gangunterschieds- und Längen(Dicken-) Messung
ausreichend.
Durchführung einer Meßfolge
1. Die Messung beginnt mit der Gangunterschiedsbestimmung.
Anzeigebild
2. Je nach Meßvariante schließt sich der Arbeitsablauf für
Kipp-Kompensatoren entsprechend Abschnitt 8.1./1. ... 9.
bzw. für SENARMONT-Messungen nach 9.1.2. und 9.2./1., 2.
an.
3. Mit dem Tastendruck /MESS/ erscheint das Anzeigebild
. Dabei wird der Gangunterschied berechnet,
gespeichert sowie der Geber zur Längenmessung freigegeben. Der berechnete Wert selbst wird, da er nur Hilfsgröße für die Doppelbrechungsbestimmung ist, nicht angezeigt.
4. Eine Dickenmessung der Faser wird entsprechend 12.3./l. …
2. angeschlossen.
5. Mit dem Tastendruck /MESS/ wird sofort die Doppelbrechung
bestimmt und analog der Anzeige unter 13.2./6. ausgewiesen. Durch Zurückschalten auf den Kompensatorgeber können
weitere Messungen an anderen Orten der Faser durchgeführt
werden.

83
x
Nr.
R:L
L
1 .01563
256.0um
2 .01052
420.0um
3 .01137
366.0um
4 .00875
389.0um
5 .01067
350.0um
SM1
5
.00317 .01139
SM2
5
62 356.2um
n # .00xxx
6. Mittelwert
sind im Speicher SM2, bzw. der Doppelbrechungsbestimmungen
im Speicher SM1 berechnet, und somit über die Tasten /SM1/
bzw. /SM2/ abrufbar. (Anmerkung siehe 13.2./7.).
7. Grobe Meßfehler können im Anzeigebild über
die Taste /CE/ gelöscht werden.
Die Meßfolge insgesamt wird über Taste /CLEAR/ gelöscht.
8. Als Besonderheit wurde das Druckbild bei automatischem
Ergebnisausdruck nach. 7.3.1.2. b so abgewandelt, daß wichtige zueinandergehörende Daten [Δn und d (L )] nebeneinander
stehen. (Siehe Druckerauszug eines Beispiels!)
und Standardabweichung s der Dickenmessungen
14. Subjektive interferometrische Messung
Dieses Programm dient an den Mikroskopen JENAPOL-, JENAVERTund JENAVAL interphako zum rationellen Erfassen interferometrischer Gangunterschiede.
Das Ausmessen anisotroper Objekte in bestimmten, definierten
Präparatlagen erfolgt am JENAPOL interphako unter Verwendung
polarisationsoptischer Kriterien für die Objektorientierung.
Für den Meßbetrieb sind folgende Voraussetzungen zu schaffen:

84
• Anschluß des inkrementalen translatorischen Gebers IGT (in
den Interferenztubus integrierte Baueinheit) (s. 5.1.).
• Vereinbarungen
- Druckerinitialisierung (s. 7.2.1.)
- Wahl der Meßmethode /INT/ (s. 7.2.4.1.)
- Wahl der Meßwellenlänge mit Vorgabe einer Gerätekon-
stante (s. 7.2.4.2. und 7.2.4.2.5.),
ggf. Bestimmung der Konstanten nach 14.2.
- Wahl des Operationsmodus (s. 7.2.5. bzw. 7.2.5.1.)
- Wahl einer Verfahrenskonstante (s. 7.2.5.3.)
- Datenklassierung (s. 7.2.6.)
Der schematische Meßablauf ist in Tabelle 8b) zusammengefaßt.
Den Kalibriervorgang zur Bestimmung der Gerätekonstante enthält die Tabelle 8a).
14.1. Vorbemerkung
Für o.g. Geräte wird ein Werksprotokoll geliefert, in dem
die Konstanten (hier Impulskonstanten genannt) für die Wellenlängen F, e, D, C enthalten sind.
Diese Werte sind auf die Benutzung mit dem DIGIMIN abgestimmt und müssen bei Verwendung des RETARMET 2 halbiert
werden. Für Interferenzfilter mit abweichendem Wellenlängen-
schwerpunkt (λ
) bzw. für andere Wellenlängen ist eine
max
Neubestimmung der Konstante erforderlich.
Achtung!
Die Eingabe oder Neubestimmung von Gerätekonstanten in den Meßmethoden /INT/ oder /VEL/ (Abschnitt 15) gilt für beide Methoden gleichwertig,
d.h. Wertevorgaben in der Meßmethode /INT/ erscheinen bei Abruf der Wellenlängen über /λ/ST/
auch in der Meßmethode /VEL/ und umgekehrt. Neubestimmungen in einer dieser Meßmethode überschreiben auch die Daten für die andere Methode!

85
INT XXX -.----
INT XXX y.yyyy
INT ---.-
INT MD - λ
C .*
Die Geräte sind zur Kalibrierung der Konstante entsprechend
GA 30-G0320-1 bzw. 30-G0062-1 herzurichten.
Erforderlich sind:
Objektiv 20x bzw. 25x,
Shearingeinsatz,
monochromatisches Licht mit dem gewählten Filter,
Streifenfeld
(ca. 10 Streifen im Bild) bei Bildaufspaltung "0",
ca. eine Stunde Einlaufzeit.
Schwankungen der Raumtemperatur von > 2 K/h sind zu vermeiden.
Zur Beleuchtung sind weder Spalt noch Gitter zu verwenden.
14.2. Bestimmung der Gerätekonstante - Kalibriervorgang
1. Die Kalibrierung wird durch den Tastendruck /o/ im Anzeigebild
oder eingeleitet.
(XXX ≙ Meßwellenlänge, aufgerufen über Taste / λ/ST/ ,
yyy ≙ einer nicht mehr aktuellen Gerätekonstante).
2. Für eine frei wählbare Wellenlänge ist nach 5maligem Ta-
stendruck / λ/ST/ im Anzeigebild die Eingabe
der Schwerpunktwellenlänge entsprechend der Angabe des
Filterherstellers vorzunehmen und mit // abzuschließen.
3. Auf Tastendruck /o/ erscheint die Anzeige
Sie fordert auf, eine Kalibrierstrecke (Meßdistanz) in
" λ" vorzugeben.
Für die genaue Bestimmung der Konstante ist über mehrere
Wellenlängen (z.B. 6 λ) zu kalibrieren.
Die Eingabe erfolgt über die Tastenfolge /0...9/ , //.
Fehleingaben können auf Tastendruck /CLEAR/ vor // gelöscht werden.
4. Die Anzeige fordert durch IGT-Betätigung den
Beginn der Kalibriermeßreihe.
5. Damit die Messung im mittleren Arbeitsbereich des Fein-
phasenschiebers erfolgt, wird er vorsichtig nach links
oder rechts bis zum Anschlag gedreht.
Die Taste /o/ setzt den Geberwert gleich Null.
Am IGT (Feinphasenschieber) wird gedreht bis die Anzeige
- 4500 i oder 4500 i erscheint.

86
1 xxxx i
6. Interferenzfilter ausschalten .
Mit den Grobphasenschieber den kräftigsten Interferenzstreifen (1. Ordnung) in Dingfeldmitte (auf dem Fadenkreuz) abbilden. Interferenzfilter wieder einschalten.
Bestmöglichen Kontrast der Streifen durch Kontrolle der
Aufspaltung und Beleuchtung einstellen. Streifen parallel
zum waagerechten Strich des Fadenkreuzes ausrichten.
7. Interferenzbild um 3 Ordnungen (3 Streifen) durch Drehen
am IGT nach oben verschieben.
8. Intensitätsminimum des Streifens genau mittig zum Faden-
kreuz ausrichten.
9. Geberwert durch Tastendruck /o/ gleich Null setzen.
10. Durch Geberdrehung werden im mikroskopischen Bild sechs
Interferenzstreifen nach unten verschoben.
11. Wiederholung des Punktes 8, danach Taste /MESS/ betäti-
gen. Die Anzeige gibt die Anzahl der Im-
pulse i wieder, der 6 λ zugeordnet sind.
12. Die Kalibrierung kann beliebig oft wiederholt werden, in-
dem durch IGT-Drehung das Interferenzbild nun um 6 Ordnungen nach oben verschoben und Punkt 11 angeschlossen
wird. Die letzte Einstellung am IGT dient als Ausgangspunkt der nächsten, gegenläufigen Messung, da mit jedem
Tastendruck /MESS/ eine automatische Nullung des Impulszählers erfolgt. (Der Anfangspunkt der Messungen kann
ggf. auch durch den Tastendruck /o/ jedesmal neu definiert werden.)
Auf Tastendruck /MESS/ erscheint nun in der Anzeige links
die Anzahl der Kalibrierungen, in der Mitte der prozentuale (halbe) Vertrauensbereich und rechts der Impulsmittelwert.
13. Die Gerätekonstante selbst wird automatisch im Speicher
SM1 berechnet und kann zur Kontrolle über den Tastendruck
/SM1/ abgerufen werden. Diese Anzeige enthält neben der
berechneten Konstante (rechts), den statistischen Fehler
der Kalibriermeßreihe (Mitte) und die zugehörige Wellenlänge (links).

87
INT λ/
INT OM
INT σ'/
x
INT s/
x
14. Bei groben Meßfehlern kann der letzte Kalibrierwert durch
die Taste /CE/ eliminiert werden. Liegt ein fehlerhaftes
Ergebnis weiter zurück, muß die gesamte Meßreihe durch
/CLEAR/ verworfen werden.
15. Wenn der prozentuale Vertrauensbereich einen ausreichend
kleinen Wert annimmt (angestrebt sind etwa 0,02%), wird
die Kalibrierung durch den Tastendruck // beendet.
16. Mit Abschluß einer Kalibrierung erscheint die Anzeige
Dieses Bild fordert zur Entscheidung auf, ob mit der so-
eben bestimmten Konstante für eine Wellenlänge gearbeitet
werden kann (dann Taste //), oder ob Messungen bei weiteren Wellenlängen zu erwarten sind. (Mit Taste /λ/ST/
nächste Wellenlänge aufrufen, und die Kalibrierung wiederholen). Der Kalibrierabschluß auf Tastendruck //
führt zur Anzeige (blinkend),
d.h. zur Aufforderung mit wiederholtem Tastendruck /OM/
einen Operationsmode zu wählen.
14.3. Mehrfaches Messen an einem Objekt - Serienmessung
• Wahl des Operationsmodus oder
nach Abschn. 7.2.5.1.
Es sind zwei Möglichkeiten für die Messung zu empfehlen!
• Das Arbeiten im Streifenfeld (Shearing-Verfahren) ermög-
licht einen schnellen Überblick über die Gangunterschiedsgröße im Objekt.
• Für genaue Messungen ist der Abgleich mittels einer Halb-
schattenplatte vorzuziehen.
Um das Vorzeichen der Messungen richtig interpretieren zu
können, gelten folgende Regeln:
- Das Vorzeichen ist positiv,
wenn im Durchlicht die Objektbrechzahl bzw. Objektdicke
größer ist, als die der Vergleichsstelle,
wenn im Auflicht Vertiefungen oder bei transparenten
Strukturen höhere Brechzahlen, als die der Vergleichs-
stelle auftreten.

88
(Achtung: Im Auflicht sind Phasensprünge an unterschiedlichen Materialien zu beachten!)
- Der Meßablauf beginnt an der Vergleichsstelle (Umgebung)
und wird fortgesetzt im unbeweglichen Doppelbild oder beginnt im beweglichen und wird fortgesetzt im unbeweglichen Teilbild für das Shearing-Verfahren bzw. von der Umgebung zum Objektbild beim Interphako-Verfahren.
Durchführung einer Meßreihe
a) im Streifenfeld zwischen Umgebung und Meßobjekt.
1. Meßstelle im Objekt in der Fadenkreuzmitte abbilden.
2. Aufspaltung, Streifenausrichtung (waagerecht) und Kon-
trast entsprechend den Gerätegebrauchsanleitungen optimieren.
3. In unmittelbarer Umgebung des Meßobjekts wird ein Strei-
fen der 1. Ordnung durch Drehen am Feinphasenschieber
(IGT) so verschoben, bis sein Intensitätsminimum exakt
auf dem waagerechten Teil des Fadenkreuzes abgebildet
ist.
4. Interferenzfilter der gewählten Meßwellenlänge ein-
schalten und die unter Pkt. 3 genannte Einstellung optimieren.
5. Am RETARMET entsprechend der Anzeigeaufforderung "0!"
durch die Taste /o/ den Zählerstand des Gebers gleich
Null setzen.
6. Interferenzfilter ausschalten, und den Verlauf des ge-
wählten Streifens ins Objekt (am unbeweglichen Teilbild) verfolgen.
Durch Drehen am Feinphasenschieber (IGT) diesen Strei-
fen im o.g. Doppelbild in die Fadenkreuzmitte verschieben, und nach Einschalten des Interferenzfilters die
Einstellung analog Punkt 3 optimieren.
7. Auf Tastendruck /MESS/ wird am RETARMET 2 die erste
Messung abgeschlossen.
Das Vorzeichen drückt das Brechzahlverhältnis zur Um-
gebung aus (siehe 14.3.).
8. Die Messung kann beliebig oft nach Punkt 3., 4. bzw.
6., jeweils gefolgt von /MESS/, wiederholt werden.

89
Die letzte Einstellung am Geber dient als Ausgangspunkt
der nächsten, gegenläufigen Meßeinstellung, da über
/MESS/ ein automatisches Nullen des Gebers erfolgt (der
Ausgangspunkt jeder Messung kann ggf. auch durch den
Tastendruck /o/ jedesmal neu definiert werden).
In der Anzeige erscheint links die Anzahl der Messungen, in der Mitte der statistische Fehler, berechnet
entsprechend der Operationsmode-Vorgabe, und rechts der
Mittelwert der Meßreihe. Das Vorzeichen bleibt bei Ergebnisberechnung unabhängig von der Drehrichtung des
Gebers entsprechend Punkt 7. erhalten.
9. Grobe Meßfehler werden auf Tastendruck /CE/ aus der
Meßreihe beseitigt. Die Meßreihe selbst kann über
/CLEAR/ gelöscht werden.
Anmerkung:
Neben der Messung von Umgebung zu Teilbild kann bei Vorgabe
einer Verfahrenskonstanten 0,5 auch zwischen beiden Teilbildern gemessen werden. Die Einstellung unter Punkt 3. für die
Umgebung erfolgt nun am beweglichen Teilbild.
b) im homogenen Feld mit Halbschattenplatte
1. Meßstelle auf der Fadenkreuzmitte abbilden.
2. Arbeiten im homogenen, streifenfreien Feld mit mono-
chromatischem Licht und Gitterblende.
Objektiv, Gitter und Aufspaltung so wählen, daß ein
optimaler Kontrast erreicht wird, wenn die Doppelbilder der Meßstelle möglichst getrennt erscheinen (Handhabung siehe Gerätegebrauchsanweisungen).
3. Halbschattenplatte soweit einschieben, daß das unbe-
wegliche Teilbild durch eine ihrer Kanten etwa halbiert wird.
4. Feinphasenschieber drehen, bis Halbschatten-"Balken"
und die unmittelbare Umgebung des Meßobjekts in gleicher Dunkelheit erscheinen.
5. RETARMET-2-Zählerstand durch die Taste /o/ gleich Null
setzen.

90
INT x
6. Durch Drehen am Feinphasenschieber (IGT) die beiden,
durch die Kante der Halbschattenplatte getrennten
Hälften des unbeweglichen Doppelbildes so angleichen,
daß diese auch in gleicher Dunkelheit erscheinen.
7. Das Ergebnis wird auf Tastendruck /MESS/ berechnet,
analog dem Abschnitt 14.3. a, Punkt 7. ... 9.
14.4. Bestimmung aktueller Einzelergebnisse – Meßfolgen
• Wahl des Operationsmodus nach 7.2.5.1.
Diese Meßweise ist geeignet zur Gangunterschiedsprofildar-
stellung über gut profilierte Objekte größerer Ausdehnung so-
wie zur Bestimmung von Gangunterschiedsänderungen durch be-
stimmte Einflußfaktoren, die auf das Objekt einwirken.
• Einen Überblick des Objektprofils erhält man bei Spalt-
blendenbeleuchtung, totaler Aufspaltung (aneinandergrenzendes Doppelbild des Objekts) und bei sehr engem Streifenabstand. Der Grobphasenschieber ist dabei so zu verstellen, daß der Streifen 1. Ordnung durch das Meßobjekt
verläuft. Die Auslenkung des Streifens ist ein Maß für
die Gangunterschiedsänderung im Objekt.
• Ein analoger Meßvorgang, wie im Abschnitt 14.3.a be-
schrieben (Rückführung der Streifenauslenkung auf den gemeinsamen Bezug - waagerechtes Fadenkreuzteil), ist zwar
denkbar, führt aber zu ungenauen Ergebnissen.
• Günstiger sind die Resultate bei oben genannter Aufspal-
tung aber im homogenen, streifenfreien Feld. Diese Meßweise wird im anschließenden Abschnitt erläutert.
• Auch für gering profiliertere Proben ergibt die Anwendung
des VELOMET-2 (s. Abschn. 15.3.) exakte Werte.
Durchführung einer Meßfolge
1. Homogenes Feld und Objektaufspaltung wie o.g. einstellen.
2. Bei örtlichen Änderungen des Gangunterschieds (Profilen)
einen markanten Ausgangspunkt in der Probe suchen. Bei

91
1 .Onm
zeitlichen Änderungen (durch Einflußgrößen) ist die zu
beobachtende Meßstelle aufzusuchen. Für beide Möglichkeiten wird durch den Feinphasenschieber (IGT) die Farbe der
ersten oder der zweiten Ordnung teinte sensible an den
o.g. Meßstellen eingestellt.
3. Am RETARMET 2 durch Tastendruck /o/ die Ausgangsposition
als Null definieren. Die Anzeige weist diese Einstellung
als ersten Meßwert mit der Größe "Null" aus.
4. Bei Änderung des Farbeindruckes an einer benachbarten Ob-
jektstelle (Profildarstellung) oder bei Farbänderunq bedingt durch die Einflußgröße wird diese Änderung durch
Verstellen am Feinphasenschieber kompensiert, bis der ursprüngliche Farbton erneut eingestellt ist.
5. Auf Tastendruck /MESS/ erfolgt die Berechnung der Gangun-
terschiedsänderungen, bezogen auf die Ausgangsposition.
Das Vorzeichen bestimmt die Richtung dieser Änderung.
6. Punkt 4 und 5 können beliebig oft wiederholt werden, wo-
bei mit jedem Tastendruck /MESS/ automatisch der Geberstand des IGT erneut Null gesetzt wird.
Dies bedeutet, daß jede Folgemessung sich stets auf die
unmittelbar vorangegangene als Ausgangsposition bezieht.
7. Für eine Rauhigkeitsanalyse findet automatisch eine
statistische Verarbeitung der aktuellen Meßwerte im Speicher SM1 statt. Der Abruf dieser Daten erfolgt über die
Taste /SM1/.
8. Das Löschen der Meßfolge kann mittels Tastendruck /CLEAR/
erfolgen. Einzelne, fehlerhafte Meßergebnisse können
durch /CE/ eliminiert werden.
15. Objektivierte interferometrische Messung
Dieses Meßprogramm nutzt den Abgleichindikator VELOMET-2 zur
Meßerleichterung und zur Steigerung der Meßgenauigkeit beim
Bestimmen interferometrischer Gangunterschiede.
Für den Meßbetrieb sind folgende Voraussetzungen zu schaffen:

92
VEL ---.-
• Anschluß des inkrementalen translatorischen Gebers IGT
(siehe 5.1.)
• Anschluß des VELOMET 2 und des SLC-1OO an das Mikroskop
(siehe Geräte-GA)
• Vereinbarungen
- Druckerinitialisierung (s. 7.2.1.)
- Wahl der Meßmethode /VEL/ (s. 7.2.4.1.)
- Wahl der Meßwellenlänge mit Vorgabe einer Gerätekon-
stante (s. 7.2.4.2. und 7.2.4.2.5.),
ggf. Bestimmung der Konstante nach 15.1.
- Wahl des Operationsmodus (s. 7.2.5. bzw. 7.2.5.1.)
- Wahl einer Verfahrenskonstante (s. 7.2.5.3.)
- Datenklassierung (s. 7.2.6.)
Der schematische Meßablauf ist in Tabelle 9 b),
der Kalibriervorgang zur Bestimmung der Gerätekonstante in
Tabelle 9 a) zusammengefaßt.
Auch für diese Meßmethoden sind die im Abschnitt 14.1. angegebenen Vorbemerkungen voll gültig und zu beachten!
Ist eine Kalibrierung der Gerätekonstante erforderlich, sind
die gleichen Voraussetzungen wie unter 14.1. am Gerät zu re-
alisieren!
1. VELOMET 2 einschalten; Einlaufzeit von 1 Stunde beachten!
2. Durch wiederholten Tastendruck /MM/ am RETARMET 2 zunächst
3. Durch Tastenfolge /MM/ 2x, // zur Meßmethode /VEL/
15.1. Bestimmung der Gerätekonstante - Kalibriervorgang
auf die Meßmethode /INT/ übergehen, mit // bestätigen.
Mit Taste /λ/ST/, gefolgt von //, eine beliebige Wellen-
länge wählen und zum Kalibrierprogramm durch die Tastenfolge /o/ , /l/ , // übergehen.
Die Arbeitsschritte 5 und 6 des Abschnittes 14.2. ohne
Interferenzfilter durchführen.
wechseln.
Die Meßwellenlänge durch die Taste /λ/ST/ wählen. Für ei-
ne frei wählbare Wellenlänge ist nach 5maligem Tastendruck /λ/ST/ im Anzeigebild die Eingabe
der Schwerpunktwellenlänge lt. Filterhersteller vorzunehmen, gefolgt von //.

93
C S/S
C 0! xx
C x
4. Große Meßblende einschalten.
(Als Bezugspunkt für die Sehfeldmitte dient nun die Blen-
de, statt des Fadenkreuzes!)
5. Es folgen die Arbeitsschritte 3, 4, 7 des Abschnittes 14.2.
Für den Punkt 7 ist das Interferenzfilter, entsprechend
der Meßwellenlänge einzuschalten.
6. Mit der Betätigung des Phasenschiebers erscheint die An-
zeige blinkend.
Der Aufforderung gemäß wird der Phasenschwinger durch die
Taste /S/S/ aktiviert; das Interferenzstreifensystem im
Mikroskopbild wird dabei verfahrensbedingt flau.
7. Warten bis der Einschwingvorgang durch den Wechsel
"C" ═══► "CS" im Anzeiqebild vollzogen ist.
8. Feinphasenschieber drehen, bis die Anzeige "xx" am RETAR-
MET ihren maximalen positiven Wert erreicht. (Bei negativen Werten Drehsinn am Phasenschieber ändern!)
9. Mit Potentiometer am VELOMET 2 die RETARMET-Anzeige unge-
fähr auf 2 0 0 einstellen.
10. Phasenschieber (IGT) im entgegengesetzten Sinn drehen,
bis das Analogsignal xx Null ausweist, danach Taste /o/
betätigen.
Anzeigeübergang zum Bild:
11. In der Anzeige stellt "x" den spontan erfaßten Analogwert
Dabei ist eine 10 mV Anzeigesperre zu überwinden, d.h.
mit Tastendruck /o/ dar.
Sollte diese Momentananzeige um +/- 2 von Null abweichen,
kann durch erneuten Tastendruck /S/S/ die aktuelle Analogsignalanzeige nochmal auf ihre korrekte Nulleinstellung geprüft, ggf. am Feinphasenschieber korrigiert und
durch Taste /o/ neu fixiert werden.
der Phasenschieber ist soweit zu drehen, bis der Anzeigewechsel "C-" ═══► "CS" ersichtlich ist.

94
C S/S
C - xx
l xxxx i
12. Die Taste /S/S/, dann ein- oder zweimal betätigt, stoppt
den Phaserischwinger (Anzeige: ); im Mikroskop
erscheint das Interferenzstreifenbild wieder kontrast-
reich.
13. Durch den Feinphasenschieber ist das Interferenzbild um
6 Streifen nach unten zu verschieben und das Intensitätsminimum des Streifens auf der Meßblende abzubilden.
14. Mit dem Tastendruck /S/S/ den Schwinger erneut starten.
Anzeige:
Mit Geberbetätigung wechselt die Anzeige: "C-" ═══► "CS".
Das Analogsignal ist erneut auf den Wert Null abzuglei-
chen. Auch hier ist analog Punkt 12. durch Tastendruck
/S/S/ eine Kontrolle der aktuellen Analogsignalanzeige
möglich und ratsam.
Ergibt dies größere Abweichungen von Null durch Drift
oder Signalrauschen, wurde die Einlaufzeit nicht eingehalten bzw. die Signalverstärkung ist zu hoch.
15. Der Tastendruck /MESS/ schließt den ersten Kalibriervor-
gang mit der Anzeige ab.
Dargestellt wird die Anzahl der Geberimpulse, der 6λ
zugeordnet sind.
16. Die Kalibrierung kann beliebig oft wiederholt werden, in-
Die letzte IGT-Einstellung dient als Ausgangspunkt der
(Der Anfangspunkt kann ggf. auch durch den Tastendruck
In der Anzeige erscheint auf /MESS/ die Zahl der Kalib-
dem der Schwinger mit Tastendruck [/S/S/ 2x] gestoppt,
durch Drehen am Feinphasenschieber das Interferenzbild
nun um 6 Ordnungen nach oben verschoben, das Intensitätsminimum des Streifens erneut über der Meßblende ausgerichtet wird und die Punkte 14, 15 und 16 wiederholt werden.
nächsten, gegenläufigen Messung, da jeder Tastendruck
/MESS/ den Zählerstand automatisch "Null" setzt.
/o/ jedesmal neu definiert werden).
riervorgänge (links), der prozentuale Vertrauensbereich
(Mitte) und der Impulsmittelwert (rechts).

95
VEL λ/
VEL σ'/x
VEL s/x
17. Die Gerätekonstante wird im Speicher SM1 automatisch be-
rechnet und gespeichert. (Weiteres siehe Abschn. 14.2./13)
18. Das Eliminieren grober Meßfehler erfolgt analog 14.2./14
durch /CE/.
19. Als Abbruchkriterium dient das Erreichen von 0,02% des
ausgewiesenen Vertrauensbereichs. Die Kalibrierung wird
dann mit Tastendruck // abgebrochen, und führt zum Anzeigebild analog dem Abschnitt 14.2./16.
15.2. Mehrfaches Messen an einem Objekt - Serienmessung
• Wahl des Operationsmodus oder
nach Abschnitt 7.2.5.1.
Um den Einfluß unvermeidlicher Drifterscheinungen bei Geräteerwärmung auf die Meßergebnisse auszuschließen, sollte eine Einlaufzeit von 1 Stunde eingehalten werden.
Die Messungen erfolgen sowohl bei Shearing- als auch beim
Interphako-Verfahren stets im Streifenfeld.
Die Gangunterschiedsrelation zur Vergleichsstelle wird durch
das Vorzeichen der Meßgröße bestimmt.
Darauf abgestimmt ist der Meßablauf.
Über beide Aspekte gibt der Abschnitt 14.3. Auskunft.
Durchführung einer Meßreihe
1. Meßstelle im Objekt in die Fadenkreuzmitte schieben.
2. - Streifen waagerecht zum Fadenkreuz ausrichten,
- Meßblende am Mikroskop in den Strahlengang bringen.
Bei Shearing-Verfahren Aufspaltung mindestens so groß
wählen, daß die gewünschte Blende im unbeweglichen Teil
des Doppelbildes abgebildet werden kann.
Beim Interphako-Verfahren ist zu beachten, daß die Mes-
sung unmittelbar am Übergang Umgebung/Objekt erfolgen
muß. Die Meßeinstellung soll von der Bereichsmitte des
Feinphasenschiebers ausgehen (ggf. entsprechend 15.1./2.
prüfen und Einstellung korrigieren; die Meßblende kennzeichnet die Sehfeldmitte). Optimalen Kontrast der
Streifen nach den Hinweisen der Gerätegebrauchsanleitung
einstellen.

96
M S/S
M 0! xx
3. In unmittelbarer Umgebung des Meßobjekts wird ein Strei-
fen 1. Ordnung durch Drehen am Feinphasenschieber auf der
Meßblende abgebildet.
4. Interferenzfilter der gewählten Meßwellenlänge einschalten.
5. Mit Betätigung des Phasenschiebers erscheint die Anzeige
blinkend.
Sie fordert auf, durch Tastendruck /S/S/ den Phasenschwin-
ger einzuschalten; das Interferenzstreifensystem im Mikroskopbild wird verfahrensbedingt flau.
6. Warten bis der Einschwingvorgang durch den Anzeigewechsel
"M" ═══► "MS" im Bild vollzogen ist.
7. Es folgen die Arbeitsschritte 8 bis 12 des Abschnitts
15.1.. (Statt der beschriebenen Anzeigen mit dem Symbol
"C" erscheint nun "M").
Ergibt die Kontrolle größere Abweichungen von Null als im
Punkt 12. angegeben ist, ist der Einsatz einer größeren
Blende zu erwägen bzw. der Übergang zur Gitterbeleuchtung
ratsam, d.h. es sind Maßnahmen zur Herabsetzung der Verstärkung (Rauschminderung) zu treffen.
8. Das Objekt wird verschoben, bis die Meßstelle auf der
Meßblende abgebildet ist.
9. Interferenzfilter ausschalten und den Verlauf des gewähl-
10. Interferenzfilter wieder einschalten. Phasenschwinger
11. Am Phasenschieber drehen, bis die Analogsignalanzeige
12. Der Tastendruck /MESS/ führt zur Anzeige des ersten Er-
13. Dieser Meßvorgang kann beliebig oft wiederholt werden,
ten Streifens in das Objekt (am unbeweglichen Teilbild)
hinein verfolgen. Durch Drehen am Feinphasenschieber diesen Streifen im o.g. Doppelbild auf der Meßblende abbilden.
durch den Tastendruck /S/S/ einschalten; Interferenzstreifen werden flau.
gleich Null ist.
gebnisses.
indem der Schwinger gestoppt (/S/S/ 2x), der zutreffende
Streifen wieder im Umfeld des Objekts verfolgt und auf
der Meßblende erneut abgebildet wird (Objektverschiebung/Feinphasenschieber).

97
VEL x
Im Anschluß daran folgen die Punkte 10, 11, 12. Auch
hier dient die Position des Feinphasenschiebers nach
/MESS/ als Ausgangsort der nächsten Messung, da jeder
Tastendruck /MESS/ den Zählerstand gleich Null setzt.
(Der Anfangspunkt kann jedoch auch mit Tastendruck /o/
jedesmal neu definiert werden).
Es werden der Mittelwert der Meßserie rechts, die statistische Berechnung, σ' oder s in der Mitte und die An-
zahl der Messungen links ausgewiesen.
14. Eine Speicherung und Zusammenfassung von Serienmessungen
ist im Speicher SM1 auf Tastendruck /SM1/ möglich (siehe
7.2.5.2.) ebenso eine Datenklassierung (7.2.6.).
15. Grobe Meßfehler werden durch sprunghafte Vergrößerung
oder Anzeigeüberlauf "xxx" der statistischen Werte
sichtbar und können, falls unmittelbar erkannt, durch
/CE/ gelöscht werden.
16. Das Löschen von Meßreihen, der Speicherinhalte SM1 und
SM2 und ggf. von Klassierdaten erfolgt durch die Taste
/CLEAR/ nach den Regeln 5.1.2., 5.1.4., 5.1.5.(Tab. 2).
15.3. Bestimmen aktueller Einzelergebnisse – Meßfolgen
• Wahl des Operationsmodus nach 7.2.5.1.
Die Anwendung dieser Meßvariante ist im Abschnitt 14.4. dargestellt.
Da das VELOMET 2 eine wesentlich höhere Meßgenauigkeit besitzt, ist die Arbeitsweise des Abschnitts 14.4. zweiter Anstrich möglich. Es gilt folgender Arbeitsablauf:
Durchführung einer Meßfolge
1. Mikroskop und VELOMET 2 entspr. Gebrauchsanleitung ein-
2. Streifenfeld bei totaler Bildaufspaltung der Meßdetails
richten und eine Stunde Einlaufzeit einhalten.
optimal kontrastieren.

98
l x
3. Die Messung soll von der Bereichsmitte des Feinphasen-
schiebers ausgehen, dazu entsprechend 15.1./2. die Einstellung prüfen und ggf. korrigieren.
Mit dem Grobphasenschieber einen Streifen der 1. Ordnung
so verschieben, daß er durch das Meßobjekt verläuft.
4. Streifen waagerecht ausrichten, Meßblende einschalten.
5. Bei örtlichen Änderungen des Gangunterschieds (Profilen)
einen markanten Ausgangspunkt in der Probe suchen, bei
zeitlichen Änderungen durch Einflußgrößen die zu beobachtende Meßstelle aussuchen und auf der Meßblende im unbeweglichen Teil des Doppelbildes abbilden.
6. Durch Drehen am Feinphasenschieber wird das Intensitäts-
minimum des Streifens auf der Meßblende abgebildet.
7. Interferenzfilter der gewählten Meßwellenlänge einschal-
ten und die Arbeitsschritte 5 bis 7. des Abschnitts 15.2.
durchführen.
Auf Tastendruck /o/ erscheint in der Anzeige
8. Die Streifenauslenkung an einer benachbarten Objektstelle
(Profildarstellung) bzw. das Auswandern des Streifens
über der Meßstelle wird durch Verstellen am Feinphasenschieber kompensiert (bei größeren Verschiebungen Interferenzfilter dabei ausschalten).
Der Schwinger ist durch Taste /S/S/, ggf. 2x, erneut zu
starten.
Die Einstellung am Feinphasenschieber wird korrigiert, bis
9. Auf Tastendruck /MESS/ erfolgt die Berechnung und Anzeige
Das Vorzeichen bestimmt die Richtung dieser Änderung.
die Analogsignalanzeige (rechts) gleich Null ist.
Bei kleinen Änderungen am Meßobjekt kann das Abschalten
des Schwingers (Arbeitsschritt 15.1./12) und das Ausschalten des Interferenzfilters entfallen.
der aktuellen Gangunterschiedsänderung, bezogen auf die
Ausgangsposition (Punkt 5).
 Loading...
Loading...