Page 1

MAN GUIDE 105
TGE - Das 6-Gang-Schaltgetriebe
Page 2
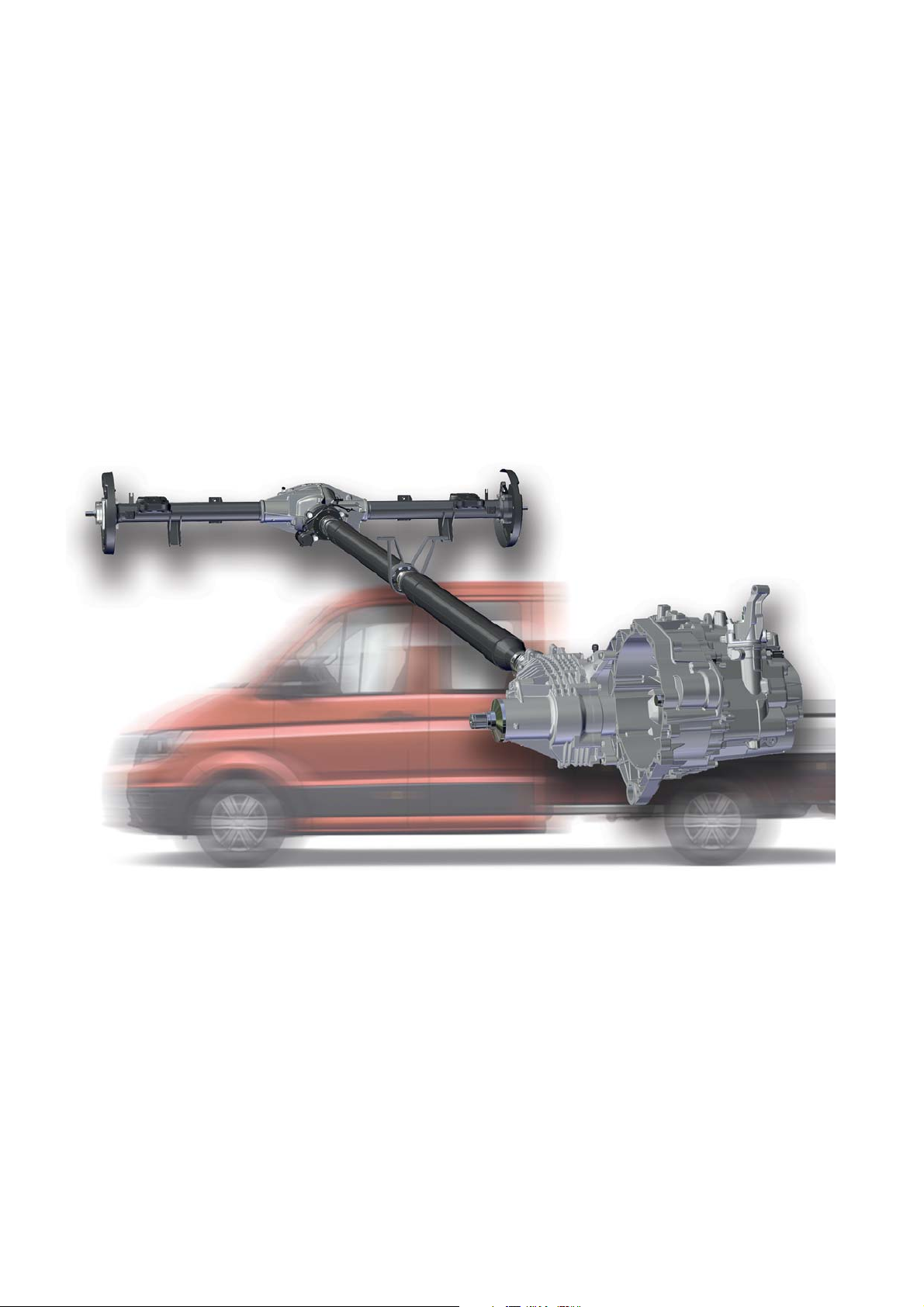
Die Getriebewelt im MAN TGE
MAN hat das Anforderungsprofi l an die modernen Getriebe seiner Fahrzeuge deutlich verändert. Dies wurde erforderlich durch
die innovativen Entwicklungen im Bereich der Kraftübertragung, wie beispielsweise durch das 6-Gang-Schaltgetriebe für den
Frontantrieb und den Allradantrieb 4x4.
Gleichzeitig mussten die Getriebe an die unterschiedlichen Motorvarianten und Einsatzbedingungen des MANTGE angepasst
werden. Dies gilt besonders für die drehmomentstarken Motoren mit ihrer ausgeprägten Dynamik. Trotzdem standen als
Entwicklungsziele nach wie vor die Verbrauchsreduzierung und Verminderung des CO
-Ausstoßes mit im Vordergrund.
2
Technischer Stand April 2018
2
m104_002
Page 3
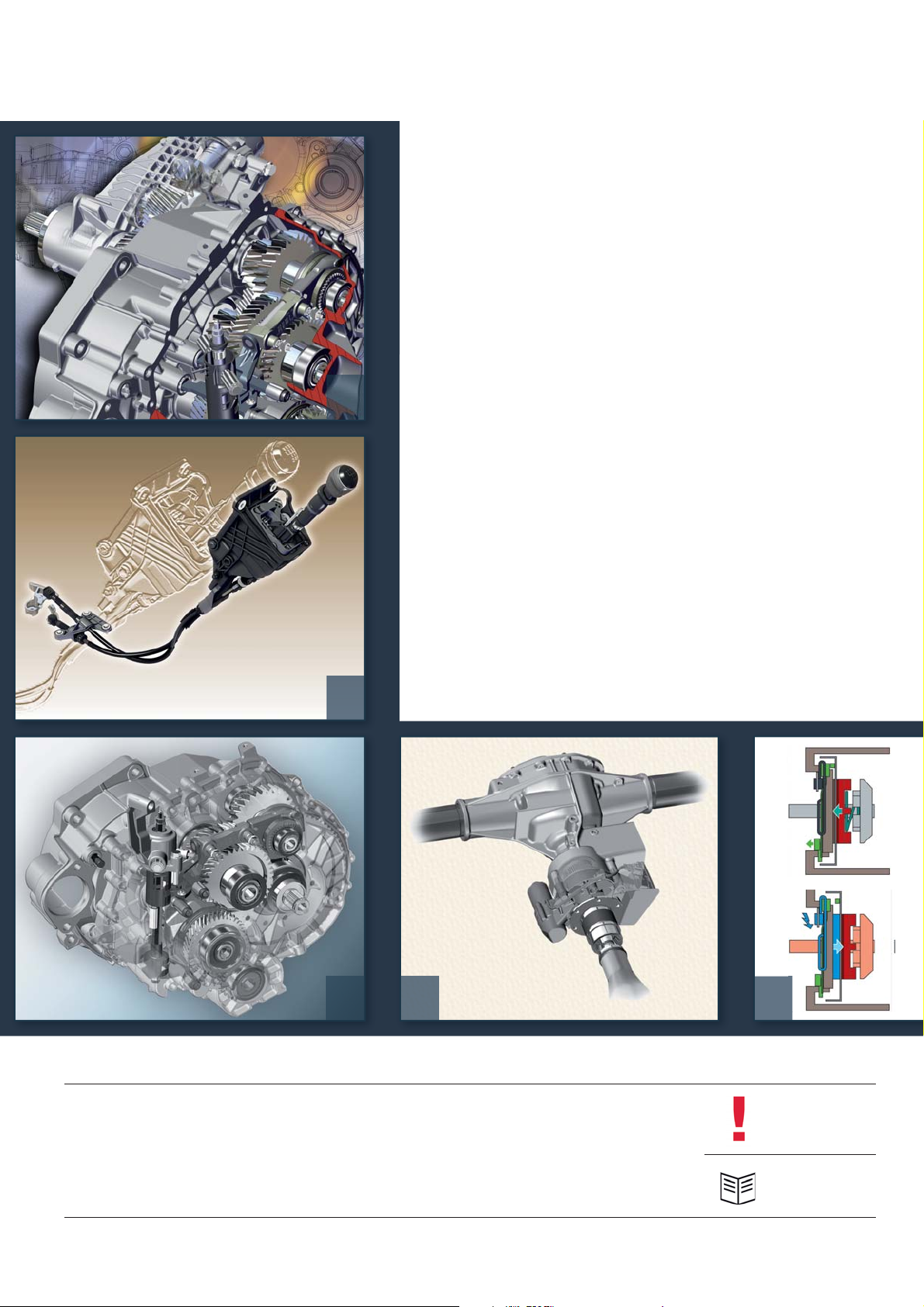
INHALTSVERZEICHNIS
4 EINLEITUNG
8 SCHALTBETÄTIGUNG
4
8
10 6-GANG-SCHALTGETRIEBE
19 ALLRADANTRIEB 4X4
24 GETRIEBEMANAGEMENT
10
Der MAN TGE Guide vermittelt Grundlagen zu Konstruktion und Funktion für Sales und After Sales neuer Fahrzeugmodelle, neuen Fahrzeugkomponenten oder neuen Techniken.
Der MAN TGE Guide ist kein Verkaufshandbuch und kein Reparaturleitfaden! Angegebene Werte dienen nur zum leichteren Verständnis und beziehen sich auf den zum Zeitpunkt der Erstellung des MAN TGE Guide gültigen Datenstand.
Die Inhalte werden nicht aktualisiert.
Für die Kundenberatung sowie Wartungs- und Reparaturarbeiten nutzen Sie bitte unbedingt die entsprechende technische Literatur.
19
24
Hinweis
Verweis
3
Page 4
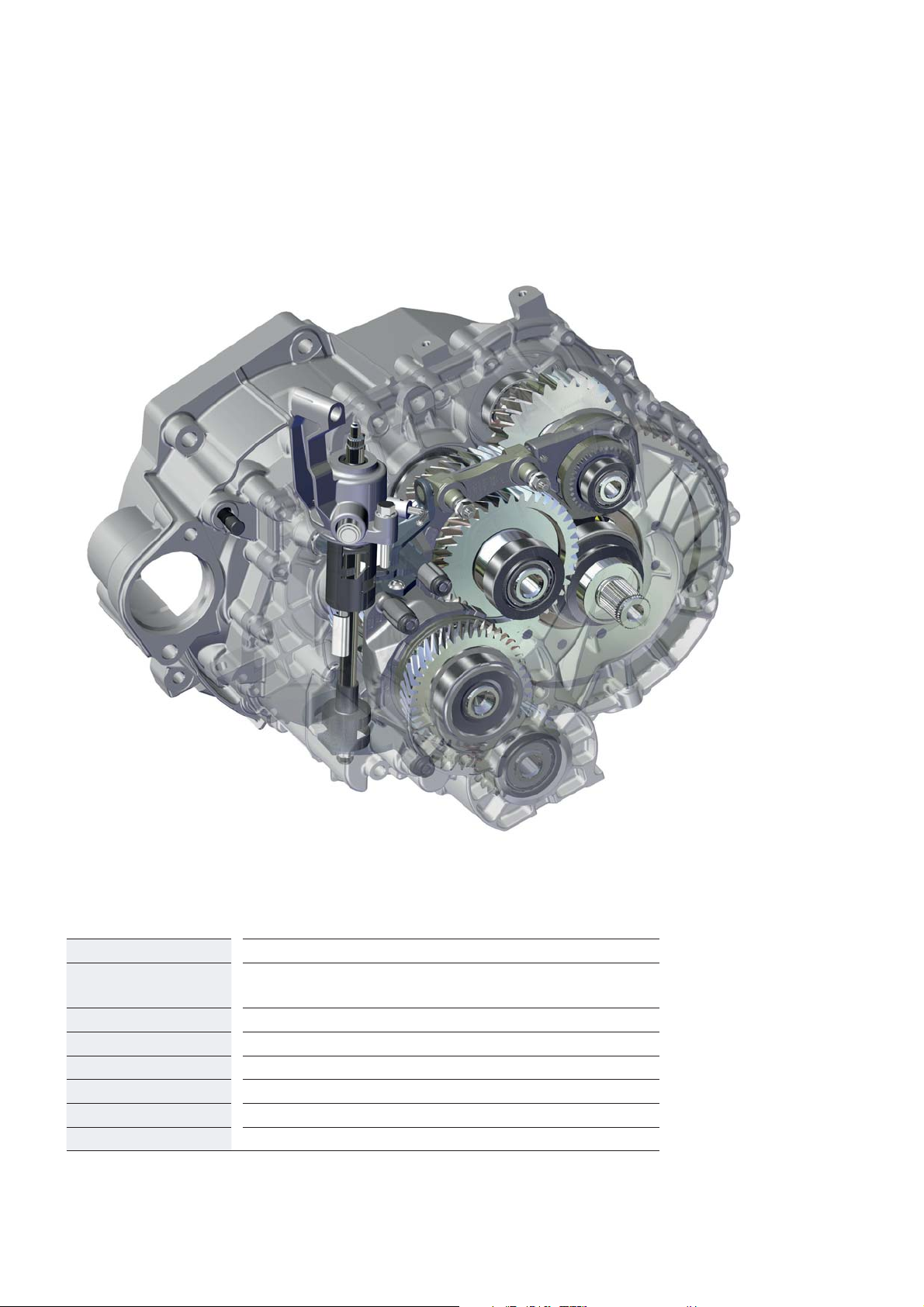
EINLEITUNG
Die technischen Daten des
6-Gang-Schaltgetriebes
Hersteller Volkswagen AG
Getriebekennzeichnung MQ 500 0AX
Getriebemerkmale
Maximales Drehmoment 410 Nm
Spezifi kation Getriebeöl SAE 75 nach TL 52 527 A
Füllmenge Getriebeöl 2,5 Liter
Füllmenge Achsantrieb 1,0 Liter
Füllmenge Allradkupplung 1,0 Liter
Füllmenge Winkelgetriebe 0,86 Liter
4
6-Gang-Schaltgetriebe mit vier Wellen und Seilzugbetätigung für Front- und
Allradantrieb im Quereinbau
m105_003
Page 5
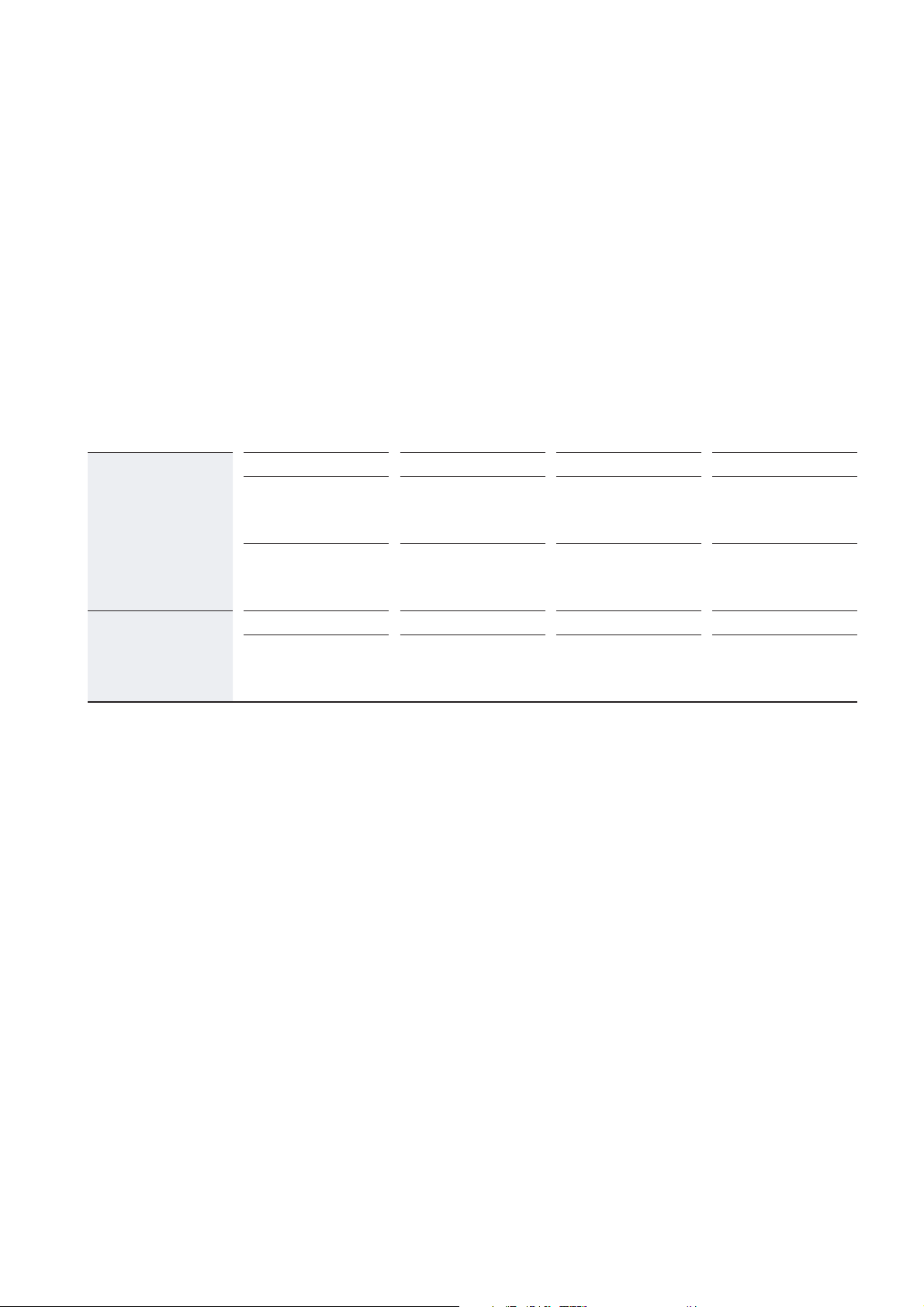
Der Antriebsstrang im TGE
Bedingt durch das vielfältige Einsatzgebiet des TGE gibt es in seinem Antriebskonzept bei der
Kraftübertragung mehrere Varianten. Das Spektrum reicht vom Frontantrieb mit 6-Gang-Schaltgetriebe bis zum Allradantrieb mit 8-Gang-Automatikgetriebe inklusive einer Allradkupplung der
Generation5 und elektronischer Differenzialsperre.
Getriebe Motorisierung Antriebsart Allrad Differenzialsperre
6-Gang-Schaltgetriebe
0AX
8-GangAutomatikgetriebe
09Q
2,0l-TDI mit 75kW Frontantrieb - nein
2,0l-TDI mit 103kW Front- und
Allradantrieb
2,0l-TDI mit 130kW Front- und
Allradantrieb
2,0l-TDI mit 103kW Frontantrieb nein
2,0l-TDI mit 130kW Front- und
Allradantrieb
Winkelgetriebe und
Allradkupplung
Generation 5
Winkelgetriebe und
Allradkupplung
Generation 5
Winkelgetriebe und
Allradkupplung
Generation5
elektr.
Differenzialsperre
(optional)
elektr.
Differenzialsperre
(optional)
elektr.
Differenzialsperre
(optional)
In diesem Heft werden Aufbau und Funktionsweise des 6-Gang-Schaltgetriebes mit seinen
Komponenten für Front- und Allradantrieb vorgestellt.
5
Page 6

Die Hinterachsen des TGE
Frontantrieb
Radlagerung
Längsblattfeder Längsblattfeder
Hinterachskörper Radlagerung
m105_004
Im TGE mit Frontantrieb setzt als Basis eine starre
Hinterachse mit Längsblattfedern und Stabilisator ein.
Die Materialstärke der Hinterachse ist auf die höchste
Nutzlast beim Crafter auslegt. Die verschiedenen
Nutzlastvarianten und Aufbauten erfordern konstruktive
Vorteile einer Starrachse
keine Sturzänderung bei parallelem Einfedern
konstanter Sturz zur Straße bei Querneigung des Aufbaus
spurstabile, fl ache Bauweise bei nicht angetriebenen Achsen
Selbstlenkverhalten bei Kurvenfahrt
Anpassungen an den Blattfedern, Stabilisatoren und
den Stoßdämpfern. Je nach Höhe des Karosseriebodens werden zwei verschiedene Hinterachsen
verbaut.
6
Page 7

Allradantrieb
Radlagerung
Starres Achsrohr
Ausgleichsgetriebe
Starres Hinterachsrohr
Allradkupplung
Radlagerung
m105_005
Beim TGE mit Allradantrieb setzt eine Starrachse mit
Ausgleichsgetriebe und Allradkupplung der Generation
5 ein. Optional ist das Hinterachsgetriebe mit einer
elektrisch zuschaltbaren Differenzialsperre für das
Schalt- und Automatikgetriebe erhältlich. Das Achs-
getriebegehäuse ist achsmittig positioniert und aus
Grauguss gefertigt. Die Achsrohre sind mit dem Ausgleichsgetriebegehäuse verschweißt. Die Steckwellen
sind massiv ausgeführt.
7
Page 8
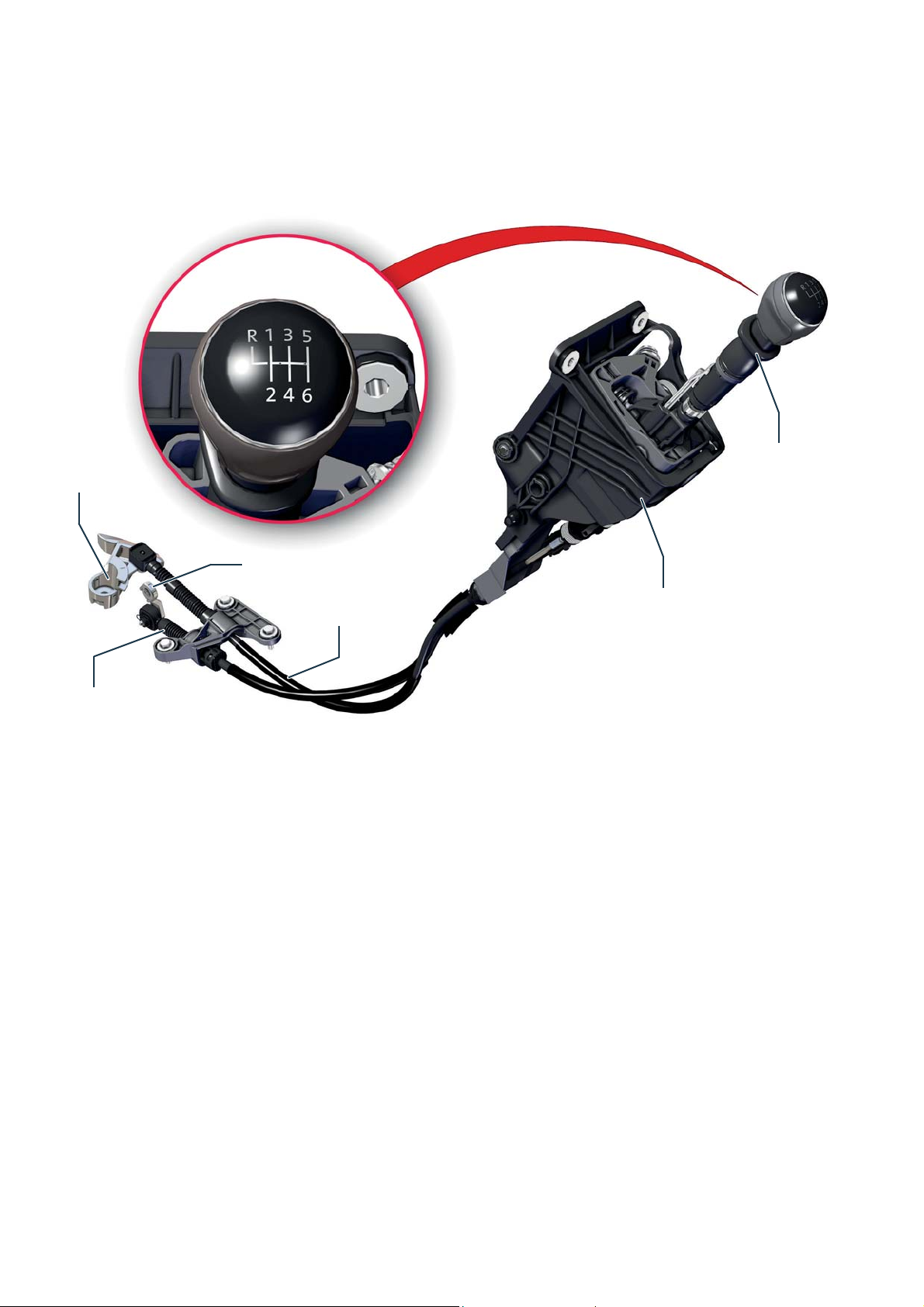
SCHALTBETÄTIGUNG
Die äußere Schaltbetätigung
Schaltschema
Umlenkhebel
Schalthebel mit
Zugring
Umlenkhebel
Seilzug „Schalten“
Seilzug „Wählen“
Im TGE setzt eine äußere Schaltbetätigung mit Zugring ein.
Aufbau und Funktionsweise
Die Schaltbetätigung besteht aus zwei Hauptbaugruppen:
dem Schalthebelgehäuse mit zwei Umlenkhebeln
dem Schalthebel mit Zugring
Die Lagerung des Schalthebels besteht aus vier Kunststoffführungen im Schalthebelgehäuse.
Die Anbindung an das Getriebe erfolgt an den Umlenkhebeln über zwei Seilzüge:
den Seilzug „Wählen”
den Seilzug „Schalten”
Schalthebelgehäuse
m105_006
Die Anbindungspunkte an den Umlenkhebeln sind mit
Kugelköpfen versehen, um eine hohe Beweglichkeit zu
gewährleisten. Um den Schalthebel in der Mittelstellung zu fi xieren, ist eine Schenkelfeder verbaut. Als
Rückwärtsgangsperre wird ein System mit Zugring am
8
Schalthebel verwendet. Für das Getriebe wurde eine
Vier-Gassen-Schaltung nach dem bekannten
H-Schaltprinzip gewählt, bei der der Rückwärtsgang
vorn links liegt.
Page 9
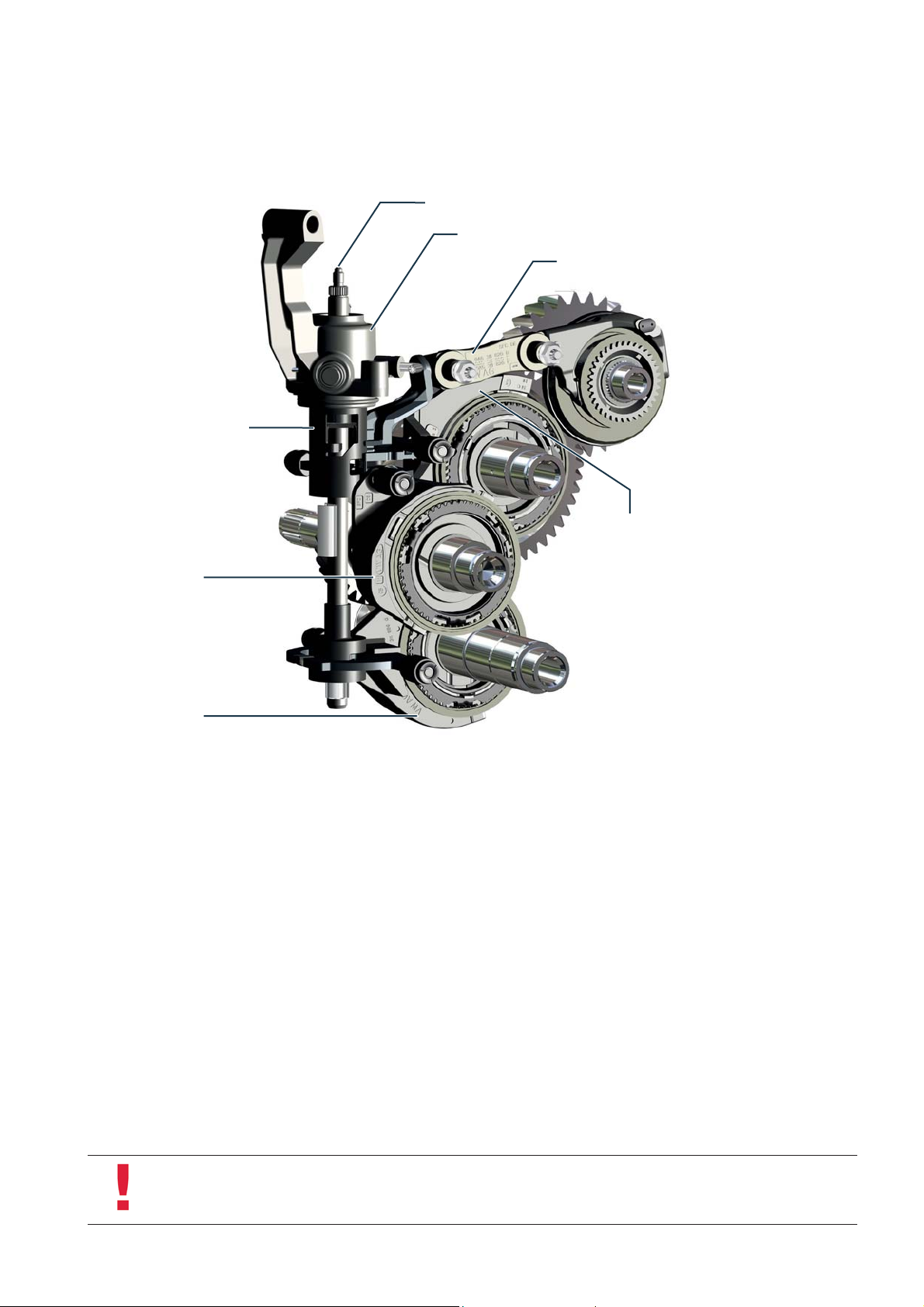
Die innere Schaltbetätigung
Schaltwelle
Schaltdeckel
Arretierhülse mit Schaltfi nger
Schaltgabel 5.Gang
und 6.Gang
Schaltschwinge für den Rückwärtsgang
Schaltgabel 1. Gang
und 2. Gang
Schaltgabel 3.Gang
und 4.Gang
Die Schaltbewegungen werden durch die Schaltwelle in das Getriebe übermittelt.
Aufbau und Funktionsweise
Die Führung der Schaltwelle, erfolgt im Schaltdeckel
gleit- und im Getriebegehäuse wälzgelagert. Je nach
geschaltetem Gang greifen die Schaltfi nger der Schaltwelle in eine der Schaltgabeln für den 1. bis 6. Gang
bzw. in die Schaltschwinge für den Rückwärtsgang ein
und betätigt diese. Die Lagerung der Schaltgabeln
erfolgt als Gleitlagerung im Getriebegehäuse. Sie
können somit zum Schalten eines Ganges axial verschoben werden. Der Rückwärtsgang wird über eine
eigene Schaltschwinge geschaltet. Sie ist über einen
Lagerbock am Getriebegehäuse verschraubt und
schwenkt um eine gleitgelagerte Achse.
m105_007
Hinweis
Zum Einstellen der Seilzugschaltung fi nden Sie ausführliche Informationen im Reparaturleitfaden.
9
Page 10

6-GANG-SCHALTGETRIEBE
Der Getriebeaufbau im Überblick
Kupplungsgehäuse
Getriebegehäuse
Das 6-Gang-Schaltgetriebe 0AX im TGE gehört mit seinen 4 Wellen und einer Baulänge von
390mm zu den Kurzbaugetrieben. Dadurch ergeben sich erhebliche Platzvorteile für den Einbau
von Motor und Getriebe. Das Gehäuse des Getriebes ist zweiteilig aufgebaut und besteht aus:
dem Getriebegehäuse
dem Kupplungsgehäuse
Beide Gehäuseteile sind aus einer Aluminium-Legierung gefertigt. Am Getriebegehäuse ist das
Widerlager zur Befestigung der beiden Schaltzüge angeschraubt.
m105_008
10
Page 11

Getriebeschema
Antriebswelle
Ausgleichsgetriebe
Triebwelle 2
3
5
6
44
1
3/2
5
6
Triebwelle 1 Triebwelle 3
R
R
1
2
m105_009
Im Getriebegehäuse sind die Schalträder zum Schalten der Gänge den Wellen folgendermaßen
zugeordnet:
1. und 2. Gang auf der Triebwelle 1
3. und 4. Gang auf der Triebwelle 2
5. und 6. Gang auf der Antriebswelle
Rückwärtsgang auf der Triebwelle 3
Zur Geräuschoptimierung werden alle Laufverzahnungen der Gang- und Schalträder hartbearbeitet. Die
Gänge 1 bis 3 besitzen eine 3-Konus-Synchronisierung. Der 4. Gang ist zweifach, der 5. und 6. Gang
sind einfach synchronisiert. Der Rückwärtsgang ist mit
einer 1-Konus-Gewinde-Synchronisierung versehen.
Das Drehmoment wird über die drei Triebwellen übertragen, die ständig mit dem Zahnrad für Achsantrieb
im Eingriff stehen. Dabei erfolgt der Drehmomentfl uss
von der Antriebswelle über jeweils eine Triebwelle zum
Ausgleichsgetriebe und dem Achsantrieb.
11
Page 12

Die Antriebswelle
Antriebswelle (massiv)
Zylinderrollenlager
Gangrad 4. Gang
Verzahnung 1. Gang
Verzahnung 2. und 3. Gang
Synchronkörper mit Schiebemuffe
Schaltrad 5. Gang
Rillenkugellager
Schaltrad 6. Gang
Lagerplatte
m105_010
Aufbau
Die Antriebswelle ist im Getriebegehäuse in einem Rillenkugellager und im Kupplungsgehäuse in
einem Zylinderrollenlager gelagert. Die Lagerplatte des Rillenkugellagers ist mit vier Schrauben im
Getriebegehäuse verschraubt, der Innenring mittels einer Zentralschraube fest mit der Antriebswelle verbunden.
Auf der Triebwelle 1 sind die Schalträder für den 1. und 2. Gang als Losräder auf je einem Nadellager gelagert. Das Rückwärtsgangrad ist auf dem Schaltrad für den 1. Gang aufgeschweißt und
sorgt somit für die Drehrichtungsumkehr, da es nicht kraftschlüssig mit der Triebwelle 1 verbunden
ist. Das Abtriebsrad zum Ausgleichsgetriebe ist als Festrad Bestandteil der Triebwelle 1.
Synchronisation
Für die Schalträder dieser Welle kommt eine 3- Konus-Synchronisierung zum Einsatz. 3-KonusSynchronisierung bedeutet, dass die Anzahl der Reibfl ächen durch Zwischenringe erweitert wird.
Aufgrund dieser Anordnung kann somit ein höheres Reibmoment erzielt werden.
Der Synchronkörper für den 1. und 2. Gang ist über eine Steckverzahnung fest mit der Triebwelle
verbunden.
12
Page 13

Die Triebwelle 1
Schaltrad 1. GangAbtriebsrad zum Ausgleichsgetriebe
Kegelrollenlager
Nadellager
Rückwärtsgangrad
Schaltrad 2. Gang
Kegelrollenlager
Triebwelle 1
(hohlgebohrt)
Nadellager
Synchronkörper mit Schiebemuffe
m105_011
Aufbau
Die Triebwelle 1 ist mit je einem Kegelrollenlager im Getriebegehäuse und im Kupplungsgehäuse
gelagert. Zur Ölversorgung ist die Triebwelle hohlgebohrt. Durch diese Bohrung wird außerdem
eine Gewichtsreduzierung erreicht.
Auf der Triebwelle 1 sind die Schalträder für den 1. und 2. Gang als Losräder auf je einem Nadellager gelagert. Das Rückwärtsgangrad ist auf dem Schaltrad für den 1. Gang aufgeschweißt und
sorgt somit für die Drehrichtungsumkehr, da es nicht kraftschlüssig mit der Triebwelle 1 verbunden
ist. Das Abtriebsrad zum Ausgleichsgetriebe ist als Festrad Bestandteil der Triebwelle 1.
Synchronisation
Für die Schalträder dieser Welle kommt eine 3- Konus-Synchronisierung zum Einsatz. 3-KonusSynchronisierung bedeutet, dass die Anzahl der Reibfl ächen durch Zwischenringe erweitert wird.
Aufgrund dieser Anordnung kann somit ein höheres Reibmoment erzielt werden.
Der Synchronkörper für den 1. und 2. Gang ist über eine Steckverzahnung fest mit der Triebwelle
verbunden.
13
Page 14

Die Triebwelle 2
Kegelrollenlager
Abtriebsrad zum
Ausgleichsgetriebe
Schaltrad 4. Gang Schaltrad 3. Gang
Nadellager
Synchronkörper mit Schiebemuffe
Nadellager
Gangrad 5. Gang
Triebwelle 2 (hohlgebohrt)
Gangrad 6. Gang
Kegelrollenlager
m105_012
Aufbau
Die Triebwelle 2 ist mit je einem Kegelrollenlager im Getriebegehäuse und im Kupplungsgehäuse
gelagert. Zur Gewichtsreduzierung ist diese Triebwelle hohlgebohrt.
Auf der Triebwelle2 sind die Schalträder für den 3. und 4.Gang als Losräder auf je einem Nadellager gelagert. Die Gangräder für Gang5 und6 sind als Festräder auf der Triebwelle aufgeschrumpft.
Das Abtriebsrad zum Ausgleichsgetriebe ist fester Bestandteil der Triebwelle 2.
Synchronisation
Für das Schaltrad des 3.Ganges kommt eine 3-Konus-Synchronisierung und für das Schaltrad
des 4.Ganges eine 2-Konus-Synchronisierung zum Einsatz. 2- Konus-Synchronisierung bedeutet,
dass der Synchronring und das zugeordnete Schaltrad über zwei Reibfl ächen (Reibkonen) verfügen
und sich somit eine größere Gesamtreibfl äche ergibt.
Der Synchronkörper für den 3. und 4. Gang ist über eine Steckverzahnung fest mit der Triebwelle2
verbunden.
14
Page 15

Die Triebwelle 3
Abtriebsrad zum
Ausgleichsgetriebe
Schaltrad RückwärtsgangKegelrollenlager
Synchronkörper mit Schiebemuffe
Kegelrollenlager
Zylinderrollenlager
Nadellager
Aufbau
Die Abtriebswelle 3 ist mit je einem Kegelrollenlager im Getriebegehäuse und im Kupplungsgehäuse gelagert. Zur Ölversorgung und Gewichtsreduktion ist die Welle ebenfalls hohlgebohrt.
Auf der Abtriebswelle3 befi nden sich nur das Schaltrad und die Schiebemuffe für den Rückwärtsgang. Das Schaltrad ist auf einem Nadellager gelagert. Auch das Abtriebsrad der Triebwelle3 zum
Ausgleichsgetriebe ist fester Bestandteil der Welle.
Synchronisation
Für das Schaltrad kommt eine 1-Konus-Synchronisierung zum Einsatz. 1-Konus-Synchronisierung
bedeutet, dass der Synchronring und das Schaltrad über nur eine Reibfl äche (Reibkonus) verfügen.
Der Synchronkörper für den Rückwärtsgang ist über eine Innensteckverzahnung fest mit der
Abtriebswelle verbunden.
Triebwelle 3 (hohlgebohrt)
m105_013
15
Page 16

Die Funktionsweise der Synchronisation
Aufbau
Synchronisationselemente und ihre Bestandteile übernehmen beim Schaltvorgang die Anpassung
der Drehzahl zwischen Triebwelle und Schaltrad und die formschlüssige Kopplung beider Bauteile.
Eine Koppelung ist nur möglich, wenn die Drehzahlen übereinstimmen. Dieser Vorgang wird als
Synchronisieren bezeichnet.
Aufbau
1-Konus-, 2-Konus- und 3-Konus-Synchronisationen sind prinzipiell gleich aufgebaut. Der Unterschied liegt in der Anzahl der Reibkonen zwischen Synchronring und Schaltrad und damit in der
Gesamtgröße der Reibfl äche. Um den Reibwert zu erhöhen, werden die Synchronringe mit einer
Carbonbeschichtung versehen.
Ein Synchronisationselement besteht aus:
der Schiebemuffe
dem Synchronkörper
dem Synchronring außen
dem Synchronring innen
dem Zwischenring
den drei Sperrstücken
der Sperrstückfeder
Schiebemuffe
Sperrstück
Synchronkörper
Zwischenring
Sperrstück
Synchronring (innen)
Sperrstückfeder
Synchronring (außen)
m105_014
16
Schaltrad mit Reibkonus und Kupplungsverzahnung
Page 17

Ablauf der Synchronisation
Bei der Synchronisation wird zwischen zwei Stellungen des Synchronisationselementes unterschieden:
der Sperrausgangs- bzw. Synchronisierungsstellung
der Schaltstellung
Schiebemuffe
Synchronring (außen)
Sperrausgangs- bzw. Synchronisierungsstellung
Beim Schalten wird die Schiebemuffe aus der neutralen Mittellage in
Richtung des zu schaltenden Schaltrades verschoben und nimmt
dabei die Sperrstücke mit. Diese drücken den Synchronring gemeinsam mit dem Zwischenring und dem inneren Synchronring in Rich-
Rotationsgeschwindigkeit
hoch
Rotationsgeschwindigkeit
niedrig
tung Schaltrad. Solange sich die Schiebemuffe und das Schaltrad
nicht mit gleicher Drehzahl drehen, entstehen Reibmomente, die den
äußeren Synchronring so weit verdrehen, bis dieser mit seinen Erhebungen seitlich an den Aussparungen des Synchronkörpers anliegt.
Die Zahndächer der Innenverzahnung der Schiebemuffe liegen dabei
an den Schrägen der Sperrzähne des Synchronringes an und sperren
so die Schiebemuffe gegen ein weiteres axiales Verschieben. Die
Synchronkörper
Schaltrad mit Reibkonus und
Kupplungsverzahnung
Reibmomente bewirken außerdem ein Abbremsen bzw. Beschleunigen des Schaltrades bis dessen Drehzahl mit der der Triebwelle
übereinstimmt.
Sperrung der Schiebemuffe
ist aufgehoben.
Rotationsgeschwindigkeit
gleich
Verzahnungen von Synchronkörper, Schiebemuffe,
Synchronring (außen) und Schaltrad greifen ineinander
m105_015
Rotationsgeschwindigkeit
gleich
m105_016
Schaltstellung
Sobald die Drehzahlen übereinstimmen, entstehen keine Reibmomente mehr, die die Schiebemuffe gegen ein weiteres axiales Verschieben sperren. Der äußere Synchronring wird nun von den Zahndächern der Innenverzahnung der Schiebemuffe so verdreht, bis sie
in die Kupplungsverzahnung des Schaltrades geschoben werden
kann. Damit ist der Kraftfl uss zwischen Triebwelle und Schaltrad
hergestellt.
17
Page 18

Das Ausgleichsgetriebe
Verzahnung zu den
Triebwellen
Kegelrollenlager
Schaftkegelrad mit
Innenverzahnung
zum Radantrieb
Radialwellendichtung
Schaftkegelrad mit
Innenverzahnung zum
Radantrieb
Kegelrollenlager
Differenzial
Ausgleichsgetriebegehäuse
Äußerer Aufbau
Die Lagerung des Ausgleichsgetriebes erfolgt mit Kegelrollenlagern im Getriebegehäuse. Das
Zahnrad für den Achsantrieb ist mit dem Ausgleichsgetriebegehäuse verschraubt und mit den drei
Triebwellen ständig im Eingriff. Die Abdichtung der Flanschwellen nach außen erfolgt beim Frontantrieb mit zwei baugleichen Radialwellen-Dichtringen. Beim Allradantrieb ist die Abdichtung der
Flanschwelle auf der rechten Seite durch einen geänderten Radialwellendichtring ausgeführt
worden.
Innerer Aufbau
Das 6-Gang-Schaltgetriebe kann für den Front- als auch Allradantrieb eingesetzt werden. Der
Achsantrieb für die Vorderräder wird dabei von der Innensteckverzahnung der beiden Schaftkegelräder durch die Antriebswelle zum Rad geführt. Bei Einsatz des Allradantriebes kommt ein separates Winkelgetriebe zum Einsatz, welches zur Kraftübertragung über eine zusätzliche Steckverzahnung verfügt.
m105_017
18
Page 19

ALLRADANTRIEB 4X4
Der Allradantrieb im Überblick
Hinterachsantrieb mit
elektronischer
Differenzialsperre
Allradkupplung (Generation 5)
Hinterachskörper mit
Antriebswellen
6-Gang-Schaltgetriebe
Kardanwelle
Winkelgetriebe
Der Allradantrieb 4x4 des TGE besteht zusätzlich zum 6-Gang-Schaltgetriebe aus den folgenden
Komponenten:
dem Winkelgetriebe
der Allradkupplung (Generation 5)
der Kardanwelle
dem Hinterachsantrieb
der elektronischen Differenzialsperre
den Antriebswellen der Hinterräder
m105_018
Hinweis
Das 6-Gang-Schaltgetriebe und das 8-Gang-Automatikgetriebe für den Querverbau, sind für ein Allradkonzept in
Verbindung mit einem Winkeltrieb und einer Allradkupplung vorgesehen.
19
Page 20

Das Winkelgetriebe
Winkelgetriebe
Das Winkelgetriebe bildet mit dem 6-Gang-Schaltgetriebe eine Baueinheit. An das Ausgleichsgetriebe schließt der Winkeltrieb an, über den das Antriebsmoment zur Hinterachse weitergeleitet
wird.
Aufbau und Funktionsweise
Kardanwelle
Schaltkegelrad
Der Antrieb des Winkelgetriebes erfolgt über eine
Hohlwelle mit Innenverzahnung. Diese Innenverzahnung greift in die Außenverzahnung der Abtriebswelle
des Ausgleichsgetriebes. Von der Verzahnung der
Hohlwelle wird das Antriebsmoment auf eine Zwischenwelle mit Kopfkegelrad übertragen. Das Kopfkegelrad greift in das Schaltkegelrad der Kardanwelle
und lenkt den Kraftfl uss zum Hinterachsantrieb.
Zwischenwelle mit Kopfkegelrad
m105_019
20
m105_020
Antriebswelle rechts Hohlwelle mit Verzahnung
Page 21

Die Allradkupplung
Allradkupplung
(Generation 5)
Im TGE mit Allradantrieb wird eine Allradkupplung der Generation 5 verbaut. Durch die Allradkupplung wird die Größe des Antriebsmomentes zur Hinterachse gesteuert. Sie leitet je nach Öffnungsgrad das erforderliche Antriebsmoment an die Hinterachse.
Technische Merkmale
Motordrehmomente bis max. 380 Nm
übertragbares Drehmoment an der Hinterachse bis max. 4900 Nm
elektro-hydraulisch gesteuerte Lamellenkupplung
permanent angesteuerte Pumpe für Allradkupplung V181
m105_021
Hinweis
Der Ölwechsel erfolgt alle 3 Jahre, ohne Kilometerbeschränkungen. Auf die Verwendung der richtigen Öleinfüll- und
Ölablassschraube achten! Weitere Informationen fi nden Sie im Reparaturleitfaden.
21
Page 22

Aufbau
Steuergerät für Allradantrieb J492
Gehäuse
Ölhülse
Antriebsnabe
Anlaufscheibe
Antriebsfl ansch
Axialnadellager
Tellerfeder Pumpe für Allradkupplung
Arbeitskolben mit Dichtring
Lamellenpaket
Kupplungskorb
Gegenüber der Generation 4 sind bei der Entwicklung der Allradkupplung der Generation 5 Bauteile angepasst bzw. hinzugefügt worden. Andere Bauteile der Allradkupplung der Generation 4
sind dafür entfallen.
Neue Bauteile
das Überdruckventil
die Ölhülse
Axialnadellager
Rollenlager
V181
m105_022
Überarbeitete Bauteile
die Pumpe für Allradkupplung V181
das Steuergerät für Allradantrieb J492
das Gehäuse
Entfallene Bauteile
der Akkumulator
der Ölfi lter
das Ventil für Steuerung des Öffnungsgrades der Kupplung N373
22
Page 23

Der Achsantrieb
Antriebskegelrad
Achskegelrad
Tellerrad mit Hypoidverzahnung
Das Hinterachsgetriebe besteht aus einem Antriebskegelrad und einem Tellerrad mit einer Hypoidverzahnung. Bei einer Hypoidverzahnung sind die Achsen von Antriebs- und Tellerrad versetzt
angeordnet. Durch diese Art der Verzahnung erhöhen sich Laufruhe und Belastbarkeit bei verringertem Platzbedarf. Der Differenzialausgleich wird mithilfe von Achskegelrädern erreicht.
Die Position des Trieblings zum Tellerrad wird über eine Einstellscheibe vor dem inneren Lager des
Trieblings festgelegt. Die Lagervorspannung erfolgt über eine Stauchhülse. Das Flankenspiel zwischen Antriebskegelrad und Tellerrad bestimmen zwei Einstellscheiben im Differenzialgehäuse.
Neben den allgemeinen Vorteilen der Hypoidverzahnung wird die Flächenpressung an der Verzahnung von Antriebskegelrad und Tellerrad reduziert.
Das Hinterachsgetriebe wird in nur einer Übersetzung mit l=2,47 gefertigt.
m105_023
Hinweis
Die elektronische Differenzialsperre ist im Achsantrieb integriert. Weitere Informationen zu Aufbau und Funktionsweise der elektronischen Differenzialsperre fi nden Sie im Kapitel Getriebemanagement.
23
Page 24

GETRIEBEMANAGEMENT
Die elektronische Differenzialsperre
Sie wird über den Taster für Differenzialsperre hinten E121 aktiviert. Die Statusanzeige erfolgt im
Schalttafeleinsatz. Bei eingeschalteter Differenzialsperre bleiben ESP und ABS weiterhin aktiv.
Systemübersicht
Taster für Differenzialsperre hinten E121
Steuergerät für Differenzialsperre J187
Steuermagnet N5
Hallgeber 1 für
Quersperre G460
Aufbau
Der Aktuator ist der Steuermagnet N5. Sein Gehäuse
ist über Haltelaschen drehfest am Achsgehäuse
befestigt. Die Druckplatte und die Schaltklaue sind
ebenfalls drehfest mit dem Differenzialgehäuse verbunden. Am Steuermagnet N5 ist der Hallgeber 1 für
Quersperre G460 verbaut. Die Steuerung der Differenzialsperre erfolgt über das im CAN-Datenbus Antrieb
eingebundene Steuergerät für Differenzialsperre J187.
Es ist direkt mit dem Gehäuse der Allradkupplung
verschraubt.
Haltelasche
Steuermagnet N5
Achsgehäuse
Kombiprozessor im
Schalttafeleinsatz J218
Kontrollleuchte für
Quersperre hinten K276
m105_024
Hallgeber 1 für
Quersperre G460
Achskegelrad mit
Sperrverzahnung
Schaltklaue
Druckplatte
24
m105_025
Hinweis
Zur Durchführung von Instandsetzungsarbeiten an der Differenzialsperre muss das Achsgetriebe teilweise demontiert werden. Dazu sind Mess- und Einstellarbeiten erforderlich. Beispielsweise muss das Steuergerät für Differenzialsperre auf den Hallgeber 1 für Quersperre mit dem VAS-Diagnosetester angepasst werden. Vollständige Hinweise
zu Instandsetzungsarbeiten erhalten Sie im Reparaturleitfaden.
Page 25

Funktionsweise
m105_026
m105_027
Druckplatte
Steuermagnet N5
Achskegelrad mit
Sperrverzahnung
Schaltklaue
Hallgeber 1 für
Quersperre G460
Achskegelrad ist
gesperrt
Mit Einschalten der Differenzialsperre wird die Magnetspule des Steuermagneten N5 vom Steuergerät für
Differenzialsperre J187 bestromt. Der Steuermagnet
rückt aus und drückt über einen Metallring und die
Druckplatte auf die Schaltklaue. Die Schaltklaue greift
in die Sperrverzahnung des Achskegelrads ein und
blockiert dieses.
Das Achskegelrad ist nun drehfest mit dem
Differenzial gehäuse verbunden und das Differenzial ist
gesperrt. Um eine unzulässig hohe Erwärmung des
Steuermagneten zu vermeiden, wird die Magnetspule
pulsweitenmoduliert bestromt. Zur Ansteuerung verarbeitet das Steuergerät die Signale des Hallgebers 1 für
Quersperre G460. Dieser Positionssensor arbeitet
nach dem Hallprinzip. Er erfasst die aktuelle Position
des Steuermagneten bzw. dessen Druckplatte. Das
Steuergerät für Differenzialsperre J187 unterscheidet
anhand dieser Signale zwischen den Positionen „geöffnet”, „betätigt” und „Zahn-auf-Zahn-Stellung”. Für die
gesamte Zeitdauer der Aktivierung muss der Steuermagnet bestromt werden.
m105_028
Druckplatte
Schaltklaue
Achskegelrad ist
entsperrt
Rückstellfeder
Mit Ausschalten der Differenzialsperre wird die Schaltklaue über die Rückstellfeder in ihre Ruheposition
zurückgestellt.
25
Page 26

Weitere Sensoren
Der Geber für Fahrtenschreiber G75
Bei Einsatz des Getriebes in einem Fahrzeug mit
Fahrtenschreiber wird am Ausgleichsgetriebe zusätzlich der Geber für Fahrtenschreiber G75 verbaut. Der
Geber wird von außen in einer Bohrung des Kupplungsgehäuses montiert.
m105_029
Aufbau und Funktionsweise
Bei Ausstattung des TGE 2017 mit Fahrtenschreiber
erhält das Ausgleichsgetriebe ein Impulsgeberrad als
Teil seines Gehäuses. Dieses Geberrad wird vom
Geber für Fahrtenschreiber nach dem Hall-Prinzip
abgetastet. Zur Auswertung überträgt der Geber die
Signale an den Fahrtenschreiber G24.
Geber für Fahrtenschreiber G75
Impulsgeberrad
m105_030
26
Hinweis
Die serienmäßige Ausstattung erfolgt ohne den Sensorring und Geber für Fahrtenschreiber G75. Eine Nachrüstung
ist nicht möglich.
Page 27

27
Page 28

MAN Truck & Bus AG
MAN Academy
Dachauer Straße 667
80976 München
www.mantruckandbus.com
MAN Truck & Bus – Ein Unternehmen der MAN Gruppe
 Loading...
Loading...