
Cat. No. W364-DE1-02
SYSMAC CQM1H-Serie
CQM1H-CPU■■ Programmierbare Steuerungen
CQM1H-■■ ■■ ■ Spezialmodule
PROGRAMMIERHANDBUCH
Kurzübersicht
2 SPS-Konfiguration
Advanced Industrial Automation
61 Spezialmodule
141 Speicherbereiche
203 Befehlssatz

SYSMAC CQM1H–Serie
CQM1H-CPUjj Programmierbare Steuerungen
CQM1H-jjjjj Spezialmodule
Programmierhandbuch
Mai 2000
i

Hinweis:
OMRON–Produkte werden entsprechend den ordnungsgemäßen Vorschriften hergestellt und sind
durch einen qualifizierten Techniker in Betrieb zu nehmen und nur zweckmäßig anzuwenden, wie in
diesem Handbuch beschrieben ist.
Die folgenden Konventionen werden dazu verwendet, Gefahrensituationen zu kennzeichnen und für
dieses Handbuch einzustufen. Bitte beachten Sie immer die Informationen, die Ihnen hiermit zur
Verfügung gestellt werden. Eine Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen kann zu Verletzungen von
Menschen und Schäden an den Analgen führen.
GEFAHR Zeigt eine drohend gefährliche Situation an, die wenn nicht vermieden, zu Tod oder ernster
!
Verletzung führt.
WARNUNG Zeigt eine potentiell gefährliche Situation an, die, wenn nicht vermieden, zu Tod oder ernster
!
Verletzung fürhen könnte.
Vorsicht Zeigt eine potentiell gefährliche Situation an, die, wenn nicht vermieden, zu
!
unbedeutender oder gemäßigter Verletzung oder Eigenschaftsschäden führen kann.
OMRON Produktreferenz
Alle OMRON–Produkte werden in diesem Handbuch großgeschrieben.
Die Abkürzung “Ch”, die auf einigen Anzeigen und auf einigen OMRON–Produkten erscheint,
bedeutet häufig “Wort” und ist in der Dokumentation in diesem Sinn mit “Wd” abgekürzt.
Die Abkürzung “SPS” bedeutet ausschließlich speicherprogrammierbare Steuerung.
Visuelle Hilfsmittel
Die folgenden Überschriften helfen Ihnen, verschiedene Arten von Informationen zu identifizieren.
Hinweis Kennzeichnet Informationen, die einen effizienten und bedienerfreudlichen
1, 2, 3...
Einsatz des Produktes ermöglichen.
1.Unterteilt Handlungsabläufe in einzelne Schritte, wie z. B. Verfahren,
Checklisten usw.
OMRON, 2000
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf in irgendeiner Form, wie z. B. Druck, Fotokopie oder
einem anderen Verfahren, ohne schriftliche Genehmigung der Firma OMRON, Langenfeld, reproduziert, vervielfältigt
oder veröffentlicht werden.
Änderungen vorbehalten.
iii

Zu diesem Handbuch:
Dieses Handbuch beschreibt die Programmierung der CQM1H Programmierbaren Steuerung,
einschließlich Speicherstruktur, Speicherinhalt, Kontaktplanbefehle usw. und enthält die nachfolgend
beschriebenen Kapitel. Hardware–Informationen und Betriebsverfahren der Programmierkonsole
entnehmen Sie bitte dem
Lesen Sie dieses Handbuch bitte sorgfältig und stellen Sie sicher, dass Sie alle hierin enthaltenen
Informationen verstehen, bevor Sie mit der Programmierung und dem Betrieb der CQM1H beginnen.
CQM1H Bedienerhandbuch
.
Kapitel 1
Interrupt–Verarbeitung und Kommunikation. Die SPS–Konfiguration kann zur Überwachung der
Betriebsparameter der SPS verwendet werden.
Kapitel 2
Funktionalität zu verbessern. Einzelheiten über das serielle Kommunikationsmodul entnehmen Sie bitte
dem
Zusammenfassung dieses Spezialmoduls.
Kapitel 3
ebenfalls die Speichermodulvorgänge zum Übertragen von Daten zwischen der CPU–Baugruppe und
einem Speichermodul.
Kapitel 4
Befehle vor, die dazu verwendet werden, die Basisstruktur des Kontaktplans zu erstellen und die
Ausführung zu steuern.
Kapitel 5
verwendet werden können.
Kapitel 6
Host–Link–Kommunikation über die SPS–Schnittstellen verwendet werden können.
Kapitel 7
erforderliche Zeit. In diesem Kapitel ist das präzise Zeitverhalten der SPS–Vorgänge für ein besseres
Verständnis beschrieben.
Kapitel 8
eventuell während des SPS–Betriebs auftreten können.
Die folgenden Anhänge sind enthalten:
Speicherbereiche
G Liste der FAL–Nummern
erklärt die SPS–Konfiguration und verwandte SPS–Funktionen, einschließlich
beschreibt die Spezialmodule, die in die CPU–Baugruppe installiert werden können, um die
Bedienerhandbuch Serielles Kommunikationsmodul
beschreibt die Struktur der SPS–Speicherbereiche und deren Anwendung. Es beshreibt
enthält eine Einführung in die Grundbegriffe der Kontaktplan–Programmierung. Es stellt
enthält die Programmierbefehle des Kontaktplans, die für die Programmierung der CQM1H
beschreibt die Methoden und Verfahren zur Anwendung der Host–Link–Befehle, die für die
erklärt die interne Verarbeitung der SPS und die für die Verarbeitung und Ausführung
beschreibt die Fehlersuche und –behebung von Hardware– und Software–Fehlern, die
A Programmierbefehle, B Fehler– und Arithmetikmerker, C
,
D Verwendung der Uhr, E E/A–Zuweisungsblatt, F Programmierblatt
und
H Erweiterte ASCII.
(W365).
Kapitel 2
enthält lediglich eine
,
!
WARNING Failure to read and understand the information provided in this manual may result in
personal injury or death, damage to the product, or product failure. Please read each
section in its entirety and be sure you understand the information provided in the section
and related sections before attempting any of the procedures or operations given.
v

INHALTSVERZEICHNIS
Vorsichtsmaßnahmen xiii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Zielgruppe xiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1–1 Generelle Vorsichtsmaßnahmen xiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Sicherheitsmaßnahmen xiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Betriebsumgebungs–Sicherheitsvorkehrungen xvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 Anwendungs–Sicherheitsvorkehrungen xvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Übereinstimmung mit den EC–Richtlinien xix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1 Anwendbare Richtlinien xix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2 Konzepte xix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3 Übereinstimmung mit den EC–Richtlinien xix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-4 Störungsreduzierung der Relaisausgänge xx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitel 1 – SPS–Konfiguration und andere Merkmale 1 . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1 SPS–Konfiguration 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1-1 Änderung der SPS–Konfiguration 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1-2 Einstellungen des seriellen Kommunikationsmoduls 3 . . . . . . . . . . . . .
1-1-3 SPS–Konfigurationseinstellungen 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2 Spezialmodul–Einstellungen 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2-1 Einstellungen für ein serielles Kommunikationsmodul 9 . . . . . . . . . . .
1-2-2 Einstellungen für ein Schneller Zähler–Modul 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2-3 Einstellungen für ein Impuls–E/A–Modul 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2-4 Einstellungen für ein Absolutwertencoder–Schnittstellenmodul 10 . . . .
1-2-5 Einstellungen für ein Analog–E/A–Modul 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3 Basis–SPS–Betrieb und E/A–Verarbeitungen 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3-1 Einschaltbetriebsart 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3-2 Systemhaftmerker–Status 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3-3 RS–232–Schnittstellen–Service–Zeit 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3-4 Service–Zeit der Peripherieschnittstelle 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3-5 Kleinste Zykluszeit 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3-6 Eingangs–Zeitkonstanten 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3-7 Schnelle Zeitgeber 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3-8 DSW(87) Eingabestellen und Ausgangs–Auffrischungsverfahren 16 . . .
1-3-9 Peripherieschnittstellen–Einstellungen 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3-10 Fehlerprotokoll–Einstellungen 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4 Interrupt–Funktionen 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4-1 Interrupt–Arten 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4-2 Eingangs–Interrupts 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4-3 Maskierung aller Interrupts 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4-4 Intervall–Zeitgeber–Interrupts 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4-5 Schneller Zähler 0–Interrupts 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4-6 Schneller Zähler 0–Über–/Unterlauf 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-5 Impulsausgabefunktion 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6 Kommunikationsfunktionen 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6-1 Host–Link und Ohne–Protokoll–Kommunikationseinstellungen 47 . . . .
1-6-2 Host–Link–Kommunikationseinstellungen und –verfahren 49 . . . . . . . .
1-6-3 Ohne Protokoll–Kommunikationseinstellungen und –verfahren 51 . . . .
1-6-4 1:1–Data–Links 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6-5 NT–Link 1:1–Mode–Kommunikation 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6-6 Verdrahtung der Schnittstellen 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-7 Berechnung von vorzeichenbehafteten Binärdaten 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-7-1 Definition vorzeichenbehafteter Binärdaten 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-7-2 Arithmetische Merker 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-7-3 Eingabe vorzeichenbehafteter Binärdaten unter Verwendung
1-7-4 Verwendung von Erweiterten Befehlen für vorzeichenbehaftete
1-7-5 Anwendungsbeispiele mit vorzeichenbehafteten Binärdaten 59 . . . . . . .
von Dezimalwerten 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Binärwerte 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vii

Inhaltsverzeichnis
Kapitel 2 – Spezialmodule 61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1 Schneller Zähler–Modul 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1-1 Modell 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1-2 Funktionen 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1-3 Schneller Zähler–Modul–Beispiel 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1-4 Verwendbare Spezialmodul–Steckplätze 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1-5 Namen und Funktionen 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1-6 Technische Daten 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1-7 Schnelle Zähler 1 bis 4 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2 Impuls–E/A–Modul 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-1 Modell 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-2 Funktion 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-3 Systemkonfiguration 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-4 Verwendbarer Spezialmodul–Steckplatz 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-5 Namen und Funktionen 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-6 Technische Daten 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-7 Schnelle Zähler 1 und 2 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-8 Funktionen 102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-9 Impulsausgabe mit festem Tastverhältnis 102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-10 Variable Tastverhältnis–Impulsausgaben 114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-11 Ermittlung des Status der Schnittstellen 1 und 2 117 . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-12 Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung der
Impulsausgabefunktionen 118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-3 Absolutwertencoder–Schnittstellenmodul 119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-3-1 Modell 119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-3-2 Funktionen 119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-3-3 Systemkonfiguration 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-3-4 Anwendbare Spezialmodul–Steckplätze 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-3-5 Namen und Funktionen 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-3-6 Technische Daten des Absolutwertencodereingangs 121 . . . . . . . . . . . . . .
2-3-7 Schneller Zähler–Interrupts 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-4 Analogeinstellungs–Modul 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-4-1 Modell 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-4-2 Funktion 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-4-3 Verwendbare Steckplätze für Spezialmodule 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-4-4 Namen und Funktionen 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-4-5 Technische Daten 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-5 Analog–E/A–Modul 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-5-1 Modell 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-5-2 Funktion 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-5-3 Systemkonfiguration 134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-5-4 Verwendbarer Spezialmodul–Steckplatz 134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-5-5 Namen und Funktionen 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-5-6 Technische Daten 136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-5-7 Applikationsverfahren 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-6 Serielles Kommunikationsmodul 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-6-1 Modelnummer 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-6-2 Serielle Kommunikationsmodule 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-6-3 Merkmale 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-6-4 Systemkonfiguration 140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
viii
Kapitel 3 – Speicherbereiche 141 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1 Speicherbereichsstruktur 142 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2 IR–Bereich 144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2-1 Ein– und Ausgangsbereiche 144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2-2 Arbeitsbereiche 144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2-3 E/A–Zuordnung 144 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2-4 Merker/Bits für ein Spezialmodul auf Steckplatz 1
(IR 200 bis IR 215) 149 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2-5 Merker/Bits für ein Spezialmodul auf Steckplatz 2
(IR 232 bis IR 243) 152 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2-6 Kommunikationsmodule–Merker/Bits 154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inhaltsverzeichnis
3-3 SR–Bereich 154 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4 TR–Bereich 158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-5 HR–Bereich 158 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-6 AR–Bereich 159 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-6-1 Gemeinsam genutzte Merker/Bits (AR 00 bis AR 04) 159 . . . . . . . . . . . .
3-6-2 Merker/Bits der Spezialmodule (AR 05 und AR 06) 159 . . . . . . . . . . . . .
3-6-3 Gemeinsamgenutzte Merker/Bits (AR 07 bis AR 27) 161 . . . . . . . . . . . . .
3-6-4 Verwendung der Uhr 164 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-7 LR–Bereich 165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-8 Zeitgeber/Zählerbereich 165 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-9 DM–Bereich 166 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-10 EM–Bereich 167 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-11 Verwendung des Speichermoduls 167 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-11-1 Speichermodule und deren Inhalt 168 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-11-2 Speichermodul–Kapazität und Programmgröße 169 . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-11-3 Speichern von Daten auf das Speichermodul 170 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-11-4 Lesen von dem Speichermodul 171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-11-5 Vergleichen von Speichermodul–Inhalten 171 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitel 4 – Kontaktplan–Programmierung 173 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1 Grundlegende Verfahren 174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2 Befehlsterminologie 174 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3 Kontaktplanstruktur 175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3-1 Grundlegende Begriffe 175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3-2 AWL 176 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3-3 Kontaktplanbefehle 177 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3-4 OUTPUT und OUTPUT NOT 180 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3-5 Der END–Befehl 181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3-6 Logikblock–Befehle 181 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3-7 Programmierung mehrerer rechts angeordneter Befehle 190 . . . . . . . . . .
4-3-8 Strompfad–Verzweigungen 190 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3-9 Sprungbefehle 194 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-4 Steuerung des Bitzustands 195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-4-1 SET und RESET 195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-4-2 DIFFERENTIATE UP– und DIFFERENTIATE DOWN
(Flankengetriggerte Ausführung) 196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-4-3 KEEP (Bistabiles Flip–Flop) 196 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-4-4 Selbsthaltemerker 197 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-5 Arbeitsmerker 197 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-6 Vorsichtsmaßnahmen bei der Programmierung 199 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-7 Programmausführung 201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-8 Indirekte Adressierung des DM– und EM–Bereiches 201 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitel 5 – Befehlssatz 203 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1 Begriffsdefinition 207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2 Befehlsformat 207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3 Datenbereiche, Zuweiserwerte und Merker 207 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-4 Befehle mit flankengesteuerter Ausführung 209 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-5 Erweiterte Befehle 210 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-6 Eingabe von rechts angeordneten Befehlen 211 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-7 Befehlstabellen 213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-7-1 Befehle mit festem Funktionscode 213 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-7-2 Erweiterte Befehle 215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-7-3 Alphabetisch sortierte AWL–Liste 215 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-8 Kontaktplanbefehle 218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-8-1 LOAD, LOAD NOT, AND, AND NOT, OR und OR NOT 219 . . . . . . . .
5-8-2 AND LOAD und OR LOAD 219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-9 Bitsteuerungs–Befehle 220 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-9-1 Ausgang und invertierter Ausgang – OUT und OUT NOT 220 . . . . . . . .
5-9-2 SET und RESET – SET und RSET 221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-9-3 KEEP (R–S–Flip Flop) – KEEP(11) 221 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ix

Inhaltsverzeichnis
5-9-4 DIFFERENTIATE UP and DOWN – DIFU(13) und DIFD(14)
5-10 KEIN VORGANG – NOP(00) 223 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-11 ENDE – END(01) 224 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-12 VERRIEGELUNG und VERRIEGELUNG LÖSCHEN – IL(02) und ILC(03) 224 .
5-13 SPRUNG und SPRUNGENDE – JMP(04) und JME(05) 226 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-14 Anwenderdefinierte Fehlerbefehle:
FAL(06) und FALS(07) – FAILURE ALARM AND RESET
und SEVERE FAILURE ALARM 227 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-15 Schrittbefehle:
STEP DEFINE und STEP START (Schritt und nächster Schritt) –
STEP(08)/SNXT(09) 228 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-16 Zeitgeber– und Zählerbefehle 230 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-16-1 TIMER (ZEITGEBER) – TIM 231 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-16-2 ZÄHLER – CNT 232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-16-3 CNTR (12) – REVERSIBLE COUNTER
5-16-4 HIGH–SPEED TIMER (SCHNELLER ZEITGEBER) – TIMH(15) 235 .
5-16-5 AUFSUMMIERENDER ZEITGEBER – TTIM(––) 236 . . . . . . . . . . . . .
5-16-6 INTERVAL TIMER (Intervall–Zeitgeber) – STIM(69) 238 . . . . . . . . . . .
5-16-7 REGISTER–COMPARISON TABLE
5-16-8 MODE CONTROL (Zählersteuerung) – INI(61) 251 . . . . . . . . . . . . . . . .
5-16-9 HIGH–SPEED COUNTER PV READ
5-17 Shift Instructions 257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17-1 SHIFT REGISTER (Schieberegister) – SFT(10) 257 . . . . . . . . . . . . . . . .
5-17-2 WORD SHIFT (Wortweises Verschieben) – WSFT(16) 258 . . . . . . . . . . .
5-17-3 ARITHMETIC SHIFT LEFT (Verschiebung nach links) – ASL (25) 258
5-17-4 ARITHMETIC SHIFT RIGHT
5-17-5 ROTATE LEFT (Rotation nach links) – ROL(27) 260 . . . . . . . . . . . . . . .
5-17-6 ROTATE RIGHT (Rotation nach rechts) – ROR(28) 260 . . . . . . . . . . . . .
5-17-7 ONE DIGIT SHIFT LEFT (Eine Stelle nach links verschieben) –
5-17-8 ONE DIGIT SHIFT RIGHT (Verschiebung um eine Stelle nach rechts) –
5-17-9 REVERSIBLE SHIFT REGISTER
5-17-10 ASYNCHRONOUS SHIFT REGISTER
5-18 Datenübertragungs–Befehle 265 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-18-1 MOVE (Übertragen) – MOV(21) 265 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-18-2 MOVE NOT (Invertiertes Übertragen) – MVN(22) 266 . . . . . . . . . . . . . .
5-18-3 BLOCK TRANSFER (Blockweise übertragen) – XFER(70) 267 . . . . . . .
5-18-4 BLOCK SET (Blockweise vorbesetzen) – BSET(71) 268 . . . . . . . . . . . . .
5-18-5 DATA EXCHANGE (Datenaustausch) – XCHG(73) 269 . . . . . . . . . . . . .
5-18-6 SINGLE WORD DISTRIBUTE (Datenverteilung) – DIST(80) 269 . . . .
5-18-7 DATA COLLECT (Daten sammeln) – COLL(81) 271 . . . . . . . . . . . . . . .
5-18-8 MOVE BIT (Bit übertragen) – MOVB(82) 273 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-18-9 MOVE DIGIT (Digit–Übertragung) – MOVD(83) 274 . . . . . . . . . . . . . . .
5-18-10 TRANSFER BITS – XFRB (Bits kopieren) 275 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-19 Vergleichsbefehle 276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-19-1 COMPARE (Vergleich) – CMP(20) 276 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-19-2 TABLE COMPARE (Tabellenver gleich) – TCMP(85) 277 . . . . . . . . . . . .
5-19-3 BLOCK COMPARE (Blockweiser Vergleich) – BCMP(68) 278 . . . . . . .
5-19-4 DOUBLE COMPARE (Doppeltgenauer Vergleich) – CMPL(60) 280 . . .
5-19-5 MULTI–WORD COMPARE (Mehrwort–Vergleich) – MCMP(19) 281 .
5-19-6 CPS(––) – SIGNED BINARY COMPARE (Vorzeichenbehaftete 16
5-19-7 CPSL(––) – DOUBLE SIGNED BINARY COMPARE
5-19-8 – AREA RANGE COMPARE (Bereichsvergleiche) – ZCP(––) 284 . . . .
5-19-9 DOUBLE AREA RANGE COMPARE
(Ausführung bei steigender/fallender Flanke) 222 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Aufwärts–/Abwärts–ZÄHLER) 234 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(VERGLEICHSTABELLE) – CTBL(63) 240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Schnellen Zähler–Istwert einlesen) – PRV (62) 253 . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Arithmetisches Verschieben nach rechts) – ASR(26) 259 . . . . . . . . . . . .
SLD(74) 261 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SRD(75) 262 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Links/Rechts–Schieberegister) – SFTR(84) 262 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Asynchrones Schieberegister) – ASFT (17) 264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bit–Binärwerte vergleichen) 282 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(vorzeichenbehaftete 32 Bit–Binärwerte vergleichen) 283 . . . . . . . . . . . .
(Doppelte Bereichsvergleiche) – ZCPL(––) 286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
x

Inhaltsverzeichnis
5-20 Konvertierungsbefehle 286 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-20-1 BCD–TO–BINARY (BCD–Binär–Konvertierung) – BIN(23) 286 . . . . . .
5-20-2 BINARY–TO–BCD (BIN–BCD–Konvertierung) – BCD(24) 287 . . . . . .
5-20-3 DOUBLE BINARY–TO–DOUBLE BCD
5-20-4 DOOUBLE BINARY–TO–DOUBLE BCD
5-20-5 4–TO–16 DECODER (4–in–16–Dekoder) – MLPX(76) 289 . . . . . . . . . .
5-20-6 16–TO–4 ENCODER (16–in–4–Enkoder) – DMPX(77) 291 . . . . . . . . . .
5-20-7 7–SEGMENT DECODER (Dekodierung für 7–Segment–Anzeige) –
5-20-8 ASCII CONVERT (ASCII–Konvertierung) – ASC(86) 296 . . . . . . . . . . .
5-20-9 ASCII–TO–HEXADECIMAL
5-20-10 SCALING (Skalierung) – SCL(66) 300 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-20-11 SIGNED BINARY TO BCD SCALING (Vorzeichenbehaftete
5-20-12 BCD TO SIGNED BINARY SCALING (Skalierung BCD zu
5-20-13 HOURS–TO–SECONDS (Stunden–in–Sekunden) – SEC(––) 306 . . . . . .
5-20-14 SECONDS–TO–HOURS (Sekunden–in–Stunden) – HMS(––) 307 . . . . .
5-20-15 COLUMN-TO-LINE(Spalte–zu–Zeile) – LINE(––) 308 . . . . . . . . . . . . .
5-20-16 LINE-TO-COLUMN (Zeile–zu–Spalte) – COLM(––) 309 . . . . . . . . . . . .
5-20-17 2’S COMPLEMENT (2er–Komplement) – NEG(––) 310 . . . . . . . . . . . . .
5-20-18 DOUBLE 2’S COMPLEMENT(Doppelwort–2er–Komplement) –
5-21 BCD–Rechenbefehle 313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-21-1 SET CARRY – STC(40) 313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-21-2 CLEAR CARRY – CLC(41) 313 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-21-3 BCD ADDITION (BCD–Addition) – ADD(30) 313 . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-21-4 BCD SUBTRACT (BCD–Subtraktion) – SUB(31) 314 . . . . . . . . . . . . . .
5-21-5 BCD MULTIPY (BCD–Multiplikation) – MUL(32) 316 . . . . . . . . . . . . .
5-21-6 BCD DIVIDE (BCD–Division) – DIV(33) 317 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-21-7 DOUBLE BCD ADD (Doppelwort BCD–Addition) – ADDL(54) 318 . .
5-21-8 DOUBLE BCD SUBTRACT
5-21-9 DOUBLE BCD MULTIPLY (Doppelwort BCD–Multiplikation) –
5-21-10 DOUBLE BCD DIVIDE (Doppelwort BCD–Division) – DIVL(57) 322 .
5-21-11 SQUARE ROOT – ROOT(72) 323 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-22 Binäre Rechenbefehle 324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-22-1 BINÄR ADD (Binäre Addition) – ADB(50) 324 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-22-2 SBB(51) – BINARY SUBTRACT (Binäre Subtraktion) 325 . . . . . . . . . .
5-22-3 BINARY MULTIPLY (Binäre Multiplikation) – MLB(52) 326 . . . . . . . .
5-22-4 BINARY DIVIDE (Binäre Division) – DVB(53) 327 . . . . . . . . . . . . . . . .
5-22-5 DOUBLE BINARY ADD – ADBL(––) 328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-22-6 DOUBLE BINARY SUBTRACT – SBBL(––) 329 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-22-7 SIGNED BINARY MULTIPLY – MBS(––) 331 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-22-8 DOUBLE SIGNED BINARY MULTIPLY – MBSL(––) 332 . . . . . . . . . .
5-22-9 SIGNED BINARY DIVIDE – DBS(––) 333 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-22-10 DOUBLE SIGNED BINARY DIVIDE – DBSL(––) 334 . . . . . . . . . . . . .
5-23 Spezielle mathematische Befehle 335 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-23-1 FIND MAXIMUM (Maximum suchen) – MAX(––) 335 . . . . . . . . . . . . .
5-23-2 FIND MINIMUM (Minimum suchen) – MIN(––) 336 . . . . . . . . . . . . . . .
5-23-3 AVERAGE VALUE (Mittelwerte berechnen) – AVG(––) 337 . . . . . . . . .
5-23-4 SUM (Addition) – SUM(––) 339 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-23-5 ARITHMETIC PROCESS – APR(––) 341 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-24 Mathematische Fließkomma–Befehle 343 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-24-1 FLIEßKOMMA ZU 16-BIT: FIX(––) 349 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-24-2 FLIEßKOMMA–ZU–32-BIT: FIXL(––) 350 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-24-3 16-BIT–ZU–FlIEßKOMMA: FLT(––) 351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-24-4 32-BIT–ZU–FLOATING: FLTL(––) 351 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-24-5 FLIEßKOMMA–ADDITION: +F(––) 352 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-24-6 FLIEßKOMMA–SUBTRAKTION: –F(––) 353 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-24-7 FLIEßKOMMA–MULTIPLIKATION: *F(––) 354 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Doppelwort BCD– Doppelwort BIN–Konvertierung) – BINL(58) 288 . .
(Doppelwort BIN– Doppelwort BCD–Konvertierung) – BCDL(59) 288 .
SDEC(78) 293 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(in Hexadezimal–Wort konvertieren) – HEX(––) 297 . . . . . . . . . . . . . . . .
Binärwerte in BCD–Worte konvertieren) – SCL2(––) 302 . . . . . . . . . . . .
vorzeichenbehaftetem Binärwert) – SCL3(––) 304 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NEGL(––) 311 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Doppelwort BCD–Subtraktion) – SUBL(55) 320 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MULL(56) 321 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
xi

Inhaltsverzeichnis
5-24-8 FLIEßKOMMA–DIVISION: /F(––) 356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-24-9 GRAD IN RADIANTEN: RAD(––) 357 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-24-10 RADIANTEN IN GRAD: DEG(––) 358 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-24-11 SINUS: SIN(––) 359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-24-12 KOSINUS: COS(––) 360 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-24-13 TANGENS: TAN(––) 361 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-24-14 ARKUSSINUS: ASIN(––) 362 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-24-15 ARKUSKOSINUS: ACOS(––) 363 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-24-16 ARC TANGENT: ATAN(––) 364 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-24-17 QUADRATWURZEL: SQRT(––) 365 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-24-18 EXPONENT: EXP(––) 366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-24-19 LOGARITHM: LOG(––) 367 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-25 Logikbefehl 368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-25-1 COMPLEMENT (Komplement) – COM(29) 368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-25-2 LOGICAL AND (Wortweise UND–Verknüpfung) – ANDW(34) 369 . . .
5-25-3 LOGICAL OR (Wortweise ODER–Verknüpfung) – ORW(35) 370 . . . . .
5-25-4 EXCLUSIVE OR (Wortweise EXKLUSIV–ODER–Verknüpfung) –
XORW(36) 370 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-25-5 EXCLUSIVE NOR (Wortweise EXKLUSIV–ODER–NICHT–
Verknüpfung) – XNRW(37) 371 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-26 Inkrementier/Dekrementier–Befehle 372 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-26-1 BCD INCREMENT (BCD–Inkrementierung) – INC(38) 372 . . . . . . . . . .
5-26-2 BCD DECREMENT (BCD–Dekrementierung) – DEC(39) 372 . . . . . . . .
5-27 Unterprogrammbefehle 373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-27-1 SUBROUTINE ENTER (Unterprogramm–Aufruf) – SBS(91) 373 . . . . .
5-27-2 SUBROUTINE DEFINE and RETURN (Unterprogramm–Anfang und
5-28 Spezielle Befehle 375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-28-1 TRSM(45) – TRACE MEMORY SAMPLING (Datenaufzeichnung). 375
5-28-2 MESSAGE DISPLAY (Meldungsanzeige) – MSG(46) 377 . . . . . . . . . . .
5-28-3 IORF(97) – I/O REFRESH (E/A–Auffrischung) 378 . . . . . . . . . . . . . . . .
5-28-4 MACRO (Unterprogramm–Struktur) – MCRO(99) 379 . . . . . . . . . . . . . .
5-28-5 BIT COUNTER (Bits zählen) – BCNT(67) 381 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-28-6 FRAME CHECKSUM (Rahmenprüfsumme berechnen) – FCS(––) 381 .
5-28-7 FAILURE POINT DETECTION (Fehlererkennung) – FPD(––)
5-28-8 INTERRUPT CONTROL (Interrupt–Steuerung) – INT(89) 387 . . . . . . .
5-28-9 SET PULSES (Impulsausgabe) – PULS(65) 389 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-28-10 SPEED OUTPUT (Geschwindigkeitsausgabe) – SPED(64) 391 . . . . . . . .
5-28-11 PULSE OUTPUT (Impulsausgabe) – PLS2(––) 393 . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-28-12 ACCELERATION CONTROL (Steuerung von Impulsausgaben) –
5-28-13 PULSE WITH VARIABLE DUTY FACTOR (Impulse mit variablen
5-28-14 DATA SEARCH (Datenbereiche durchsuchen) – SRCH(––) 399 . . . . . . .
5-28-15 PID CONTROL (PID–Regelung) – PID(––) 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-29 Netzwerk–Befehle 402 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-29-1 NETWORK SEND(Netzwerk senden) – SEND(90) 402 . . . . . . . . . . . . . .
5-29-2 NETZWERK EMPFANGEN – RECV(98) 406 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-29-3 FINS–BEFEHL ZUSTELLEN: CMND(––) 409 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-30 Kommunikationsbefehle 411 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-30-1 RECEIVE (Empfangen) – RXD(47) 411 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-30-2 TRANSMIT (Daten senden) – TXD(48) 414 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-30-3 SERIELLE SCHNITTSTELLENKONFIGURATION ÄNDERN –
5-30-4 PROTOKOLL–MAKRO – PMCR(––) 419 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-31 Besondere E/A–Befehle 422 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-31-1 7-SEGMENT–ANZEIGENAUSGABE – 7SEG(88) 422 . . . . . . . . . . . . .
5-31-2 Digitaler Eingangsschalter – DSW(87) 425 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-31-3 HKY(––) – HEXADECIMAL KEY INPUT
5-31-4 Dateneingabe über das Zehner–Tastenfeld – TKY(18) 431 . . . . . . . . . . . .
Unterprogramm–Ende) – SBN(92)/RET(93) 375 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Fehlerdiagnose) 383 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ACC(––) 395 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tastverhältnis) – PWM(––) 398 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
STUP(––) 417 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Eingabe von Daten über hexadezimales Tastenfeld) 428 . . . . . . . . . . . . .
xii

Inhaltsverzeichnis
Kapitel 6 – Host–Link–Befehle 435 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-1 Host–Link–Befehlsübersicht 436 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-2 Endecodes 436 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-2-1 Codes 436 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-2-2 Codes und verfügbare Befehle 438 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-3 Kommunikationsverfahren 438 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-4 Befehls– und Antwortformate 439 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-4-1 Befehle vom Host–Computer 439 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-4-2 Befehle von der SPS 443 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5 Host–Link–Befehle 444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-1 IR/SR–Bereich lesen –– RR 444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-2 LR–Bereich lesen –– RL 444 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-3 HR–Bereich lesen –– RH 445 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-4 Istwert lesen –– RC 445 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-5 Zeitgeber/Zählerstatus lesen –– RG 445 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-6 DM–Bereich lesen –– RD 446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-7 EM–Bereich lesen –– RE 446 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-8 AR–Bereich lesen –– RJ 447 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-9 IR/SR–Bereich speichern –– WR 447 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-10 LR–Bereich speichern –– WL 448 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-11 HR–Bereich speichern –– WH 448 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-12 Istwert speichern –– WC 449 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-13 TC–Status speichern –– WG 449 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-14 DM–Bereich speichern –– WD 450 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-15 EM–Bereich speichern –– WE 451 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-16 AR–Bereich speichern –– WJ 451 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-17 Sollwert lesen 1 –– R# 452 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-18 Sollwert lesen 2 –– R$ 453 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-19 Sollwert lesen 3 –– R% 454 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-20 Sollwert ändern 1 –– W# 455 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-21 Sollwert ändern 2 –– W$ 455 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-22 Sollwert ändern 3 –– W% 456 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-23 Status lesen –– MS 457 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-24 Status speichern –– SC 458 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-25 Fehler lesen –– MF 459 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-26 Zwangsweises Setzen –– KS 460 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-27 Zwangsweises Rücksetzen –– KR 461 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-28 Mehrfaches Setzen/Rücksetzen –– FK 462 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-29 Zwangsweises Setzen/Rücksetzen aufheben –– KC 463 . . . . . . . . . . . . . .
6-5-30 SPS–Modell lesen –– MM 464 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-31 TEST–– TS 464 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-32 Programm lesen –– RP 465 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-33 Programm speichern –– WP 465 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-34 Multi–Bereichsspezifikationsbefehl –– QQ 465 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-35 Abbruch –– XZ 467 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-36 Initialisieren –– :: 467 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-37 TXD–Antwort –– EX 468 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6-5-38 Undefinierter Befehl –– IC 468 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitel 7 – CPU–Baugruppenbetrieb und Verarbeitungszeit 469 . . . . . . . . . . .
7-1 CPU–Baugruppenvorgänge 470 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-2 Versorgungsspannungsunterbrechungen 471 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-2-1 Vorgänge bei einem Versorgungsspannungsausfall 471 . . . . . . . . . . . . . . .
7-2-2 Einschaltvorgänge nach einer Versorgungsspannungunterbrechung 472 .
7-3 Zykluszeit 474 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-3-1 Übersicht 474 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-3-2 Befehlsausführungszeiten 476 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-3-3 E/A–Reaktionszeit 487 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-3-4 1:1 Link–E/A–Ansprechzeit 488 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7-3-5 Interrupt–Verarbeitungszeit 490 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
xiii

Inhaltsverzeichnis
Kapitel 8 – Fehlersuche 493 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-1 Einführung 494 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-2 Fehlermeldung der Programmierkonsole 494 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-3 Programmierfehler 495 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-4 Anwenderdefinierte Fehler 496 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-5 Betriebsfehler 497 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-5-1 Geringfügige Fehler 497 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-5-2 Schwerwiegende Fehler 499 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-6 Fehlerprotokoll 500 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8-7 Ablaufdiagramm zur Fehlerbehebung 502 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anhang 509 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A – Programmierbefehle 509 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B – Fehler– und Artihmetikmerker 515 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C – Speicherbereiche 519 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D – Verwendung der Uhr 535 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E – E/A–Zuweisungsblatt 537 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
F – Programmierblatt 539 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
G – Liste der FAL–Nummern 543 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H – Erweiterte ASCII–Codes 545 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDEX
xiv

Vorsichtsmaßnahmen
Dieses Kapitel beschreibt die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit Speicherprogrammierbaren Steuerungen
(SPS) und verwandten Geräten.
Diese Informationen sind sehr wichtig für eine sichere und zuverlässige Anwendung der SPS. Lesen Sie die Vorsichts–
maßnahmen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation oder Inbetriebnahme eines SPS–Systems beginnen.
1 Zielgruppe xiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1–1 Generelle Vorsichtsmaßnahmen xiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Sicherheitsmaßnahmen xiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Betriebsumgebungs–Sicherheitsvorkehrungen xvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 Anwendungs–Sicherheitsvorkehrungen xvi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Übereinstimmung mit den EC–Richtlinien xix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1 Anwendbare Richtlinien xix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2 Konzepte xix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3 Übereinstimmung mit den EC–Richtlinien xix . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-4 Störungsreduzierung der Relaisausgänge xx . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
xiii

1 Zielgruppe
Dieses Handbuch ist zum Gebrauch für die nachfolgend aufgeführten Personengruppen bestimmt, die über Kenntnisse auf dem Gebiet elektrischer Sys–
teme verfügen sollten (Elektroingenieure oder ähnliche):
• Personen, deren Aufgabengebiet die Installation von Automatisierungs–
Systemen ist.
• Personen, deren Aufgabengebiet der Entwurf von Automatisierungs–Sys–
temen ist.
• Personen, deren Aufgabengebiet der Betrieb und die Überwachung von
Automatisierungs–Systemen ist.
1-1 Generelle Vorsichtsmaßnahmen
Der Anwender darf das Produkt nur entsprechend den in diesem Handbuch
niedergelegten Vorgaben einsetzen.
Bevor Sie dieses Produkt unter Bedingungen anwenden, die nicht in diesem
Handbuch beschrieben sind oder das Produkt in nuklearen Steuerungssystemen, Bahnnetzen, Luftfahrtsystemen, Fahrzeugen, Verbrennungssystemen,
medizinischen Geräten, Glücksspielautomaten, Sicherheitsgeräten und anderen Systemen, Maschinen und Geräten anwenden, die bei unsachgemäßer Anwendung ernsthaften Einfluss auf Leben und Eigentum haben, konsultieren Sie bitte Ihre OMRON–Vertretung.
Stellen Sie sicher, dass die Nennleistungen und Betriebsmerkmale des Produktes den Anforderungen der Systeme, Maschinen und Anlagen genügen.
Die Systeme, Maschinen und Anlagen ihrerseits sollten mit Doppel–Sicherheitsmechanismen ausgestattet sein.
Dieses Handbuch enthält Informationen über die Installation und den Betrieb
von OMRON SPS–Systemen. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor
Sie die Software anwenden. Halten Sie das Handbuch zur weiteren Information bereit.
2Sicherheitsmaßnahmen
WARNUNG Die SPS und alle SPS–Baugruppen dürfen nur für die im Handbuch
!
spezifizierten Zwecke und nur unter den spezifizierten Vorgaben eingesetzt
werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Anlage als solche eine
Gefahr für Leib und Leben von Personen in sich birgt. Setzen Sie sich mit
der nächsten OMRON–Niederlassung in Verbindung, wenn Sie die SPS in
einem der oben erwähnten Systeme einsetzen wollen.
2 Sicherheitsmaßnahmen
WARNUNG Die CPU–Baugruppe frischt die E/A auch dann auf, wenn das Programm
!
gestoppt wird (d. h. auch in der PROGRAM–Betriebsart). Achten Sie auf
ausreichende Sicherheitsmaßnahmen, bevor Sie den Status der Speicher
ändern, die den E/A–Baugruppen, erweiterten E/A–Baugruppen oder
Spezialmodulen zugewiesen sind. Änderungen von Daten, die irgendeiner
Baugruppe zugewiesen sind, können zu einem unerwarteten Betrieb von den
Lasten, die an diese Baugruppen angeschlossen sind, führen. Jede der
folgenden Funktionen kann zu Änderung des Speicherstatus führen:
• Übertragung von E/A–Speicherdaten in die CPU–Baugruppe über ein
Programmiergerät.
• Änderung der aktuellen Werte über ein Programmiergerät.
• Zwangsweises Setzen/Rücksetzen von Bits über ein Programmiergerät.
• Übertragung des E/A–Speichers von einem Host–Computer oder einer
anderen SPS in einem Netzwerk.
xiv
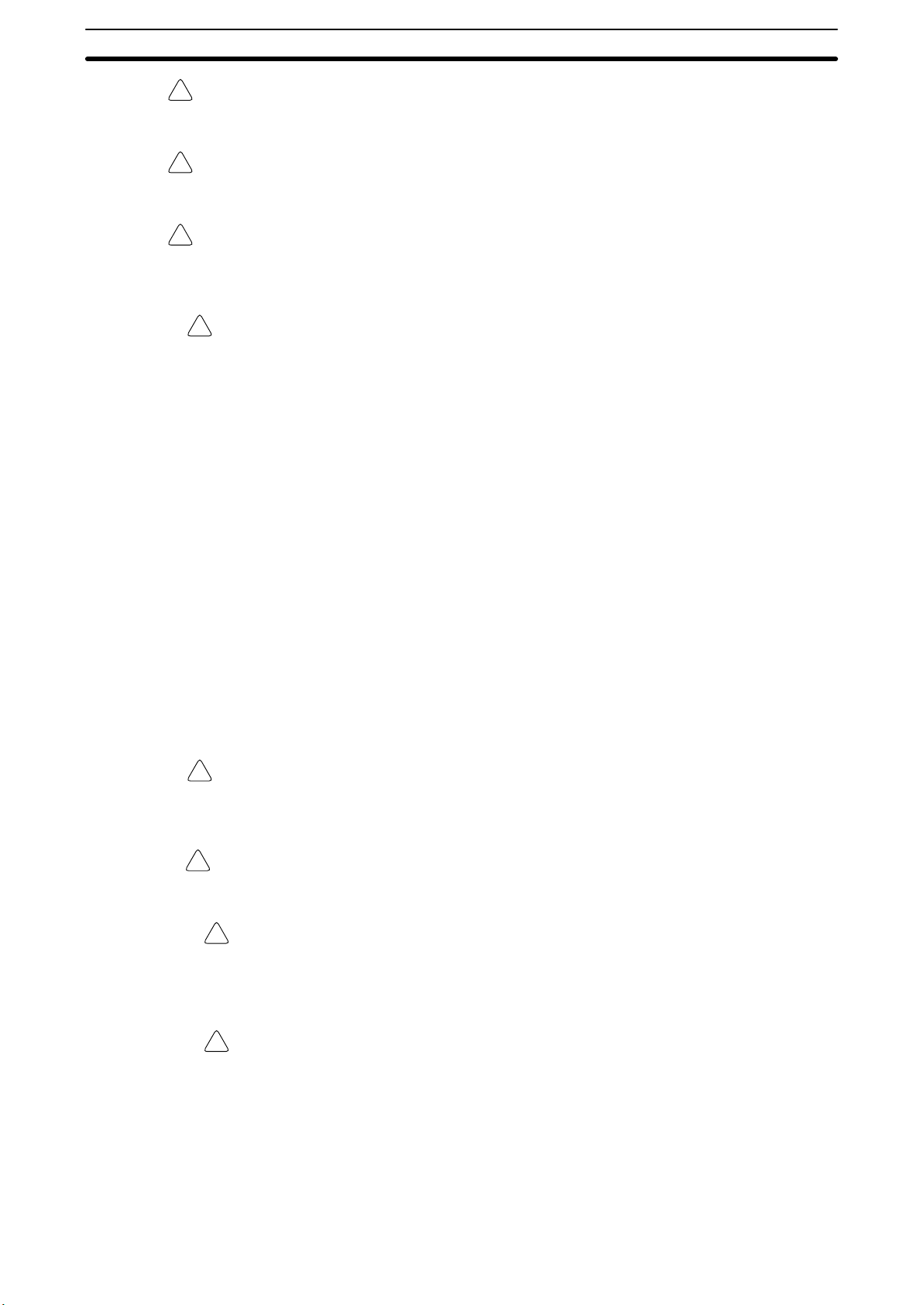
WARNUNG Versuchen Sie keinesfalls bei anliegender Spannung eine Baugruppe zu
!
zerlegen. Andernfalls kann ein elektrischer Schlag verursacht werden.
WARNUNG Berühren Sie keine Klemmen oder Klemmenblöcke bei anliegender
!
Spannung. Andernfalls kann ein elektrischer Schlag verursacht werden.
WARNUNG Versuchen Sie nicht, die Baugruppe zu zerlegen, selbst zu reparieren oder
!
zu verändern. Andernfalls könnten Fehlfunktionen, Feuer oder elektrische
Schocks hervorgerufen werden.
WARNUNG Sorgen Sie für entsprechende Sicherheitsmaßnahmen in externen
!
Schaltungen (d. h. außerhalb der SPS), einschließlich der nachfolgenden
Angaben, um das System bei Fehlfunktionen der SPS oder vor anderen
externen Faktoren, die den SPS–Betrieb stören, zu schützen. Andernfalls
können ernsthafte Unfälle verursacht werden.
• NOT–AUS–Schalter, Verriegelungs–Schalter, Grenzschalter und ähnliche
Sicherheitsmaßnahmen müssen in den externen Steuerschaltungen
vorhanden sein.
• Die SPS schaltet alle Ausgänge aus, wenn die Selbstdiagnose–Funktion
einen Fehler erfasst oder wenn ein ernster Fehleralarm (FALS)–Befehl
ausgeführt wird. Als Gegenmaßnahme müssen externe
Sicherheitsmaßnahmen zur Sicherheit des Systems veranlasst werden.
• Die SPS–Ausgänge könnten bei Ablagerungen oder Verbrennungen der
Ausgangsrelais oder Zerstörung der Ausgangstransistoren ein– bzw.
ausgeschaltet bleiben. Als Gegenmaßnahme müssen externe
Sicherheitsmaßnahmen zur Sicherheit des Systems veranlasst werden.
• Wenn der 24-VDC–Ausgang (Versorgungsspannung für die SPS)
überlastet oder kurzgeschlossen wird, könnte die Spannung abfallen und
dazu führen, dass die Ausgänge ausschalten. Als Gegenmaßnahme
müssen externe Sicherheitsmaßnahmen zur Sicherheit des Systems
veranlasst werden.
2Sicherheitsmaßnahmen
WARNUNG Berühren Sie die Spannungsversorgung nicht bei anliegender Spannung oder
!
unmittelbar nach Ausschalten der Spannung. Dies kann zum elektrischen
Schlag führen.
Vorsicht Führen Sie eine Online–Editierung nur dann aus, wenn sichergestellt ist,
!
dass keine nachteiligen Folgen durch Erhöhung der Zykluszeit entstehen.
Andernfalls sind die Eingangssignale nicht lesbar.
Vorsicht Achten Sie auf Sicherheitsvorkehrungen des Zielteilnehmers, bevor Sie ein
!
Programm an einen anderen Teilnehmer übertragen oder den Inhalt des
E/A–Speicherbereichs ändern. Andernfalls könnten Verletzungen verursacht
werden.
Vorsicht Ziehen Sie die Schrauben des Klemmenblocks der
!
AC–Spannungsversorgungsbaugruppe gemäß den Spezifikationen in dem
Handbuch mit dem entsprechenden Drehmoment fest. Andernfalls könnten
Verbrennungen oder Fehlfunktionen verursacht werden.
xv

3 Betriebsumgebungs–Sicherheitsvorkehrungen
Vorsicht Vom Betrieb des Steuerungssystems sollte bei Vorliegen einer der nachste-
!
hend beschriebenen Umständen abgesehen werden
• direkte Sonneneinstrahlung,
• Umgebungstemperatur und relative Luftfeuchtigkeit außerhalb der spezifi-
zierten Toleranzbereiche,
• Kondensation als Folge erheblicher Temperaturschwankungen,
• ätzende oder leicht entflammbare Gase,
• Stäube (insbesondere Eisenstäube) oder Salze,
• Vorhandensein von Wasser, Öl oder Chemikalien,
• Erschütterungen oder Vibrationen
Vorsicht Führen Sie ausreichende Gegenmaßnahmen durch, wenn Sie auf die nach-
!
folgenden Umgebungsbedingungen treffen:
• elektrostatische oder andere Störungen,
• starke elektromagnetische Felder,
• Auftreten von Radioaktivität,
• Nähe zu Netzleitungen.
4Anwendungs–Sicherheitsvorkehrungen
Vorsicht Die Umgebungsbedingungen des SPS–Systems haben auf die Lebensdauer
!
und Zuverlässigkeit des Systems einen erheblichen Einfluss. Unzureichende
Umgebungsbedingungen können zu Fehlfunktion, Systemausfall und anderen unvorhersehbaren Problemen im SPS–Betrieb führen. Stellen Sie sicher,
dass die Umgebungsbedingungen sowohl bei der Installation als auch während des späteren Betriebs innerhalb der spezifizierten Toleranzbereiche liegen.
4 Anwendungs–Sicherheitsvorkehrungen
Beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen, wenn Sie das SPS–Sys–
tem verwenden.
WARNUNG Befolgen Sie stets die Vorsichtsmaßnahmen. Nichtbeachten der folgenden
!
Sicherheitsmaßnahmen kann zu schweren und schwersten
Gesundheitsschäden führen.
• Erden Sie das System bei der Installation der Baugruppen. Andernfalls kann
ein elektrischer Schlag verursacht werden.
• Eine Erdung muss installiert werden, wenn die GR– und LG–Klemmen an
der Spannungsversorgungsbaugruppe kurzgeschlossen werden.
• Schalten Sie die Spannungsversorgung der SPS stets aus, bevor Sie eine der
nachfolgend aufgeführten Handlungen durchführen. Andernfalls könnten
Fehlfunktionen oder ein elektrischer Schock verursacht werden.
• Einbau oder Ausbau der E/A–Baugruppen, CPU–Baugruppen, Spezialmodule oder anderer Baugruppen.
• Zusammenbau der Baugruppen.
• Einstellung der DIP–Schalter oder Drehschalter.
• Verbinden oder Verdrahten von Kabel.
• Verbinden oder Trennen von Anschlüssen.
xvi
Vorsicht Nichtbeachten der folgenden Vorsichtsmaßnahmen kann zu Fehlfunktionen
!
der SPS oder des Systems führen und die SPS bzw. die SPS–Baugruppe
beschädigen. Befolgen Sie stets die Vorsichtmaßnahmen.

4Anwendungs–Sicherheitsvorkehrungen
• Schalten Sie immer zuerst die Spannung der SPS ein, bevor Sie das
Steuerungssystem einschalten. Wenn die Spannungsversorgung der SPS
nach Einschalten des Steuerungssystems erfolgt, können kurzzeitige
Fehler in den Signalen des Steuerungssystems auftreten, da die
Ausgangsklemmen der DC–Ausgangsbaugruppe und anderer Baugruppen
kurzzeitig einschalten, wenn die Spannung der SPS eingeschaltet wird.
• Der Anwender muss entsprechende Maßnahmen einleiten, um die
Sicherheit zu gewährleisten, wenn die Ausgänge der Ausgangsbaugruppe
aufgrund von internen Schaltungsfehlern, die in Relais, Transistoren und
anderen Bauteilen auftreten können, eingeschaltet bleiben.
• Der Anwender muss entsprechende Maßnahmen einleiten, um auch für den
Fall falscher, fehlender oder abnormaler Signale, bedingt durch unterbrochene Signalleitungen bzw. vorübergehende Spannungsunterbrechungen,
die Sicherheit zu gewährleisten.
• Schalten Sie die Spannungsversorgung nicht aus, während Daten übertragen werden, insbesondere beim Schreiben und Lesen in eine Speicherkarte.
• Wenn der E/A–Systemhaftmerker (SR 25212) eingeschaltet wird, werden die
Ausgänge der SPS nicht ausgeschalten; sie behalten ihren vorherigen Status,
wenn die SPS von der RUN– oder MONITOR–Betriebsart auf die PROGRAM–Betriebsart umgeschaltet wird. Achten Sie in diesem Fall darauf, dass
externe Lasten keine gefährlichen Situationen herbeiführen. (Wird der Betrieb
aufgrund eines schwerwiegenden Fehlers oder aufgrund von Fehlern, die
durch den Befehl FALS(07) hervorgerufen werden, angehalten, werden alle
Ausgänge der Ausgangsbaugruppe ausgeschalten und nur der interne Ausgangsstatus bleibt erhalten.)
• Wenn eine Spannungsversorgung von 200 bis 240 V AC von einer
CQM1-PA216–Spannungsversorgungsbaugruppe geliefert wird, entfernen
Sie immer die Metall–Brücke von den Spannungsauswahl–Klemmen. Das
Produkt könnte bei einer Spannung von 200 bis 240 V AC geschädigt
werden, wenn die Metall–Brücke angebracht ist.
• Legen Sie immer die in dem Technischen Handbuch spezifizierte Spannung
an. Eine falsche Spannung kann zu Fehlfunktionen oder Bränden führen.
• Führen Sie entsprechende Maßnahmen durch, um sicherzustellen, dass die
spezifizierte Leistung mit der Nennspannung und Frequenz geliefert wird, insbesondere in Gegenden mit instabiler Spannungsversorgung. Eine falsche
Spannungsversorgung kann zu Fehlfunktionen führen.
• Installieren Sie externe Trennschalter und andere Sicherungen, um Kurzschlüsse in der externen Verdrahtung zu vermeiden. Andernfalls kann ein
Brand verursacht werden.
• Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Eingangsbaugruppen der Nenneingangsspannung entspricht. Überspannungen können Brände verursachen.
• Stellen Sie sicher, dass die Spannungen oder angeschlossenen Lasten der
maximalen Schaltkapazität entsprechen. Überspannungen oder zu große
Lasten können Brände verursachen.
• Trennen Sie immer die FG–Klemme ab, wenn Sie einen Durchschlags–
Spannungstest durchführen. Andernfalls können Brände verursacht werden.
• Installieren Sie alle Baugruppen ordnungsgemäß entsprechend den Anleitungen in den Technischen Handbüchern. Eine falsche Installation der Baugruppen kann einen fehlerhaften Betrieb verursachen.
• Stellen Sie sicher, dass alle Montageschrauben, Klemmenschrauben und
Kabelsteckerschrauben gemäß den Spezifikationen in den Handbüchern
mit einem entsprechenden Drehmoment fest angezogen sind. Andernfalls
können Fehlfunktionen verursacht werden.
xvii

4Anwendungs–Sicherheitsvorkehrungen
• Entfernen Sie beim Verdrahten nicht die Schutzaufkleber von der Baugruppe.
Andernfalls könnten Fehlfunktionen auftreten, wenn Fremdkörper in die Baugruppe gelangen.
• Entfernen Sie die Schutzaufkleber nach Abschluss der Verdrahtung, um ordnungsgemäße Wärmeabfuhr zu gewährleisten. Andernfalls können Fehlfunktionen auftreten.
• Verwenden Sie für die Verdrahtung Kabelschuhe. Schließen Sie keine blanken, verdrillten Leitungen direkt an die Klemmen an. Andernfalls können
Brände verursacht werden.
• Verdrahten Sie alle Anschlüsse korrekt.
• Überprüfen Sie alle Verdrahtungen und Schaltereinstellungen nochmals, be-
vor Sie die Spannungsversorgung einschalten. Andernfalls können Brände
verursacht werden.
• Bauen Sie die Baugruppe erst ein, nachdem alle Klemmenblöcke und Steckverbinder überprüft wurden.
• Bevor Sie die Baugruppe berühren, berühren Sie erst einen geerdeten metallischen Gegenstand, um jede statische Aufladung zu vermeiden. Andernfalls
könnten Fehlfunktionen oder Beschädigungen verursacht werden.
• Achten Sie darauf, dass die Steckverbinder, Klemmenblöcke, Anschlusskabel
und andere Teile mit Verriegelung sicher verriegelt sind. Andernfalls können
Fehlfunktionen verursacht werden.
• Überprüfen Sie die Schaltereinstellung, die Inhalte des DM–Bereichs und andere Einstellungen vor dem Betriebsstart. Andernfalls könnte ein fehlerhafter
Betrieb verursacht werden.
• Prüfen Sie das Anwenderprogramm auf korrekte Ausführung, bevor Sie es auf
der SPS ablaufen lassen. Andernfalls könnte ein fehlerhafter Betrieb verursacht werden.
• Stellen Sie sicher, dass keine nachteiligen Folgen auftreten, bevor Sie die folgenden Handlungen durchführen. Andernfalls könnte ein fehlerhafter Betrieb
verursacht werden.
• Änderung der Betriebsart der SPS.
• Zwangssetzen und Zwangsrücksetzen von Bits im Speicher
• Ändern von Istwerten der Worte oder Sollwerten im Speicher.
• Nehmen Sie den Betrieb erst auf, nachdem der Inhalt der DM– und HR–Berei-
che und andere Daten in die neue CPU–Baugruppe übertragen wurde. Andernfalls kann ein unvorhersehbarer Betrieb verursacht werden.
• Die Kabel dürfen nicht mit übermäßiger Kraft gezogen oder gebogen werden.
Andernfalls können die Kabel brechen.
• Legen Sie keine Gegenstände auf die Kabel. Andernfalls können die Kabel
brechen.
• Achten Sie beim Austausch von Teilen darauf, dass die Leistungsmerkmale
der neuen Teile korrekt sind. Andernfalls können Fehlfunktionen oder Brände
verursacht werden.
• Decken Sie die Leiterplatten beim Transport oder Lagern mit einem antistatischen Material ab, um sie vor elektrostatischer Aufladung zu schützen und
sorgen Sie für eine geeignete Lagertemperatur.
• Berühren Sie die Rückseite der Leiterplatten oder deren internen Komponente
nicht mit bloßen Fingern. Scharfe Drähte und andere Teile können zu Verletzungen führen.
• Die Batterieklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden und die Batterie
darf nicht geladen, zerlegt, erhitzt oder verbrannt werden. Die Batterie darf
keinen starken Stößen ausgesetzt werden. Andernfalls könnte die Batterie
Auslaufen, Hitze erzeugen oder entzünden. Entsorgen Sie jede Batterie,
die zu Boden gefallen ist, oder auf andere Weise starken Stößen
ausgesetzt wurde. Andernfalls könnte die Batterie bei weiterer Verwendung
auslaufen.
xviii

• Entsprechend den UL–Standards dürfen Batterien nur von erfahrenen
Technikern ersetzt werden. Stellen Sie sicher, dass keine anderen
Personen die Batterien ersetzen.
5 Übereinstimmung mit den EC–Richtlinien
5-1 Anwendbare Richtlinien
• EMV–Richtlinien
• Niederspannungsrichtlinie
5-2 Konzepte
EMV–Richtlinien
OMRON–Produkte, die den EC–Richtlinien entsprechen, entsprechen
außerdem den zugehörigen EMV–Standards, so dass sie einfach in andere
Geräte und Maschinen installiert werden können. Die aktuellen Produkte
wurden auf Übereinstimmung mit den EMV–Standards überprüft (sehen Sie
den folgenden Hinweis). Ob die Produkte mit den Standards in dem System
übereinstimmen, muss jedoch vom Kunden sichergestellt werden.
OMRON–Produkte mit EMV–Leistung, die den EC–Richtlinien entsprechen,
variieren in Abhängigkeit mit Konfiguration, Verdrahtung und anderen
Bedingungen der Ausrüstung und Schaltschrank, in die das OMRON–Gerät
installiert ist. Der Kunde muss daher abschließende Untersuchungen
durchführen, um sicherzustellen, dass die Geräte und das gesamte System
mit den EMV–Standards übereinstimmen.
5Übereinstimmung mit den EC–Richtlinien
Hinweis Anwendbare EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)–Standards sind wie
folgt:
EMS (Elektromagnetische Anfälligkeit): EN61131-2
EMI (Elektromagnetische Beeinflussung): EN50081-2
(Störausstrahlung: 10m Bestimmung)
Niederspannungs–Richtlinie
Achten Sie immer darauf, dass Geräte, die mit einer Spannung von 50 bis 1.000
V AC oder 75 bis 1.500 V DC betrieben werden, den erforderlichen
Sicherheitsstandards der SPS entsprechen (EN61131-2).
5-3 Übereinstimmung mit den EC–Richtlinien
Die SPS der CQM1H-Serie entsprechen den EC–Richtlinien. Um
sicherzustellen, dass die Maschine oder das Gerät, in dem die SPS der
CQM1H-Serie verwendet wird, den EC–Richtlinien entspricht, müssen bei
der Installation der SPS folgende Punkte berücksichtigt werden:
1, 2, 3...
1. Die SPS muss in einen Schaltschrank installiert werden.
2. Eine verstärkte Isolierung oder Doppelisolierung muss für die
DC–Spannungsversorgungen, die für die Kommunikations– und
E/A–Spannungsversorgungen verwendet werden, vorhanden sein.
3. SPS, die den EC–Richtlinien entsprechen, entsprechen auch dem
CE–Standard (EN50081-2). Wenn eine SPS in eine Maschine installiert
wird, können jedoch Störungen auftreten, die beim Umschalten der
Geräte mit Hilfe von Relaisausgängen verursacht werden, wodurch die
Übereinstimmung mit den Standards nicht mehr gegeben ist. In diesem
Fall muss ein Überspannungsschutz angeschlossen oder andere
Maßnahmen ergriffen werden.
Nachfolgend werden typische Verfahren zur Reduzierung von Störungen
aufgeführt, die nicht in allen Fällen ausreichend sind. Die erforderlichen
Gegenmaßnahmen sind abhängig von dem an dem Schaltschrank
angeschlossenen Gerät, der Verdrahtung, der Konfiguration des
Systems und anderen Bedingungen.
xix

5-4 Störungsreduzierung der Relaisausgänge
Die SPS der CQM1H-Serie entspricht den CE–Standards (EN50081-2) der
EMV–Richtlinien. Störungen, die durch Schalten des Relaisausgangs
erzeugt wurden, entsprechen nicht diesen Standards. In diesem Fall muss
ein Entstörfilter an die Lastseite angeschlossen oder andere geeignete
Maßnahmen ergriffen werden.
Maßnahmen, die zur Übereinstimmung mit den Standards erforderlich sind,
sind abhängig von den Geräten auf der Lastseite, der Verdrahtung, der
Konfiguration des Systems usw. Nachfolgend werden Beispiele zur
Reduzierung von Störungen aufgeführt.
Gegenmaßnahmen
Für weitere Einzelheiten sehen Sie EN50081-2.
Gegenmaßnahmen sind nicht erforderlich, wenn die Frequenz der
Lastschaltung für das gesamte System einschließlich SPS unter 5 Mal pro
Minute liegt.
Gegenmaßnahmen sind erforderlich, wenn die Frequenz der Lastschaltung
für das gesamte System einschließlich SPS bei 5 Mal pro Minute oder
darüber liegt
5Übereinstimmung mit den EC–Richtlinien
xx
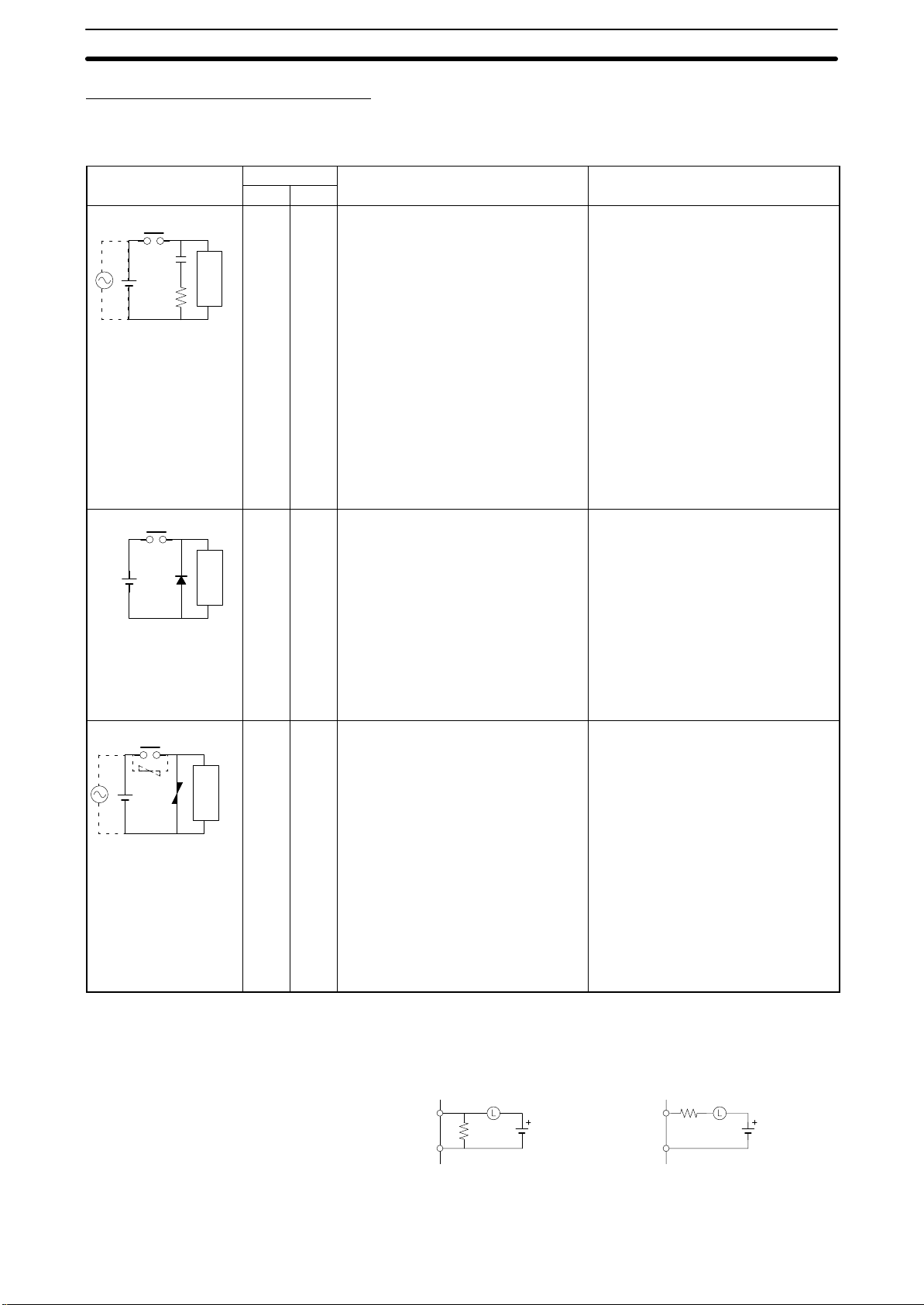
Beispiele für Gegenmaßnahmen
Schließen Sie beim Schalten einer induktiven Last einen
Überspannungschutz, Dioden oder ähnliche Schutzeinrichtungen parallel zur
Last oder dem Kontakt an, wie nachfolgend dargestellt.
Schaltung Strom Kenndaten Erforderliches Element
AC DC
CR–Verfahren
Spann.–
versorgung
Dioden–Verfahren
Spann.–
Spann.–
Spann.–
Spann.–
versorgung
versorgung
versorgung
versorgung
VDR–Widerstand
Spann.–
versorgung
Induktive
Last
Induktive
Last
Induktive
Last
Ja Ja
Nein Ja
Ja Ja
Wenn die Last ein Relais oder
Elektromagnet ist, entsteht zwischen
dem Zeitpunkt, wenn die Schaltung
geöffnet wird, und dem Zeitpunkt,
wenn die Last zurückgesetzt wird,
eine Verzögerung.
Wenn die Spannungsversorgung 24
oder 48 V beträgt, setzen Sie einen
Überspannungsschutz parallel zur
Last ein. Wenn die
Spannungsversorgung 100 bis 200 V
beträgt, setzen Sie einen
Überspannungsschutz zwischen den
Kontakten ein.
Die Diode, die parallel an die Last
angeschlossen ist, ändert die in der
Spule gespeicherte Energie in Strom,
der dann in die Spule fließt, so dass
der Strom durch den Widerstand der
induktiven Last in Wärme
umgewandelt wird.
Diese Verzögerung zwischen dem
Zeitpunkt, wenn die Schaltung
geöffnet wird, und dem Zeitpunkt,
wenn die Last zurückgesetzt wird, ist
länger als bei dem CR–Verfahren.
Das Verfahren mit VDR–Widerstand
verhindert durch Verwendung der
konstanten Spannungskenndaten des
VDR–Widerstands, die Erzeugung
von hohen Spannungen zwischen den
Kontakten. Zwischen dem Zeitpunkt,
wenn die Schaltung geöffnet wird, und
dem Zeitpunkt, wenn die Last
zurückgesetzt wird, entsteht eine
Verzögerung.
Wenn die Versorgungsspannung 24
oder 48 V beträgt, setzen Sie den
VDR–Widerstand parallel zur Last ein.
Wenn die Versorgungsspannung 100
bis 200 V beträgt, setzen Sie den
VDR–Widerstand parallel zu den
Kontakten ein.
Bei Schalten einer Last mit hohem Einschaltstrom, wie z. B. einer
Glühlampe, unterdrücken Sie den Einschaltstrom wie nachfolgend
dargestellt.
5Übereinstimmung mit den EC–Richtlinien
Die Kapazität des Kondensators muss
1 bis 0,5 µF pro Kontaktstrom von 1 A
und der Widerstand muss 0,5 bis 1 Ω
pro Kontaktspannung von 1 V
betragen. Diese Werte variieren
jedoch in Abhängigkeit mit der Last
und den Kenndaten des Relais. Legen
Sie die Werte anhand eines Tests fest,
und beachten Sie, dass die Kapazität
die Funkenentladung unterdrückt,
wenn die Kontakte getrennt werden,
und der Widerstand begrenzt den
Strom, der in die Last fließt, wenn die
Schaltung wieder geschlossen wird.
Die Durchschlagfestigkeit des
Kondensators muss zwischen 200
und 300 V liegen. Bei einer
AC–Schaltung verwenden Sie einen
Kondensator ohne Polarität.
Der Wert der Durchschlagfestigkeit
der Diode muss mind. 10 Mal so groß
wie der Spannungswert der Schaltung
sein. Der Vorwärtsstrom der Diode
muss gleich oder größer als der
Laststrom sein.
Der Wert der Durchschlagfestigkeit
der Diode kann zwei– oder dreimal so
groß wie die Spannungsversorgung
sein, wenn der Überspannungsschutz
auf die elektronische Schaltung mit
niedriger Betriebsspannung
angewandt wird.
---
Gegenmaßnahme 1
OUT
R
COM
Mit Dunkelstrom von ca. ein Drittel
des Nennwertes einer Glühlampe
Gegenmaßnahme 2
R
OUT
COM
Mit Grenzwiderstand
xxi

KAPITEL 1
SPS–Konfiguration und andere Merkmale
Dieser Abschnitt beschreibt die SPS–Konfiguration und andere CQM1H–Merkmale, einschließlich Interrupt–Verarbeitung
und Kommunikation. Die SPS–Konfiguration wird zur Steuerung der Betriebsparameter der CQM1H verwendet. Sehen Sie
das CQM1H Technisches Handbuch zur Änderung der SPS–Konfiguration über die Programmierkonsole. Sehen Sie das CX-
Programmer Handbuch für Verfahren mit dem CX–Programmer.
Lesen Sie Abschnitt 1-4 SPS–Konfiguration, falls Sie nicht mit OMRON–SPS–Systemen oder der Kontaktplanprogrammierung vertraut sind, als eine Übersicht über die für die CQM1H zur Verfügung stehenden Betriebsparameter; lesen Sie ebenfalls Abschnitt 3 Speicherbereiche, Abschnitt 4 Kontaktplanprogrammierung und Abschnitt 5 Befehlssatz, bevor Sie den
nächsten Abschnitt beginnen.
1-1 SPS–Konfiguration 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1-1 Änderung der SPS–Konfiguration 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1-2 Einstellungen des seriellen Kommunikationsmoduls 3 . . . . . . . . . . . . . .
1-1-3 SPS–Konfigurationseinstellungen 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2 Spezialmodul–Einstellungen 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2-1 Einstellungen für ein serielles Kommunikationsmodul 9 . . . . . . . . . . . .
1-2-2 Einstellungen für ein Schneller Zähler–Modul 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2-3 Einstellungen für ein Impuls–E/A–Modul 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2-4 Einstellungen für ein Absolutwertencoder–Schnittstellenmodul 10 . . . . .
1-2-5 Einstellungen für ein Analog–E/A–Modul 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3 Basis–SPS–Betrieb und E/A–Verarbeitungen 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3-1 Einschaltbetriebsart 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3-2 Systemhaftmerker–Status 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3-3 RS–232–Schnittstellen–Service–Zeit 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3-4 Service–Zeit der Peripherieschnittstelle 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3-5 Kleinste Zykluszeit 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3-6 Eingangs–Zeitkonstanten 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3-7 Schnelle Zeitgeber 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3-8 DSW(87) Eingabestellen und Ausgangs–Auffrischungsverfahren 16 . . . .
1-3-9 Peripherieschnittstellen–Einstellungen 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-3-10 Fehlerprotokoll–Einstellungen 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4 Interrupt–Funktionen 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4-1 Interrupt–Arten 18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4-2 Eingangs–Interrupts 21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4-3 Maskierung aller Interrupts 28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4-4 Intervall–Zeitgeber–Interrupts 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4-5 Schneller Zähler 0–Interrupts 32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-4-6 Schneller Zähler 0–Über–/Unterlauf 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-5 Impulsausgabefunktion 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6 Kommunikationsfunktionen 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6-1 Host–Link und Ohne–Protokoll–Kommunikationseinstellungen 47 . . . . .
1-6-2 Host–Link–Kommunikationseinstellungen und –verfahren 49 . . . . . . . . .
1-6-3 Ohne Protokoll–Kommunikationseinstellungen und –verfahren 51 . . . . .
1-6-4 1:1–Data–Links 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6-5 NT–Link 1:1–Mode–Kommunikation 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-6-6 Verdrahtung der Schnittstellen 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-7 Berechnung von vorzeichenbehafteten Binärdaten 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-7-1 Definition vorzeichenbehafteter Binärdaten 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-7-2 Arithmetische Merker 57 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-7-3 Eingabe vorzeichenbehafteter Binärdaten unter Verwendung
1-7-4 Verwendung von Erweiterten Befehlen für vorzeichenbehaftete
1-7-5 Anwendungsbeispiele mit vorzeichenbehafteten Binärdaten 59 . . . . . . . .
von Dezimalwerten 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Binärwerte 58 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1

1-1 SPS–Konfiguration
Die SPS–Konfiguration enthält Betriebsparameter, die die Funktion des
CQM1H–Betriebs steuern. Um die CQM1H–SPS–Systeme bei der
Verwendung von Interrupt-Verarbeitungs- und Kommunikationsfunktionen
optimal zu nutzen, können die Parameter an die anwendungsspezifischen
Betriebsbedingungen angepasst werden.
Die allgemeinen SPS–Konfigurationseinstellungen werden in DM 6600 bis
DM 6655 und die Einstellungen des seriellen Kommunikationsmoduls in DM
6550 bis DM 6559 gespeichert. Genau genommen sind die Einstellungen
des seriellen Kommunikationsmoduls Teil des DM–Nur Lese–Bereiches und
nicht der SPS–Konfiguration; aber diese sind enthalten da sie den
SPS–Konfigurationseinstellungen ähnlich sind.
Vor dem Versand wurden die SPS–Systeme werksseitig auf die
Vorgabewerte für allgemeine Betriebsbedingungen eingestellt; die CQM1H
kann daher ohne Änderung der Einstellungen verwendet werden. Die
Vorgabewerte müssen jedoch vor dem Betrieb überprüft werden.
1-1AbschnittSPS–Konfiguration
Vorgabewerte
Vorsicht Wird der ganze Datenwortbereich (DM) über ein Programmiergerät gelöscht,
!
Der Vorgabewert für alle Worte der SPS–Konfiguration ist 0000. Die
Vorgabewerte für DM 6600 bis DM 6655 können jederzeit durch Setzen von
SR 25210 auf EIN zurückgesetzt werden.
werden die Konfigurationseinstellungen ebenfalls auf Null zurückgesetzt.
1-1-1 Änderung der SPS–Konfiguration
Die SPS–Konfigurationseinstellungen werden nur zu bestimmtem
Zeitpunkten gelesen (sehen Sie die nachfolgende Beschreibung).
• 6550 DM bis 6559 DM: Werden regelmäßig bei eingeschalteter
Versorgungsspannung gelesen.
• 6600 DM bis 6614 DM: Werden nur beim Einschalten der
SPS–Versorgungsspannung gelesen.
• 6615 DM bis 6644 DM: Werden nur zu Beginn der Programmausführung
gelesen.
• 6645 DM bis 6655 DM: Werden regelmäßig bei eingeschalteter
Versorgungsspannung gelesen.
Änderungen in der SPS–Konfiguration werden nur zu den oben
angegebenen Zeiten wirksam. Die CQM1H muss daher erneut gestartet
werden, um die in DM 6600 bis DM 6614 vorgenommenen Änderungen zu
aktivieren und die Programmausführung muss erneut gestartet werden, um
die in DM 6615 bis DM 6644 vorgenommenen Änderungen zu aktivieren.
2

1-1AbschnittSPS–Konfiguration
Änderungen über ein
Programmiergerät
vornehmen
Die SPS–Konfiguration kann vom Anwenderprogramm zwar gelesen, aber
nicht überschrieben werden. Das Schreiben kann nur über eine
Programmierkonsole oder Programmier–Software (CX–Programmer, Syswin)
erfolgen.
DM 6600 bis DM 6644 können nur in der PROGRAM-Betriebsart eingestellt
oder geändert werden. DM 6550 bis DM 6559 und DM 6645 bis DM 6655
können nur in der PROGRAM– oder MONITOR–Betriebsart eingestellt oder
geändert werden.
Schreibschutz für die
SPS–Konfiguration
Nach Vornahme der SPS–Konfigurationseinstellungen kann Schalter 1 des
DIP–Schalters auf der Vorderseite der CPU–Baugruppe auf ON gestellt
werden, um ein Überschreiben der Konfigurationseinstellung durch ein
Programmiergerät zu verhindern. Wurde Schalter 1 auf ON gesetzt, kann
das Anwenderprogramm, der DM–Nur Lese–Bereich (DM 6144 bis DM
6568) und die SPS–Konfiguration (DM 6600 bis DM 6655) nicht durch ein
Programmiergerät überschrieben werden.
Fehler in der
SPS–Konfiguration
Ein geringfügiger Fehler (Fehler–Code 9B) wird generiert, falls auf eine fehlerhafte SPS–Konfigurationseinstellung zugegriffen wird und der entsprechende Fehlermerker auf EIN gesetzt; anschließend wird die Vorgabeeinstellung verwendet.
Merker Funktion
AR 2400 Aktiviert, wenn ein Fehler in DM 6600 bis DM 6614 vorliegt (wird nach dem Einschalten der
AR 2401 Aktiviert, wenn ein Fehler in DM 6600 bis DM 6614 vorliegt (wird bei Beginn der Ausführung gelesen).
AR 2402 Aktiviert, wenn ein Fehler in DM 6645 bis DM 6655 vorliegt (wird regelmäßig nach dem Einschalten der
AR 0400...AR 0407 In dieses Byte wird der Fehlercode 10 geschrieben, wenn ein Fehler in DM 6550 bis DM 6559 vorliegt (wird
Versorgungsspannung gelesen).
Versorgungsspannung gelesen).
regelmäßig nach dem Einschalten der Versorgungsspannung gelesen).
1-1-2 Einstellungen des seriellen Kommunikationsmoduls
Die folgende Tabelle zeigt die Einstellungen des seriellen
Kommunikationsmoduls in dem DM–Bereich. Weitere Einzelheiten
entnehmen Sie bitte dem
Kommunikationsmodul.
Wort (s) Bit (s) Funktion
Serielle Kommunikationsmodul–Einstellungen
Die folgenden Einstellungen sind nach der Übertragung zur SPS wirksam. (Die Einstellungen für Schnittstelle 2 sind in den Worten DM
6550 bis DM 6554 und die Einstellungen für Schnittstelle 1 in den Worten DM 6555 bis DM 6559 .)
DM 6550
(Schnitt–
stelle 2)
DM 6555
(Schnitt–
stelle 1)
00 bis 03 Schnittstelleneinstellungen
0: Vorgabe (1 Startbit, 7 Datenbits, gerade Parität, 2 Stoppbits, 9.600 Baud)
01: Einstellungen in DM 6551 (DM 6556 für Schnittstelle 1)
04 bis 07 CTS–Handshake–Einstellungen
0: Deaktiviert;
1: Aktiviert
08 bis 11 Link–Worte für den 1:1–Data–Link (wenn Bits 12 bis 15 auf 3 gesetzt sind)
0: LR 00 bis LR 63; 1: LR 00 bis LR 31; 2: LR 00...LR 15
Höchste NT–Nummer (wenn Bits 12 bis 15 auf 5 eingestellt sind)
1 bis 7
12 bis 15 Kommunikationsmodus
0: Host–Link;
1: Ohne Protokoll; 2: 1:1–Data–Link–Verbindung (Slave)
3: 1:1–Data–Link–Verbindung (Master)
4: NT–Link im 1:1–Modus; 5: NT–Link im 1:n–Modus; 6: Protokoll–Makro
Technischen Handbuch Serielles
3
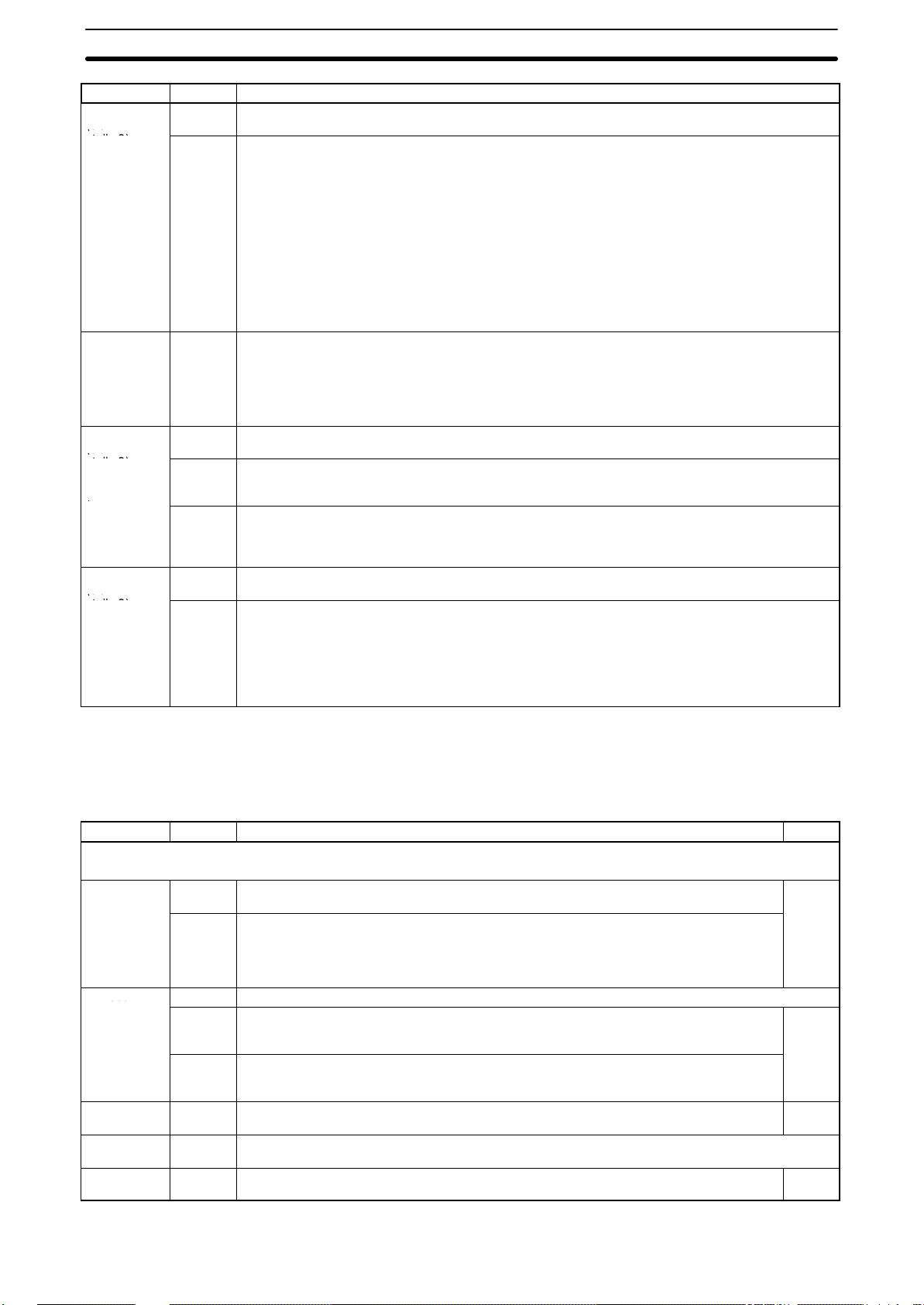
Wort (s) FunktionBit (s)
(Schnitt
(Schnitt
(
(Schnitt
660
DM 6551
(Schnitt–
stelle 2)
DM 6556
(Schnitt
stelle 1)
DM 6552
(Schnittstelle
2)
DM 6557
(Schnittstelle
1)
DM 6553
(Schnitt–
stelle 2)
DM 6558
(Schnitt–
stelle 1)
DM 6554
(Schnitt–
stelle 2)
DM 6559
(Schnitt–
stelle 1)
00 bis 07 Baudrate
08 bis 15 Rahmenformat
00 bis 15 Übertragungsverzögerungszeit (Host–Link oder Ohne Protokoll)
00 bis 07 Teilnehmernummer (Host–Link)
08 bis 11 Startcode–Freigabe (Ohne Protokoll)
12 bis 15 Endcode–Freigabe (Ohne Protokoll)
00 bis 07 Startcode (Ohne Protokoll)
08 bis 15 Wenn Bits 12 bis 15 von DM 6553 oder DM 6558 auf 0 gesetzt sind:
1-1AbschnittSPS–Konfiguration
00: 1,2K, 01: 2,4K, 02: 4,8K, 03: 9,6K, 04: 19,2K
Startbit Länge Stop Parität
00: 1 Bit 7 Bits 1 Bit Gerade
01: 1 Bit 7 Bits 1 Bit Ungerade
02: 1 Bit 7 Bits 1 Bit Kein
03: 1 Bit 7 Bits 2 Bits Gerade
04: 1 Bit 7 Bits 2 Bits Ungerade
05: 1 Bit 7 Bits 2 Bits Kein
06: 1 Bit 8 Bits 1 Bit Gerade
07: 1 Bit 8 Bits 1 Bit Ungerade
08: 1 Bit 8 Bits 1 Bit Kein
09: 1 Bit 8 Bits 2 Bits Gerade
10: 1 Bit 8 Bits 2 Bits Ungerade
11: 1 Bit 8 Bits 2 Bits Kein
0000 bis 9999 (BCD): Einstellung in Einheiten von 10 ms, z.B. entspricht die Einstellung 0001 dem Wert 10
ms
00 bis 31 (BCD)
0: Deaktiviert;
1: Aktiviert
0: Deaktiviert (Anzahl der empfangenen Bytes)
1: Einstellung (spezifizierter Endcode)
2: CR, LF
00 bis FF (hexadezimal)
Anzahl der empfangenen Bytes
00: Vorgabeeinstellung (256 Bytes)
01 bis FF: 1 bis 255 Bytes,
Wenn Bits 12 bis 15 von DM 6553 oder DM 6558 auf 1 gesetzt sind:
Endcode (Ohne Protokoll)
00 bis FF (hexadezimal)
1-1-3 SPS–Konfigurationseinstellungen
Die folgende Tabelle zeigt die SPS–Konfigurationseinstellungen in der
Reihenfolge, in der diese in dem DM–Bereich abgelegt sind. Weitere
Informationen finden Sie unter den angegebenen Seiten.
Wort (s) Bit (s) Funktion Seite
Einschaltverarbeitung (DM 6600 bis DM 6614)
Die folgenden Einstellungen sind erst nach der Übertragung in die SPS und nach dem erneuten Starten des Betriebes wirksam.
DM 6600
DM 6601
DM6602 bis
DM6603
6604 DM bis
6610 DM:
DM6611 bis
DM6612
00 bis 07 Einschaltbetriebsart (wirksam, wenn Bits 08 bis 15 auf 02 gesetzt werden).
08 bis 15 Einschaltbetriebsartzuweisung
00 bis 07 Nicht verwendet.
08 bis 11 E/A–Haftmerkerstatus(SR 25212)
12 bis 15 Zwangsetzungs–Haftmerkerstatus (SR 25211)
00 bis 15 Einstellungen für Spezialmodul–Steckplatz 1 (Sehen Sie Abschnitt
00 bis 15 Nicht verwendet.
00 bis 15 Einstellungen für Spezialmodul–Steckplatz 2 (Sehen Sie Abschnitt
00: PROGRAM; 01: MONITOR 02: RUN
00: Hängt von den CPU–Baugruppen–DIP–Schalter 7– und
Programmierkonsolen–Schaltereinstellungen ab
01: Fortsetzung der Betriebsart, die vor dem Ausfall der Versorgungsspannung aktiv war
02: Einstellung in DM 6600 Bits 00 bis 07
0: Rücksetzung;
1: Status nicht ändern
0: Rücksetzung;
1: Status nicht ändern
Spezialmodul–Einstellungen
Spezialmodul–Einstellungen
für weitere Einzelheiten.)
für weitere Einzelheiten.)
1-2
1-2
12
13
9
9
4

Wort (s) SeiteFunktionBit (s)
9
66
66 3
66
66 5
66 6
66
DM 6613 00 bis 15 Service–Zeiteinstellung für serielle Kommunikationsmodul–Schnittstelle 2
DM 6614 00 bis 15 Service–Zeiteinstellung für serielle Kommunikationsmodul–Schnittstelle 1
Impulsausgabe– und Zykluszeiteinstellungen (DM 6615 bis DM 6619)
Die folgenden Einstellungen sind nach der Übertragung in die SPS und dem erneuten Start des Betriebs wirksam.
DM 6615
DM 6616
DM 6617
DM 6618
DM 6619 00 bis 15 Zykluszeit
Interrupt–Verarbeitung (DM 6620 bis DM 6639)
Die folgenden Einstellungen sind nach der Übertragung in die SPS und dem erneuten Start des Betriebs wirksam.
DM 6620
DM 6621
DM 6622
DM 6623
DM 6624
DM 6625
DM 6626
DM 6627
DM 6628
00 bis 07 Wort für Impulsausgabe
00: IR 100; 01: IR 101; 02: IR 102... 15: IR 115
Stellt das für eine Impulsausgabe verwendete Wort einer Baugruppe mit Transistorausgängen
ein. Impulse können jeweils nur von einem Ausgang ausgegeben werden.
08 bis 15 Nicht verwendet. Auf 00 eingestellt.
00 bis 07 Servicezeit der RS–232C–Schnittstelle (wirksam, wenn Bits 08 bis 15 auf 01 gesetzt werden)
00 bis 99 (BCD): Prozentsatz der Zykluszeit, die zum Service der RS–232C–Schnittstelle benötigt
wird. Die Service–Zeit muss zwischen 0,256 ms und 65,536 ms liegen.
08 bis 15 Aktivierung der RS–232C–Schnittstellen–Service–Einstellung
00: 5% der Zykluszeit
01: Die Zeit in 00 bis 07 verwenden.
(Bei angehaltener SPS beträgt die Service–Zeit immer 10 ms.)
00 bis 07 Servicezeit der Peripherieschnittstelle (wirksam, wenn Bits 08 bis 15 auf 01 gesetzt werden)
00 bis 99 (BCD): Prozentsatz der Zykluszeit, die zum Service der Peripherie verwendet wird. Die
Service–Zeit muss zwischen 0,256 ms und 65,536 ms liegen.
08 bis 15 Aktivierung der Service–Einstellung für die Peripherieschnittstelle
00: 5% der Zykluszeit
01: Die Zeit in 00 bis 07 verwenden.
(Bei angehaltener SPS beträgt die Service–Zeit immer 10 ms.)
00 bis 07 Zyklusüberwachungszeit (wenn Bits 08 bis 15 auf 01, 02 oder 03 gesetzt sind)
00 bis 99 (BCD) × Einstelleinheiten (sehen Bits 08 bis 15.)
08 bis 15 Zyklusüberwachungs–Freigabe
00: 120 ms (Einstellung in Bits 00 bis 07 deaktiviert)
01: Einstelleinheit: 10 ms
02: Einstelleinheit: 100 ms
03: Einstelleinheit: 1 s
0000: Variable (kein Minimum)
0001 bis 9999 (BCD): Kleinste Zykluszeit in ms
00 bis 03 Eingangs–Zeitkonstante für IR 00000 bis IR 00007
0: 8 ms; 1: 1 ms; 2: 2 ms; 3: 4 ms; 4: 8 ms; 5: 16 ms; 6: 32 ms; 7: 64 ms; 8: 128 ms
04 bis 07 Eingangs–Zeitkonstante für IR 00008 und IR 00015 (gleiche Einstellung wie für Bits 00 bis
03).
08 bis 11 Eingangs–Zeitkonstante für IR und IR 001 (gleiche Einstellung wie für Bits 00 bis 03).
12 bis 15 Nicht verwendet. Auf 0 setzen.
00 bis 07 Eingangszeit–Konstante für IR 002
00: 8 ms; 01: 1 ms; 02: 2 ms; 03: 4 ms; 04: 8 ms; 05: 16 ms; 06: 32 ms; 07: 64 ms; 08: 128 ms
08 bis 15 Eingangs–Zeitkonstanten für IR 003 (Gleiche Einstellung wie für IR 002).
00 bis 07 Eingangs–Zeitkonstanten für IR 004 (Gleiche Einstellung wie für IR 002).
08 bis 15 Eingangs–Zeitkonstanten für IR 005 (Gleiche Einstellung wie für IR 002).
00 bis 07 Eingangs–Zeitkonstanten für IR 006 (Gleiche Einstellung wie für IR 002).
08 bis 15 Eingangs–Zeitkonstanten für IR 007 (Gleiche Einstellung wie für IR 002).
00 bis 07 Eingangs–Zeitkonstanten für IR 008 (Gleiche Einstellung wie für IR 002).
08 bis 15 Eingangs–Zeitkonstanten für IR 009 (Gleiche Einstellung wie für IR 002).
00 bis 07 Eingangs–Zeitkonstanten für IR 010 (Gleiche Einstellung wie für IR 002).
08 bis 15 Eingangs–Zeitkonstanten für IR 011 (Gleiche Einstellung wie für IR 002).
00 bis 07 Eingangs–Zeitkonstanten für IR 012 (Gleiche Einstellung wie für IR 002).
08 bis 15 Eingangs–Zeitkonstanten für IR 013 (Gleiche Einstellung wie für IR 002).
00 bis 07 Eingangs–Zeitkonstanten für IR 014 (Gleiche Einstellung wie für IR 002).
08 bis 15 Eingangs–Zeitkonstanten für IR 015 (Gleiche Einstellung wie für IR 002).
00 bis 03 Interrupt–Aktivierung für IR 00000
(0: Standardeingang; 1: Interrupt–Eingang im Interrupt–Eingangs– oder Zählermodus
04 bis 07 Interrupt–Aktivierung für IR 00001
(0: Standardeingang; 1: Interrupt–Eingang im Interrupt–Eingangs– oder Zählermodus
08 bis 11 Interrupt–Aktivierung für IR 00002
(0: Standardeingang; 1: Interrupt–Eingang im Interrupt–Eingangs– oder Zählermodus
12 bis 15 Interrupt–Aktivierung für IR 00003
(0: Standardeingang; 1: Interrupt–Eingang im Interrupt–Eingangs– oder Zählermodus
1-1AbschnittSPS–Konfiguration
9
44
13
14
16
14
14
14
23
5
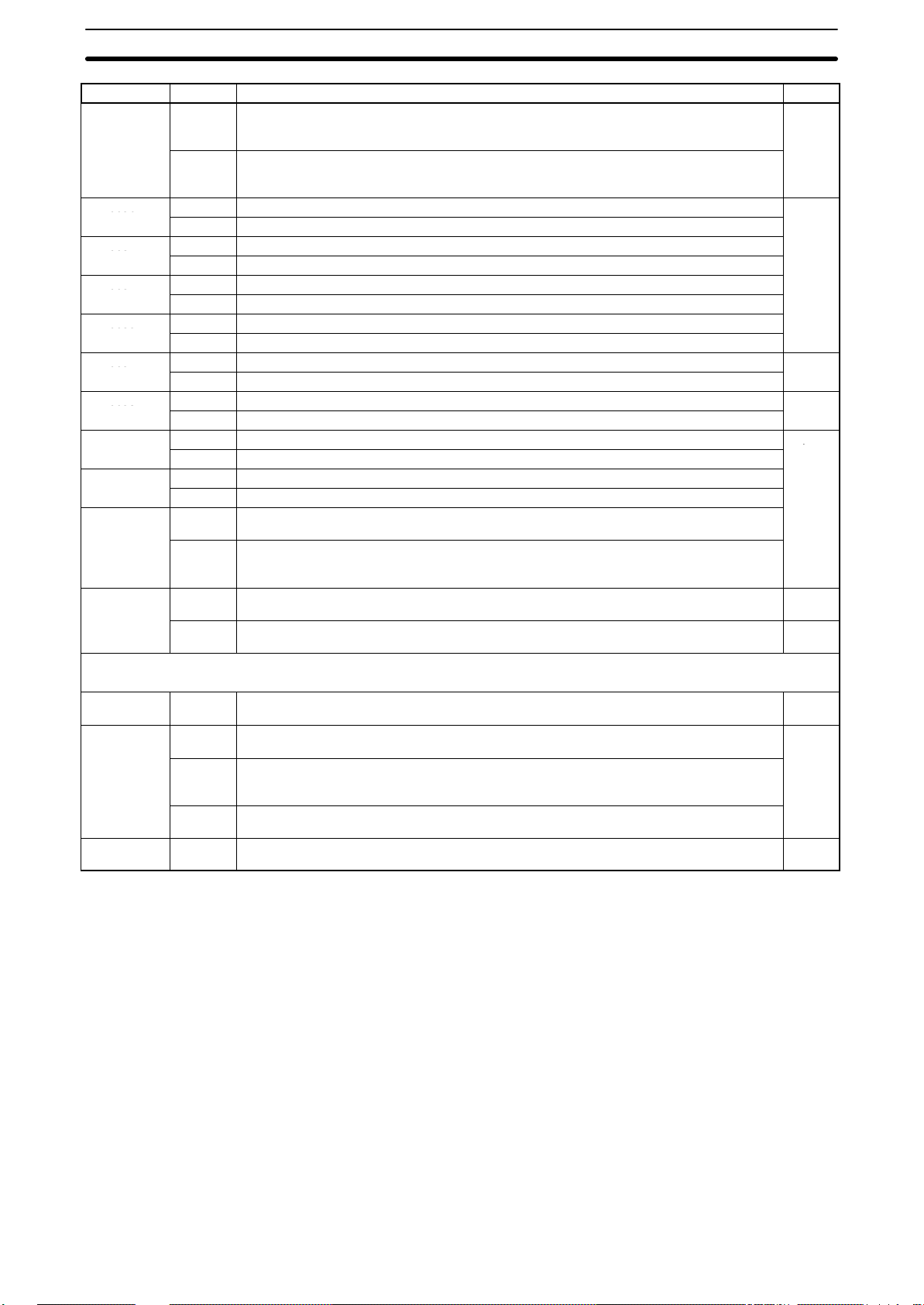
Wort (s) SeiteFunktionBit (s)
6630
663
663
6633
663
6635
6636
9, 3
663
DM 6629
DM 6630
DM 6631
DM 6632
DM 6633
DM 6634
DM 6635
DM 6636
DM 6637
DM 6638
DM 6639
Schneller Zähler–Einstellungen (DM 6640 bis DM 6644)
Die folgenden Einstellungen sind nach der Übertragung in die SPS und dem erneuten Start des Betriebs wirksam.
DM 6640 bis
DM 6641
DM 6642
DM6643 bis
DM6644
00 bis 07 Anzahl der TIMH(15)–Schnellen Zeitgeber, die bei einer Interrupt–Auffrischung aufgefrischt
08 bis 15 Freigabe der Schnellen Zeitgeber–Interrupt–Auffrischung
00 bis 07 Erstes Eingangs–Auffrischungswort für E/A–Interrupt 0: 00 bis 11 (BCD)
08 bis 15 Anzahl der Eingangs–Auffrischungsworte für E/A–Interrupt 0: 00 bis 12 (BCD)
00 bis 07 Erstes Eingangs–Auffrischungswort für E/A–Interrupt 1: 00 bis 11 (BCD)
08 bis 15 Anzahl der Eingangs–Auffrischungsworte für E/A–Interrupt 1: 00 bis 12 (BCD)
00 bis 07 Erstes Eingangs–Auffrischungswort für E/A–Interrupt 2: 00 bis 11 (BCD)
08 bis 15 Anzahl der Eingangs–Auffrischungsworte für E/A–Interrupt 2: 00 bis 12 (BCD)
00 bis 07 Erstes Eingangs–Auffrischungswort für E/A–Interrupt 3: 00 bis 11 (BCD)
08 bis 15 Anzahl der Eingangs–Auffrischungsworte für E/A–Interrupt 3: 00 bis 12 (BCD)
00 bis 07 Erstes Eingangs–Auffrischungswort für Schnellen Zähler 1: 00 bis 11 (BCD)
08 bis 15 Anzahl der Eingangs–Auffrischungsworte for Schnellen Zähler 1: 00 bis 12 (BCD)
00 bis 07 Erstes Eingangs–Auffrischungswort für Schnellen Zähler 2: 00 bis 11 (BCD)
08 bis 15 Anzahl der Eingangs–Auffrischungsworte für Schnellen Zähler 2: 00 bis 12 (BCD)
00 bis 07 Erstes Eingangs–Auffrischungswort für Intervall–Zeitgeber 0: 00 bis 15 (BCD)
08 bis 15 Anzahl der Eingangs–Auffrischungsworte für Intervall–Zeitgeber 0: 00 bis 16 (BCD)
00 bis 07 Erstes Eingangs–Auffrischungswort für Intervall–Zeitgeber 1: 00 bis 15 (BCD)
08 bis 15 Anzahl der Eingangs–Auffrischungsworte für Intervall–Zeitgeber 1: 00 bis 16 (BCD)
00 bis 07 Erstes Eingangs–Auffrischungswort für Intervall–Zeitgeber 2 oder Schnellen Zähler 0:
08 bis 15 Anzahl der Eingangs–Auffrischungsworte für Intervall–Zeitgeber 2 oder Schnellen
00 bis 07 Ausgangs–Auffrischungsverfahren
08 bis 15 Anzahl der Stellen für den DIGITAL SWITCH (DSW(87) – Digitalschalter)–Befehl
00 bis 15 Einstellungen für Spezialmodul–Steckplatz 1 (Sehen Sie Abschnitt
00 bis 03 Schneller Zähler 0–Eingangsmodus
04 bis 07 Schneller Zähler 0–Rücksetzmodus
08 bis 15 Schneller Zähler 0–Freigabe
00 bis 15 Einstellungen für Spezialmodul–Steckplatz 2 (Sehen Sie
werden sollen
00 bis 15 (BCD; z.B. für Zeitgeber 00 bis 02 auf 3 eingestellt)
00: 16 Zeitgeber (Einstellung in Bits 00 bis 07 deaktiviert)
01: Die Einstellung in 00 bis 07 verwenden.
00 bis 15 (BCD)
Zähler 0:
00 bis 16 (BCD)
00: Zyklisch; 01: Direkt
00: 4 Stellen; 01: 8 Stellen
1-2
Spezialmodul–Einstellungen
0: Differential–Phasenmodus; 4: Inkrementierbetriebsart
0: Z–Phase und Software–Rücksetzung;
1: Nur Software–Rücksetzung
00: Schneller Zähler 0 nicht verwenden; 01: Schneller Zähler 0 verwenden.
für weitere Einzelheiten.)
1-2 Spezialmodul–Einstellungen
weitere Einzelheiten.)
für
1-1AbschnittSPS–Konfiguration
15
24
24
24
29, 37
16, 471
16, 425
9
37
9
6
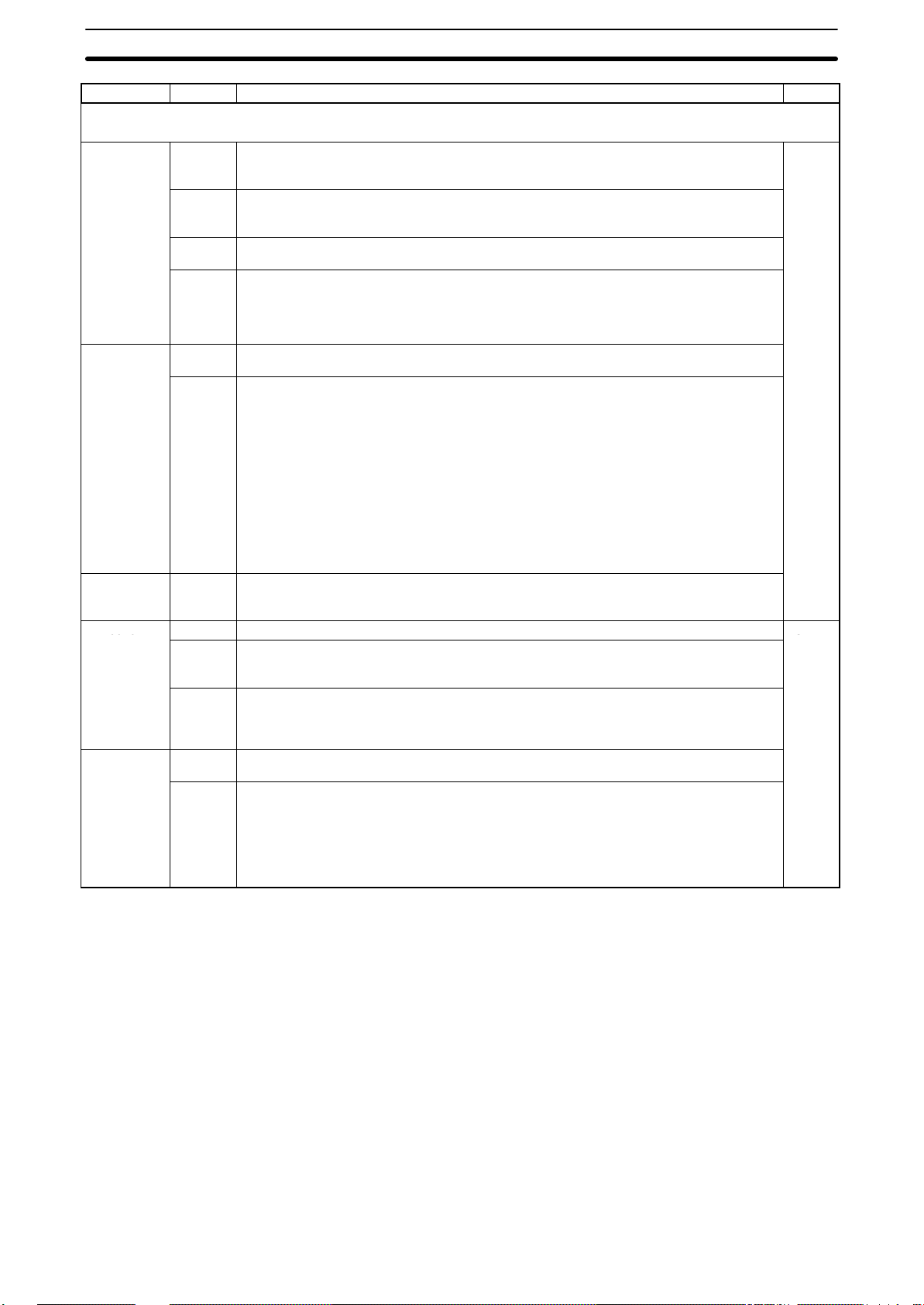
Wort (s) SeiteFunktionBit (s)
66 8
5
RS–232–Schnittstelleneinstellungen
Die folgenden Einstellungen sind nach der Übertragung zur SPS wirksam.
DM 6645 00 bis 03 Schnittstelleneinstellungen (Host–Link– oder Ohne Protokoll–Kommunikationsmodus)
04 bis 07 CTS–Handshake–Einstellungen (Host–Link– oder Ohne Protokoll–Kommunikationsmodus)
08 bis 11 Link–Worte für 1:1–Data–Link (1:1–Data–Link–Master–Modus)
12 bis 15 Kommunikationsmodus
DM 6646
DM 6647 00 bis 15 Übertragungsverzögerungszeit (Host–Link oder Ohne Protokoll)
DM 6648
DM 6649
00 bis 07 Baudrate
08 bis 15 Rahmenformat
00 bis 07 Teilnehmernummer (Host–Link): 00 bis 31 (BCD)
08 bis 11 Startcode–Freigabe (Ohne Protokoll)
12 bis 15 Endcode–Freigabe (Ohne Protokoll)
00 bis 07 Startcode (Ohne Protokoll)
08 bis 15 Bits 12 bis 15 des Datenwortes DM 6648 auf 0 gesetzt:
0: Vorgabe (1 Startbit, 7 Datenbits, gerade Parität, 2 Stopbits, 9.600 Baud)
01: Einstellungen in DM 6646
0: Deaktiviert;
1: Aktiviert
0: LR 00 bis LR 63; 1: LR 00 bis LR 31; 2: LR 00...LR 15
0: Host–Link;
1: Ohne Protokoll; 2: 1:1–Data–Link–Verbindung (Slave)
3: 1:1–Data–Link–Verbindung (Master)
4: NT–Link im 1:1–Modus
00: 1,2 Kb/sec, 01: 2,4 Kb/sec, 02: 4,8 Kb/sec, 03: 9,6 Kb/sec, 04: 19,2 Kb/sec
Startbit Länge Stopp Parität
00: 1 Bit 7 Bits 1 Bit Gerade
01: 1 Bit 7 Bits 1 Bit Ungerade
02: 1 Bit 7 Bits 1 Bit Kein
03: 1 Bit 7 Bits 2 Bits Gerade
04: 1 Bit 7 Bits 2 Bits Ungerade
05: 1 Bit 7 Bits 2 Bits Kein
06: 1 Bit 8 Bits 1 Bit Gerade
07: 1 Bit 8 Bits 1 Bit Ungerade
08: 1 Bit 8 Bits 1 Bit Kein
09: 1 Bit 8 Bits 2 Bits Gerade
10: 1 Bit 8 Bits 2 Bits Ungerade
11: 1 Bit 8 Bits 2 Bits Kein
0000 bis 9999 (BCD): Einstellung in Einheiten von 10 ms, z.B. entspricht die Einstellung 0001
dem Wert 10 ms
0: Deaktiviert;
1: Aktiviert
0: Deaktiviert (Anzahl der empfangenen Bytes)
1: Einstellung (spezifizierter Endcode)
2: CR, LF
00 bis FF (hexadezimal)
Anzahl der empfangenen Bytes
00: Vorgabeeinstellung (256 Bytes)
01 bis FF: 1 bis 255 Bytes,
Bits 12 bis 15 des Datenwortes DM 6648 auf 1 gesetzt:
Endcode (Ohne Protokoll)
00 bis FF (hexadezimal)
1-1AbschnittSPS–Konfiguration
45
45
7
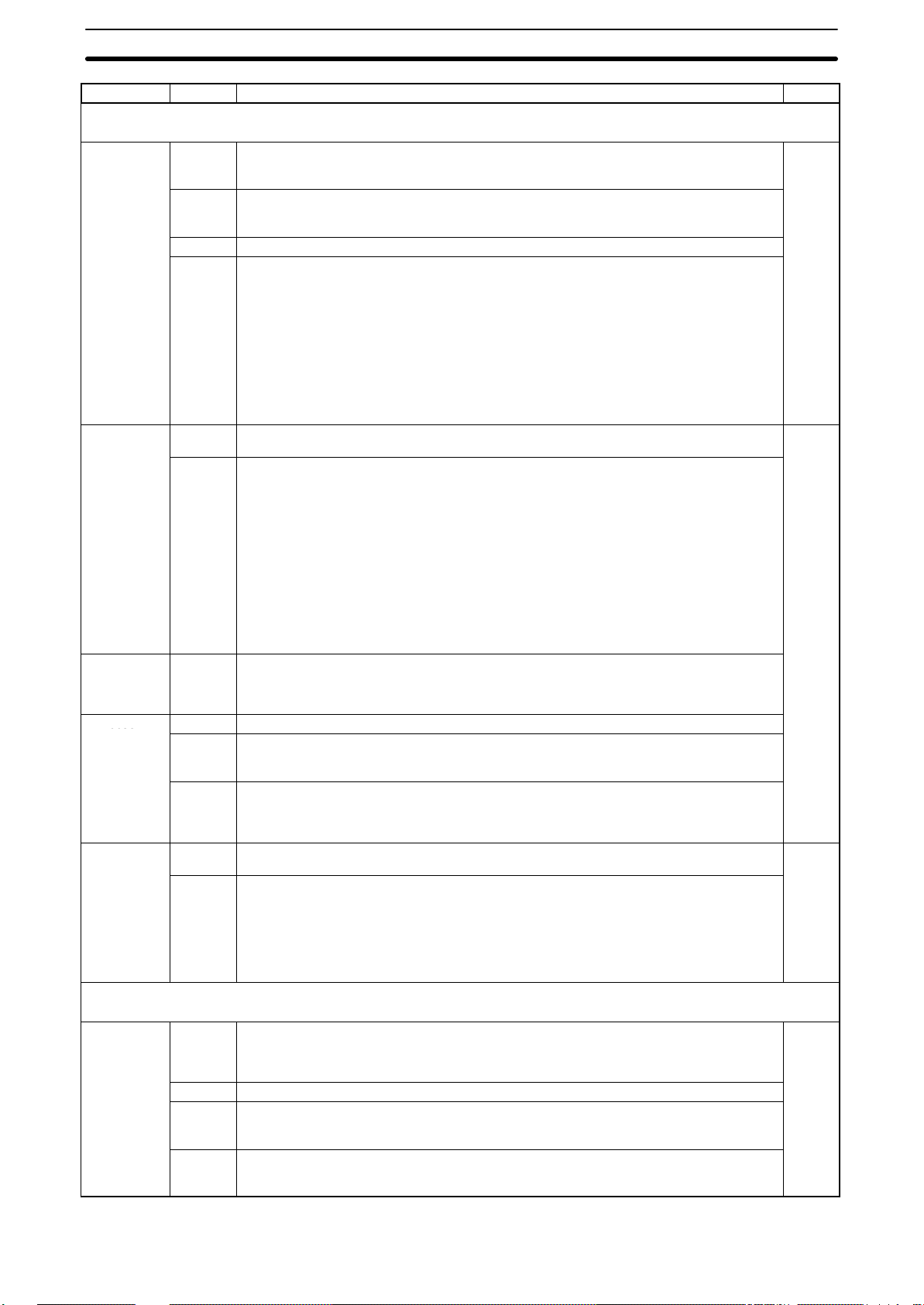
Wort (s) SeiteFunktionBit (s)
6653
Peripherieschnittstellen–Einstellungen
Die folgenden Einstellungen sind nach der Übertragung zur SPS wirksam.
DM 6650
DM 6651
DM 6652 00 bis 15 Übertragungsverzögerung (nur Ohne Protokoll– oder Slave-initiierter
DM 6653
DM 6654
Fehlerprotokolleinstellungen (DM 6655)
Die folgenden Einstellungen sind nach der Übertragung zur SPS wirksam.
DM 6655
00 bis 03 Schnittstelleneinstellungen (Host–Link– oder Ohne Protokoll–Kommunikationsmodus)
0: Vorgabe (1 Startbit, 7 Datenbits, gerade Parität, 2 Stopbits, 9.600 Baud)
01: Einstellungen im Datenwort DM 6651
04 bis 07 CTS–Handshake–Einstellungen (Host–Link– oder Ohne Protokoll–Kommunikationsmodus)
0: Deaktiviert;
1: Aktiviert
08 bis 11 Nicht verwendet.
12 bis 15 Kommunikationsmodus (wenn Bits 00 bis 03 auf 1 gesetzt sind)
0: Host–Link;
1: Ohne Protokoll
Schalten Sie DIP–Schalter 7 der CPU–Baugruppe AUS, wenn eine Programmierkonsole an der
Peripherieschnittstelle angeschlossen ist. (Schalter 5 und die SPS–Konfigurationseinstellungen
sind in diesem Fall deaktiviert.)
Setzen Sie Schalter 7 auf ON und stellen Sie den “Host–Link”–Kommunikationsmodus ein, wenn
ein Computer als Programmiergerät an die Peripherieschnittstelle angeschlossen wird. Werden
diese Einstellungen vorgenommen und wird die SPS auf Toolbus–Betrieb eingestellt, wird der
Peripherieschnittstellen–Kommunikationsmodus der CPU–Baugruppe automatisch auf
Toolbus–Betrieb umgeschaltet.
00 bis 07 Baudrate (Host–Link–, Toolbus– oder Ohne Protokoll–Kommunikationsmodus)
00: 1,2 Kb/sec, 01: 2,4 Kb/sec, 02: 4,8 Kb/sec, 03: 9,6 Kb/sec, 04: 19,2 Kb/sec
08 bis 15 Rahmenformat (Host–Link– oder Ohne Protokoll–Kommunikationsmodus)
Start Länge Stopp Parität
00: 1 Bit 7 Bits 1 Bit Gerade
01: 1 Bit 7 Bits 1 Bit Ungerade
02: 1 Bit 7 Bits 1 Bit Kein
03: 1 Bit 7 Bits 2 Bits Gerade
04: 1 Bit 7 Bits 2 Bits Ungerade
05: 1 Bit 7 Bits 2 Bits Kein
06: 1 Bit 8 Bits 1 Bit Gerade
07: 1 Bit 8 Bits 1 Bit Ungerade
08: 1 Bit 8 Bits 1 Bit Kein
09: 1 Bit 8 Bits 2 Bits Gerade
10: 1 Bit 8 Bits 2 Bits Ungerade
11: 1 Bit 8 Bits 2 Bits Kein
Host–Link–Kommunikationsmodus)
0000 bis 9999 (BCD): Einstellung in Einheiten von 10 ms, z.B. entspricht die Einstellung 0001
dem Wert 10 ms
00 bis 07 Teilnehmernummer (Host–Link): 00 bis 31 (BCD)
08 bis 11 Startcode–Freigabe (Ohne Protokoll)
0: Deaktiviert;
1: Aktiviert
12 bis 15 Endcode–Freigabe (Ohne Protokoll)
0: Deaktiviert (Anzahl der empfangenen Bytes)
1: Einstellung (spezifizierter Endcode)
2: CR, LF
00 bis 07 Startcode (Ohne Protokoll)
00 bis FF (hexadezimal)
08 bis 15 Bits 12 bis 15 des Datenwortes DM 6653 auf 0 gesetzt:
Anzahl der empfangenen Bytes
00: Vorgabeeinstellung (256 Bytes)
01 bis FF: 1 bis 255 Bytes,
Bits 12 bis 15 des Datenwortes DM 6653 auf 1 gesetzt:
Endcode (Ohne Protokoll)
00 bis FF (hexadezimal)
00 bis 03 Art
0: Verschiebung nach der Speicherung von 10 Aufzeichnungen
1: Speichern der ersten 10 Aufzeichnungen (keine Verschiebung)
2 bis F: Kein Speichern der Aufzeichnungen
04 bis 07 Nicht verwendet. Auf 0 setzen.
08 bis 11 Aktivierung der Zykluszeit–Überwachung
0: Auswertung langer Programmabarbeitungszeiten als geringfügige Fehler
1: Lange Programmabarbeitungszeiten werden nicht erkannt.
12 bis 15 Batterieunterspannungs–Fehler aktiviert
0: Batterieunterspannung als geringfügigen Fehler auswerten
1: Batterieunterspannung NICHT als geringfügigen Fehler auswerten
1-1AbschnittSPS–Konfiguration
16, 45
45
45
16
8

1-2 Spezialmodul–Einstellungen
(Steck
2)
66 0
(Steck
66
(Steck
Dieser Abschnitt beschreibt die auf die Spezialmodul–Steckplätze 1 und 2
bezogenen SPS–Konfigurationseinstellungen.
1-2-1 Einstellungen für ein serielles Kommunikationsmodul
Verwenden Sie die Einstellungen in DM 6613 und DM 6614, um die
Service–Zeiten für ein auf Spezialmodul–Steckplatz 1 eingesetztes serielles
Kommunikationsmodul einzustellen. (Kein serielles Kommunikationsmodul
kann auf Steckplatz 2 eingesetzt werden.)
Wort Bits Funktion
DM 6613
DM 6614
00 bis 07 Service–Zeit für die serielle
Kommunikationsmodul–Schnittstelle 2 (über die Bits 08 bis 15
aktiviert)
00 bis 99 (BCD): Stellt den Prozentsatz der zum Service der
Schnittstelle 2 verwendeten Zykluszeit ein. Die Service–Zeit muss
zwischen 0,256 ms und 65,536 ms liegen.
08 bis 15 Service–Zeiteinstellung für die serielle
Kommunikationsmodul–Schnittstelle 2
00 Fest auf 5% der Zykluszeit.
01: Die Zeit in 00 bis 07 verwenden.
(Bei angehaltener SPS beträgt die Service–Zeit immer 10 ms.)
00 bis 07 Service–Zeit für die serielle
Kommunikationsmodul–Schnittstelle 1 (über die Bits 08 bis 15
aktiviert)
00 bis 99 (BCD): Stellt den Prozentsatz der zum Service der
Schnittstelle 1 verwendeten Zykluszeit ein. Die Service–Zeit muss
zwischen 0,256 ms und 65,536 ms liegen.
08 bis 15 Service–Zeiteinstellung für die serielle
Kommunikationsmodul–Schnittstelle 1
00 Fest auf 5% der Zykluszeit.
01: Die Zeit in 00 bis 07 verwenden.
(Bei angehaltener SPS beträgt die Service–Zeit immer 10 ms.)
1-2Abschnitt
1-2-2 Einstellungen für ein Schneller Zähler–Modul
Die Einstellungen in DM 6602, DM 6640 und DM 6641 legen den Betrieb
eines auf Spezialmodul–Steckplatz 1 eingesetzten Schnellen Zähler–Moduls
fest.
Die Einstellungen in DM 6611, DM 6643 und DM 6644 legen den Betrieb
eines auf Spezialmodul–Steckplatz 2 eingesetzten Schnellen Zähler–Moduls
fest.
Wort Bits Funktion Einstellungen
DM 6602
(Steck–
platz 1)
DM 6611
(Steck–
p
platz
DM 6640
(Steck–
platz 1)
DM 6643
platz 2)
DM 6641
(Steck–
platz 1)
DM 6644
platz 2)
00 Schneller Zähler–Istwertdatenformat 0: 8-stellig, hexadezimal
01 bis 07 Nicht verwendet. Auf 0 setzen.
08 Einstellung des externen
09 bis 15 Nicht verwendet. Auf 0 setzen.
00 bis 03 Schneller Zähler 1–Eingangsmodus (Sehen Sie Hinweis 1).
04 bis 07 Schneller Zähler 1–Zählfrequenz,
08 bis 11 Schneller Zähler 2–Eingangsmodus (Sehen Sie Hinweis 1).
–
–
12 bis 15 Schneller Zähler 2–Zählfrequenz,
00 bis 03 Schneller Zähler 3–Eingangsmodus (Sehen Sie Hinweis 1).
04 bis 07 Schneller Zähler 3–Zählfrequenz,
08 bis 11 Schneller Zähler 4–Eingangsmodus (Sehen Sie Hinweis 1).
–
–
12 bis 15 Schneller Zähler 4–Zählfrequenz,
Ausgangstransistors
Wertebereich und Zähler–Rücksetzmodus
Wertebereich und Zähler–Rücksetzmodus
Wertebereich und Zähler–Rücksetzmodus
Wertebereich und Zähler–Rücksetzmodus
1: 8-stellig BCD
0: Quelle
1: Senke
(Sehen Sie Hinweis 2).
(Sehen Sie Hinweis 2).
(Sehen Sie Hinweis 2).
(Sehen Sie Hinweis 2).
9

Hinweis 1. Die Einstellungen für den Schneller Zähler–Eingangsmodus sind wie
folgt:
Einstellung Eingangsmodus
0 Hex Differentialphasen–Eingänge, 1x
1 Hex Differentialphasen–Eingänge, 2x
2 Hex Differentialphasen–Eingänge, 4x
3 Hex Auf–/Abwärtseingang
4 Hex Impuls–/Richtungseingang
2. Die Einstellungen für die Zählfrequenz des Schnellen Zählers, den
Wertebereich und den Zähler–Rücksetzmodus sind wie folgt:
Einstellung Zählfrequenz Wertebereich Rücksetzmodus
0 Hex
1 Hex Nur Software–Rücksetzung
2 Hex
3 Hex Nur Software–Rücksetzung
4 Hex
5 Hex Nur Software–Rücksetzung
6 Hex
7 Hex Nur Software–Rücksetzung
50 kHz Linearzähler
Rundzähler
500 kHz Linearzähler
Rundzähler
Phase-Z +
Software–Rücksetzung
Phase-Z +
Software–Rücksetzung
Phase-Z +
Software–Rücksetzung
Phase-Z +
Software–Rücksetzung
1-2Abschnitt
1-2-3 Einstellungen für ein Impuls–E/A–Modul
Die Einstellungen in DM 6611, DM 6643 und DM 6644 legen den Betrieb
eines auf Spezialmodul–Steckplatz 2 eingesetzten Impuls–E/A–Moduls fest.
(Kein Impuls–E/A–Modul kann auf Steckplatz 1 eingesetzt werden.)
Wort Bits Funktion
DM 6611 00 bis 15 Moduseinstellung für Schnittstellen 1 und 2
DM 6643
DM 6644
00 bis 03 Eingangsmodus von Schnittstelle 1
04 bis 07 Schnittstelle 1–Zähler–Rücksetzverfahren
08 bis 11 Schnittstelle 1–Wertebereich
12 bis 15 Schnittstelle 1–Impulsausgabe–Tastverhältnis
00 bis 03 Schnittstelle 2–Eingangsmodus
04 bis 07 Schnittstelle 2–Zähler–Rücksetzverfahren
08 bis 11 Schnittstelle 2–Wertebereich
12 bis 15 Schnittstelle 2–Impulsausgabe–Tastverhältnis
0000: Schneller Zähler–Modus
0001: Einfacher Positioniermodus
0: Differential–Phasenmodus
1: Impuls–/Richtungsmodus
2: Auf–/Abwärtsmodus
0: Z–Phase und Software–Rücksetzung;
1: Nur Software–Rücksetzung
0: Linearzähler; 1: Rundzähler
0: Festes Tastverhältnis; 1: Variables Tastverhältnis
0: Differential–Phasenmodus
1: Impuls–/Richtungsmodus
2: Auf–/Abwärtsmodus
0: Z–Phase und Software–Rücksetzung;
1: Nur Software–Rücksetzung
0: Linearzähler; 1: Rundzähler
0: Festes Tastverhältnis; 1: Variables Tastverhältnis
1-2-4 Einstellungen für ein Absolutwertencoder–Schnittstellenmodul
Die Einstellungen in DM 6611, DM 6612, DM 6643 und DM 6644 legen den
Betrieb eines auf Spezialmodul–Steckplatz 2 eingesetzten
Absolutwertencoder–Schnittstellenmoduls fest. (Kein
10
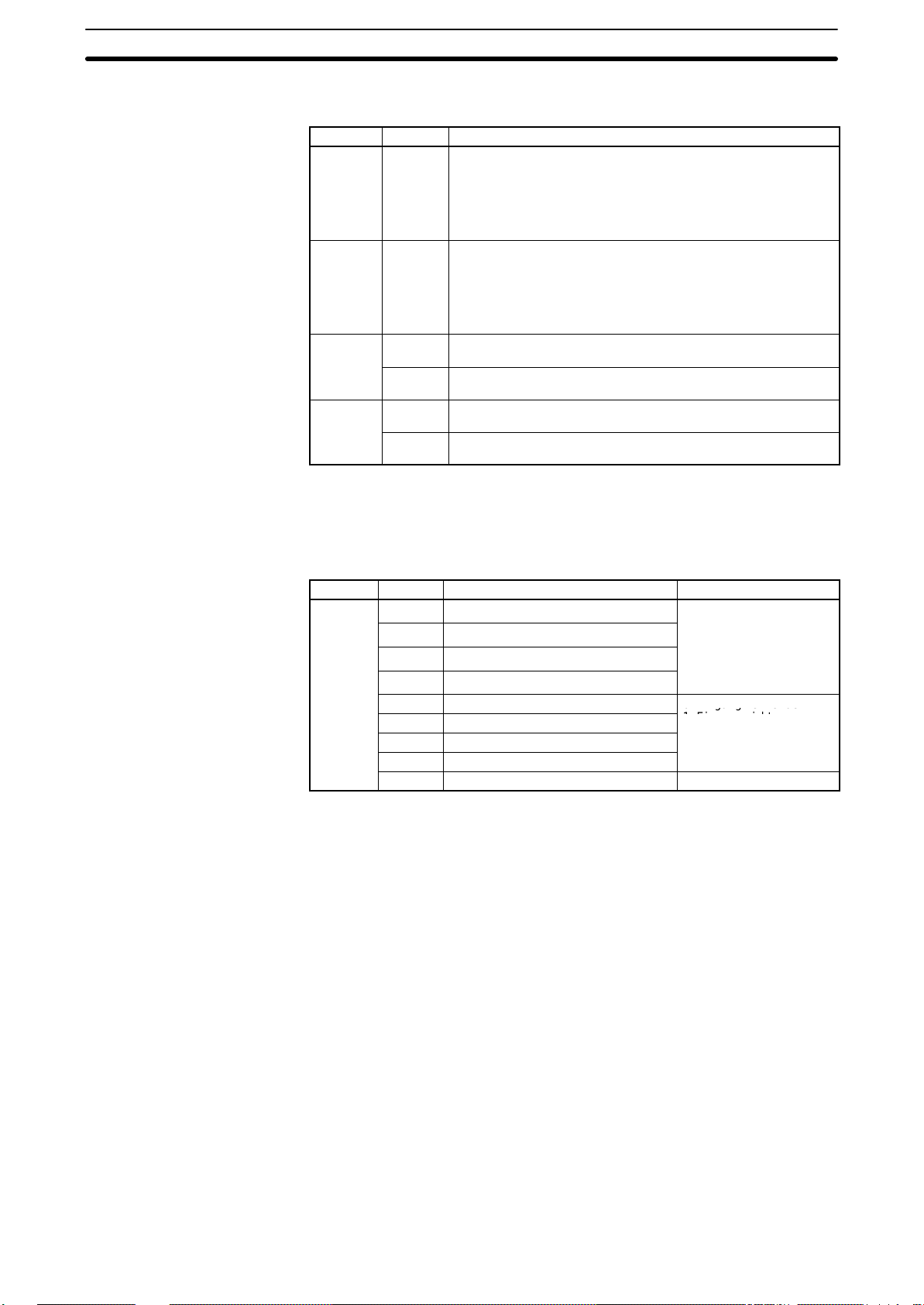
Absolutwertencoder–Schnittstellenmodul kann auf Steckplatz 1 eingesetzt
00: –10 bis +10 V
10: 0 bis 5 V od
0gageede
werden.)
Wort Bits Funktion
DM 6611 00 bis 15 Nullpunktkompensation für Schnittstelle 1 (4-stelliger BCD–Wert)
Der Nullpunkt wird kompensiert, wenn der Schnittstelle
1–Nullpunktkompensationsmerker (SR 25201) gesetzt wird. Der
Kompensationswert wird, abhängig davon, ob der Zähler auf den
BCD– oder 360°Modus eingestellt ist, als BCD–Wert zwischen 0000
und 4095 gespeichert.
DM 6612 00 bis 15 Nullpunktkompensation für Schnittstelle 2 (4-stelliger BCD–Wert)
Der Nullpunkt wird kompensiert, wenn der Schnittstelle
2–Nullpunktkompensationsmerker (SR 25202) gesetzt wird. Der
Kompensationswert wird, abhängig davon, ob der Zähler auf den
BCD– oder 360°Modus eingestellt ist, als BCD–Wert zwischen 0000
und 4095 gespeichert.
DM 6643
DM 6644
00 bis 07 Schnittstelle 1–Eingangsauflösung
00: 8 Bits; 01: 10 Bits; 02: 12 Bits
08 bis 15 Schnittstelle 1–Modus
00: BCD–Modus; 01: 360°–Modus
00 bis 07 Schnittstelle 2–Eingangsauflösung
00: 8 Bits; 01: 10 Bits; 02: 12 Bits
08 bis 15 Schnittstelle 2–Modus
00: BCD–Modus; 01: 360°–Modus
1-2Abschnitt
1-2-5 Einstellungen für ein Analog–E/A–Modul
Die Einstellungen in DM 6611 legen den Betrieb eines auf
Spezialmodul–Steckplatz 2 eingesetzten Analog–E/A–Moduls fest. (Kein
Analog–E/A–Modul kann auf Steckplatz 1 eingesetzt werden.)
Wort Bits Funktion Einstellungen
DM 6611
00 bis 01 Analogeingang 1–Signalbereich
02 bis 03 Analogeingang 2–Signalbereich
04 bis 05 Analogeingang 3–Signalbereich
06 bis 07 Analogeingang 4–Signalbereich
08 Analogeingang 1–Verwendung
09 Analogeingang 2–Verwendung
10 Analogeingang 3–Verwendung
11 Analogeingang 4–Verwendung
12 bis 15 Nicht verwendet. Auf 0 setzen.
Setzen Sie die zwei Bits
wie folgt:
00: –10 bis +10 V
01: 0 bis 10 V
er
0 bis 20 mA
0: Eingang verwendet
1: Eingang nicht
verwendet.
11
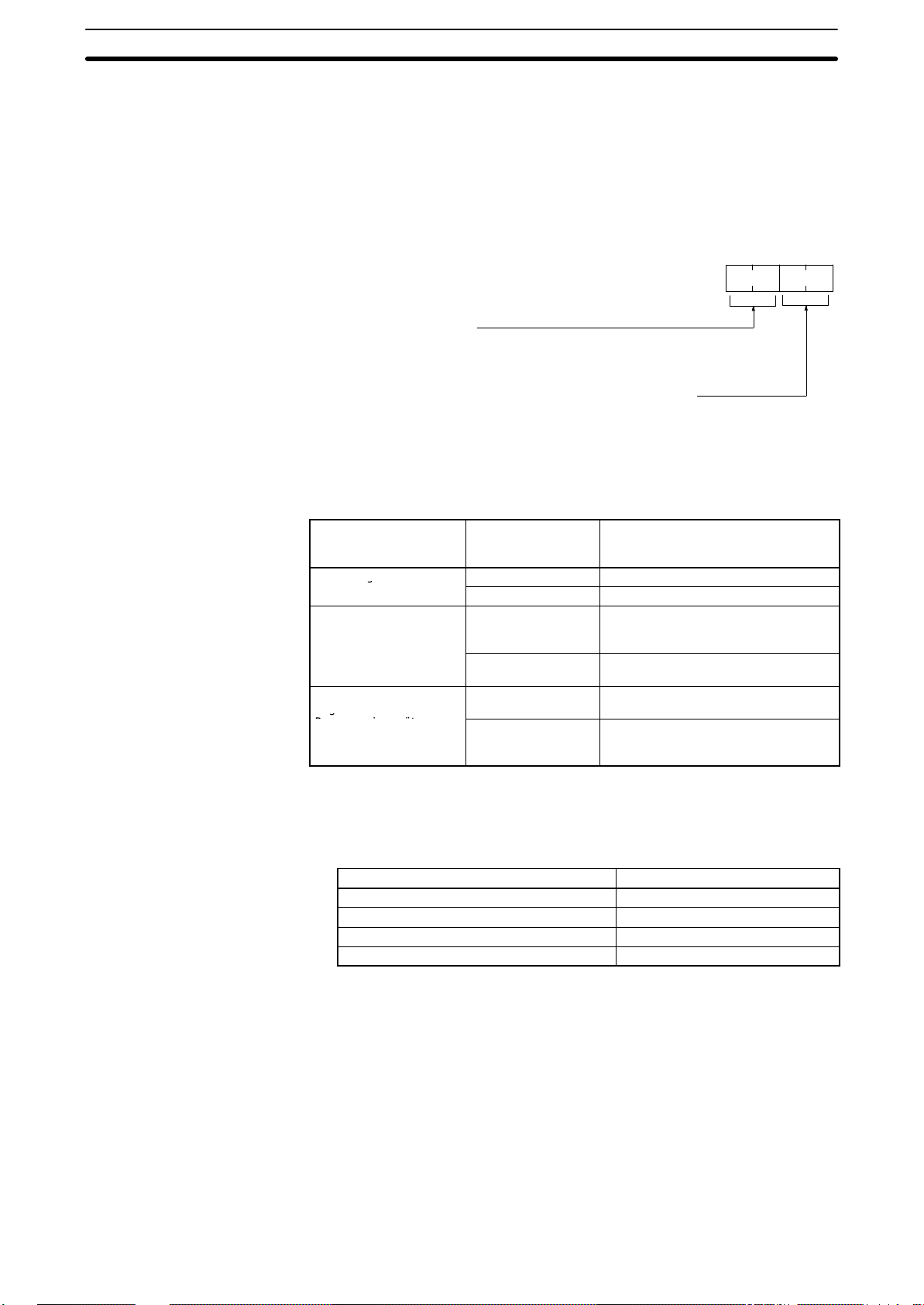
1-3 Basis–SPS–Betrieb und E/A–Verarbeitungen
c s a gesc osse
angeschlossenes
In diesem Abschnitt werden die Konfigurationseinstellungen für den
SPS-Standardbetrieb und die E/A-Verarbeitung erläutert.
1-3-1 Einschaltbetriebsart
Die nach dem Einschalten der SPS aktivierte Betriebsart wird, wie
nachfolgend dargestellt, eingestellt.
Einschaltbetriebsart–Zuweisung
00: Hängt von den Programmiergeräte– und DIP–Schaltereinstellungen ab (sehen
Sie die folgende Tabelle)
01: Betriebsart, die vor dem Ausschalten der SPS aktiviert war
02: Einstellung der Betriebsart über die Bits 00 bis 07
Start-Betriebsart (Bits 08 bis 15: Gültig, wenn Bits 00 bis 07 auf 02 gesetzt werden)
00: PROGRAM–Betriebsart
01: MONITOR–Betriebsart
02: RUN–Betriebsart
Bit
DM 6600
15
1-3AbschnittBasis–SPS–Betrieb und E/A–Verarbeitungen
0
Vorgabe:Abhängig von den Programmiergeräte– und DIP–Schaltereinstellungen, ent-
Programmiergerät beim
Nichts angeschlossen.
Programmierkonsole
angeschlossen
Anderes,
angeschlossenes
Programmiergerät
(Computer)
sprechend der folgende Tabelle.
Einschalten
angeschlossen
AUS PROGRAM–Betriebsart
EIN RUN–Betriebsart
AUS Über den Betriebsartenschalter der
EIN PROGRAM–Betriebsart (Sehen Sie
AUS PROGRAM–Betriebsart (Sehen Sie
EIN Hängt von dem verwendeten
Schalter 7 des
DIP–Schalters der
CPU–Baugruppe
Einschaltbetriebsart
Programmierkonsole eingestellte
Betriebsart
Hinweis 1.)
Hinweis 1.)
Verbindungskabel ab. (Sehen Sie
Hinweis 2).
Hinweis 1. In diesen Fällen kann die CQM1H nicht mit dem angeschlossenen Pro-
grammiergerät kommunizieren.
2. Die Einschaltbetriebsart ist PROGRAM oder RUN, abhängig von dem
verwendeten Verbindungskabel.
Verbindungskabel Einschaltbetriebsart
CS1W-CN114 + CQM1-CIF01/02 PROGRAM–Betriebsart
CS1W-CN118 + CBL209 PROGRAM–Betriebsart
CS1W-CN226/626 RUN–Betriebsart
CS1W-CN118 + CBL209 RUN–Betriebsart
12

1-3-2 Systemhaftmerker–Status
Die folgenden Einstellungen spezifizieren, ob der
Zwangssetzungsstatus-Systemmerker (SR 25211) und/oder der
E/A–Speicherhaltemerker (SR 25212) beim Einschalten der SPS den
Zustand beibehalten, der beim letzten Ausschalten der SPS gültig war oder
ob der vorhergehende Zustand zurückgesetzt wird.
Bit
DM 6601
1-3AbschnittBasis–SPS–Betrieb und E/A–Verarbeitungen
15 0
00
SR 25211–Einstellung
0: Rücksetzung des Zustands
1: Aufrechterhaltung des Zustands
SR 25212–Einstellung
0: Rücksetzung des Zustands
1: Aufrechterhaltung des Zustands
Vorgabe: Beide Systemmerker zurückgesetzt.
Der Zwangssetzungsstatus-Systemmerker (SR 25211) bestimmt, ob der
Zwangssetzungsstatus (gesetzt/zurückgesetzt) beim Umschalten von der
PROGRAM- in die MONITOR-Betriebsart erhalten bleibt.
Der E/A–Speicher–Haltemerker (SR 25212) bestimmt, ob der Zustand der
IR–Bits und der LR–Bits beim Start und bei der Deaktivierung des
SPS-Betriebs beibehalten wird.
1-3-3 RS–232–Schnittstellen–Service–Zeit
Die folgenden Einstellungen spezifizieren den prozentualen Anteil der
Zykluszeit für den Service der RS–232C–Schnittstelle.
Service–Zeiteinstellung aktiviert
00: Deaktiviert (5% der Zykluszeit)
01: Aktiviert (die Einstellung in den Bits 00 bis 07 wird
verwendet)
Service-Zeit (%, gültig, wenn die Bits 08 bis 15 auf 01 gesetzt sind)
00 bis 99 (BCD, zweistellig)
Immer 00
Bit
DM 6616
15 0
Vorgabe: 5% der Zykluszeit
Beispiel: Wird DM 6616 auf 0110 gesetzt, wird 10% der Zykluszeit für den
Service der RS-232C-Schnittstelle aufgewendet.
Die kleinste Service–Zeit beträgt 0,256 ms.
Die gesamte Service-Zeit wird erst verwendet, wenn eine entsprechende
Anforderung vorliegt.
13
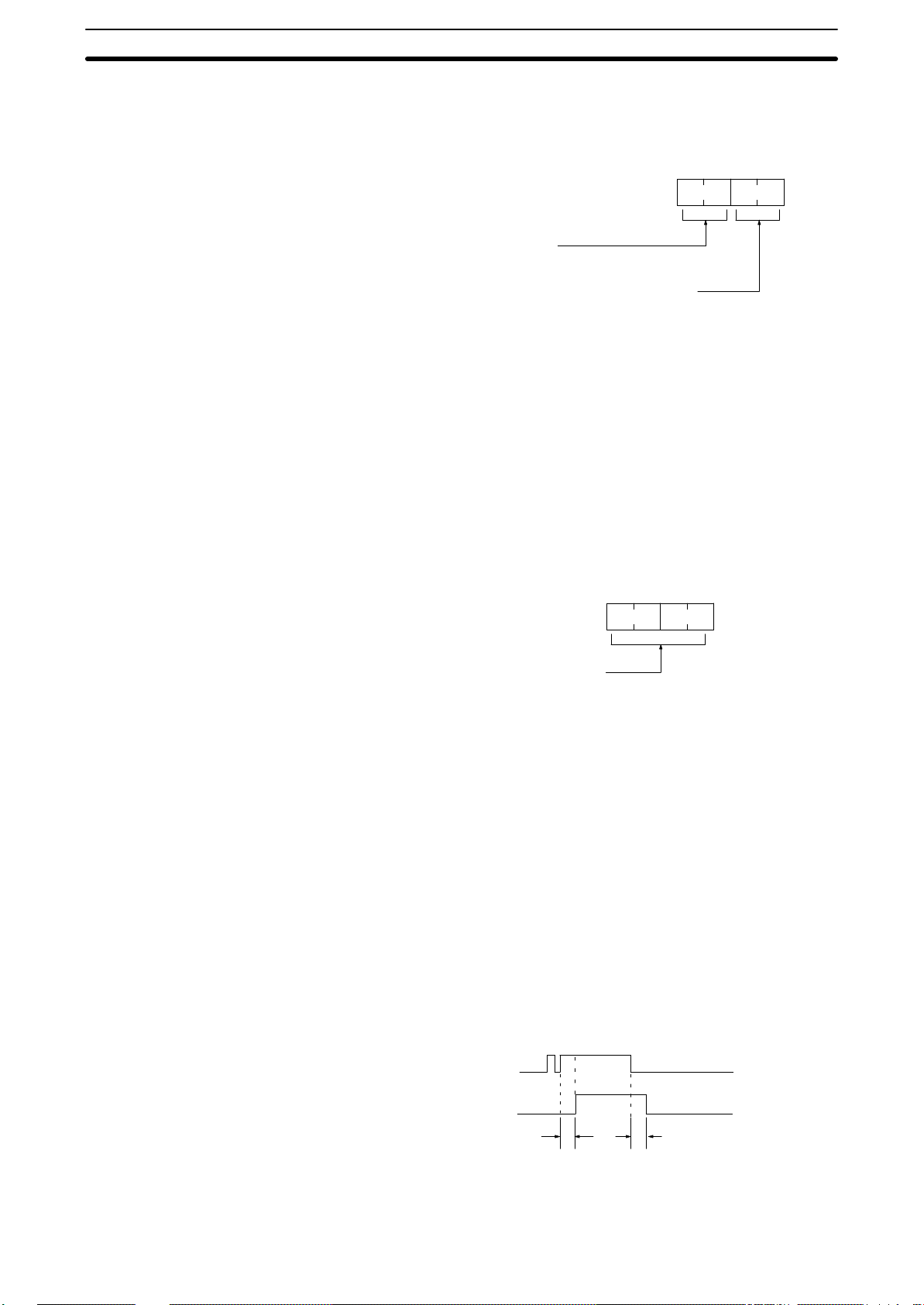
1-3-4 Service–Zeit der Peripherieschnittstelle
Die folgenden Einstellungen spezifizieren den prozentualen Anteil der
Zykluszeit für den Service der Peripherieschnittstelle.
Service–Zeiteinstellung aktiviert
00: Deaktiviert (5% der Zykluszeit)
01: Aktiviert (die Einstellung in den Bits 00 bis 07 wird verwendet)
Service-Zeit
(%, gültig, wenn die Bits 08 bis 15 auf 01 gesetzt sind)
00 bis 99 (BCD, zweistellig)
Vorgabe: 5% der Zykluszeit
Beispiel: Wird DM 6617 auf 0115 gesetzt, wird 15% der Zykluszeit für den
Service der Peripherieschnittstelle aufgewendet.
Die kleinste Service–Zeit beträgt 0,256 ms.
Die gesamte Service-Zeit wird erst verwendet, wenn eine entsprechende
Anforderung vorliegt.
Bit
DM 6617
1-3AbschnittBasis–SPS–Betrieb und E/A–Verarbeitungen
15 0
1-3-5 Kleinste Zykluszeit
Die folgenden Einstellungen dienen zur Spezifikation der Standard-Zykluszeit
und verhindern Schwankungen der E/A-Ansprechzeit durch Einstellung der
minimalen Zykluszeit.
Ist die tatsächliche Zykluszeit kürzer als die minimale Zykluszeit, erfolgt die
Ausführung erst nach Ablauf der Mindestzeit. Ist die Ist–Zykluszeit länger als
die min. Zykluszeit, dann erfolgt die Abarbeitung entsprechend der
Ist–Zykluszeit. Bei Überschreitung der minimalen Zykluszeit wird AR 2405
gesetzt.
1-3-6 Eingangs–Zeitkonstanten
Die folgenden Einstellungen spezifizieren die Zeit, in der die tatsächlichen
Eingänge der DC-Eingangsbaugruppe auf AUS oder EIN gesetzt werden bis
zur Auffrischung der entsprechenden Eingangsbits (d.h. bis zur Änderung
des EIN/AUS-Zustandes). Diese Einstellungen dienen zur Spezifikation der
Zeit, in der die Eingänge stabilisiert werden.
Das Vergrößern der Eingangs–Zeitkonstante kann die Wirkungen von
prellenden und externen Störungen reduzieren.
Bit
15 0
DM 6619
Zykluszeit (BCD, vierstellig)
0000: Variable Zykluszeit
0001 bis 9999: Minimale Zykluszeit (Einheit: 1 ms)
Vorgabe: Variable Zykluszeit
14
Eingang von einem Eingangsgerät wie z.B. Begrenzungsschalter
Eingangsbit–Status
t
t
Eingangs–Zeitkonstante

Eingangs–Zeitkonstanten für IR 000 bis IR 001
Zeitkonstante für IR 00100 bis IR 00115 (BCD, einstellig; sehen Sie unten)
Zeitkonstante für IR 00008 bis IR 00015 (1 BCD–Ziffer; sehen Sie unten)
Zeitkonstante für IR 00000 bis IR 00007 (1 BCD–Ziffer; sehen Sie unten)
Vorgabe: 0000 (jeweils 8 ms)
Eingangs–Zeitkonstanten für IR 002 bis IR 015
DM 6621: IR 002 und IR 003
DM 6622: IR 004 und IR 005
DM 6623: IR 006 und IR 007
DM 6624: IR 008 und IR 009
DM 6625: IR 010 und IR 011
DM 6626: IR 012 und IR 013
DM 6627: IR 014 und IR 015
Eingangs–Zeitkonstante für IR 003, IR 005, IR 007, IR 009, IR 011, IR 013 und IR 015
Eingangs–Zeitkonstante für IR 002, IR 004, IR 006, IR 008, IR 010, IR 012 und IR 014
Vorgabe: 0000 (jeweils 8 ms)
DM6621 bis DM6627
Bit
15 0
Bit
DM 6620
1-3AbschnittBasis–SPS–Betrieb und E/A–Verarbeitungen
15 0
0
Die neun möglichen Einstellungen für die Eingangs–Zeitkonstante sind
nachfolgend dargestellt. Für IR 000 muss nur die äußerst rechte Ziffer
eingestellt werden.
0: 8 ms 1: 1 ms 2: 2 ms 3: 4 ms 4: 8 ms
5: 16 ms 6: 32 ms 7: 64 ms 8: 128 ms
1-3-7 Schnelle Zeitgeber
Nehmen Sie die nachfolgend gezeigten Einstellungen vor, um die Anzahl der
mit TIMH(15) erzeugten Schnellen Zeitgeber, die die Interrupt–Verarbeitung
verwenden, festzulegen.
Freigabe der Schnellen Zeitgeber–Interrupt–Einstellung
00: Einstellung deaktiviert (Interrupt–Verarbeitung für alle Schnellen Zeitgeber, TIM 000
bis TIM 015)
01: Aktiviert (die Einstellung in den Bits 00 bis 07 wird verwendet)
Anzahl der für Interrupts verwendeten Schnellen Zeitgeber (gültig, wenn Bits 08 bis
15 auf 01 gesetzt sind)
00 bis 15 (BCD, zweistellig)
Vorgabe: Interrupt–Verarbeitung für alle Schnellen Zeitgeber, TIM 000 bis TIM 015
Die Einstellung spezifiziert die Anzahl der Zeitgeber, die eine
Interrupt–Verarbeitung verwenden, beginnend mit TIM 000. Wird z. B. “0108”
spezifiziert, dann werden acht Zeitgeber, TIM 000 bis TIM 007, für die
Interrupt–Verarbeitung verwendet.
Bit
DM 6629
15 0
Hinweis 1. Schneller Zeitgeber sind ohne eine Interrupt–Verarbeitung ungenau, falls
die Zykluszeit nicht 10 ms oder weniger beträgt.
2. Wird der SPED(64)–Befehl verwendet und werden Impulse mit einer
Frequenz von 500 Hz oder mehr ausgegeben, dann stellen Sie die
Anzahl der Schnellen Zeitgeber mit Interrupt–Verarbeitung auf vier oder
weniger ein. Sehen Sie die Informationen über den SPED(64)–Befehl für
weitere Einzelheiten.
15

3. Die Interrupt–Reaktionszeit für andere Interrupts wird verbessert, falls die
6650 Ein
g(
Interrupt–Verarbeitung auf 00 eingestellt wird und keine Schnelle
Zeitgeber–Verarbeitung benötigt wird. Dies schließt jede Zykluszeit ein,
die geringer als 10 ms ist.
1-3-8 DSW(87) Eingabestellen und Ausgangs–Auffrischungsverfahren
Nehmen Sie die nachfolgend gezeigten Einstellungen vor, um die Anzahl der
Eingabestellen für den DSW(87)–Befehl und das
Ausgangs–Auffrischungsverfahren festzulegen.
Bit
15 0
DM 6639
Anzahl der Eingabestellen für DSW(87)
00: 4 Stellen
01: 8 Stellen
Ausgangs–Auffrischungsverfahren:
00: Zyklisch
01: Direkt
Vorgabe: Die Anzahl der Eingabestellen für den
DSW(87)–Befehl wird auf “4” eingestellt und das Ausgangs–
Auffrischungsverfahren auf zyklisch.
1-3AbschnittBasis–SPS–Betrieb und E/A–Verarbeitungen
Sehen Sie Seite
425
für weitere Einzelheiten des DSW(87)–Befehls und
Abschnitt 7 SPS–Betrieb und Verarbeitungszeit
E/A–Auffrischungsverfahren.
1-3-9 Peripherieschnittstellen–Einstellungen
Die Kommunikationseinstellungen der Peripherieschnittstelle werden über
Schalter 5 und 7 des DIP–Schalters der CPU–Baugruppe, die
Hexadezimalwerte in DM 6650 und das an die Peripherieschnittstelle
angeschlossene Gerät festgelegt.
DIP–Schalter–
einstellungen
Sch.5Sch.
7
AUS AUS Ignoriert Programming Console Programmierkonsolenbus
AUS EIN
EIN AUS Ignoriert Programmierkonsole Programmierkonsolenbus
EIN EIN Ignoriert Ein anderes
DM
6650–Ein–
stellung
0000
0001
10jj Ohne Protokoll
Angeschlossenes Gerät Kommunikationsmodus
Ein anderes
Programmiergerät außer
einer
Programmierkonsole (wie
z. B. ein PC)
Programmiergerät außer
einer
Programmierkonsole (wie
z. B. ein PC)
für weitere Einzelheiten der
Host–Link, Vorgabeeinstellungen
Toolbusmodus falls ein
CX-Programmer auf den Toolbus
eingestellt ist.
Host–Link, anwedungsspez
Einstellungen
Toolbusmodus falls ein
CX-Programmer auf den Toolbus
eingestellt ist.
Host–Link, Vorgabeeinstellungen
Toolbusmodus falls ein
CX-Programmer auf den Toolbus
eingestellt ist.
1-3-10Fehlerprotokoll–Einstellungen
Zyklusüberwachungszeit
(DM 6618)
16
Nehmen Sie die nachfolgenden Einstellungen vor, um Fehler zu erkennen
und das Fehlerprotokoll zu speichern.
Die Zykluszeit-Überwachung dient zur Erkennung extrem langer
Zykluszeiten, die zum Beispiel im Falle einer unendlichen Programmschleife
auftreten können. Überschreitet die Zykluszeit den für die

1-3AbschnittBasis–SPS–Betrieb und E/A–Verarbeitungen
Zykluszeit-Überwachung spezifizierten Wert, wird ein schwerwiegender
Fehler (FALS 9F) generiert.
Bit
15 0
DM 6618
Zyklusüberwachungszeit–Aktivierung und Einheit
00: Einstellung deaktiviert (Zeit auf 120 ms fest eingestellt)
01: Einstellung in 00 bis 07 aktiviert; Dauer: 10 ms
02: Einstellung in 00 bis 07 aktiviert; Dauer: 100 ms
03: Einstellung in 00 bis 07 aktiviert; Dauer : 1 s
Zyklusüberwachungszeit–Einstellung
(Wenn Bits 08 bis 15 einen Wert ungleich 00 besitzen)
00 bis 99 (BCD, zweistellig; Einheiteneinstellung in
den Bits 08 bis 15)
Vorgabe: 120 ms.
Hinweis 1. Die Einheiten, die für die im AR–Bereich (AR 26 und AR 27) gespeicher-
ten Maximal– und Ist–Zyklusdauer verwendet werden, werden durch die
Einstellung für die Zyklusüberwachungszeit in DM 6618, wie nachfolgend
gezeigt, bestimmt.
Bits 08 bis 15 auf 01 gesetzt:0,1 ms
Bits 08 bis 15 auf 02 gesetzt:1 ms
Bits 08 bis 15 auf 03 gesetzt:10 ms
2. Auch bei Zykluszeiten von 1 s oder länger beträgt die über
Programmiergeräte gelesene Zykluszeit maximal 999,9 ms. Die
tatsächlichen maximalen und aktuellen Zykluszeiten werden in dem
AR–Bereich gespeichert.
Beispiel
Wird 0230 in DM 6618 eingestellt, wird kein FALS 9F–Fehler generiert, bis
die Zykluszeit 3 Sek. überschreitet. Beträgt die Ist–Zykluszeit 2,59 Sek.,
beträgt die im AR–Bereich gespeicherte Zykluszeit 2590 (ms), aber die über
ein Programmiergerät angezeigte Zykluszeit beträgt nur 999,9 ms.
Ein ”geringfügiger” Fehler (Zykluszeit-Überschreitung) wird generiert, sobald
die Zykluszeit 100 ms überschreitet. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass
die Erkennung langer Zykluszeiten über die Einstellung in DM 6655
deaktiviert wurde.
Fehlererkennung und
Fehlerprotokollierung
(DM 6655)
Die folgenden Einstellungen spezifizieren, ob ein ”geringfügiger” Fehler
generiert wird, wenn die Zykluszeit 100 ms überschreitet oder die Spannung
der integrierten Batterie sinkt. Darüber hinaus wird das Verfahren für die
Speicherung von Datensätzen in dem Fehlerprotokoll beim Auftreten von
Fehlern spezifiziert.
Bit
15 0
DM 6655
Batteriespannung niedrig–Erkennung
0: Erkennung
1: Keine Erkennung
Zykluszeit überschritten–Erkennung
0: Erkennung
1: Keine Erkennung
Fehlerprotokoll–Speicherverfahren
0: Die 10 zuletzt aufgetretenen Fehler werden immer gespeichert (ältere Fehler werden gelöscht).
1: Nur die ersten 10 Fehler werden gespeichert (weitere Fehler werden nicht gespeichert).
2 bis F: Fehler werden nicht gespeichert.
Vorgabe: Niedrige Batteriespannung und Zykluszeit-Überschreitungen
werden als Fehler erkannt und die 10 zuletzt aufgetretenen Fehler gespeichert.
0
immer 0
17

Zu geringe Batteriespannungen und Zykluszeit-Überschreitungen werden als
”geringfügige” Fehler eingestuft. Sehen Sie
weitere Einzelheiten bezüglich der Fehlerprotokollierung.
1-4 Interrupt–Funktionen
Dieser Abschnitt beschreibt die Einstellungen und Verfahren für die
Anwendung der CQM1H–Interrupt–Funktionen.
1-4-1 Interrupt–Arten
Die CQM1H verfügt über vier Arten von Interrupts, die nachfolgend
aufgeführt sind.
Eingangs–Interrupts
Die Interrupt–Verarbeitung wird ausgeführt, wenn ein Eingangssignal eines
der CPU–Eingangsbits IR 00000 bis IR 00003 auf EIN gesetzt wird.
Intervall–Zeitgeber–Interrupts
Die Interrupt–Verarbeitung wird durch einen Intervall–Zeitgeber mit einer Genauigkeit von 0,1 ms ausgeführt.
Schneller Zähler–Interrupts
Die Interrupt–Verarbeitung wird entsprechend dem Istwert des eingebauten
Schnellen Zählers ausgeführt. CQM1H–CPU–Baugruppen sind mit den folgenden 3 Arten von Schneller Zähler–Interrupts ausgerüstet. Alle können als
Zielwert– oder Bereichsvergleichs-Interrupts eingesetzt werden. (Ein Zielwert–Interrupt wird generiert, wenn der Istwert dem Sollwert entspricht; ein
Bereichsvergleichs–Interrupt wird generiert, wenn sich der Istwert innerhalb
eines Sollwertbereichs befindet.)
Abschnitt 8 Fehlerbehandlung
1-4AbschnittInterrupt–Funktionen
für
1, 2, 3...
Hinweis Keine Interrupt–Verarbeitung wird für die Schnellen Zähler 1, 2, 3 und 4 einer
Interrupt–Verarbeitung Ein entsprechendes Unterprogramm wird ausgeführt, wenn ein Interrupt
1. Schneller Zähler 0 (integriert in die CPU–Baugruppe)
Schneller Zähler 0 zählt eingehende Impulse an den CPU–Baugruppen–
eingängen 4 bis 6. Zweiphasenimpulse bis zu 2,5 kHz können gezählt
werden.
2. Schneller Zähler 1 und 2 (Impuls–E/A–Modul)
Schneller Zähler 1 und 2 zählen schnelle Impulse, die an den
Schnittstellen 1 und 2 des Impuls–E/A–Moduls anliegen.
Zweiphasenimpulse bis zu 25 kHz können gezählt werden.
3. Absolute Schnelle Zähler 1 und 2
(Absolutwertencoder–Schnittstellenmodul)
Schneller Zähler 1 und 2 zählen Absolutwertencoder–Signale, die an die
Schnittstellen 1 und 2 des Absolutwertencoder–Schnittstellenmoduls
angelegt werden.
Schnellen Zähler–Baugruppe durchgeführt. Eine Schnelle Zähler–Baugruppe
kann Impulse mit bis zu 50 kHz oder 500 kHz zählen. Schnelle Zähler–Istwerte können mit Zielwerten oder einem Sollwertbereich verglichen werden
und Bitmuster kann intern oder extern ausgegeben werden anstatt der Generierung eines Interrupts.
Serielle Kommunikationsmodul–Interrupts
Eine Interrupt–Verarbeitung durch die CPU–Baugruppe ist erforderlich, wenn
das serielle Kommunikationsmodul eine gewünschte Meldung empfängt.
generiert wird.
Anlegen von Unterprogrammen
Interrupt–Unterprogramme werden wie normale Unterprogramme angelegt,
indem SBN(92) und RET(93) hinter das Ende des Hauptprogramms definiert
wird.
Werden Interrupt–Unterprogramme ausgeführt, kann ein bestimmter Bereich
von Eingangsbits aufgefrischt werden.
18
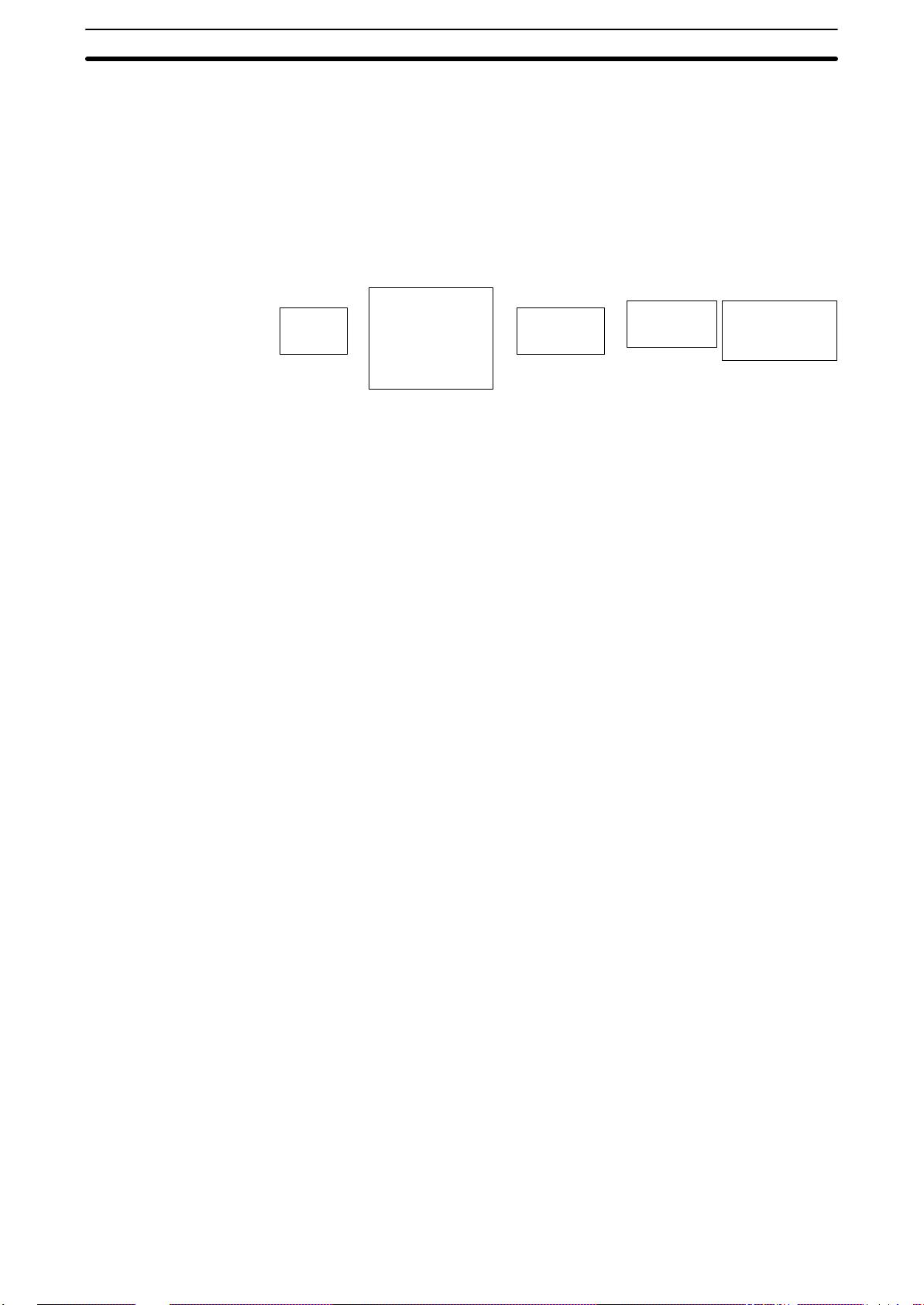
1-4AbschnittInterrupt–Funktionen
Ein Interrupt–Unterprogramm definiert, wie ein “No SBS Error”–Fehler
während des Programmtests generiert wird, aber die Ausführung wird weiter
fortgesetzt. Überprüfen Sie, falls dieser Fehler auftritt, alle normalen
Unterprogramme, um sicherzustellen, dass SBS(91) programmiert wurde,
bevor Sie den Vorgang fortsetzen.
Interrupt–Priorität
Interrupts besitzen die folgende Prioritätsreihenfolge. Eingangs–Interrupts
und Interrupts von den Schnellen Zählern 1 und 2 besitzen die höchste Priorität; die Interrupt–Meldung einer seriellen Kommunikations–Baugruppe besitzt die niedrigste.
1, 2, 3...
Ein-
gangs–
Interrupts
Schnelle Zähler
1– oder
2–Interrupts
=
(vom Impuls–E/A–
oder Absolutwert–
encoder–Schnitt-
stellenmodul)
Intervall–
>=
Zeitgeber–
Interrupts
Schneller
Zähler
0–Interrupts
Interrupt–Meldung
von einem seriel-
>
len Kommunikati-
onsmodul
Wird während der Interrupt–Verarbeitung ein Interrupt mit höherer Priorität
empfangen, wird der aktuelle Betrieb abgebrochen und stattdessen der neu
anliegende Interrupt verarbeitet. Erst nach der vollständigen Ausführung des
Unterprogrammes wird die Verarbeitung des vorhergehenden Interrupts
wieder aufgenommen.
Wird während der Interrupt–Verarbeitung ein Interrupt mit geringerer oder
gleicher Priorität ausgelöst, wird der neu anliegende Interrupt nach der
vollständigen Abarbeitung des aktuellen Unterprogrammes verarbeitet.
Werden zwei Interrupts gleicher Priorität gleichzeitig empfangen, werden sie
in folgender Reihenfolge ausgeführt:
1. Eingangs–Interrupt 0 > Eingangs–Interrupt 1 > Eingangs–Interrupt 2 >
Eingangs–Interrupt 3 > Schneller Zähler–Interrupt 1 > Schneller Zähler–
Interrupt 2
2. Intervall–Zeitgeber–Interrupt 0 > Intervall–Zeitgeber–Interrupt 1 >
Intervall–Zeitgeber–Interrupt 2 (Intervall–Zeitgeber–Interrupt 2 ist der
Schnelle Zähler–Interrupt 0.)
Impulsausgabe–Befehle
und Interrupts
Die folgenden Befehle können nicht in einem Interrupt–Unterprogramm
ausgeführt werden, wenn ein Befehl zur Steuerung der Impuls–E/A oder
Schnelle Zähler im Hauptprogramm ausgeführt wird: (SR 25503 wird
aktiviert)
INI(89), PRV(62), CTBL(63), SPED(64), PULS(65), PWM(––), PLS2(––)
und ACC(––)
19

Die folgenden Methoden können zur Umgehung dieser Einschränkung
genutzt werden:
Methode 1
Die gesamte Interrupt–Verarbeitung kann während der Befehlsausführung
maskiert werden.
@INT(89)
100
000
000
@PLS2(––)
001
000
DM 0010
@INT(89)
200
000
000
Methode 2
Führen Sie den Befehl wieder im Hauptprogramm aus.
In der nachfolgenden Abbildung ist der Programmabschnitt des
Hauptprogrammes dargestellt.
1-4AbschnittInterrupt–Funktionen
@PRV(62)
001
002
LR0000
DM 0000
@CTBL(63)
001
000
DM 0000
RSET LR 0000
In der nachfolgenden Abbildung ist der Programmabschnitt des Interrupt–
Unterprogrammes dargestellt.
SBN(92) 000
25313
25503
P_ER
CTBL(63)
001
000
DM 0000
0000
LR
20

1-4AbschnittInterrupt–Funktionen
1-4-2 Eingangs–Interrupts
Die der CPU–Baugruppe zugewiesenen Eingänge IR 00000 bis IR 00003
können zum Anlegen externer Interrupt–Signale verwendet werden.
Eingangs–Interrupt 0 bis 3 entsprechen diesen Eingangsbits; diese Interrupts
werden verwendet, um die Unterprogramme 000 bis 003 aufzurufen. Werden
keine Eingangs–Interrupt verwendet, können die Unterprogramme 000 bis
003 für normale Unterprogramme verwendet werden.
Verarbeitung Zwei Arten stehen für die Verarbeitung von Eingangs–Interrupts zur Verfügung:
Die erste ist der Eingangs–Interrupt–Modus, in dem Interrupts als Folge von
externen Eingangssignalen ausgeführt werden. Die zweite ist der Zählmodus,
in dem schnelle Signale von externen Quellen gezählt werden und ein Interrupt
jeweils für eine bestimmte Anzahl dieser Signale ausgeführt wird.
Der INT(89)–Befehl legt den zu verwendenden Modus fest.
Im Eingangs–Interrupt–Modus werden Signale mit einer Länge von 100 ms
oder mehr erkannt. Im Zählmodus werden Signale mit bis zu 1 kHz gezählt.
Verfahren
(Eingangs–Interrupt–
Modus)
1, 2, 3...
Führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus, um
Eingangs–Interrupts im Eingangs–Interrupt–Modus einzusetzen.
1. Legen Sie die Interrupt–Eingangsnummer fest.
Eingang Entsprechende Bitadresse Unterprogramm–
Nummer
B0 IN0 IR 00000 000
A0 IN1 IR 00001 001
B1 IN2 IR 00002 002
A1 IN3 IR 00003 003
2. Verdrahten Sie den Eingang. (Sehen Sie Seite 23 für weitere
Einzelheiten.)
3. Nehmen Sie die SPS–Konfigurationseinstellungen vor. (Sehen Sie Seite
23 für weitere Einzelheiten.)
a) Schreiben Sie eine 1 auf die entsprechende Stelle in DM 6628, um zu
kennzeichnen, dass dieser Eingang für einen Eingangs–Interrupt (Eingangs–Interrupt– oder Zählmodus) verwendet wird.
b) Bits in DM 6630 bis DM 6633 können aktiviert werden, um den Eingang
aufzufrischen, bevor das Interrupt–Unterprogramm ausgeführt wird.
4. Programmieren Sie den entsprechenden Programmabschnitt.
a) Verwenden Sie INT(89), um den Eingangs–Interrupt zu demaskieren.
(Sehen Sie Seite 24 für weitere Einzelheiten.)
b) Schreiben Sie ein Unterprogramm zwischen SBN(92) und RET(93).
Eingangs–
Interrupt 0
Interrupt 0
1
2
3
Interrupt 1
Interrupt 2
Interrupt 3
SPS–Konfiguration
DM 6628
Kontaktplan–Programm
INTERRUPT–
STEUERUNG
Interrupts freigeben.
Interrupt generieren
Spezifiziertes Unterprogramm ausführen.
Interrupt–Unterprogramm
21

1-4AbschnittInterrupt–Funktionen
Verfahren
(Zählmodus)
1, 2, 3...
Führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus, um
Eingangs–Interrupts im Zählmodus einzusetzen.
1. Legen Sie die Interrupt–Eingangsnummer fest.
Eingang Entsprechende Bitadresse Unterprogramm–
Nummer
B0 IN0 IR 00000 000
A0 IN1 IR 00001 001
B1 IN2 IR 00002 002
A1 IN3 IR 00003 003
2. Legen Sie den Anfangs–Zählsollwert fest.
3. Verdrahten Sie den Eingang. (Sehen Sie Seite 23 für weitere
Einzelheiten.)
4. Nehmen Sie die SPS–Konfigurationseinstellungen vor. (Sehen Sie Seite
23 für weitere Einzelheiten.)
a) Schreiben Sie eine 1 auf die entsprechende Stelle in DM 6628, um zu
kennzeichnen, dass dieser Eingang für einen Eingangs–Interrupt (Eingangs–Interrupt– oder Zählmodus) verwendet wird.
b) Bits in DM 6630 bis DM 6633 können aktiviert werden, um den Eingang
aufzufrischen, bevor das Interrupt–Unterprogramm ausgeführt wird.
5. Programmieren Sie den entsprechenden Programmabschnitt.
a) Verwenden Sie INT(89), um den Zählersollwert im Zählmodus aufzufri-
schen. (Sehen Sie Seite 25 für weitere Einzelheiten.)
b) Schreiben Sie ein Interrupt–Unterprogramm zwischen SBN(92) und
RET(93) (nur bei Verwendung von Aufwärtszähl–Interrupts.)
Eingangs–Interrupt 0
Zähler 0
1
2
3
Zähler 1
Zähler 2
Zähler 3
SPS–
Konfiguration
DM 6628
Interrupt–Eingang (Zählmodus)
Kontaktplan–Programm
INTERRUPT–
STEUERUNG
Zählersollwert–Auffrischung
(Dekrementiermodus)
Zähler–Sollwert
Jeden Zyklus
Zähler–Istwert – 1
Zähler 0
Zähler 1
Zähler 2
Zähler 3
Zähler 0
Zähler 1
Zähler 2
Zähler 3
SR 248
SR 249
SR 250
SR 251
SR 244
SR 245
SR 246
SR 247
Interrupt generieren
Spezifiziertes Unterprogramm ausführen.
Unterprogramm
Nur bei Verwendung von Interrupts.
22
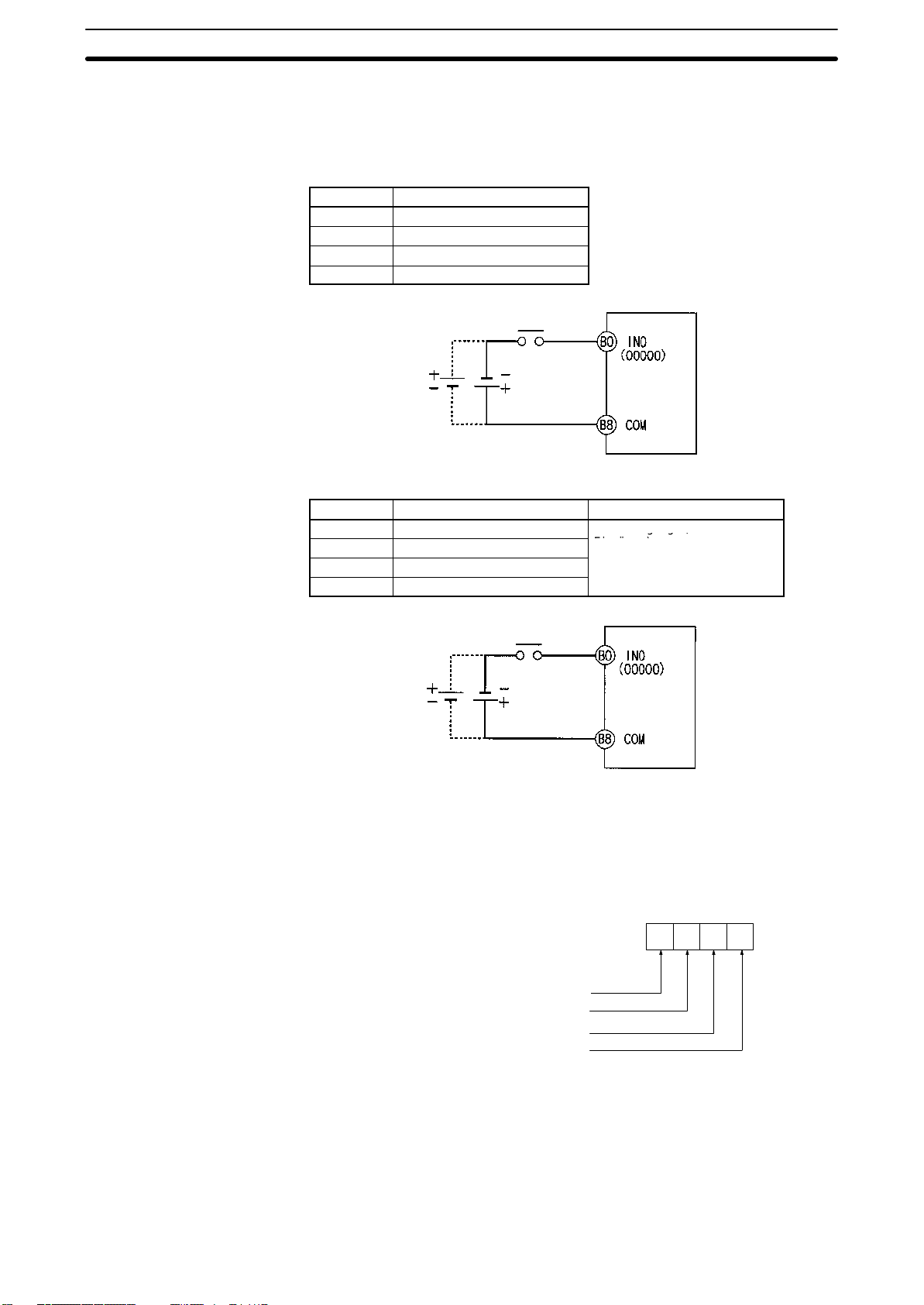
Verdrahtung der Eingänge Verdrahten Sie das Eingangs–Interrupt– oder Zähleingangssignale, bevor
use gä ge( a
Sie Eingangs–Interrupts verwenden, mit der Eingangsklemme der CPU–Baugruppe, wie es nachfolgend dargestellt ist.
Verdrahtungsbeispiel für ein Interrupt–Eingangssignal (Eingangs–Interrupt–
Modus)
Eingang Entsprechende Bitadresse
B0 (IN0) IR 00000
A0 (IN1) IR 00001
B1 (IN2) IR 00002
A1 (IN3) IR 00003
1-4AbschnittInterrupt–Funktionen
Interrupt–Signal
CPU–Baugruppe
Verdrahtungsbeispiel für Zähleingangssignal (Zählmodus)
Eingang Entsprechende Bitadresse Dekrementierender Zählmodus
B0 (IN0) IR 00000
A0 (IN1) IR 00001
B1 (IN2) IR 00002
A1 (IN3) IR 00003
Zähl–Eingangssignal
Impulseingänge (max. 4
Eingänge)
CPU–Baugruppe
SPS–Konfigurations–
parameter
Nehmen Sie folgende Einstellungen in der SPS–Konfiguration in der PROGRAM–Betriebsart vor, bevor Sie das Programm ausführen,
Interrupt–Eingangseinstellungen (DM 6628)
Interrupts können in dem Programm nicht verwendet werden, falls diese
Einstellungen nicht vorgenommen werden.
Bit
15 0
DM 6628
Interrupt–Einstellung für Eingang 3
Interrupt–Einstellung für Eingang 2
Interrupt–Einstellung für Eingang 1
Interrupt–Einstellung für Eingang 0
0: Normaler Eingang
1: Eingangs-Interrupt
Vorgabe: Alle normalen Eingänge.
23
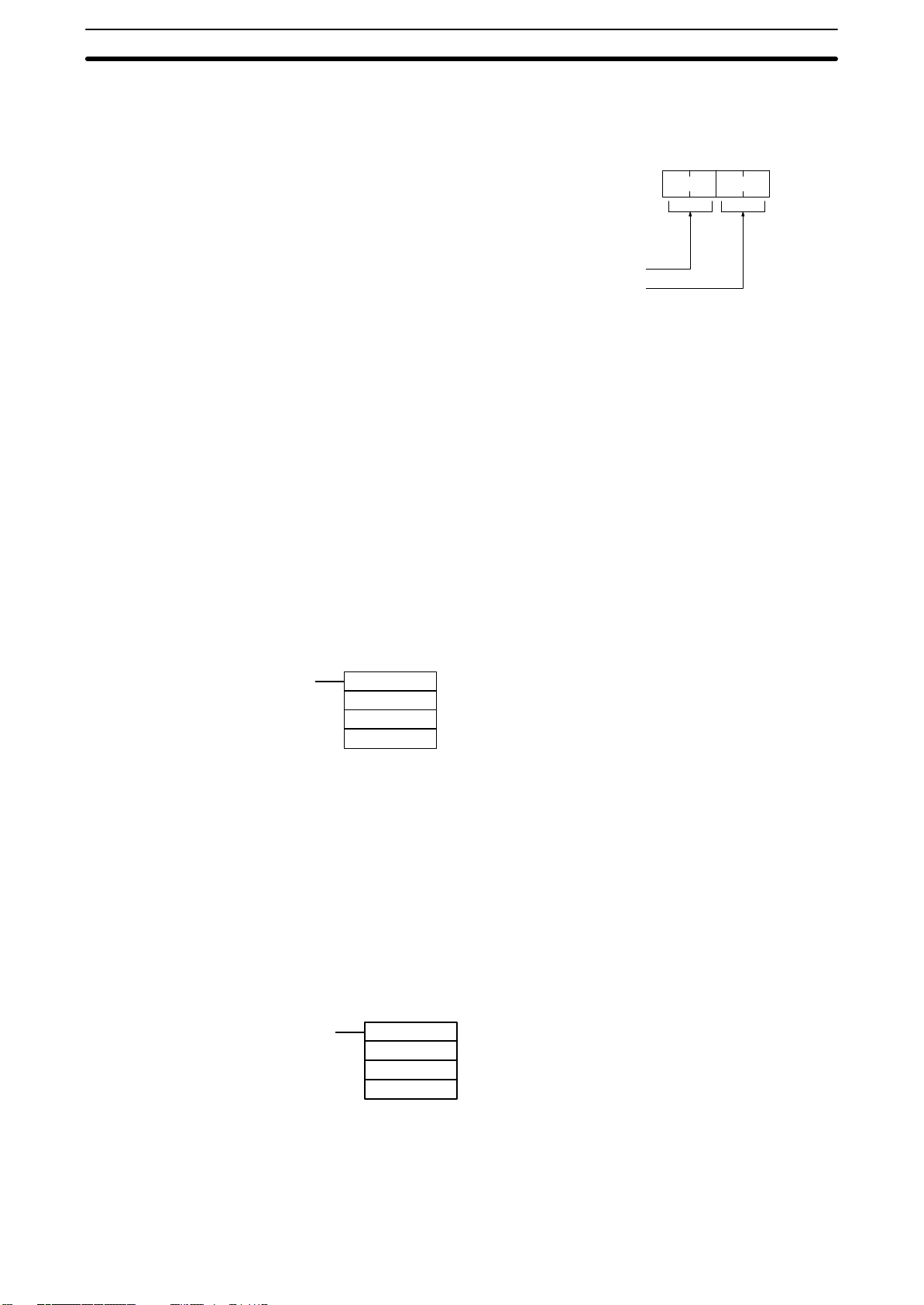
1-4AbschnittInterrupt–Funktionen
Eingangs–Auffrischungswort–Einstellungen (DM 6630 bis DM 6633)
Nehmen Sie diese Einstellungen vor, wenn es nötig ist, Eingänge für den
Eingangs–Interrupt– oder Zählmodus aufzufrischen.
Bit
15 0
DM 6630: Interrupt 0
DM 6631: Interrupt 1
DM 6632: Interrupt 2
DM 6633: Interrupt 3
Anzahl der Worte (BCD, 2–stellig) 00 bis 16
Anfangswort (BCD, 2–stellig) 00 bis 15
Vorgabe: Keine Eingangsauffrischung
Beispiel:
Wird DM 6630 auf 0100 eingestellt, wird IR 000 aufgefrischt, wenn ein Signal
für Interrupt 0 empfangen wird.
Hinweis Wird keine Eingangsauffrischung verwendet, ist der Eingangssignal-Zustand
innerhalb des Interrupt-Unterprogramms nicht eindeutig festgelegt. Dies gilt
auch für den Status des Interrupt-Eingangsbits, das den Interrupt aktiviert
hat. Zum Beispiel würde IR 00000 nicht in der Interrupt–Routine für Eingangs–Interrupt 0 aktiviert werden, bis er aufgefrischt würde (in diesem Fall
könnte der Immer–EIN–Merker SR 25313 anstelle von IR 00000 verwendet
werden).
DM6630 bis DM6633
(IR 000 bis IR 015)
Eingangs–Interrupt–
Modus
Verwenden Sie die folgenden Befehle, um Eingangs–Interrupts im Eingangs–Interrupt–Modus zu programmieren.
Maskierung aller Interrupts
Durch den INT(89)-Befehl können Eingangs-Interrupt-Maskierungen in der
erforderlichen Weise gesetzt bzw. zurückgesetzt werden.
(@)INT(89)
Die Einstellungen erfolgen über die D-Bits 0 bis 3, die den EingangsInterrupts 0 bis 3 entsprechen.
000
0: Löschen der Maskierung (Eingangs–Interrupt freigegeben.)
000
1: Setzen der Maskierung: (Eingangs–Interrupt nicht freigegeben.)
D
Am Anfang des Betriebes werden alle Eingangs–Interrupts maskiert.
Verwenden Sie INT(89), um Eingangs–Interrupts vor deren Einsatz im
Eingangs–Interrupt–Modus auszumaskieren.
Löschen maskierter Interrupts
Wechselt das einem Eingangs-Interrupt entsprechende Bit während der
Maskierung auf EIN, wird der betreffende Eingangs-Interrupt gespeichert und
nach der Aufhebung der Maskierung direkt ausgeführt. Soll der betreffende
Eingangs-Interrupt bei der Aufhebung der Maskierung nicht ausgeführt
werden, muss die Interrupt–Speicherung aus dem Speicher gelöscht werden.
Für jede Interrupt-Nummer wird nur ein Interrupt-Signal gespeichert.
Über den INT(89)-Befehl wird der Eingangs-Interrupt aus dem Speicher
gelöscht.
24
(@)INT(89)
Werden die den Eingangs-Interrupts 0 bis 3
entsprechenden D-Bits 0 bis 3 auf 1 gesetzt, werden
001
die Eingangs-Interrupts gelöscht.
000
0: Der Eingangs-Interrupt wird nicht gelöscht.
D
1: Der Eingangs-Interrupt wird gelöscht.
Lesen des Maskierungszustands
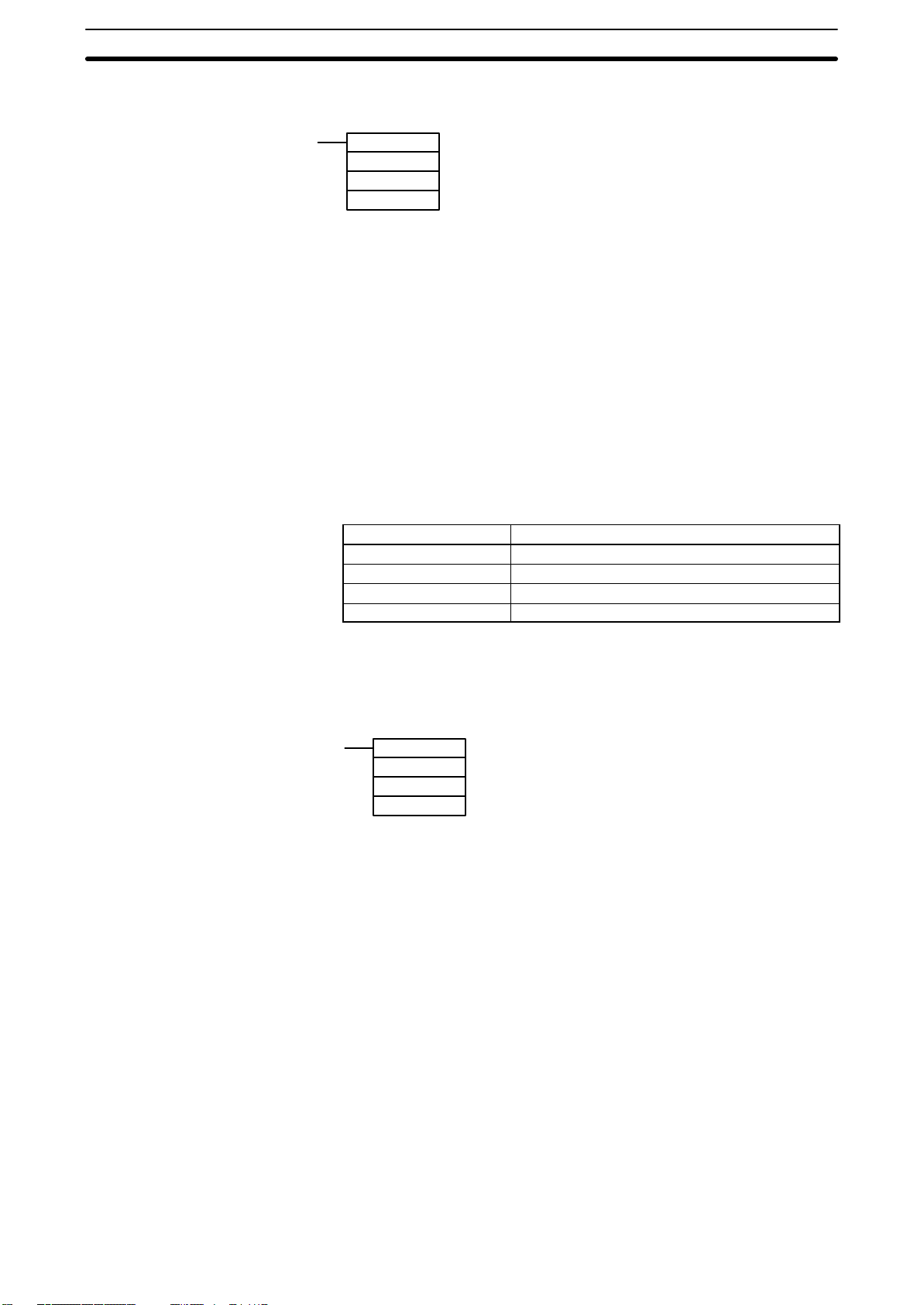
Über den INT(89)-Befehl kann der Zustand der
Eingangs-Interrupt-Maskierung gelesen werden.
1-4AbschnittInterrupt–Funktionen
(@)INT(89)
Der Zustand der äußerst rechten Stellen der in Wort D gespeicherten
Daten (Bits 0 bis 3) zeigt den Maskierungszustand.
002
000
0: Löschen der Maskierung (Eingangs–Interrupt freigegeben.)
1: Setzen der Maskierung: (Eingangs–Interrupt nicht freigegeben.)
D
Verfahren (Zählermodus) Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Eingangs–Interrupts im Zählermo-
dus zu programmieren.
Hinweis Die im Zählermodus (SR 244 bis SR 251) verwendeten SR–Worte enthalten
alle hexadezimale Daten und keine BCD–Werte.
1, 2, 3...
1. Schreiben Sie die Sollwerte für den Zählerbetrieb in die SR–Worte, die
den Interrupts 0 bis 3 entsprechen. Die Sollwerte liegen zwischen 0000
und FFFF (0 bis 65535). Der Wert 0000 deaktiviert den Zählbetrieb, bis
ein neuer Wert spezifiziert und der nachfolgende Schritt 2 wiederholt
wurde.
Hinweis Diese Systemmerker werden zu Beginn des Betriebs
zurückgesetzt und müssen von dem Programm neu gesetzt
werden.
Die höchste Frequenz des Eingangssignals beträgt 1 kHz.
Interrupt Wort, in dem der Zählersollwert gespeichert ist
Eingangs–Interrupt 0 SR 244
Eingangs–Interrupt 1 SR 245
Eingangs–Interrupt 2 SR 246
Eingangs–Interrupt 3 SR 247
Wird der Zählermodus nicht verwendet, können diese SR–Bits als
Hilfsbits verwendet werden.
2. Mit dem INT(89)-Befehl können die in der Zähler-Betriebsart
spezifizierten Sollwerte festgelegt bzw. erneuert werden, wobei die
Maskierung aufgehoben wird.
(@)INT(89)
Werden die den Eingangs-Interrupts entsprechenden
D-Bits 0 bis 3 zurückgesetzt, wird der Sollwert festgelegt
003
und Interrupts sind zulässig.
000
0: Der in der Zähler-Betriebsart spezifizierte Sollwert wird
festgelegt und die Maskierung aufgehoben.
D
1: Nichts passiert. (Die Bits für alle nicht zu ändernden Interrupts auf 1 setzen.)
Der Eingangs-Interrupt, dessen Sollwert festgelegt wird, wird in der
Zähler-Betriebsart aktiviert. Erreicht der Zähler den Sollwert, erfolgt ein
Interrupt und der Zähler wird zurückgesetzt. Die Zählvorgänge/Interrupts
werden bis zur Deaktivierung des Zählers fortgesetzt.
Hinweis 1. Wird der INT(89)-Befehl während des Zählvorgangs aufgerufen, wird der
Istwert auf den Sollwert gesetzt. Für einen Interrupt müssen Sie daher
die differenzierte Form des Befehls verwenden, andernfalls wird kein Interrupt ausgelöst.
2. Der Sollwert wird bei der Ausführung des INT(89)-Befehls festgelegt. Ist
bereits ein Interrupt aktiv, dann kann der Sollwert nicht einfach durch
Änderung des Inhaltes von SR 244 bis SR 247 geändert werden; hierzu
muss der Sollwert durch wiederholte Ausführung des INT(89)-Befehls
erneuert werden.
25
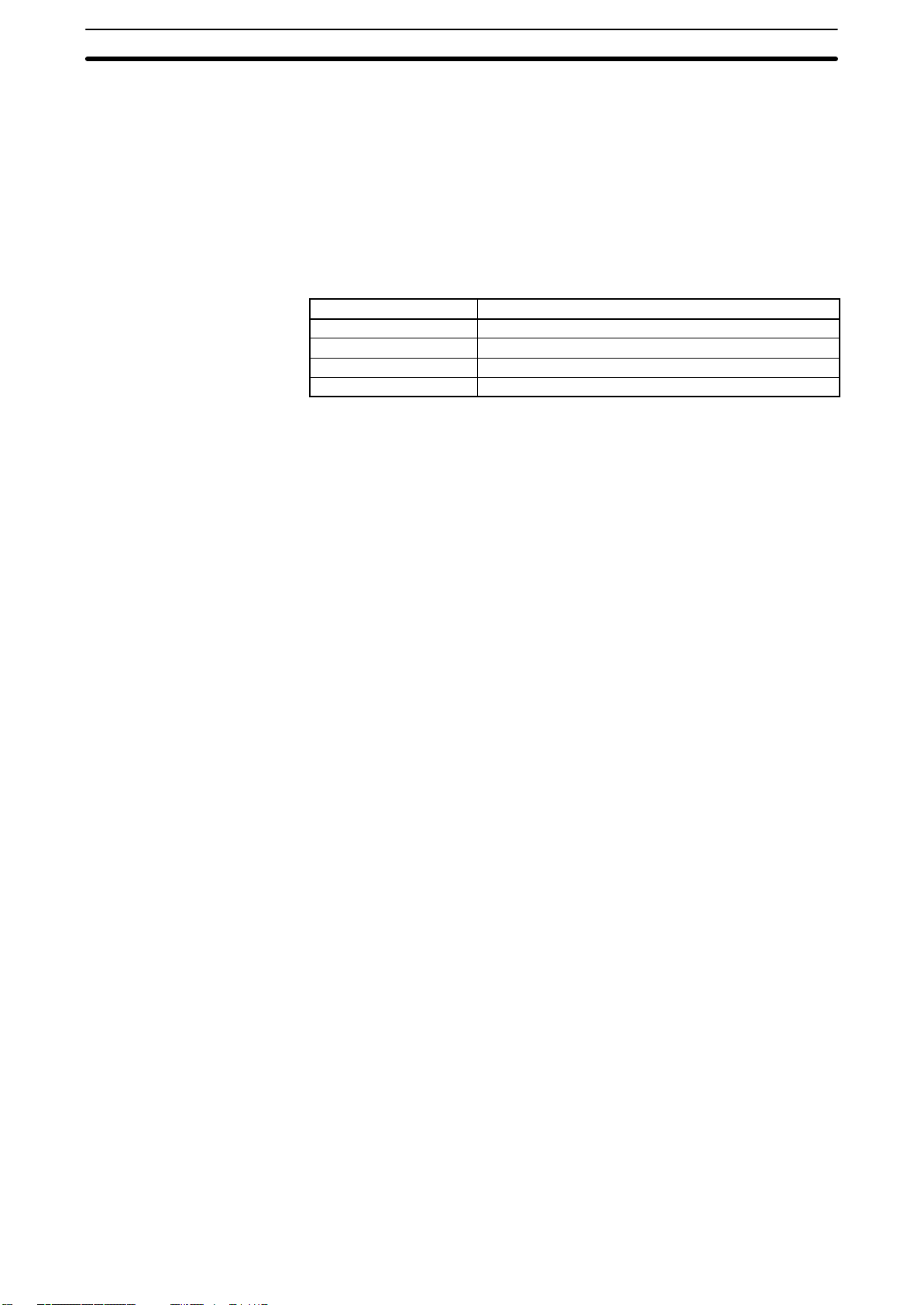
Die Maskierung von Interrupts erfolgt auf die gleiche Weise wie in der
Eingangs-Interrupt-Betriebsart. Werden Maskierungen jedoch auf die gleiche
Weise aufgehoben, wird nicht die Zähler-Betriebsart deaktiviert sondern
stattdessen die Eingangs-Interrupt-Betriebsart aktiviert. Die Speicherung für
maskierte Interrupts wird auf die gleiche Weise wie in der
Eingangs-Interrupt-Betriebsart gelöscht.
Zähler–Istwert im Zählermodus
Werden Eingangs–Interrupts im Zählmodus verwendet, wird der Zähler–Istwert im SR–Wort, das den Eingangs–Interrupts 0 bis 3 entspricht, gespeichert. Die Werte betragen 0000 bis FFFE (0 bis 65534) und entsprechen
dem Zähler-Istwert minus 1.
Interrupt Wort, das den Zähler–Istwert – 1 enthält
Eingangs–Interrupt 0 SR 248
Eingangs–Interrupt 1 SR 249
Eingangs–Interrupt 2 SR 250
Eingangs–Interrupt 3 SR 251
Beispiel: Der Istwert für einen Interrupt, dessen Sollwert 000A beträgt, wird
unmittelbar nach der Ausführung des INT(89)-Befehls als 0009 gespeichert.
Hinweis Auch wenn keine Eingangs-Interrupts in der Zähler-Betriebsart verwendet
werden, können diese SR–Systemmerker nicht als Hilfsbits verwendet werden.
1-4AbschnittInterrupt–Funktionen
Anwendungsbeispiel In diesem Beispiel wird Eingangs–Interrupt 0 im Eingangs–Interrupt–Modus
und Eingangs–Interrupt 1 im Zählermodus verwendet. Stellen Sie vor Ausführung des Programms sicher, dass die SPS–Konfiguration überprüft wurde.
SPS–Konfiguration DM 6628: 0011 (IR 00000 und IR 00001 werden für
Eingangs–Interrupts verwendet). Standardeinstellungen werden für alle
26

25315 (EIN for einen Zyklus)
00100
MOV(21)
(@)INT(89)
anderen SPS–Konfigurationsparameter verwendet. (Eingänge werden nicht
gleichzeitig während der Interrupt–Verarbeitung aufgefrischt.)
Spezifiziert 10 als Zählmodus–Sollwert für Eingangs–Interrupt 1.
#000A
245
Wenn IR 00100 aktiviert wird:
001
000
#0003
Ausmaskierte Interrupts für Eingangs–Interrupts 0 und 1 werden gelöscht.
1-4AbschnittInterrupt–Funktionen
00100
25313 (Immer EIN)
(@)INT(89)
#000E
(@)INT(89)
#000D
BCD (24)
D0000
INC(38)
D0000
(@)INT(89)
#000F
SBN (92) 000
ADB(50)
#000A
INT(89)
#000D
Interrupts sind für Interrupt 0 im Eingangs–Interrupt–Modus freigegeben.
000
000
Interrupts sind für Interrrupt 1 im Zählmodus freigegeben.
003
000
249
(Sollwert: 10 )
Der Inhalt von SR 249 (Istwert – 1) wird in BCD konvertiert und in DM
0000 gespeichert.
Der Inhalt von DM 0000 wird inkrementiert, Ergebnis =
Istwert.
000
000
245
245
Wird IR 00100 deaktiviert, werden Eingangs–Interrupts 0 und 1 ausmaskiert und Interrupts sind gesperrt.
Wird Interrupt 0 für den Eingangs–Interrupt ausgeführt, wird Unterprogramm 000
aufgerufen und der Zählmodus wird mit dem Sollwert für Eingangs–Interrupt 1
aufgefrischt, wobei 10 hinzugefügt wird (Sollwert = 20)
003
000
RET (93)
SBN (92) 001
RET (93)
Wird der Sollwert für den Eingangs–Interrupt 1–Zähler erreicht, wird Unterprogramm
001 aufgerufen und das Interrupt–Unterprogramm ausgeführt.
27

00000
C U aug u e
1-4AbschnittInterrupt–Funktionen
Bei der Ausführung des Programms ergibt sich folgender Ablauf.
Unterprogramm 000
00001
Unterprogramm 001
00100
10 Zähl. 10 Zähl. 20 Zähl.
(Sehen Sie Hinweis 1) (Sehen Sie Hinweis 1)
Hinweis 1. Der Zähler zählt weiter, auch während der Ausführung der Interrupt–Rou-
tine.
2. Der Eingangs–Interrupt bleibt maskiert.
1-4-3 Maskierung aller Interrupts
Mit dem INT(89)-Befehl können alle Interrupts, einschließlich der Eingangs-,
Intervall-Zeitgeber- und Schneller-Zähler-Interrupts als Gruppe maskiert und
ausmaskiert werden. Dieser Vorgang erfolgt zusätzlich zu Maskierungen
einzelner Interrupts. Darüber hinaus wird durch Ausmaskierung aller
Interrupts die Maskierung einzelner Interrupt-Arten nicht zurückgesetzt. Die
Bedingungen vor der Ausführung des INT(89)-Befehls zur Maskierung der
Interrupts als Gruppe sind weiterhin gültig.
Über INT(89) maskierte/ausmaskierte
Eingangs–Interrupts
Intervall–Zeitgeber–Interrupts
Schneller Zähler 0–Interrupt
Schneller Zähler 1– und 2–Interrupts Impuls–E/A–Modul
Schneller Zähler 1– und 2–Interrupts Absolutwertencoder–Schnittstellenmodul
Verwenden Sie INT(89) nur zur Maskierung von Interrupts, wenn alle
Interrupts temporär maskiert werden müssen. INT(89)-Befehle sollten immer
paarweise eingesetzt werden. Der erste INT(89)-Befehl dient zur Maskierung
und der zweite zur Ausmaskierung von Interrupts.
Innerhalb von Interrupt-Routinen kann INT(89) nicht zur (Aus)Maskierung
aller Interrupts verwendet werden.
(Sehen Sie Hinweis 2)
Modul oder Baugruppe
Interrupts
CPU–Baugruppe
Der INT(89)-Befehl dient zur Deaktivierung aller Interrupts.
Ausmaskierung von
Interrupts
28
(@)INT(89)
100
000
000
Wird während der Maskierung ein Interrupt generiert, erfolgt keine
Interrupt-Verarbeitung, sondern der Interrupt für den Eingang, den
Intervall-Zeitgeber und den Schnellen Zähler wird gespeichert. Die Interrupts
werden unmittelbar nach der Ausmaskierung ausgeführt.
Mit Hilfe des INT(89)-Befehls können Interrupts folgendermaßen ausmaskiert
werden:
(@)INT(89)
200
000
000
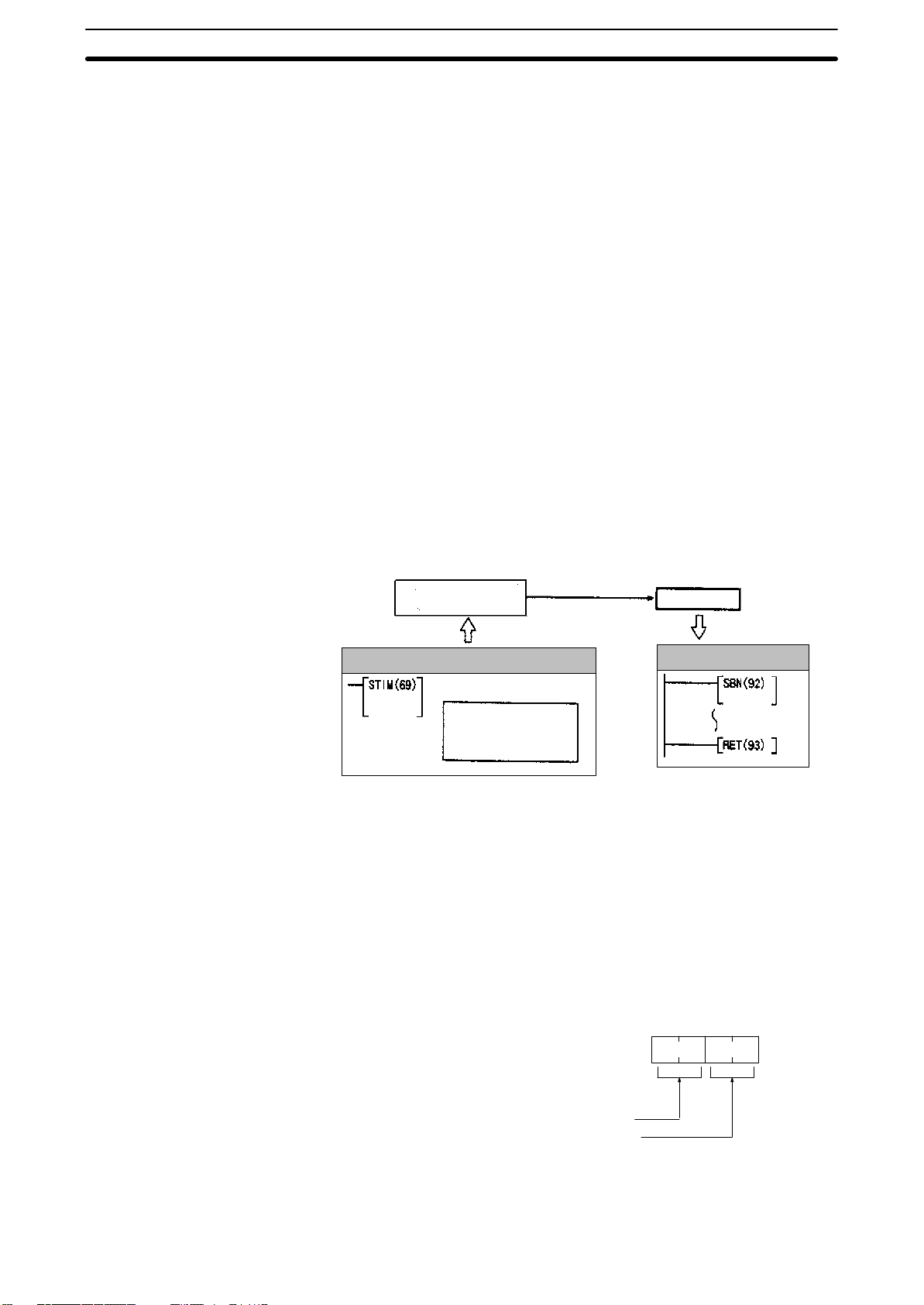
1-4AbschnittInterrupt–Funktionen
1-4-4 Intervall–Zeitgeber–Interrupts
Mit Intervall–Zeitgebern kann eine schnelle, hochgenaue zeitgebergesteuerte
Interrupt–Verarbeitung durchgeführt werden. Die CQM1H stellt drei
Intervall–Zeitgeber, nummeriert von 0 bis 2, zur Verfügung.
Hinweis 1. Intervallzeitgeber 0 kann nicht verwendet werden, wenn Impulse über
SPED(64) an Transistorausgangsbaugruppen ausgegeben werden.
2. Intervall–Zeitgeber 2 kann nicht gleichzeitig mit dem Schnellen Zähler 0
verwendet werden.
Verarbeitung Für den Intervall-Zeitgeberbetrieb stehen zwei Betriebsarten zur Verfügung.
In der ONE SHOT(Monoflop)-Betriebsart wird nach Ablauf der Zeit nur ein
Interrupt ausgelöst. In der SCHEDULED (zeitgesteuerten) INTERRUPT-Betriebsart wird das Interrupt–Unterprogramm in einem festen Zeitintervall
wiederholt.
Verarbeitung Führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte aus, um Intervall–Zeitge-
ber–Interrupts zu verwenden.
1, 2, 3...
1. Spezifizieren Sie, ob der Zeitgeber in der Monoflop– oder zeitgesteuerten Interrupt–Betriebsart arbeiten soll.
2. Programmieren Sie die entsprechenden Programmabschnitte.
a) Verwenden Sie STIM(69), um den Sollwert des Zeitgebers einzustellen
und diesen in der Monoflop– oder zeitgesteuerten Interrupt–Betriebsart
zu starten.
b) Schreiben Sie ein Unterprogramm zwischen SBN(92) und RET(93).
Intervall–Zeitgeber 0 bis 3
(Sehen die Hinweise 1 und 2.)
Kontaktplan–Programm
Intervall-Zeitgeber
Starten Sie den Zeitgeber.
Entweder Monoflop– oder
zeitgesteuerter Interrupt–Betrieb Lesen der abgelaufenen
Zeit
Interrupt generieren
Spezifiziertes Unterprogramm
ausführen
Hinweis 1. Intervall–Zeitgeber 2 kann nicht gleichzeitig mit dem Schnellen Zähler 0
verwendet werden.
2. Intervallzeitgeber 0 kann nicht verwendet werden, wenn Impulse über
SPED(64) an Transistorausgangsbaugruppen ausgegeben werden.
SPS–Konfiguration Nehmen Sie, wenn Sie Intervall–Zeitgeber–Interrupts verwenden, die folgen-
den Einstellungen in der SPS–Konfiguration in der PROGRAM–Betriebsart
vor, bevor Sie das Programm ausführen.
Eingangs–Auffrischungswort–Einstellungen (DM 6636 bis DM 6638)
Führen Sie diese Einstellungen aus, wenn Eingänge aufgefrischt werden
müssen.
Bit
15 0
DM 6636: Zeitgeber 0
DM 6637: Zeitgeber 1
DM 6638: Zeitgeber 2
Anzahl der Worte (BCD, 2-stellig) 00 bis 16
Anfangswort (BCD, 2-stellig) 00 bis 15
Vorgabe: Keine Eingangsauffrischung
DM6636 bis DM6638
(IR 000 bis IR 015)
29

1-4AbschnittInterrupt–Funktionen
Schneller Zähler–Einstellungen (DM 6642)
Überprüfen Sie bei Einsatz des Intervall–Zeitgebers 2 und vor dem Beginn
des Betriebs, ob der Schnelle Zähler (SPS–Konfiguration: DM 6642) auf die
Vorgabeeinstellung (0000: Schneller Zähler wird nicht verwendet) eingestellt
ist.
Betrieb Der folgende Befehl dient zur Aktivierung und Steuerung des Intervall-Zeitge-
bers.
Zeitgeber-Start in der Monoflop-Betriebsart
Der STIM(69)-Befehl ermöglicht den Start des Intervall-Zeitgebers in der
ONE SHOT-Betriebsart.
(@)STIM(69)
Wort
C
2
C2 + 1 Dekrementierungs–Zeitintervall (BCD, 4-stellig; Einheit: 0,1 ms): 0005 bis 0320
Sollwert des Abwärtszählers (BCD, 4-stellig): 0000 bis 9999
(0,5 ms bis 32 ms)
Hinweis Wird für C
C1: Intervall–Zeitgeber–Nr.
Intervall–Zeitgeber 0000
C
1
C
2
C
3
C
2
C
3
Dekrementierungs–Zeitintervall mit 0010 oder 1 ms festgelegt; somit
wird der Sollwert in C
Intervall–Zeitgeber 1: 001
Intervall–Zeitgeber 2: 002
: Zeitgeber–Sollwert (erste Wortadresse oder Konstante)
: Unterprogramm-Nr. (BCD, 4-stellig): 0000 bis 0255
Funktion
eine Konstante verwendet, ist das
2
in ms ausgedrückt.
2
Nach Ablauf des in Wort C2 + 1 spezifizierten Zeitintervalls dekrementiert der
Zähler den Istwert um 1. Beträgt der Istwert 0, wird das spezifizierte
Unterprogramm einmal aufgerufen und der Zeitgeber gestoppt.
Wird für C
eine Wortadresse verwendet, wird die Zeit zwischen der
2
Ausführung des STIM(69)–Befehls bis zum Ablauf der Zeit wie folgt
berechnet:
(Inhat des Wortes C
) x (Inhalt des Wortes C2 + 1) x 0,1 ms = (0,5 bis
2
319.968 ms)
Zeitgeber–Start in der zeitgesteuerten Interrupt–Betriebsart
Der STIM(69)-Befehl ermöglicht den Start des Intervall-Zeitgebers in der
SCHEDULED (zeitgesteuerten) INTERRUPT-Betriebsart.
(@)STIM(69)
Wort
C
2
C2 + 1 Dekrementierungs–Zeitintervall (BCD, 4-stellig; Einheit: 0,1 ms): 0005 bis 0320
Sollwert des Abwärtszählers (BCD, 4-stellig): 0000 bis 9999
(0,5 ms bis 32 ms)
Hinweis Wird für C
C1: Intervall–Zeitgeber–Nr. + 3
C
1
C
2
C
3
C
2
C
3
Dekrementierungs–Zeitintervall mit 0010 oder 1 ms festgelegt; somit
wird der Sollwert in C
Intervall–Zeitgeber 0: 003
Intervall–Zeitgeber 1: 004
Intervall–Zeitgeber 2: 005
: Zeitgeber–Sollwert (erste Wortadresse oder Konstante)
: Unterprogramm-Nr. (BCD, 4-stellig): 0000 bis 0255
Funktion
eine Konstante verwendet, ist das
2
in ms ausgedrückt.
2
In der ONE SHOT(Monoflop)-Betriebsart besitzen die Einstellungen die
gleiche Bedeutung. In der SCHEDULED (zeitgesteuerten)
INTERRUPT-Betriebsart wird der Zeitgeber-Istwert jedoch auf den Sollwert
zurückgesetzt und die Dekrementierung beginnt nach dem Aufruf des
Unterprogramms. In der SCHEDULED (zeitgesteuerten)
INTERRUPT-Betriebsart werden die Interrupts in festen Zeitintervallen bis
zum Betriebsende wiederholt.
30
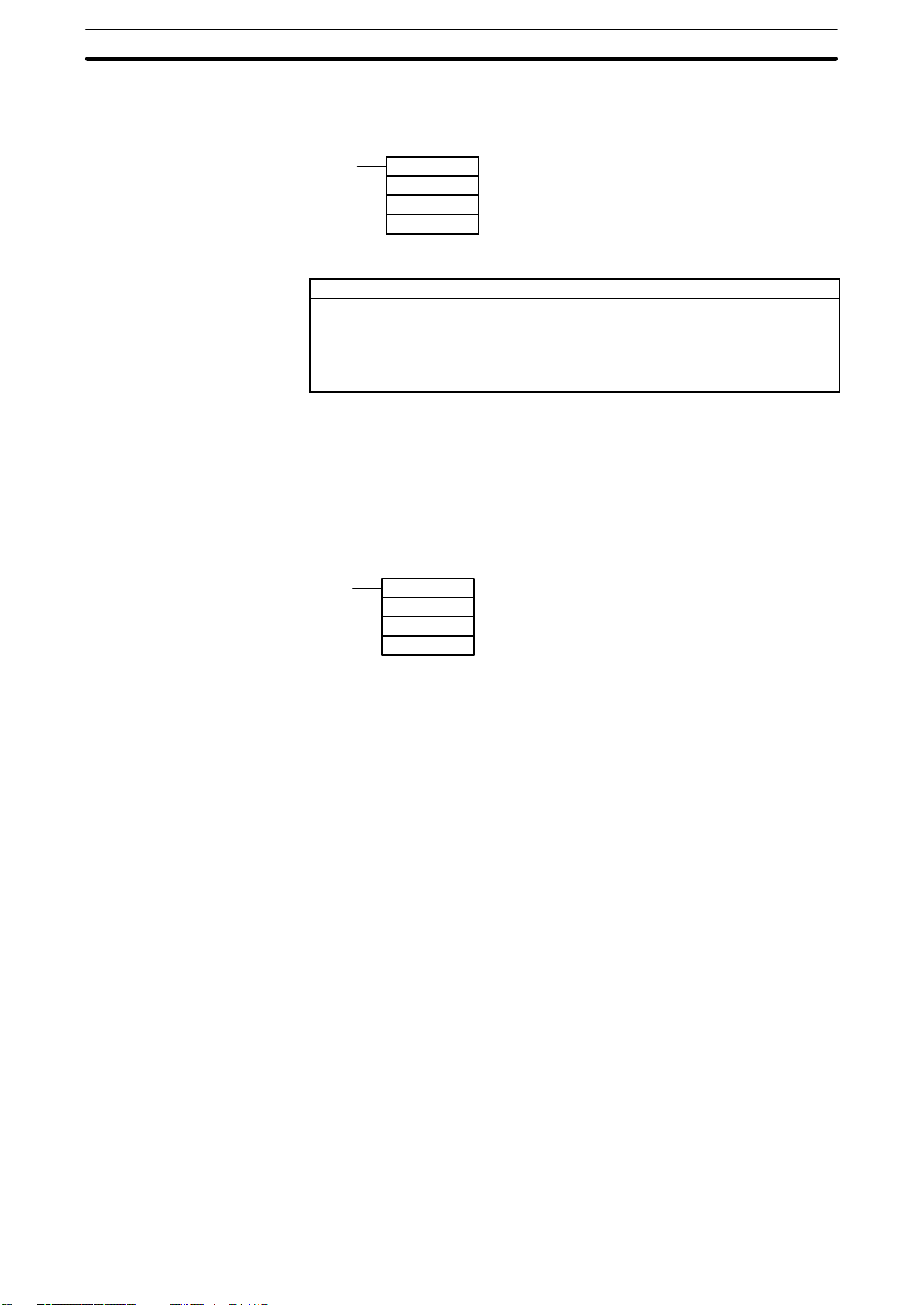
1-4AbschnittInterrupt–Funktionen
Lesen der abgelaufenen Zeit des Zeitgebers
Der STIM(69)-Befehl dient zum Lesen der von dem Zeitgeber abgelaufenen
Zeit.
(@)STIM(69)
Wort
C
2
C2 + 1 Zeitintervall des Abwärtszählers (BCD, 4-stellig; Einheit: 0,1 ms)
C
3
Anzahl der Zähler-Dekrementierungen (4-stelliger BCD-Wert)
Abgelaufene Zeit seit der vorhergehenden Dekrementierung (BCD, 4-stellig;
Einheit: 0,1 ms)
Hinweis Dieser Wert ist kleiner als das dekrementierende Zähler–Zeitintervall.
C1: Intervall–Zeitgeber–Nr. + 6
C
1
C
2
C
3
C
2
C
3
Intervall–Zeitgeber 0: 006
Intervall–Zeitgeber 1: 007
Intervall–Zeitgeber 2: 008
: Erste Wortadresse von Parameter 1
: Parameter 2
Funktion
Die abgelaufene Zeit vom Starten des Intervall-Zeitgebers bis zur
Ausführung dieses Befehls wird folgendermaßen berechnet:
{(Inhalt des Wortes C2) x (Inhalt des Wortes C2 + 1) + (Inhalt des Wortes C3)} x 0,1
ms
Bei einem Stopp des spezifizierten Intervall-Zeitgebers wird ”0000”
gespeichert.
Anhalten der Zeitgeber
Verwenden Sie den STIM(69)-Befehl, um den Intervall-Zeitgeber anzuhalten.
(@)STIM(69)
C
1
C1: Intervall–Zeitgeber–Nr. + 10
000
000
Intervall–Zeitgeber 0: 010
Intervall–Zeitgeber 1: 011
Intervall–Zeitgeber 2: 012
Der spezifizierte Intervall–Zeitgeber wird angehalten.
Anwendungsbeispiel In diesem Beispiel wird durch den Intervall–Zeitgeber 1 alle 2,4 ms (0,6 ms x
4) ein Interrupt ausgelöst. Für alle anderen Einstellungen der SPS–Konfi-
31

1-4AbschnittInterrupt–Funktionen
guration werden Vorgabewerte angenommen. (Eingänge werden für die Interrupt–Verarbeitung nicht aufgefrischt.)
25315 Erster Zyklus–Merker
EIN für 1 Zyklus
00100
00100
Intervall–Zeitgeber–Sollwerte:
MOV (21)
#0004
DM 0010
MOV(21)
#0006
DM 0011
@STIM(69)
DM 0010
#0023
@STIM(69)
SBN (92) 023
RET (93)
Setzt den Sollwert des Dekrementierungs–Zählers auf 4.
Setzt das Dekrementierungs–Zeitgeber–Intervall auf 0,6 ms.
Intervall–Zeitgeber 1 startet, wenn IR 00100 aktiviert wird.
004
Intervall–Zeitgeber 1 stoppt, wenn IR 00100 deaktiviert wird.
011
000
000
Alle 2,4 ms wird der Zählwert von Intervall–Zeitgeber 1 erreicht, Unterprogramm 023 aufgerufen und die Interrupt–Verarbeitung ausgeführt.
Wird das Programm ausgeführt, wird Unterprogramm 023 alle 2,4 ms
ausgeführt, während IR 00100 aktiviert ist.
IR 00100
Unterprogramm 023
2,4 ms 2,4 ms 2,4 ms
1-4-5 Schneller Zähler 0–Interrupts
An die CPU–Bits 00004 bis 00006 angelegte Impulse von einem Encoder
können mit hoher Geschwindigkeit über den Schnellen Zähler 0 (dem
integrierten Schnellen Zähler) gezählt werden und eine
Interrupt–Verarbeitung kann entsprechend dem Zählstand ausgeführt
werden.
Eingangssignaltypen und
Zählmodi
Zwei Signaltypen können über einen Impuls–Encoder eingegeben werden.
Die für den Schnellen Zähler 0 verwendete Zähl-Betriebsart wird von dem
Signaltyp bestimmt.
Betriebsart Betrieb
Differential–
Phasenmodus
Inkrementier–
betriebsart
Ein phasenverschobenes 4X Zweiphasen-Signal (Phase A und B) und ein
Z-Signal werden mit den Eingängen verbunden. Der Zähler wird
entsprechend dem Unterschied zwischen den Phasen A und B inkrementiert
bzw. dekrementiert.
Ein einphasiges Impulssignal und ein Zähler-Rücksetzsignal wird verwendet.
Der Zähler wird entsprechend des einphasigen Signals inkrementiert.
32
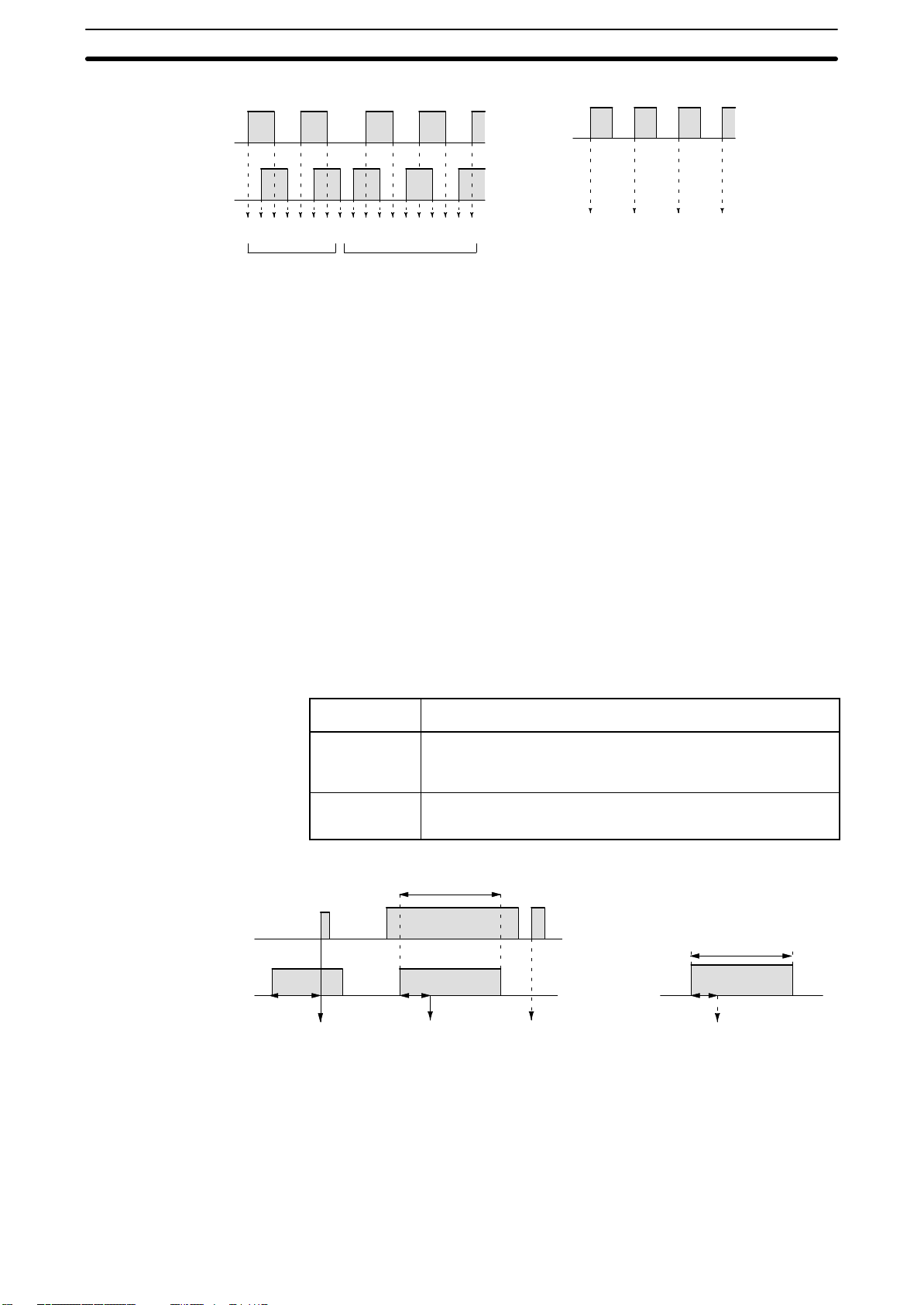
1-4AbschnittInterrupt–Funktionen
Phase A
Phase B
Zählen
Differential–Phasenmodus
1234567876543210–1–2
Inkrementierung Dekrementierung
Impulseingabe
Zählen
Inkrementierbetriebsart
1 2 3 4
Nur Inkrementierung
Hinweis Eines der folgenden Verfahren sollte immer zur Rücksetzung des Zählers bei
einem Neustart verwendet werden. Der Zähler wird am Anfang bzw. Ende
einer Programmausführung automatisch zurückgesetzt.
Die folgenden Signalübergänge werden als Vorwärts-Zählimpulse
(Inkrementierung) ausgewertet: Ansteigende Flanke Phase A - ansteigende
Flanke Phase B - fallende Flanke Phase A - fallende Flanke Phase B. Die
folgenden Signalübergänge werden als Rückwärts-Zählimpulse
(Dekrementierung) ausgewertet: Ansteigende Flanke Phase B - ansteigende
Flanke Phase A - fallende Flanke Phase B - fallende Flanke Phase A.
Im Differential–Phasenmodus reicht der Zählbereich von –32.767 bis 32.767
und im Inkremental–Zählmodus von 0 bis 65.535. Impulse können im
Differential–Phasenmodus mit bis zu 2,5 kHz und im Inkremental–Zählmodus
mit bis zu 5,0 kHz gezählt werden.
Der Differential–Phasenmodus verwendet ein 4X phasenverschobenes
Eingangssignal. Die Anzahl der Zählimpulse für jede Encoder-Umdrehung
entspricht der vierfachen Zählerauflösung. Wählen Sie einen Encoder auf der
Grundlage des zählbaren Bereiches.
Rücksetzverfahren
Zur Rücksetzung des Zähler-Istwertes (d.h. Istwert auf 0) kann eines der
beiden folgenden Verfahren verwendet werden.
Phase-Z (Rücksetzsignal)
SR 25200
1 oder mehrere
Zyklen
Rücksetz–
verfahren
Z–Phasensignal +
Software–
Rücksetzung
Software–
Rücksetzung
Z–Phasensignal + Software–Rücksetzung:
Innerhalb eines
Zyklus
Interrupt–gesteuerte
Rücksetzung
Der Istwert wird zurückgesetzt, wenn das Z-Phasensignal
(Rücksetz-Eingang) nach dem Setzen des
SCHNELLER-ZÄHLER(0)-RÜCKSETZ-Systemmerkers (SR 25200) auf
EIN gesetzt wird.
Der Istwert wird beim Setzen des
SCHNELLER-ZÄHLER(0)-RÜCKSETZ-Systemmerkers (SR 25200)
zurückgesetzt.
1 oder mehrere Zyklen
Zyklus–gesteuerte
Rücksetzung
Keine Rücksetzung
Betrieb
SR 25200
Innerhalb
eines Zyklus
Software–Rücksetzung
1 oder mehrere Zyklen
Zyklus–gesteuerte
Rücksetzung
Hinweis Der SCHNELLER-ZÄHLER(0)-RÜCKSETZ-Systemmerker (SR 25200) wird
innerhalb eines programmzyklus einmal aufgefrischt. Zur eindeutigen Identifizierung des Merkerzustands muss dieser daher für mindestens einen Programmzyklus gesetzt sein.
”Z” in ”Phase Z” steht für ZERO (Null). Dieses Signal zeigt an, dass der
Encoder einen Zyklus abgeschlossen hat.
33

1-4AbschnittInterrupt–Funktionen
Zählen mit dem Schneller Zähler(0)-Interrupt
Für einen Interrupt des Schnellen Zählers 0 wird anstelle eines AufwärtsZählvorgangs eine mit dem CTBL–Befehl erstellte Vergleichstabelle verwendet. Die Zähleristwert-Prüfung erfolgt mit Hilfe eines der beiden nachfolgend
beschriebenen Verfahren. In der Vergleichstabelle werden Vergleichsbedingungen (für den Vergleich mit dem Istwert) und Kombinationen aus InterruptRoutinen gespeichert.
Verfahren Betrieb
Zielwert Maximal 16 Vergleichsbedingungen (Zähler–Istwert und Zählrichtungen) und
Bereichs–
vergleich:
Zielwert–Vergleiche
Der Ist–Zählwert wird mit den Zielwerten in der Reihenfolge verglichen, in der
die Zielwerte in der Vergleichtabelle gespeichert sind und Interrupts werden
generiert, wenn der Zählwert dem Zielwert entspricht. Nachdem der Zählwert
allen Zielwerten in der Tabelle entsprochen hat, wird der Zeiger auf den ersten Zielwert in der Tabelle eingestellt; der Vergleich beginnt wiederum mit
dem Ist–Zählwert, bis die zwei Werte gleich sind.
Interrupt-Unterprogramme werden in der Vergleichstabelle gespeichert.
Entspricht der Zähler-Istwert und die Zählrichtung den
Vergleichsbedingungen, wird das spezifizierte Interrupt-Unterprogramm
ausgeführt.
Acht Vergleichsbedingungen (obere und untere Grenzwerte) und
Interrupt-Unterprogramme werden in der Vergleichstabelle abgelegt. Ist der
Istwert größer oder gleich dem unteren Grenzwert und kleiner oder gleich dem
oberen Grenzwert, wird das spezifizierte Interrupt-Unterprogramm ausgeführt.
Vorgabewert
Zählen
Zielwert
Interrupts
12 3 4 5
Vergleichstabelle
Zielwert 1
Zielwert 2
Zielwert 3
Zielwert 4
Zielwert 5
Bereichsvergleiche
Der Ist–Zählwert wird auf zyklische Art gleichzeitig mit allen Bereichen verglichen, und, basierend auf den Ergebnissen der Vergleiche, werden Interrupts
generiert.
Vergleichstabelle
0
Zählen
13
24
Bereichseinstellung 1
Bereichseinstellung 2
Bereichseinstellung 3
Bereichseinstellung 4
Hinweis Bei der Durchführung von Zielwert–Vergleichen darf der INI–Befehl nicht wie-
derholt verwendet werden, um den Ist–Zählwert zu ändern und den Vergleichsvorgang zu beginnen. Die Interrupt–Funktion abeitet evtl. nicht richtig,
wenn der Vergleich sofort nach der Änderung des Istwertes durch das Programm begonnen wird. (Der Vergleich kehrt automatisch zum ersten Zielwert
zurück, sobald ein Interrupt für den letzten Zielwert generiert wurde. Eine
wiederholende Abarbeitung ist möglich, indem lediglich der aktuelle Wert geändert wird.)
Verfahren Führen Sie die nachfolgend beschriebenen Schritte durch, um den Schnellen
Zähler 0 (in die CPU–Baugruppe integriert) zu verwenden.
34

1-4AbschnittInterrupt–Funktionen
1, 2, 3...
1. Spezifizieren Sie den zu verwendenden Eingangsmodus (Differential–
Phasenmodus oder Inkrementalmodus) und das Rücksetzverfahren
(Z–Phasensignal + Software–Rücksetzung oder Software–Rücksetzung).
2. Legen Sie den Interrupt–Typ fest.
a) Kein Interrupt (Nur Lesen des schnellen Zähler–Istwerts oder Lesen der
Bereichs–Vergleichsergebnisse)
b) Zielwert– oder Bereichsvergleichs-Interrupts werden verwendet.
3. Verdrahtung der Eingänge. (Sehen Sie das
CQM1H–Programmierhandbuch
Eingang Entsprechende Bitadresse
B2 IN4 IR 00004
A2 IN5 IR 00005
B3 IN6 IR 00006
für Einzelheiten zur Verkabelung.)
4. Nehmen Sie die SPS–Konfigurationseinstellungen in DM 6642 vor.
(Sehen Sie Seite 37 für weitere Einzelheiten.)
a) Speichern Sie 01 in dem linken Byte, um die Verwendung des Schnellen
Zählers 0 zu markieren.
b) Spezifizieren Sie den Eingangsmodus (Differential–Phasen– oder In-
krementalmodus.)
c) Spezifizieren Sie das Rücksetzverfahren (Z–Phasensignal + Software–
Rücksetzung oder Software–Rücksetzung)
Hinweis Der Schnelle Zähler 0 kann nicht gleichzeitig mit dem
Intervall–Zeitgeber 2 verwendet werden. (Die Einstellungen im
linken Byte von DM 6642 bestimmen, ob der Schnelle Zähler 0
oder Intervall–Zeitgeber 2 verwendet werden kann.)
Gebereingänge
Eingangsmodus
Differentialphase
Inkrementierung
SPS−Konfiguration
DM 6642, Bits 00
bis 03
5. Programmieren Sie den entsprechenden Programmabschnitt.
a) Verwenden Sie CTBL(63), um die Vergleichstabelle zu speichern und
den Vergleich zu starten.
b) Verwenden Sie INI(61), um den Istwert des Schneller Zählers zu ändern
oder den Vergleich zu starten.
c) Verwenden Sie PRV(62), um den Istwert des Schnellen Zählers, den
Vergleichsstatus oder das Vergleichsergebnis zu lesen.
d) Schreiben Sie ein Interrupt–Unterprogramm zwischen SBN(92) und
RET(93) (nur wenn Sie den Schneller Zähler 0–Interrupt verwenden.)
Schneller Zähler 0
Rücksetz-Verfahren
Phase-Z + Software–
Rücksetzung
Software
SPS−Konfiguration
DM 6642, Bits 04
bis 07
Jeden Zyklus
Zähler–Istwert
SR 231 und SR 230
Zählen
Bei jeder Ausführung
SPS–Konfiguration
DM 6642, Bits
08 bis 15
Kontaktplan–Programm
VERGLEICHSTABELLE
SPEICHERN
Tabelle speichern
Vergleich beginnen
MODUSSTEUERUNG
Zähler–Istwert ändern
Vergleich beginnen/beenden
ISTWERT DES SCHNELLEN ZÄHLERS LESEN
Zähler–Istwert lesen
Vergleichsstatus lesen
Bereichsvergleichs–Ergebnisse lesen
Bereichsvergleichs–
Ergebnisse
Interrupt
generieren
Interrupt−Unterprogramm
Nur bei Verwendung von Interrupts.
AR 1100 bis
AR 1107
Spezifiziertes Unterprogramm ausführen.
35

Die folgende Tabelle enthält Befehle, die sich auf die Schnelle
C (63)
(6 )
(6 )
Zählers 0 (der in die CPU Baugru e
Zähler–Steuerung beziehen.
Befehl Steuerfunktionen
CTBL (63)
INI (61)
PRV(62)
Zielwert–Vergleichstabelle speichern und Vergleich beginnen
Bereichs–Vergleichstabelle speichern und Vergleich beginnen
Nur Zielwert–Vergleichstabelle speichern.
(Vergleich mit INI(61) beginnen.)
Bereichs–Vergleichstabelle speichern.
(Vergleich mit INI(61) beginnen.)
Startet den Vergleich mit der gespeicherten Vergleichstabelle.
Vergleich beenden
Ändert den Schnellen Zähler–Istwert.
Istwert des Schnellen Zählers lesen
Bereichsvergleichs–Ergebnisse lesen
Die folgenden Merker und Steuerbits werden zur Überwachung und
Steuerung des Schneller Zähler–Betriebs verwendet.
Wort Bits Name Funktion
SR 230 00 bis 15 Schneller Zähler 0–Istwert
(äußerst rechte 4 Stellen)
SR 231 00 bis 15 Schneller Zähler 0–Istwert
(äußerst linke 4 Stellen)
SR 252 00 Rücksetzmerker,
Schneller–Zähler 0
AR 11 00 bis 07 Schneller Zähler
0–Bereichsvergleichs–
merker
Enthält den Istwert des Schnellen
Zählers 0 (der in die CPU–Baugruppe
integrierte Schnelle Zähler.)
Zurücksetzen des Istwertes des
Schnellen Zählers 0.
Spezifizieren die
Bereichs–Vergleichsergebnisse für den
Schnellen Zähler 0.
0: Bereichs–Vergleichsbedingung nicht
erfüllt.
1: Bereichs–Vergleichsbedingung
erfüllt.
1-4AbschnittInterrupt–Funktionen
Abhängig vom Eingangsmodus werden die Signale vom Geber wie folgt
an die Eingangsklemmen der CPU–Baugruppe angeschlossen.
Eingang Zugewiesene
Bitadresse
B2 (IN4) 00004 Encoderphase A Impuls–Zähleingang
A2 (IN5) 00005 Encoderphase B --B3 (IN6) 00006 Encoderphase Z Rücksetzeingang
Differential–Phasenmodus Inkrementierbetriebsart
Wird die Software–Rücksetzung verwendet, kann IR 00006 als gewöhnlicher
Eingang verwendet werden.
Hinweis 1. Wird der Eingangsmodus auf Inkrementalmodus eingestellt, kann IR
00005 als gewöhnlicher Eingang verwendet werden.
2. Wird die Software–Rücksetzung verwendet, kann IR 00006 als
gewöhnlicher Eingang verwendet werden.
Das folgende Diagramm zeigt ein Verdrahtungsbeispiel mit einem
E6B2-CWZ6C–NPN–Offenen Kollektor–Ausgang.
CPU–Baugruppe
Encoder
(Spannung: 12 V)
Schwarz
Weiß
Orange
Braun
Blau
Phase A
Phase B
Z–Phase
+Vcc
0 V (COM)
Differential–Phasenmodus
IN4 (Encoderphase A)
IN5 (Encoderphase B)
IN6 (Encoderphase Z)
COM
36
12 V DC–Netzteil

1-4AbschnittInterrupt–Funktionen
SPS–Konfiguration Nehmen Sie bei Verwendung der Schnelle Zähler–Interrupts die folgen-
den Einstellungen in der SPS–Konfiguration in der
PROGRAM–Betriebsart vor, bevor Sie das Programm ausführen.
Eingangs–Auffrischungswort–Einstellungen (DM 6638)
Führen Sie diese Einstellungen aus, wenn Eingänge aufgefrischt werden
müssen. Die Einstellung entspricht dem von Intervall–Zeitgeber 2.
Bit
15 0
DM 6638
Anzahl der Worte (BCD, 2–stellig) 00 bis 16
Anfangswort (BCD, 2–stellig) 00 bis 15
Vorgabe: Keine Eingangsauffrischung
Schneller Zähler 0–Einstellungen (DM 6642)
Der Schnelle Zähler 0 kann in dem Programm nicht verwendet werden, falls
diese Einstellungen nicht durchgeführt werden.
(IR 000 bis IR 015)
Bit
15 0
DM 6642
01
Schneller Zähler 0 verwenden.
Rücksetz-Verfahren
0: Z–Phase und Software–Rücksetzung;
1: Software–Rücksetzung
Eingangsmodus
0: Differential–Phasenmodus
4: Inkrementier–Betriebsart
Vorgabe: Schneller Zähler 0 nicht verwendet.
Änderungen der Einstellungen in DM 6642 werden nur nach dem Aus– und
Wiedereinschalten der Versorgungsspannung oder nach dem Start des
SPS–Programms wirksam.
Programmierung Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen Schnellen Zähler 0 zu pro-
grammieren.
Der Zählbetrieb des Schnellen Zählers 0 beginnt nach der richtigen
Einstellung in der SPS–Konfiguration. Vergleiche mit Hilfe der
Vergleichstabelle und die Generierung von Interrupts erfolgen erst nach
Ausführung des CTBL(63)-Befehls.
Der Schnelle Zähler 0 wird beim Einschalten der SPS und zu Beginn des
Betriebs auf ”0” zurückgesetzt.
Der Istwert des Schnellen Zählers wird in SR 230 und SR 231 gespeichert.
Steuerung der Schnellen Zähler-Interrupts
1, 2, 3...
1. Verwenden Sie den CTBL(63)-Befehl, um die Vergleichstabelle in der
CQM1H zu speichern und um Vergleiche zu starten.
(@)CTBL(63)
C: (BCD, 3-stellig)
000
000: Die Zielwertetabelle wird erstellt und der
C
TB
001: Die Bereichstabelle wird erstellt und der
002: Nur die Zielwertetabelle wird erstellt
003: Nur die Bereichstabelle wird erstellt
TB: Anfangswort der Vergleichstabelle
Vergleich gestartet.
Vergleich gestartet.
Wird C auf 000 gesetzt, erfolgen Vergleiche durch
Zielübereinstimmungs-Verfahren. Wird C auf 001 gesetzt, werden
37

Bereiche miteinander verglichen. Die Vergleichstabelle wird gespeichert
und die Vergleiche werden anschließend vorgenommen. Während der
Vergleiche werden schnelle Interrupts, entsprechend der
Vergleichstabelle, ausgeführt. Sehen Sie die Beschreibung des
CTBL(63)–Befehls in
Kapitel 5 Befehlssatz
für weitere Informationen
über den Inhalt der gespeicherten Vergleichstabellen
Hinweis Die Vergleichsergebnisse werden während der
Bereichsvergleichs–Ausführung normalerweise in AR 1100 bis
AR 1107 gespeichert.
Wird C auf 002 gesetzt, erfolgen Vergleiche durch
Zielwertübereinstimmungs-Verfahren. Wird C auf 003 gesetzt, werden
Bereiche miteinander verglichen. In beiden Fällen wird die
Vergleichstabelle gespeichert, Vergleiche werden jedoch nicht
ausgeführt. Hierzu müssen Sie den INI(61)-Befehl verwenden.
2. Um Vergleiche zu beenden, führen Sie den INI(--)-Befehl aus, wie
nachfolgend dargestellt.
(@)INI(61)
000
001
000
1-4AbschnittInterrupt–Funktionen
1, 2, 3...
Äußerste linke
4 Ziffern
SR 231 SR 230
Äußerste rechte
4 Ziffern
Um Vergleiche erneut auszuführen, stellen Sie den zweiten Operanden
auf ”000” ein (Ausführung der Vergleichstabelle) und führen Sie den
INI(61)-Befehl aus.
Eine gespeicherte Tabelle bleibt während des Betriebs (d.h. während der
Programmausführung) in der CQM1H bis zur Speicherung einer anderen
Tabelle erhalten.
Istwerte lesen
Zum Istwert lesen stehen zwei Möglichkeiten zur Verfügung. Als Erstes
werden Istwerte von SR 230 und SR 231 gelesen und als zweites der
PRV(62)-Befehl angewendet.
1. Lesen von SR 230 und SR 231
Der Istwert des Schnellen Zählers 0 wird, wie nachfolgend dargestellt, in
SR 230 und SR 231 gespeichert. Bei negativen Werten ist die äußerst
linke Stelle auf F gesetzt.
Differential–Phasenmodus Inkrementierbetriebsart
F0032768 bis 00032767
(–32,768)
00000000 bis 00065535
Hinweis Diese Worte werden nur einmal pro Programmzyklus
aufgefrischt. Daher besteht möglicherweise ein Unterschied zu
dem tatsächlichen Istwert.
Wird der Schnelle Zähler 0 nicht verwendet, können die Bits in diesen
Worten als Arbeitsmerker eingesetzt werden.
2. Verwendung des PRV(62)-Befehls
Der PRV(62)-Befehl dient zum Lesen des Istwertes des Schnellen
Zählers 0.
38
(@)PRV(62)
000
000
P1: Erste Wortadresse des Istwertes
P1
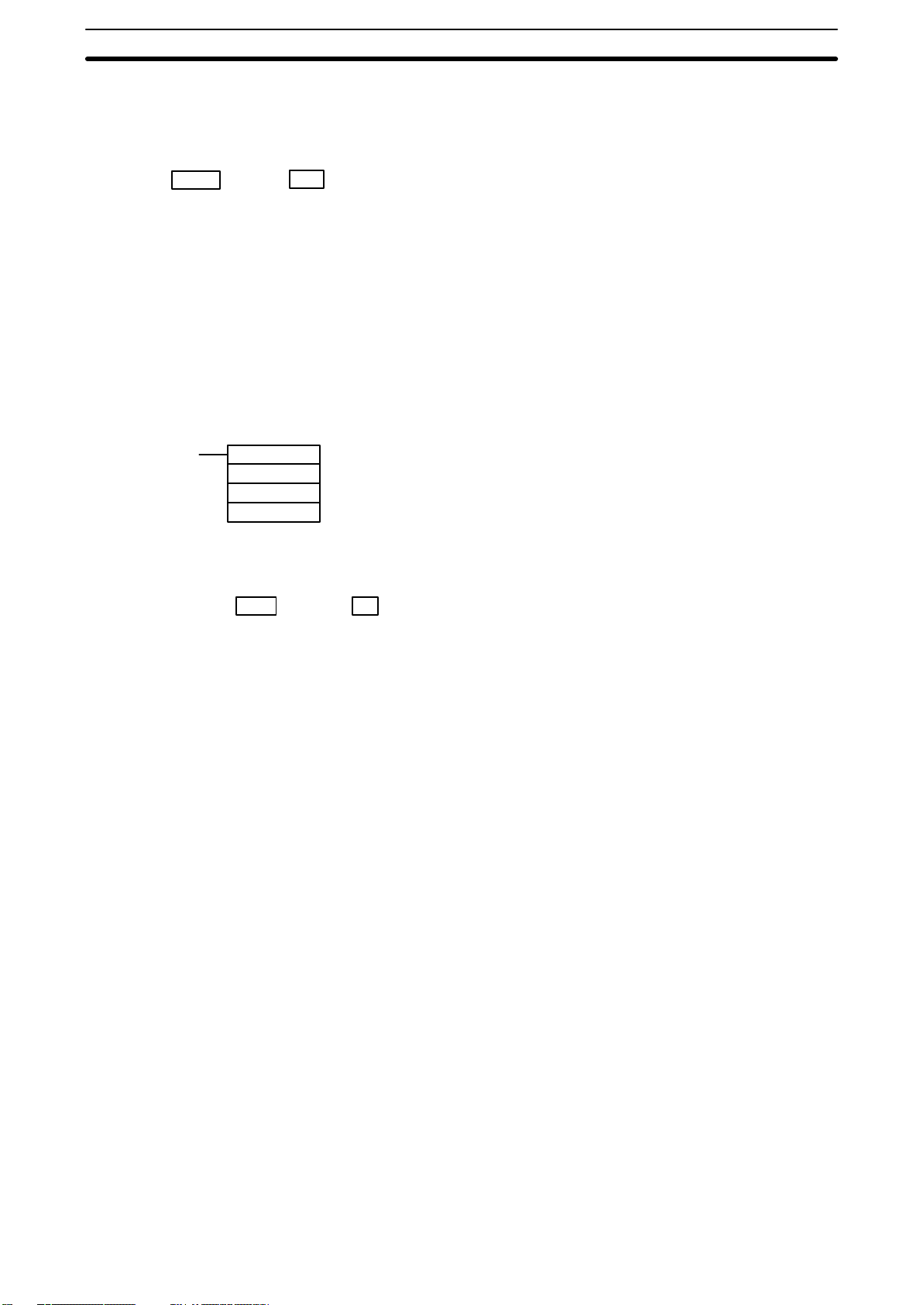
Der Istwert des Schnellen Zählers 0 wird folgendermaßen gespeichert.
Bei negativen Werten ist die äußerst linke Stelle auf F gesetzt.
1-4AbschnittInterrupt–Funktionen
Äußerste linke
4 Ziffern
P1+1
(@)INI(61)
Äußerste linke
4 Ziffern
Z+1 Z
Äußerste rechte
4 Ziffern
P1
Differential–PhasenmodusInkrementierbetriebsart
F0032768 bis 00032767
(–32,768)
00000000 bis 00065535
Der Istwert wird bei der Ausführung des PRV(62)-Befehls gelesen.
Änderung des Istwertes
Der Istwert des Schnellen Zählers 0 kann auf zwei Arten geändert werden.
Die erste Möglichkeit besteht in der Rücksetzung mit Hilfe SR25200. (In
diesem Fall wird der Istwert auf 0 zurückgesetzt). Die Verwendung des
INI(61)-Befehls stellt die zweite Möglichkeit dar.
Die Verwendung des INI(61)-Befehls wird nachfolgend erläutert. Eine
Beschreibung des Rücksetzverfahrens finden Sie am Anfang der
Beschreibung des Schnellen Zählers 0.
Ändern Sie den Zeitgeber-Istwert, wie nachfolgend gezeigt, mit dem
INI(61)-Befehl.
D: Erste Wortadresse zur Speicherung von
Istwert–Änderungsdaten
000
002
D
Äußerste rechte
4 Ziffern
Differential–Phasenmodus Inkrementierbetriebsart
F0032768 bis 00032767 00000000 bis 00065535
Zur Spezifikation einer negativen Zahl setzen Sie die äußerst linke Stelle auf
F.
Betriebsbeispiel Dieses Beispiel zeigt ein Programm zur Verwendung des Schnellen Zählers
0 im Inkrementalmodus, wobei die Vergleiche nach dem Zielwert–Vergleichsverfahren durchgeführt werden; die Frequenz der Ausgabeimpulse wird entsprechend dem Istwert des Zählers geändert. Stellen Sie vor Ausführung des
Programms die SPS–Konfiguration folgendermaßen ein.
DM 6642: 0114 (Schneller Zähler 0, verwendet mit Software–Rücksetzung
und im Inkrementalmodus). Für alle anderen Einstellungen der
SPS–Konfiguration werden Vorgabewerte verwendet. (Eingänge werden
nicht zum Zeitpunkt der Interrupt–Verarbeitung aufgefrischt und
Impulsausgaben werden für IR 100 ausgeführt.)
39

Zusätzlich werden die folgenden Parameter für die Vergleichstabelle
gespeichert:
DM 0000: 0002 — Anzahl der Vergleichsbedingungen: 2
DM 0001: 1000 — Zielwert 1: 1000
DM 0002: 0000
DM 0003: 0101 — Vergleich 1–Interrupt–Unterprogramm: 101
DM 0004: 2000 — Zielwert 1: 2000
DM 0005: 0000
DM 0006: 0102 — Vergleich 2–Interrupt–Unterprogramm: 102
1-4AbschnittInterrupt–Funktionen
25315 (EIN für einen Zyklus)
25313 (Immer EIN)
25313 (Immer EIN)
CTBL(63)
000
000
DM 0000
SPED(64)
020
001
#0050
SBN (92) 101
SPED(64)
020
001
#0020
RET (93)
SBN (92) 102
SPED(64)
020
001
#0000
RET (93)
Speichert die Vergleichstabelle in dem Format der Zeile und beginnt den Vergleich.
Beginnt die fortlaufende Impulsausgabe an IR10002 mit 500 Hz.
Erreicht der Schnelle Zähler den Wert 1000, wird Unterprogramm 101 aufgerufen
und die Frequenz der Impulsausgabe wird auf 200 Hz geändert.
Erreicht der Schneller Zähler den Wert 2000, wird Unterprogramm 102 aufgerufen
und die Frequenz der Impulsausgabe wird auf 0 Hz geändert.
In Folgenden ist die Programmausführung grafisch dargestellt:
Impulsfrequenz
500
200
0
1-4-6 Schneller Zähler 0–Über–/Unterlauf
Wird der zulässige Zählbereich für den Schnellen Zähler 0 überschritten und
tritt ein Unter– oder Überlauf auf, so verbleibt der Istwert des Zählers auf
0FFF FFFF bei einem Überlauf und auf FFFF FFFF bei einem Unterlauf, bis
der Überlauf/Unterlauf–Status durch Zurücksetzen des Zählers gelöscht
wird. Die zulässigen Zählbereiche sind wie folgt:
Differential–Phasenmodus F003 2768 bis 0003 2767
Inkrementalmodus: 00000000 bis 00065535
Hinweis 1. Die zuvor aufgeführten Werte sind theoretische Werte und setzen eine
verhältnismäßig kurze Zykluszeit voraus. Die Werte entsprechen tatsäch-
Verstrichene Zeit
(s)
40

lich jedoch denen, die in einem Zyklus vor dem Überlauf/Unterlauf vorhanden waren.
2. Die sechste und siebente Stelle des Istwerts des Schnellen Zählers 0
sind normalerweise 00; diese können jedoch als
“Überlauf/Unterlauf–Merker” verwendet werden, indem Werte ober– oder
unterhalb der zulässigen Werte erfasst werden.
Der Schnelle Zähler 0 kann wie in dem vorhergehenden Abschnitt
beschrieben zurückgesetzt werden oder automatisch durch einen Neustart
der Programmausführung. Der Schnelle Zähler 0 und entsprechende
Funktionen werden nicht normal arbeiten, bis der Über–/Unterlaufzustand
behoben ist. Folgende Betriebsabläufe treten bei einem Überlauf/Unterlauf
auf.
• Es werden keine Vergleichstabellenoperationen mehr durchgeführt.
• Die Vergleichstabelle wird nicht gelöscht.
• Es werden keine Interrupt–Routinen für den Schnellen Zähler ausgeführt.
• CTBL(63) kann nur verwendet werden, um die Vergleichstabelle zu
speichern. Wird versucht, einen Vergleichstabellenvorgang zu starten, so
wird der Vorgang nicht ausgeführt und die Vergleichstabelle wird nicht
gespeichert.
• INI(61) kann nicht zum Starten und Stoppen des
Vergleichstabellenvorgangs oder zur Änderung des Istwertes verwendet
werden.
• PRV(62) liest nur 0FFF FFFF oder FFFF FFFF als Istwert.
1-4AbschnittInterrupt–Funktionen
Wiederherstellung Verwenden Sie das folgende Verfahren, um einen Überlauf/Unterlaufzustand
zu beheben.
Mit einer gespeicherten Vergleichstabelle
1, 2, 3...
1, 2, 3...
Hinweis Die Bereichs–Vergleichsergebnisse verbleiben auch nach einer Wiederher-
Rücksetz–Funktion Wird der Schnelle Zähler 0 zurückgesetzt, wird der Istwert auf 0 gesetzt und
1. Setzen Sie den Zähler zurück
2. Stellen Sie, falls erforderlich, den Istwert mit PRV(62) ein.
3. Spezifizieren Sie, falls erforderlich, die Vergleichstabelle mit CTBL(63)
4. Starten Sie den Vergleichstabellenvorgang mit INI(61).
Ohne eine gespeicherte Vergleichstabelle
1. Setzen Sie den Zähler zurück
2. Stellen Sie, falls erforderlich, den Istwert mit PRV(62) ein.
3. Spezifizieren Sie die Vergleichstabelle und beginnen Sie den Vorgang
mit CTBL(63) und INI(61).
stellung in AR 11. Tritt unmittelbar nach einer Behebung ein Interrupt–Zustand auf, wird das aufgerufene Interrupt–Unterprogramm nicht ausgeführt,
falls der Interrupt–Zustand bereits anlag, bevor der Überlauf/Unterlaufzustand auftrat. Löschen Sie AR 11 vor der Weiterverarbeitung, falls die Ausführung eines Interrupt–Unterprogramms erforderlich ist.
das Zählen beginnt bei 0; Vergleichstabelle, Ausführungsstatus und die
Ausführungsergebnisse werden beibehalten.
Zählerstatus beim
Einschalten
Zählerstatus beim
Anhalten
Wird der Schnelle Zähler 0 gestartet, wird der Zählmodus in der SPS–Konfiguration gelesen und verwendet; der Istwert wird auf 0 gesetzt, der Überlauf/Unterlaufzustand wird gelöscht, die Vergleichstabelle gespeichert und Ausführungsstatus sowie Bereichs–Ausführungsergebnisse werden ebenfalls gelöscht. (Bereichs–Ausführungsergebnisse werden immer gelöscht, wenn der
Vorgang gestartet wird oder wenn die Vergleichstabelle gespeichert wird.)
Wird der Schnelle Zähler 0 gestoppt, wird der Istwert beibehalten, die Vergleichstabellenspeicherung und der Ausführungsstatus gelöscht sowie die Bereichs–Ausführungsergebnisse beibehalten.
41

1-5 Impulsausgabefunktion
Dieser Abschnitt beschreibt die Einstellungen und Verfahren für die
Anwendung der CQM1H–Impulsausgabefunktion. Sehen Sie das
Handbuch der CQM1H
Hardware–Anschlüsse an Ausgänge und Schnittstellen.
Normale Impulse können mit SPED(64) über eine
Transistor–Ausgangsbaugruppe ausgegeben werden. Impulse können
jeweils nur über ein Bit ausgegeben werden. Das Tastverhältnis der
Impulsausgabe beträgt 50% und die Frequenz kann von 20 Hz bis 1 kHz
eingestellt werden.
für weitere Informationen über die
Transistor–Ausgangsbaugruppe
t
on
T
1-5AbschnittImpulsausgabefunktion
Technische
+ 50% (0.5)
Angabe
Anwendbare
Baugruppe
Impulsausgang Impulsausgabe über spezifiziertes Bit
Merkmale Frequenz: 20 Hz bis 1 kHz
Anwendbare
Befehle
Transistor–Ausgangsbaugruppe
Ein beliebiges Ausgangswort von IR 100 bis IR 115 kann spezifiziert
werden, aber Impulse können jeweils nur über ein Bit eines Wortes
ausgegeben werden.
Tastverhältnis: 50%
Wortspezifikation: SPS–Konfiguration (DM 6615)
Bitspezifikation: Im Kontaktplanbefehl
Impulsanzahl einstellen: PULS(65)
Impulsausgabe starten: SPED(64)
Frequenz ändern: SPED(64)
Impulsausgabe anhalten: SPED(64) or INI(61)
Transistor–Ausgangsbaugruppe
Technische Daten
Motortreiber
24 V DC
42
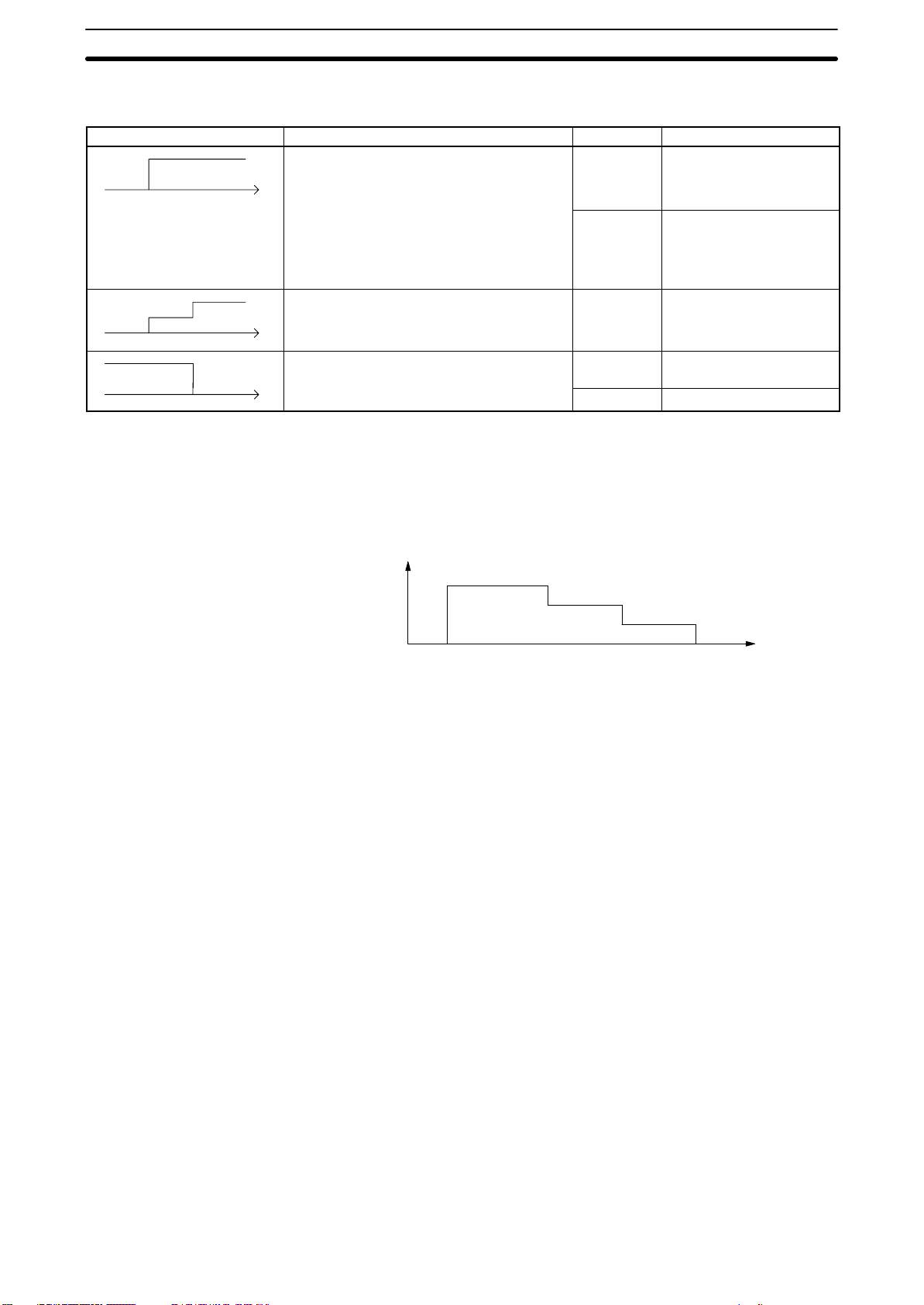
1-5AbschnittImpulsausgabefunktion
(Fortlaufender Modus) oder bis die s ezifische
(Führen Sie SPED(64) oder INI(61) aus.)
Impulsausgangs–
Funktionen
Die folgende Tabelle zeigt die Impulsausgabefunktionen, die in Kombination mit
PULS(65), SPED(64), und INI(61) ausgeführt werden können.
Frequenzänderung Befehl Operandeneinstellungen
Impulsausgabe bei spezifizierter Frequenz
starten.
Ausgabe erfolgt ohne Unterbrechung
(Fortlaufender Modus) oder bis die spezifische
Anzahl der Impulse ausgegeben wurde
(einmaliger Modus.)
(Führen Sie Befehle PULS(65) und anschließend
Befehle SPED(64) aus, wenn Sie den einmaligen
Modus verwenden.)
Ändern Sie die Frequenz (stufenweise) der
ausgehenden Impulse.
Stoppen Sie die Impulsausgabe mit einem Befehl.
(Führen Sie SPED(64) oder INI(61) aus.)
PULS (65) Anzahl der Impulse
(nur Einmalig–Modus)
SPED (64) Schnittstelle
Modus
Frequenz
SPED (64) Schnittstelle
Modus
Frequenz
SPED(64) Schnittstellte
Frequenz= 0
INI(61) Steueroperand=003
Hinweis Für diese Anwendung muss eine Transistor–Ausgangsbaugruppe verwendet
zwerden.
Wenn Impulse über einen Ausgang ausgegeben werden, kann die Frequenz mit
dem Befehl SPED(64) stufenweise mit verschiedenen Frequenzen mit dem Be fehl SPED(64) wieder geändert werden, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Vorgangsbeschreibung
1, 2, 3...
Frequenz
Zeit
Impulse können von einem Ausgang in dem Fortlaufenden–Modus oder Einmalig–Modus ausgegeben werden.
Fortlaufender Modus
Impulse werden kontinuierlich ausgegeben, bis der Vorgang mit dem Befehl
SPED(64) oder INI(61) gestoppt wird.
Einmaliger Modus
Die Impulsausgabe stoppt automatisch, sobald die Anzahl der Impulse, die in
SPED(64) spezifiziert wurde, erreicht ist. Die Impulsausgabe kann vorzeitig
mit SPED(64) oder INI(61) gestoppt werden.)
Gehen Sie entsprechend den nachfolgend aufgeführten Schritten vor, um Impulse von einer Transistor–Ausgangsbaugruppe auszugeben. Impulse können
nur von einem Ausgang der Transistor–Ausgangsbaugruppe gleichzeitig ausgegeben werden.
1. Legen Sie das IR–Wort (IR 100 bis IR 115) fest, das für die Impulsausgabe verwendet werden soll.
2. Verdrahten Sie die Transistor–Ausgangsbaugruppe. Verdrahten Sie die
Klemmen entsprechend dem Bit, das in dem ausgewählten Wort verwendet
werden soll.
3. Stellen Sie die gewünschte IR–Wortadresse in DM 6615 der SPS–Einstellung ein. Einstellungen 0000 bis 0015 BCD entsprechen IR 100 bis IR 115.
4. Programmieren Sie die zugehörigen Programmabschnitte.
a) PULS(65) kann verwendet werden, um die Anzahl der Ausgabeimpulse
einzustellen.
b) SPED(64) kann verwendet werden, um die Impulsausgabe zu steuern
(eine Impulsausgabe ohne Beschleunigung oder Abbremsung.)
43
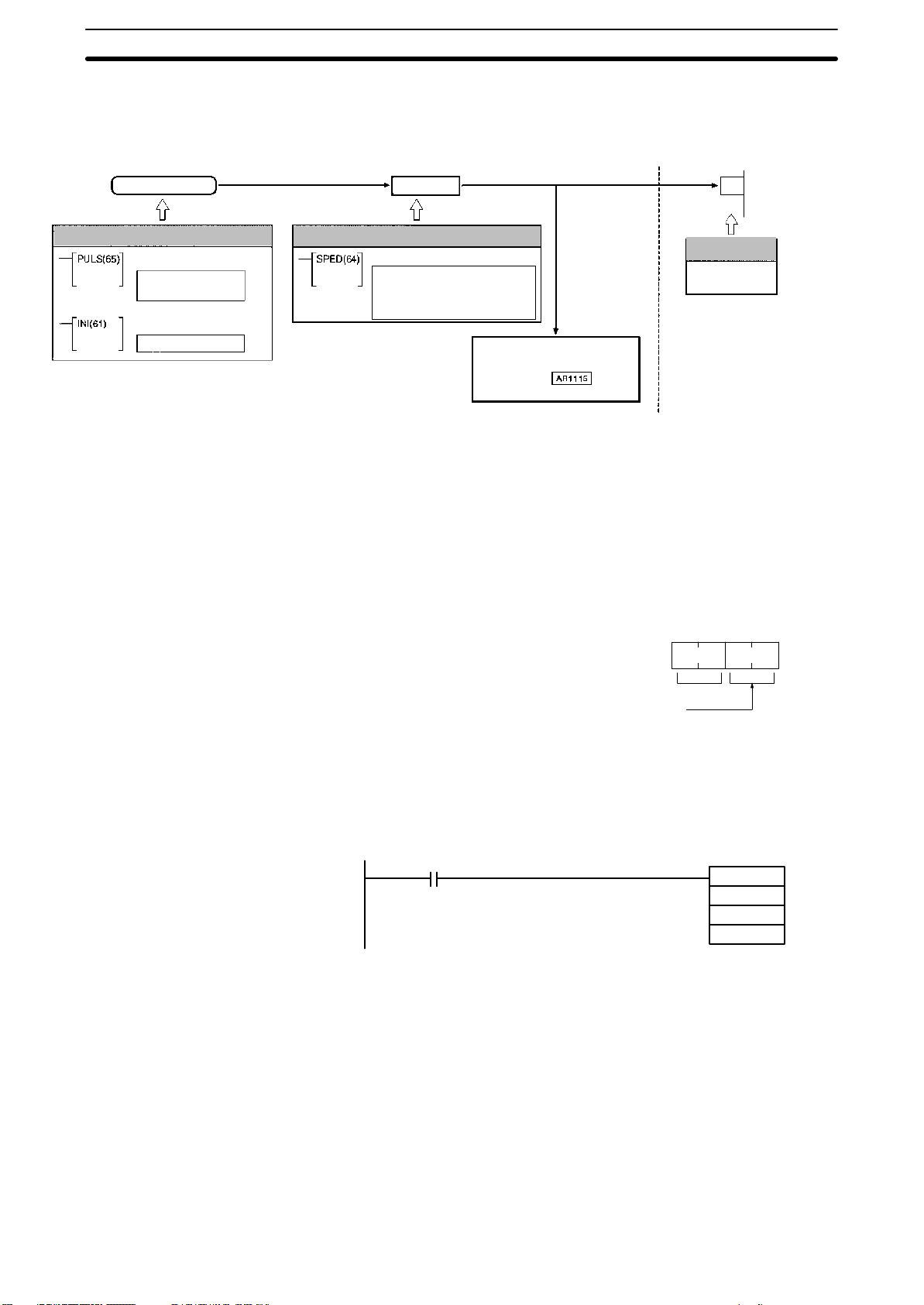
1-5AbschnittImpulsausgabefunktion
c) INI(61) kann verwendet werden, um die Impulsausgabe zu stoppen.
Impulsanzahl Frequenz
Kontaktplanprogramm
IMPULSE EINSTELLEN
Anzahl der Ausgangsimpulse einstellen
(8-stellige BCD.)
BETRIEBSARTENSTEUERUNG
Stoppen Impulsausgabe.
SPS–Konfigurations–
einstellungen
Vor Ausführung von SPED(64) in Ausgabeimpulse einer Ausgangsbaugruppe, stellen Sie die SPS auf den PROGRAM–Modus und nehmen Sie die
folgenden Einstellungen in den SPS–Konfigurationen vor.
Spezifizieren Sie in DM 6615 das Ausgangswort, das für die SPED(64) Impulsausgabe der Ausgangsbaugruppen verwendet werden soll. (Das Bit wird in dem
ersten Operanden in SPED(64) spezifiziert.)
Der Inhalt von DM 6615 (0000 bis 0015) spezifiziert die Ausgangsworte IR 100
bis IR 115. Beispiel: Wenn DM 6615 auf 0002 gestellt ist, werden die Impulse in
IR 102 ausgegeben.
Kontaktplanprogramm
GESCHWINDIGKEITSAUSGABE
Den Ausgabemodus einstellen (fortlaufend oder einmalig).
Die Impulsfrequenz einstellen (20
Hz bis 1 kHz.)
Die Impulsausgabe starten.
Impulsausgabe–Zustand
(von einer Ausgangsbaugruppe mit einem zugeordneten
Transistor–Impulsausgabe
Wort zwischen IR 100 und IR 115)
Impulsausgabe
SPS–Konfi–
guration
DM 6615 Bits
00 bis 07
Jeder Zyklus
Fortlaufende
Impulsausgabe
Einstellung der Anzahl
der Impulse
Bit
15 0
DM 6615
Ausgangswort (beiden rechten Stellen, BCD): 00 bis 15
Vorgabe: Impulsausgabe in IR 100.
00
Immer 00
Impulse werden an dem spezifizierten Ausgangsbits ausgegeben, wenn
SPED(64) ausgeführt wird. Stellen Sie das Ausgangsbit zwischen 00 bis
15 (D=000 bis 150) ein und die Frequenz von 20 Hz bis 1000 Hz (F=0002
bis 0100). Stellen Sie den Fortlaufenden Modus (M=001) ein.
Ausführungsbedingung
@SPED(64)
Z
M
F
Die Impulsausgabe kann gestoppt werden, indem INI(61) mit C=003 ausgeführt wird oder SPED(64) mit einer Frequenz von 0 ausgeführt wird. Die Frequenz kann geändert werden, indem SPED(64) nochmals mit einer anderen
Frequenzeinstellung ausgeführt wird.
Die gesamte Anzahl der Impulse, die ausgegeben werden, kann mit
PULS(65) eingestellt werden, bevor SPED(64) im Einmalig–Modus ausge-
44
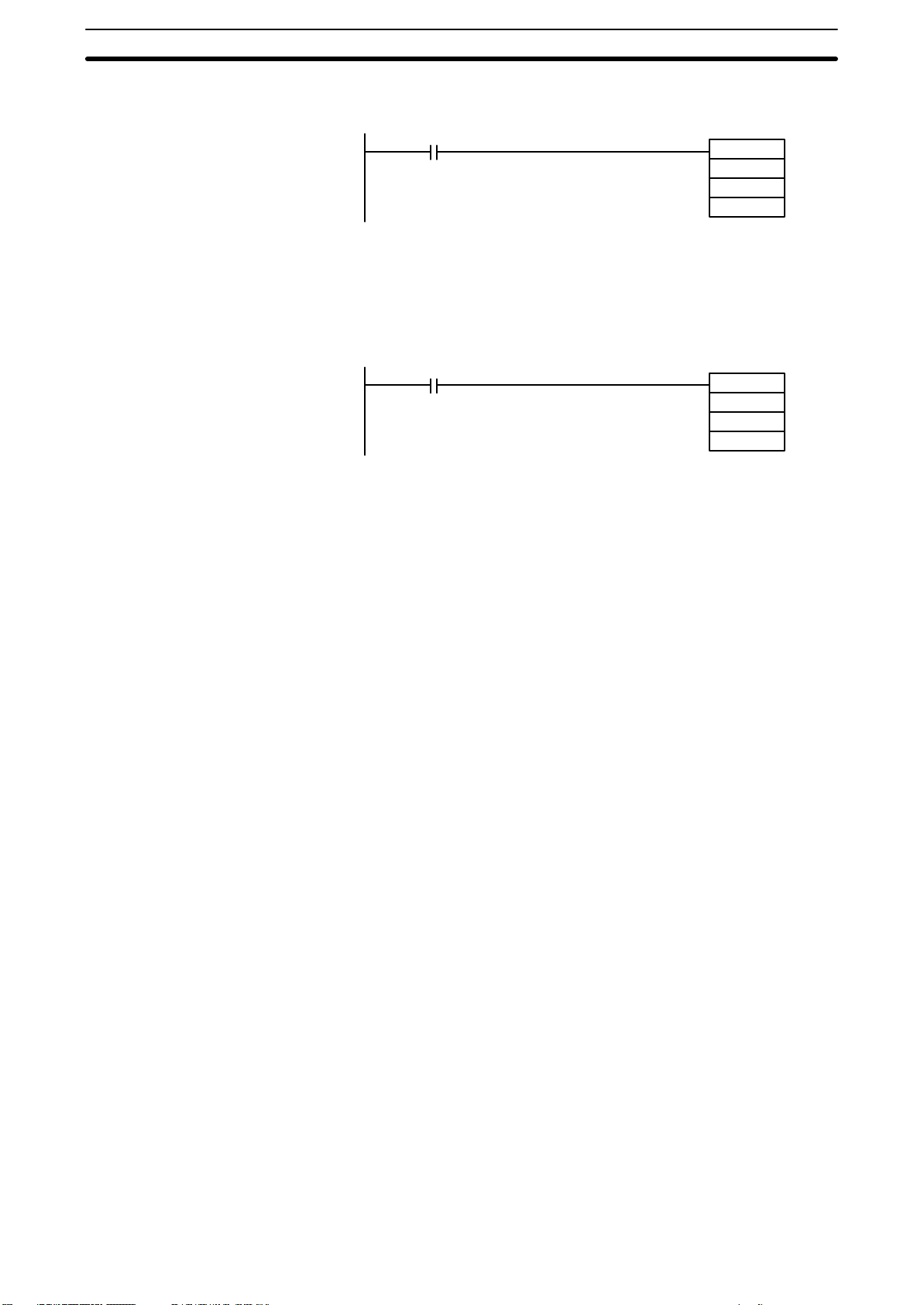
führt wird. Die Impulsausgabe wird automatisch gestoppt, wenn die Anzahl
der Impulse mit PULS(65) spezifiziert ausgegeben wurde.
1-6AbschnittKommunikationsfunktionen
Ausführungsbedingung
@PULS(65)
000
000
P1
PULS(65) stellt die 8-stellige Anzahl der Impulse P1+1, P1 ein. Diese Impulse können zwischen 00000001 und 16777215 eingestellt werden. Auf die
Anzahl der Impulse, die mit PULS(65) eingestellt wird, kann zugegriffen werden, wenn SPED(64) im Einmalig–Modus ausgeführt wird. (Die Anzahl der
Impulse kann nicht für Impulse geändert werden, die gerade ausgegeben
werden.)
Ausführungsbedingung
@SPED(64)
Z
M
F
Wenn SPED(64) ausgeführt wird, werden die Impulse an dem spezifizierten
Ausgangsbit (D=000 bis 150: Bit 00 bis 15) bei der spezifizierten Frequenz
(F=0002 bis 0100: 20 Hz bis 1000 Hz) ausgegeben. Stellen Sie den Einmalig–Modus (M=000) ein, um die Anzahl der Impulse, die mit PULS(65) eingestellt wurden, auszugeben. Die Frequenz kann geändert werden, indem
SPED(64) nochmals mit einer anderen Frequenzeinstellung ausgeführt wird.
Änderung der Frequenz Die Frequenz kann geändert werden, indem SPED(64) nochmals mit einer
anderen Frequenzeinstellung ausgeführt wird. Verwenden Sie die gleichen
Einstellungen für Ausgangsbits (P) und den Modus (M), die beim Starten der
Impulsausgabe verwendet wurden. Die neue Frequenz kann zwischen 20 Hz
und 1000 Hz (F=0002 bis 0100) liegen.
1-6 Kommunikationsfunktionen
Die folgende Tabelle zeigt, welche Kommunikationmodi von den Kommunikationsschnittstellen der CQM1H CPU–Baugruppe unterstützt werden. (Die
CQM1H-CPU11 CPU–Baugruppe besitzt keine RS-232C–Schnittstelle.)
Die SPS–Konfigurationseinstellungen und Kommunikationsverfahren für
diese Kommunikationsmodi werden später in diesem Abschnitt beschrieben.
45
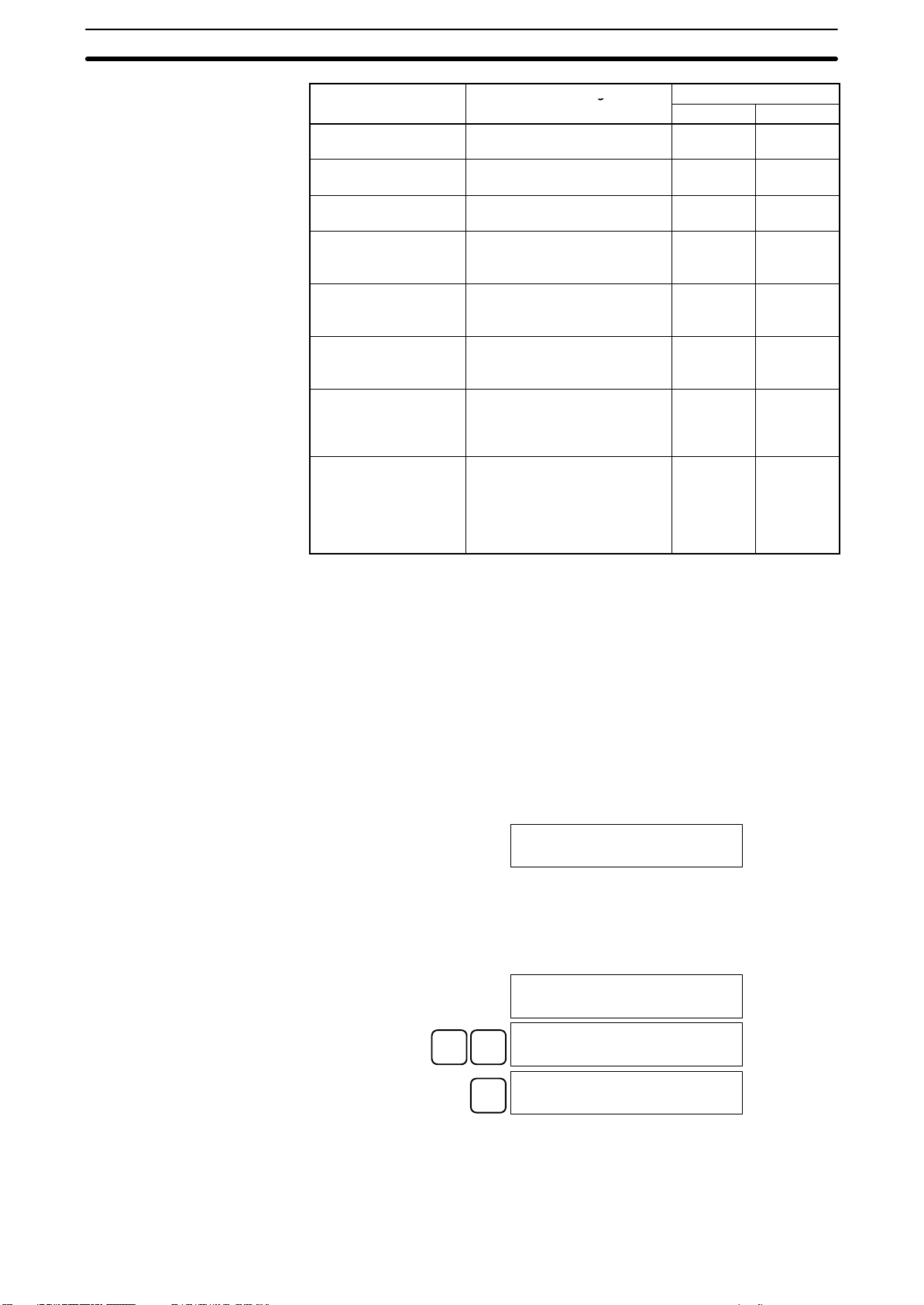
1-6AbschnittKommunikationsfunktionen
ouao
e e du g
Kommunikation Verwendung
Programmier–
konsolenbus
Toolbus Anschluss an einen Computer
Host-Link Host–Link oder programmier-
Protokoll–Makro Datenübertragung mit externen
Ohne Protokoll Ohne–Protokoll–Kommunika-
1:1 Data–Link Einrichtung eines Data–Links
NT–Link im 1:1–Modus Einrichtung eines 1:1–Data–
NT–Link im
1:N–Modus
Programmierkonsolenanschluss
mit Dienstprogrammen
barer Terminal
Standardgeräten mit Hilfe eines beliebigen Protokolls
tion mit externen Standardgeräten
mit einer anderen CPU–Baugruppe
Links mit einem programmierbaren Terminal
Einrichtung eines 1:1–Data–
Link mit einem programmier–
baren Terminal oder einer 1:N–
Verbindung mit zwei oder mehreren programmierbaren Terminals
Schnittstelle
Peripherie RS-232C
Ja Keine
Ja Keine
Ja Ja
Keine Keine
Ja Ja
Keine Ja
Keine JA
(Sehen Sie
den Hinweis.)
Keine Keine
Automatische
Modusänderung
Hinweis 1. Die Programmierkonsolenfunktionen des programmierbaren Terminals NT
können verwendet werden, wenn Schalter 7 des DIP–Schalters eingeschaltet ist.
2. Schalten Sie Schalter 7 des DIP–Schalters der CPU–Baugruppe ein, wenn
Sie eine Peripherieschnittstelle für ein Gerät außer der Programmierkonsole verwenden.
Wenn sich die SPS im RUN–Modus befindet und eine Programmierkonsole
an die Peripherieschnittstelle der CPU–Baugruppe angeschlossen ist, während Bediengeräte an die eingebaute RS-232C–Schnittstelle der CPU– Baugruppe angeschlossen sind, oder eine der Schnittstellen der CQM1H-SCB41
den Host Link–Modus verwendet, erscheint die folgende Meldung auf der
Programmierkonsole, um darauf hinzuweisen, dass für weitere Funktionen
ein Paßwort erforderlich ist (bei Verwendung der Programmierkonsole).
<MONITOR>
PASSWORD!
Dies liegt daran, dass die Bediengeräte den Betriebsmodus vom RUN–Modus
in den Monitor–Modus ändern, um Daten in die CPU–Baugruppe zu schreiben.
Um den Betrieb mit der Programmierkonsole fortzusetzen, muss das Paßwort
erneut eingegeben werden.
Eingabe des Paßwortes
<MONITOR>
PASSWORD!
46
CLR MONTR
<MONITOR> BZ
00000
CLR
• Der Modus wird nicht geändert, wenn Bediengeräte über ein NT–Link angeschlossen sind.
• Wenn ein Computer mit installierter Programmiersoftware an die Peripherieschnittstelle angeschlossen ist, wechselt die Anzeige (am Computer) für den
Betriebsmodus der CPU–Baugruppe von ”RUN” auf “MONITOR.”

1-6-1 Host–Link und Ohne–Protokoll–Kommunikationseinstellungen
Dieser Abschnitt beschreibt die SPS–Konfigurationseinstellungen, die von dem
Host–Link und den Ohne–Protokoll–Kommunikationmodi verwendet werden.
Führen Sie die erforderlichen SPS–Konfigurationseinstellungen durch, bevor
Sie versuchen den Host–Link oder die Ohne–Protokoll–Kommunikation einzu–
richten.
Hinweis Wenn Stift 5 des DIP–Schalters der CQM1H auf EIN gestellt wird, werden die
SPS–Konfigurations–Kommunikationsparameter ignoriert und die folgenden
Einstellungen werden verwendet.
1-6AbschnittKommunikationsfunktionen
Kommunikations–
einstellungen
(DM 6645 und DM 6650)
Parameter Einstellung wenn Stift 5 des DIP–Schalters auf EIN gesetzt
KommunikationsBetriebsart
Teilnehmernummer 00
Startbits 1 Bit
Datenlänge 7 Bits
Stoppbits 2 Bits
Parität Gerade
Baudrate 9.600 b/sec.
Übertragungsverzöge-
rung
Host-Link
Kein
ist.
Die SPS–Konfigurationsparameter in DM 6645 bis DM 6654 werden verwendet,
um die Parameter für die Kommunikationsschnittstellen einzustellen.
Die Einstellungen in DM 6645 und DM 6650 legen die wichtigsten Kommunikationsparameter fest, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Bit
15 0
DM 6645: RS-232C–Schnittstelle
DM 6650: Peripherieschnittstelle
Kommunikationsmodus
0: Host-Link
1: Ohne Protokoll
2: 1:1–Data–Link–Slave*
3: 1:1–Data–Link–Master*
4: NT–Link im 1:1–Modus*
Link–Worte für 1:1–Data–Link*
0: LR 00 bis LR 63
1: LR 00 bis LR 31
2: LR 00...LR 15
CTS–Steuerungseinstellungen
0: Deaktiviert
Schnittstelleneinstellungen
0: Standard–Kommunikationsbedingungen
1: Entsprechend den Einstellungen in DM 6646, DM 6651
1: Aktiviert
Kommunikations–
einstellungen
(DM 6646 und DM 6651)
Vorgabe (0000): Host–Link mit Verwendung der Standardparameter, keine CTS–Steuerung
Hinweis *Diese Einstellungen können für die RS-232C–Schnittstelle (DM 6645)
verwendet werden, jedoch nicht für die Peripherieschnittstelle (DM 6650).
Wenn Stift 5 des DIP–Schalters der CPU–Baugruppe auf AUS geschaltet ist
und die Einstellungen in DM 6646 (oder DM 6651) und DM 6645 (oder DM 6650)
47

1-6AbschnittKommunikationsfunktionen
gesendet hat, werden die nächsten Daten erst dann
aktiviert sind, legen diese Einstellungen das Übertragungs–Rahmenformat und
die Baudrate fest, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.
Bit
DM 6646:RS-232C–Schnittstelle
DM 6651:Peripherieschnittstelle
Übertragungs–Rahmenformat (Siehe Tabelle unten.)
Baudrate (Siehe Tabelle unten.)
Vorgabe: Standard–Kommunikationsbedingungen
Übertragungs–Rahmenformat
Einstellung Stoppbits Datenlänge Stoppbits Parität
00 1 7 1 Gerade
01 1 7 1 Ungerade
02 1 7 1 Kein
03 1 7 2 Gerade
04 1 7 2 Ungerade
05 1 7 2 Kein
06 1 8 1 Gerade
07 1 8 1 Ungerade
08 1 8 1 Kein
09 1 8 2 Gerade
10 1 8 2 Ungerade
11 1 8 2 Kein
15 0
Übertragungs–
verzögerungszeit
(DM 6647 und DM 6652)
Baudrate
Einstellung Baudrate
00 1.200 b/sec.
01 2.400 b/sec.
02 4.800 b/sec.
03 9.600 b/sec.
04 19.200 b/sec.
Abhängig von den Geräten, die an die Kommunikationsschnittstelle angeschlossen sind, ist eventuell eine bestimmte Zeit für die Übertragung erforderlich. In diesem Fall stellen Sie bitte eine Übertragungsverzögerungszeit ein, um
die zulässige Zeit zu regulieren.
Bit
15 0
DM 6647:RS-232C–Schnittstelle
DM 6652:Peripherieschnittstelle
Übertragungsverzögerungszeit (4–stellige BCD; Einheit: 10 ms)
Vorgabe: Keine Verzögerung
Die Übertragungsverzögerungszeit wird in der SPS–Konfiguration eingestellt,
um einen minimalen Intervall zwischen dem Senden der Daten von der SPS zu
erstellen. Die Übertragungsverzögerungszeit wird für die folgenden seriellen
Kommunikationsmodi verwendet.
48
Kommunikationsmodus Anwendung
Host–Link, Antworten Sobald die SPS eine Antwort an den Host–Computer
gesendet hat, wird die nächste Antwort erst dann
gesendet, wenn die eingestellte Übertragungszeit
abgelaufen ist.
Host–Link, SPS-initiierte
Kommunikation
Ohne
Protokoll–Kommunikation
Wenn die SPS–Daten mit dem Befehl TXD(48)
gesendet hat, werden die nächsten Daten erst dann
versendet, wenn die eingestellte Übertragungszeit
abgelaufen ist.
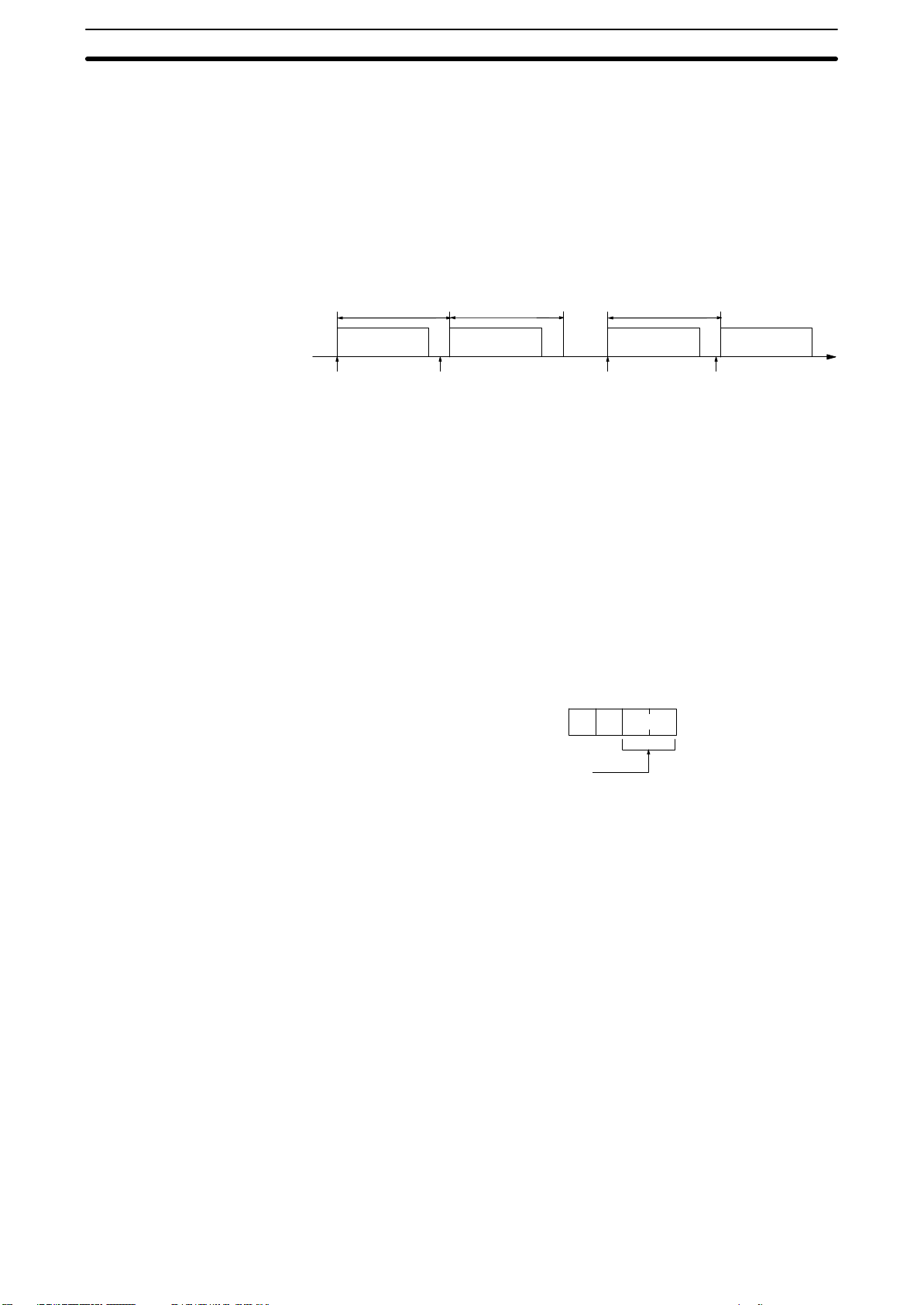
1-6AbschnittKommunikationsfunktionen
Die Verzögerungszeit wird nicht verwendet, wenn zum ersten Mal Daten von der
SPS gesendet werden. Die Verzögerungszeit beeinflusst andere Sendedaten
nur, wenn die normale Sendezeit der Sendedaten vor der eingestellten Übertragungsverzögerungszeit abgelaufen ist.
Wenn die Verzögerungszeit bereits abgelaufen und die nächsten Sendedaten
schon bereit sind, werden die Daten sofort gesendet. Wenn die Verzögerungszeit nicht abgelaufen ist, werden die Sendedaten so lange verzögert, bis die eingestellte Übertragungsverzögerungszeit abgelaufen ist.
Die Funktionen der Übertragunsverzögerungszeit für Daten, die von der SPS
gesendet werden, werden nachfolgend dargestellt.
Übertragungsver-
zögerung
Antwort/Daten
gesendet
1. Sendedaten
von SPS
Übertragungsver-
zögerungszeit
Antwort/Daten
gesendet
2. Sendedaten
von SPS
Übertragungsver-
zögerungszeit
Antwort/Daten
gesendet
3. Sendedaten
von SPS
Antwort/Daten
gesendet
4. Sendedaten
von SPS
1-6-2 Host–Link–Kommunikationseinstellungen und –verfahren
Dieser Abschnitt beschreibt die SPS–Konfigurationseinstellungen und Verfahren, die für die Host–Link–Kommunikation erforderlich sind.
SPS–Konfigurations–
einstellungen
Schreiben Sie 00 in die äußeren linken Stellen von DM 6645 (RS-232C–Schnittstelle) oder DM 6650 (Peripherieschnittstelle), um die Host–Link–Kommunikation zu spezifizieren. Weitere Host–Link–Kommunikationsparameter werden in
die äußeren rechten Stellen von DM 6645/DM 6650 und DM 6646/DM 6651 eingestellt.
Eine Teilnehmernummer muss für die Host–Link–Kommunikation eingestellt
werden, um zwischen den Teilnehmern zu unterscheiden, wenn mehrere Teilnehmer an einer Kommunikation teilnehmen. Diese Einstellung ist nur für die
Host–Link–Kommunikation erforderlich.
Bit
15 0
DM 6648: RS-232C–Schnittstelle
DM 6653: Peripherieschnittstelle
00
Zeit
Übersicht der Host–Link–
Kommunikation
Kommunikations–
verfahren
Teilnehmernummer
(2–stellige BCD): 00 bis 31
Vorgabe: 00
Die Teilnehmernummer wird in der Regel auf 00 gesetzt. Andere Einstellungen
sind nicht erforderlich, sofern nicht mehrere Teilnehmer in einem Netzwerk verbunden sind.
Die Host–Link–Kommunikation wurde von OMRON entwickelt, um SPS und einen oder mehrere Host–Computer über ein RS-232C–Kabel zu verbinden und
um die PC–Kommunikation von dem Host–Computer zu steuern. In der Regel
sendet der Host–Computer einen Befehl an eine SPS und die SPS sendet automatisch eine Antwort zurück. Daher wird die Kommunikation ausgeführt, ohne
dass die SPS aktiv beteiligt sind. Die SPS können außerdem die Datenübertragung starten, wenn eine direkte Beteiligung erforderlich ist.
Im Allgemeinen stehen zwei Arten für die Implementierung der Host–Link–Kommunikation zur V erfügung. Eine basiert auf C-Mode–Befehle und die andere auf
FINS (CV-Mode)–Befehle. Die CQM1H unterstützt nur die C-Mode–Befehle.
Einzelheiten über die Host–Link–Kommunikation entnehmen Sie bitte
Host–Link–Befehle.
6
Abschnitt
Dieser Abschnitt erklärt wie das Host–Link verwendet wird, um Datenübertragungen von der CQM1H durchzuführen. Diese Methode ermöglicht die automatische Datenübertragung von der CQM1H, wenn Daten geändert werden, und
49

1-6AbschnittKommunikationsfunktionen
vereinfacht das Kommunikationsverfahren durch Eliminierung der konstanten
Überwachung durch den Computer.
1, 2, 3...
1. Stellen Sie sicher, dass AR 0805 (RS-232C–Schnittstelle Sendebereit–
Merker) auf EIN gestellt ist.
2. Verwenden Sie den TXD(48)–Befehl für die Datenübertragung.
Vom Zeitpunkt der Ausführung dieses Befehls bis zur Beendigung der Datenübertragung bleibt AR 0805 (oder AR 0813 für die Peripherie–Schnittstelle) auf
AUS geschaltet. Nach Beendigung der Datenübertragung wird er wieder auf
EIN gestellt. Der TXD(48)–Befehl liefert keine automatische Antwort. Damit
eine Bestätigung eingeht, wenn der Computer die Daten erhalten hat, muss das
Computerprogramm so geschrieben werden, dass beim Schreiben der Daten in
der CQM1H der Computer eine Meldung ausgibt.
Der Übertragungsdatenrahmen für die mit dem TXD(48)–Befehl übertragenen
Daten im Host–Link–Mode ist wie folgt.
@ EX
x 10
Teilnehmer–
Nr.
0
1
x 10
Start–Code
(Muss “EX” sein)
(@)TXD(48)
S
C
N
Daten (bis zu 122 Zeichen)
S: Erste Wortadresse der Übertragungsdaten
C: Steuerdaten
N: Anzahl der Bytes der zu sendenden Daten (4–stellige BCD)
0000: RS-232C–Schnittstelle
1000: Peripherieschnittstelle
0000 bis 0061
FCS-
Prüfzeichen
:
Abschluss–
code
↵
Um die RS-232C–Schnittstelle zurückzusetzen (z. B. um den Anfangsstatus
wiederherzustellen), stellen Sie SR 25209 auf EIN. Um die Peripherieschnittstelle zurückzusetzen, schalten Sie SR 25208 auf EIN. Diese Bits werden nach
dem Rücksetzen automatisch auf AUS gesetzt.
Wenn der TXD(48)–Befehl ausgeführt wird, während CQM1H auf einen Computerbefehl antwortet, wird die Antwortübertragung abgeschlossen, bevor die
Übertragung entsprechend dem TXD(48)–Befehl ausgeführt wird.In allen diesen Fällen erhält die Datenübertragung basierend auf einen TXD(48)–Befehl
die erste Priorität.
Anwendungsbeispiel Dieses Beispiel zeigt ein Programm für die Verwendung der RS-232C–
Schnittstelle im Host–Link–Modus, um Daten von 10 Bytes (DM 0000 bis DM
0004) an den Computer zu übertragen. Die Standardwerte werden für alle
SPS–Einstellungen angenommen (z. B. die RS-232C–Schnittstelle wird im
Host–Link–Modus verwendet, die Teilnehmer–Nr. ist 00 und die Standardkommunikationsbedingungen werden verwendet.) Von DM 0000 bis DM
0004, “1234” wird in jedem Wort gespeichert. Führen Sie vom Computer ein
Programm aus, um die CQM1H–Daten mit den
Standardkommunikationsbedingungen zu erhalten.
00100 AR 0805
@TXD(48)
DM 0000
#0000
#0010
Wenn AR 0805 (der Sendebereit–Merker)
auf EIN gesetzt ist und IR 00100 auf EIN
schaltet, werden die zehn Bytes Daten (DM
0000 bis DM 0004) übertragen.
50

Das folgende Programm muss im Host–Computer vorbereitet werden, um die
Daten zu empfangen. Mit diesem Programm kann der Computer die von der
SPS empfangenen Daten lesen und anzeigen, während ein Host–Link–Lesebefehl ausgeführt wird, um die Daten von der SPS zu lesen.
10 ’CQM1H SAMPLE PROGRAM FOR EXCEPTION
20 CLOSE 1
30 CLS
40 OPEN ”COM:E73” AS #1
50 :KEYIN
60 INPUT ”DATA ––––––––”,S$
70 IF S$=” ” THEN GOTO 190
80 PRINT ”SEND DATA = ”;S$
90 ST$=S$
100 INPUT ”SEND OK? Y or N?=”,B$
110 IF B$=”Y” THEN GOTO 130 ELSE GOTO :KEYIN
120 S$=ST$
130 PRINT #1,S$ ’Sendet Befehl an SPS
140 INPUT #1,R$ ’Empfängt Antwort von SPS
150 PRINT ”RECV DATA = ”;R$
160 IF MID$(R$,4,2)=”EX” THEN GOTO 210 ’Identifiziert Befehl von SPS
170 IF RIGHT$(R$,1)<>”:” THEN S$=” ”:GOTO 130
180 GOTO :KEYIN
190 CLOSE 1
200 END
210 PRINT ”EXCEPTION!! DATA”
220 GOTO 140
Die vom Computer empfangenen Daten sind wie folgt. (FCS ist “59.”)
“@00EX1234123412341234123459:CR
”
1-6AbschnittKommunikationsfunktionen
1-6-3 Ohne Protokoll–Kommunikationseinstellungen und –verfahren
Dieser Abschnitt beschreibt die SPS–Setup–Einstellungen und Verfahren, die
für die Ohne Protokoll–Kommunikation erforderlich sind. Mit der Ohne Protokoll–Kommunikation können Daten über Standard–Geräte ausgetauscht werden. Beispielsweise können Daten über einen Drucker ausgegeben oder von
einem Barcode–Lesegerät eingegeben werden.
SPS–Konfigurations–
einstellungen
DM 6648: RS-232C–Schnittstelle
DM 6653: Peripherieschnittstelle
Endcode
0: Nicht eingestellt (Menge der spezifizierten
Empfangsdaten)
1: Einstellen (spezifizierter Endcode.)
2: CR/LF
Startcode
0: Nicht eingestellt
1: Einstellen (spezifizierter Startcode.)
Schreiben Sie 10 in die äußeren linken Stellen von DM 6645 (RS-232C–Schnittstelle) oder DM 6650 (Peripherieschnittstelle), um die Ohne–Protokoll–Kommunikation zu spezifizieren. Weitere Kommunikationsparameter werden in die
äußeren rechten beiden Stellen von DM 6645/DM 6650 und DM 6646/DM 6651
eingestellt.
Die Anfangs– und Abschlusscodes oder die Datenmenge, die empfangen werden soll, können wie in der folgenden Abbildung dargestellt, eingestellt werden,
wenn dies für die Ohne–Protokoll–Kommunikation erforderlich ist. Diese Einstellung ist nur für die Ohne–Protokoll–Kommunikation erforderlich. Diese Einstellungen sind nur gültig, wenn Stift 5 des DIP–Schalters auf AUS gesetzt ist.
Start– und Endcodes aktivieren
Bit
15 0
00
Vorgabe: Kein Start– oder Endcode (Spezifizierte Anzahl der zu empfangenen Bytes.)
51
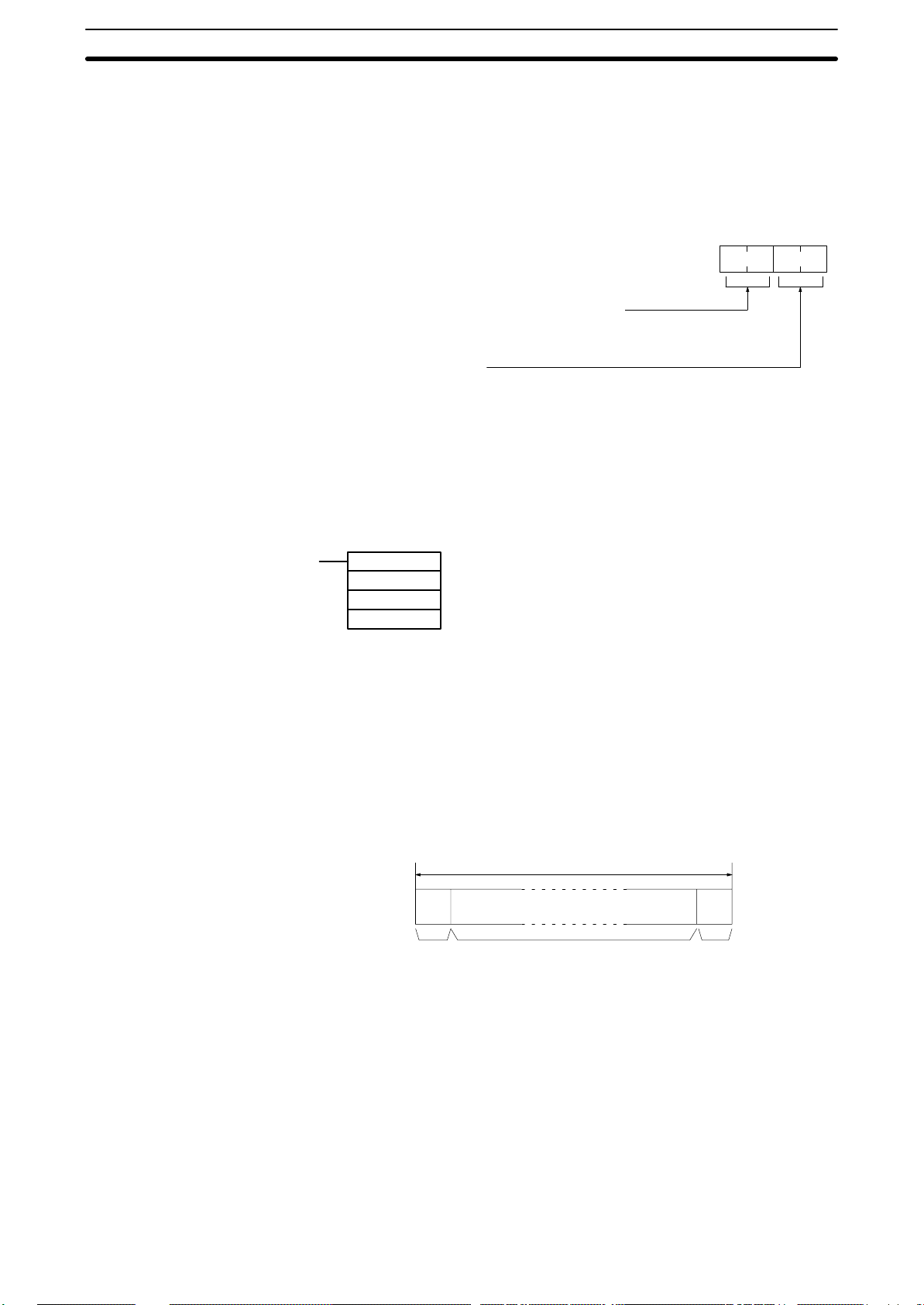
Kommunikationsverfahren
1-6AbschnittKommunikationsfunktionen
Spezifizieren Sie, ob ein Startcode am Anfang der Daten und ein Endcode am
Ende der Daten eingestellt werden soll oder nicht. Anstelle eines Endcodes
kann die Anzahl der zu empfangenen Bytes vor Beendigung der Empfangsfunktion spezifiziert werden. Sowohl die Codes als auch die Anzahl der Bytes der
Empfangsdaten werden in DM 6649 oder DM 6654 eingestellt.
Einstellung des Startcodes, Endcodes und der Menge der Empfangs–
daten
Bit
DM 6649: RS-232C–Schnittstelle
DM 6654: Peripherieschnittstelle
Endcode oder zu empfangenen Anzahl der Bytes
Für Endcode: (00 bis FF)
Für Menge der Empfangsdaten: 2–stellige Hexadezimal, 00 bis FF (00: 256 Bytes)
Startcode 00 bis FF
Vorgabe: Kein Startcode; Datenempfang bei 256 Bytes abgeschlossen.
Übertragungen
15 0
1, 2, 3...
1. Stellen Sie sicher, dass AR 0805 (der RS-232C–Schnittstellen–Sendebereit–Merker) auf EIN gestellt ist.
2. Verwenden Sie den TXD(48)–Befehl für die Datenübertragung.
(@)TXD(48)
S
C
N
S: Erstes zu übertragenes Datenwort
C: Steuerdaten
N: Anzahl der Bytes der zu übertragenen Daten (4–stellige
BCD), 0000 bis 0256
Vom Zeitpunkt der Ausführung dieses Befehls bis zur Beendigung der Datenübertragung bleibt AR 0805 (oder AR0813 für die Peripherie–Schnittstelle) auf
AUS geschaltet. (Nach Beendigung der Datenübertragung wird er wieder auf
EIN gestellt.)
Start– und Endcodes sind nicht eingeschlossen, wenn die Anzahl der zu übertragenen Bytes spezifiziert ist. Die größte Übertragungsmenge, die mit oder
ohne Start– und Endcodes in 256 Bytes gesendet werden kann, N, liegt zwischen 254 und 256 je nach Spezifikation der Start– und Endcodes. Wenn die
Anzahl der zu sendenden Bytes auf 0000 eingestellt ist, werden nur die Start–
und Endcodes gesendet.
max. 256 Bytes
52
1, 2, 3...
Startcode Daten Endcode
Um die RS-232C–Schnittstelle zurückzusetzen (z. B. um den Anfangsstatus
wiederherzustellen), schalten Sie SR 25209 auf EIN. Um die Peripherieschnittstelle wiederherzustellen, schalten Sie SR 25208 auf EIN. Diese Bits schalten
nach dem Rücksetzen automatisch auf AUS.
Empfangsdaten
1. Stellen Sie sicher, dass AR 0806 (RS-232C Empfang abgeschlossen–
Merker) oder AR 0814 (Peripherie–Empfang abgeschlossen–Merker) auf
EIN geschaltet ist.

2. Verwenden Sie den RXD(47)–Befehl, um Daten zu empfangen.
1-6AbschnittKommunikationsfunktionen
(@)RXD(47)
D: Erstes Wort zum Speichern der Empfangsdaten
D
C: Steuerdaten
C
N
N: Anzahl der gespeicherten Bytes (4–stellige BCD),
0000 bis 0256
Bits 00 bis 03
0: Äußere linken Bytes zuerst
1: Äußere rechten Bytes zuerst
Bits 12 bis 15
0: RS-232C–Schnittstelle
1: Peripherieschnittstelle
3. Die Leseergebnisse der empfangenen Daten werden in dem AR–Bereich
gespeichert. Stellen Sie sicher, dass die Funktion ordnungsgemäß ausgeführt wurde. Die Inhalte dieser Bits werden bei jeder Ausführung des
RXD(47)–Befehls zurückgesetzt.
RS-232C–
Schnittstelle
AR
0800...AR
0803
AR 0804 AR 0812 Kommunikationsfehler
AR 0807 AR 0815 Empfangen–Überlaufmerker (Nachdem der Empfang
AR 09 AR10 Anzahl der empfangenen Bytes (4-stellige BCD)
Peripherie–
Schnittstelle
AR 0808 bis
AR 0811
Fehler
RS-232C–Schnittstellen–Fehlercode (1–stellige BCD)
0: Normale Beendigung 1: Paritätsfehler 2:
Rahmenfehler 3: Überlauffehler
beendet ist, wurden die nachfolgenden Daten
empfangen, bevor die Daten mit Hilfe des
RXD(47)–Befehls gelesen wurden.)
Um die RS-232C–Schnittstelle zurückzusetzen (z. B. um den Anfangsstatus
wiederherzustellen), stellen Sie SR 25209 auf EIN. Um die Peripherieschnittstelle zurückzusetzen, schalten Sie SR 25208 auf EIN. Diese Bits werden nach
dem Rücksetzen automatisch auf AUS gesetzt.
Der Startcode und Endcode sind nicht in AR 09 oder AR 10 (Anzahl der empfangenen Bytes) eingeschlossen.
Anwendungsbeispiel Dieses Beispiel zeigt ein Programm für die Verwendung der RS-232C–
Schnittstelle in dem Ohne–Protokoll–Modus für die Übertragung von Daten
von 10 Bytes (DM 0100 bis DM 0104) an den Computer und zum Speichern
der empfangenen Daten von dem Computer in dem DM–Bereich beginnend
mit DM 0200. Vor Ausführung des Programms müssen die folgenden
SPS–Konfigurationseinstellungen durchgeführt werden.
DM 6645:1000 (RS-232C–Schnittstelle im Ohne–Protokoll–Modus; Standard–
Kommunikationsbedingungen)
DM 6648: 2000 (Kein Startcode; Endcode CR/LF)
Die Vorgabewerte gelten für alle anderen SPS–Konfigurationseinstellungen.
Von DM 0100 bis DM 0104 wird 3132 in jedem Wort gespeichert. Führen Sie
vom Computer ein Programm mit den Standardkommunikationsbediungungen
aus, um die CQM1H–Daten zu erhalten.
00100
00101 AR 0805
AR 0806
DIFU(13) 00101
@TXD(48)
DM 0100
#0000
#0010
@RXD(47)
DM 0200
#0000
AR09
Wenn AR 0805 (der Sendebereit–Merker) auf
EIN gesetzt ist und IR 00100 auf EIN schaltet,
werden die zehn Bytes Daten (DM 0100 bis
DM 0104), beginnent bei den äußersten linken
Bytes, übertragen.
Wenn AR 0806 (Empfang beendet–Merker) auf
EIN schaltet, wird die in AR 09 spezifizierte Anzahl der Bytes von dem Empfangspuffer der
CQM1H gelesen und im Speicher, beginnend
bei DM 0200, mit den äußersten linken Bytes
zuerst, gespeichert.
Die Daten sind wie folgt: “31323132313231323132CR LF”
53

1-6-4 1:1–Data–Links
Hinweis Die Peripherie–Schnittstelle kann nicht für 1:1–Data–Links verwendet werden.
1-6AbschnittKommunikationsfunktionen
Wenn eine CQM1H über eine 1:1–Verbindung an eine andere CPU–Baugruppe
über die RS-232C–Schnittstellen angeschlossen wird, können sie gemeinsam
auf den LR–Bereich zugreifen. Eine der SPS arbeitet als Master und die andere
als Slave. Eine CQM1H kann über die 1:1–Verbindung mit den folgenden SPS
verbunden werden: CQM1H, CQM1, C200HX/HG/HE, C200HS, CPM1,
CPM1A, CPM2A, CPM2C oder SRM1(-V2).
Verwenden Sie die in der CPU–Baugruppe integrierte RS-232C–Schnittstelle
oder die RS-232C– oder RS-422A/485–Schnittstelle des seriellen Kommunikationsmoduls.
Übersicht der
CPU–Link 1:1–
Kommunikation
Schreib–Bereich
Lese–Bereich
Mit einem 1:1–Data–Link können zwei CQM1Hs auf die gleichen Daten in
deren LR–Bereiche zugreifen. Wie in der nachfolgenden Abbildung
dargestellt, werden beim Schreiben von Daten in einem Wort in dem LR–
Bereich, diese Daten automatisch genauso in das gleiche Wort der anderen
Baugruppe geschrieben. Jede SPS besitzt spezielle Worte, in die geschrieben werden kann und spezielle Worte, in die eine andere SPS schreiben
kann. Jeder kann die von einer anderen SPS geschriebenen Worte lesen,
jedoch nicht schreiben.
Master Slave
1"
schreiben
Automatisches Schreiben.
1
Das Wort, das von jeder SPS verwendet wird, wird in der folgenden Tabelle gezeigt, entsprechend den Einstellungen für die Master–, Slave– und Link–Worte.
Stellen Sie den Link–Bereich auf LR 00 bis LR 15, wenn die CQM1H mit einem
CPM1–, CPM1A–, CPM2A– oder SRM1(-V2)–PC verbunden ist.
DM 6645–Einstellung Master–Bereich Slave–Bereich
LR 00...LR 15 LR 00...LR 07 LR 08...LR 15
LR 00...LR 31 LR 00...LR 15 LR 16...LR 31
LR 00...LR 63 LR 00...LR 31 LR 32...LR 63
1" schreiben
1
1
Schreib–Bereich
Lese–Bereich
SPS–Setup–
Einstellungen
Um ein 1:1–Data–Link zu verwenden, sind nur die Einstellungen für den Kommunikationsmodus und die Link–Worte erforderlich. Stellen Sie den Kommunikationsmodus für eine der SPS auf 1:1–Data–Link–Master und den anderen
auf 1:1–Data–Link–Slave und stellen Sie anschließend die Link–Worte in der
SPS, der als Master arbeitet, ein.
Bit
15 0
DM 6645
Kommunikations-Betriebsart
2: 1:1–Data–Link–Slave
3: 1:1–Data–Link–Master
Link–Worte
0: LR 00...LR 63
1: LR 00...LR 31
2: LR 00...LR 15
Vorgabe: Kommunikationsmodus = 0 (Host–Link)
00
Hinweis Diese Einstellungen sind nur gültig, wenn Stift 5 des DIP–Schalters der CPU–
Baugruppe auf AUS gesetzt ist. Bits 08 bis 11 sind nur in dem 1:1–Data–Link–
Master gültig.
54
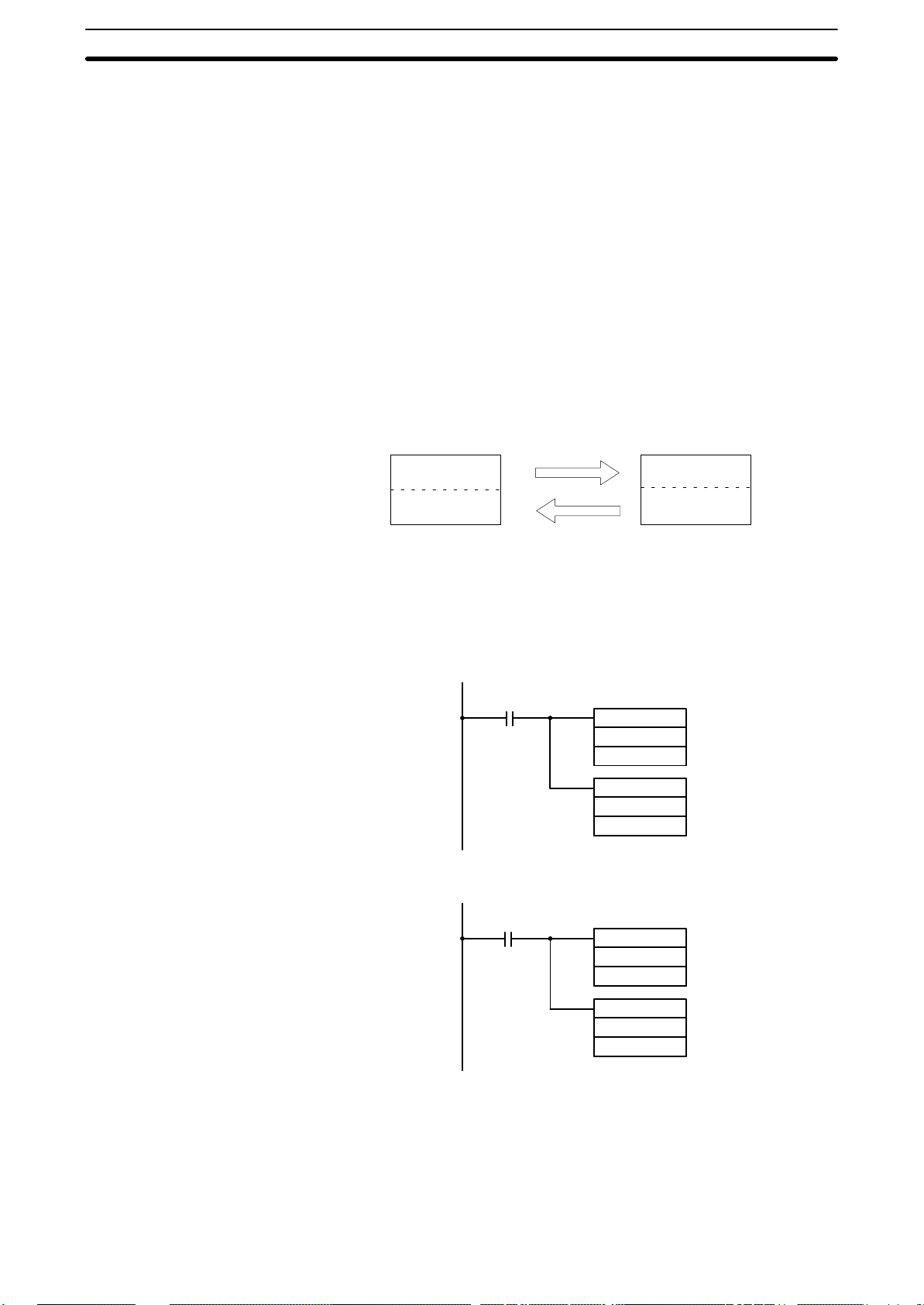
1-6AbschnittKommunikationsfunktionen
Kommunikationsverfahren Wenn die Einstellungen für den Master und Slave korrekt durchgeführt wur-
den, wird der 1:1–Data–Link automatisch gestartet, indem einfach die Spannungsversorgung für beide CPU–Baugruppen eingeschaltet wird, und der
Betrieb ist unabhängig von den Betriebsarten der CPU–Baugruppen.
Link–Fehler Wenn ein Slave innerhalb von einer Sekunde keine Antwort von dem Master
erhalten hat, schalten der 1:1–Data–Link–Fehlermerker (AR 0802) und der
Kommunikations–Fehlermerker (AR 0804) auf EIN.
Anwendungsbeispiel Dieses Beispiel zeigt ein Programm, dass die Bedingungen für die Ausfüh-
rung eines 1:1–Data–Link mit Hilfe von RS-232C–Schnittstellen prüft. Vor
Starten des Programms stellen Sie die folgenden SPS–Setup–Parameter
ein.
Master: DM 6645: 3200 (1:1–Data–Link–Master; verwendeter Bereich: LR
00 bis LR 15)
Slave: DM 6645: 2000 (1:1–Data–Link–Slave)
Die Vorgaben werden für alle anderen SPS–Setup–Parameter vorausgesetzt.
Die Worte, die für den 1:1–Data–Link verwendet werden, werden nachfolgend
gezeigt.
LR 00
LR 07
LR 08
LR 15
Master
Schreibbereich
Lesebereich
Slave
Lesebereich
Schreibbereich
LR 00
LR 07
LR 08
LR 15
Wenn das Programm für den Master und Slave ausgeführt wurde, wird der Status von IR 001 jeder Baugruppe in IR 100 der anderen Baugruppe wiedergegeben. Genauso wird der Status von IR 001 der anderen Baugruppe in IR 100 jeder Baugruppe wiedergegeben. IR 001 ist ein Eingangswort und IR 100 ein Ausgangswort.
Im Master
25313 (Immer EIN)
MOV(21)
001
LR00
MOV(21)
LR08
100
Im Slave
25313 (Immer EIN)
1-6-5 NT–Link 1:1–Mode–Kommunikation
Dieses Kapitel erklärt die Kommunikation mit einem programmierbaren Terminal, wobei der Kommunikationsmodus auf NT–Link im 1:1–Modus gestellt ist.
Die Peripherieschnittstelle kann nicht für die NT–Link–Kommunikation verwendet werden.
MOV(21)
001
LR08
MOV(21)
LR00
100
55

Einstellungen Stellen Sie den Kommunikationsmodus auf NT–Link im 1:1–Modus, indem
Sie DM 6645 auf 4000 stellen. Achten Sie darauf, dass Stift 5 des DIP–
Schalters der CPU–Baugruppe auf AUS gestellt ist.
Einzelheiten zu den Einstellungen des programmierbaren Terminals entnehmen Sie bitte dem Technischen Handbuch des programmierbaren Terminals.
1-7AbschnittBerechnung von vorzeichenbehafteten Binärdaten
Übersicht der
NT–Link–1:1–
Kommunikation
Kommunikations–
verfahren
Die NT–Link–Kommunikation wurde von OMRON entwickelt, um eine Hochgeschwindigkeitskommunikation zwischen der SPS und einem programmierbaren Terminal herzustellen. Zwei Arten der NT–Link–Kommunikation sind verfügbar: Der 1:1–Modus, bei dem ein einzelner programmierbarer Terminal an eine
SPS angeschlossen wird, und der 1:N–Modus, bei dem mehrere programmierbare Terminals an eine SPS angeschlossen werden können. Die in der CQM1H
integrierte RS-232C–Schnittstelle unterstützt nur die 1:1–Modus–Kommunikation. Beide Modi, 1:1 und 1:N, können jedoch verwendet werden, wenn ein optionales serielles Kommunikationsmodul in der SPS installiert ist.
Einige programmierbare Terminals sind mit Programmierkonsolenfunktionen
ausgestattet, mit denen der programmierbare Terminal die CQMH1 programmieren und überwachen kann. Die Programmierkonsolenfunktionen des programmierbaren Terminals können nicht verwendet werden, wenn eine Programmierkonsole an die Peripherieschnittstelle der CQM1H angeschlossen ist.
Einzelheiten über Programmierkonsolenfunktionen entnehmen Sie bitte dem
Technischen Handbuch des Programmierbaren Terminals.
Mit der NT–Link–Kommunikation antwortet die SPS automatisch auf die Befehle des programmierbaren Terminals, daher ist keine Kommunikationsprogrammierung in der CQM1H erforderlich.
1-6-6 Verdrahtung der Schnittstellen
Informationen bezüglich der Verdrahtung von Kommunikationsschnittstellen
entnehmen Sie bitte dem
CQM1H Betriebshandbuch
.
1-7 Berechnung von vorzeichenbehafteten Binärdaten
Die SPS der CQM1H–Serie ermöglichen Berechnungen mit
vorzeichenbehafteten Binärdaten. Die folgenden Befehlen dienen zur
Bearbeitung vorzeichenbehafteter Binärdaten. Vorzeichenbehaftete
Binärdaten werden unter Anwendung von 2er–Komplemente verwendet.
Die SPS–Systeme der CQM1H verfügen über die folgenden
vorzeichenbehafteten binären Befehle:
Einwort–Befehle
• 2er–KOMPLEMENT – NEG(––)
• BINÄRE ADDITION – ADB(50)
• BINÄRE SUBTRAKTION – SBB(51)
• VORZEICHENBEHAFTETE BINÄRWERT–MULTIPLIKATION – MBS(––)
• VORZEICHENBEHAFTETE BINÄRWERT–DIVISION – DBS(––)
Doppelwort(Lang)–Befehle
• DOPPELWORT–2ER–KOMPLEMENT – NEGL(––)
• BINÄRE DOPPELWORT–ADDITION – ADBL(––)
• BINÄRE DOPPELWORT–SUBTRAKTION – SBBL(––)
• VORZEICHENBEHAFTETE BINÄR–DOPPELWORT–
MULTIPLIKATION – MBS(––)
• VORZEICHENBEHAFTETE BINÄR–DOPPELWORT–DIVISION – DBSL(––)
1-7-1 Definition vorzeichenbehafteter Binärdaten
Die CQM1H bietet Befehle, die ein oder zwei Datenworte verarbeiten.
Vorzeichenbehaftete Binärdaten werden mit dem 2er–Komplement manipuliert
56

1-7AbschnittBerechnung von vorzeichenbehafteten Binärdaten
und das MSB der Ein– oder Zweiwortdaten wird als Vorzeichen verwendet.
Demnach ist der Bereich der ausdrückbaren Daten von ein oder zwei Worten:
• Einwort–Daten:
–32.768 bis 32.767 (8000 bis 7FFF hex)
• Zweiwort–Daten:
–2.147.483.648 bis 2.147.483.647 (8000 0000 bis 7FFF FFFF hex)
Die folgende Tabelle zeigt das Äquivalent zwischen dezimalen und
hexadezimalen Daten.
Dezimalzahl 16-Bit hex 32-Bit hex
2.147.483.647
2.147.483.646
.
.
.
32.768
32.767
32.766
.
.
.
2
1
0
–1
–2
.
.
.
–32.767
–32.768
–32.769
.
.
.
–2.147.483.647
–2.147.483.648
–––
–––
–––
7FFF
7FFE
0002
0001
0000
FFFF
FFFE
8001
8000
–––
–––
–––
.
.
.
.
.
.
FFFF FFFE
.
.
.
.
.
.
7FFF FFFF
7FFF FFFE
.
.
.
0000 8000
0000 7FFF
0000 7FFE
.
.
.
0000 0002
0000 0001
0000 0000
FFFF FFFF
.
.
.
FFFF 8001
FFFF 8000
FFFF 7FFF
.
.
.
8000 0001
8000 0000
1-7-2 Arithmetische Merker
Die Auswirkungen der Ausführungsergebnisse vorzeichenbehafteter
Binärbefehle auf arithmetische Merker. Die Merker und Bedingungen, unter
denen diese auf EIN gesetzt werden, sind in der folgenden Tabelle aufgeführt.
Die Merker sind auf AUS gesetzt, wenn diese Bedingungen nicht erfüllt werden.
Übertragsmerker (SR 25504) Additionsübertrag
Gleichmerker (SR 25506) Die Ergebnisse der Addition, Subtraktion,
Überlaufmerker (SR 25404) 32.767 (7FFF) wurde in den Ergebnissen der
Unterlaufmerker (SR 25405) –32.768 (8000) wurde in den Ergebnissen der
Merker EIN–Bedingungen
Negativergebnis einer Subtraktion
Multiplikation oder Division sind 0.
Konvertierungsergebnisse des
2er–Komplements sind 0.
16–Bit–Addition oder –Subtation überschritten.
2.147.483.647 (7FFF FFFF) wurde in den
Ergebnissen der 32-Bit–Addition oder
–Subtraktion überschritten.
16-Bit–Addition oder –Subtraktion oder in der
Konvertierung des 2er–Komplements
überschritten.
–2.147.483.648 (8000 0000) wurde in den
Ergebnissen der 32-Bit–Addition oder
Subtraktionoder in der Konvertierung des
2er–Komplements überschritten.
57

1-7AbschnittBerechnung von vorzeichenbehafteten Binärdaten
1-7-3 Eingabe vorzeichenbehafteter Binärdaten unter Verwendung von
Dezimalwerten
Obwohl Berechnungen für vorzeichenbehaftete Binärdaten hexadezimale
Ausdrücke verwenden, können Eingaben von der Programmierkonsole oder
des CX–Programmers unter Anwendung der Dezimalzahl–Eingabe
vorgenommen werden. Das Verfahren für das Verwenden der
Programmierkonsole zur Eingabe dezimaler Werte wird im
Technisches Handbuch
tion Manual
CX–Programmers.
Befehlseingabe Nur für die folgenden Anweisungen können 16-Bit–Operanden eingegeben
werden: NEG(––), ADB(50), SBB(51), MBS(––) und DBS(––). Sehen Sie das
CQM1H–Programmierhandbuch
über die Programmierkonsole.
der SPS der C–Serie für Einzelheiten zur Anwendung des
beschrieben. Sehen Sie das
für Einzelheiten zur Eingabe von Befehlen
CX-Programmer Opera-
CQM1H
1-7-4 Verwendung von Erweiterten Befehlen für vorzeichenbehaftete
Binärwerte
Den folgenden CQM1H–Befehle müssen Funktionscodes in der Befehlstabelle
zugewiesen werden, bevor sie verwendet werden können.
• 2ER–KOMPLEMENT – NEG(––)
• DOPPELWORT–2ER–KOMPLEMENT – NEGL(––)
• BINÄRE DOPPELWORT–ADDITION – ADBL(––)
• BINÄRE DOPPELWORT–SUBTRAKTION – SBBL(––)
• VORZEICHENBEHAFTETE BINÄRWERT–MULTIPLIKATION – MBS(––)
• VORZEICHENBEHAFTETE BINÄR–DOPPELWORT–MULTIPLIKATION –
MBSL(––)
• VORZEICHENBEHAFTETE BINÄR–DIVISION – DBS(––)
• VORZEICHENBEHAFTETE BINÄR–DOPPELWORT–DIVISION – DBSL(––)
Zuweisung von
Funktionscodes
Das Verfahren für die Verwendung der Programmierkonsole zur Zuweisung der
Funktionscodes wird im
Sie sicher, dass Schalter 4 des DIP–Schalters der CQM1H eingeschalten ist,
um die Verwendung einer anwenderspezifischen Befehlstabelle zu
ermöglichen, bevor diese Vorgange durchgeführt werden.
CQM1H–Technisches Handbuch
beschrieben. Stellen
58
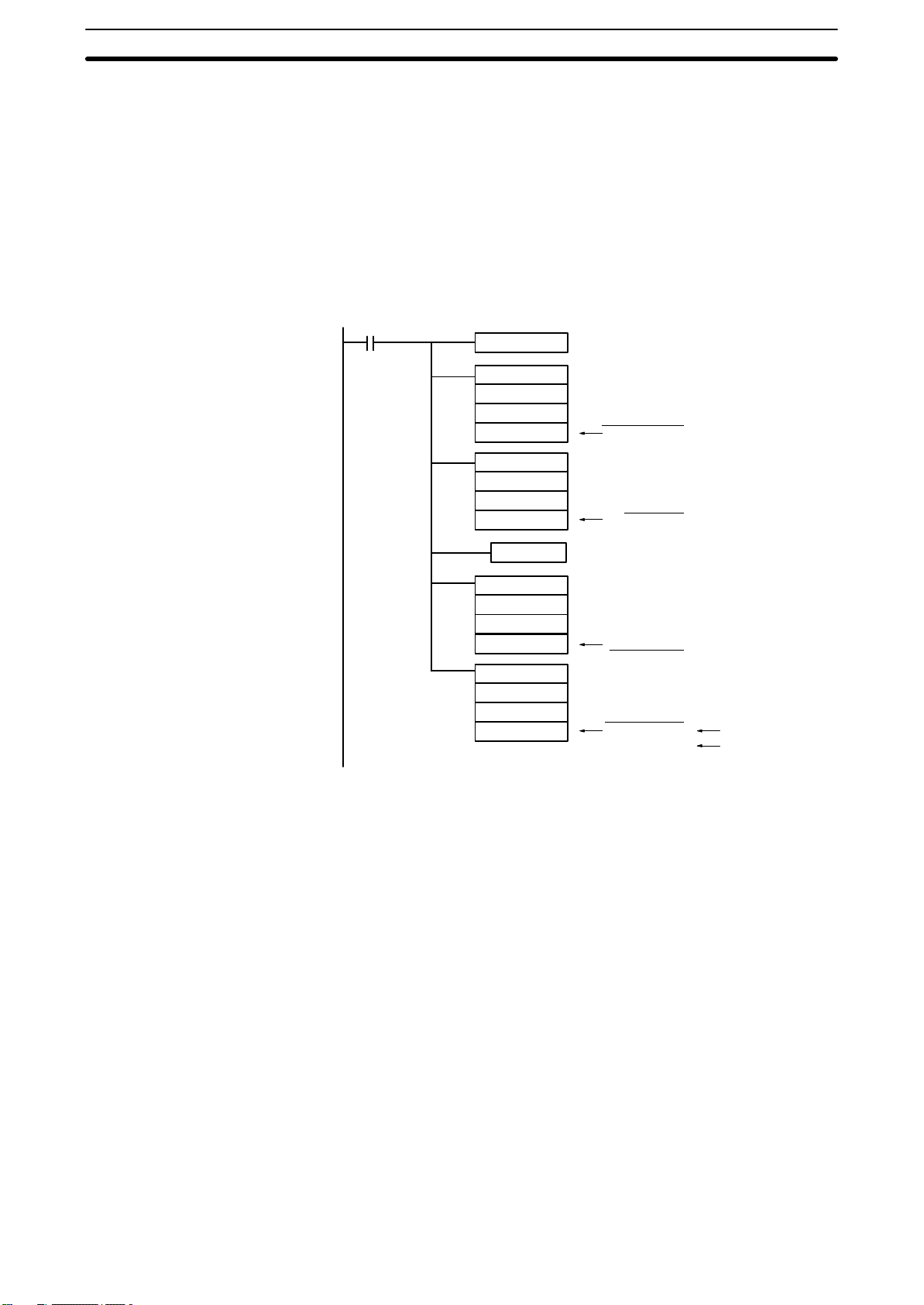
1-7-5 Anwendungsbeispiele mit vorzeichenbehafteten Binärdaten
Die folgende Programmierung kann für Berechnungen vorgenommen werden,
wie z. B. die folgenden in der CQM1H:
((1234 + (–123)) x 1212 – 12345) (–1234) = –1081, Rest 232
000 = 04D2 ← 1234
001 = FF85 ← –123
LR00 = 04BC ← 1212
HR50 = 3039 ← 12345
HR51 = 0000 ←
DM1000 = FB2E ← –1234
DM1001 = FFFF ←
1-7AbschnittBerechnung von vorzeichenbehafteten Binärdaten
10000
CLC(41)
ADB(50)
MBS(––)
SBBL(––)
DBSL(––)
CLC(41)
DM1000
000
001
010
010
LR00
020
020
HR50
030
030
040
04D2
FF85
+ 0
0457
0457
X 04BC
00148BE4
00148BE4
00003039
– 0
00145BAB
00145BAB
FFFFFB2E
FFFFFBC7
000000E8
Ergebnis
Rest
59

KAPITEL 2
Spezialmodule
Dieses Kapitel beschreibt Software–Anwendungsinformationen für die folgenden Spezialmodule: Schneller Zähler–Modul,
Impuls–E/A–Modul, Absolutwertencoder–Schnittstellenmodul, Analogeinstellungs–Modul, Analog–E/A–Modul und
serielles Kommunikationsmodul. Sehen Sie das Technisches Handbuch der CQM1H für Hardware–Informationen.
2-1 Schneller Zähler–Modul 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1-1 Modell 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1-2 Funktionen 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1-3 Schneller Zähler–Modul–Beispiel 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1-4 Verwendbare Spezialmodul–Steckplätze 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1-5 Namen und Funktionen 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1-6 Technische Daten 64 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1-7 Schnelle Zähler 1 bis 4 66 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2 Impuls–E/A–Modul 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-1 Modell 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-2 Funktion 83 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-3 Systemkonfiguration 84 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-4 Verwendbarer Spezialmodul–Steckplatz 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-5 Namen und Funktionen 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-6 Technische Daten 86 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-7 Schnelle Zähler 1 und 2 92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-8 Funktionen 102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-9 Impulsausgabe mit festem Tastverhältnis 102 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-10 Variable Tastverhältnis–Impulsausgaben 114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-11 Ermittlung des Status der Schnittstellen 1 und 2 117 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-12 Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung der
2-3 Absolutwertencoder–Schnittstellenmodul 119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-3-1 Modell 119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-3-2 Funktionen 119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-3-3 Systemkonfiguration 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-3-4 Anwendbare Spezialmodul–Steckplätze 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-3-5 Namen und Funktionen 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-3-6 Technische Daten des Absolutwertencodereingangs 121 . . . . . . . . . . . . . .
2-3-7 Schneller Zähler–Interrupts 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-4 Analogeinstellungs–Modul 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-4-1 Modell 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-4-2 Funktion 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-4-3 Verwendbare Steckplätze für Spezialmodule 132 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-4-4 Namen und Funktionen 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-4-5 Technische Daten 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-5 Analog–E/A–Modul 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-5-1 Modell 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-5-2 Funktion 133 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-5-3 Systemkonfiguration 134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-5-4 Verwendbarer Spezialmodul–Steckplatz 134 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-5-5 Namen und Funktionen 135 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-5-6 Technische Daten 136 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-5-7 Applikationsverfahren 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-6 Serielles Kommunikationsmodul 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-6-1 Modelnummer 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-6-2 Serielle Kommunikationsmodule 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-6-3 Merkmale 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-6-4 Systemkonfiguration 140 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Impulsausgabefunktionen 118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61

2-1 Schneller Zähler–Modul
2-1-1 Modell
Name Modell Technische Daten
Schneller Zähler–Modul CQM1H-CTB41 Vier Impulseingänge
2-1-2 Funktionen
Das Schnelle Zähler–Modul ist ein Spezialmodul zum Anlegen von Impulsen.
Schnelle Zählimpulseingänge 1 bis 4
Das Schnelle Zähler–Modul zählt Impulse von 50 bis 500 kHz, die über die
Schnittstellen 1 bis 4 angelegt werden und führt Aktionen anhand der
gezählten Anzahl von Impulsen aus.
Eingangsmodi
Die folgenden drei Eingangsmodi stehen zur Verfügung:
• Differential–Phasenmodus (1x/2x/4x)
• Aufwärts–/Abwärts–Modus
• Impuls–/Richtungsmodus
Vergleichsvorgang
Entspricht der Istwert des Schnellen Zählers einem spezifizierten Zielwert
oder liegt der Istwert innerhalb eines spezifizierten Bereiches, wird das in der
Vergleichstabelle spezifizierte Bitmuster in den internen Ausgangsbits und
den physikalischen Ausgängen gespeichert. Für jedes Vergleichsergebnis
kann ein Bitmuster spezifiziert werden und die physikalischen Ausgänge
werden, wie nachfolgend beschrieben, über die Ausgangsbits gesetzt.
Physikalische Ausgänge
Bis zu vier physikalische Ausgänge können angesteuert werden, wenn
entweder der Zählwert dem Zielwert entspricht oder ein Zählwert innerhalb
eines Bereiches liegt.
2-1Abschnitt
Vier Ausgänge für Vergleichsergebnisse
Hinweis Das Schneller Zähler–Modul erlaubt keine Schnellen Zähler–Interrupts. Es
vergleicht nur den Istwert mit dem Zielwert oder Vergleichsbereichswert und
setzt dementsprechend Merker und Ausgänge.
2-1-3 Schneller Zähler–Modul–Beispiel
Schneller Zähler–Modul
Schneller Zähler–Modul
2-1-4 Verwendbare Spezialmodul–Steckplätze
Das Schneller Zähler–Modul kann entweder auf Steckplatz 1 (linker
Steckplatz) oder Steckplatz 2 (rechter Steckplatz) der CQM1H-CPU51/61–
Inkrementalencoder
(max. 8)
62

CPU–Baugruppe eingesetzt werden. Beide Steckplätze können gleichzeitig
belegt werden.
2-1-5 Namen und Funktionen
Ein Schneller Zähler–Modul verfügt über zwei Steckverbinder zum Anlegen
der schnellen Eingangsimpulse. CN1 wird für die Eingänge 1 und 2 und CN2
für die Eingänge 3 und 4 verwendet.
CQM1H-CTB41 Schneller Zähler–Modul
2-1Abschnitt
Steckpl. 1 Steckpl. 2
Schneller Zähler–Modul
LED–Anzeigen
CN1
Impulseingang 1
Impulseingang 2
CN2
Impulseingang 3
Impulseingang 4
RDY: Betrieb (grün)
Leuchtet, wenn Eingangssignale verarbeitet werden können.
Impulseingänge (orange)
A1, A2, A3, A4:
Leuchtet, wenn Phase A an den Schnittstellen 1,
2, 3 oder 4 auf EIN–Pegel anliegt.
B1, B2, B3, B4:
Leuchtet, wenn Phase B an den Schnittstellen 1,
2, 3 oder 4 auf EIN–Pegel anliegt.
Z1, Z2, Z3, Z4:
Leuchtet, wenn Phase Z an den Schnittstellen 1,
2, 3 oder 4 auf EIN–Pegel anliegt.
Ausgänge (orange)
OUT1, OUT2, OUT3, OUT4:
Leuchtet, wenn der entsprechende Ausgang (1, 2, 3
ERR: Fehler (rot)
Leuchtet, wenn ein Fehler in den SPS–Konfigurationseinstellungen für die
Impulseingangsfunktion festgestellt wird oder wenn ein Über– oder Unterlauf
in den Istwert des Schnellen Zählers auftritt.
oder 4) auf EIN–Pegel ist.
Kompatibler Steckverbinder
Kontaktleiste: XM2D-1501 (OMRON)
Gehäuse XM2S-1511 (OMRON)
Zwei Kontaktleisten/Gehäuse–Sätze
werden als Standardzubehör mitgeliefert.
63

2-1-6 Technische Daten
s
ae
uo
äe
e s e jedes ä e s de Sc s e e des
Zykl
äe
g
ges eichert werden (BCD oder
äe3
)
werden (DM 6602 und DM 6611)
äe
IR 209:
IR 241:
Zähler 3
Zähler 3
Zähl
4
Zähl
4
g
1 → 0: Vergleich unterbrochen
0 e eb d o gese
Befehle
Befehl Beschreibung
CTBL(63) Wird verwendet, um Zielwert– oder Bereichsvergleichstabellen zu
INI(61) Wird verwendet, um den Vergleich mit einer gespeicherten
PRV(62) Wird verwendet, um den Istwert oder Status eines Schnellen Zählers zu
Entsprechende Steuerbits, Merker und Statusinformation
Wort
Steckplatz1Steckplatz
IR 200 IR 232 00 bis 15
IR 201 IR 233 00 bis 15
IR 202 IR 234 00 bis 15
IR 203 IR 235 00 bis 15
IR 204 IR 236 00 bis 15
IR 205 IR 237 00 bis 15
IR 206 IR 238 00 bis 15
IR 207 IR 239 00 bis 15
IR 208:
Zähler 1
Zähler 2
IR 210:
IR 211:
er
IR 212 AR 05
2
IR 240:
Zähler 1
Zähler 2
IR 242:
IR 243:
er
Bits Name Funktion
Zähler 1
Zähler 2
Zähler 3
Zähler 4
00 bis 07 Vergleichsergebnisse: Interne
Ausgangsbits 00 bis 07
08 bis 11 Vergleichsergebnisse: Bits für die
Ausgänge 1 bis 4
12 Zähler–Betriebsmerker 0: Beendet;
13 Vergleichsmerker Zeigt an, ob zur Zeit ein Vergleich stattfindet.
14 Istwert–Über–/Unterlaufmerker Zeigt an, ob ein Über– oder Unterlauf
15 Sollwert–Fehlermerker 0: Normal
00 Rücksetzmerker, Schneller–Zähler 1
01 Rücksetzmerker, Schneller–Zähler 2
02 Rücksetzmerker, Schneller–Zähler 3
03 Rücksetzmerker, Schneller–Zähler 4
08 Vergleichs–Startmerker, Schneller–Zähler
1
09 Vergleichs–Startmerker, Schneller–Zähler
2
10 Vergleichs–Startmerker, Schneller–Zähler
3
11 Vergleichs–Startmerker, Schneller–Zähler
4
12 Stoppmerker, Schneller–Zähler 1
13 Stoppmerker, Schneller–Zähler 2
14 Stoppmerker, Schneller–Zähler 3
15 Stoppmerker, Schneller–Zähler 4
speichern oder um Vergleiche mit zuvor gespeicherten Vergleichstabellen
zu starten. Eine Tabelle kann mit separaten Befehlen oder dem gleichen
Befehl gespeichert und der Vergleich gestartet werden.
Vergleichstabelle zu beginnen oder zu beenden oder um den Istwert eines
Schnellen Zählers zu ändern.
lesen.
Istwert (rechten vier Stellen)
Istwert (linken vier Stellen)
Istwert (rechten vier Stellen)
Istwert (linken vier Stellen)
Istwert (rechten vier Stellen)
Istwert (linken vier Stellen)
Istwert (rechten vier Stellen)
Istwert (linken vier Stellen)
2-1Abschnitt
Der Istwert jedes Zählers der Schnittstellen des
Schnellen Zähler–Moduls wird nach jedem
Hinweis Das Format, in dem die Daten
Enthält das über den Operanden in CTBL(63)
spezifzierte Bitmuster, wenn eine Bedingung
erfüllt ist.
Enthält das über den Operanden in CTBL(63)
spezifzierte Bitmuster, wenn eine Bedingung
erfüllt ist.
1: Aktiv
0: Beendet
1: Aktiv
stattgefunden hat.
0: Normal
1: Über– oder Unterlauf hat stattgefunden
1: Einstellfehler
Z–Phase und Software–Rücksetzung
0: Zähler wird bei Phase Z nicht zurückgesetzt
1: Zähler wird bei Phase Z zurückgesetzt
Nur Software–Rücksetzung
0:Zähler nicht zurückgesetzt
0→1: Zähler zurückgesetzt
0 → 1: Vergleich beginnt
1 → 0: Vergleich unterbrochen
0: Betrieb wird fortgesetzt
1: Betrieb wird unterbrochen
p
us gespeichert.
espeichert werden (BCD oder
Hexadezimal) kann in der
SPS–Konfiguration spezifiziert
.
64

2-1Abschnitt
Ausgangsstatus
01 oder 02 Hex: Hardware Fehler
s
uo
ese de
Wort FunktionNameBits
Steckplatz
1
IR 213 AR 06
SR 254 15 Spezialmodul–Fehlermerker 0: Kein Fehler
AR 04
Steckplatz
2
00 Ausgang 1, zwangsweises
Setzen–Steuerbit
01 Ausgang 2, zwangsweises
Setzen–Steuerbit
02 Ausgang 3, zwangsweises
Setzen–Steuerbit
03 Ausgang 4, zwangsweises
Setzen–Steuerbit
04 Ausgang, Freigabebit Zwangsweises
Setzen
00 bis 07 Fehlercode für Spezialmodul auf
Steckplatz 1
08 bis 15 Fehlercode für Spezialmodul auf
Steckplatz 2
0: Keine Auswirkungen auf den
Ausgangsstatus
1: Setzt den Ausgang zwangsweise auf EIN
0: Zwangsweises Setzen der Ausgänge 1 bis 4
gesperrt
1: Zwangsweises Setzen der Ausgänge 1 bis 4
freigegeben
1: Fehler
Wird aktiviert, wenn ein Fehler auf den
Steckplätzen 1 und 2 installierten
Spezialmodulen auftrtitt. Der Fehlercode für
Steckplatz 1 wird in AR 0400 bis AR 0407 und
der für Steckplatz 2 in AR 0408 bis AR 0415
gespeichert.
00 Hex: Normal
01 oder 02 Hex: Hardware–Fehler
03 Hex: SPS–Konfigurationsfehler
Entsprechende SPS–Konfigurationseinstellungen
Wort
Steckplatz 1 Steckplatz 2
DM 6602 DM 6611
DM 6640 DM 6643
DM 6641 DM 6644
Bits Funktion Lesen der
00 bis 03 Datenformat, in dem Istwerte der Schnellen Zähler 1 bis 4
gespeichert werden
0: 8–stellig, hex (BIN)
1: 8–stellig, BCD
04 bis 07 Nicht verwendet.
08 bis 11 NPN/PNP–Einstellung für die Ausgänge 1 bis 4
0: PNP
1: NPN
12 bis 15 Nicht verwendet.
00 bis 03 Schneller Zähler–Eingangsmodus1
0 hex: 1x Differential–Phaseneingang
1 hex: 2x Differential–Phaseneingang
2 hex: 4x Differential–Phaseneingang
3 hex: Auf–/Abwärts–Impulseingang
4 hex: Impuls–/Richtungseingang
04 bis 07 Zählfrequenz, nummerischer Bereichs–Modus und
Zähler–Rücksetzverfahren des Schnellen Zählers 1. Sehen
Sie die folgende Tabelle.
08 bis 11 Eingangsmodus des Schnellen Zählers 2
(Sehen Sie die obenstehende Erklärung für den Schnellen
Zähler 1.)
12 bis 15 Zählfrequenz, nummerischer Bereichs–Modus und
Zähler–Rücksetzverfahren des Schnellen Zählers 2
(Sehen Sie die obenstehende Erklärung für den Schnellen
Zähler 1.)
00 bis 03 Eingangsmodus des Schnellen Zählers 3
(Sehen Sie die obenstehende Erklärung für den Schnellen
Zähler 1.)
04 bis 07 Zählfrequenz, nummerischer Bereichs–Modus und
Zähler–Rücksetzverfahren des Schnellen Zählers 3
(Sehen Sie die obenstehende Erklärung für den Schnellen
Zähler 1.)
08 bis 11 Eingangsmodus des Schnellen Zählers 4
(Sehen Sie die obenstehende Erklärung für den Schnellen
Zähler 1.)
12 bis 15 Zählfrequenz, nummerischer Bereichs–Modus und
Zähler–Rücksetzverfahren des Schnellen Zählers 4
(Sehen Sie die obenstehende Erklärung für den Schnellen
Zähler 1.)
FunktionNameBits
Einstellung
Nach dem
Einschalten.
Wenn der Betrieb
beginnt.
65
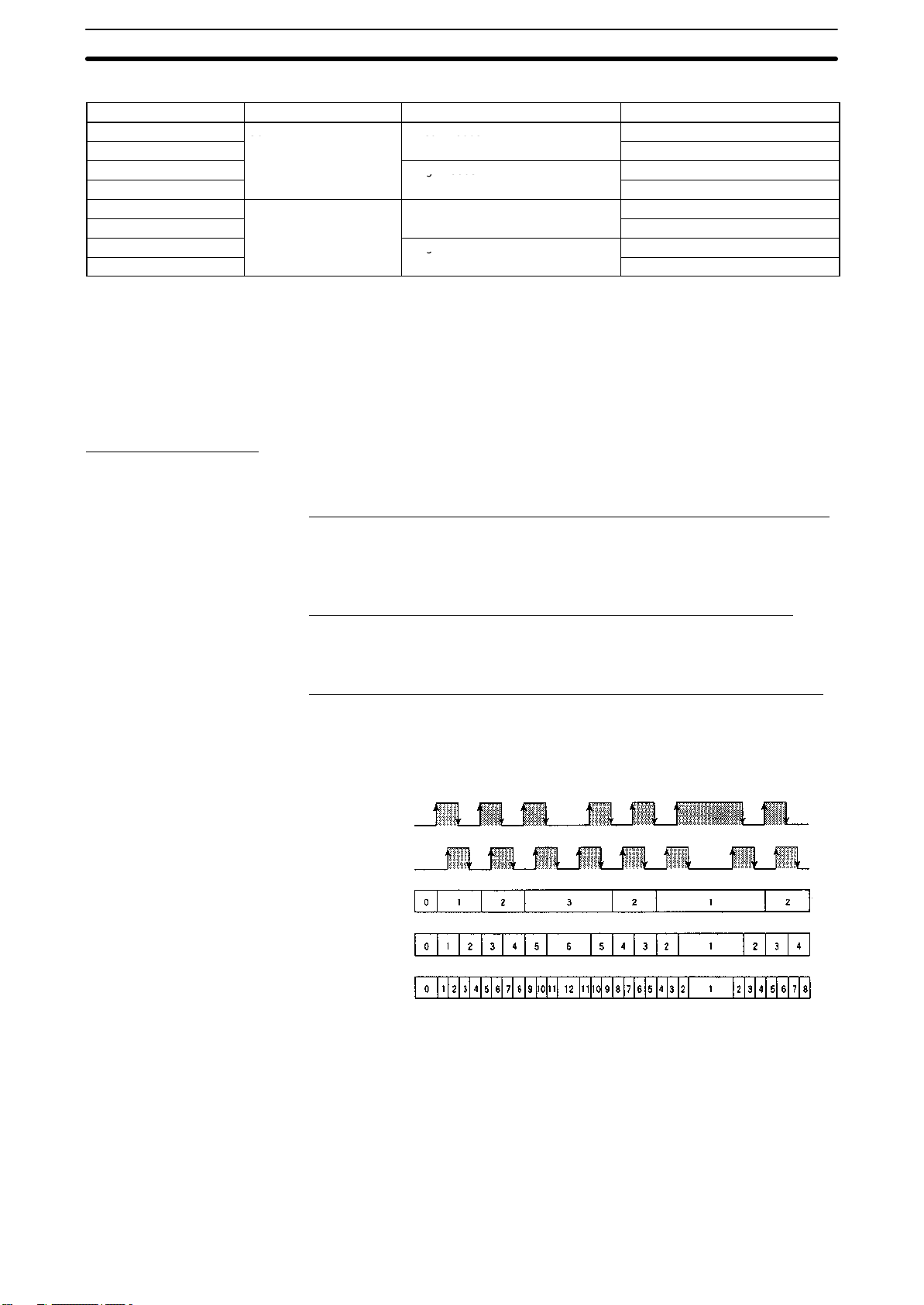
Zählfrequenz, nummerischer Bereichs–Modus und Zähler–Rücksetzverfahren der Schnellen Zähler
50
ea odus
g odus
500
ea odus
g odus
Wert Zählfrequenz Nummerischer Bereichs–Modus Zählerrückstellverfahren
0 hex
1 hex
2 hex
3 hex
4 hex
5 hex
6 hex
7 hex
50 kHz Linear Modus
Ring–Modus
500 kHz Linear Modus
Ring–Modus
Phase Z + Software–Rücksetzung
Nur Software–Rücksetzung
Phase Z + Software–Rücksetzung
Nur Software–Rücksetzung
Phase Z + Software–Rücksetzung
Nur Software–Rücksetzung
Phase Z + Software–Rücksetzung
Nur Software–Rücksetzung
2-1-7 Schnelle Zähler 1 bis 4
Das Schneller Zähler–Modul zählt Eingangsimpulse der Schnittstellen 1 bis 4
von Drehweggebern und setzt entsprechend den gezählten Impulsen Merker
und Ausgänge. Die vier Schnittstellen können unabhängig voneinander
verwendet werden. Eine grobe Funktionsbeschreibung der Schnellen Zähler
1 bis 4 ist nachfolgend gegeben.
Funktionsübersicht
Eingangssignale und
Eingangsmodi
Die Schnellen Zähler 1 bis 4 können auf verschiedene Betriebsmodi
entsprechend den Eingangssignalen eingestellt werden.
Differential–Phasenmodus (Zählgeschwindigkeit: 25 kHz oder 250 kHz)
Zweiphasen–Signale (Phase A und Phase B) mit unterschiedlichen
Phasendifferenz–Multiplikatoren von 1x, 2x oder 4x zusammen mit einem
Phase Z–Signal. Der Zählwert wird, entsprechend dem Unterschied der zwei
Phasensignale, inkrementiert oder dekrementiert.
Auf–/Abwärts–Modus (Zählgeschwindigkeit: 50 kHz oder 500 kHz)
Phase A ist der inkrementierende Impuls und Phase B der dekrementierende
Impuls. Der Zähler wird, abhängig von dem anliegenden Impuls inkrementiert
oder dekrementiert.
Impuls/Richtungs–Modus (Zählgeschwindigkeit: 50 kHz oder 500 kHz)
Phase A ist das Impulssignal und Phase B das Richtungssignal. Der
Zählwert wird mit eingeschalteter Phase B inkrementiert und dekrementiert,
wenn diese ausgeschaltet ist.
2-1Abschnitt
Differential–Phasenmodus
Phase A
Phase B
1x
2x
4x
66

Phase A Phase B x 1 x 2 x 4
↑ L Inkrementierung Inkrementierung Inkrementierung
H ↑ --- --- Inkrementierung
↓ H --- Inkrementierung Inkrementierung
L ↓ --- --- Inkrementierung
L ↑ --- --- Dekrementierung
↑ H --- Dekrementierung Dekrementierung
H ↓ --- --- Dekrementierung
↓ L Dekrementierung Dekrementierung Dekrementierung
2-1Abschnitt
Auf–/Abwärtsmodus
Gebereingang A
(Aufwärtseingang)
Gebereingang B
(Abwärtseingang)
Nummerische Bereiche
Imulse/Richtungsmodus
Gebereingang A
(Impulseingang)
Gebereingang B
(Richtungseingang)
Dekrementiert
DekrementierungInkrementierungInkrementierung
Die von den Schnellen Zählern 1 bis 4 gezählten Werte können innerhalb der
zwei Bereichseinstellungen gezählt werden:
Ringzählermodus
Im Ringzählermodus wird der Maximalwert eines nummerischen Bereiches
mit CTBL(63) eingestellt; wird der Zählwert über diesen Maximalwert hinaus
inkrementiert, wird er auf Null zurückgesetzt. Der Zählwert wird niemals
negativ. Ähnlich ist es, wenn der Zählwert über Null hinaus dekrementiert
wird; er wird auf den Maximalwert zurückgesetzt. Der Maximalwert kann auf
einen Wert zwischen 1 und 8388607 BCD oder zwischen 1 und 7FFFFFFF
hex eingestellt werden. Wird der Maximalwert auf 8388607 gesetzt, ist der
Bereich 0 bis 8388607 BCD.
Linearzählermodus
Im Linearzählermodus ist der Zählwertbereich immer –8388608 bis 8388607
BCD oder F8000000 bis 07FFFFFF hex. Wird der Zählwert auf einen Wert
unterhalb von –8388608 BCD der F8000000 hex dekrementiert, wird ein
Unterlauf generiert und wird er auf einen Wert oberhalb von 8388607 BCD
oder 07FFFFFF hex inkrementiert, tritt eine Überlauf auf.
Ringzählermodus
Max. Zählwert
(Ringzählwert)
Dekrementierung Inkrementierung
Tritt ein Überlauf auf, verbleibt der Istwert bei 08388607 BCD oder
07FFFFFF hex und tritt ein Unterlauf auf, verbleibt er bei F8388608 BCD
oder F8000000 hex. In jedem Fall wird der Zählvorgang und der Vergleich
abgebrochen, aber die Vergleichstabelle verbleibt im Speicher. Der in der
nachfolgenden Tabelle aufgeführte Istwert–Unter–/Überlaufmerker wird
aktiviert, um einen Unter– oder Überlauf anzuzeigen.
Schneller Zähler 1 IR 20814 IR 24014
Schneller Zähler 2 IR 20914 IR 24114
Schneller Zähler 3 IR 21014 IR 24214
Schneller Zähler 4 IR 21114 IR 24314
Linearzählermodus
F8000000 hex
–8388608 BCD
Unterlauf Überlauf
Istwert–Über–/Unterlaufmerker
Steckplatz 1 Steckplatz 2
07FFFFFF hex
67

Verwenden Sie beim Neustart des Zählers die nachfolgend beschriebenen
Rücksetzverfahren für die Schnellen Zähler 1 und 2. (Die Zähler werden
automatisch zurückgesetzt, wenn die Programmausführung gestartet und
beendet wird.)
2-1Abschnitt
Rücksetzverfahren
Die folgenden zwei Verfahren können verwendet werden, um festzustellen,
wann der Istwert des Zählers zurückgesetzt wird (z.B. auf 0):
• Z–Phasensignal + Software–Rücksetzung:
• Software–Rücksetzung
Z–Phasen–Signal (Rücksetzeingang) + Software–Rücksetzen
Der Istwert des Schnellen Zählers wird auf der ersten steigenden Flanke des
Phase Z–Signals zurückgesetzt, nachdem der entsprechende Schneller
Zähler–Rücksetzmerker (sehen Sie die nachfolgende Beschreibung) aktiviert
wurde.
1 oder mehrere Zyklen
(Rücksetzeingang)
Schneller–Zähler 0
Phase-Z
Rücksetzmerker
1 oder
mehrere Zyklen
Innerhalb
eines 1 Zyklus
Interrupt–gesteuerte
Rücksetzung
Zyklus–gesteuerte
Rücksetzung.
Keine
Rücksetzung
Software–Rücksetzung
Der Istwert wird zurückgesetzt, wenn der Rücksetzmerker des Schnellen
Zähler gesetzt wird. Für jeden der Schnellen Zähler 1 bis 4 ist eignes
Rücksetzbit vorhanden.
Abfrageverfahren für
Schnelle
Zähler–Interrupts
1 oder mehrere Zyklen
Rücksetzmerker
Schneller–Zähler 0
Innerhalb eines 1 Zyklus
Zyklus–gesteuerte Rücksetzung
Die Rücksetzmerker der Schnellen Zähler 1 bis 4 sind in der nachfolgenden
Tabelle aufgeführt.
Rücksetzmerker
Steckplatz 1 Steckplatz 2
Schneller Zähler 1 IR 21200 AR 0500
Schneller Zähler 2 IR 21201 AR 0501
Schneller Zähler 3 IR 21202 AR 0502
Schneller Zähler 4 IR 21203 AR 0503
Die Rücksetzmerker der Schnellen Zähler 1 bis 4 werden einmal pro Zyklus
aufgefrischt. Ein Rücksetzmerker muss für mindestens einen Zyklus aktiviert
sein, um zuverlässig erkannt zu werden.
Hinweis Die Vergleichstabellenspeicherung und der Vergleichsausführungsstatus
werden durch die Rücksetzung des Istwertes nicht beeinflusst. Ein gerade
stattfindender Vergleich wird auch nach einer Rückseztung fortgesetzt.
Die folgenden zwei Verfahren stehen zur Verfügung, um den Istwert der
Schnellen Zähler 1 bis 4 abzufragen. (Dies sind die gleichen Verfahren wie
die für den eingebauten Schnellen Zähler 0.)
• Zielwertverfahren
• Bereichsvergleichsverfahren
Sehen Sie Seite 34 für eine Beschreibung jedes Verfahrens.
68
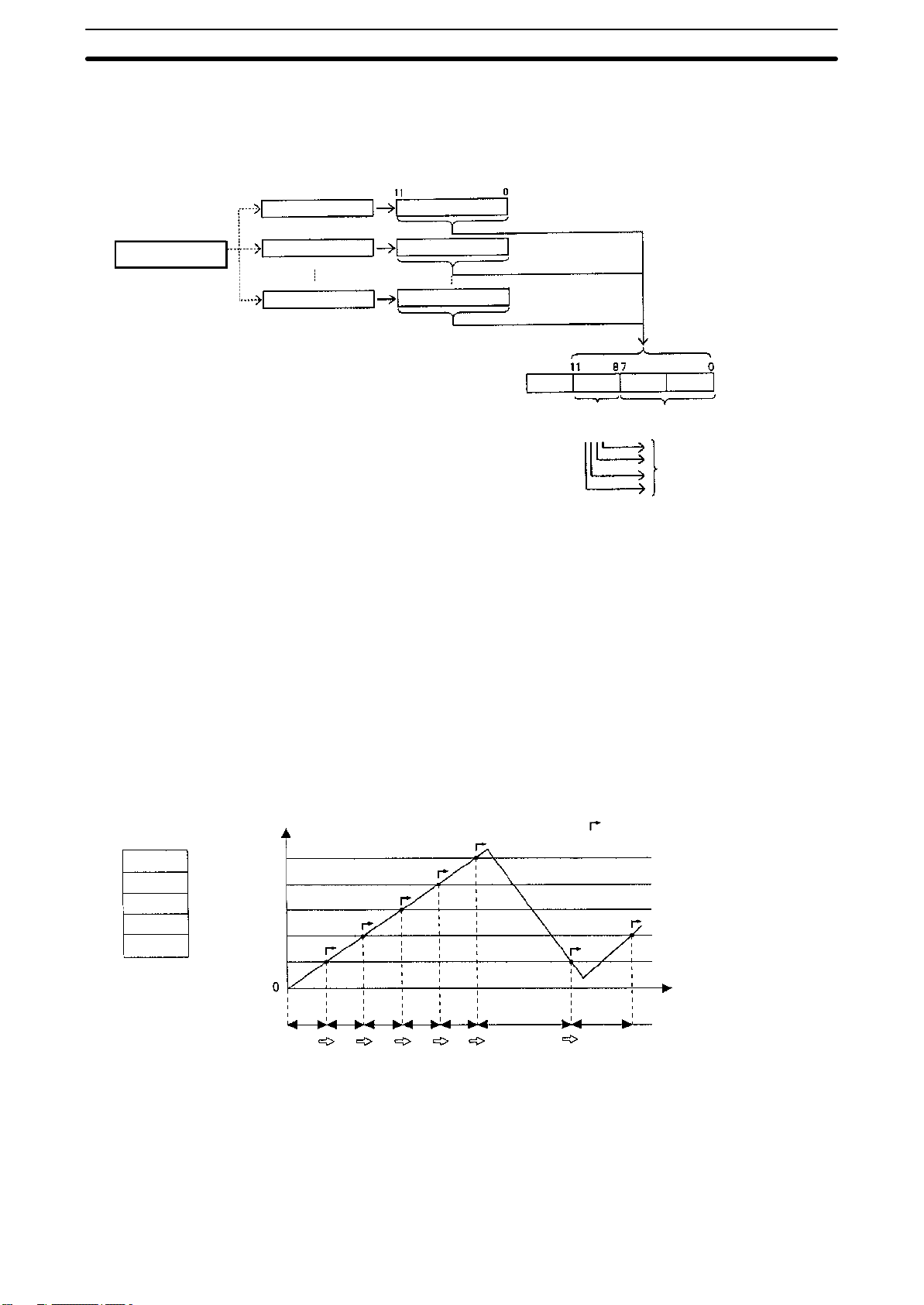
Vergleich
Maximal 48 Zielwerte können für das Zielwertverfahren gespeichert werden.
Entspricht der Istwert des Zählers einem von 48 gespeicherten Zielwerten,
wird das entsprechende Bitmuster (1 von 48) an die entsprechenden Merker
im Speicher ausgegeben.
Bei Übereinstimmung
Zielwert (1)
Bitmuster (1)
2-1Abschnitt
Schneller
Zähler–Istwert
Zielwert (2)
Zielwert (48)
Bitmuster (2)
Bitmuster (48)
208 bis 211/240 bis 243 Wd
Externe
Ausgänge
Interne Ausgangsbits (8 Bits)
Die entsprechenden Bits
von IR 208 bis IR 211 oder
IR 240 bis IR 243 werden
über ein OR verknüpft.
Externe Ausgänge
(vier Ausgänge)
Bei der Verwendung von Zielwerten wird in der Reihenfolge der
Vergleichstabelle der Vergleich des Istwertes mit jedem Zielwert
vorgenommen, bis alle Werte gefunden wurden; anschließend beginnt der
Vergleich erneut mit dem ersten Wert in der Tabelle. Bei dem Schnellen
Zähler–Modul spielt es keine Rolle, ob der Zielwert durch eine
Inkrementierung oder Dekrementierung des Istwertes erreicht wurde.
Hinweis Ist der Schnelle Zähler 0 auf der CPU–Baugruppe oder der Schnelle Zähler 1
oder 2 auf dem Impuls–E/A– oder Absolutwertencoder–Schnittstellenmodul
vorhanden, legt das linke Bit des Wortes, das die Unterprogrammnummer in
der Vergleichstabelle enthält, fest, ob die Zielwerte für eine Dekrementierung
oder Inkrementierung des Istwertes gültig sind.
Vergleichstabelle
Zielwert 1
Zielwert 2
Zielwert 3
Zielwert 4
Zielwert 5
Zielwert für den Vergleich
Zielwert 5
Zielwert 4
Zielwert 3
Zielwert 2
Zielwert 1
Beispiele für einen Vergleichstabellenvorgang und die entsprechenden
Bitmusterausgaben sind in den folgenden Diagrammen dargestellt.
Zähler–Istwert
12345 1 2
Bitmusterausgabe an den Speicher
Zeit
69

2-1Abschnitt
Zähler–Istwert
Zielwert 1
Zielwert 2
Zielwert 3
Zielwert 4
Zielwert 5
Zielwert für den
Vergleich
123451
Vergleichswerte 1 bis 48 und Bitmuster 1 bis 48 sind in der Zielwerttabelle
gespeichert. Von den Bits 00 bis 11 jedes dieser Bitmuster werden die Bits 0
bis 7 als Merker gespeichert und die Bits 08 bis 11 als externe Ausgangbits.
Wie in dem nachfolgenden Diagramm gezeigt, werden die Bits in den
externen Ausgangsbits in einer OR–Verknüpfung mit den entsprechenden
Bits der Schnellen Zähler 1 bis 4 verwendet; die Ergebnisse werden dann
jeweils über die Ausgänge 1 bis 4 ausgegeben.
Beispiel:
Steckplatz 1 Steckplatz 2
Vergleichsergebnis, Schneller Zähler 1 (IR 208 oder IR 240)
Vergleichsergebnis, Schneller Zähler 2 (IR 209 oder IR 241)
Vergleichsergebnis, Schneller Zähler 3 (IR 210 oder IR 242)
Vergleichsergebnis, Schneller Zähler 4 (IR 211 oder IR 243)
Bitmusterausgabe an den Speicher
Zeit
Bit
Mit den Bits an der gleichen
Position wird eine OR–Verknüpfung vorgenommen und
das Ergebnis ausgegeben.
Vergleich
Schneller
Zähler–Istwert
Ausgang 1 EIN
Ausgang 2 EIN
Ausgang 3 EIN
Ausgang 4 AUS
Für das Bereichsvergleichsverfahren sind 16 Vergleichsbereiche in der
Vergleichstabelle gespeichert. Liegt der Istwert des Zähler zum ersten Mal
zwischen den Ober– und Untergrenzen einer dieser Bereiche 1 bis 16, wird
das entsprechende Bitmuster (1 bis 16) einmal an die spezifizierten Bits im
Speicher ausgegeben.
Ausgegebenes Bitmuster wenn Istwert innerhalb des Bereiches ist.
Untere Grenze 1 bis
obere Grenze 1
Untere Grenze 2 bis
obere Grenze 2
Untere Grenze 16 bis
obere Grenze 16
Bitmuster 1
Bitmuster 2
Bitmuster 16
IR 208 bis IR 211 oder
IR 240 bis IR 243
Interne Bits
der Ausgänge
Interne Ausgangsbits (8 Bits)
Die entsprechenden
Bits von IR 208 bis
IR 211 oder IR 240 bis
IR 243 werden über
ein OR verknüpft.
Ausgänge (vier)
70
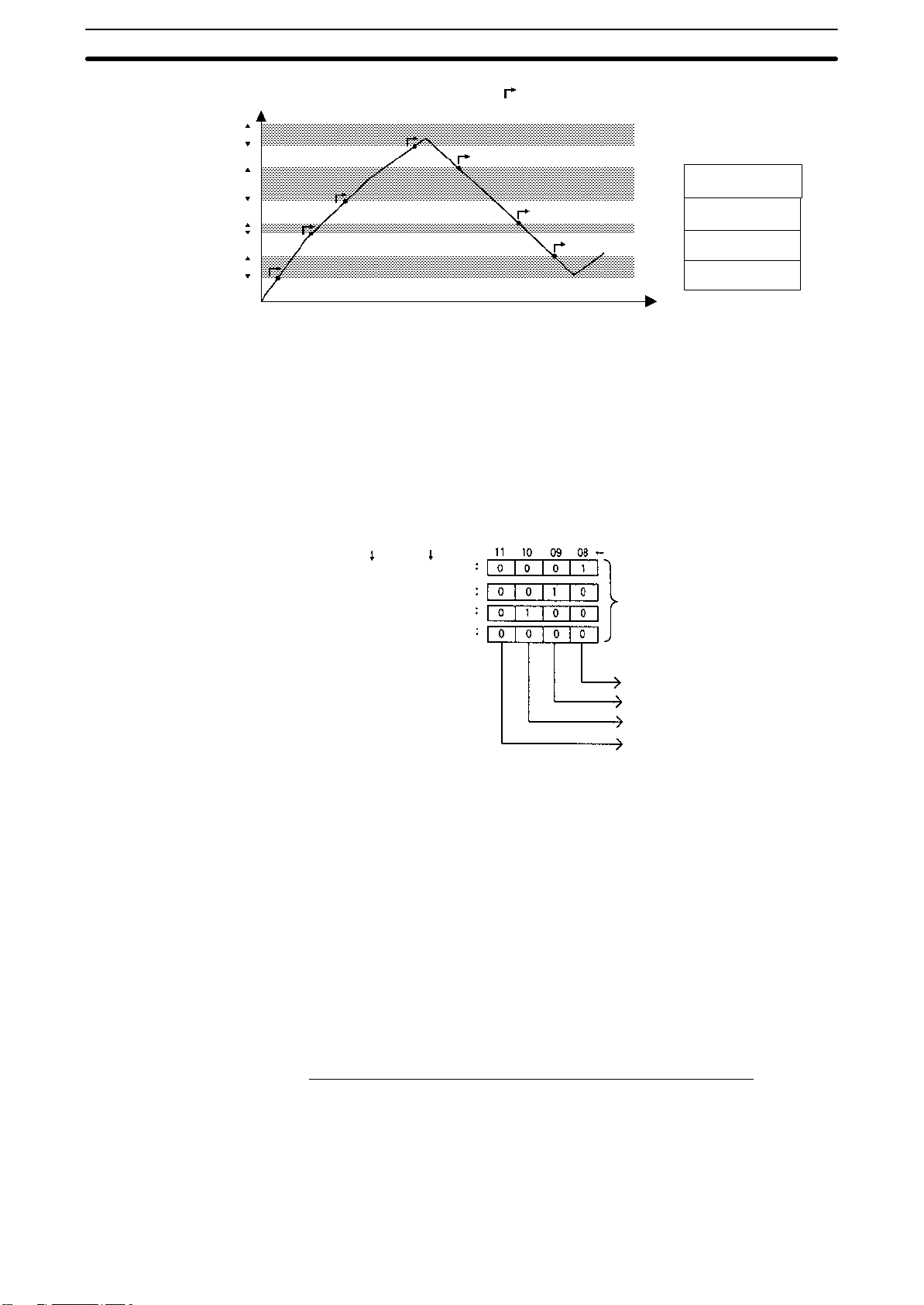
2-1Abschnitt
Vergleichsbereich 4
Vergleichsbereich 3
Vergleichsbereich 2
Vergleichsbereich 1
Beispiel:
Zähler–Istwert
Der Istwert wird kontinuierlich mit allen Vergleichsbereichen verglichen.
Bitmusterausgabe an den Speicher
Vergleichstabelle
Vergleichsbereich 1
Vergleichsbereich 2
Vergleichsbereich 3
Vergleichsbereich 4
Zeit
Die unteren und oberen Grenzwerte der Bereiche 1 bis 16 und die Bitmuster
1 bis 16 werden in der Bereichsvergleichstabelle gespeichert. Von den Bits 0
bis 11 jedes dieser Bitmuster werden die Bits 0 bis 7 als Merker gespeichert
und die Bits 8 bis 11 als externe Ausgangsbits. Wie in dem nachfolgenden
Diagramm gezeigt, werden die Bits in den externen Ausgangsbits in einer
OR–Verknüpfung mit den entsprechenden Bits der Schnellen Zähler 1 bis 4
verwendet; die Ergebnisse werden dann jeweils über die Ausgänge 1 bis 4
ausgegeben.
Vergleichsergebnis, Schneller Zähler 1 (IR 208 oder IR 240)
Vergleichsergebnis, Schneller Zähler 2 (IR 209 oder IR 241)
Vergleichsergebnis, Schneller Zähler 3 (IR 210 oder IR 242)
Vergleichsergebnis, Schneller Zähler 4 (IR 211 oder IR 243)
Lesen des Status des
Schnellen Zählers
Steckplatz 1 Steckplatz 2
Bit
Mit den Bits an der gleichen
Position wird eine OR–Verknüpfung vorgenommen und
das Ergebnis ausgegeben.
Ausgang 1 EIN
Ausgang 2 EIN
Ausgang 3 EIN
Ausgang 4 AUS
Die Ausgänge 1 bis 4 werden über OR–Verknüpfungen der entsprechenden
Bits (z.B. Bits mit der gleichen Bitnummer) in den Vergleichsergebnisbits 08
bis 11 für die Schnellen Zähler 1 bis 4 gesteuert. Der Anwender legt die zu
aktivierenden Ausgänge für jedes Vergleichsergebnis fest und setzt die
Bitmuster, damit die OR–Verknüpfung das erwartete Ergebnis liefert.
Hinweis Der integrierte Schnelle Zähler (Schneller Zähler 0) und das Impuls–E/A–Mo-
dul für die Bereiche 1 bis 8 unterstützen die Bereichsvergleichsmerker. Diese
Merker werden jedoch nicht von dem Schnellen Zähler–Modul unterstützt.
Die internen Bitmuster müssen dazu verwendet werden, die gleichen Ausgabeergebnisse zu erzielen.
Die folgenden zwei Verfahren stehen zur Verfügung, um den Istwert der
Schnellen Zähler 1 bis 4 zu lesen
• Unter Verwendung von Speicherworten der CPU–Baugruppe
• Durch PRV(62)
Unter Verwendung von Speicherworten der CPU–Baugruppe
Nachfolgend sind die den Status der Schnellen Zähler 1 bis 4 anzeigenden
Speicherworte und –bits aufgeführt.
71
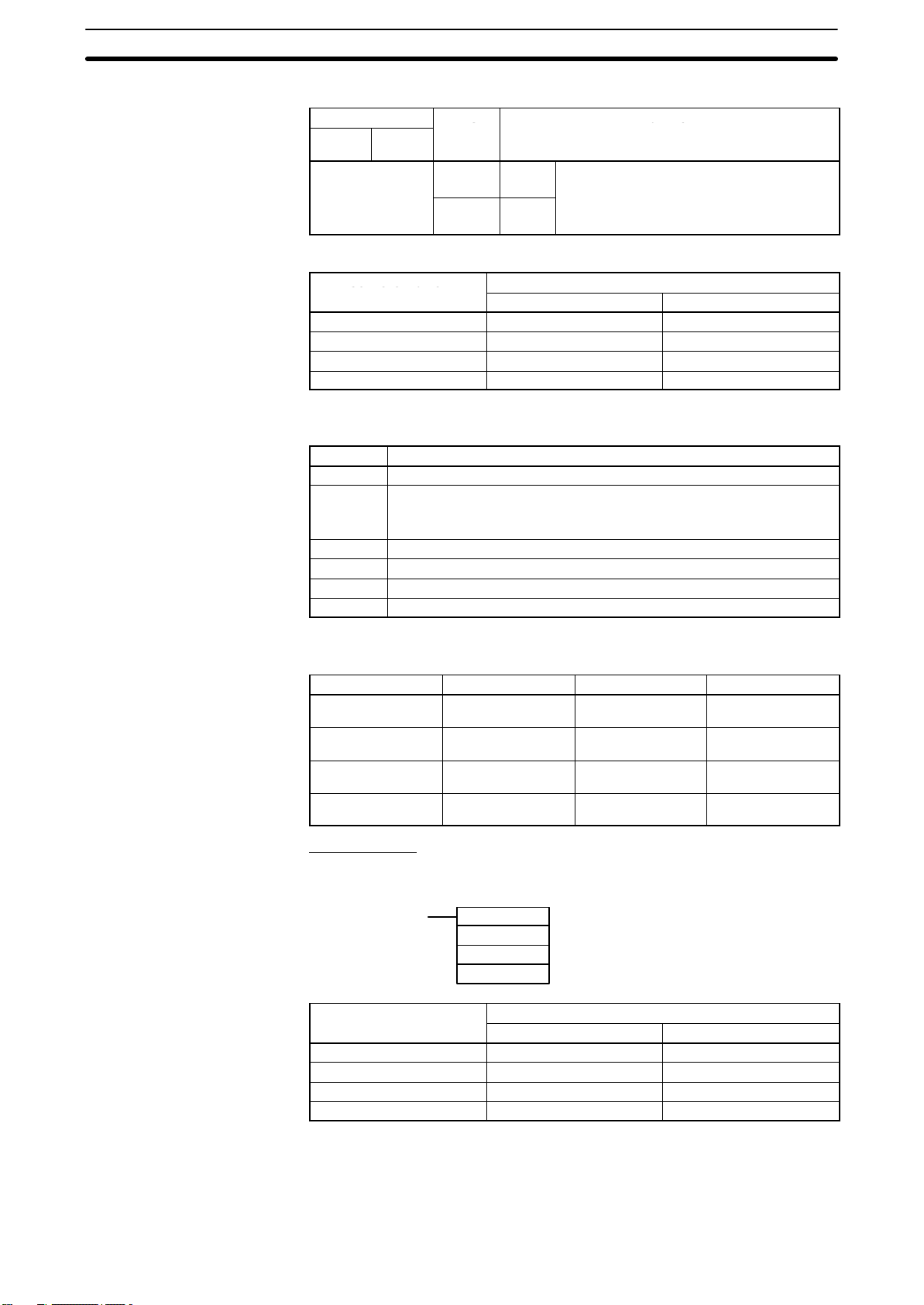
Spezialmodul–Fehlermerker
s
uo
Sc e e ä e
Sc e e ä e
2-1Abschnitt
Steck–
platz 1
AR 04
Wort
Steck–
platz 2
Bits Funktion
00 bis 07 Steck–
platz 1
08 bis 15 Steck–
platz 2
Die folgenden zweistelligen Fehlercodes werden
gespeichert.
00 hex: Normal
01 oder 02 hex: Hardware–Fehler
03 hex: SPS–Konfigurationsfehler
Betriebsstatusworte
Schneller Zähler
Steckplatz 1 Steckplatz 2
Schneller Zähler 1 IR 208 IR 240
Schneller Zähler 2 IR 209 IR 241
Schneller Zähler 3 IR 210 IR 242
Schneller Zähler 4 IR 211 IR 243
Wort
Die Funktionen der Bits des Betriebsstatuswortes sind nachfolgend
aufgeführt:
Bits Funktion
00 bis 07 Vergleichsergebnisse: Interne Bits
08 bis 11 Vergleichsergebnisse: Bits für die Ausgänge 1 bis 4
Das Ergebnis einer OR–Verknüpfung der Bits an den gleichen Bitpositionen der
Schnellen Zähler 1 bis 4 wird ausgegeben.
12 Zähler–Betriebsmerker (0: beendet; 1: aktiv)
13 Vergleichsmerker (0:beendet; 1: aktiv)
14 Istwert–Über–/Unterlaufmerker (0: nein; 1: ja)
15 Sollwert–Fehlermerker (0: Normal; 1: Fehler)
Hinweis Die folgende Tabelle zeigt die Beziehung zwischen den Ausgängen 1 bis 4
und die externen Ausgangsbits für Vergleichsergebnisse:
Schneller Zähler Ausgang Steckplatz 1 Steckplatz 2
Zähler 1 Ausgang 1 OR der Bits 08 von
IR 208 bis IR 211
Zähler 2 Ausgang 2 OR der Bits 09 von
IR 208 bis IR 211
Zähler 3 Ausgang 3 OR der Bits 10 von
IR 208 bis IR 211
Zähler 4 Ausgang 4 OR der Bits 11 von
IR 208 bis IR 211
OR der Bits 08 von
IR 240 bis IR 241
OR der Bits 09 von
IR 240 bis IR 241
OR der Bits 10 von
IR 240 bis IR 241
OR der Bits 11 von
IR 240 bis IR 241
Durch PRV(62)
Der Status der Schnellen Zähler 1 bis 4 kann, wie nachfolgend gezeigt, über
PRV(62) ermittelt werden.
(@)PRV(62)
P
P: Schnittstellendefinition
C
C: 001
D
D: Erstes Zielwort
Schneller Zähler
Steckplatz 1 Steckplatz 2
Schneller Zähler 1 101 001
Schneller Zähler 2 102 002
Schneller Zähler 3 103 003
Schneller Zähler 4 104 004
In P spezifizierter Wert
72
Nachfolgend ist die Bedeutung der einzelnen Bits in D, in dem der Status der
Schnellen Zähler 1 bis 4 gespeichert ist, dargestellt.

Bits Funktion
00 bis 07 Vergleichsergebnisse: Interne Bits
08 bis 11 Vergleichsergebnisse: Bits für die Ausgänge 1 bis 4
Das Ergebnis einer OR–Verknüpfung der Bits an den gleichen Bitpositionen der
Schnellen Zähler 1 bis 4 wird ausgegeben.
12 Zähler–Betriebsmerker (0: beendet; 1: aktiv)
13 Vergleichsmerker (0: beendet; 1: aktiv)
14 Istwert–Über–/Unterlaufmerker (0: nein; 1: ja)
15 Sollwert–Fehlermerker (0: Normal; 1: Fehler)
Anwendungsverfahren für Schnelle Zähler
2-1Abschnitt
Bestimmen Sie die Zählrate, den Eingangsmodus, das Rücksetzverfahren, den
nummerischen Bereichsmodus, das Format, in dem der Istwert des Schnellen Zählers gespeichert wird, und das Ausgabeverfahren.
Spezifizieren Sie den Eingangsspannungsbereich
(Schalter auf dem Modul).
Setzen Sie das Modul ein und
verdrahten Sie die Eingänge.
SPS–Konfiguration
(Steckplatz 1: DM 6602, DM 6640, DM 6641
Steckplatz 2: DM 6611, DM 6643, DM 6644)
Zählrate: 50 kHz/500 kHz
Eingangsmodi:
Differential–Phasenmodus; Impuls–/Richtungsmodus; Aufwärts/Abwärts–Betriebsart
Rücksetzverfahren: Phase Z + Software–Rücksetzung; Software–
Rücksetzung
Nummerische Bereichsmodi: Ring– oder Linearzählermodus
Format, in dem der Istwert des Schnellen Zählers gespeichert wird:
8-stellig BCD oder 8-stellig hex.
Ausgabeverfahren:
PNP– oder NPN–Transistorausgang
Zählrate: 50 kHz/500 kHz
Eingangsmodi:
Differential–Phasenmodus; Aufwärts/Abwärts–Betriebsart Impuls–/Richtungsmodus
Rücksetzverfahren
Phase Z + Software–Rücksetzung Software–Rücksetzung
Nummerische Bereiche Ring– oder Linearzählermodus
Ausgabeverfahren:
PNP– oder NPN–Transistorausgang
Format, in dem der Istwert des Schnellen Zählers gespeichert wird:
8-stellig BCD 8–stellig hex.
Festlegung der Zählerüberprüfungs– (Vergleichs)–Verfahren und der internen/externen Bitmuster.
Kontaktplanprogramm
Zählerauswertungverfahren: Zielwert oder Bereichsvergleich
Ausgangsbitmuster, wenn Bedingung erfüllt ist:
Interne und externe Ausgangsbits
VERGLEICHSTABELLE SPEICHERN (CTBL(63)):
Schnittstellenangabe; Vergleichstabelle speichern; Vergleich beginnen
MODUSSTEUERUNG (INI(61)):
Schnittstellenangabe; Istwert–Änderung; Vergleich beginnen
SCHNELLEN ZÄHLER–ISTWERT LESEN PRV(62)
Lesen des Istwertes des Schnellen Zählers und des Status des Vergleichs.
73

Schneller Zähler–Funktion
2-1Abschnitt
Schnitt−
stelle 1
(CN1)
Geber−
eingang
Schnitt−
stelle 2
(CN1)
Geber−
eingang
Schnitt−
stelle 1
(CN2)
Geber−
eingang
Schnitt−
stelle 2
(CN2)
Geber−
eingang
Eingangs−
spannung
Eingangs−
spannung
Eingangs−
spannung
Eingangs−
spannung
Zählrate
SPS−Konfiguration
Bits 04 bis 07 oder Bits 12
bis 15 von DM 6640/ DM
6641/ DM 6643/DM 6644
Merker kennzeichnen den Zählerstart/−stop (IR
21212 bis IR 21215 oder AR 0512 bis AR 0515)
und den Zählervergleichsstart/−stop (IR 21308 bis
IR 2131 1 oder AR 0508 bis AR 0511).
Eingangsmodus
Differentialphase
Auf−/Abwärtsimpuls
Impuls/Richtung
SPS−Konfiguration
Bits 00 bis 03 oder Bits 08
bis 11 von
DM 6640/ DM 6641/
DM 6643/DM 6644
Steckpl. 1
Schnittst. 1: IR 201 und IR 200
Schnittst. 2: IR 203 und IR 202
Schnittst. 3: IR 205 und IR 204
Schnittst. 4: IR 207 und IR 206
Kontaktplan–Programm
VERGLEICHSTABELLE SPEICHERN
Tabelle speichern
Vergleich beginnen
MODUSSTEUERUNG
Istwert ändernVergleich
beginnen/beenden
RücksetzVerfahren
Phase Z + Software
Nur Software
SPS−Konfiguration
Bits 04 bis 07 oder Bits 12 bis
15 von DM 6640/ DM 6641/
DM 6643/DM 6644
Jeden Zyklus
Steckpl. 2
Schnittst. 1: IR 233 und IR 232
Schnittst. 2: IR 235 und IR 234
Schnittst. 3: IR 237 und IR 236
Schnittst. 4: IR 239 und IR 238
Zählerüberprüfung
(Vergleich)
Bits 00 bis 11
von IR 208 bis
IR 211 oder
IR 240 bis
IR 243
Transistorausgänge
PNP/NPN
Nummerischer Bereich
Ringzählermodus
Linearzählermodus
SPS−Konfiguration
Bits 04 bis 07 oder Bits 12 bis
15 von DM 6640/ DM 6641/
DM 6643/DM 6644
SPS−Konfiguration
Bits 00 bis 03
von DM 6611
SCHNELLER ZÄHLER− ISTWERT LESEN
Gespeichertes Bitmuster
Extern Intern
Istwert des Zählers
Data werden im 8stelligen
hexadezimal oder 8stellig.
BCD−Format gespeichert.
Istwert−
Vergleichsstatus
SPS−Konfiguration
Bit 08 bis 11 von DM
6602/DM 6611
Zählen
Bei jeder
Ausführung
74

Vorläufige SPS–Konfigurationseinstellungen
Nehmen Sie für die Anwendung der Schnellen Zähler 1 bis 4 die folgenden
Einstellungen in der PROGRAM–Betriebsart vor.
Datenformat und PNP/NPN–Einstellungen der Ausgänge
2-1Abschnitt
Steckpl. 1: DM 6602
Steckpl. 2: DM 6611
Ausgänge 1 bis 4, Transistorauswahl
0 hex: PNP
1 hex: NPN
Istwert–Datenformat der Schnellen Zähler 1 bis 4
0 hex: 8-stellig hex. (BIN)
1 hex: 8-stellig BCD
Vorgabe: 0000 (8-stellig hex und PNP)
Eingangsmodus, Zählfrequenz, nummerischer Bereichsmodus und Zähler–Rücksetzverfahren
Schneller Zähler 1
Steckpl. 1: Bits 00 bis 07 von DM 6640 Steckpl 2: Bits 00 bis 07 von DM 6643
Schneller Zähler 2
Steckpl. 1: Bits 08 bis 15 von DM 6640 Steckpl. 2: Bits 08 bis 15 von DM 6643
Schneller Zähler 3
Steckpl. 1: Bits 00 bis 07 von DM 6641 Steckpl. 2: Bits 00 bis 07 von DM 6644
Schneller Zähler 4
Steckpl. 1: Bits 08 bis 15 von DM 6641 Steckpl. 2: Bits 08 bis 15 von DM 6644
DM 6640, DM 6641,
DM 6643, DM 6644
Zählfrequenz, nummerischer Bereich–Modus und Zähler–
Rücksetzverfahren (sehen Sie die nachfolgende Tabelle)
Schneller Zähler–Eingangsmodus
0 hex: 1x Differential–Phaseneingang
1 hex: 2x Differential–Phaseneingang
2 hex: 4x Differential–Phaseneingang
3 hex: Auf–/Abwärts–Impulseingang
4 hex.: Impuls–/Richtungseingang
Vorgabe: 0000 (1x Differential–Phaseneingang, 50 kHz, Linearzählermodus, Phase Z + Software–
Rücksetzung)
DM 6602
DM 6611
Bit
15 0
00
Bit
15 0
Zählfrequenzen,
Nummerischer
Bereich–Modus und
Rücksetzverfahren
Anwendung
Wert Zählfrequenz Nummerischer
0 hex
1 hex Nur Software–
2 hex
3 hex Nur Software–
4 hex
5 hex Nur Software–
6 hex
7 hex Nur Software–
50 kHz Linearzählermodus
500 kHz Linearzählermodus
Bereichsmodus
Ringzählermodus
Ringzählermodus
Zählerrückstell–
verfahren
Phase Z + Software–
Rücksetzung
Rücksetzung
Phase Z + Software–
Rücksetzung
Rücksetzung
Phase Z + Software–
Rücksetzung
Rücksetzung
Phase Z + Software–
Rücksetzung
Rücksetzung
Schnelle Zähler werden wie folgt programmiert:
• Der Zählvorgang beginnt, sobald gültige Einstellungen vorhanden sind.
• Der Istwert wird auf Null zurückgesetzt, wenn die Versorgungsspannung
eingeschaltet und die Programmausführung gestartet oder gestoppt wird.
75

• Der Zählvorgang alleine löst nicht den Vergleichsvorgang mit der
Sc e e ä e
Sc e e ä e
Vergleichstabelle aus.
• Der Istwert kann über die in der folgenden Tabelle aufgeführten Worte
überwacht werden.
2-1Abschnitt
Beginn des Vergleichsvorgangs
Schneller Zähler
Steckplatz 1 Steckplatz 2
Schneller Zähler 1 IR 200, IR 201 IR 232, IR 233
Schneller Zähler 2 IR 202, IR 203 IR 234, IR 235
Schneller Zähler 3 IR 204, IR 205 IR 236, IR 237
Schneller Zähler 4 IR 206, IR 207 IR 238, IR 239
Wort
Die Vergleichstabelle wird in der CQM1H gespeichert und der Vergleich
selbst mit CTBL(63) begonnen. Der Vergleich kann ebenfalls über die
entsprechenden Steuerbits (IR 21208 bis IR 21211 für Steckplatz 1; AR 0508
bis AR 0511 für Steckplatz 2) erfolgen.
Beginnen des Vergleichs mit CTBL(63)
(@)CTBL(63)
Schneller Zähler
Schneller Zähler 1 101 001
Schneller Zähler 2 102 002
Schneller Zähler 3 103 003
Schneller Zähler 4 104 004
P: Schnittstelle
C: Modus
P
000: Speichern der Zielwerttabelle und Beginnen des Vergleichs
C
001: Speichern der Bereichstabelle und Beginnen des Vergleichs
TB
002: Nur Speichern der Zielwerttabelle
003: Nur Speichern der Bereichvergleichstabelle
TB: Erstes Wort der Vergleichstabelle
In P spezifizierter Wert
Steckplatz 1 Steckplatz 2
Wird C auf 000 eingestellt, wird eine Zielwert–Vergleichstabelle gespeichert;
wird 001 eingestellt, wird eine Bereichvergleichstabelle gespeichert. Der
Vergleich beginnt nach dem Abschluss der Speicherung. Während der
Ausführung des Vergleichs wird, wie durch die Vergleichstabelle vorgegeben,
ein Bitmuster in den internen Bits und externen Ausgangsbits gespeichert.
Sehen Sie die Beschreibung von CTBL(63) für Einzelheiten bezüglich der
Vergleichstabellenspeicherung.
Hinweis Bei der Einstellung von C auf 002 (Speichern einer Zielwert–Vergleichsta-
belle) oder auf 003 (Speichern einer Bereich–Vergleichstabelle) wird der Vergleich nicht automatisch begonnen. Hierfür muss eine Steuerbit oder INI(61)
verwendet werden.
Starten des Vergleichs mit Steuerbits
Der Vergleichsvorgang wird gestartet, wenn das dem Schnellen Zähler
entsprechende Bit in IR 21208 bis IR 21211 für Steckplatz 1 oder in AR 0508
bis AR 0511 für Steckplatz 2 auf EIN gesetzt wird. Zuvor musste jedoch eine
Vergleichstabelle gespeichert worden sein. Vergleiche können nicht in der
PROGRAM–Betriebsart stattfinden.
Hinweis Das Schnelle Zähler–Modul gibt die Ergebnisse der Vergleiche als Bitmuster
an entsprechende Bits im Speicher aus; das Modul löst keine Interrupt–Unterprogramme aus. Bitmuster werden an interne und externe Bits ausgegeben; der Status der externen Bits wird anschließend an die Ausgänge 1 bis 4
ausgegeben.
Abbrechen des Vergleichsvorganges
Führen Sie, um einen Vergleichsvorgang abzubrechen, INI(61) wie
nachfolgend dargestellt aus. Der Abbruch des Vergleichs kann auch über
Steuerbits erfolgen.
76

Abbrechen des Vergleichs mit INI(61)
Sc e e ä e
(@)INI(61)
001
000
P
P: Schnittstelle
2-1Abschnitt
Lesen des Istwertes
Schneller Zähler
Steckplatz 1 Steckplatz 2
Schneller Zähler 1 101 001
Schneller Zähler 2 102 002
Schneller Zähler 3 103 003
Schneller Zähler 4 104 004
In P eingestellter Wert
Abbrechen des Vergleichs mit Steuerbits
Der Vergleichsvorgang wird abgebrochen, wenn das dem Schnellen Zähler
entsprechende Bit in IR 21208 bis IR 21211 für Steckplatz 1 oder in AR 0508
bis AR 0511 für Steckplatz 2 auf AUS gesetzt wird.
Hinweis 1. Führen Sie entweder INI(61) mit der Schnittstellennummer als ersten
Operanden und 000 (Vergleich ausführen) als zweiten Operanden aus
oder ändern Sie den Status der Steuerbits von 0 auf 1.
2. Nachem eine Tabelle gespeichert wurde, bleibt sie in der CQM1H
während des gesamten Vorgangs (d.h., während der
Programmausführung) gespeichert, bis eine neue Tabelle gespeichert
wird.
Die folgenden zwei Verfahren stehen zum Lesen des Istwertes der Schnellen
Zähler 1 bis 4 zur Verfügung:
• Lesen der Istwertworte im Speicher
• Durch PRV(62)
Lesen der Istwertworte im Speicher
Die Istwerte der Schnellen Zähler 1 bis 4 werden folgendermaßen
gespeichert. Das Format in dem die Istwertdaten gespeichert werden, wird
durch Einstellungen der Bits 00 bis 03 von DM 6602 für Steckplatz 1 und
DM 6611 für Steckplatz 2 festgelegt. Die Vorgabeeinstellung ist 8-stellig hex.
Steckplatz 1:
Schnitt–
stelle 1
Schnitt–
stelle 2
Schnitt–
stelle 3
Schnitt–
stelle 4
Steckplatz 2:
Schnitt–
stelle 1
Schnitt–
stelle 2
Schnitt–
stelle 3
Schnitt–
stelle 4
Linken vier Stellen Rechten vier Stellen
IR 201
IR 203
IR 205
IR 207
Linken vier Stellen
IR 233
IR 235
IR 237
IR 239
IR 200
IR 202
IR 204
IR 206
Rechten vier Stellen
IR 232
IR 234
IR 236
IR 238
8-stellig hex: F8000000 bis 07FFFFFF 00000000 bis 07FFFFFF
8-stellig BCD: F8388608 bis 08388607 00000000 bis 08388607
8-stellig hex: F8000000 bis 07FFFFFF 00000000 bis 07FFFFFF
8-stellig BCD: F8388608 bis 08388607 00000000 bis 08388607
(Bei einem negativen Wert enthält die linke Stelle F.)
Hinweis Diese Worte werden nur einmal pro Programmabarbeitungszyklus aufge-
frischt. Daher besteht möglicherweise ein Unterschied zu dem tatsächlichen
Istwert.
Linearzählermodus
(Bei einem negativen Wert enthält die linke Stelle F.)
Linearzählermodus Ringzählermodus
Ringzählermodus
77

Durch PRV(62)
Sc e e ä e
Sc e e ä e
PRV(62) kann auch zum Lesen der Istwerte der Schnellen Zähler 1 bis 4
verwendet werden.
(@)PRV(62)
P
P: Schnittstelle
C
C: 000
D
D: Erstes Zielwort
2-1Abschnitt
Ändern des Istwertes
Schneller Zähler Nr.
Steckplatz 1 Steckplatz 2
Schneller Zähler 1 101 001
Schneller Zähler 2 102 002
Schneller Zähler 3 103 003
Schneller Zähler 4 104 004
In P spezifizierter Wert
Die Istwerte der Schnellen Zähler 1 bis 4 werden folgendermaßen
gespeichert.
Llinken vier
Stellen
D + 1
Rechten vier
Stellen
D 8-stellig hex: F8000000 bis 07FFFFFF hex
Linearzählermodus Ringzählermodus
8–stellig BCD: F8388608 bis 08388607 BCD
(Bei einem negativen Wert enthält die linke Stelle F.)
00000000 bis 07FFFFFF hex
00000000 bis 08388607 BCD
Hinweis PRV(62) liest den gegenwärtigen Istwert, wenn der Befehl ausgeführt wird.
Die folgenden zwei Verfahren stehen zum Ändern des Istwertes der
Schnellen Zähler 1 bis 4 zur Verfügung:
• Das Zurücksetzen des Zählers (d.h. Zurücksetzen des Zählers auf 0) kann
über eines der Rücksetzverfahren erfolgen.
• Verwendung von INI(61)
Nachfolgend wird die Verwendung von INI(61) beschrieben. Sehen Sie
Rücksetzverfahren
auf Seite 68 für eine Beschreibung der Anwendung
dieser Rücksetzverfahren.
Ändern des Istwertes über INI(61)
INI(61) wird verwendet, um den Istwert der Schnellen Zähler 1 bis 4 zu
ändern.
78
(@)INI(61)
P: Schnittstellendefinition
P
C
C: 002
P1
P1: Erstes Istwertwort
Schneller Zähler Nr.
Steckplatz 1 Steckplatz 2
Schneller Zähler 1 101 001
Schneller Zähler 2 102 002
Schneller Zähler 3 103 003
Schneller Zähler 4 104 004
Linken vier
Stellen
P1 + 1
Rechten vier
Stellen
P1 F8000000 bis 07FFFFFF hex
Ringzählermodus Ringzählermodus
F8388608 bis 08388607 BCD
(Bei einem negativen Wert enthält die linke Stelle F.)
In P spezifizierter Wert
00000000 bis 07FFFFFF hex
00000000 bis 08388607 BCD
Hinweis Nach dem Vergleich des letzten Zielwertes in einer Zielwerttabelle kehrt der
Vergleichsvorgang automatisch zum ersten Zielwert in der Tabelle zurück.
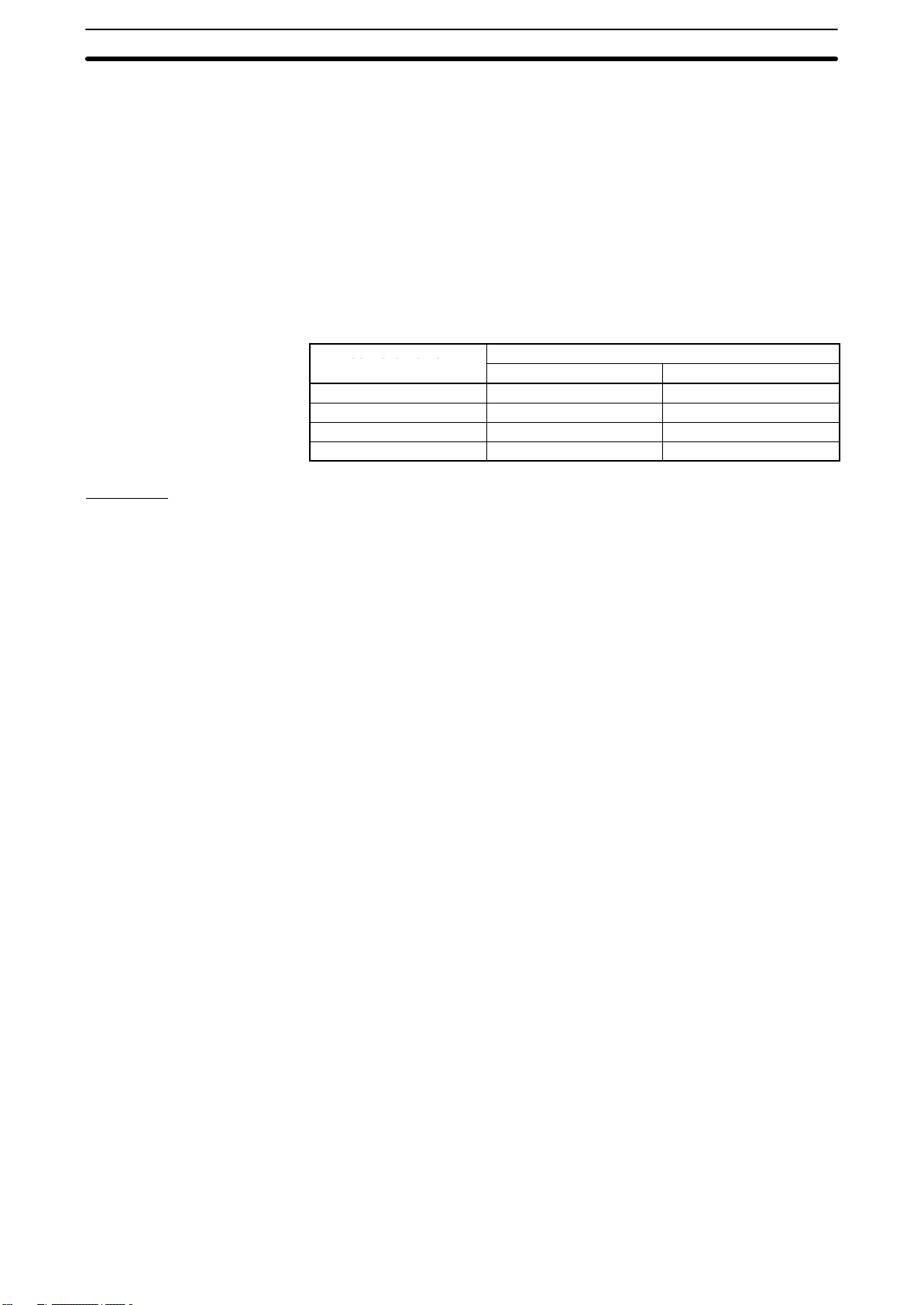
2-1Abschnitt
Sc e e ä e
Daher kann nach Abschluss einer Vergleichssequenz der Vorgang durch Initialisierung des Istwertes wieder neu eingeleitet werden.
Beenden und Neustarten
des Zählvorgangs
Hinweis Der Zähler aktiv–Merker kann verwendet werden, um festzustellen, ob der
Beispiele
Ein Zählvorgang eines der vier Schnellen Zähler kann durch Setzen eines
Steuerbits auf EIN beendet werden. Der Istwert des Zählers wird
beibehalten.
Der Zählvorgang kann durch Setzen eines der Bits 12 bis 15 von IR 212 für
Steckplatz 1 oder von AR 05 für Steckplatz 2 beendet werden. Diese Bits
entsprechen den Schnellen Zählern 1 bis 4. Setzen Sie diese Bits auf AUS,
um den Zählvorgang neu zu starten. Die Schnellen Zähler setzen den
Zählvorgang mit dem Wert fort, der anlag als diese gestoppt wurden.
Zählvorgang aktiv oder beendet ist (0: beendet; 1: aktiv)
Schneller Zähler
Steckplatz 1 Steckplatz 2
Schneller Zähler 1 IR 20812 IR 24012
Schneller Zähler 2 IR 20912 IR 24112
Schneller Zähler 3 IR 21012 IR 24212
Schneller Zähler 4 IR 21112 IR 24312
Zähler aktiv–Merker
In den folgenden Beispielen sind verschiedene Anwendungen des Schnellen
Zählers 1 eines Schnellen Zähler–Moduls, das sich auf Steckplatz 2 befindet,
aufgeführt. Es wird ein Zielwertvergleich durchgeführt, um im Speicher
abgelegte Bits der internen und externen Bitmustern entsprechend dem
Istwert des Zählwertes auf EIN zu setzen. Der Status dieser internen Bits
wird verwendet, um die Frequenz eines Impulsausgangs zu steuern.
Das Rücksetzbit bleibt im Programm auf EIN gesetzt, damit der Istwert des
Zählers durch das Phase Z–Signal zurückgesetzt wird, nachdem der letzte
Zielwert erreicht wurde.
Vor der Ausführung des Programms sollte die SPS–Konfiguration wie
nachfolgend gezeigt eingestellt werden und die CQM1H neu gestartet
werden, um die neuen Einstellungen in DM 6611 zu aktivieren.
DM 6611: 0001 (PNP–Ausgänge für die Ausgänge 1 bis 4, 8-stelliges
BCD–Format für die Istwert–Speicherung der Schnellen Zähler 1 bis 4)
DM 6643: 0003 (Schneller Zähler 1: Zählfrequenz 50 kHz;
Linearzählermodus; Z–Phasensignal + Software–Rücksetzung;
Aufwärts–/Abwärts–Betriebsart).
Erreicht der Istwert 2500, wird IR 05000 eingeschaltet und somit der
Ausgang 1.
Erreicht der Istwert 7500, wird IR 05001 eingeschaltet und somit der
Ausgang 2.
79
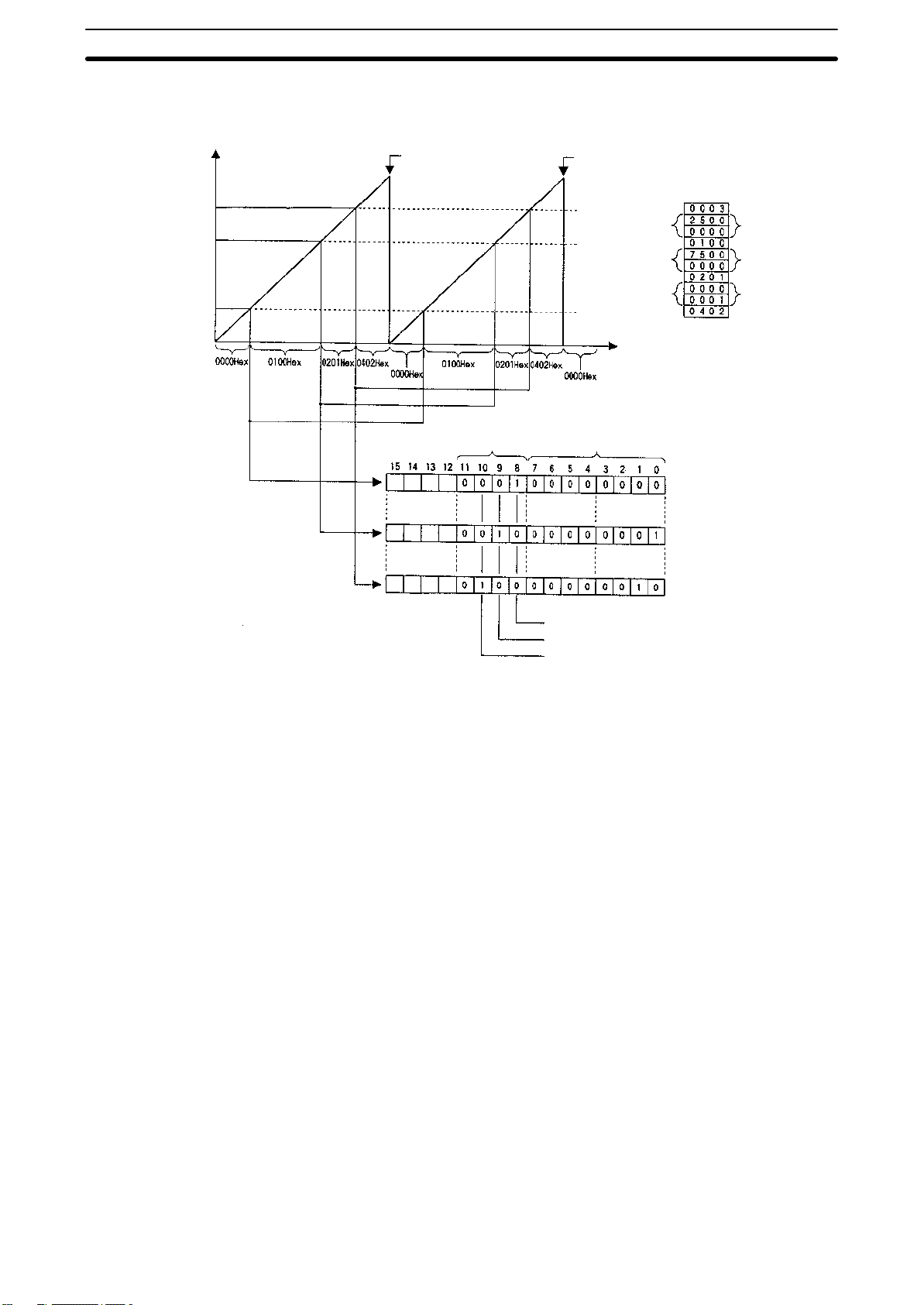
Zielwert 3: 10000
Zielwert 2: 7500
Zielwert 1: 2500
Zähler–Istwert
Erreicht der Istwert 10000, wird IR 05002 eingeschaltet und somit der
Ausgang 3.
Der Istwert wird beim
Phase Z–Signal zurückgesetzt
Der Istwert wird beim
Phase Z–Signal zurückgesetzt
Zielwert 1
Zielwert 2
Zielwert 3
Drei Vergleichszustände
2500
Bitmuster 1
7500
Bitmuster 2
10000
Bitmuster 3
2-1Abschnitt
IR 240
Inhalt von IR 240
Zeit
Muster der externen Bits Muster der internen Bits
0100 Hex: Ausgang 1 EIN
IR 05000 EIN
0201 Hex: Ausgang 2 EIN
IR 05001 EIN
0402 Hex: Ausgang 3 EIN
IR 05002 EIN
Ausgang 1
Ausgang 2
Ausgang 3
80
 Loading...
Loading...