Page 1
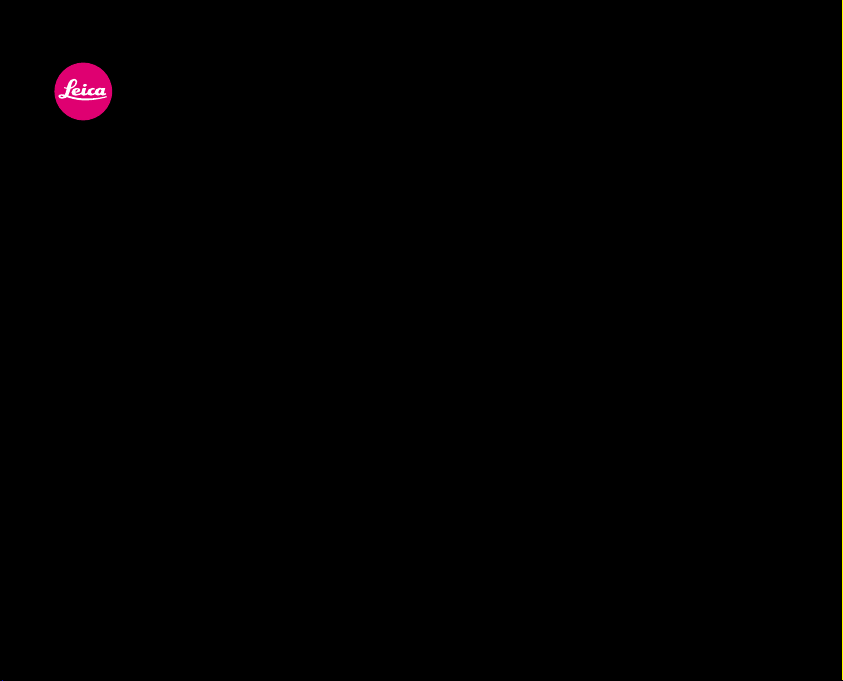
LEICA R9
Bedienungsanleitung / Instructions
Page 2
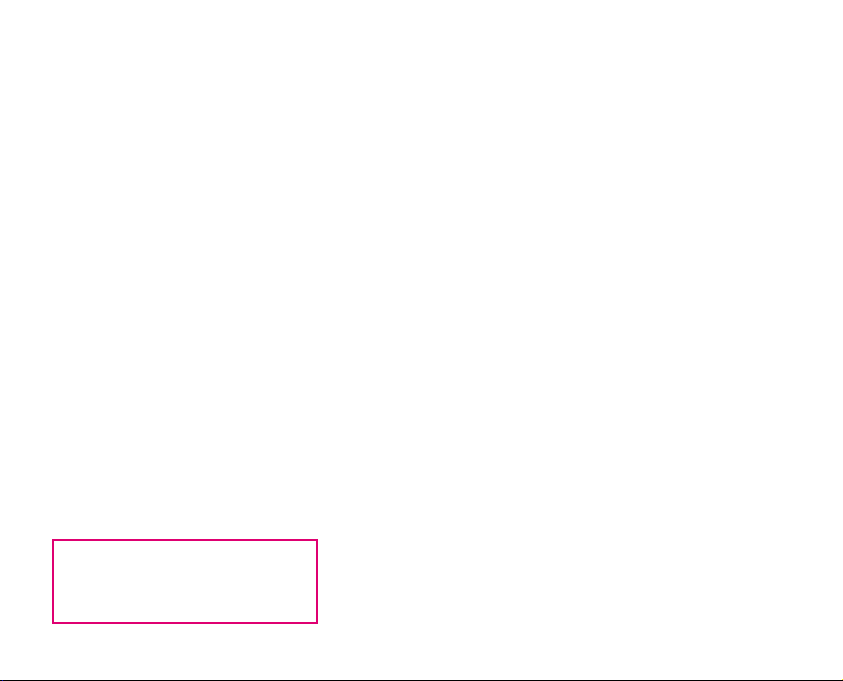
English Instructions pages
102 - 203
Page 3

1.1
1.3
1.4
1.5
1.2
1.4
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15 b
1.15 a
1.16
1.17
1.18
1.19
1.20
1.211.221.231.24
Page 4

1.31
1.25
1.26a
1.26b
1.27
1.28 1.29 1.30
1.32
1.34 1.33
1.2
1.37 1.38 1.381.39 1.40 1.41 1.42 1.43
1.35 1.36
Page 5

1.45
1.44
1.46
1.47
1.48 1.49
1.50
1.51
1.53
1.52
1.54
Page 6

Die CE-Kennzeichnung unserer Produkte dokumentiert die Einhaltung der grundlegenden Anforderungen der jeweils gültigen EU-Richtlinien.
Warnhinweis
Moderne Elektronikbauelemente reagieren empfindlich auf elektrostatische Entladung.
Da sich Menschen z.B. beim Laufen über synthetischen Teppichboden leicht auf mehrere 10.000 Volt
aufladen können, kann es beim Berühren Ihrer LEICA insbesondere dann, wenn sie auf einer leitfähigen Unterlage liegt, zu einer Entladung kommen. Betrifft sie nur das Kameragehäuse, ist diese Entladung für die Elektronik völlig ungefährlich. Die nach außen geführten Kontakte, wie Batterie- oder
Rückwandkontakte, sollten allerdings - trotz eingebauter zusätzlicher Schutzschaltungen - aus Sicherheitsgründen möglichst nicht berührt werden.
Benutzen Sie bitte für eine eventuelle Reinigung der Kontakte nicht ein Optik-Mikrofasertuch (Synthetik), sondern ein Baumwoll- oder Leinentuch! Wenn Sie vorher bewusst an ein Heizungs- oder Wasserrohr (leitfähiges, mit "Erde" verbundenes Material) fassen, wird Ihre eventuelle elektrostatische
Ladung mit Sicherheit abgebaut.
Vermeiden Sie bitte Verschmutzung und Oxidation der Kontakte auch durch trockene Lagerung Ihrer
LEICA im geschlossenen Zustand!
Page 7

1
Vorwort
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
Leica möchte sich bei Ihnen für den Erwerb der
LEICA R9 bedanken und Sie zu Ihrer Entscheidung beglückwünschen. Sie haben mit dieser
einzigartigen Spiegelreflex-Kamera eine hervorragende Wahl getroffen.
Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim
Fotografieren mit Ihrer neuen LEICA R9.
Eine Vielzahl von Automatikfunktionen und die
manuellen Einstellmöglichkeiten bieten Ihnen ein
unbeschwertes Fotografieren und zugleich alle
Freiheiten der kreativen Bildgestaltung. Hochwertige Präzisionsmechanik und Elektronik sorgen für Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer.
Die Kamera wird ergänzt durch ein sinnvoll abgestimmtes Zubehörprogramm, so dass Sie Ihre
fotografischen Wünsche durch eine optimale
Ausrüstung realisieren können.
Die Bedienung der LEICA R9 ist praxisgerecht
ausgelegt, logisch und übersichtlich gestaltet.
Trotzdem sollten Sie zunächst sorgfältig diese
Anleitung lesen, um alle fotografischen Möglichkeiten Ihrer neuen LEICA R9 optimal nutzen zu
können.
Page 8
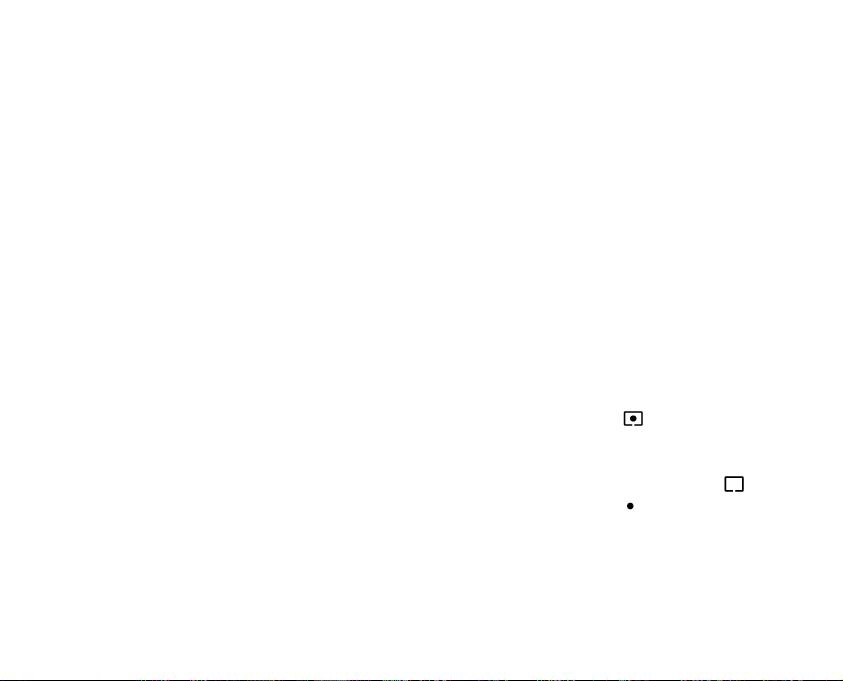
2
Inhaltsverzeichnis
CE-Warnhinweis................................................u4
Vorwort...............................................................1
Befestigen des Tragriemens................................5
Bezeichnung der Teile.........................................6
Die Anzeigen im Sucher......................................8
Die Anzeigen im Rückwand-Display ..................10
- Einschalten der Display-Beleuchtung ..............11
Die Stromversorgung / Einsetzen und
Auswechseln der Batterien ...............................12
- Automatische Batteriekontrolle ......................13
- Hinweise zur Batteriebenutzung .....................13
Einstellen des Okulars ......................................14
- Der Okularverschluss......................................15
- Wechseln der Augenmuschel..........................15
Einstellen der Schärfe mit der
Universalscheibe...............................................16
Das Belichtungsbetriebsarten-Wählrad.............17
Das Verschlusszeiten-Einstellrad ......................17
Der Auslöser .....................................................18
Der Belichtungsmessmethoden-Wählhebel.......19
Der Schnellspannhebel .....................................19
Filmwechsel......................................................20
- Öffnen der Kamera .........................................20
- Einlegen des Films..........................................20
- Filmrückspulung..............................................21
Einstellen der Filmempfindlichkeit....................23
Ansetzen und Abnehmen des Objektivs ...........25
- Verwendung vorhandener Objektive und
Zubehör ..........................................................26
- Leica R-Objektive............................................26
- LEICAFLEX SL/SL2-Objektive ohne
R-Steuernocken..............................................27
- VISOFLEX-Objektive an der LEICA R9.............27
Richtiges Halten der Kamera ............................28
Einschalten der Kamera / Aktivieren der
Elektronik / - des Belichtungs- Messsystems...29
Die Belichtungsmessung ..................................30
- Die Mehrfeldmessung – ...........................31
- Anpassen des Belichtungsniveaus der
Mehrfeldmessung...........................................32
- Die mittenbetonte Integralmessung – .....34
- Die Selektivmessung – ............................35
- Die Messwertspeicherung ..............................36
- Belichtungskorrekturen ..................................36
- Eingabe und Löschen einer
Belichtungskorrektur ......................................37
- Beispiel für eine Korrektur nach Plus..............38
Page 9
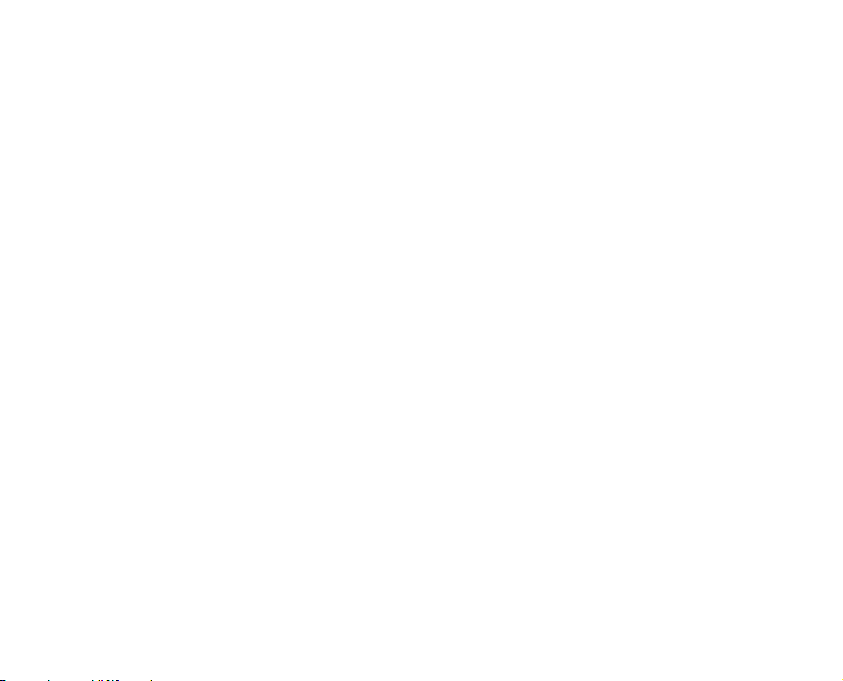
3
- Beispiel für eine Korrektur nach Minus...........38
- Unterschreitung des Messbereichs ................39
- Offenblendenmessung....................................39
- Arbeitsblendenmessung .................................39
- Arbeitsdiagramm des Belichtungsmessers ..40/41
Die Belichtungs-Betriebsarten ..........................42
- Die Variable Programmautomatik – P.............42
- Charakteristik und Anwendung der
variablen Programmautomatik........................44
- Standardeinstellung........................................45
- Wenn eine größere Schärfentiefe und/oder
eine längere Verschlusszeit gewünscht wird...45
- Wenn eine kürzere Verschlusszeit und/oder
eine geringere Schärfentiefe gewünscht wird ...46
- Programmverläufe bei verschiedenen
Verschlusszeit-Einstellungen und mit
verschiedenen Objektiven ..............................47
- Die Zeitautomatik – A .....................................48
- Die Blendenautomatik – T...............................49
- Die manuelle Einstellung von Blende und
Belichtungszeit – m.........................................51
Blitzen mit der LEICA R9...................................52
- Allgemeines zur Verwendung von
Blitzgeräten ....................................................52
- Die Blitzsynchronzeit ......................................52
- Wahl des Synchronzeitpunktes.......................53
- Blitzen über den X-Kontakt.............................55
- Blitzen über die Blitzanschlussbuchse ............55
- Blitzen mit SCA 3000/3002-Standard-Blitzgeräten und SCA 3501/3502M3-Adaptern ...56
- Blitzbereitschafts- und Kontrollanzeigen
(nur mit SCA 3501/3502 M3-Adaptern).........57
- Blitz-Belichtungskorrekturen...........................58
- Einstellung von Blitz-Belichtungskorrekturen
am SCA 3501/3502 M3-Adapter ...................60
- Einstellung von Blitz-Belichtungskorrekturen
an SCA-3002-Standard-Blitzgeräten ...............61
- Einstellung von Blitz-Belichtungskorrekturen
an der Kamera in der
Belichtungs-Betriebsart – m............................61
- Die Blitzsteuerung in den vier
Belichtungs-Betriebsarten mit
SCA 3501/3502 M3-Adapter ..........................61
- Programmautomatik P und TTL-Blitzbetrieb ....61
a) TTL-Vollblitz bei schlechten Lichtverhältnissen..62
b) Automatische Blitzaufhellung bei
normalen Lichtverhältnissen.......................63
c) Keine Blitzauslösung bei sehr großer
Helligkeit.....................................................63
Page 10
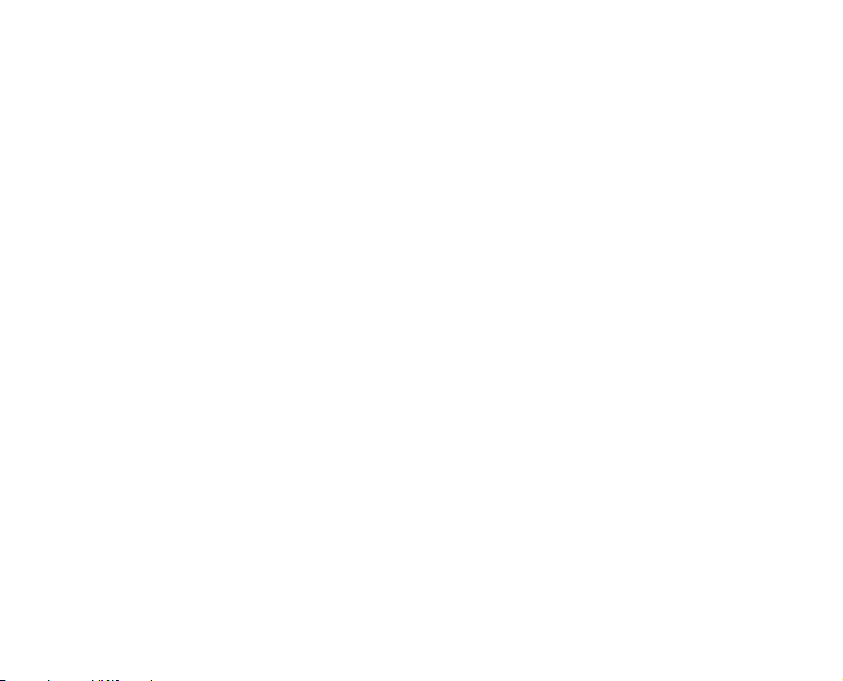
4
- Manuelle Blitz-Belichtungskorrekturen in
der Kamera-Belichtungsbetriebsart P .............64
- Zeitautomatik A und TTL-Blitzbetrieb ..............65
- Blendenautomatik T und TTL-gesteuerte,
variable Blitzaufhellung...................................65
- Manuelle Belichtungssteuerung m und
TTL-gesteuerte, variable Blitzaufhellung..........66
- Blitzen mit der Blitzgeräte-eigenen
Computer-Automatik ......................................66
- Manuelles Blitzen mit konstanter
Blitzleistung ....................................................67
- Zusammenfassende Übersicht zum Blitzen
mit SCA 3501/3502 M3-Adaptern ...........68/69
- Der Linear-Blitzbetrieb....................................70
- Linear-Blitzen mit der Betriebsart M HSS
des Blitzgeräts................................................72
- Linear-Blitzen mit der Betriebsart TTL HSS
des Blitzgeräts................................................73
- Die Bestimmung der Blitzbelichtung ...............74
- Messblitz-Betrieb vor der Aufnahme -
F
..........76
- Stroboskop-Blitzbetrieb mit
SCA 3501/3502 M3-Adapter..........................78
- Warnanzeigen (Fehlercodes) bei Fehl-
einstellungen im Blitzbetrieb...........................80
Der Selbstauslöser............................................81
Spiegelvorauslösung.........................................82
Mehrfachbelichtung..........................................84
Abblendschieber und Schärfentiefe..................85
Tipps zur Werterhaltung Ihrer LEICA R9 und
Objektive ..........................................................86
Stichwortverzeichnis ........................................88
Zubehör zur LEICA R9.......................................90
- Auswechselbare Einstellscheiben...................90
- Große Augenmuschel......................................91
- Korrektionslinsen............................................92
- Winkelsucher..................................................92
- LEICA MOTOR-WINDER R8/R9 ......................93
- LEICA MOTOR-DRIVE R8/R9..........................93
- Taschen ..........................................................94
- Aufnahmefilter................................................94
Technische Daten.............................................95
Leica Akademie ..............................................100
Leica im Internet.............................................100
Leica Infodienst ..............................................101
Leica Kundendienst.........................................101
Page 11
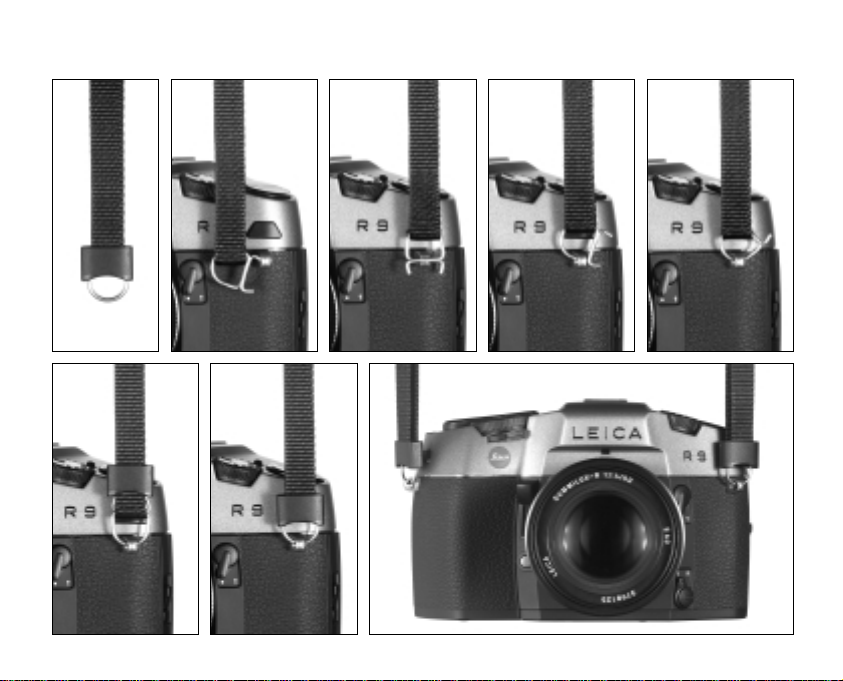
5
Befestigen des Tragriemens
➔
➔
Page 12

6
Bezeichnung der Teile
Vorderansicht
1.1 Objektiv-Entriegelungsknopf
1.2 Batteriefach
1.3 Abblendschieber
1.4 Tragriemenösen
1.5 Selbstauslöser-Leuchtdiode
1.6 Spiegelvorauslöser-Wählhebel
1.7
Wählhebel für den Synchronisierungs-Zeitpunkt (auf den 1. oder 2. Verschlussvorhang)
1.8 Blitzanschlussbuchse
Ansicht von oben
1.9 Rückspulkurbel
1.10 Entriegelungsknopf für Belichtungsbetriebsarten-Wählrad
1.11 Belichtungsbetriebsarten-Wählrad
1.12 Blendenring
1.13 Fester Ring mit Schärfentiefe-Skala und
Indexpunkt für Objektivwechsel
1.14 Entfernungs-Einstellring
1.15 a Belichtungsmessmethoden-Wählhebel
mit
b Entriegelungstaste
1.16 Verschlusszeiten-Einstellrad
1.17 Auslöser
1.18 Gewinde für Drahtauslöser
1.19 Mehrfach-Belichtungshebel
1.20 Rückspul-Entriegelungsknopf
1.21 Schnellspannhebel
1.22 Bildzählwerk
1.23 Mitten- und Steuerkontakte für Blitzbetrieb
1.24 Blitzgeräteschuh
Rückansicht
1.25 Filmpatronen-Sichtfenster
1.26 a Einstellhebel für Belichtungskorrekturen
mit
b Entriegelungsschieber
1.27 Okular-Einstellrad
1.28 Augenmuschel
1.29 Suchereinblick
1.30 Augenmuschel-Entriegelungsschieber
1.31 Okular-Verschlusshebel
1.32 Filmtransport-Kontrollfenster
1.33 Abdeckklappe über den Rückwand-Tasten
1.34 Rückwand-Display
Page 13

7
Ansicht bei geöffneter Abdeckklappe über
den Rückwand-Tasten
1.35 +/- Tastenpaar zur Einstellung der Filmempfindlichkeit, bzw. Wahl der Art der
Einstellung / zur Einstellung einer
Belichtungskorrektur zur NiveauAnpassung der Mehrfeld-Messung
1.36 2 s/12s Tastenpaar zur Einstellung des
Selbstauslösers, bzw. der SelbstauslöserVorlaufzeit / zur Einschaltung der
Rückwand-Displaybeleuchtung.
Ansicht von unten
1.37 Entriegelungsschieber für
Batteriefachdeckel
1.38 Passlöcher für Führungsstifte der
motorischen Antriebe
1.39 Kupplung für motorischen Filmtransport
1.40 Stativgewinde
1.41 Passloch für Verdrehsicherung
1.42 Kupplung für motorische Filmrückspulung
1.43 Steuerungskontakte für ansetzbare
motorische Antriebe
Ansicht von links
1.44 Rückwand-Entriegelungsschieber
1.45 Entriegelungstaste für Rückwand-Entriegelungsschieber
Ansicht bei geöffneter Rückwand
1.46 Filmpatronenkammer
1.47 DX-Kontaktleiste
1.48 Film-Führungsschienen
1.49 Kontaktleisten für Funktionsübertragung
von Rückwand
1.50 Filmtransportwalze
1.51 Filmandruckwelle
1.52 Rote Markierung für Filmanfang
1.53 Filmfang- und Aufwickelspule
1.54 Antriebswelle für Filmtransportanzeige
Page 14

8
Die Anzeigen im Sucher
2.1 Warnsymbol bei Messbereichsunterschreitung
2.2 Hinweis für
a eine Belichtungskorrektur und/oder
b eine vom DX-Wert abweichende,
manuelle Empfindlichkeitseinstellung
2.3 Messmethodensymbol
a = Mehrfeldmessung
b = Mittenbetonte Integralmessung
c = Selektivmessung
Verlöschen nach Druckpunktnahme bei
Selektiv- und Integralmessung =
Messwertspeicherung
2.4 Blitzsymbol
a Blinken = Blitz lädt auf, keine
Blitzbereitschaft
b Leuchten = Blitzbereitschaft
2.5 Plus oder Minus = Hinweis für eingestellte
Blitz-Belichtungskorrektur
2.6 Belichtungs-Betriebsart
a = manuelle Einstellung von
Verschlusszeit und Blende
b = Zeitautomatik
c = variable Programmautomatik
d = Blendenautomatik
e = Messblitz-Betrieb
Blinken von oder = nicht eingestellte kleinste Blende des Objektivs
2.7 Blende,
manuell eingestellter Wert bei und ,
automatisch gesteuerter Wert bei
und ; Anzeige in halben Stufen
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10
Page 15
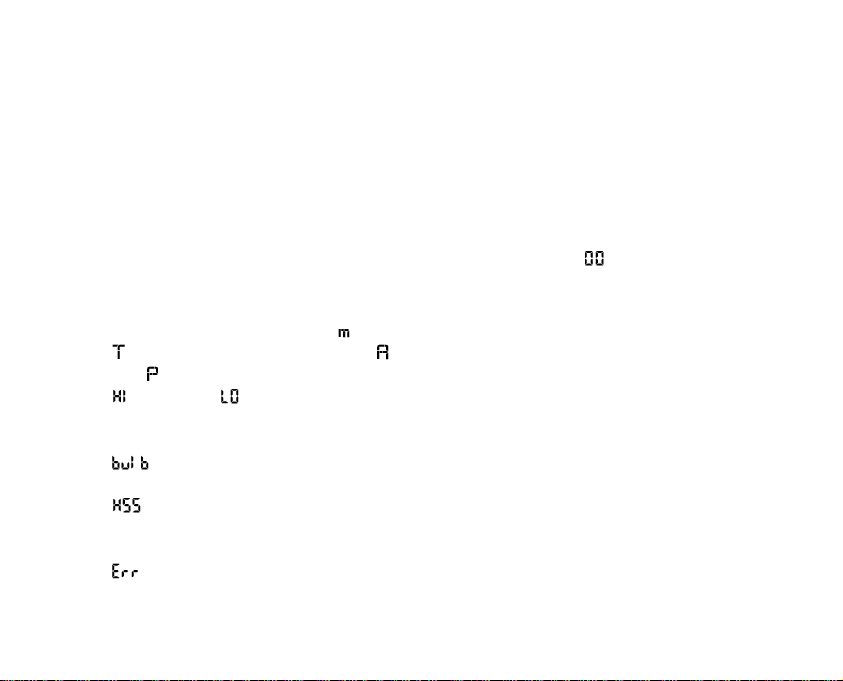
9
2.8 Lichtwaage zur Anzeige von
a manuellen Belichtungsabgleich
(kleine Markierung jeweils
1
/2EV-Stufe,
große Markierung jeweils 1 EV-Stufe)
b Belichtungskorrektur-Einstellung bei den
Automatik-Betriebsarten
c Einstellung der automatischen
Belichtungsreihe (Bracketing, nur
mit Motor-Drive R8/R9 möglich.)
d Belichtungsabgleich beim Messblitzbe-
trieb
2.9 Verschluss (= Belichtungs) -zeit
a manuell eingestellter Wert bei und
,
automatisch gesteuerter Wert bei
und ;
Anzeige in halben Stufen, oder
b (high) oder (low) für Über- oder
Unterbelichtung bei den AutomatikBetriebsarten und durch Blitzlicht,
c =
B
– Einstellung für Langzeit-
belichtung,
d = High Speed Synchronisation für
Linearblitz-Betrieb (abwechselnd mit
dem Zeitwert)
e bei nicht ausführbaren Kamera-
Einstellungen
2.10 Bildzählwerk für
a Anzeige der Bildnummer
b Blinken beider Ziffern = Mehrfachbelichtung
c Blinken der Ziffern in folgender Reihen-
folge: linke / rechte / beide =
erste / zweite / dritte Aufnahme einer
automatischen Belichtungsreihe
(Bracketing, nur mit Motor-Drive R8/R9
möglich.)
d Blinken von = Film nicht richtig ein-
gelegt oder komplett zurückgespult (Nur
bei Verwendung mit Motor-Winder
R8/R9 und Motor-Drive R8/R9.)
Hinweis:
Die Sucher-LCD ist bei bestromter Kamera (siehe
dazu "Einschalten der Kamera / Aktivieren der
Elektronik /- des Belichtungs- Messsystems", S. 29)
grundsätzlich beleuchtet. Die Helligkeit dieser
Beleuchtung wird zwecks optimaler Ablesbarkeit
automatisch der Außenhelligkeit angepasst. So
wird sowohl die Erkennbarkeit der Angaben
gewährleistet – bei großer Außenhelligkeit, wie
auch Überstrahlungen bei knappem Licht vermieden.
Page 16
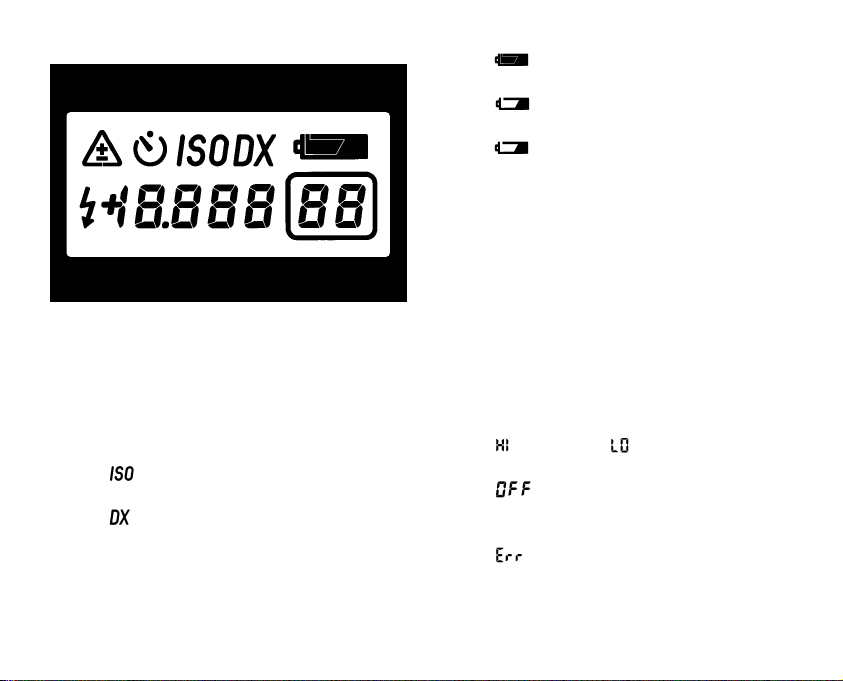
10
Die Anzeigen im Rückwand-Display
3.1 Hinweis für
a eingestellte Belichtungskorrektur
b vom DX-Wert abweichende, manuelle
Empfindlichkeitseinstellung
3.2 Hinweis für Selbstauslöserbetrieb
3.3 Filmempfindlichkeits-Einstellung
a = manuelle Empfindlichkeits-
einstellung
b = automatische DX-Abtastung
3.4 Batterie-Zustandsanzeige
a und andere Anzeigen =
Batteriekapazität ausreichend
b und andere Anzeigen = Batterien
müssen bald ausgewechselt werden
c , keine andere Anzeigen =
Batterien leer, keine Auslösung möglich
3.5 Blitzsymbol
a Blinken = Blitz lädt auf, keine
Blitzbereitschaft
b Leuchten = Blitzbereitschaft
3.6 Plus/Minus- und Ziffernanzeige für
a Belichtungskorrekturwert mit Vorzeichen
b Filmempfindlichkeit
c Belichtungsabgleich beim Messblitz-
Betrieb
d abgelaufene Belichtungszeit bei
B
– Einstellung
e (High) oder (Low) für Über- oder
Unterbelichtung durch Blitzlicht
f für ausgeschalteten Selbstauslöser
(nur kurzzeitig nach Einstellung)
g Selbstauslöser-Restlaufzeit
h bei nicht ausführbaren Kamera-
Einstellungen
3.1 3.2 3.3 3.4
3.5 3.6 3.7
Page 17
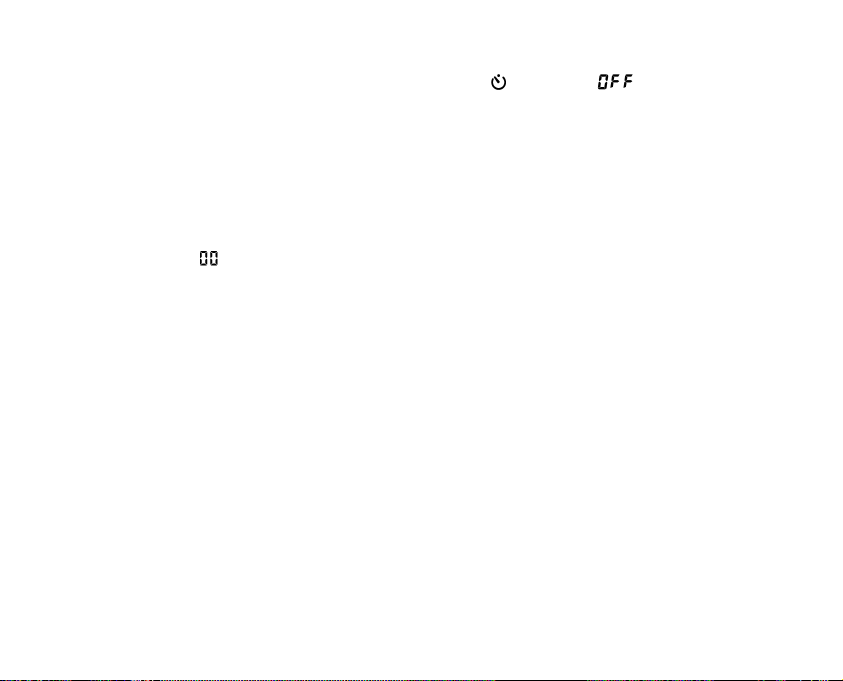
3.7 Bildzählwerk für
a Anzeige der Bildnummer
b Blinken beider Ziffern =
Mehrfachbelichtung
c Blinken der Ziffern in folgender Reihen-
folge: linke / rechte / beide =
erste / zweite / dritte Aufnahme einer
automatischen Belichtungsreihe
(Bracketing, nur mit Motor-Drive R8/R9
möglich.)
d Blinken von = Film nicht richtig ein-
gelegt oder komplett zurückgespult (Nur
bei Verwendung mit Motor-Winder
R8/R9 und Motor-Drive R8/R9.)
Einschalten der Display-Beleuchtung
Das Rückwand-Display der LEICA R9 kann blau
hinterleuchtet werden zwecks optimaler Ablesbarkeit selbst bei Dunkelheit. Zum Einschalten
dieser Beleuchtung werden bei gespannter und
bestromter Kamera (siehe dazu "Der Schnellspannhebel", S.19 und "Einschalten der Kamera /
Aktivieren der Elektronik / - des BelichtungsMesssystems", S. 29) beide Tasten zur Wahl der
Selbstauslöser-Vorlaufzeit (1.36) gleichzeitig kurz
gedrückt. Danach erscheinen im Display kurzfristig (3.2) und (3.6f) – unabhängig
davon, ob bereits eine Selbstauslöser-Vorlaufzeit
eingegeben war oder nicht.
Falls der Selbstauslöser danach verwendet werden soll, muss also die gewünschte Vorlaufzeit
erneut eingegeben werden. Die Beleuchtung wird
anschließend zusammen mit den Anzeigen bei
jedem Bestromen der Kamera durch Antippen
des Auslösers (1.17) eingeschaltet und erlischt
mit ihnen nach Ablauf der Haltezeit. Zum Ausschalten werden die beiden Tasten nochmals
kurz gedrückt.
Jedes Abschalten der Kamera durch Drehen des
Belichtungsbetriebsarten-Wählrades (1.11) in die
OFF – Stellung schaltet die Beleuchtung auf
Dauer aus. Infolgedessen muss sie bei erneuter
Inbetriebnahme der Kamera grundsätzlich wie
oben beschrieben wieder eingeschaltet werden.
11
Page 18
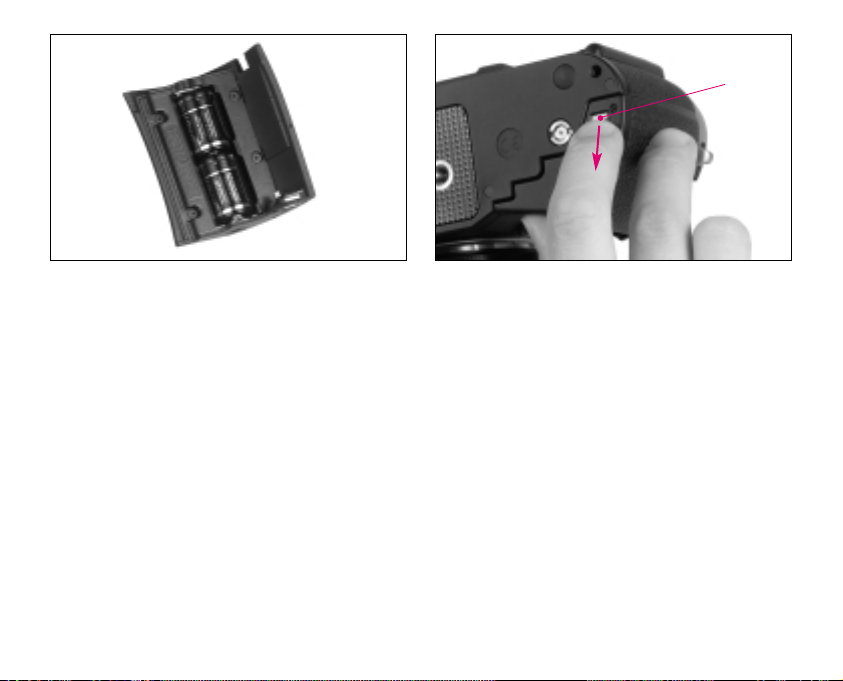
12
Die Stromversorgung / Einsetzen und
Auswechseln der Batterien
Die LEICA R9 benötigt 2 Lithiumzellen des Typs
"CR 2" (Ø 15,6 mm x 27mm), die in einem abnehmbaren Batteriefach (1.2) untergebracht werden, das gleichzeitig als Handgriff dient. Zum
Abnehmen des Batteriefachs wird der Entriegelungsschieber (1.37) auf der Unterseite in Pfeilrichtung gedrückt. Dann kann das Batteriefach
nach unten abgezogen werden.
Wichtig:
Das Belichtungsbetriebsarten-Wählrad (1.11) sollte
vorher auf OFF gestellt werden.
Zum Ansetzen wird das Batteriefach von unten
aufgeschoben. Es muss deutlich einrasten.
Motor-Winder R8/R9 und Motor-Drive R8/R9 sind
jeweils mit eigenem Batteriefach ausgestattet
und werden komplett mit diesem an die Kamera
angesetzt. Das Batteriefach der Kamera ist dazu
vorher abzunehmen.
Hinweis:
Die Kapazitäten der Batterien unterschiedlicher
Hersteller sind sehr verschieden. Angaben über
die Anzahl von Aufnahmen pro Batteriesatz sind
daher nicht machbar.
1.37
Page 19
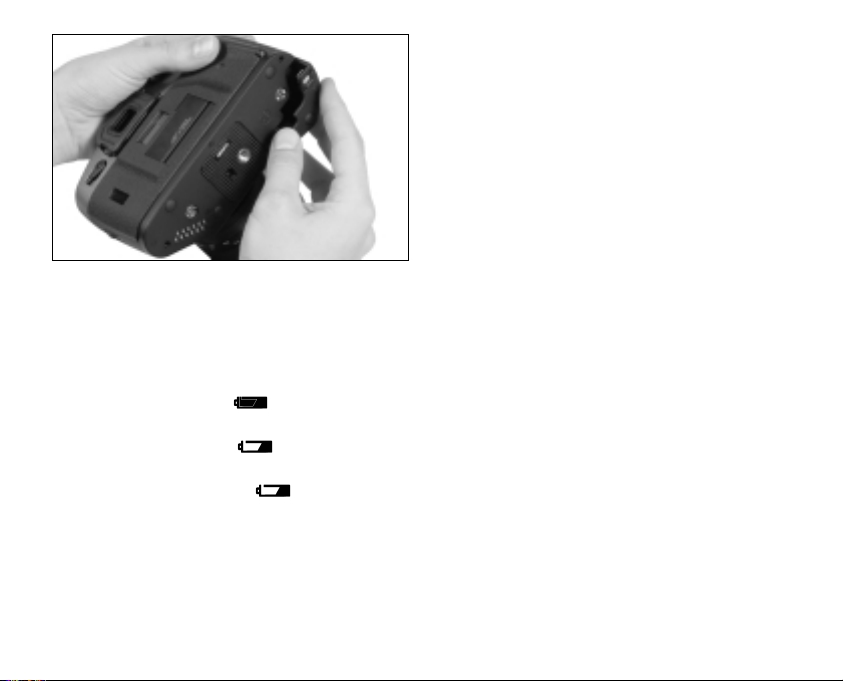
13
Automatische Batteriekontrolle
Die zur Verfügung stehende Batteriekapazität
wird von der Kamera automatisch überwacht und
durch das zweigeteilte Batteriesymbol (3.4) auf
dem Rückwanddisplay (1.34) angezeigt:
• Volles Batteriesymbol ( ) und die normalen
Anzeigen leuchten: Batterien sind in Ordnung.
• Halbes Batteriesymbol ( ) und die normalen
Anzeigen leuchten: Neue Batterien bereithalten!
• Halbes Batteriesymbol ( ) leuchtet, alle
anderen Anzeigen nicht: Batterien sind leer,
keine Auslösung möglich.
Hinweise zur Batteriebenutzung
• Batterien sind kühl und trocken zu lagern.
• Es sollten keine neuen und gebrauchten Batterien zusammen verwendet, oder Batterien verschiedener Fabrikate oder Typen kombiniert
werden.
• Wenn die Kamera längere Zeit nicht benutzt
wird, sollten die Batterien herausgenommen
werden.
• Verbrauchte Batterien bitte nicht in den normalen Abfall werfen (sie enthalten oftmals giftige, umweltbelastende Substanzen), sondern
einer geregelten Entsorgung zuführen.
Page 20
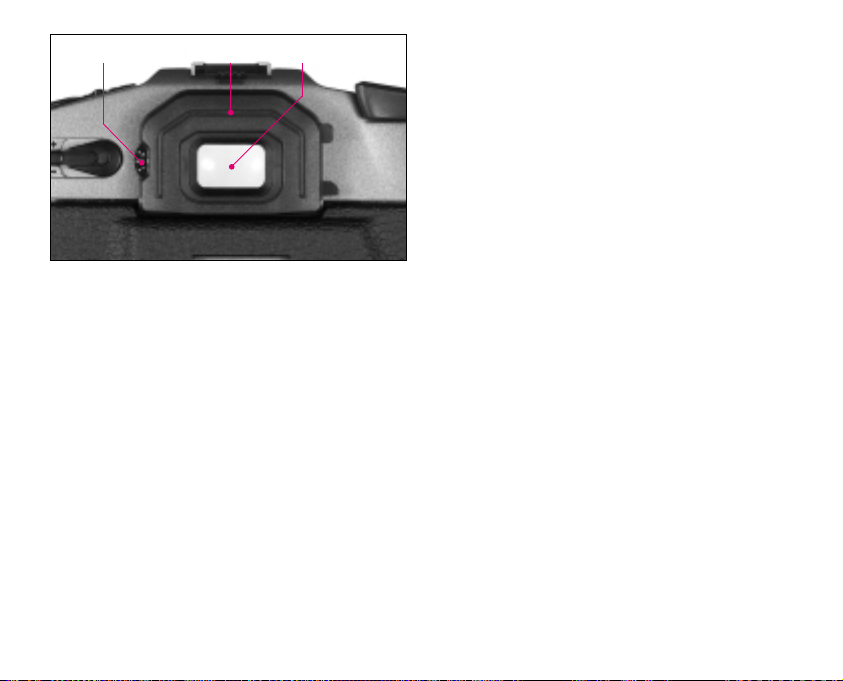
14
Einstellen des Okulars
Um die Möglichkeiten der LEICA R9 und die hohe
Leistung der Leica R-Objektive voll nutzen zu
können, muss das Sucherbild optimal scharf
gesehen werden. Das Okular (1.29) lässt sich
deshalb um ca. ±2 Dioptrien verstellen, um es
auf das eigene Auge exakt abstimmen zu können. Dazu wird das Rädchen (1.27) links neben
dem Okular
1. etwas herausgezogen, um es zu entriegeln, und
2. während der Beobachtung des Sucherbildes
solange gedreht, bis die Begrenzung des
selektiven Messfeldes scharf und kontrastreich gesehen wird.
Hinweis:
Es ist empfehlenswert, die Einstellung ohne
Objektiv vorzunehmen oder das Objektiv auf
kürzeste Entfernung einzustellen und die Kamera
gegen ein gleichmäßig helles Motiv (z.B. Himmel)
zu richten.
3. Nach der Einstellung wird das Rädchen wieder
eingeschoben, um die gewählte Okular-Einstellung zu verriegeln.
Anhand der Markierungen lässt sich eine einmal
gefundene Einstellung immer wieder reproduzieren. Sollte der Bereich der Okularverstellung für
eine optimale Einstellung nicht ausreichen,
stehen zusätzlich Korrektionslinsen (s. Abschnitt
"Korrektionslinsen", S. 92) zur Verfügung.
1.27
1.28 1.29
Page 21
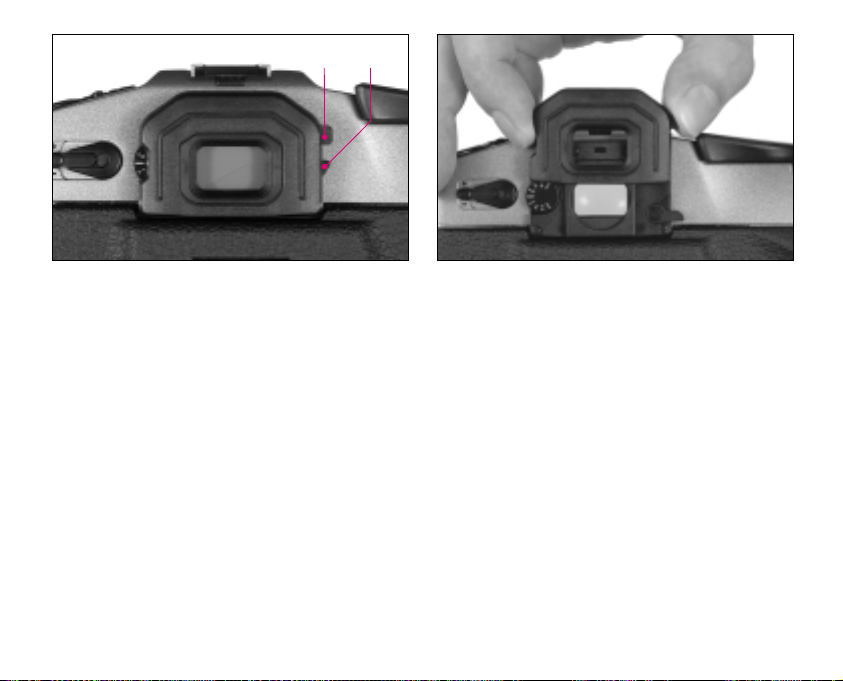
15
Der Okularverschluss
Die Silizium-Fotodioden des Belichtungsmessers
der LEICA R9 befinden sich an lichtgeschützter
Stelle. Deshalb kann durch das Okular einfallendes Licht das Messergebnis nur in extremen Fällen beeinflussen, z.B. wenn der Benutzer bei Aufnahmen vom Stativ nicht durch den Sucher blickt
und von hinten direktes Sonnenlicht oder starkes
Scheinwerferlicht in das Okular treffen. Für
diesen Fall ist rechts vom Sucher der Okularverschlusshebel (1.31), mit dem das Okular verschlossen werden kann. Die eingeschwenkte
Abdeckung ist rot gefärbt.
Wechseln der Augenmuschel
Die serienmäßige Augenmuschel (1.28) der
LEICA R9 kann gegen eine größere ausgewechselt werden, die insbesondere Brillenträger noch
besser gegen störendes Seitenlicht schützt
(siehe "Große Augenmuschel", S. 91).
Zum Abnehmen einer Augenmuschel muss
1. der Entriegelungsschieber (1.30) nach links in
Richtung Okular gedrückt werden, und dann
2. die Augenmuschel gerade nach oben abgezo-
gen werden.
Zum Aufsetzen wird sie gerade von oben in die
Führung des Okulars geschoben, bis sie hörbar
einrastet.
1.311.30
Page 22
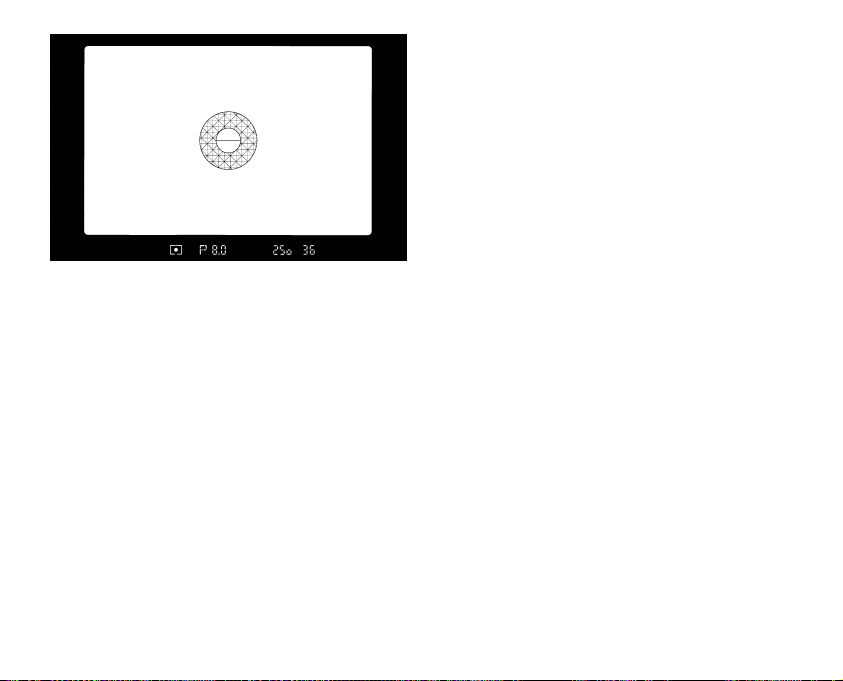
16
Einstellen der Schärfe mit der Universalscheibe
Die LEICA R9 wird serienmäßig mit der Universalscheibe geliefert, die für die häufigsten fotografischen Anwendungsgebiete benutzt werden kann
und drei verschiedene Möglichkeiten zum Scharfeinstellen bietet:
1. Bei nicht exakt eingestellter Schärfe sind im
waagerechten Schnittkeil des Suchers die Kanten und Linien des Objekts gegeneinander verschoben.
2. Um den zentralen Schnittkeil ist ein Ring mit
Prismenraster angeordnet, der zum Scharfeinstellen von konturenschwachen Objekten dient.
Ein deutliches Flimmern zeigt Unschärfe an.
3. Das Umfeld ist mattiert. Es dient zur Beurteilung der Schärfe im ganzen Bildfeld und ist
insbesondere beim Arbeiten mit längeren
Brennweiten und im Makrobereich vorteilhaft.
Als Zubehör stehen weitere Einstellscheiben zur
Verfügung, die je nach Anwendungsgebiet optimale Einstellbedingungen bieten und leicht zu
wechseln sind (s. Abschnitt "Auswechselbare
Einstellscheiben", S. 90).
Page 23
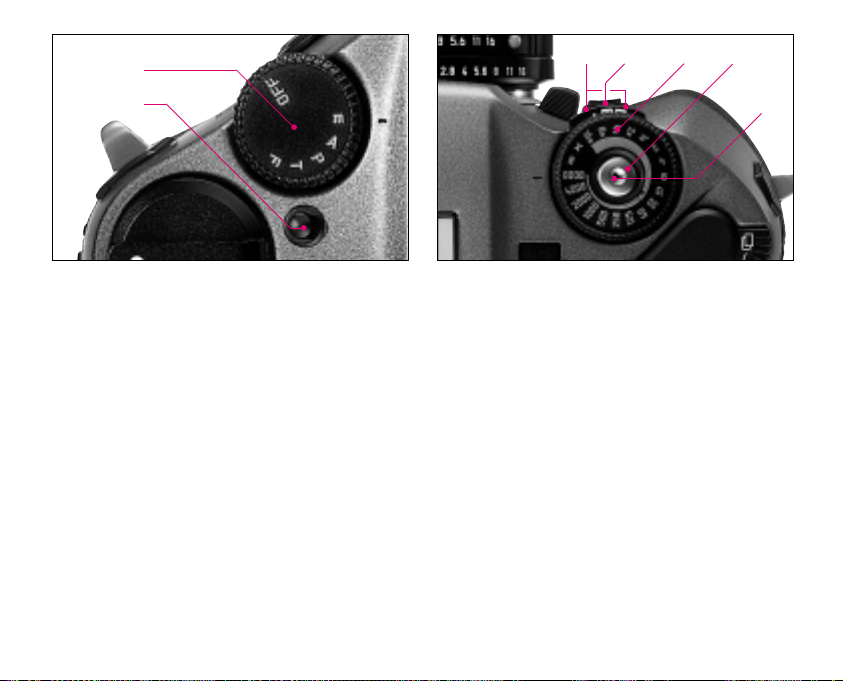
17
Das Belichtungsbetriebsarten-Wählrad
Das Belichtungsbetriebsarten-Wählrad (1.11) der
LEICA R9 dient gleichzeitig als Hauptschalter. Es
besitzt 6 Raststellungen, die zusätzlich gegen versehentliches Verstellen gesichert sind. Zum Verstellen muss immer der Entriegelungsknopf (1.10)
gedrückt werden. Die Positionen im Einzelnen:
OFF In dieser Stellung sind alle Funktionen und
Anzeigen der Kamera abgeschaltet (s. S. 29).
m Manuelle Einstellung von Belichtungszeit
und Blende (s. S. 51).
A Zeitautomatik mit Blendenvorwahl (s. S. 48).
P Variable Programmautomatik (s. S. 42).
T Blendenautomatik mit Zeitvorwahl (s. S. 49).
F
Messblitz-Betrieb vor der Aufnahme
(s. S. 76)
.
Das Verschlusszeiten-Einstellrad
In den Betriebsarten m (manuelles Einstellen von
Verschluss-/Belichtungszeit und Blende) und
T
(Blendenautomatik) wird die Belichtungszeit
manuell mit dem Verschlusszeitenrad (1.16) eingestellt. Es stehen Zeiten von 16s bis 1/8000s
zur Verfügung, wobei auch halbe Zeitstufen eingestellt werden können.
1.10
1.11
1.15a 1.15 b 1.16 1.17
1.18
Page 24
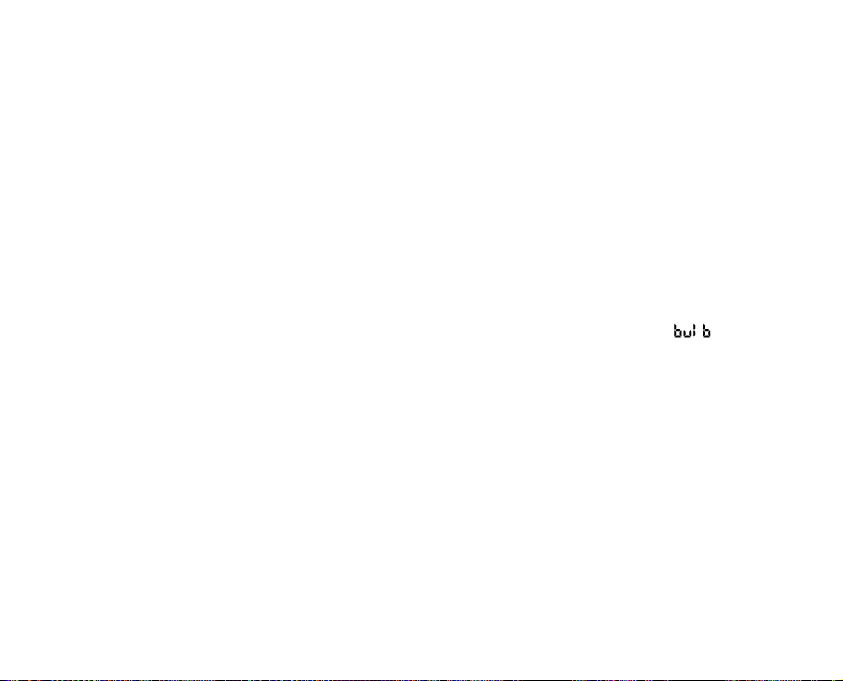
18
In der Betriebsart P (Programmautomatik) bestimmen Sie mit der manuell eingestellten Belichtungszeit den Charakter der entstehenden
Aufnahmen durch Beeinflussung der automatisch
gesteuerten Verschlusszeit-/Blenden-Kombination.
Beim Arbeiten mit A (Zeitautomatik) kann das
Verschlusszeitenrad auf jeden beliebigen Wert
außer B oder X gestellt werden.
Bei der Verwendung von nicht systemkonformen
Blitzgeräten wird die Einstellung X (kürzeste Blitzsynchronzeit = 1/250s) empfohlen.
Langzeitbelichtungen von beliebiger Dauer werden mit der Stellung B ausgeführt.
Der Auslöser
Die LEICA R9 besitzt einen dreistufigen Auslöser (1.17):
1. Ein kurzes Antippen aktiviert das Messsystem
und startet eine evtl. vorgewählte Selbstauslöser-Vorlaufzeit.
2. Durch Niederdrücken bis zum Druckpunkt und
Halten in dieser Stellung wird der Messwert
bei Selektiv- und Integralmessung in den Automatik-Betriebsarten gespeichert.
3. Beim Weiterdrücken löst die Kamera aus.
Steht das Verschlusszeitenrad auf B, bleibt der Verschluss offen, solange der Auslöser gedrückt ist.
Im Sucher erscheint die Anzeige (2.9 c) und
im Rückwanddisplay (1.34) ist die ablaufende
Belichtungszeit (3.6d) ablesbar. Diese Anzeige
arbeitet bis 19 min. 59 s. Wird die Stellung B und
eine zusätzliche Selbstauslöser-Vorlaufzeit gewählt,
öffnet sich der Verschluss erst nach Ablauf des
Selbstauslösers und bleibt solange offen, bis der
Auslöser (oder ein anderes elektrisches Bedienteil
der Kamera) wieder angetippt wird. Da der Auslöseknopf in diesem Fall nicht permanent gedrückt
gehalten werden muss, sind verwacklungsfreie
Langzeitaufnahmen möglich. In der Mitte des Auslösers befindet sich das Gewinde (1.18) zum
Anschluss von handelsüblichen Drahtauslösern.
Page 25

19
Der Belichtungsmessmethoden-Wählhebel
Die LEICA R9 bietet – unabhängig von der gewählten Betriebsart – drei verschiedene Belichtungs-Messmethoden, mit denen eine Anpassung
an die verschiedensten Situationen und Arbeitsweisen möglich ist. Der Messmethoden-Wählhebel (1.15) befindet sich unterhalb des Verschlusszeiten-Einstellrades, so dass er bequem mit dem
Zeigefinger und mit der Kamera am Auge bedient
werden kann.
Zum Einstellen einer der Messmethoden wird die
in der Mitte vorstehende Entriegelungstaste (1.15b)
gedrückt und der Wählhebel (1.15a) nach links
bzw. rechts verschoben.
Mittenbetonte Integralmessung
(Wählhebel nach rechts)
Mehrfeldmessung
(Wählhebel in der Mitte)
Selektivmessung
(Wählhebel nach links, Richtung Objektiv)
Der Schnellspannhebel
Der Schnellspannhebel (1.21) transportiert den
Film und spannt den Verschluss. Im herausgeklappten Zustand (Bereitschaftsstellung) kann
der Daumen hinter den Schnellspannhebel greifen und dadurch die Kamera sicher abstützen.
Direkt nach erfolgter Belichtung sollte der Film
um ein Bild weitertransportiert werden, um
sofort wieder aufnahmebereit zu sein.
Wenn einer der beiden motorischen Antriebe angesetzt ist – Motor-Winder-R8/R9 oder Motor-Drive R8/R9
– dient der Schnellspannhebel gleichzeitig als
deren Hauptschalter. Solange er ausgeklappt ist,
sind die Motoren ausgeschaltet, ist er dagegen
eingeklappt, wird der Film nach jeder Aufnahme
motorisch weiter transportiert.
Page 26
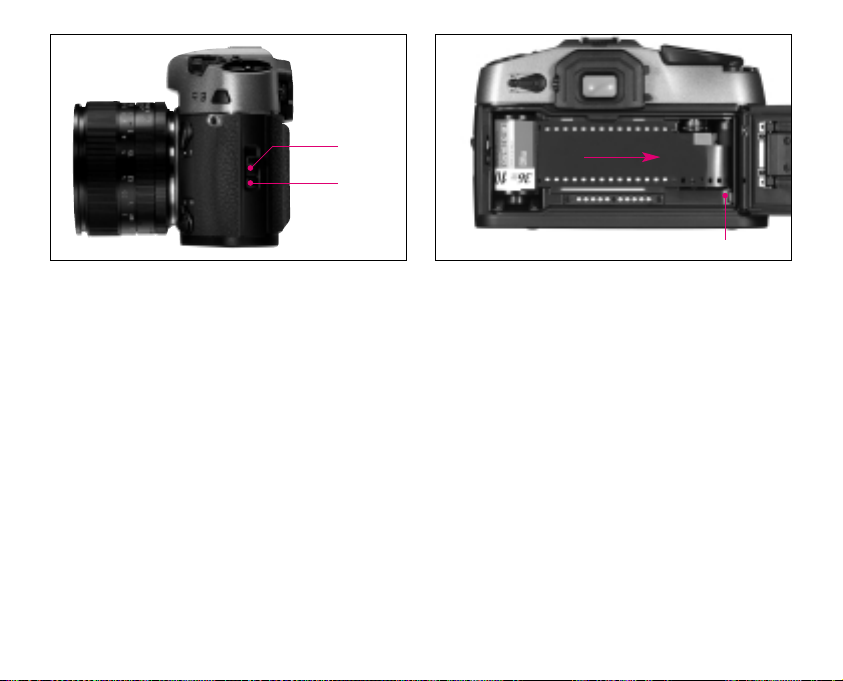
20
Filmwechsel
Überzeugen Sie sich immer erst durch einen
Blick auf das Filmtransport-Kontrollfenster (1.32),
ob nicht bereits ein Film eingelegt ist. Falls ja,
verfahren Sie wie unter "Filmrückspulung", S. 21
beschrieben.
Öffnen der Kamera
Zum Öffnen der Rückwand
1. die Entriegelungstaste (1.45) drücken, und
währenddessen
2. den Rückwand-Entriegelungsschieber (1.44)
nach oben schieben. Dadurch springt die
Rückwand auf und kann vollständig geöffnet
werden.
Einlegen des Films
3. Legen Sie die Filmpatrone in die leere Filmpatronenkammer (1.46) und
4. ziehen Sie den Filmanfang bis zur roten
Markierung (1.52) auf die gegenüberliegende
Aufwickelspule (1.53). Der Film muss flach zwischen den Führungsschienen (1.48) liegen und
die Zahnräder der Transportwalze (1.50) müssen
in die Perforationslöcher des Films greifen.
5. Anschliessend die Rückwand wieder schließen,
d.h. andrücken bis sie hör- und fühlbar einrastet.
6. Transportieren Sie schließlich den Film entweder manuell mit dem Schnellspannhebel, oder,
mit angesetztem Motor, durch drücken des
Auslösers bis Bild Nr. 1. Dabei wird der Film
automatisch eingefädelt.
1.44
1.45
1.52
Page 27
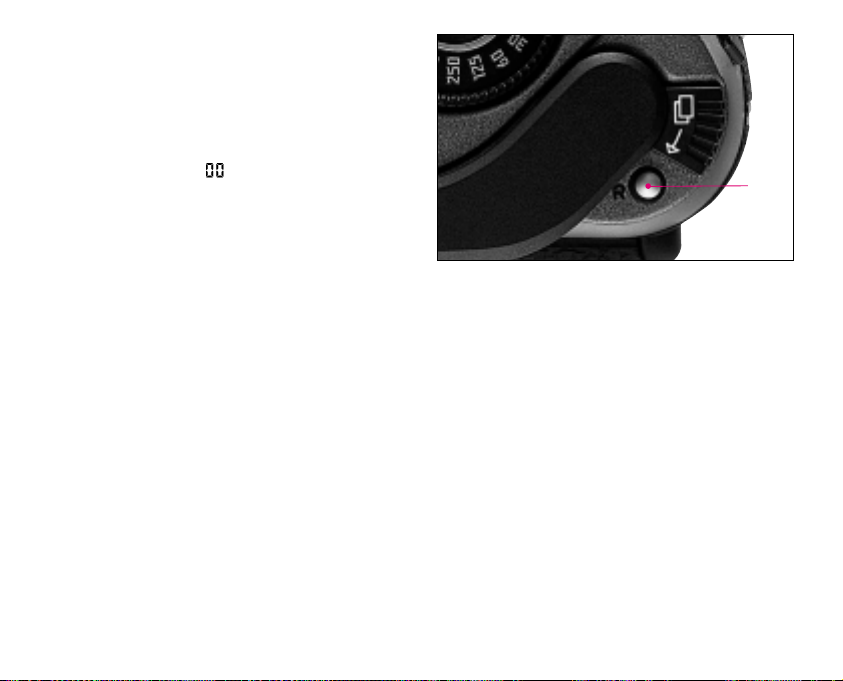
Im Filmtransport-Kontrollfenster (1.32) ist zu
erkennen, ob der Film ordnungsgemäß transportiert wird: Die Streifen bewegen sich von oben
nach unten.
Wenn dies nicht der Fall ist, bzw. wenn bei der
Verwendung eines Motors in den Bildzählwerken
(1.22, 2.10, 3.7) die blinkt, ist der Film nicht
ordnungsgemäß eingelegt. Dann bitte die Rückwand nochmals öffnen und die Filmlage korrigieren.
Hinweis:
Für die automatische Filmeinfädelung ist es
wichtig, dass die Aufwickelspule nicht verschmutzt ist. Sie sollte bei Bedarf mit einem
leicht angefeuchteten Tuch gereinigt werden.
Filmrückspulung
Ist der Film bis zur letzten Aufnahme belichtet,
lässt sich der Schnellspannhebel nicht mehr
betätigen, bzw. schaltet sich ein angesetzter
Motor aus. Vor der Entnahme muss der Film in
die Filmpatrone zurückgespult werden. Dazu
1. den Rückspul-Entriegelungsknopf (1.20) drücken,
2. die Rückspulkurbel (1.9) ausklappen, und
3. durch Drehen in Pfeilrichtung (im Uhrzeigersinn) den Film zurückspulen.
Sobald die Streifen im Filmtransportfenster stillstehen, ist der Film bis auf den Vorspann zurückgespult. Wenn Sie den Film vollständig in die
Patrone spulen möchten (z.B. um ihn eindeutig
als belichtet zu kennzeichnen), sollten Sie mit der
1.20
21
Page 28
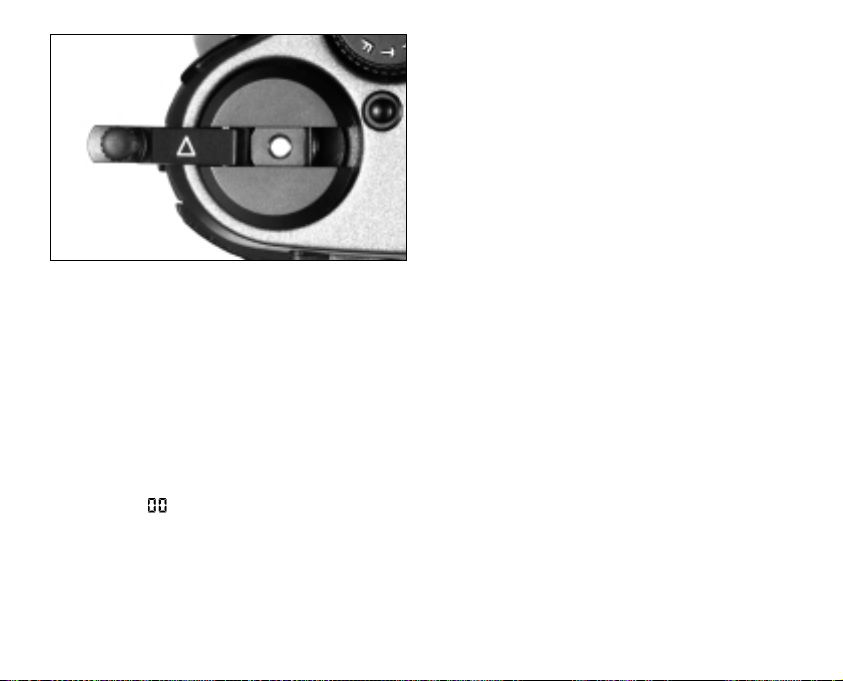
22
Kurbel einige Umdrehungen weiterdrehen, bis
Sie am deutlich geringeren Widerstand spüren,
dass der Filmvorspann vollständig in die Patrone
gespult ist.
Mit angesetztem Motor-Winder R8/R9 oder
Motor-Drive R8/R9 kann die Rückspulung auch
motorisch erfolgen. Auch mit den Motoren können Sie entscheiden, ob der Vorspann in die
Filmpatrone gespult werden soll oder nicht. Nach
erfolgter motorischer Rückspulung blinkt im Bildzählwerk die , die Kamera kann dann geöffnet
und der Film entnommen werden. Näheres zum
Betrieb der Motoren entnehmen Sie bitte den
jeweiligen Anleitungen.
Wichtig:
Zum Zurückspulen darf nur der Knopf zur Rückspulfreigabe gedrückt und nicht der MehrfachBelichtungshebel (1.19, Filmbremse!) eingeschwenkt
werden.
Achtung:
Ragt nach der Rückspulung der Filmanfang noch
aus der Filmkassette, darf der Auslöser nicht
betätigt werden, da der Filmanfang evtl. den Verschluss beschädigen kann.
Page 29
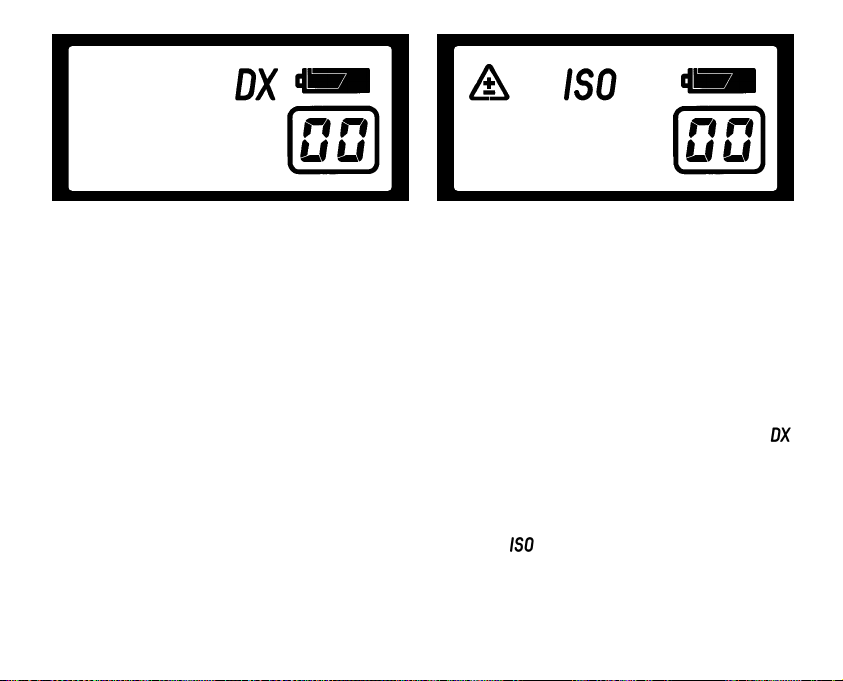
23
Einstellen der Filmempfindlichkeit
Die LEICA R9 erlaubt sowohl automatische wie
auch manuelle Einstellung der Filmempfindlichkeit. Die automatische Einstellung DX-gekennzeichneter Filme erfolgt im Bereich von ISO
25/15° bis 5000/38° (ISO ist die internationale
Bezeichnung für die Filmempfindlichkeit). Manuell können Empfindlichkeiten zwischen ISO 6/9°
und 12500/42° eingestellt werden.
Hinweis:
Durch zusätzlich eingestellte Belichtungskorrekturen (bis zu ±3 EV) steht insgesamt ein Einstellbereich von ISO 0,8/0° bis 100000/51° zur Verfügung.
Zur Wahl der Art der gewünschten Einstellung,
bzw. zur Einstellung selbst,
1. schalten Sie zunächst die Kamera mit dem
Belichtungsbetriebsarten-Wählrad (1.11) ein
(siehe auch "Das BelichtungsbetriebsartenWählrad", S. 17), und
2. bestromen sie durch Antippen des Auslösers
(1.17) (siehe auch "Einschalten der Kamera /
Aktivieren der Elektronik / - des BelichtungsMesssystems", S. 29).
Erscheint nach dem Bestromen der Kamera auf
dem Rückwand-Display (1.34) die Anzeige
(3.3 b), so ist die Kamera auf DX-Abtastung eingestellt. Zur Bestätigung der korrekten Funktion
wird in diesem Fall grundsätzlich auch der abgelesene ISO-Wert angezeigt (3.6 b). Erscheint
dagegen (3.3a), war der Empfindlichkeitswert vorher manuell eingestellt. Bei bestromter
Kamera kann durch einen kurzen Tastendruck
auf eine der beiden Einstelltasten (1.35) der
momentan eingestellte Wert abgelesen werden.
Page 30
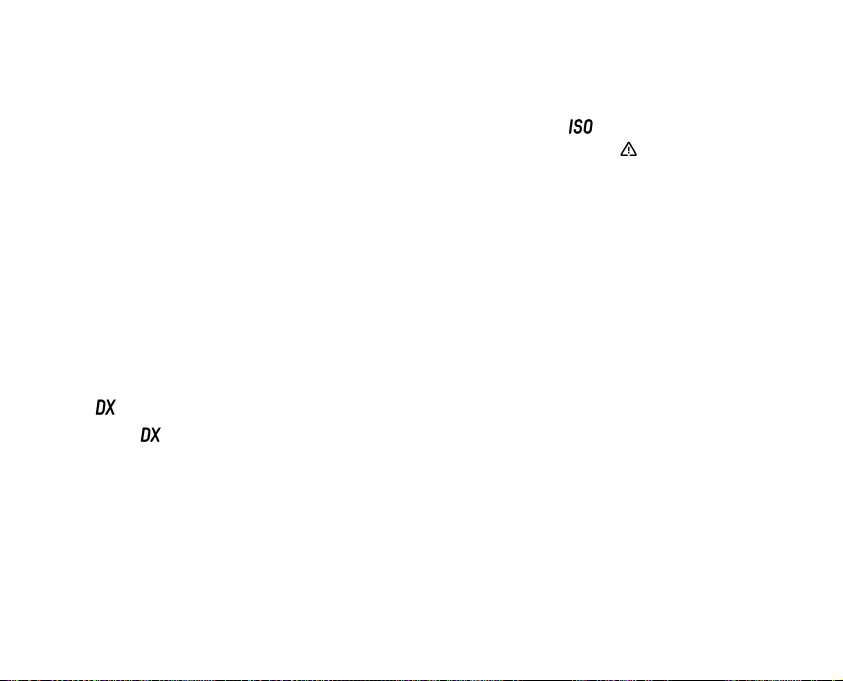
24
Dann
3. die durch einen Magnet gehaltene Abdeckklappe über den Rückwand-Tasten (1.33) nach
unten öffnen.
4. Mit der Plus- bzw. Minustaste (1.35) werden
auf die folgende Art sowohl die Einstellart
gewählt als auch die Empfindlichkeit manuell
eingestellt:
Drücken der linken Minus-Taste verringert die
ISO-Werte, drücken der rechten Plus-Taste
vergrößert sie, bzw. stellt die Kamera im
Anschluss an den höchsten ISO-Wert (12500)
auf automatischen DX-Betrieb ein. Kurzes
Drücken der Tasten verändert die Werte um
jeweils eine Stufe, längeres Drücken lässt die
Werte bis zu den jeweiligen Endwerten, bzw. in
die -Stellung durchlaufen.
Wird in der -Stellung ein Film ohne, bzw. mit
beschädigter, und damit unlesbarer DX-Kennzeichnung verwendet, oder ist kein Film eingelegt, arbeitet die Kamera mit ISO 100/21°. Bei
einem anschließend eingelegten Film mit DXKennzeichnung ist die automatische Abtastung
wieder aktiv.
Wenn für eine bewusste Über- oder Unterbelichtung des gesamten Films ein von der DX-gekennzeichneten Empfindlichkeit abweichender ISOWert manuell eingestellt wird, erscheinen im
Rückwanddisplay , sowie zusätzlich dort und
im Sucherdisplay die –Warnanzeigen (3.1,
2.2). Der manuell eingestellte Wert ist in diesem
Fall der gültige.
Ein manuell eingestellter ISO-Wert bleibt auch
nach dem Filmwechsel erhalten, selbst wenn der
neue DX-kodierte Film eine andere Empfindlichkeit aufweist.
Aus Schutzgründen, und um ein versehentliches
Verstellen der Werte zu verhindern, sollte die
Abdeckklappe der Kamerarückwand beim Fotografieren immer geschlossen sein.
Page 31

25
Ansetzen und Abnehmen des Objektivs
An die LEICA R9 können alle Objektive und
Zubehörteile mit Steuernocken für Leica R-Kameras angesetzt werden, d.h. es stehen Objektive
von 15mm bis 800 mm Brennweite zur Verfügung
(siehe "Verwendung vorhandener Objektive und
Zubehör", S. 26). Die LEICA R9 besitzt bajonettseitig - wie auch die meisten aktuellen Leica
R-Objektive - eine Kontaktleiste. Dadurch wird
zusätzlich zur mechanischen eine elektronische
Belichtungskontrolle erreicht, und Objektivdaten,
wie z.B. die Brennweite, werden zur Kamera
übertragen.
Die Leica R-Objektive werden unabhängig von
der Entfernungs- und Blendeneinstellung wie
folgt eingesetzt:
1. Objektiv am festen Ring (1.13) fassen.
2. Roten Punkt an der Objektivfassung der Taste
der Bajonettentriegelung (1.1) am Kameragehäuse gegenüberstellen.
3. Objektiv in dieser Stellung gerade einsetzen.
4. Eine kurze Rechtsdrehung lässt das Objektiv
hörbar und fühlbar einrasten.
Zum Abnehmen des Objektivs wird
1. der Entriegelungsknopf gedrückt,
2. das Objektiv durch eine kurze Linksdrehung
entriegelt, und
3. gerade abgenommen.
1.1 1.13
Page 32

Verwendung vorhandener
Objektive und Zubehör
Leica R-Objektive
Alle Objektive und das Objektiv-Zubehör des
Leica R-Programms passen ohne Umbau an die
LEICA R9.
Einige frühere Objektive ohne Springblende
sowie verschiedenes Zubehör ohne Springblendenübertragung lassen sich nur bei Zeitautomatik
oder manueller Einstellung benutzen (siehe
"Arbeitsblendenmessung", S. 39).
Die meisten Leica R-Objektive können nachträglich mit einer elektrischen Kontaktleiste zur
Datenübertragung und zum elektronischen Belichtungsabgleich ausgerüstet werden. Dazu
müssen jedoch die LEICAFLEX SL/SL2 – Steuerkurven entfernt werden, d.h. diese Objektive sind
dann nur an den Leica R-Modellen einsetzbar (ab
Modell LEICA R3).
26
R-Nocken (a) und Leicaflex-Steuerkurven (b)
R-Nocken (a) und elektrische Kontakte (c)
a a
c
b
b
Page 33

27
LEICAFLEX SL/SL2-Objektive ohne
R-Steuernocken
Objektive und Zubehör der Leicaflex-Modelle
(ohne R-Steuernocken) dürfen nicht in die LEICA R9
eingesetzt werden, da sonst die Kamera beschädigt werden kann. Sollen sie an der LEICA R9
bzw. an anderen Leica R-Kameras (ab dem Modell
LEICA R3) benutzt werden, müssen sie nachträglich mit dem R-Steuernocken versehen werden.
Ein Umbau solcher Objektive ist im allgemeinen
möglich, der Customer Service der Leica Camera
AG berät Sie gerne darüber (für Adresse, s. S.101).
Soweit die LEICAFLEX SL/SL2-Steuerkurven
erhalten bleiben, wird die Verwendungsmöglichkeit umgebauter Objektive und Zubehör an allen
Leicaflex Modellen voll erhalten. Kontaktleisten zur
Datenübertragung an die LEICA R9 können dann
nicht zusätzlich angebracht werden.
VISOFLEX-Objektive an der LEICA R9
Alle zum VISOFLEX-Ansatz passenden Objektive
aus dem Leica M-Programm können mit dem
Adapter Bestell.-Nr. 14167 auch an der LEICA R9
verwendet werden. Die Arbeitsbedingungen, z.B.
Aufnahme-Abstand und erreichbare Objektfeldgröße, sind dann die gleichen, wie bei der Benutzung dieser Objektive am VISOFLEX. Eine automatische Springblende ist nicht vorhanden, so
dass die Belichtungszeit mit der Arbeitsblende
gemessen wird.
Page 34

Richtiges Halten der Kamera
Zur sicheren Dreipunkthaltung fasst die rechte
Hand die Kamera. Der Zeigefinger liegt auf dem
Auslöseknopf, der Daumen hinter dem Schnellspannhebel. Die linke Hand stützt das Objektiv
von unten ab. Bei Aufnahmen im Hochformat
wird die Kamera einfach gedreht. Die Hände bleiben in der gleichen Stellung wie bei Aufnahmen
im Querformat, bereit zum Weiterschalten des
Films und zum Scharfeinstellen.
28
Page 35

29
Einschalten der Kamera / Aktivieren der
Elektronik / - des Belichtungs- Messsystems
Die LEICA R9 wird mit dem Belichtungsbetriebsarten-Wählrad (1.11) ein- und ausgeschaltet. In
der OFF-Position sind zwecks Sicherung gegen
versehentliche Auslösung und unnötigen Stromverbrauch die Kameraelektronik und alle Displays
ausgeschaltet. Mit der Wahl einer der Belichtungs-Betriebsarten wird die Kamera in einen
Bereitschaftszustand gebracht (siehe dazu auch
"Das Belichtungsbetriebsarten-Wählrad", S. 17).
Durch Antippen des Auslösers an der Kamera
(1.17), einer der beiden am Motor-Drive R8/R9
oder an einer Fernbedienung wird das Belichtungs-Messsystem eingeschaltet. Die Anzeigen in
den LC-Displays im Sucher, auf der Deckkappe
(1.22) und der Rückwand (1.34) leuchten auf. Bei
gespanntem Verschluss leuchten sie nach Freigeben des Auslösers noch ca.14 Sekunden nach,
bei abgelaufenem Verschluss verlöschen sie
sofort nach dem Loslassen.
Hinweise:
Im ausgeschalteten Zustand ist der Energiebedarf der LEICA R9 am geringsten, d.h. nochmal
deutlich niedriger als beim oben beschriebenen
Bereitschaftszustand (nach Erlöschen der Anzeigen). Daher sollten Sie es sich zur Gewohnheit
machen, das Wählrad grundsätzlich bei längerem
Nichtgebrauch auf OFF zu stellen. Vergewissern
Sie sich dabei, dass die Rückwand geschlossen
ist, da sonst ebenfalls ein erhöhter Stromverbrauch erfolgt.
Durch Ausschalten der Kamera werden laufende
Funktionen, wie Langzeit-Belichtungen und die
Spiegelvorauslösung (siehe "Spiegelvorauslösung”,
S. 82) abgebrochen. Der Selbstauslöser-Betrieb
(siehe "Der Selbstauslöser”, S. 81) wird dagegen
nur unterbrochen.
Beim Ausschalten der Kamera erlischt das Zählwerk auf der Deckkappe erst nach einer kurzen
Verzögerung.
Page 36

Die Belichtungsmessung
Um den verschiedenen Lichtsituationen und
Reflexionseigenschaften der Motive gerecht zu
werden, besitzt die LEICA R9 eine Belichtungsmessung durch das Objektiv mit drei verschiedenen Messmethoden: Mehrfeldmessung, Mittenbetonte Integralmessung und Selektivmessung. Für
diese TTL-Messverfahren (Through The Lens =
durch das Aufnahme-Objektiv) besitzt die Kamera
zwei verschiedene Fotodioden: eine runde Diode
auf dem Reflektor hinter dem teildurchlässigen
Schwingspiegel mit einem exakt begrenzten
Messfeld, und eine Diode mit 5 Messfeldern an
streulichtgeschützter Stelle im Kameraboden. Je
nach gewünschter Messmethode werden die
Messwerte dieser sechs Felder ausgewertet.
30
Strahlengang bei Mehrfeld- und mittenbetonter Messung
Strahlengang bei Selektivmessung
Page 37

31
Die Mehrfeldmessung
Diese Messmethode beruht auf der Erfassung
von 6 Messwerten – die der 5 Felder der Mehrfeld-Messzelle und die der Selektiv-Messzelle.
Es werden häufig vorkommende, schwierige
Lichtverhältnisse und Kontraste wie z.B. Reflexe,
Gegenlicht, großer Himmelsanteil bei Landschaften usw. automatisch analysiert und die Helligkeits-Verteilungsmuster zu abgespeicherten, typischen Motiven zugeordnet. Der Mikroprozessor
ermittelt dann die Belichtung.
Die Mehrfeldmessung stellt damit eine außerordentlich komfortable, universelle und sichere Art
der Belichtungsmessung für die überwiegende
Mehrzahl aller Aufnahmen dar, und zwar unabhängig vom Helligkeitsniveau und davon, ob Sie
Ihr Hauptmotiv in der Bildmitte anordnen oder
nicht. Sie eignet sich daher besonders für
schnelle Schnappschüsse und die gemeinsame
Verwendung mit der Programmautomatik.
Page 38

Anpassen des Belichtungsniveaus der Mehrfeldmessung
Zusätzlich können Sie an der LEICA R9 das
Belichtungsniveau der Mehrfeldmessung in sehr
feiner Abstufung Ihren individuellen Gegebenheiten anpassen. Sinnvoll kann diese Belichtungskorrektur, eine dauerhafte "Übersteuerung" der
Automatik, aus den folgenden Gründen sein:
Trotz der Treffsicherheit der Mehrfeldmessung
gibt es bei Motiven mit großen Kontrasten immer
auch Bereiche, die durch diese "optimierte Kompromiss-Belichtung" vernachlässigt, d.h. überoder unterbelichtet werden. Darüber hinaus kann
das System auch nicht berücksichtigen, ob Sie
mit Dia- oder Farbnegativ-Material fotografieren
und für welchen Zweck die Aufnahmen verwendet werden sollen, wie z.B. für Abzüge, Projektion oder Druck.
Hinweise:
Eine Korrektur der Mehrfeldmessung kann nur
erfolgen, wenn diese Messmethode auch eingestellt ist.
Diese Korrektur beinflusst ausschließlich die
Mehrfeldmessung, so dass beim Umschalten die
beiden anderen Messmethoden weiterhin in der
Grundeinstellung zur Verfügung stehen, z.B. für
gezieltes Abstimmen der Belichtung auf wichtige
Motivbereiche. Auch Blitzbelichtungen bleiben
von dieser Korrektur unberührt.
Wenn sowohl eine Korrektur der Mehrfeldmessung als auch eine "normale" Belichtungskorrektur eingestellt werden, addieren sich die Werte.
Zum Beispiel ergibt eine Mehrfeld-Korrektur von
– 0,5 EV zusammen mit einer Belichtungskorrektur von –1 EV für die Mehrfeldmessung insgesamt
eine Korrektur von –1,5 EV (siehe auch "Belichtungskorrekturen", S. 36):
32
Page 39

33
Zur Einstellung wird bei eingeschalteter und
bestromter Kamera (siehe dazu "Einschalten der
Kamera / Aktivieren der Elektronik / - des Belichtungs- Messsystems", S. 29)
1. das +/- Tastenpaar (beide!) zur Einstellung der
Filmempfindlichkeit (1.35) mit zwei Fingern
der rechten Hand ca. 3s gedrückt, bis im
Rückwand-Display (1.34) die Ziffernanzeige
(3.6a) blinkt.
2. Während die beiden Tasten weiter gedrückt
gehalten werden, wird der Entriegelungsschieber des Einstellhebels für Belichtungskorrekturen (1.26b) mit dem linken Daumen zunächst
zur Entriegelung nach rechts geschoben und
dann zusammen mit dem Hebel (1.26a) nach
oben oder unten bewegt (für eine Verstellung
nach Plus oder Minus). Jede Bewegung des
Hebels führt zu einer Korrektur um 0,1 EV.
Sobald die +/- Tasten freigegeben werden, ist
die Korrektur gespeichert.
Im Rückwand-Display wird der eingestellte Wert
angezeigt. Einstellbar sind Werte von maximal
±
0,7 EV.
Ein einmal eingestellter Korrekturwert bleibt
auch bei Abschaltung der Kamera erhalten. Um
eine Korrektur von z.B. + 0,4EV wieder auf Null
zu setzen, wird der Hebel entweder 4 mal nach
unten bewegt, oder in der unteren Stellung für
ca. 2 s festgehalten. Zum Löschen eines MinusKorrekturwertes wird der Hebel entsprechend
nach oben bewegt.
Hinweis:
Zur Rückstellung einer Korrektur der Mehrfeldmessung muss grundsätzlich wie beschrieben
vorgegangen werden. Dies erfolgt nicht gleichzeitig bei der Rückstellung einer "normalen" Belichtungskorrektur.
1.35
Page 40

Die mittenbetonte Integralmessung
Auch bei der mittenbetont arbeitenden Integralmessung werden alle Messwerte herangezogen,
jedoch anders gewichtet. Diese Messmethode
berücksichtigt ebenfalls das gesamte Bildfeld,
die in der Mitte erfassten Motivteile bestimmen
jedoch sehr viel stärker als die Randbereiche die
Berechnung des Belichtungswerts.
Sie ist dann geeignet, wenn im Motiv keine
besonders hohen Kontraste auftreten, die unterschiedlich hellen Details gleichmäßig verteilt sind
und/oder Ihr Hauptmotiv in der Bildmitte angeordnet werden soll. Sie bietet sich insbesondere
dann an, wenn Sie bequem arbeiten und dabei
dennoch die Belichtung kontrollieren und evtl.
auch gezielt beeinflussen möchten, z.B. in Verbindung mit einer Belichtungskorrektur (siehe
dazu "Belichtungskorrekturen", S. 36) oder mit
der Messwert-Speicherung (siehe dazu "Die
Messwertspeicherung", S. 36).
34
-1 EV
-2EV
-3EV
Page 41

35
Die Selektivmessung
Für die Selektivmessung wird lediglich der Messwert der runden Messzelle auf dem Reflektor
genutzt.
Diese Methode wird immer dann gewählt, wenn
im Gesamtmotiv kritische Helligkeitsunterschiede herrschen und die Belichtung auf ein bildwichtiges Detail abgestimmt werden soll. Da das
exakt begrenzte Messfeld im Sucher durch den
großen zentralen Kreis mit 7mm Durchmesser
angezeigt wird, lässt sich das Motivteil, bzw. ein
Bereich, dessen Helligkeit dem mittleren Grauwert entspricht, gezielt anmessen. Sollen solche
Bereiche jedoch nicht in der Bildmitte angeordnet werden, ist die Verwendung der Messwertspeicherung empfehlenswert.
Bei allen Objektivbrennweiten ist das Messfeld
im Verhältnis zum gesamten Bildfeld gleich groß
und bei allen Einstellscheiben klar im Sucher
erkennbar.
Page 42

Die Messwertspeicherung
Immer wenn 1. mit einer der drei automatischen
Belichtungs-Betriebsarten gearbeitet wird, und 2.
bei einer einzelnen Aufnahme das Hauptmotiv,
bzw. der angemessene mittelgraue Bereich aus
gestalterischen Gründen nicht in der Bildmitte
angeordnet werden soll, erweist sich die Messwertspeicherung als eine sehr einfache und nützliche Funktion. Sie steht sowohl mit der Integralwie auch mit der Selektivmessung zur Verfügung.
Die Anwendung:
1. Den anzumessenden Bereich mit dem 7mmKreis im Sucher anvisieren.
2. Den Auslöser (1.17) bis zum 2. Druckpunkt
niederdrücken. Solange der Finger diesen
Druckpunkt hält, bleibt die Speicherung erhalten. Als sichtbares Zeichen dafür erlischt das
jeweilige Messmethoden-Symbol (2.3). Werden während dieser Zeit noch Blende oder
Belichtungszeit verändert, so passt sich der
jeweils andere Wert entsprechend an und wird
angezeigt.
3. Während der Druckpunkt gehalten wird, den
endgültigen Bildausschnitt bestimmen, und
4. auslösen.
Die Speicherung wird aufgehoben, wenn der Finger vom Auslöser-Druckpunkt genommen wird.
Belichtungskorrekturen
Belichtungsmesser sind auf einen mittleren Grauwert geeicht (18% Reflexion), der der Helligkeit
eines normalen fotografischen Motivs entspricht.
Nicht selten erfüllt das angemessene Motiv(-teil)
diese Voraussetzungen nicht, bzw. die Aufnahmen sollen aus bestimmten Gründen (z.B. wegen
unterschiedlicher Nutzung oder persönlichem
Geschmack) gezielt knapper oder reichlicher
belichtet werden. Wenn dies für eine ganze Reihe
aufeinander folgender Aufnahmen oder für einen
ganzen Film gilt, ist eine entsprechende Belichtungskorrektur der Messwertspeicherung vorzuziehen, die immer nur für eine Aufnahme durchgeführt werden kann.
36
Page 43

37
Eingabe und Löschen einer Belichtungskorrektur
Zur Einstellung wird bei eingeschalteter und bestromter Kamera (siehe dazu "Einschalten der
Kamera / Aktivieren der Elektronik / des Belichtungs- Messsystems" auf S. 29) der Entriegelungsschieber des Einstellhebels für Belichtungskorrekturen (1.26b) mit dem linken Daumen
zunächst zur Entriegelung nach rechts geschoben und dann zusammen mit dem Hebel (1.26a)
nach oben oder unten bewegt (für eine Verstellung nach Plus oder Minus). Jede Bewegung des
Hebels führt zu einer Korrektur um 0,5 EV. Einstellbar sind Werte von ±3EV.
Sobald eine Belichtungskorrektur eingegeben ist,
erscheint im Sucher das entsprechende Warnsymbol (2.2), und bei den Automatik-Betriebsarten
A, T
und Pist gleichzeitig auf der Lichtwaage (2.8) die Einstellung ablesbar. Auf dem Rückwanddisplay erscheint bei allen Betriebsarten das
Warnsymbol (3.1) und der eingestellte Wert (3.6a).
Ein einmal eingestellter Korrekturwert bleibt
auch bei Abschaltung der Kamera erhalten.
Um eine Belichtungskorrektur von z.B. + 2 EV wieder auf Null zu setzen, wird der Hebel entweder
4 mal nach unten bewegt, oder in der unteren
Stellung für ca. 2 s festgehalten. Zum Löschen
eines Minus-Korrekturwertes wird der Hebel entsprechend nach oben bewegt.
Wichtig:
Eine an der Kamera eingestellte Belichtungskorrektur beeinflusst sowohl die Messung des
vorhandenen Lichtes als auch die des Blitzlichts.
Page 44

Beispiel für eine Korrektur nach Plus
Bei sehr hellen Motiven, wie z.B. Schnee oder
Strand, wird der Belichtungsmesser wegen der
großen Helligkeit eine relativ kurze Belichtungszeit angeben. Der Schnee wird dadurch in einem
mittleren Grau wiedergegeben, vorhandene Personen sind zu dunkel: Unterbelichtung!
Als Abhilfe muss die Belichtungszeit verlängert
bzw. die Blende weiter geöffnet werden, d.h. eine
Korrektur-Einstellung von z.B. + 2 vorgenommen
werden.
Beispiel für eine Korrektur nach Minus
Bei sehr dunklen Motiven, die wenig Licht reflektieren, wird der Belichtungsmesser eine zu lange
Belichtungszeit angeben. Aus einem schwarzen
wird ein graues Auto: Überbelichtung!
Die Belichtungszeit muss verkürzt, d.h. eine
Korrektur-Einstellung von z.B. -1 vorgenommen
werden.
38
Page 45

39
Unterschreitung des Messbereichs
Wird der Messbereich der Kamera unterschritten, ist eine exakte Belichtungsmessung nicht
möglich. Die dann eventuell noch im Sucher
angezeigten Messwerte können zu falschen Belichtungsergebnissen führen. Deshalb erscheint
bei unterschrittenem Messbereich grundsätzlich
das Warnsignal (2.1) im Sucher.
Das Messsystem der LEICA R9 ist insbesondere
für die gezielte Selektivmessung mit einer sehr
hohen Empfindlichkeit ausgestattet. Falls die
Warnanzeige bei eingestellter Integral- oder
Mehrfeldmessung aufleuchtet, kann daher oft
noch mit Selektivmessung gearbeitet werden.
Offenblendenmessung
Die meisten Leica R-Objektive sind mit automatischer Springblende ausgestattet. Das bedeutet,
dass das Sucherbild immer bei voll geöffneter
Blende und damit größter Sucherhelligkeit betrachtet werden kann, und die Belichtungsmessung bei offener Blende erfolgt. Erst unmittelbar
vor der Aufnahme bzw. nach der Spiegelvorauslösung oder beim Niederdrücken des Abblendschiebers schließt sich die Objektivblende auf
den vorgewählten Wert.
Arbeitsblendenmessung
Das Objektiv PC-Super-Angulon-R 1:2,8/28mm,
einige frühere Leica R-Objektive und verschiedene Zubehörteile besitzen keine automatische
Springblende. Die Belichtung muss bei diesen
Geräten mit der jeweils eingestellten Objektivblende, also mit der Arbeitsblende, gemessen
werden. In diesem Fall erhalten die Messzellen
der LEICA R9 durch Verändern der Objektivblende mehr oder weniger Licht. Mit Objektiven und
Zubehörteilen ohne automatische Springblende
können nur die Betriebsarten
A
oder mbenutzt
werden. Die Arbeitsblende kann von der Kamera
nicht angezeigt werden.
Page 46

Arbeitsdiagramm des Belichtungsmessers
In der folgenden Darstellung werden die Zusammenhänge zwischen Filmempfindlichkeit
(SV = Speed value) und Leuchtdichte/ Helligkeit
(BV = Brightness value) einerseits und zwischen
Belichtungszeit (TV = Time value) und Blendenwert (AV = Aperture value) andererseits erkennbar, jeweils mit den sich daraus ergebenden
Belichtungswerten (EV = Exposure value). Dazu
dienen zwei Diagramme, die durch diagonale
Linien, entsprechend den EV-Werten, miteinander in Bezug gebracht werden.
Ein Beispiel (gestrichelte Linie) zeigt die Zusammenhänge der einzelnen Werte zueinander: Von
der eingestellten Filmempfindlichkeit (hier: ISO
100/21°) verfolgt man die senkrechte Linie bis
zum Schnittpunkt mit der waagerechten Linie der
gegebenen Leuchtdichte (hier: 2 000 cd/m
2
). Die
durch diesen Schnittpunkt laufende Diagonale
führt zu dem zugehörigen Belichtungswert (EV 14).
Dieser EV-Wert lässt sich in verschiedene Kombinationen von Blendenwert und Belichtungszeit
umsetzen, d.h. in den Arbeitsbereich der Kamera
übertragen.
Die Schnittpunkte aus senkrechten AV- und waagerechten TV-Linien müssen für eine richtige
Belichtung auf der EV-Diagonalen liegen, z.B.
Blende 16 und 1/60s (Fall A), oder Blende 8 und
1/250s (Fall B) oder Blende 4 mit 1/1000 s
(Fall C). Jede dieser Kombinationen ergibt eine
korrekte Belichtung.
Bei Zeit- und Blendenautomatik wird jeweils einer
dieser Werte vorgegeben, der zweite bildet sich
automatisch. In der Programmautomatik bilden
sich beide Werte automatisch.
40
Page 47

41
Arbeitsdiagramm des
Belichtungsmessers
Verschlusszeit /s.
Blende
ISO
Lichtwert
Page 48

Die Belichtungs-Betriebsarten
Die LEICA R9 bietet Ihnen vier BelichtungsBetriebsarten zur Wahl, mit denen Sie die Kamera optimal auf Ihre bevorzugte Arbeitsweise oder
auf das jeweilige Motiv einstellen können.
Die Variable Programmautomatik –
P
Die richtige Betriebsart, um immer aufnahmebereit zu sein. Optimal für unbeschwertes Fotografieren, da sich Blende und Belichtungszeit
automatisch bilden.
Als Schnappschusseinstellung sind folgende Einstellungen vorzunehmen bzw. empfehlenswert:
1. Belichtungsbetriebsarten-Wählrad (1.11) auf
Stellung P,
2.
Blende ganz schließen, d.h. den Blendenring (1.12)
auf den größten Wert drehen (z.B. 16 oder 22),
3. Verschlusszeiten-Einstellrad (1.16) auf 30 P, und
4. Belichtungsmessmethoden-Wählhebel (1.15) auf
Mehrfeldmessung .
Belichtungszeit und Objektivblende bilden sich
dann automatisch entsprechend dem vorhandenen Licht und stufenlos zwischen zwischen
1/8000 s und 32 s, bzw. zwischen offener- und
Kleinstblende des jeweiligen Objektivs (bzw. der
eingestellten kleinsten Blende, siehe unten).
42
Page 49

43
Im Sucher erscheinen
• für die gewählte Belichtungs-Betriebsart
(2.6c),
• das Symbol für die gewählte Messmethode
(2.3), sowie
• die automatisch eingesteuerten Zeit- und
Blendenwerte (2.9a, 2.7).
Die Betriebsart
P
funktioniert mit allen Leica
R-Objektiven mit automatischer Springblende.
Über die Stellung des Verschlusszeiten-Einstellrades kann auf die automatisch gebildete
Zeit/Blenden-Kombination jederzeit Einfluss
genommen werden (siehe dazu "Charakteristik
und Anwendung der variablen Programmautomatik", S. 44).
Wichtig:
Am Objektiv muss die kleinste Blende (16 bzw.
22) eingestellt werden, damit der gesamte Blendenbereich für die automatische Steuerung zur
Verfügung steht. Ist dies nicht der Fall, blinkt im
Sucher die Anzeige (2.6c). Wird ausgelöst,
bildet die Kamera trotzdem automatisch eine
richtige Zeit-Blenden-Kombination. Der Regelbereich der Blende wird in solchen Fällen allerdings
auf den Bereich zwischen Offenblende und eingestelltem Blendenwert begrenzt.
Hinweise:
Bei einigen älteren Objektiven blinkt die Anzeige
, auch wenn ganz abgeblendet wurde, die richtige Blende wird dennoch automatisch gebildet.
Bei sehr wenig Licht oder extremer Helligkeit
kann es vorkommen, dass der verfügbare Zeit/
Blenden-Bereich nicht mehr ausreicht. Dann
erscheint im Sucher (2.9b) für Unterbelichtung (evtl. auch der Warnhinweis für Messbereichs-Unterschreitung (2.1), siehe dazu
"Unterschreitung des Messbereichs", S. 39) oder
(2.9b) für Überbelichtung.
Page 50

Charakteristik und Anwendung der variablen
Programmautomatik
Die variable Programmautomatik der LEICA R9
verbindet die Sicherheit und Schnelligkeit der
vollautomatischen Belichtungssteuerung mit der
Möglichkeit, jederzeit die von der Kamera gewählte Zeit/Blenden-Kombination den eigenen
Vorstellungen entsprechend variieren zu können.
Dazu dient das Verschlusszeiten-Einstellrad (1.16).
Will man z.B. bei Sportaufnahmen bevorzugt mit
schnellen Zeiten und offener Blende arbeiten,
wird eine kurze Zeit vorgewählt. Legt man dagegen mehr Wert auf große Schärfentiefe (geschlossene Blende) und akzeptiert die dadurch
notwendigen, längeren Zeiten, wird eine längere
Verschlusszeit eingestellt (z.B. bei Landschaftsaufnahmen). Die Gesamtbelichtung, d.h. die Helligkeit des Bildes, bleibt dabei unverändert.
Die Arbeitsweise der Programmautomatik ist
ganz allgemein wie folgt: Geht man von sehr
niedriger Helligkeit aus, so verkürzt sich mit
zunehmender Helligkeit nur die Belichtungszeit
stufenlos automatisch bis zum eingestellten Zeitwert, während das Objektiv voll aufgeblendet
bleibt. Ab der eingestellten Belichtungszeit werden Zeit und Blende automatisch verändert, d.h.
die Zeit stufenlos verkürzt und das Objektiv stufenlos abgeblendet. Ist aufgrund des Programms
die kleinste Blende erreicht, verkürzt sich bei
weiter zunehmender Helligkeit nur die Zeit, bis
zur 1/8 000 s. Ist dagegen 1/8000s vor der
Kleinstblende des jeweiligen Objektivs erreicht,
so wird ab dieser Belichtungszeit nur noch die
Blende verkleinert.
44
Page 51

45
Standardeinstellung (Beispiel A)
Verschlusszeiten-Einstellrad auf 60.
Besonders geeignet
•bei normalen Motiven und unkritischen Lichtverhältnissen, sowie
•bei Brennweiten zwischen 35mm und 90mm.
Es wird ein Objektiv mit der Lichtstärke 4 eingesetzt (z.B. Vario-Elmar-R 1:4/35-70 mm). Am Verschlusszeiten-Einstellrad ist 1/60s eingestellt. Es
ergibt sich ein Verlauf entsprechend der Linie A.
Liegt z.B. ein Belichtungswert von EV 14 vor,
führt diese Programmeinstellung zu einer Belichtung von 1/250s bei Blende 8.
Wenn eine größere Schärfentiefe und/oder
eine längere Verschlusszeit gewünscht wird
(Beispiel B)
Verschlusszeiten-Einstellrad zwischen 16s und
1/15s. Ergibt eine Tendenz zu stärker abgeblendetem Objektiv mit längeren Belichtungszeiten.
Besonders geeignet
•bei guten Lichtverhältnissen und kurzen Brennweiten, und
•bei statischen Motiven, z.B. Landschaftsaufnahmen.
Achtung:
Erhöhte Verwacklungsgefahr durch längere Belichtungszeiten!
Es wird ein Objektiv mit der Lichtstärke 2,8 eingesetzt (z.B. Elmarit-R 1:2,8/19mm). Am Verschlusszeiten-Einstellrad ist 1/2s eingestellt. Es
ergibt sich ein Verlauf entsprechend der Linie B.
Beim gleichen Lichtwert EV 14, ergibt dieses Programm eine Belichtung mit 1/60s bei Blende 16.
Page 52

Wenn eine kürzere Verschlusszeit und/oder
eine geringere Schärfentiefe gewünscht wird
(Beispiel C)
Verschlusszeiten-Einstellrad zwischen 1/60 s bis
1/8000 s.
Ergibt eine Tendenz zu kürzeren Belichtungszeiten bei geringerer Schärfentiefe (größere Blendenöffnungen). Besonders geeignet
•bei schlechten Lichtverhältnissen oder langen
Brennweiten, und
•bei bewegten Objekten, z.B. Sportaufnahmen.
Achtung:
Geringere Schärfentiefe!
Es wird ein Objektiv mit der Lichtstärke 2 eingesetzt (z.B. Apo-Summicron-R 1:2/180mm). Am
Verschlusszeiten-Einstellrad ist 1/250s eingestellt. Es ergibt sich ein Verlauf entsprechend der
Linie C. Beim gleichen Beispiel von EV 14 ergibt
dieses Programm eine Belichtung von 1/1 000 s
bei Blende 4.
Faustregel:
Um Verwacklungsunschärfen bei Freihandaufnahmen zu vermeiden, sollte man als längste
Belichtungszeit einen Wert anstreben, der sich
aus 1 : Brennweite (mm) ergibt.
Verwendet man z.B. ein Objektiv der Brennweite
180mm, sollten Belichtungszeiten nicht länger
als 1/180s benutzt werden. Am Verschlusszeiten-Einstellrad sollte dafür z.B. 250 eingestellt
werden.
46
Page 53

47
Programmverläufe bei verschiedenen Verschlusszeit-Einstellungen und mit verschiedenen Objektiven
32
Verschlusszeit /s
16
8
4
2
1
1/2
1/4
1/8
1/15
1/30
1/60
1/125
1/250
1/500
1/1000
1/2000
1/4000
1/8000
-4 -3 -2 -1 0 1 2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1,4 2 2,8 4 5,6
Blende
8111622
EV
B
A
C
Page 54

Die Zeitautomatik –
A
Diese Betriebsart eignet sich besonders dann,
wenn die Schärfentiefe wesentliches Gestaltungselement ist.
Dafür ist
1. das Belichtungsbetriebsarten-Wählrad (1.11)
auf A zu stellen.
2. Das Verschlusszeiten-Einstellrad (1.16) darf auf
jedem beliebigen Wert außer X oder B stehen.
3. Die Blende, und damit auch der Bereich der
Schärfentiefe, wird mit dem Blendenring (1.12)
festgelegt.
Die Belichtungszeit bildet sich dann automatisch
entsprechend dem vorhandenen Licht und stufenlos zwischen 1/8000 s und 32 s.
Im Sucher erscheinen
• (Aperture priority) für die gewählte Belichtungs-Betriebsart (2.6b),
•
das Symbol für die gewählte Messmethode (2.3),
• der manuell eingestellte Blendenwert (2.7),
sowie
• der automatische eingesteuerte Zeitwert (2.9a,
nächstliegender halber oder voller Wert).
Diese Betriebsart funktioniert mit allen Leica
R-Objektiven und Zusatzgeräten, wie Adaptern,
Balgeneinstellgerät, usw., d.h. unabhängig davon,
ob diese nur Arbeitsblendenmessung erlauben
oder dank automatischer Springblende die Offenblendenmessung.
48
Page 55

49
Hinweise:
Bei extremer Helligkeit kann es vorkommen, dass
der Verschlusszeitenbereich für die vorgewählte
Blende nicht mehr ausreicht. Im Sucher erscheint dann (2.9 b). Zur Abhilfe kann - falls
möglich - eine kleinere Blende gewählt werden.
Leuchtet bei sehr schlechten Lichtverhältnissen
im Sucher die Anzeige (2.9b), sollte eine
größere Blende gewählt werden, da sich sonst
eine Unterbelichtung ergibt.
Im Falle einer Messbereichs-Unterschreitung
leuchtet zusätzlich der entsprechende Warnhinweis (2.1). Dann ist eine korrekte Belichtungsmessung nicht mehr möglich.
Die Blendenautomatik –
T
Diese Betriebsart wird vor allem bei bewegten
Objekten eingesetzt, bei denen die Belichtungszeit gestaltendes Mittel ist. Dies gilt z.B. für
Bewegungsabläufe, Sportaufnahmen, Aufnahmen
von unruhigem Kamerastandpunkt, sowie bei
Aufnahmen mit längeren Brennweiten.
Dafür ist
1. das Belichtungsbetriebsarten-Wählrad (1.11)
auf T zu stellen.
2.
Blende ganz schließen, d.h. den Blendenring (1.12)
auf den größten Wert drehen (z.B. 16 oder 22), und
3. die gewünschte Belichtungszeit zwischen
1/8000 s bis 16 s am VerschlusszeitenEinstellrad (1.16) vorgewählt.
Die Objektivblende bildet sich dann automatisch
entsprechend dem vorhandenen Licht und stufenlos zwischen offener- und Kleinstblende des
jeweiligen Objektivs (bzw. der eingestellten kleinsten Blende, siehe unten).
Page 56

Im Sucher erscheinen
• (Time priority) für die gewählte BelichtungsBetriebsart (2.6d),
• das Symbol für die gewählte Messmethode (2.3),
• der manuell eingestellte Zeitwert (2.9a), sowie
•
der automatische eingesteuerte Blendenwert (2.7).
Die Betriebsart Tfunktioniert mit allen Leica
R-Objektiven mit automatischer Springblende.
Wichtig:
Am Objektiv muss die kleinste Blende (16 bzw. 22)
eingestellt werden, damit der gesamte Blendenbereich für die automatische Steuerung zur Verfügung steht. Ist dies nicht der Fall, blinkt im
Sucher die Anzeige (2.6d). Wird ausgelöst,
bildet die Kamera trotzdem automatisch eine
richtige Zeit-Blenden-Kombination. Der Regelbereich der Blende wird in solchen Fällen allerdings
auf den Bereich zwischen Offenblende und eingestelltem Blendenwert begrenzt.
Hinweise:
Bei einigen älteren Objektiven blinkt die Anzeige
, auch wenn ganz abgeblendet wurde, die richtige Blende wird dennoch automatisch gebildet.
Bei sehr wenig Licht oder extremer Helligkeit
kann es vorkommen, dass der verfügbare Blendenbereich des verwendeten Objektivs für die
vorgewählte Belichtungszeit nicht mehr ausreicht. Auch in diesem Fall erfolgt jedoch eine
korrekte Belichtung durch automatische Einstellung der passenden Verschlusszeit, d.h. durch
eine "Übersteuerung" der manuellen Vorwahl.
Bei Unterbelichtung erscheint (2.9b) (evtl.
auch der Warnhinweis für Messbereichs-Unterschreitung (2.1), siehe dazu den Abschnitt
"Unterschreitung des Messbereichs", S. 39) oder
(2.9b) für Überbelichtung.
50
Page 57

51
Die manuelle Einstellung von Blende und
Belichtungszeit -
m
Bei vielen interessanten Aufnahmesituationen
und Bildgestaltungs-Vorstellungen würde keine
der automatischen Belichtungs-Betriebsarten die
gewünschten Ergebnisse liefern. In solchen
Fällen ist die gezielte Handeinstellung von Belichtungszeit und Blende die Lösung.
Dafür ist
1. das Belichtungsbetriebsarten-Wählrad (1.11)
auf m, und
2. der Blendenring- (1.12), das Verschlusszeit-Einstellrad (1.16) und der Belichtungsmessmethoden-Wählhebel (1.15) auf die gewünschten
Werte, bzw. Messmethode zu stellen.
Im Sucher erscheinen
•
für die gewählte Belichtungs-Betriebsart (2.6a),
• das Symbol für die gewählte Messmethode (2.3),
• die manuell eingestellten Zeit- und Blenden-
werte (2.9a, 2.7), sowie
• eine Lichtwaage (2.8), mit deren Hilfe der
Belichtungsabgleich erfolgt.
Die Lichtwaage zeigt die Abweichung der jeweils
gerade eingestellten Zeit-/Blenden-Kombination
vom korrekten Belichtungswert an. Im Bereich
von -2,5 EV bis +2,5EV erfolgt die Anzeige eindeutig in 0,5 EV-Stufen. Größere Abweichungen
werden durch das Aufleuchten aller Markierungen auf der Plus- oder Minusseite der Lichtwaage
angezeigt.
Blende und/oder Zeit sind für eine korrekte
Belichtung gemäß Belichtungsmesser-Angabe
solange zu verändern, bis nur die Null-Markierung der Lichtwaage leuchtet.
Diese Betriebsart funktioniert mit allen Leica
R-Objektiven und Zusatzgeräten, wie Adaptern,
Balgeneinstellgerät, usw., d.h. unabhängig davon,
ob diese nur Arbeitsblendenmessung erlauben
oder dank automatischer Springblende die Offenblendenmessung.
Page 58

Blitzen mit der LEICA R9
Allgemeines zur Verwendung von Blitzgeräten
An die LEICA R9 können alle Blitzgeräte und Studioblitzanlagen angeschlossen werden, die der
aktuell gültigen ISO-Norm 10330 sowie der älteren DIN 19014 entsprechen (positive Polarität
am X-Kontakt)
1
. Die vielfältigsten Möglichkeiten
bieten Elektronenblitzgeräte, die über die technischen Voraussetzungen einer System-CameraAdaption (SCA) des Systems 3000/3002 verfügen und über den Adapter SCA 3501 oder SCA
3502M3 an die LEICA R9 angeschlossen werden.
Andere Aufsatzblitzgeräte
2
mit Normblitzschuh
können ebenfalls benutzt und über den Mittenkontakt (X-Kontakt) gezündet werden.
Studioblitzanlagen und andere Blitzgeräte mit
Blitzkabel und Normblitzstecker lassen sich über
die Blitzanschlussbuchse (1.8) anschließen.
1
Möchten Sie z.B. eine Studioblitzanlage an die LEICA R9
anschließen, die der ISO-Norm nicht entspricht, wenden Sie
sich bitte an den Customer Service der Leica Camera AG oder
den Kundendienst einer Leica Vertretung.
2
Die Verwendung von Systemblitzgeräten anderer Kamerahersteller sowie von SCA-Adaptern für andere Kamerasysteme
wird nicht empfohlen, da deren unterschiedliche Kontaktlage
und -Belegung zu Fehlfunktionen oder sogar zu Schäden führen
können.
Neben der Auslösung und Belichtungssteuerung
von Blitzgeräten während der Aufnahme bietet
die LEICA R9 auch die Möglichkeit, die Blitzleistung vor der Aufnahme selektiv zu messen und
damit die einzustellende Blende zu bestimmen
(siehe dazu "Messblitz-Betrieb vor der Aufnahme - F"
,
S. 76).
Die Blitzsynchronzeit
Die Blitzsynchronzeit der LEICA R9 beträgt bei
herkömmlicher Blitztechnik 1/250s. Insbesondere Studioblitzanlagen haben oft Leuchtzeiten, die
wesentlich länger sind. Um die Lichtmenge dieser Blitzgeräte voll nutzen zu können, sind
längere Zeiten, wie z.B. 1/180s oder 1/125s,
empfehlenswert.
Die LEICA R9 erlaubt zusammen mit Blitzgeräten
des SCA 3002-Standards, die über die
HSS -
Betriebsart (High-Speed Synchronisation) verfügen, und dem SCA-Adapter 3502M3 auch den
Einsatz sämtlicher kürzerer Verschlusszeiten bis
1/8000 s (siehe "Der Linear-Blitzbetrieb", S. 70).
52
Page 59

53
Wahl des Synchronzeitpunktes
Die Belichtung von Blitzaufnahmen erfolgt durch
zwei Lichtquellen, dem vorhandenen – und dem
Blitzlicht. Die ausschließlich oder überwiegend vom
Blitzlicht ausgeleuchteten Motivteile werden dabei
durch den extrem kurzen Lichtimpuls fast immer
(bei korrekter Scharfeinstellung) gestochen scharf
wiedergegeben. Dagegen werden alle anderen
Motivteile – nämlich die, die ausreichend vom vorhandenen Licht ausgeleuchtet sind, bzw. selbst
leuchten - im gleichen Bild unterschiedlich scharf
abgebildet.
Ob diese Motivteile scharf oder "verwischt" wiedergegeben werden, wie auch der Grad der "Verwischung", wird durch zwei – voneinander abhängige Faktoren bestimmt,
1. die Länge der Belichtungszeit, d.h. wie lange
diese Motivteile auf den Film "einwirken", und
2. wie schnell sich diese Motivteile - oder auch
die Kamera selbst - während der Aufnahme
bewegen.
Blitz auf den ersten Vorhang Blitz auf den zweiten Vorhang
Page 60

Je länger die Verschluss-/Belichtungszeit, bzw. je
schneller die Bewegung ist, desto deutlicher können sich die beiden - sich überlagernden - Teilbilder unterscheiden.
Beim herkömmlichen Zeitpunkt der Blitz-Zündung
zu Beginn der Belichtung, d.h. sofort nachdem
der 1. Verschlussvorhang das Bildfenster vollständig geöffnet hat, kann das sogar zu scheinbaren Widersprüchen führen, wie z.B. beim Bild
des Motorrades (S. 53 links), das von seinen
eigenen Lichtspuren überholt wird.
Die LEICA R9 erlaubt Ihnen die Wahl zwischen
diesem herkömmlichen Blitz-Zündzeitpunkt und
der Synchronisation auf das Ende der Belichtung,
d.h. unmittelbar bevor der 2. Verschlussvorhang
beginnt, das Bildfenster wieder zu schließen.
Das scharfe Bild befindet sich in dem Fall am
Ende der Bewegung. Diese Blitztechnik vermittelt
im Foto (S. 53 rechts) einen natürlicheren Eindruck von Bewegung und Dynamik.
Der Blitzzeitpunkt wird am Wählhebel für den
Synchronisierungs-Zeitpunkt (1.7) vorgegeben:
• Stellung I: Blitzauslösung nach dem
1. Verschlussvorhang
• Stellung II: Blitzauslösung vor dem
2. Verschlussvorhang
Hinweise:
Beim Blitzen mit der Synchron- und kürzeren Verschlusszeiten ergibt sich kaum, bzw. nur bei
schnellen Bewegungen ein bildmäßiger Unterschied zwischen den beiden Blitzzeitpunkten.
Die Wahl auf den 2. Verschlussvorhang ist bei
Stroboskop-Blitzbetrieb unwirksam.
54
1.7
1.8
Page 61

55
Blitzen über den X-Kontakt
Beim Anschluss über den Zubehörschuh (1.24)
ohne den Adapter SCA 3501/3502M3 kann der
Blitz wahlweise auf den ersten oder zweiten Verschlussvorhang vorgewählt und gezündet werden. Da aber keine Informationen vom Blitzgerät
übertragen werden, kann die Kamera ein angeschlossenes Blitzgerät "nicht erkennen" und verhält sich so, als wäre kein Blitzgerät angeschlossen. Die Belichtungszeit ist manuell auf die Blitzsynchronzeit X = 1/250 s oder auf längere Zeiten
einzustellen; eine automatische Umschaltung findet nicht statt. Die Blitzbereitschafts- und Kontrollanzeigen sind nicht aktiv.
Falls das Blitzgerät dafür geeignet ist, kann die
Lichtsteuerung mittels Computerblende, d.h. über
den Sensor am Blitzgerät, oder manuell durch die
Wahl entsprechender Teillicht-Leistungsstufen erfolgen (s. Anleitung zum Blitzgerät).
Blitzen über die Blitzanschlussbuchse
Über die Blitzanschlussbuchse (1.8) können Blitzgeräte und große Studioblitzanlagen mit genormtem Blitzstecker angeschlossen werden. Die
Kamera zündet den Blitz wahlweise auf den
ersten oder zweiten Verschlussvorhang. Da aber
keine Blitzinformationen übertragen werden, verhält sich die Kamera wie ohne Blitz. Die Belichtungszeit ist manuell auf die Blitzsynchronzeit X
= 1/250 s oder auf längere Zeiten einzustellen;
eine automatische Umschaltung findet nicht
statt.
Sehr leistungsstarke Blitzgeräte und insbesondere Studioblitzanlagen haben oft Leuchtzeiten, die
länger sind. Um die Lichtmenge dieser Blitzgeräte voll nutzen zu können, sind längere Zeiten, wie
z.B. 1/180s oder 1/125s, empfehlenswert. Die
Blitzbereitschafts- und Kontrollanzeigen sind
nicht aktiv.
Page 62

Blitzen mit SCA 3000/3002-Standard-Blitzgeräten und SCA Adaptern 3501/3502M3
Beim Anschluss eines geeigneten Blitzgerätes mittels Adapter SCA 3501/3502M3 bietet die LEICA R9
in vielen Anwendungsfällen entscheidende Vorteile
und verhilft zu gelungenen Blitzaufnahmen. Abhängig von der gewählten Betriebsart führt die Kamera
verschiedene Funktionen automatisch aus bzw.
lässt den nötigen, kreativen Spielraum, um Blitzaufnahmen den Anforderungen entsprechend gestalten zu können:
• Blitzbelichtungsmessung während der Aufnahme durch das Objektiv (TTL-Messung). Diese
Blitzbelichtungsmessung empfiehlt sich z.B. in
der Makrofotografie, bei Filtereinsatz oder bei
Vario- und Tele-Objektiven.
• Alle Informationen über Blitzladezustand und
Blitz-Über- oder Unterbelichtung im Sucher
und im Rückwanddisplay.
• Automatische Umschaltung auf die Blitzsynchronzeit (je nach Betriebsart).
• Blitz-Belichtungskorrekturen, d.h. gezielte Überoder Unterdosierung ausschließlich des Blitzlichtes, um unabhängig vom vorhandenen Licht
im Vordergrund Schatten aufzuhellen oder bei
Gegenlichtaufnahmen eine bessere Lichtverteilung zu erhalten (Nur am Adapter, bzw. Blitzgerät, siehe S. 60).
• Übertragung der Objektiv-Brennweite zur automatischen Reflektoranpassung des Blitzgerätes (nur bei Objektiven mit elektrischen Kontakten).
• Übertragung der eingestellten Objektivblende
zur Steuerung der Computer-Automatik des
Blitzgerätes (nur bei Objektiven mit elektrischen Kontakten).
• Anzeige von Blenden-Zwischenwerten bei der
Verwendung von Zoomobjektiven veränderlicher Lichtstärke (nur bei Objektiven mit elektrischen Kontakten).
• Übertragung der Filmempfindlichkeit und
Belichtungskorrekturen der Kamera zur Steuerung des Blitzgerätes.
• Automatische Umschaltung auf längere Zeiten
bei Stroboskopblitz.
• Automatische Blitz-Belichtungsreihen (nur bei
entsprechend ausgestatteten Blitzgeräten).
56
Page 63

57
Die TTL-Blitzbelichtungsmessung erfolgt integral
über separat angeordnete Silizium-Fotodioden,
die sich neben der Messzelle für die MehrfeldBelichtungsmessung an streulichtgeschützter
Stelle im Kameraboden befinden. Mit Hilfe von
entsprechenden Adaptern (im Handel erhältlich)
können auch mehrere Blitzgeräte gleichzeitig
gezündet oder die TTL-Steuerung drahtlos ausgeführt werden.
Blitzbereitschafts- und Kontrollanzeige
(nur mit SCA 3501/3502M3-Adaptern)
Bei bestromter Kamera (siehe "Einschalten der
Kamera / Aktivieren der Elektronik / - des Belichtungs- Messsystems", S. 29) und Benutzung des
SCA 3501/3502M3 zeigt das Blitzsymbol (
1
, 2.4)
im Sucher und auf dem Rückwanddisplay (3.5)
den jeweiligen Ladungszustand des Blitzgerätes
und damit die Blitzbereitschaft an:
• Blinken des Blitzsymbols: Das Blitzgerät lädt
gerade auf. Da die Blitzbereitschaft noch nicht
gegeben ist, verhält sich die Kamera wie ohne
Blitz und arbeitet in der eingestellten Betriebsart. Wird ausgelöst, zündet der Blitz nicht.
Strahlengang bei TTL-Blitzbelichtungsmessung
Page 64

• Konstantes Leuchten des Blitzsymbols: Blitzbereitschaft ist gegeben.
War das Blitzlicht bei TTL-Steuerung oder Computer-Automatik für eine korrekte Belichtung nicht
ausreichend (Unterbelichtung), so leuchtet automatisch nach der Aufnahme die Anzeige (2.9 b)
für etwa 4s im Sucher. Bei TTL-Steuerung wird
auch eine aufgetretene Überbelichtung durch
das Blitzlicht durch die Anzeige (2.9b) für 4 s
angezeigt. In diesen Fällen bitte den Arbeitsbereich des Blitzgerätes beachten und die Aufnahme mit entsprechend geänderter Blende
nochmals ausführen.
Hinweis:
Die Anzeigen erfolgen auf der Grundlage normgerechter Belichtungen. Daher können einzelne
Aufnahmen trotz dieser Anzeigen dennoch aus
individueller Sicht als akzeptabel bewertet werden.
Blitz-Belichtungskorrekturen
Über Schalter am Adapter SCA 3501/3502M3,
bzw. am Blitzgerät selbst (bei SCA-3002 Standard-Geräten) kann unabhängig von der Belichtungskorrektur-Einstellung an der Kamera - die
sowohl die Belichtung des vorhandenen - wie
auch des Blitzlichts beeinflusst, eine Blitz-Belichtungskorrektur eingestellt werden, die nur die
Blitzbelichtung beeinflusst, um diese bewusst zu
verstärken oder abzuschwächen.
58
Ohne Blitzaufhellung
Page 65

59
Eine Verstellung nach Minus wird immer dann
vorgenommen, wenn der Blitzlicht-Anteil verringert werden soll, z.B. wenn er lediglich zur Aufhellung dienen soll. In solchen Fällen bleibt die
vorhandene Lichtstimmung erhalten, und durch
den zusätzlichen Blitz werden lediglich dunkle
Motivteile oder Schattenpartien im Vordergrund
aufgehellt.
Diese Korrektur ist beim Blitzen mit der Computer-Automatik des Blitzgeräts und bei TTL-Messung der Kamera bei allen Kamera-BelichtungsBetriebsarten wirksam. In der Programmautomatik er
setzt sie die feste Korrektur von –1 2/3EV
(Exposure Value – Belichtungswert), die ansonsten beim in Abhängigkeit vom vorhandenen
Licht automatisch gesteuerten Aufhellblitzbetrieb
vorgegeben wird. Weiteres zu manuellen BlitzBelichtungskorrekturen in der Kamera-Betriebsart
P
entnehmen Sie bitte dem entsprechenden
Abschnitt auf S. 64.
Hinweis:
Blitz- Belichtungskorrekturen sind nicht wirksam
bei Messblitz-Betrieb
F
und manuellem Blitzbetrieb, bei denen mit konstanter Leistung geblitzt
wird.
Mit Blitzaufhellung
Page 66

60
Einstellung von Blitz-Belichtungskorrekturen
am SCA 3501/3502M3-Adapter
Die Eingabe und Aktivierung einer Blitz-Belichtungskorrektur geschieht über drei Schalter
(beim SCA 3502M3 sind diese von einer Klappe
verdeckt). Am ersten Schalter wird die BlitzBelichtungskorrektur in ganzen Lichtwerten (EV-
Stufen) eingestellt, also –3 EV, -2 EV, ...., + 3 EV.
Am zweiten Schalter wird die Feinabstufung in
1
/3EV-Werten vorgenommen (–1/3EV, 0 EV oder
+
1
/3EV), so dass sich alle Werte von – 3 1/3EV
bis + 3
1
/3EV in Abstufungen von 1/3EV-Werten
einstellen lassen. Um die eingestellten Werte
wirksam werden zu lassen, wird der dritte Schalter auf ON gestellt.
Als Hinweis auf eine eingestellte Blitz-Belichtungskorrektur leuchtet außen am Adapter SCA
3501/3502M3 eine rote Leuchtdiode, bzw. bei
SCA-3002-Standard Blitzgeräten stattdessen in
dessen Displays Vorzeichen und Wert der Korrektur. Im Sucher erscheint rechts vom Blitzsymbol
ein oder (2.2).
Page 67

61
Einstellung von Blitz-Belichtungskorrekturen
an SCA-3002 Standard-Blitzgeräten
Mit Blitzgeräten des SCA 3002-Standards müssen Blitz-Belichtungskorrekturen direkt am Gerät
eingestellt werden. Einzelheiten zur Einstellung
sowie zu den entsprechenden Geräte-Anzeigen
entnehmen Sie bitte der jeweiligen Anleitung.
Als Hinweis für eine eingestellten Blitz-Belichtungskorrektur erscheint in allen Fällen im
Sucher der Kamera rechts vom Blitzsymbol ein
oder (2.2).
Einstellung von Blitz-Belichtungskorrekturen an
der Kamera in der Belichtungs-Betriebsart
m
Die manuelle Einstellung – und damit Fixierung von Verschlusszeit und Blende in der KameraBetriebsart
m
legt die Belichtung des Umgebungslichts fest. Infolgedessen beeinflusst eine
Belichtungskorrektur mit dem Hebel (1.26) an
der Kamera – nach erfolgtem Belichtungsabgleich - neben der Anzeige der Lichtwaage im
Sucher – in diesem Fall nur noch die Blitzbelichtung.
Die Blitzsteuerung in den vier Belichtungs-Betriebsarten mit einem SCA 3501/3502M3-Adapter
Programmautomatik Pund TTL-Blitzbetrieb
Die Programmautomatik
P
bietet eine vollautomatische Abstimmung von vorhandenem Licht
und Blitzlicht mit optimierter Steuerung für ausgewogene Aufnahmen durch situationsabhängig
erhöhte Anteile von vorhandenem und verringerte Anteile von Blitzlicht. Alternativ sind manuelle
Blitz-Belichtungskorrekturen (± 3
1
/3EV) möglich.
Für ein unbeschwertes Fotografieren mit Blitz
unter allen Bedingungen und eine automatische
Blitzaufhellung sind folgende Einstellungen vorzunehmen bzw. empfehlenswert:
1. Belichtungsbetriebsarten-Wählrad (1.11) auf
Stellung P,
2. Blende ganz schließen, d.h. den Blendenring
(1.12) auf den kleinsten Wert drehen (z.B.16
oder 22),
3. Verschlusszeiten-Einstellrad (1.16) z. B. auf 30 P,
4. Belichtungsmessmethoden-Wählhebel (1.15)
vorzugsweise auf Integralmessung , und
5. Blitzgerät mit Adapter SCA 3501/3502M3 auf
Stellung TTL.
Page 68

62
Abhängig vom vorhandenen Licht steuert die
Kamera die Belichtung des Umgebungs- und
Blitzlichts folgendermaßen:
a) TTL-Vollblitz bei schlechten
Lichtverhältnissen
Bei schlechten Lichtverhältnissen, z.B. in dunklen
Innenräumen, bei denen in Verbindung mit automatisch gesteuerten Verschlusszeiten (in Abhängigkeit von der verwendeten Brennweite) und der
größten Blende keine richtig belichtete Aufnahme
zu erwarten ist, wählt die Kamera automatisch
die Blende 5,6 und eine zur verwendeten Brennweite passenden Verschlusszeit (nach der
Faustregel für unverwackelte Aufnahmen aus der
Hand = 1/Brennweite, z.B. 1/60 s mit dem MacroElmarit-R 1:2,8/60 mm*) bis zur Synchronzeit
1/250s, und regelt den Blitz als Hauptlicht. Es
entsteht dann eine "normale" Blitzaufnahme.
*
Die Brennweiten-angepasste Einstellung der Verschlusszeiten
setzt die Verwendung von Objektiven mit Kontaktleiste, d.h.
ROM-Ausstattung voraus (siehe dazu "Ansetzen und Abnehmen
des Objektivs" und "Verwendung vorhandener Objektive und
Zubehör", S. 25 und 26). Bei Objektiven ohne ROM-Ausstattung arbeitet die Kamera in den beschriebenen Fällen
grundsätzlich mit 1/250s.
Die verwendeten Brenneiten/Verschlusszeit-Kombinationen
Brennweite Längste Verschlusszeit
15mm 1/15s
16-30mm 1/30 s
31-60mm 1/60 s
61-125mm 1/125s
Längere Brennweiten, bzw.
Obj. ohne ROM 1/250 s
Page 69

63
b) Automatische Blitzaufhellung bei
normalen Lichtverhältnissen
Bei normalen Lichtverhältnissen regelt die Kamera die Belichtungszeit automatisch mit einer zur
verwendeten Brennweite passenden Verschlusszeit (siehe oben unter Fall a) und wählt eine Blende entsprechend dem vorhandenen Licht, so
dass das Motiv – bereits ohne Blitz – richtig
belichtet wird.
Der Blitz wird jetzt von der Kamera als Aufhellicht gesteuert (-1
2
/3EV), um z.B. im Vordergrund dunkle Schatten oder Motive im Gegenlicht aufzuhellen und um insgesamt eine ausgewogenere Beleuchtung zu erhalten.
Die Anzeigen:
Im Sucher erscheint als Hinweis auf die automatische Blitz-Belichtungskorrektur zusätzlich zum
Blitzsymbol rechts daneben das Minus-Vorzeichen ( , 2.5).
c) Keine Blitzauslösung bei sehr großer
Helligkeit
Bei sehr großer Helligkeit, bei der im Blitzbetrieb
die 1/250s und selbst die kleinste Blende zu
einer Überbelichtung führen würden, löst die
Kamera den Blitz nicht aus. Zeit und Blende werden normal entsprechend der Programmautomatik geregelt und im Sucher angezeigt.
Das Blitzsymbol im Sucher (2.4) leuchtet trotzdem, da der Blitz aufgeladen ist.
Hinweis:
Manuelle Blitz-Belichtungskorrekturen werden
auch bei
P
grundsätzlich mit dem eingegebenen
Wert durchgeführt. Dies gilt selbst in den Fällen,
in denen die Kamera sonst automatisch auf Aufhellblitzen schalten würde (-1
2
/3EV).
Page 70

64
Manuelle Blitz-Belichtungskorrekturen in der
Kamera- Belichtungsbetriebsart
P
Die automatische Steuerung des Blitzlichts als
Aufhellung, wie oben unter Punkt b beschrieben,
ergibt bei der Mehrzahl der Motive einen angemessen ausgeleuchteten Vordergrund. Für die
Fälle, in denen die Motivteile im Vordergrund
keine durchschnittliche Helligkeit oder Reflektionseigenschaften aufweisen, wie auch für gewollte Unter- oder Überbelichtungen durch die
Blitzausleuchtung erlaubt die LEICA R9 auch in
der Betriebsart
P
eine individuelle Steuerung der
Blitzintensität.
Die Einstellung erfolgt wie in den Abschnitten
unter "Blitz-Belichtungskorrekturen" ab S. 58
beschrieben.
Die Anzeigen:
Im Sucher erscheinen als Hinweis auf die manuelle Blitz-Belichtungskorrektur zusätzlich zum
Blitzsymbol rechts daneben das jeweils zutreffende Vorzeichen. Bei einem Korrekturwert von 0
erscheint kein Vorzeichen.
Im Display von SCA-3002-Standard-Blitzgeräten
erscheinen Vorzeichen und Korrekturwert.
Zum Ausschalten einer manuellen Korrektur wird
1. die Blitz-Belichtungskorektur am Adapter oder
am Blitzgerät auf 0 zurückgestellt, und
2. an der Kamera das Belichtungsbetriebsarten-
Wählrad (1.11) aus der Position P auf eine
beliebige andere Stellung gedreht, und, zur
erneuten Verwendung der automatischen
Blitz-Belichtungskorrektur, zurück auf P.
Hinweis:
Falls die Korrektur nicht vor dem Verstellen des
Belichtungsbetriebsarten-Wählrads am Adapter
oder am Blitzgerät auf 0 zurückgestellt wird,
blinkt im Display von SCA-3002-Standard-Blitzgeräten danach noch der vorher manuell eingegebene, nun jedoch nicht mehr gültige Korrekturwert (es sei denn, es wäre –1
2
/3EV gewesen,
der der automatischen Korrektur entspricht).
Durch Wiederholen der Schritte 1 und 2 kann
dieses Blinken ausgeschaltet werden.
Page 71

65
Zeitautomatik Aund TTL-Blitzbetrieb
Für "normale" Blitzaufnahmen in Innenräumen
und allgemein bei schlechten Lichtverhältnissen.
Die Blende wird entsprechend dem Arbeitsbereich des Blitzgerätes und der gewünschten
Schärfentiefe frei gewählt, die Belichtungszeit
wird von der Kamera automatisch auf 1/250s
gesetzt. Falls diese Kombination aufgrund des
vorhandenen Umgebungslichtes zu einer Überbelichtung führen würde, blinkt die Zeitanzeige
225500
(2.9a). In diesem Fall sollte eine kleinere Blende
gewählt werden.
Blendenautomatik
T
und TTL-gesteuerte,
variable Blitzaufhellung
Für normale Aufnahmen mit vorhandenem Licht
und zusätzlicher Blitzaufhellung.
Alle Zeiten zwischen 16s und 1/250s sind frei
wählbar, die Blende ist manuell auf die Kleinstblende (z.B. 22) einzustellen. Bei eingestellten
kürzeren Zeiten schaltet die Kamera automatisch
auf die Blitzsynchronzeit 1/25 s. Die Blende wird
von der Kamera entsprechend dem vorhandenen
Licht automatisch gesteuert, so dass eine korrekte Belichtung des Motivs (bereits ohne Blitz)
gewährleistet ist.
Falls diese Kombination aufgrund des vorhandenen Umgebungslichtes zu einer Überbelichtung
führen würde, blinkt die Zeitanzeige
225500
(2.a)
(s. dazu „Wichtig“ und „Hinweise“ auf S. 50).
Der Blitz führt TTL-gesteuert zu einer Zusatzbeleuchtung. Am SCA-Adapter, bzw. am Blitzgerät
selbst (bei SCA 3002-Standard-Geräten) kann die
Blitzausleuchtung durch eine Belichtungskorrektur gezielt reduziert (z.B. – 2 EV) werden, so dass
im Vordergrund lediglich Schatten oder Motivteile
im Gegenlicht aufgehellt werden. Die natürliche
Beleuchtungssituation bleibt dadurch erhalten.
Page 72

66
Manuelle Belichtungssteuerung mund TTLgesteuerte, variable Blitzaufhellung
Die Belichtung mit vorhandenem Licht und der
Einfluss des Blitzlichtes können unabhängig voneinander gesteuert werden.
Zeit und Blende werden manuell mittels der
Lichtwaage (2.8) auf das vorhandene Licht abgestimmt. Alle Zeiten zwischen 16s und der Blitzsynchronzeit 1/250s können ausgeführt werden.
Der Einfluss des vorhandenen Lichtes und damit
auch die Helligkeit des Hintergrundes kann so
gezielt durch Über- oder Unterbelichtung beeinflusst werden. Die Wirkung des Blitzlichtes kann
am SCA Adapter, bzw. am Blitzgerät selbst (bei
SCA-3002 Standard-Geräten) geregelt werden.
Soll der Blitz nur zur Aufhellung dienen, wird eine
entsprechende Blitz-Belichtungskorrektur eingegeben (siehe dazu auch "Einstellung von BlitzBelichtungskorrekturen an der Kamera in der
Belichtungs-Betriebsart
m
", S. 61).
Blitzen mit der Blitzgeräte-eigenen ComputerAutomatik
Beim Arbeiten mit der Computer-Automatik der
Blitzgeräte und SCA 3501/3502M3 wird die vom
Motiv reflektierte Lichtmenge nicht von der
Kamera, sondern von einem im Blitzgerät integrierten Sensor gemessen und ausgewertet.
Wird am Verschlusszeiten-Einstellrad der Kamera
(1.16) die Stellung X gewählt, erfolgt die Belichtung immer mit der Blitzsynchronzeit 1/250 s.
Andernfalls laufen die Belichtungs-Betriebsarten
prinzipiell in der gleichen Weise wie ohne Blitz
ab. Als kürzeste Verschlusszeit wird jedoch die
Blitzsynchronzeit 1/250 s ausgeführt. Ergibt sich
aus dieser Begrenzung auf die Blitzsynchronzeit
eine Überbelichtung, so wird dies durch Blinken
der Zeitanzeige
225500
(2.9a) bei den automatischen
Belichtungs-Betriebsarten bzw. bei
m
durch die
Lichtwaage (2.8) im Sucher angezeigt.
Page 73

67
Da die Betriebsarten P, Aund Tbereits eine normal belichtete Aufnahme aufgrund des Umgebungslichtes erzeugen, sollte die Blitzleistung
verringert-, d.h. eine Blitz-Belichtungskorrektur
von z.B. –1 EV bis –2 EV eingestellt werden. Bei
modernen Blitzgeräten wird die am Objektiv eingestellte Blende an das Blitzgerät übertragen und
automatisch als Computerblende zugrundegelegt. Für die Messung werden die an der Kamera
eingestellte Filmempfindlichkeit, sowie ggfs. eingestellte Belichtungskorrekturen für das Umgebungslicht und Blitz berücksichtigt.
Manuelles Blitzen mit konstanter
Blitzleistung
Wird das Blitzgerät in der manuellen Blitzbetriebsart mit voller Leistung oder fester Teilleistung (soweit am Blitzgerät einstellbar) genutzt,
findet keine Steuerung der abgegebenen Blitzlichtmenge statt. Die Belichtungs-Betriebsarten
der Kamera laufen prinzipiell in der gleichen
Weise wie ohne Blitz ab, als kürzeste Verschlusszeit wird jedoch die Blitzsynchronzeit 1/250 s
ausgeführt. Ergibt sich aus dieser Begrenzung
eine Überbelichtung, so wird dies durch Blinken
der Zeitanzeige
225500
(2.9a) bei den automatischen
Belichtungs-Betriebsarten bzw. bei
m
durch die
Lichtwaage (2.8) im Sucher angezeigt.
Die einzustellende Objektivblende ergibt sich aus
Blitzleistung, Filmempfindlichkeit und Motiventfernung, oder umgekehrt, die einzustellende
Blitz-Teillichtleistung aus Blende, Filmempfindlichkeit, Brennweite und Motiventfernung (s. Anleitung Blitzgerät). Sie kann aber auch durch die
Kamera mit einem Messblitz ermittelt werden
(siehe "Messblitz-Betrieb vor der Aufnahme -
F
",
S. 76).
Page 74

68
Einstellung am Blitzgerät (mit SCA 3501/3502M3):
Kamera- TTL-Automatik Computer-Automatik Manuelles Blitzen
Einstellung mit fester Leistung
X oder B
(Betriebsart
beliebig)
m
A
T
Die Betriebsarten m, A, T,Psind nicht mehr wirksam, eine Belichtungsmessung für vorhandenes Licht erfolgt nicht. Die Belichtung wird generell mit 1/250 s bei X oder beliebig lange bei B und der manuell ein-
gestellten Blende ausgeführt. Das Blitzlicht wird entsprechend der Blitzbetriebsart gesteuert.
In der Betriebsart mkönnen Blitzaufnahmen mit Belichtungszeiten zwischen 1/250s und 16s durchgeführt werden. Das vorhandene Licht wird gemessen und über die Lichtwaage kontrolliert. Das Blitzlicht
wird entsprechend der Blitzbetriebsart gesteuert.
Die Zeitautomatik ist abgeschaltet,
es wird immer die 1/250s ausgeführt.
Die Blendenautomatik mit Zeitvorwahl
*)
ist aktiv und führt eine normale Aufnahme mit vorhandenem
Licht durch. Der zusätzliche Blitz
sollte daher mittels Blitz-Override reduziert werden.
Die jeweilige Automatik-Betriebsart (AoderT) führt eine
normale Aufnahme
*)
mit dem
vorhandenen Licht durch.
Der Blitz sollte daher mittels
Blitz-Override reduziert werden.
Die jeweilige Automatik-Betriebsart (AoderT) führt eine
normale Aufnahme
*)
mit dem
vorhandenen Licht durch.
Der Blitz kommt mit voller Leis-
tung hinzu.
Zusammenfassende Übersicht zum Blitzen mit SCA-3501/3502M3 - Adaptern
Page 75

69
Einstellung am Blitzgerät (mit SCA 3501/3502M3):
Kamera- TTL-Automatik Computer-Automatik Manuelles Blitzen
Einstellung mit fester Leistung
P
(bei Dunkelheit)
P
(bei normalen
Lichtverhältnissen)
P
(bei großer
Helligkeit)
Die Umgebungshelligkeit wird bei feststehender Blende 5,6 durch Wahl entsprechender Verschlusszeitwerte (bis zur
"Freihandgrenze" der verwendeten Brennweite = 1 :Brennweite [mit ROM-Objektiven, siehe S. 62]) berücksichtigt. Der Blitz
wird als Hauptlicht TTL-gesteuert.
Die Umgebungshelligkeit wird durch Wahl
entsprechender Blenden- und Verschlusszeitwerte (bis zur "Freihandgrenze" der
verwendeten Brennweite = 1: Brennweite
[mit ROM-Objektiven, siehe S. 62) berücksichtigt. Dazu wird zuerst nur die Blende
geöffnet und ab der vollen Öffnung ggfd.
die Verschlusszeit verlängert. Der Blitz
dient mit einer automatisch verringerten
Leistung (-1
2
/3EV) nur
zur Aufhellung.
Alternativ sind manuelle
Blitz-
Belich-
tungskorrekturen (±3
1
/3EV) möglich.
Da bei einer Blitzaufnahme mit der
1/250 s durch das Umgebungslicht
immer eine Überbelichtung zustande
kommen würde, wird der Blitz nicht
ausgelöst. Die Kamera arbeitet mit
der normalen Programmautomatik.
Die Betriebsart Pführt eine
normale Aufnahme
*)
mit dem
vorhandenen Licht durch.
Der Blitz sollte daher mittels
Blitz-Belichtungskorrektur reduziert
werden.
Die Betriebsart Pführt eine
normale Aufnahme
*)
mit dem
vorhandenen Licht durch.
Der Blitz kommt mit voller Leis-
tung hinzu.
*)
Als kürzeste Belichtungszeit wird die Blitzsynchronzeit 1/250s gewählt.
Page 76

70
Der Linear-Blitzbetrieb
(Mit entsprechend ausgestatteten Blitzgeräten (mit
HSS
-Betriebsart/-en) und SCA-3502M3 Adapter)
Die LEICA R9 erlaubt neben der beschriebenen
Blitzfotografie mit Verschlusszeiten bis zur Synchronzeit von 1/250 s auch das Blitzen mit
allen kürzeren Verschlusszeiten von 1/350 s bis
1/8000 s. Diese Blitztechnik eröffnet Ihnen neue
Möglichkeiten des Tageslicht-Aufhellblitzens, z.B.
wenn bei großer Helligkeit aus bildgestalterischen
Gründen trotzdem mit offener Blende fotografiert-, oder eine schnelle Bewegung "eingefroren"
werden soll.
Zur Technik:
Bei herkömmlicher Blitztechnik erfolgt die Blitzbelichtung durch die Abgabe eines - geregelten
oder ungeregelten – Lichtblitzes, dessen reflektiertes Licht bei offenstehendem Verschluss das
gesamte Bildfeld belichten kann.
Bei Schlitzverschlüssen wie in der LEICA R9 ist
das Bildfenster jedoch nur bis zu einer bestimmten Zeit – der Synchronzeit – für einen kurzen
Moment vollständig geöffnet.
Noch kürzere Zeiten können nur gebildet werden,
indem der 2. Verschlussvorhang bereits abläuft,
bevor der 1. das Bildfenster ganz freigegeben
hat. Infolgedessen kann das Bildfenster bei kürzeren Verschlusszeiten als dieser Synchronzeit
zu keinem Zeitpunkt vollständig von einem einzigen Lichtblitz erreicht werden.
Beim Linear-Blitzbetrieb wird dagegen durch Abgabe mehrerer Blitze in kürzester Folge annähernd
die Wirkung einer konstanten Lichtquelle erzeugt
und so während des Verschlussablaufs das gesamte Bildfeld gleichmäßig belichtet.
Linear-Blitzen ist wahlweise mit manueller- oder
TTL-Blitzsteuerung möglich, sowie mit den Kamera-Belichtungsbetriebsarten
m
und A.
Page 77

71
Hinweise:
Wegen der Verteilung der verfügbaren Energie
auf mehrere, kurz hintereinander erfolgende Blitze sind beim Linearblitzen die Leitzahlen, und
damit die erzielbaren Reichweiten, deutlich geringer als beim "normalen" Blitzbetrieb. Daher eignet sich der Linear-Blitzbetrieb vornehmlich für
die Aufhellung von Motiven im Vordergrund.
Wenn Verschlusszeiten von 1/250s oder länger
eingestellt (bei
m
), bzw. eingesteuert (bei A) sind,
schaltet die Kamera das Blitzgerät automatisch
auf den jeweiligen Betrieb mit normal gesteuertem Blitzlicht um. Zu erkennen ist dies auch an
den viel größeren Reichweiten im Display des
Blitzgeräts.
Wenn das Blitzgerät (noch) nicht betriebsbereit,
d.h. noch nicht (wieder) aufgeladen ist – die Blitzsymbole in Sucher- (2.4) und Rückwand- (3.5)
LCDs blinken – arbeiten die eingestellten Kamera-Betriebsarten normal und das Blitzgerät wird
nicht ausgelöst.
Der Linear-Blitzbetrieb ist bei aktivierter Spiegelvorauslösung nicht möglich (siehe den entsprechenden Abschnitt auf S. 82). In einem solchen
Fall schaltet die Kamera selbsttätig auf die
Synchronzeit zurück und es erfolgt eine normale
TTL-gesteuerte Blitzbelichtung.
Weitergehende Informationen entnehmen Sie
bitte der jeweiligen Blitzgeräte-Anleitung.
Page 78

72
Linear-Blitzen mit der Betriebsart
M HSS
des
Blitzgeräts
Für die totale Kontrolle über alle Parameter der
Belichtung.
Die Einstellungen im Einzelnen:
1. Belichtungsbetriebsarten-Wählrad (1.11) auf
Stellung m,
2. Verschlusszeiten-Einstellrad (1.16) auf den
gewünschten Wert (1/350 oder kürzer),
3. Blendenring (1.12) auf den gewünschten Wert
(vorzugsweise große Öffnungen, d.h. kleine
Werte),
4. Belichtungsmessmethoden-Wählhebel (1.15)
auf die gewünschte Methode,
5. zur Bestromung der Kamera den Auslöser
(1.17) antippen, und
6. am Blitzgerät
M HSS
einstellen.
Die Anzeigen:
Abweichend von den normalen Anzeigen in der
Kamera-Betriebsart
m
sind im Sucher abwechselnd die Zeitanzeige und zu sehen
(2.9 a/d).
Im Display des Blitzgeräts erscheinen M HSS, die
jeweils eingestellte Blitz-Leistungsstufe und die
sich daraus ergebende Reichweite.
Der Abgleich der Belichtung des Umlichts erfolgt
gemäß Lichtwaage der Kamera (siehe "Die manuelle
Einstellung von Blende und Belichtungszeit -
m
",
S. 51). Die Blitzbelichtung wird – anhand der
Anzeige im Blitzgeräte-Display - gemäß Leitzahlrechnung bestimmt. Dazu muss lediglich die im
Display des Blitzgeräts angegebene, jeweilige
Reichweite durch Einstellen von Verschlusszeit
und/oder Blende und/oder Blitzleistung an die
Motiventfernung angepasst werden.
Hinweise:
Beim Belichtungsabgleich für das Umlicht mit
Verschlusszeit und Blende gemäß Lichtwaage
kann die korrekte Blitzbelichtung für unterschiedliche Motiventfernungen ausschließlich über eine
manuelle Anpassung der Blitz-Abgabeleistungan
erreicht werden.
Durch Einstellung entsprechender Leistungsstufen sind auch bei
M HSS
-Betrieb Blitz-Belich-
tungskorrekturen möglich.
Page 79

73
Linear-Blitzen mit der Betriebsart
TTL HSS
des Blitzgeräts
Für TTL-gesteuerte Aufhell-Blitzbelichtungen (mit
vorgegebener –1 2/3EV-Korrektur) in Verbindung
mit selektiv gemessenem/n Vorblitz/en.
Hinweis:
Wird die Kamera ohne vorherige/n Vorblitz/e
ausgelöst, erfolgt je nach manuell eingestellter
oder automatisch eingesteuerter Verschlusszeit
entweder überhaupt keine Blitzauslösung - bei
kürzeren Zeiten als 1/250 s, oder - innerhalb des
normalen Synchronzeiten-Bereichs, eine TTLBlitzbelichtung anstatt einer Linear-Blitzbelichtung.
Die Einstellungen im Einzelnen:
1. Belichtungsbetriebsarten-Wählrad (1.11) auf
Stellung m oder A,
2. Verschlusszeiten-Einstellrad (1.16) bei
m
auf
den gewünschten Wert (1/350 oder kürzer),
bei
A
ist die Einstellung unwirksam,
3. Blendenring (1.12) auf den gewünschten Wert
(vorzugsweise große Öffnungen, d.h. kleine
Werte; der größte verfügbare Wert in dieser
Betriebsart ist 5,6)
4. Belichtungsmessmethoden-Wählhebel (1.15)
auf die gewünschte Methode,
5. zur Bestromung der Kamera den Auslöser
(1.17) antippen, und
6. am Blitzgerät
TTL HSS
einstellen.
Die Anzeigen:
Abweichend von normalem Blitzbetrieb erscheint
im Sucher rechts neben dem Blitzsymbol das
Minus-Vorzeichen (2.5), abwechselnd sind die
Zeitanzeige und zu sehen (2.9a/d) und das
Symbol für Selektimessung (2.3c) blinkt als Hinweis darauf, dass zur Ermittlung der Blitzbelichtung ein Vorblitz ausgelöst werden muss.
Im Display des Blitzgeräts wird die jeweils maximale Reichweite für diese Blitz-Betriebsart angezeigt.
Hinweis:
Werden größere Werte als 5,6 eingestellt, erscheint wieder die gewählte Belichtungs-Messmethode statt des blinkenden Selektivpunkts
und wechselt nicht mehr mit der Verschluss
zeit-Anzeige als Hinweis darauf, dass keine Vorblitz-Auslösung – und damit auch kein
HSS
Betrieb möglich ist.
Page 80

74
Die Bestimmung der Blitzbelichtung
1. Visieren Sie mit dem Selektivmessfeld der Einstellscheibe das entsprechende Motivdetail /
das Hauptmotiv an, und
2. lösen Sie durch vollständiges Niederdrücken
des Abblendschiebers (1.3) den Vorblitz aus
(je nach Motivhelligkeit und –Entfernung wird
die dadurch ausgelöste Anzahl an Vorblitzen
automatisch geregelt).
Hinweis:
Zum Auslösen von Vorblitzen muss die Kamera
aufgezogen, d.h. der Verschluss gespannt sein.
Die Anzeigen:
Im Sucher wird das blinkende Symbol für Selektimessung wieder durch das für die eingestellte
Messmethode ersetzt. Befindet sich das angemessene Motivteil außerhalb der Blitzreichweite,
d.h. ist es zu nah oder zu weit entfernt, erfolgt
für 4s eine / -Warnanzeige (2.9b).
Im Display des Blitzgeräts wird daraufhin die für
das angemessene Motivteil ermittelte maximale
Reichweite angezeigt.
Nach dem/n Vorblitz/en bleibt das Messergebnis der Kamera während einer auf 20 s verlängerten Haltezeit (d.h. solange die Anzeigen zu sehen
sind) unabhängig vom Ergebnis der Umlicht-Messung gespeichert, so dass Sie danach den Bildausschnitt frei und in Ruhe wählen können.
Unabhängig von der gespeicherten Blitzmessung
kann in der Kamera-Betriebsart
A
auch die
Umlichtmessung gespeichert werden.
Wenn anschließend die Kamera ausgelöst wird,
erfolgt auf der Grundlage des Messergebnisses
des/r TTL-Vorblitze/s eine Leitzahlgesteuerte,
d.h. auf die ermittelte Motiventfernung abgestimmte Aufhell-Blitzbelichtung mit einer automatischen Korrektur von –1
2
/3EV. Auch nach
der Aufnahme erfolgt die / -Warnanzeige
(2.9b) für 4s falls sich das angemessene Motivteil außerhalb der Blitzreichweite befand, d.h. es
zu nah oder zu weit entfernt war.
Page 81

75
Hinweise:
Es sind beliebig viele Vorblitz-Messungen vor der
Aufnahme möglich. Jede neue Messung "überschreibt" die vorherige.
Manuelle Blitzkorrekturen von ± 3
1
/3EV sind
auch im
TTL-HSS
-Betrieb als Alternative zur auto-
matischen –1
2
/3EV Korrektur möglich. Sie werden, wie in den Abschnitten "Blitz-Belichtungskorrekturen" auf S. 58 und "Manuelle BlitzBelichtungskorrekturen in der Kamera- Belichtungsbetriebsart
P
" auf S. 64 beschrieben, eingestellt und ausgeschaltet.
Bei manuell eingestellter (
m
) oder automatisch
gesteuerter (
A
) Verschlusszeit von 1/250s und
länger erfolgt ohne Vorblitz/en eine normale,
TTL-gesteuerte Aufhell-Blitzbelichtung. Mit Vorblitz/en erfolgt eine leitzahlgesteuerte AufhellBlitzbelichtung gemäß ermittelter Motivhelligkeit
auf der Grundlage des TTL-Vorblitz-Messergebnisses.
Für eine Kontrolle der Schärfentiefe ohne Vorblitz-Auslösung muss das Blitzgerät vorher ausgeschaltet werden.
Page 82

76
Messblitz-Betrieb vor der Aufnahme -
F
Die Messblitz-Funktion der LEICA R9 bietet die
Möglichkeit, die Lichtenergie von nicht TTL-steuerbaren Blitzgeräten (z.B. Studio-Blitzanlagen,
Blitzgeräte mit fester Leistung) zu messen, um so
ohne zusätzlichen Blitzbelichtungsmesser die
richtige Blende zu ermitteln. Gegenüber externen
Blitzbelichtungsmessern misst die LEICA R9
durch das Objektiv (TTL), was bei Filterverwendung, bei Vario-Objektiven veränderlicher Lichtstärke oder im Makrobereich entscheidende Vorteile bringt. Um bildwichtige Details oder z.B.
eine Graukarte gezielt anzumessen, geschieht
dies selektiv, entsprechend der Markierung auf
den Einstellscheiben.
Zur Messung wird das BelichtungsbetriebsartenWählrad (1.11) in Stellung F gebracht und mit
dem Selektivmessfeld der Einstellscheibe das
entsprechende Motivdetail anvisiert. Das Blitzgerät wird dann durch vollständiges Niederdrücken des Abblendschiebers (1.3) gezündet.
Nach der Blitzauslösung erscheint im Sucher
(Lichtwaage, 2.8d) und im Rückwanddisplay
(3.6c) die Belichtungs-Abweichung des Blitzes
gegenüber einer korrekten Belichtung im Bereich
von - 2,5EV bis + 2,5 EV in 0,5 EV-Stufungen. Abweichungen von 3 oder mehr EV-Werten werden
nicht mehr differenziert wiedergegeben und
machen eine erneute Messung mit geänderter
Blendeneinstellung erforderlich.
Als kürzeste Belichtungszeit kann die Blitzsynchronzeit der LEICA R9 (1/250 s) vorgegeben
werden. Sehr leistungsstarke Blitzgeräte und insbesondere Studioblitzanlagen haben oft Leucht-
Strahlengang bei Vorblitzmessung
Page 83

zeiten, die wesentlich länger sind. Um die Lichtmenge dieser Blitzgeräte voll nutzen zu können,
sind längere Zeiten, wie z.B. 1/180s oder 1/125s,
empfehlenswert. Der Messblitz- Betrieb funktioniert auch in Verbindung mit der Stroboskop-Einstellung am Blitzgerät. In diesem Fall wird die
Summe der ausgesandten Blitze gemessen und
ausgewertet. Diese Messmethode ist vorteilhaft,
wenn große Teile des Objektes an gleicher Stelle
verharren. Bei vielen Blitzgeräten beziehen sich
die Anzeigen über Blende und Reichweite auf
einen Einzelblitz. Diese Informationen können
vorteilhaft genutzt werden, wenn das Objekt
nicht an gleicher Stelle verharrt, sondern sich vor
dem Hintergrund bewegt.
77
Anzeigen vor der Messung
Anzeigen nach der Messung
1.3
Page 84

78
Stroboskop-Blitzbetrieb mit
SCA 3501/3502M3-Adapter
Diese Blitzmethode, bei der mehrere Blitze nacheinander während einer Belichtung abgegeben
werden, ist mit den Belichtungs-Betriebsarten
manuell
m
und Zeitautomatik Amöglich. Falls die
Kamerabetriebsarten
P
oder Tgewählt wurden,
erscheint im Sucher die Fehlermeldung
(3.6h, siehe "Fehlercodes", S. 80).
Im manuellen Betrieb werden die Belichtungszeit
zwischen 16s und 1/250s und die Blende manuell eingestellt; die Lichtwaage dient dabei zur
Kontrolle des vorhandenen Lichtes. Falls die
benötigte Zeit, die sich aus der gewählten Blitzanzahl und der Blitzfrequenz des Stroboskopblitzes ergibt, länger als die eingestellte Belichtungszeit ist, wird diese automatisch verlängert. Die
Lichtwaage (2.8a) ist weiterhin sichtbar und zeigt
an, wieweit sich dadurch eine Überbelichtung
durch das vorhandene Licht ergibt. Durch die
Blende kann dies wieder korrigiert werden.
Page 85

79
Beim Arbeiten mit der Zeitautomatik bildet die
Kamera die notwendige Zeit automatisch, abhängig von Blitzanzahl und Blitzfrequenz. Führt dies
zu einer Überbelichtung aufgrund des vorhandenen Lichtes, blinkt die Zeitanzeige.
Für eine gelungene Stroboskopaufnahme, bei der
z.B. mehrere Phasen eines Bewegungsablaufes
auf einem Bild festgehalten werden, sind der
Arbeitsbereich des Blitzgerätes, die Blitzanzahl,
die Entfernung und natürlich die Blende von entscheidender Bedeutung. Informationen dazu finden sich in der Anleitung des entsprechenden
Blitzgerätes.
Page 86

80
FehlerCode: Ursache: Abhilfe:
Kamera im Meßblitzbetrieb (
F
) und Blitzgerät auf manuell umstellen.
Blitzgerät auf TTL-Steuerung.
Kamera im Meßblitzbetrieb (
F
) und Blitzgerät auf manuell umstellen.
Blitzgerät auf Computer-Automatik.
Stroboskopblitz bei den Kamera- Kamera auf
m
oder Astellen.
betriebsarten
P
oder T.
Kamera im Meßblitzbetrieb (
F
) und Zeiteinstellring auf beliebige Zeit, außer X oder B.
Zeiteinstellring auf X, Blitzgerät im
Stroboskop-Betrieb.
Die Filmempfindlichkeit liegt unterhalb Die Meßblitzfunktion ist nur für Empfindlichkeiten
von ISO 25/15°. im Bereich von ISO 25/15° bis ISO 400/27° möglich,
Die Filmempfindlichkeit liegt oberhalb daher eine andere Empfindlichkeit benutzen.
von ISO 400/27°.
Warnanzeigen (Fehlercodes) bei Fehleinstellungen im Blitzbetrieb
Das manuelle Bedienungskonzept der Kamera
und die vielfältigen Möglichkeiten, insbesondere
mit Systemblitzgeräten, lassen auch Einstellun-
gen zu, die nicht sinnvoll sind. In diesen Fällen
erscheint im Sucher eine Fehlermeldung z.B.
:
Page 87

81
Der Selbstauslöser
Zur Verwendung des Selbstauslösers wird die
Abdeckklappe (1.33) der Rückwand geöffnet. Es
stehen zwei verschiedene Vorlaufzeiten zur Verfügung: 2 s oder 12s. Bei bestromter Kamera
wird beim ersten Antippen einer der beiden
Tasten (1.36) die Eingabe in Bereitschaft versetzt, am Rückwanddisplay (1.34) erscheint das
Selbstauslösersymbol (3.2) und OFF (3.6f). Durch
erneuten, kurzen Druck auf eine der beiden
Tasten wird nun eine der beiden Vorlaufzeiten
eingestellt.
Nach dem Antippen und Loslassen des Auslöseknopfes beginnt die Vorlaufzeit. Die jeweils verbleibende Zeit bis zur Auslösung wird auf dem
Rückwanddisplay angezeigt. Eine optische Anzei-
ge erfolgt durch Blinken der LED auf der KameraVorderseite (1.5). Das langsame Blinken geht ca.
2s vor der Auslösung in schnelles Blinken über.
Während der Vorlaufphase kann durch erneutes
Drücken einer der beiden Rückwand-Tasten der
Vorgang abgebrochen oder durch nochmaligen
Druck auf den Auslöser die Vorlaufzeit neu
gestartet, also verlängert werden.
Eine Vorlaufzeit kann nur bei gespanntem Verschluss eingestellt werden. Die Einstellung gilt
jeweils nur für eine Aufnahme, danach wird sie
automatisch zurückgenommen.
Aus Schutzgründen, und um ein versehentliches
Verstellen der Werte zu verhindern, sollte die
Abdeckklappe der Kamerarückwand beim Fotografieren immer geschlossen sein.
Hinweis:
Eine ablaufende Selbstauslöser-Vorlaufzeit wird
durch Abschalten der Kamera, d.h. durch Drehen
des Belichtungsbetriebsarten-Wählrades (1.11) in
die OFF-Position lediglich unterbrochen. Nach
erneutem Einschalten der Kamera erfolgt die
Aufnahme nach Ablauf der Rest-Laufzeit.
Page 88

82
Spiegelvorauslösung
Um die minimalen, restlichen Einflüsse von Spiegelbewegung und Schließen der Objektivblende
auszuschalten, bietet die LEICA R9 die Möglichkeit der Spiegelvorauslösung. Dazu wird der
Spiegelvorauslösungs-Wahlhebel (1.6) nach außen
bewegt. Beim ersten Betätigen des Auslösers
(1.17) klappt dann nur der Spiegel hoch, und die
Blende schließt auf den entsprechenden Wert.
Der Verschlussablauf und damit die eigentliche
Aufnahme erfolgt durch einen zweiten Druck auf
den Auslöser. Nach der Belichtung klappt der
hochgestellte Spiegel zurück, und die Blende öffnet sich wieder in gewohnter Weise. Wird die
nächste Aufnahme wieder ohne Spiegelvorauslösung gewünscht, muss der Wahlhebel wieder
zurückgestellt, d.h. nach innen bewegt werden.
Die Spiegelvorauslösung lässt sich zusätzlich mit
dem Selbstauslöser kombinieren. Dann wird
durch Niederdrücken des Auslösers der Spiegel
vorausgelöst, gleichzeitig startet mit dem Loslassen des Auslösers die Vorlaufzeit. Nach Ablauf
der Vorlaufzeit erfolgt die Aufnahme und der
Spiegel kehrt in die Normalstellung zurück. Für
verwacklungsfreies Fotografieren, z.B. mit langen
Brennweiten am Stativ, ist diese Kombination
sehr empfehlenswert.
Bei Benutzung einer Automatikbetriebsart
A, T
oder Perfolgt die Belichtungsmessung beim
ersten Betätigen des Auslösers, d.h. kurz vor der
Spiegelvorauslösung. Der Wert wird gespeichert
und die Aufnahme mit dieser Belichtung ausgeführt. In der Betriebsart
m
wird die Zeit-Blenden-
Kombination manuell vorgewählt.
1.6
Page 89

83
Nach der Spiegelvorauslösung muss die Aufnahme innerhalb von ca. 2min. ausgeführt werden,
da der Spiegel dann zwecks Batterieschonung
automatisch herunterklappt. Ein Bestromen (Auslöser antippen!) während dieser Wartezeit startet
die 2 min. erneut. Vor der nächsten Aufnahme
muss der Verschluss wieder neu gespannt werden. Um den Transport des Films dabei zu unterbinden, kann der Rückspulknopf vorher gedrückt
werden. Ein manuelles Zurücksetzen des hochgeklappten Spiegels ist nicht möglich.
Hinweis:
Ausschalten der Kamera durch Drehen des des
Belichtungsbetriebsarten-Wählrades (1.11) in die
OFF-Position lässt den Spiegel in seine Ausgangslage zurückklappen und beendet damit die
Funktion. Wird der Hebel jedoch nach erneuter
Inbetriebnahme der Kamera und vor der nächsten Aufnahme nicht wieder nach innen gestellt,
läuft die Funktion wie oben beschrieben ab.
Page 90

84
Mehrfachbelichtung
Für Mehrfachbelichtungen wird vor der ersten
Aufnahme der Mehrfachbelichtungs-Hebel (1.19)
über den Knopf zur Rückspulfreigabe (1.20)
bewegt, die Bildzählwerke blinken (1.22, 2.10a,
3.7a). Dadurch wird beim Betätigen des Spannhebels bzw. beim motorischen Aufzug nach der
ersten Belichtung nur der Verschluss gespannt,
der Film aber nicht weitertransportiert. Das Filmstück kann jetzt beliebig oft nochmals belichtet
werden.
Das Umlegen des Mehrfachbelichtungs-Hebels
aktiviert gleichzeitig eine "Filmbremse", so dass
der Film exakt im Filmkanal positioniert bleibt.
Vor der letzten Auslösung wird der Hebel wieder
zurückgeschwenkt. Dann wird nach der Belichtung der Film mit dem Spannhebel oder motorisch weitertransportiert.
Hinweis:
Bei der Verwendung der Motoren ist zu beachten, dass diese vor der letzten gewünschten
Belichtung durch Herausklappen des Schnellspannhebels (1.21) ausgeschaltet werden müssen. Ansonsten würde bei der darauf folgenden
Aufnahme erneut das gleiche Filmstück belichtet. Sofort nach Zurückstellen des Mehrfachbelichtungshebels können die Motoren wieder eingeschaltet- und wie gewohnt bedient werden
(siehe dazu auch die jeweiligen Anleitungen).
1.19
Page 91

Abblendtaste und Schärfentiefe
Die LEICA R9 misst die Belichtung bei offener
Objektivblende. Beim Betätigen des Schärfentiefeschiebers (1.3) schließt sich die Objektivblende
und ermöglicht deshalb die visuelle Beurteilung
des Schärfe-/Unschärfebereichs im Sucher (die
Belichtungsmessung zeigt dabei falsche Werte
an!). Das ist besonders bei Nahaufnahmen sehr
nützlich.
In den Kamera-Betriebsarten Messblitz
F
sowie -
im
TTL HSS
Betrieb des Blitzgeräts - mund
A
wird durch Betätigen der Abblendtaste auch der
Blitz ausgelöst. Während des Niederdrückens der
Abblendtaste ist die Auslösung blockiert.
Die Schärfentiefeskala der Objektive zeigt den
Bereich der Schärfentiefe für den jeweils eingestellten Objektabstand an. Ist z.B. das Objektiv
Summilux-R 1:1,4/50mm auf 5 m eingestellt, so
reicht die Schärfentiefe bei Blende 4 etwa von
4m - 8m, bei Blende 11 etwa von 3m - 20 m.
85
11
4
1.3
Page 92

86
Tipps zur Werterhaltung Ihrer LEICA R9 und
Objektive
Falls Ihre Leica längere Zeit aufbewahrt werden
soll, nehmen Sie bitte die Batterien heraus und
sorgen Sie für einen trockenen, ausreichend
belüfteten Lagerort. Fototaschen, die im Einsatz
nass geworden sind, sollten ausgeräumt werden,
um Beschädigungen Ihrer Ausrüstung durch
Feuchtigkeit und eventuell frei werdende Ledergerbmittel-Rückstände auszuschließen. Zum Schutz
gegen Pilzbefall (Fungus) beim Einsatz in feuchtheißem Tropenklima sollte die Kameraausrüstung
möglichst viel der Sonne und Luft ausgesetzt
werden. Ein Aufbewahren in dicht abgeschlossenen Behältern oder Taschen ist nur empfehlenswert, wenn zusätzlich ein Trockenmittel, wie z.B.
Silicagel, verwendet wird. Da jede Verschmutzung gleichzeitig Nährboden für Mikroorganismen darstellt, ist die Ausrüstung sorgfältig
sauberzuhalten.
Alle mechanisch bewegten Lager und Gleitflächen Ihrer LEICA R9 sind geschmiert. Bitte
denken Sie daran, wenn die Kamera längere Zeit
nicht benutzt wird: Um einer Verharzung der
Schmierstellen vorzubeugen, sollte die Kamera
etwa alle drei Monate ohne eingelegten Film
mehrfach aufgezogen und mit allen Verschluss-
zeiten ausgelöst werden. Ebenso empfehlenswert ist wiederholtes Verstellen und Benutzen
aller anderen Bedienelemente, wie z.B. Programmwahlschalter und DIN-ASA-Einstellung.
Auch die Objektivschnecken (Entfernungseinstellung) und Blendeneinstellringe sollten von Zeit zu
Zeit bewegt werden.
Ein Objektiv wirkt wie ein Brennglas, wenn praller Sonnenschein frontal auf die Kamera einwirkt. Die Kamera sollte deshalb auf keinen Fall
ohne Schutz vor starker Sonne weggelegt werden. Aufgesetzter Objektivdeckel, Kameraunterbringung im Schatten (oder gleich in der Tasche)
helfen, Schäden im Kamerainneren zu vermeiden.
Kamera und Objektive werden zur Beseitigung
von Flecken und Fingerabdrücken mit einem sauberen, fusselfreien Tuch abgewischt. Gröbere
Verschmutzungen in schwer zugänglichen Ecken
des Kameragehäuses lassen sich zweckmäßig
mit einer kleinen Bürste beseitigen. Bitte benutzen Sie zur Säuberung des Gehäuses keine spitzen oder scharfen Gegenstände – sie könnten
die Lackoberfläche der Deckkappe beschädigen.
Flüssige Reinigungsmittel sollten ebenfalls nicht
eingesetzt werden.
Page 93

87
Staub und Fusseln im Kamerainneren (z.B. auf
dem Spiegel oder der Filmführung) werden am
besten mit einem weichen Haarpinsel, der wiederholt in Äther entfettet und getrocknet werden
muss, vorsichtig entfernt. Dabei darf die Einstellscheibe, beispielsweise mit dem Schaft des Pinsels, nicht beschädigt werden.
Auf den Objektivaußenlinsen sollte normalerweise Beseitigung von Staub mit dem weichen Haarpinsel völlig ausreichen. Falls sie jedoch stärker
verschmutzt sind, können sie mit einem sehr
sauberen, garantiert fremdkörperfreien, weichen
Tuch mit kreisförmigen Bewegungen von innen
nach außen vorsichtig gereinigt werden.
Wir empfehlen Microfasertücher (erhältlich im
Foto- und Optikfachhandel), die im Schutzbehälter aufbewahrt werden, und bei Temperaturen
bis 40°C waschbar sind (kein Weichspüler, niemals bügeln!). Brillenreinigungstücher, die mit
chemischen Stoffen imprägniert sind, sollten
nicht benutzt werden, weil sie Objektivgläser
beschädigen können.
Optimalen Frontlinsenschutz bei ungünstigen
Aufnahmebedinungen (z.B. Sand, Salzwasserspritzer!) erreicht man mit farblosen UVa-Filtern,
die aber bei bestimmten Gegenlichtsituationen
und großen Kontrasten, wie jedes Filter, unerwünschte Reflexe verursachen können. Die generell empfehlenswerte Gegenlichtblende schützt
das Objektiv ebenfalls vor unbeabsichtigten Fingerabdrücken und Regen.
Notieren Sie die Fabrikationsnummern Ihrer
Kamera (auf der Bodenplatte Ihrer LEICA R9 eingraviert!) und Objektive, weil sie im Verlustfall
außerordentlich wichtig sind.
Page 94

Stichwortverzeichnis
Abblendschieber und Schärfentiefe .......................................85
Akademie, Leica...................................................................100
Auslöser, siehe Verschluss und Technische Daten...........18/98
Batterien ................................................................................12
- Automatische Kontrolle........................................................13
- Einlegen ...............................................................................12
- Hinweise zur Nutzung...........................................................13
Belichtung..............................................................................30
- Betriebsarten .......................................................................42
- Blendenautomatik -
T
.........................................................49
- Manuelle Einstellung von Blende und Belichtungszeit -
m
......51
- Variable Programmautomatik -
P
.......................................42
- Charakteristik und Anwendung der variablen
Programmautomatik........................................................44
- Programmverläufe bei verschiedenen Zeitvorgaben .....45/46
- Zeitautomatik -
A
...............................................................48
- Korrekturen..........................................................................36
- Anzeige der Belichtungskorrektur......................................36
- Beispiel für eine Korrektur nach Minus ..............................38
- Beispiel für eine Korrektur nach Plus.................................38
- Der Gesamt-Belichtung......................................................36
- Der Blitzbelichtung.............................................................58
- Eingabe und Löschen.........................................................37
- Messung/Grundsätzliches...................................................30
- Arbeitsdiagramm des Belichtungsmessers ..................40/41
- Arbeitsblendenmessung ....................................................39
- Belichtungsmessung durch das Objektiv (TTL-Messung)....30
- Offenblendenmessung.......................................................39
- Unterschreitung des Messbereichs....................................39
- Inbetriebnahme des Belichtungs-Messsystems .................29
- Messmethoden
- Anpassen des Belichtungsniveaus der
Mehrfeldmessung ..............................................................32
- Mehrfeldmessung ..............................................................31
- Mittenbetonte Integralmessung.........................................34
- Selektivmessung................................................................35
- Wählhebel ..........................................................................19
- Messwertspeicherung........................................................36
Blitzbetrieb.............................................................................52
- Allgemeines zur Verwendung von Blitzgeräten.....................52
- Bereitschafts- und Kontrollanzeigen ..................................57
- Blitzanschlussbuchse.........................................................55
- Blitz-Belichtungskorrekturen..............................................58
- Synchronzeit und Wahl des Synchronzeitpunktes..............53
- X-Kontakt...........................................................................55
- Blitzsteuerung mit SCA 3000/3002 kompatiblen
Blitzgeräten und SCA 3501/3502M3...................................56
- TTL-gesteuerte, automatische Blitzbelichtung....................61
- Blendenautomatik
T
und TTL-gesteuerte,
variable Blitzaufhellung....................................................65
- Manuelle Belichtungssteuerung
m
und
TTL-gesteuerte, variable Blitzaufhellung...........................66
- Programmautomatik
P
und TTL-Blitzbetrieb.....................64
- Übersichtstabelle zum Blitzen mit SCA 3501/3502M3...68/69
- Zeitautomatik
A
u. TTL-Blitzbetrieb..................................65
- Computer-Automatik .........................................................66
- Manuelles Blitzen...............................................................67
- Linearblitzen ........................................................................70
-
M HSS
................................................................................72
-
TTL HSS
.............................................................................73
- Messblitz-Betrieb vor der Aufnahme -
F
................................76
- Stroboskopblitz mit SCA 3501/3502M3..............................78
88
Page 95

89
CE-Hinweis.............................................................................u4
Einschalten der Kamera / - der Belichtungsmessung ............29
Fehlercodes ...........................................................................80
Film
- Einlegen ...............................................................................20
- Transportieren ...............................................................20/21
- Wechseln .............................................................................20
- Zurückspulen........................................................................21
Filmempfindlichkeit................................................................23
- Einstellen .............................................................................23
- Einstellbereich .....................................................................23
Gehäuse der Kamera .........................................................6/99
Infodienst, Leica ..................................................................101
Kundendienst / Customer Service, Leica ............................101
Linearblitz, siehe unter Blitzbetrieb
Mehrfachbelichtung ...............................................................84
Objektive
- Objektivwechsel...................................................................25
- Verwendung vorhandener Objektive und Zubehör ...............26
- LEICAFLEX SL/SL2- Objektive ohne R-Steuernocken........27
- Leica R-Objektive...............................................................26
- VISOFLEX-Objektive an der LEICA R9 ................................27
Okular, siehe Suchersystem
Pflegetipps für Ihre LEICA R9 und Objektive ..........................86
Richtiges Halten der Kamera..................................................28
Rückwanddisplay....................................................................10
- Einschalten der Beleuchtung ................................................11
Selbstauslöser........................................................................81
Spiegelvorauslösung ..............................................................82
Stromversorgung, siehe Batterien
Suchersystem ...................................................................14-16
- Anzeigen ..............................................................................8
- Augenmuschel wechseln..................................................15
- Okular einstellen..............................................................14
- Okularverschluss .............................................................15
- Schärfe/Entfernung einstellen.........................................16
Technische Daten...................................................................95
Tragriemen anbringen ..............................................................5
Verschluss, siehe Auslöser und Technische Daten...........18/98
Zubehör zur LEICA R9 ............................................................90
- Aufnahmefilter .....................................................................94
- Augenmuschel......................................................................91
- Einstellscheiben...................................................................90
- Korrektionslinsen.................................................................92
- MOTOR-DRIVE R8/R9..........................................................93
- MOTOR-WINDER R8/R9 ......................................................93
- Winkelsucher .......................................................................92
- Taschen................................................................................94
Page 96

Zubehör zur LEICA R9
Auswechselbare Einstellscheiben
Besondere Aufgaben erfordern maßgeschneiderte Systeme für ein schnelles und exaktes Arbeiten. Deshalb gibt es für die LEICA R9 neben der
Universalscheibe vier weitere Einstellscheiben:
• Die Vollmattscheibe (Best.-Nr.14344), z.B. für
den extremen Nahbereich und sehr lange
Brennweiten.
• Die Mikroprismenscheibe (Best.-Nr.14345), z.B.
für eine ungestörte Beurteilung des Bildaufbaus.
• Die Vollmattscheibe mit Gitterteilung (Best.-Nr.
14346), z.B. für Architektur-, Panorama- und
Reproaufnahmen (besitzt auch Markierungen
für die Herstellung von Diapositiven für TVWiedergabe).
• Die Klarscheibe (Best.-Nr. 14347) für die wissenschaftliche Fotografie, z.B. Mikro- oder
Astro-Aufnahmen.
90
Page 97

91
Die Mattscheiben werden einzeln in einem Behälter mit einer Wechselpinzette und einem Staubpinsel geliefert. Zum Wechseln der Scheiben ist
das Objektiv abzunehmen, die Scheibenhalterung
nach unten zu klappen und die Einstellscheibe mit
der Pinzette herauszunehmen.
Große Augenmuschel
Die flexible Augenmuschel zur Streulichtabschirmung (Best.-Nr. 14217) hält störendes Licht vom
Auge fern. Das Sucherbild wirkt dadurch noch brillanter.
Page 98

Korrektionslinsen
Um die Okulareinstellung über die eingebaute Verstellmöglichkeit von ± 2 Dioptrien hinaus zu verändern, stehen Korrektionslinsen von - 3 bis + 3
Dioptrien (in ganzen Dioptrienschritten) zur Verfügung. Zum Einsetzen einer Korrektionslinse wird
die Augenmuschel zunächst abgenommen (s. S. 15),
die Linse in die Okularaussparung gelegt und die
Augenmuschel wieder aufgeschoben. Eine Sicherheitsraste arretiert beide unverlierbar.
Winkelsucher
Am Repro-Stativ oder für Aufnahmen aus der
Froschperspektive erleichtert der Winkelsucher
(Best.-Nr. 14300) die Beobachtung des Sucherbildes. Durch einfaches Umschalten kann zusätzlich
eine 2 x-Lupe eingeschaltet werden. Zum Ansetzen des Winkelsuchers ist die Kamera-Augenmuschel vorher abzunehmen.
92
Page 99

93
LEICA MOTOR-WINDER R8/R9
Der Motor-Winder R8/R9 wird nach Abnahme des
Kamera-Batteriefaches angesetzt und gestattet
eine Aufnahmefrequenz von ca. 2 Bilder pro
Sekunde und eine motorische Rückspulung.
Die Batterien des Motor-Winder R8/R9 (2 x Typ
"123") übernehmen dann auch die Stromversorgung der Kamera.
Der Motor-Winder R8/R9 besitzt eine Anschlussmöglichkeit für Fernauslöser, externe Stromversorgung und Remote-Control R8/R9 mit eingebautem Timer.
LEICA MOTOR-DRIVE R8/R9
Der Motor-Drive R8/R9 wird nach Abnahme des
Kamera-Batteriefaches angesetzt. Es sind Aufnahmen mit Einzelauslösung oder einer Frequenz
von 2 und 4,5 Bilder pro Sekunde möglich. Der
Drive kann darüberhinaus zur motorischen Rückspulung genutzt werden. Zusätzlich bietet der
Motor-Drive R8/R9 auch eine Bracketing-Funktion,
d.h. es können automatisch immer 3 Aufnahmen
mit unterschiedlichen Belichtungswerten (jeweils
1
/2oder 1 EV-Wert Abweichung) vorgenommen
werden.
Der Akku-Pack des Motor-Drive R8/R9 übernimmt die Stromversorgung der Kamera. Der
Motor-Drive R8/R9 besitzt eine Anschluss möglichkeit für Fernauslöser, externe Stromversorgung und Remote-Control R8/R9 mit eingebautem Timer.
Page 100

Taschen
Für die LEICA R9 werden Breitschaftstaschen
angeboten, die hohen mechanischen Schutz für
die Kamera bieten. (Best.-Nr. 14519 für Kamera
ohne Motor-Winder R8/R9, Best.-Nr. 14527 für
Kamera mit Motor-Winder R8/R9.) Darüber hinaus stehen für umfangreiche Ausrüstungen mit
mehreren Objektiven und Zubehör verschiedene
Kombitaschen zur Verfügung.
Aufnahmefilter
Zur Verwendung an den Leica R-Objektiven steht
eine Reihe von Farb-, UVa- und Polfilter zur Verfügung.
Bei einer Belichtungsmessung durch das Objektiv
wird die Lichtabsorption durch Filter im allgemeinen automatisch berücksichtigt. Die verschiedenen Filme haben aber in den einzelnen spektralen
Bereichen eine unterschiedliche Empfindlichkeit.
Bei dichteren und extremeren Filtern können deshalb Abweichungen gegenüber der gemessenen
Zeit auftreten. So erfordern z.B. Orange-Filter in
der Regel eine Verlängerung um einen Blendenwert, Rot-Filter im Mittel um etwa zwei Blendenwerte. Ein allgemein gültiger Wert lässt sich nicht
angeben, da die Rotempfindlichkeit der Schwarzweiß-Filme sehr verschieden ist.
Mit Zirkular-Polarisationsfiltern kann wie bei normalen Filtern gemessen und eingestellt werden.
Linear-Polarisationsfilter sollten nicht verwendet
werden. Bei der Messung können Linear-Polarisationsfilter starke Abweichungen ergeben, da der
teildurchlässige Hauptspiegel selbst wie ein Polarisator wirkt und dadurch je nach Stellung des
Filters die Messung stark verfälscht wird.
94
 Loading...
Loading...