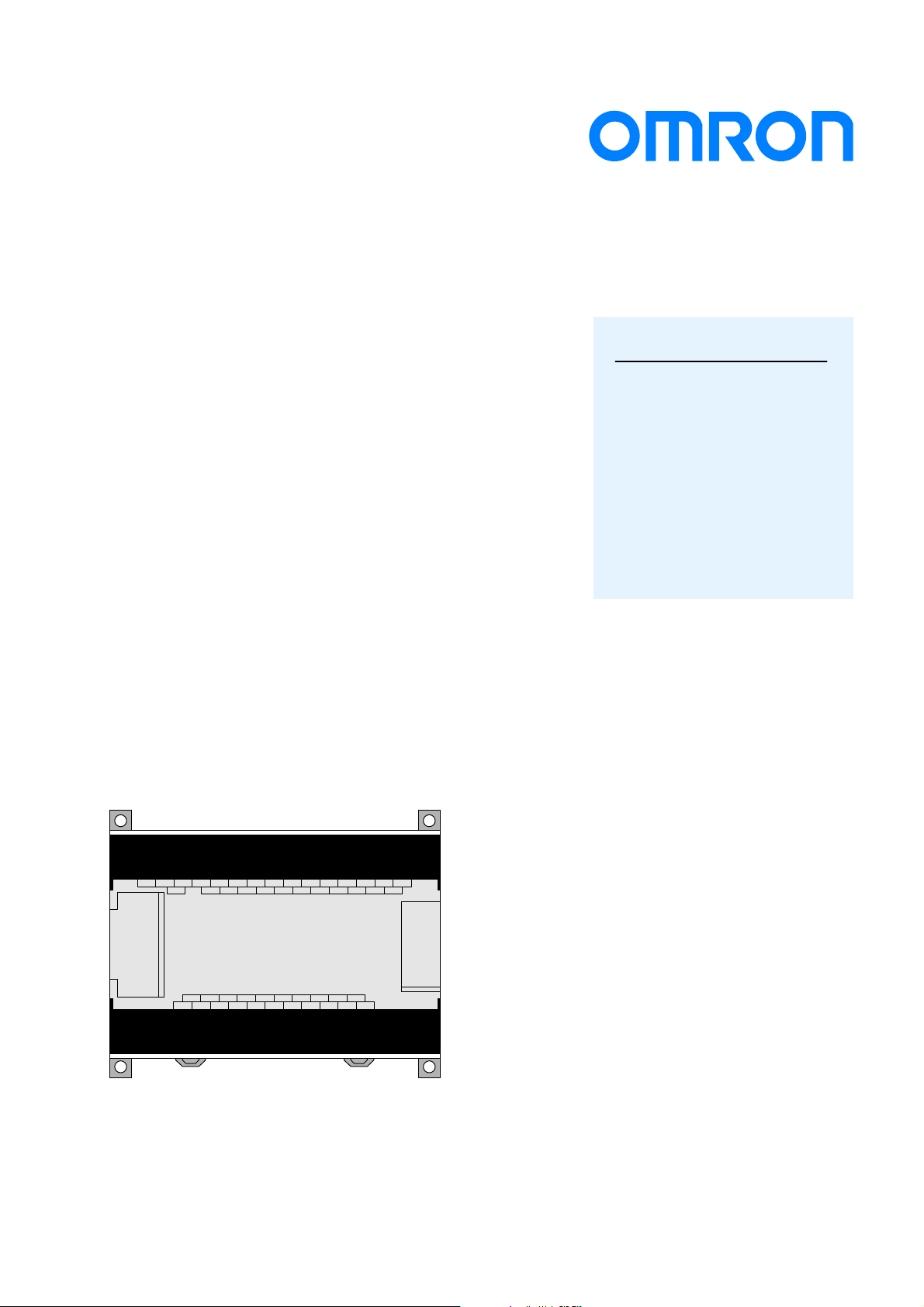
SYSMAC
Speicherprogrammierbare
Steuerung
CPM1A
Kurzübersicht
Spezifikation der Baugruppen 19
Installation und Verdrahtung 31.
Peripheriegeräte 59. . . . . . . . . . .
Testlauf und Fehlersuche 91. . .
Technisches Handbuch
W317–D1–2, Technisches Handbuch: SYSMAC CPM1A, 11.97
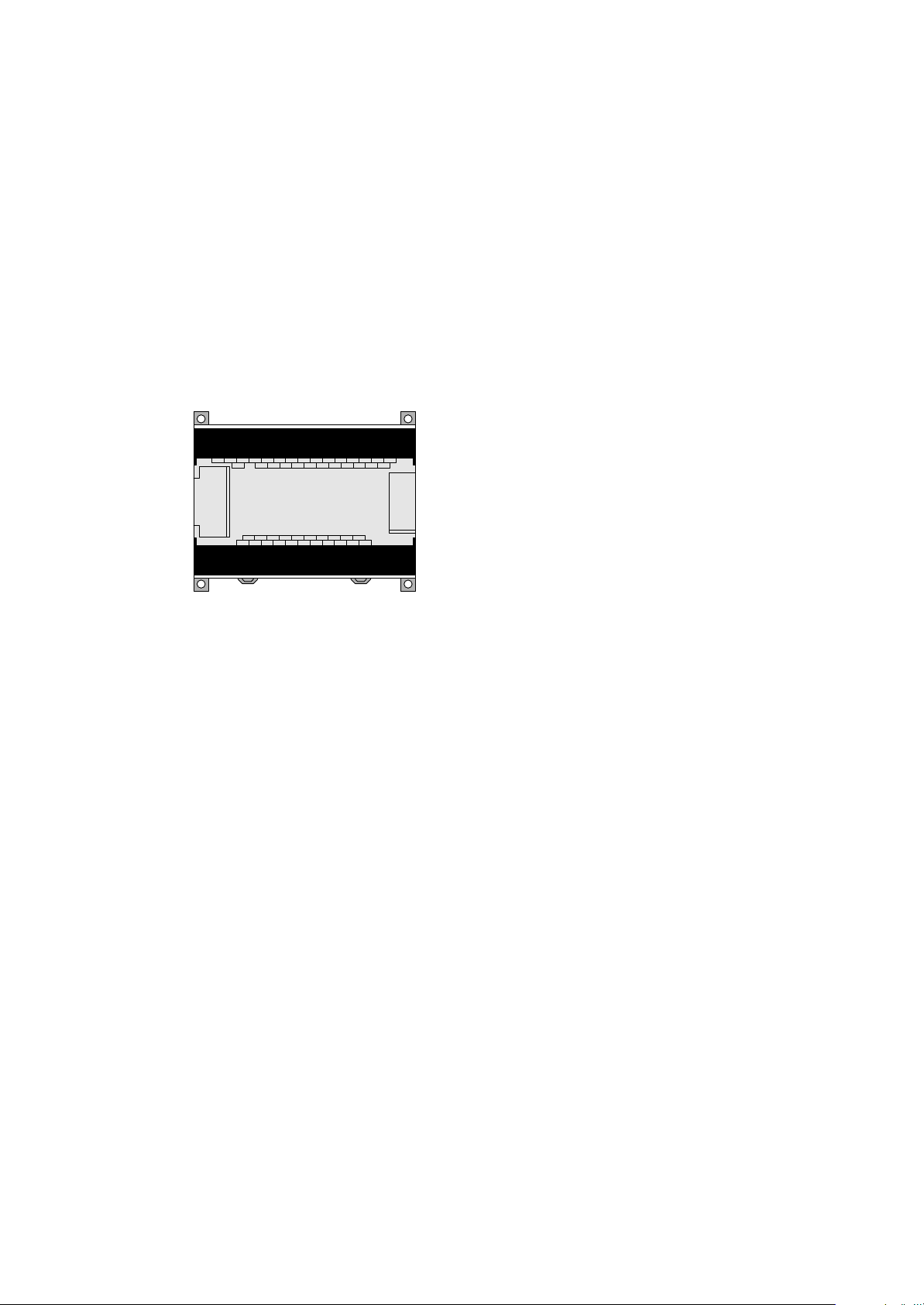
SYSMAC
Speicherprogrammierbare Steuerung
CPM1A
Technisches Handbuch
November 1997
I

E
Copyright by OMRON, Langenfeld, November 1997
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf in irgendeiner
Form, wie z.B Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren, ohne schriftliche
Genehmigung der Firma OMRON, Langenfeld, reproduziert, vervielfältigt oder
veröffentlicht werden.
Änderungen vorbehalten.
II

Vorwort
Das vorliegende Technische Handbuch der CPM1A erläutert die Systemkonfiguration, Installationsvorgänge sowie den Umgang mit der Programmierkonsole.
Lesen Sie dieses Handbuch vor Inbetriebnahme der SPS, um sich mit der
CPM1A vertraut zu machen.
Die CPM1A ist eine kompakte, hochleistungsfähige Speicherprogrammierbare
Steuerung (SPS). Zwei Handbücher stehen zur Verfügung:
CPM1A Technisches Handbuch (vorliegendes Handbuch und
CQM1/CPM1/CPM1A/SRM1
Das
CQM1/CPM1/CPM1A/SRM1
lierte Beschreibung der CPM1A–Programmierfunktionen.
Um die Arbeit mit diesem Handbuch für Sie besonders effizient zu gestalten,
beachten Sie bitte folgendes:
• Das Gesamt–Inhaltsverzeichnis finden Sie im direkten Anschluß an das Vorwort.
• Schenken Sie diesen Sicherheitshinweisen unbedingt Beachtung, da es anderfalls sowohl zu Schäden am Produkt als auch zu Personenschäden kommen kann.
Gefahr Ein Nichtbeachten hat mit hoher Wahrscheinlichkeit den Tod oder schwere
!
Personenschäden zur Folge.
Bedienerhandbuch.
Bedienerhandbuch
(W228)
gibt eine detai-
Achtung Ein Nichtbeachten hat möglicherweise den Tod oder schwere
!
Personenschäden zur Folge.
Vorsicht Ein Nichtbeachten kann zu leichten bis mittelschweren Personenschäden,
!
Sachschäden oder Betriebsstörungen führen.
Hinweis Gibt besondere Hinweise für den effizienten und sachgerechten Umgang mit
dem Produkt.
1, 2, 3...
1. Unterteilt Handlungsabläufe in einzelne Schritte, beinhaltet Checklisten
usw.
III

Inhaltsverzeichnis
Vorsichtsmaßnahmen 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 Zielgruppe 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Generelle Vorsichtsmaßnahmen 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Sicherheitsvorkehrungen 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 Betriebsumgebungs–Sicherheitsvorkehrungen 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitel 1 – Einführung 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1 Merkmale und Funktionen der CPM1A 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1-1 Merkmale der CPM1A 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1-2 E/A–Bitzuweisung 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1-3 CPM1A–Funktionen 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2 Systemkonfiguration 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2-1 CPU– und Erweiterungs–E/A–Baugruppen–Konfiguration 14. . . . . . . . . . . . . . . .
1-2-2 Host–Link–Kommunikation 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2-3 1:1 CPU–Link 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2-4 NT–Link–Kommunikation 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2-5 Anschlüsse der Peripheriegeräte 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitel 2 – Spezifikation der Baugruppen 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1 Leistungsmerkmale 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1-1 Allgemeine Merkmale 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1-2 Technische Daten 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1-3 E/A Spezifikationen 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2 Beschreibung der Baugruppen 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-1 CPU–Baugruppen 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-2 Erweiterungs–E/A–Baugruppe 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-3 Kommunikationsadapter 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitel 3 – Installation und Verdrahtung 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1 Vorsichtsmaßnahmen 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1-1 Verdrahtung der Spannungsversorgung 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1-2 Sicherheitstrennschalter 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1-3 Versorgungsspannung 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1-4 CPM1A Spannungsunterbrechungen 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2 Installationsort 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2-1 Umgebungsbedingungen 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2-2 Schalttafel/Schaltschrank–Installation 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3 Installion der CPM1A 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3-1 Anordnung der CPM1A 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3-2 Installation der CPM1A 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3-3 Anschluß einer Erweiterungs–E/A–Baugruppe 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V

3-4 Verdrahtung und Anschlüsse 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4-1 Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen bei der Verdrahtung 39. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4-2 Erdungsverdrahtung 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4-3 Verdrahtung der Spannungsversorgung 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4-4 Eingangsverdrahtung 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4-5 Ausgangsverdrahtung 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4-6 Peripheriegeräte–Anschluß 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4-7 Host–Link–Anschluß 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4-8 1:1–CPU–Link 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4-9 NT–Link–Anschluß 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitel 4 – Peripheriegeräte 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1 Programmierkonsolenbetrieb 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1-1 Kompatible Programmierkonsole 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1-2 Anschluß der Programmierkonsole 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1-3 Ändern der CPM1A–Betriebsart 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2 Programmierkonsolen–Funktion 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-1 Übersicht 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-2 Löschen des Speichers 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-3 Anzeigen/Löschen der Fehlermeldungen 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-4 Summton 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-5 Setzen und Anzeigen von Programmspeicher–Adressen 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-6 Befehls–Suche 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-7 Operanden–Bit–Suche 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-8 Einfügen und Löschen von Befehlen 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-9 Eingabe oder Editieren eines Programms 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-10 Überprüfen des Programms 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-11 Bit–/Wort–Überwachung 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-12 Flankenerkennungsüberwachung 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-13 Binärdaten–Überwachung 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-14 3-Wort Überwachung 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-15 Dezimale Überwachung mit Vorzeichen 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-16 Dezimale Überwachung ohne Vorzeichen 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-17 3-Wort–Datenänderung 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-18 Ändern der Zeitgeber/Zähler–Sollwerte 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-19 Hexadezimal–/BCD–Datenänderung 79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-20 Binärdaten–Änderung 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-21 Dezimale Datenänderung mit Vorzeichen 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-22 Dezimale Datenänderung ohne Vorzeichen 82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-23 Zwangssetzen, Zwangsrücksetzen 82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-24 Aufheben der Zwangssetzungen/Zwangsrücksetzungen 83. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-25 Hex-ASCII Anzeigeumschaltung 83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-26 Zykluszeitanzeige 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3 Programmierbeispiel 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3-1 Vorbereitende Maßnahmen 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3-2 Beispiel–Programm 86. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3-3 Programmieren 87. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3-4 Programmüberprüfung 89. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3-5 Test–Lauf in der MONITOR–Betriebsart 90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI

Kapitel 5 – Testlauf und Fehlersuche 91. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1 Systemüberprüfung und Testlauf 92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1-1 Systemüberprüfung 92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1-2 CPM1A Test–Lauf 92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1-3 Flash–Speicher–Vorsichtsmaßnahmen 93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2 Verarbeitungsablauf der CPM1A 93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3 Selbstdiagnose–Funktion 95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3-1 Geringfügige Fehler 95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3-2 Schwerwiegende Fehler 95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3-3 Fehlersuche 96. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3-4 Anwenderdefinierte Fehler 96. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-4 Programmierkonsolen–Fehlermeldungen 97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-5 Fehlersuche 97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-6 Ablaufdiagramm für Fehlerbehebung 99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-7 Wartung 106. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-8 Vorsichtsmaßnahmen während des Betriebs 107. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anhang A 109. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Standard–Baugruppen 109. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anhang B 111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abmessungen 111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII

Vorsichtsmaßnahmen
Dieses Kapitel beschreibt grundlegende Vorsichtsmaßnahmen im Umgang mit Speicherprogrammierbaren Steuerungen
(SPS) oder verwandten Geräten.
Diese Informationen sind sehr wichtig für eine sichere und zuverlässige Anwendung.
Lesen Sie die Vorsichtsmaßnahmen sorgfältig, bevor Sie mit der Installation beginnen.
1 Zielgruppe 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 Generelle Vorsichtsmaßnahmen 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 Sicherheitsvorkehrungen 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 Betriebsumgebungs–Sicherheitsvorkehrungen 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1

Sicherheitsvorkehrungen
1 Zielgruppe
Dieses Handbuch ist zum Gebrauch für die nachfolgenden skizzierten Personengruppen bestimmt, der darüberhinaus über Kenntnisse auf dem Gebiet
elektrischer Systeme verfügen sollte (Elektroingenieure):
• Personen, deren Aufgabengebiet die Installation von FA–Systemen ist.
• Personen, deren Aufgabengebiet der Entwurf von FA–Systemen ist.
• Personen, deren Aufgabengebiet der Betrieb und die Überwachung von
FA–Systemen ist.
2 Generelle Vorsichtsmaßnahmen
Der Anwender darf das Produkt nur entsprechend den in diesem Handbuch
niedergelegten Vorgaben einsetzen.
Stellen Sie sicher, daß die Nennleistungen und Betriebsmerkmale des Produkts den Anforderungen der Systeme, Maschinen oder Anlagen genügen.
Die Systeme, Maschinen und Anlagen ihrerseits sollten mit Doppel–Sicherheitsmechanismen ausgestattet sein.
Vorliegendes Handbuch enthält Informationen über das Programmieren und
den Betrieb einer OMRON–SPS. Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig, bevor Sie mit dem Programmieren beginnen. Halten Sie das Handbuch zur weiteren Information bereit.
Achtung Die SPS und die SPS–Baugruppen dürfen nur für die im Handbuch
!
spezifizierten Zwecke und nur unter den spezifierten Vorgaben eingesetzt
werden. Dies gilt insbesondere dann, wenn die Anlage als solche eine Gefahr
für Leib und Leben von Personen in sich birgt. Setzen Sie sich mit der
nächsten OMRON–Niederlassung in Verbindung, wenn Sie die SPS in einem
der oben erwähnten Systeme einsetzen wollen.
3 Sicherheitsvorkehrungen
Achtung Versuchen Sie keinesfalls bei noch anliegender Spannung eine Baugruppe
!
auszutauschen. Elektrischem Schlag -ggf. mit Todesfolge– kann die Folge sein.
Achtung Berühren Sie keinesfalls irgendwelche Klemmen, solange Spannung anliegt.
!
Elektrischer Schlag –ggf. mit Todesfolge– kann die Folge sein.
4 Betriebsumgebungs–Sicherheitsvorkehrungen
Vor Betrieb des Steuerungssystems sollte bei Vorliegen einer der nachstehend beschriebenen Umstände abgesehen werden:
• direkte Sonneneinstrahlung,
• Umgebungstemperatur und relative Luftfeuchtigkeit außerhalb der spezifi-
zierten Toleranzbereiche,
• Kondensation als Folge erheblicher Temperaturschwankungen,
• ätzende oder leicht entflammbare Gase
• Stäube (insbesondere Eisenstäube) oder Salze,
• Erschütterungen oder Vibrationen,
• Vorhandensein von Wasser, Öl oder Chemikalien.
• Führen Sie ausreichende Kontrollmessungen durch, wenn Sie auf die
nachfolgenden Umgebungsbedingungen treffen:
• elektrostatische oder andere Störungen,
• starke elektromagnetische Felder,
2

Sicherheitsvorkehrungen
• Auftreten von Radioaktivität,
• Nähe zu Netzleitungen.
Vorsicht Die Umgebungsbedingungen haben auf Lebensdauer und Zuverlässigkeit der
!
SPS einen erheblichen Einfluß. Unzureichende Umgebungsbedingungen können zu Fehlfunktion, Systemausfall und weiteren unvorhersehbaren Problemen im SPS–Betrieb führen. Stellen Sie sicher, daß die Umgebungsbedingungen sowohl bei der Installation als auch während des späteren Betriebs innerhalb der spezifizierten Toleranzbereiche liegen.
5 Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb
Beachten Sie die folgenden Sicherheitsmaßnahmen während des SPS–Betriebs.
Achtung Nichtbeachten der folgenden Sicherheitsmaßnahmen kann zu schweren und
!
schwersten Gesundheitsschäden führen.
• Erden Sie das System bei der Installation zum Schutz vor elektrischem
Schlag.
• Schalten Sie die Versorgungsspannung aus, bevor Sie eine der nachfolgend aufgezählten Handlungen vornehmen. Nichtbeachtung kann zur Erleidung eines elektrischen Schlages führen.
• Montage oder Austausch einer Baugruppe.
• Zusammenstellung der Baugruppen.
• Anschluß oder Entfernen von Kabeln und Verdrahtungen.
Vorsicht Führen Sie Online–Editieren nur aus, wenn Sie sicher sind, daß durch die da-
!
durch bedingte Verlängerung der Zykluszeit keine nachteiligen Folgen entstehen. Andernfalls können Eingangssignale nicht mehr gelesen werden.
Vorsicht Ziehen Sie die Schrauben der Klemmblöcke des AC–Netzteils mit dem in den
!
jeweiligen Handbücher angegebenen Drehmoment an. Gelockerte Schrauben
können zu Kurzschluß, Fehlfunktion oder Brand führen.
Vorsicht Benutzen Sie die Bits 08 bis 11 von DM 6601 nicht als Halte–Bit für das SPS–
!
Setup, falls die Spannungsversorgung für einen Zeitraum, der die Backup–Zykluszeit des integrierten Kondensators überschritten hat, unterbrochen wurde.
Gleiches gilt für die Bits 12 bis 15 von DM 6601 für das SPS Setup–Zwangssetzung–Halte–Bit (siehe Hinweis 1 und 2.)
Ist die CPM1A für einen langen Zeitraum ausgeschaltet, werden die über den
internen Kondensator gespeicherten Daten verloren gehen, auch wenn das
Halte–Bit und das Zwangssetzungs–Halte–Bit gesetzt sind. Die Daten nehmen zufällige Werte an.
Hinweis 1. Die Backup–Zykluszeit des internen Kondensators variiert abhängig von
der Umgebungstemperatur. Für nähere Informationen siehe
Technische Daten
Umgebungstemperatur von 25°C.
2. Die Backup–Zykluszeit in diesem Handbuch bezieht sich auf einen internen
Kondensator, der vollständig aufgeladen wurde. An der CPU–Baugruppe
muß mindestens 15 Minuten Spannung angelegt sein, bevor von einer
vollständigen Aufladung des Kondensators ausgegangen werden kann.
. Die Backup–Zykluszeit beträgt ca. 20 Tage bei einer
Seite 21,
3
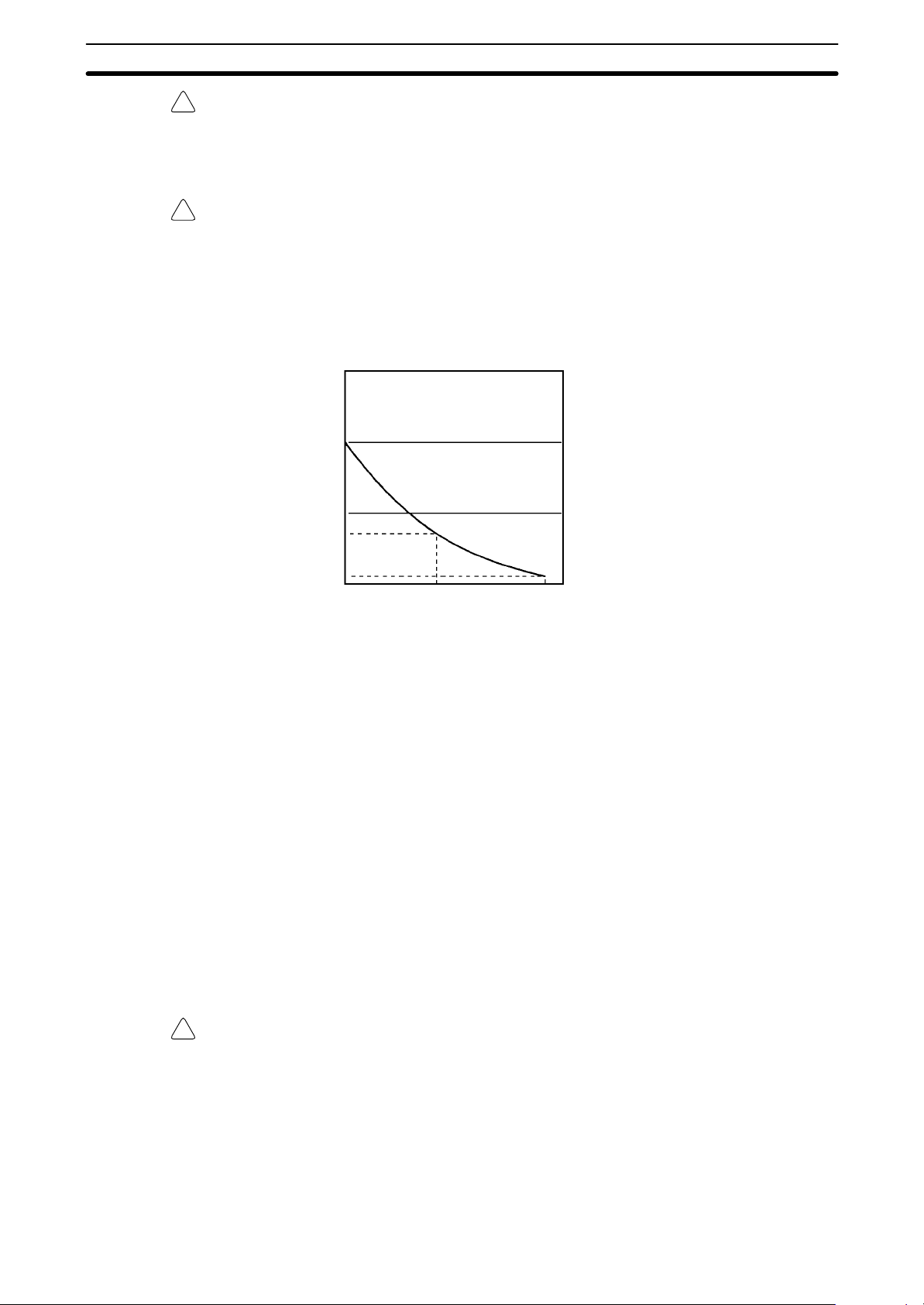
Sicherheitsvorkehrungen
Vorsicht Stellen Sie sicher, daß Sie den Speicher einer neugelieferten CPM1A lö-
!
Vorsicht Fügen Sie die CPM1A ausschließlich in ein System ein, daß keine zufälligen
!
schen. Wird der Speicher nicht gelöscht, hat der Inhalt der Speicherbereiche
Datenspeicher (DM), Haftmerker (HR), erweiterter Systemmerkerbereich (AR)
und Zähler (CNT) zufällige Werte.
Werte in den Speicherbereichen DM, HR, AR oder CNT als Folge zu langer
Versorgungsspannungunterbrechung aufweist.
• Ein in die CPU–Baugruppe integrierter Kondensator dient dazu, ein Backup
des Inhalts der Speicherbereiche DM, HR und AR durchzuführen. Die
Backup–Zykluszeit ist, wie durch den nachfolgenden Graph veranschaulicht, von der Umgebungstemperatur abhängig.
20
10
Backup–Zyklus (Tage)
7
1
25 40 80
Umgebungstemperatur (_C)
Überschreitet die Versorgungsspannungsunterbrechung die Backup–Zykluszeit, geht der Inhalt der Speicherbereiche DM, HR, AR und CNT verloren und
nimmt zufällige Werte an.
Ist der Inhalt des CPU–Programmspeicherbereichs verloren, wird, sobald die
CPM1A eingeschaltet wird, das im Flash–Speicher abgelegte Programm in
den CPU–Programmbereich zurückgelesen, während der Inhalt des Nur–Lesen–Speicherbereichs (DM 6144 bis DM 6599) und SPS–Setups (DM 6600
bis DM 6655) im Flash–Speicher gespeichert wird.
• Dabei ist zu beachten, daß, falls die Versorgungsspannung ausgeschaltet
wurde, ohne, daß die Betriebsart nach Durchführung der Änderungen im
DM–Speicherbereich (DM 6144 bis DM 6599) bzw. SPS–Setup (DM 6600
bis DM 6655) gewechselt wurde, die geänderten Daten nicht in den Flash–
Speicher gespeichert wurden. Wird also die Versorgungsspannung für länger als 20 Tage unterbrochen (bei 25_C), werden die geänderten Werte
(Inhalt des RAM–Speichers) verloren gehen bzw. zufällige Werte annehmen.
Die Änderungen können durch Umschalten der CPM1 in den RUN– oder MONITOR–Betrieb oder durch entsprechend zeitnahes Einschalten der CPM1A
gespeichert werden.
Vorsicht Nichtbeachtung der nachfolgenden Sicherheitsvorkehrungen kann zu Fehl-
!
funktionen oder Schäden an der SPS oder dem ganzen System führen.
• Legen Sie Spannung nur innerhalb der Toleranzwerte an.
• Nehmen Sie entsprechende Messungen vor, wenn Sie Grund zu der An-
nahme haben, daß die Versorgungsspannung instabil ist.
• Setzen Sie Schalter und Sicherungen ein, um Kurzschlüsse in der externen
Verdrahtung zu verhindern.
• Legen Sie keine Spannungsversorgung an, deren Leistung höher ist als die
Nennspannung der Eingangs–Baugruppen.
4

Sicherheitsvorkehrungen
• Legen Sie keine Spannungsversorgung an, deren Leistung höher ist als die
max. Schaltkapazität der Ausgangs–Baugruppen.
• Trennen Sie die LG–Klemme vom Netz, bevor Sie den Spannungstest
durchführen.
• Trennen Sie die SPS von der Netzleitung, wenn Sie eine der folgenden Arbeiten durchführen wollen:
• Ein– oder Ausbau von E/A–Baugruppen, CPU–Baugruppen, Speichermo-
dulen oder anderen Baugruppen,
• Aneinanderfügen von Baugruppen,
• Setzen von DIP– oder Drehschaltern,
• Anschluß von Leitungen oder Kabeln,
• Anschluß oder Entfernen von Steckern.
• Nehmen Sie davon Abstand Baugruppen zu zerlegen oder zu verändern.
Versuchen Sie nicht, Baugruppen selbst zu reparieren.
• Stellen Sie sicher, daß alle Schrauben, Klemmen und Kabelstecker mit
dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen sind.
• Sind Baugruppen–Lüftungsschlitze mit Staubschutzklebern versehen, sollten Sie diese solange dort belassen, bis alle Verdrahtungsarbeiten abgeschlossen sind. Der Aufkleber verhindert, daß Drahtabfälle in das Innere
der Baugruppe gelangen können.
• Entfernen Sie den Aufkleber vor Aufnahme des Betriebs, um eine ordnungsgemäße Wärmeableitung zu ermöglichen.
• Benutzen Sie für die Verdrahtung Kabelschuhe. Schließen Sie keine blanken, verdrillten Leitungen direkt an die Klemmen an.
• Überprüfen Sie die Verdrahtung sorgfälltig, bevor Sie Spannung anlegen.
• Überprüfen Sie Polarität und Richtungen, wenn Sie Klemmenblöcke oder
Stecker anschließen.
• Stellen Sie sicher, daß Klemmenblöcke, Speichermodule, Erweiterungskabel und andere Systemkomponenten mit Steckverbindungen beim Einbau
korrekt einrasten.
• Überprüfen Sie das von Ihnen erstellte Programm mehrfach, bevor Sie es
auf der SPS ablaufen lassen.
• Stellen Sie sicher, daß die Änderung der Betriebsart der SPS keine nachteiligen Folgen hat.
• Stellen Sie sicher, daß das Zwangssetzen und Zwangsrücksetzen des Relais–Kontakts keine nachteiligen Folgen hat.
• Stellen Sie sicher, daß das Setzen von Sollwerten keine nachteiligen Folgen hat.
• Stellen Sie sicher, daß nach Austausch einer CPU–Baugruppe der Betrieb
erst nach Rücksicherung des Datenspeicher–Backups wieder aufgenommen wird.
• Ziehen Sie nicht an Leitungen, biegen Sie diese nicht in ungewöhnliche
Winkel oder befestigen daran schwere Gegenstände.
• Beachten Sie bei der Installation von Baugruppen immer die Vorgaben dieses Handbuches.
5

Sicherheitsvorkehrungen
Vorsicht Die nachfolgenden Sicherheitsmaßnahmen müssen befolgt werden, um die
!
grundsätzliche Betriebssicherheit zu gewährleisten.
• Der Kunde muß entsprechende Maßnahmen einleiten, um auch für den
Fall falscher, fehlender oder abnormer Signale, bedingt durch unterbrochene Signalleitungen bzw. vorübergehende Spannungsunterbrechung, die
Sicherheit zu gewährleisten.
• Verriegelungs– und Begrenzungschaltungen oder ähnliche Sicherheitsmaßnahmen müssen vom Kunden für die externen Schaltungen (also nicht
innerhalb der SPS) installiert werden.
6

Dieses Kapitel beschreibt die Merkmale, Funktionen und Systemkonfigurationen der CPM1A.
1-1 Merkmale und Funktionen der CPM1A 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1-1 Merkmale der CPM1A 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1-2 E/A–Bitzuweisung 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-1-3 CPM1A–Funktionen 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2 Systemkonfiguration 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2-1 CPU– und Erweiterungs–E/A–Baugruppen–Konfiguration 14. . . . . . . . . . . . . . . .
1-2-2 Host–Link–Kommunikation 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2-3 1:1 CPU–Link 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2-4 NT–Link–Kommunikation 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1-2-5 Anschlüsse der Peripheriegeräte 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitel 1
Einführung
7
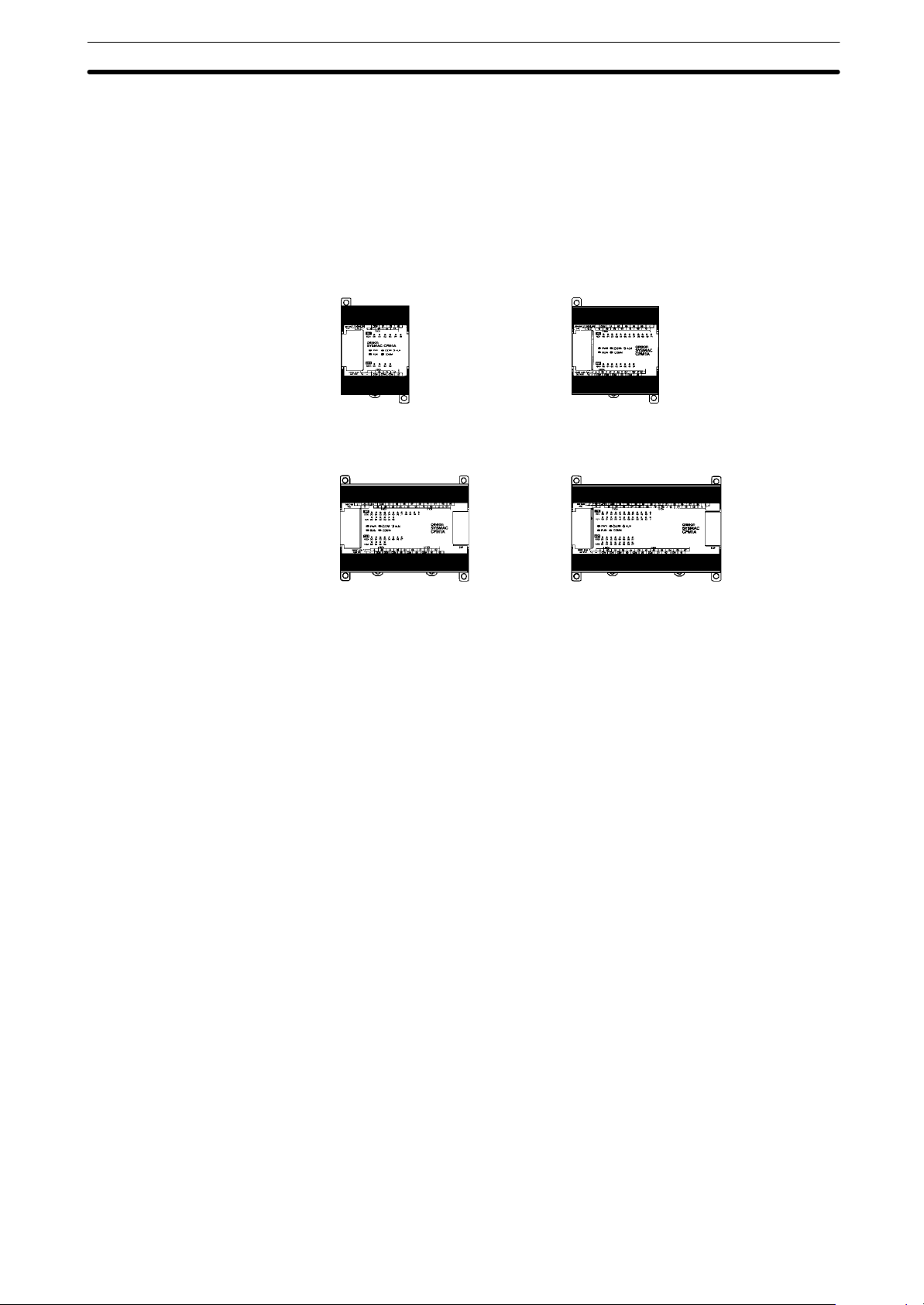
Merkmale und Funktionen der CPM1A Kapitel 1-1
1-1 Merkmale und Funktionen der CPM1A
1-1-1 Merkmale der CPM1A
Kompaktbauweise Die CPM1 ist eine in Kompakt–Bauweise konstruierte SPS mit entweder 10,
20, 30 oder 40 integrierten Ein–/Ausgängen. Drei Typen mit unterschiedlichen
Ausgangsbeschaltungen sind verfügbar: mit Relaisausgängen und mit
NPN–/PNP–Transistorausgängen.
Zusätzliche E/A–Kapazität
CPM1A-10CDR-j/10CDT-D/10CDT1-D
(10 Ein–/Ausgängen)
CPM1A-30CDR-j/30CDT-D/30CDT1-D
(30 Ein–/Ausgängen)
Bis zu drei Erweiterungs–E/A–Baugruppen mit jeweils 20 Ein–/Ausgängen
CPM1A-20CDR-j/20CDT-D/20CDT1-D
(20 Ein–/Ausgängen)
CPM1A-40CDR-j/40CDT-D/40CDT1-D
(40 Ein–/Ausgängen)
können an die CPU–Baugruppen CPM1A-30CDR-j/30CDT-D/30CDT1-D
oder CPM1A-40CDR-j/40CDT-D/40CDT1-D angeschlossen werden. Das
System kann somit bis auf max. 100 E/A ausgebaut werden.
Eingangsfilter–Funktion Die CPM1A ist mit einer Filterfunktion zur Unterdrückung von Störungen im
Eingangssignal ausgerüstet. Die Eingangszeitkonstante kann auf folgende
Werte eingestellt werden: 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms, 16 ms, 32 ms, 64 ms oder
128 ms.
Flash–Speicher Der Flash–Speicher benötigt keine separate Batterie.
Eingangs–Interrupts Bei der CPM1A-10CDR-j/10CDT-D/10CDT1-D können 2 Eingänge über das
Setup als Interrupt–Eingänge definiert werden; bei der CPM1A-20CDR-j/
20CDT-D/20CDT1-D, CPM1A-30CDR-j/ 30CDT-D/30CDT1-D und der
CPM1A-40CDR-j/40CDT-D/40CDT1-D können 4 Eingänge als Interrupt–Eingänge definiert werden. Zusätzlich zu normalen Eingangs–Interrupts verfügt
die CPM1A über eine Zähl–Betriebsart, die es ermöglicht, schnelle Eingangssignale zu zählen und Interrupts bei festen Zählwerten auszulösen.
Impuls–Speicherung Die Impuls–Speicherungs–Eingänge können Eingangssignale mit einer Puls-
weite von 0,2 ms, unabhängig von der Zykluszeit, erkennen. Impuls–Speicherungs–Eingänge und Interrupt–Eingänge verwenden die gleichen Eingangs–
Klemmen.
Intervall–Zeitgeber Die CPM1A verfügt über einen Intervall–Zeitgeber, der auf Werte zwischen
0,5 und 319.968 ms eingestellt werden kann. Der Zeitgeber kann entweder
einen einzelnen Interrupt (Monoflop–Betrieb) auslösen oder einen kontinuierlichen Interrupt (Periodischer Interrupt–Betrieb) wiederholen.
Schneller Zähler Die CPM1A verfügt über einen schnellen Zähler, der im Inkremental– oder
Aufwärts/Abwärts–Betrieb verwendet werden kann. Der schnelle Zähler kann
mit Eingangs–Interrupts kombiniert werden, um eine Bereichs–Vergleichs–
oder Sollwert–Steuerung durchzuführen, die nicht von der Zykluszeit der SPS
beeinflußt wird.
8
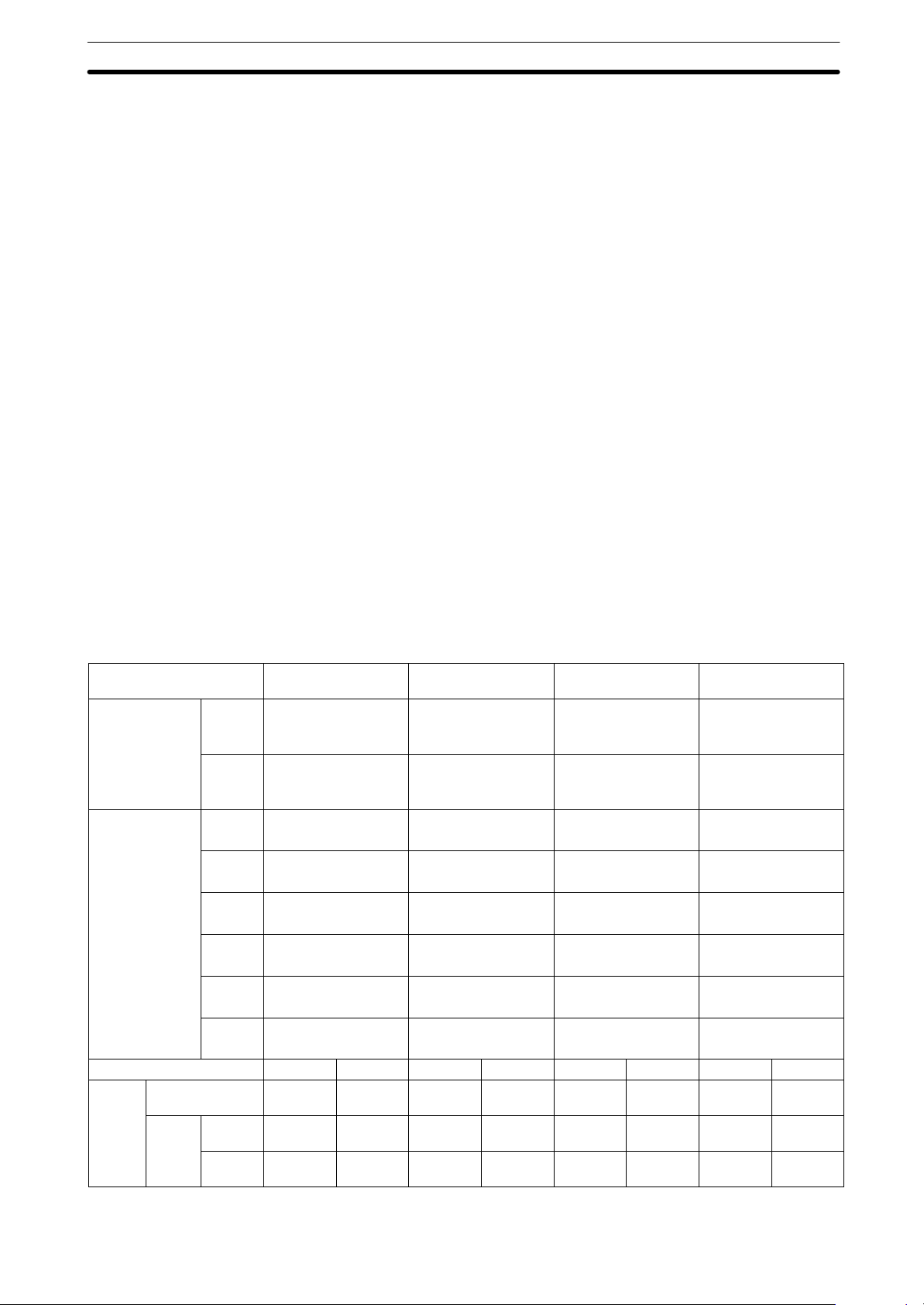
E/A–Baugruppen
Merkmale und Funktionen der CPM1A Kapitel 1-1
Puls–Ausgangsfunktion Verfügt die CPM1A über Transistorausgänge, können über die Puls–Aus-
gangsfunktion Impulse von 20 Hz bis 2 kHz (1–phasiger Ausgang) ausgegeben werden.
Einstell–Funktion Die CPM1A–SPS verfügt über 2 Analog–Regler zur manuellen Einstellung.
Host–Link–Kommunikation Die CPM1A kann über die Peripherie–Geräte–Schnittstelle an einen Indu-
strie–PC oder ein NT–Bedienterminal angekoppelt werden.
Für die 1:1–Kommunikation benötigen Sie einen RS–232C–Adapter und für
die 1:N–Kommunikation einen RS–422–Adapter.
1:1–CPU–Link Eine Datenverbindung kann mit einem Datenbereich einer anderen SPS
(CPM1A, CPM1, CQM1 oder C200Hj) erstellt werden.
Für den 1:1–CPU–Link–Kommunikation benötigen Sie einen RS–232C–Adapter.
NT–Link–Kommunikation Der direkte Zugriff auf die Speicherbereiche der CPM1A kann über ein NT–
Bedienterminal (mit NT–Link–Schnittstelle) realisiert werden. Sie benötigen
dazu einen RS–232C–Adapter.
Standard–Peripheriegeräte Für die CPM1A können die gleichen Programmierkonsolen und die gleiche
Programmiersoftware (SYSWIN) wie für die SPS der C200Hj–Serie, der
CQM1 und SRM1 verwendet werden.
Hinweis Die CPM1A mit Relaisausgängen entspricht nicht den EU–Richtlinien. Benut-
zen Sie innerhalb der EU die CPM1, die den CE–Kennzeichnungsanforderungen entspricht. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem zuständigen
OMRON–Vertriebsbüro.
1-1-2 E/A–Bitzuweisung
In der folgenden Tabelle ist die IR–Bitzuweisung für die Ein–/Ausgänge der
CPU– und Erweiterungs–E/A–Baugruppen dargestellt.
Anzahl der E/A der CPU–
Baugruppe (gesamt)
CPU–
Baugruppen
CPM1A-20EDR
Erweiterungs–
–
Spannungsversorgung AC DC AC DC AC DC AC DC
Modell–
Nummer
Relaisausgang CPM1A-
Transistor
ausgänge
Ein–
gänge
Aus–
gänge
Ein–
gänge
pp
Aus–
gänge
Ein–
gänge
Aus–
gänge
Ein–
gänge
Aus–
gänge
NPN --- CPM1A-
PNP --- CPM1A-
10 20 30 40
6 Eingänge:
00000 bis 00005
4 Ausgänge:
01000 bis 01003
--- --- 12 Eingänge:
--- --- 8 Ausgänge:
--- --- 12 Eingänge:
--- --- 8 Ausgänge:
--- --- 12 Eingänge:
--- --- 8 Ausgänge:
10CDR-A
CPM1A10CDR-D
10CDT-D
10CDT1-D
12 Eingänge:
00000 bis 00011
8 Ausgänge:
01000 bis 01007
CPM1A20CDR-A
--- CPM1A-
--- CPM1A-
CPM1A20CDR-D
20CDT-D
20CDT1-D
18 Eingänge:
00000 bis 00011
00100 bis 00105
12 Ausgänge:
01000 bis 01007
01100 bis 01103
00200 bis 00211
01200 bis 01207
00300 bis 00311
01300 bis 01307
00400 bis 00411
01400 bis 01407
CPM1A30CDR-A
--- CPM1A-
--- CPM1A-
CPM1A30CDR-D
30CDT-D
30CDT1-D
24 Eingänge:
00000 bis 00011
00100 bis 00111
16 Ausgänge:
01000 bis 01007
01100 bis 01107
12 Eingänge:
00200 bis 00211
8 Ausgänge:
01200 bis 01207
12 Eingänge:
00300 bis 00311
8 Ausgänge:
01300 bis 01307
12 Eingänge:
00400 bis 00411
8 Ausgänge:
01400 bis 01407
CPM1A40CDR-A
--- CPM1A-
--- CPM1A-
CPM1A40CDR-D
40CDT-D
40CDT1-D
9
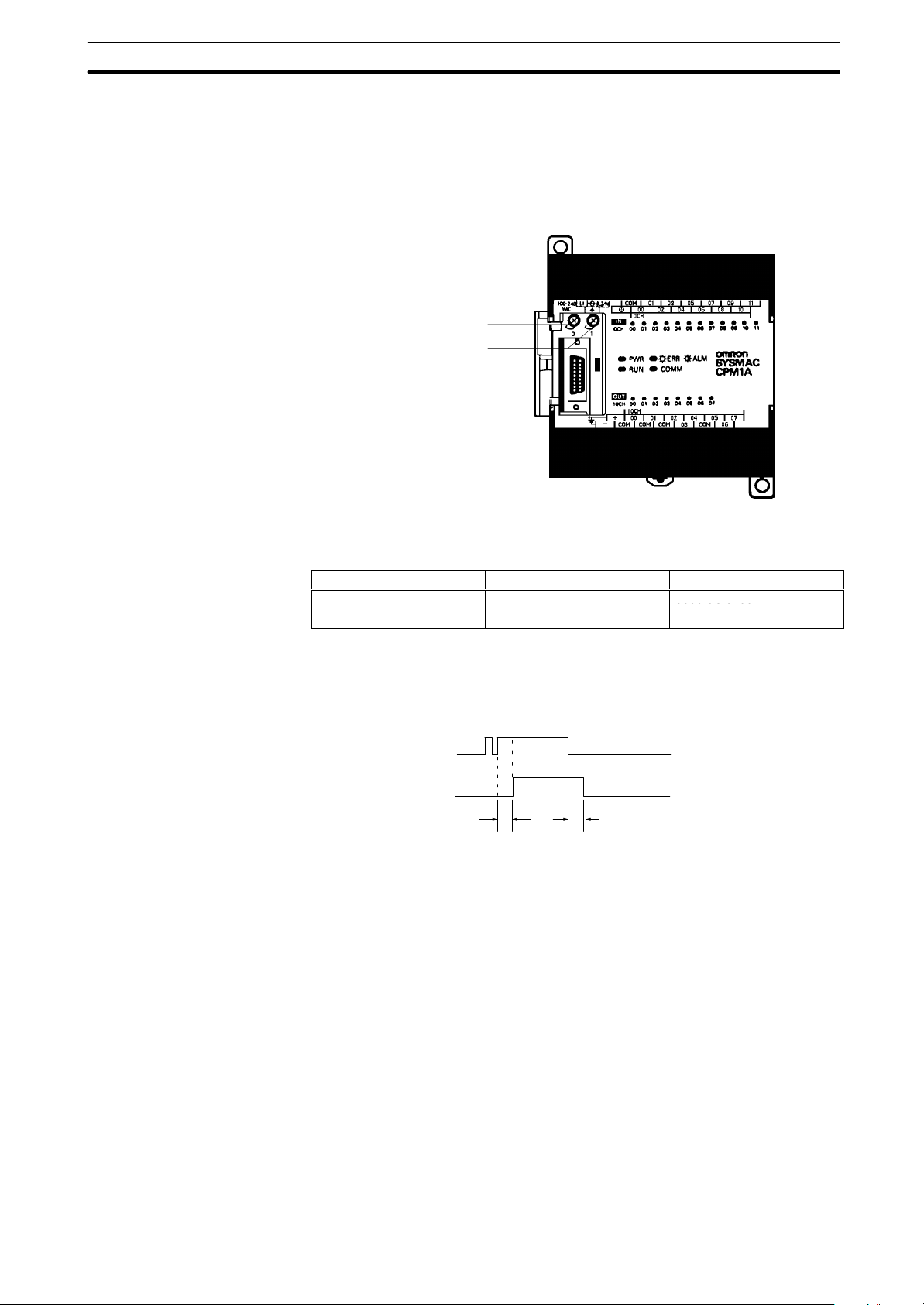
0000 b s 0 00
Merkmale und Funktionen der CPM1A Kapitel 1-1
1-1-3 CPM1A–Funktionen
Analog–Einstell–Funktion Über 2 Analog–Regler der CPM1A können manuell Zähler– und Zeitgeber-
werte eingestellt werden. Den entsprechenden Worten des IR–Bereiches werden automatisch Werte zwischen 0 und 200 (BCD) zugewiesen.
Stellen Sie die Regler mit einem Kreuzschlitz–Schraubendreher ein.
Analog–Regler 0
Analog–Regler 1
24
VDC
0.2 A
OUT
PUT
Die nachfolgende Tabelle zeigt an, welche IR–Bits den Analog–Reglern der
CPM1A–CPU–Baugruppe zugewiesen werden.
Regler Entsprechendes IR–Wort Einstell–Bereich (BCD)
Analog–Regler 0 IR 250
Analog–Regler 1 IR 251
0000 bis 0200
Eingangsfilter–Funktion Die Eingangszeit–Konstante für die externen Eingänge der CPM1A kann auf
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 oder 128 ms eingestellt werden. Das Vergrößern der Eingangszeit–Konstante führt zur weiteren Reduzierung von Eingangssignal–
Störungen.
Eingangssignal von bspw.
einem Grenztaster
Eingangs–
Bitstatus
t
t
[t ¢ Eingangszeitkonstante]
Eingangs–Interrupts Bei der CPM1A-10CDR-j/10CDT-D/10CDT1-D können 2 Eingänge als Inter-
rupt–Eingänge und bei den CPM1A-20CDR-j/20CDT-D/20CDT1-D,
CPM1A-30CDR-j/ 30CDT-D/30CDT1-D und CPM1A-40CDR-j/40CDTD/40CDT1-D können 4 Eingänge als Interrupt–Eingänge definiert werden. Es
gibt zwei Betriebsarten für die Eingangs–Interrupts: Eingangs–Interrupt–Betriebsart und Zähl–Betriebsart.
10
1, 2, 3...
1. Wenn ein Interrupt in der Eingangs–Interrupt–Betriebsart auftritt, wird das
Hauptprogramm unterbrochen, und das Interruptprogramm wird sofort
ausgeführt, ohne Rücksicht auf die Zykluszeit.
2. In der Zähl–Betriebsart werden schnelle externe Eingangssignale gezählt
(bis zu einem1 kHz). Ein Interrupt wird dann ausgelöst, wenn der vorgegebene Sollwert ereicht wird. Dann wird das Hauptprogramm unterbrochen
und das Interruptprogramm ausgeführt. Der Sollwert kann auf einen Wert
zwischen 0 und 65.535 eingestellt werden.
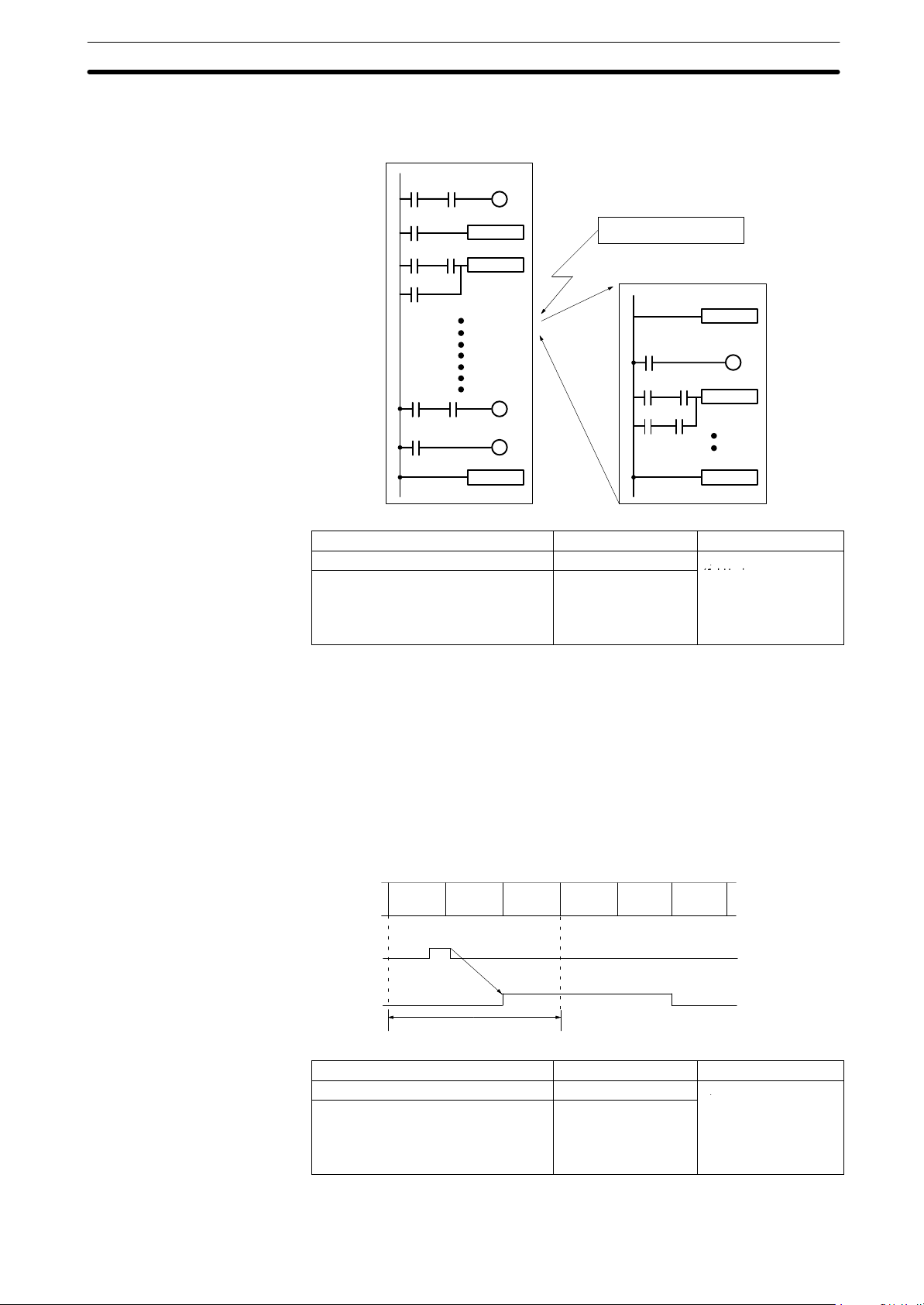
0,3 s
0, s
Merkmale und Funktionen der CPM1A Kapitel 1-1
Das folgende Diagramm zeigt den Programmablauf an, wenn ein Interrupt
auftritt.
Hauptprogramm
MOV
ADD
END
CPU–Baugruppe Eingangs–Bits Ansprechzeit
CPM1A-10CDR-j/10CDT-D/10CDT1-D IR 00003 bis IR 00004
CPM1A-20CDR-j/20CDT-D/
20CDT1-D/30CDR-j/
30CDT-D/30CDT1-D/
40CDR-j/40CDT-D/
40CDT1-D
IR 00003 bis IR 00006
Eingangsinterrupt
Interruptprogramm
SBN00
MOV
RET
0,3 ms
(1 kHz in
Zähler–Betriebsart)
Hinweis Die Eingangsbits IR 00003 bis IR00006 können auch als normale Eingänge
benutzt werden.
Impuls–Speicherungs–
Eingänge
Die CPM1A-10CDR-j/10CDT-D/10CDT1-D verfügt über 2 und die
CPM1A-20CDR-j/20CDT-D/20CDT1-D, CPM1A- 30CDR-j/30CDTD/30CDT1-D und CPM1A-40CDR-j/40CDT-D/40CDT1-D über 4 Impulsspeicherungs–Eingänge. (Für die Interrupt–Eingänge und die Impulsspeicherungs–Eingänge werden die gleichen Klemmen benutzt.)
Impulsspeicherungs–Eingänge haben einen internen Puffer, so daß Eingangssignale mit einer Pulsbreite von min. 0,2 ms innerhalb eines Zyklus erkannt
werden.
Über
wachung
Eingangs
signal
(00003)
IR 00003
CPU–Baugruppe Eingangsbits Min. Pulsweite
CPM1A-10CDR-j/10CDT-D/10CDT1-D IR 00003 bis IR 00004
CPM1A-20CDR-j/20CDT-D/
20CDT1-D/30CDR-j/
30CDT-D/30CDT1-D/
40CDR-j/40CDT-D/
40CDT1-D
Programm−
ausführung
Ein Zyklus
E/A−
Auffrischung
Über−
wachung
IR 00003 bis IR 00006
Programm−
ausführung
E/A−
Auffrischung
0,2 ms
11
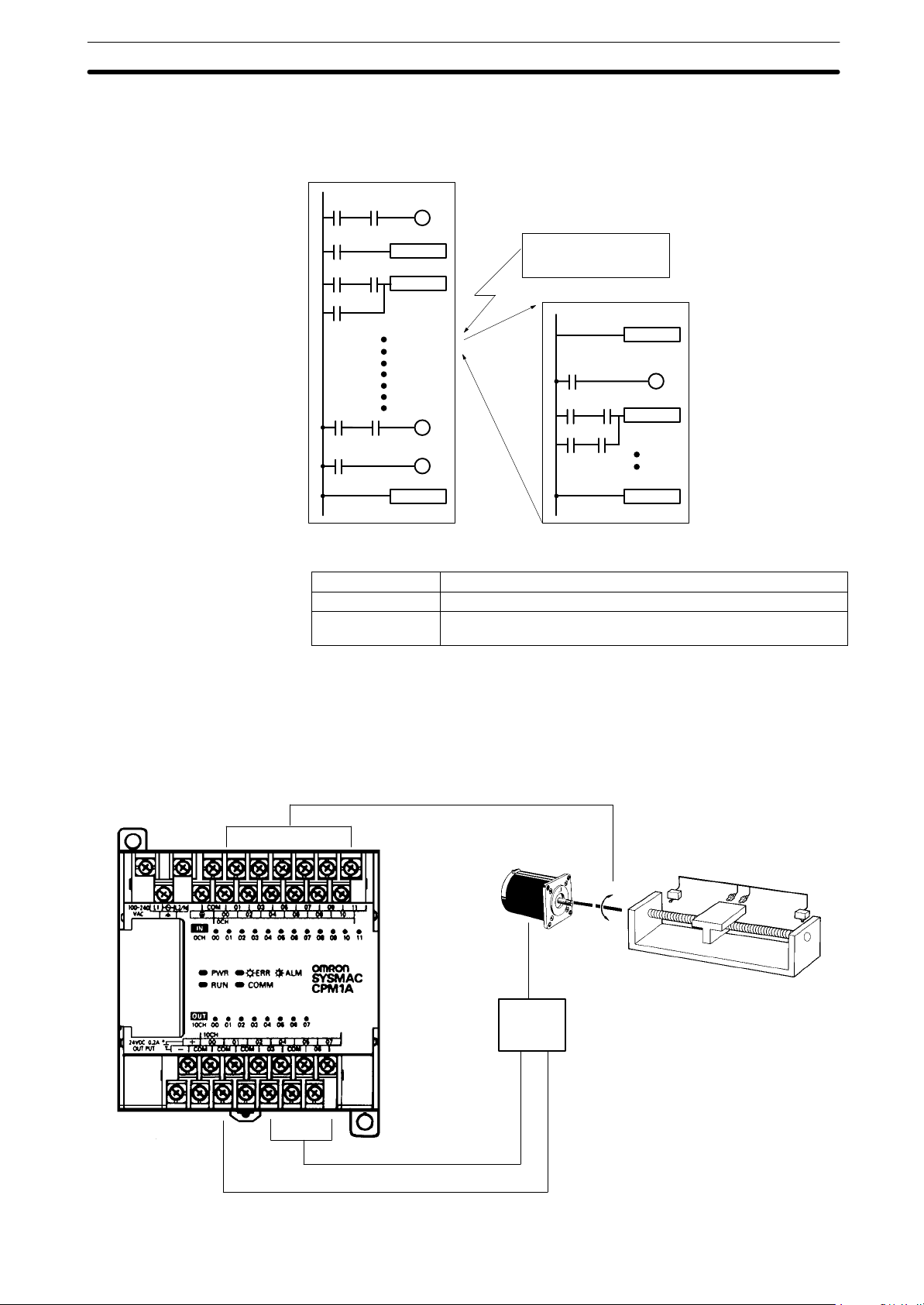
Merkmale und Funktionen der CPM1A Kapitel 1-1
Intervall–Zeitgeber–
Funktion
(periodische Interrupts)
Die CPM1A ist mit einem Intervall–Zeitgeber ausgerüstet. Der Einstellbereich
reicht von 0,5...319.968 ms (in Schritten von 0,1 ms). Es können entweder
einzelne Interrupts oder mehrere periodische Interrupts ausgelöst werden.
Hauptprogramm
MOV
ADD
END
Time–out des
Intervall–Zeitgebers
Interrupt–Programm
SBN00
MOV
RET
Betriebsart Funktion
Monoflopbetrieb Generiert beim Auslösen des Zeitgebers einen einzelnen Interrupt.
Periodische
Interrupts
Generiert periodisch einen Interrupt.
Puls–Ausgangsfunktion Über die CPM1A mit Transistorausgang können Ausgangssignale von 20 Hz
bis 2 kHz (1–phasiger Ausgang) ausgegeben werden. Der Schrittmotor wird
direkt von der CPU gesteuert.
Der Pulsausgang kann entweder durch einen Befehl (Continuous mode) oder
bei Erreichen eines aktuellen Pulswertes (1 bis 16.777.215) (Single mode)
zurückgesetzt werden.
Schrittmotor
Schrittmotor
Motor–
steuerung
Regeleingang
Puls–Ausgang
(1–phasiger Ausgang)
12
CW/CCW Regelausgang
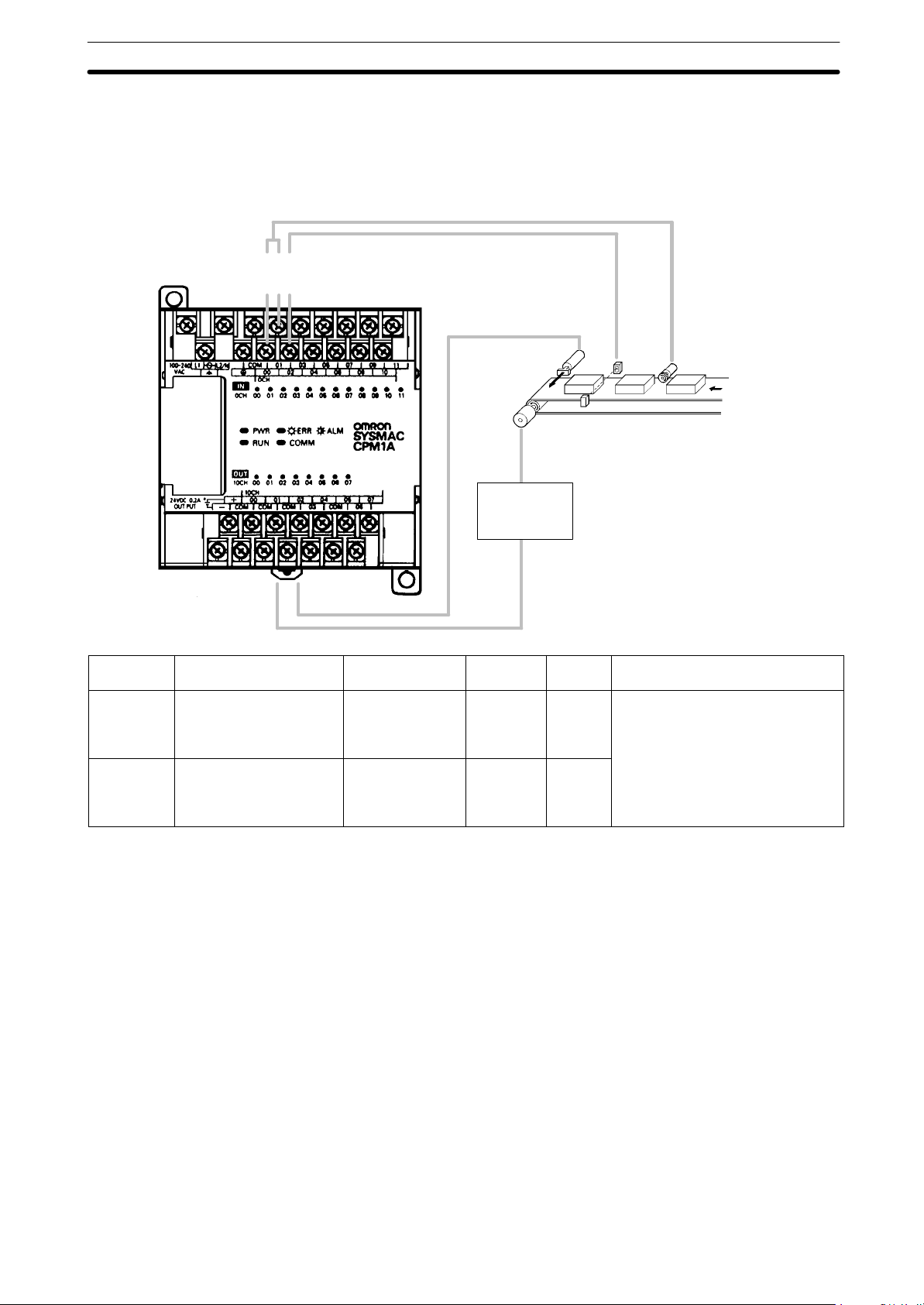
Merkmale und Funktionen der CPM1A Kapitel 1-1
Schneller Zähler Die CPM1A verfügt über einen schnellen Zähler, der entweder im Inkremen-
tier– oder Aufwärts–/Abwärts–Betrieb arbeitet. Der schnelle Zähler kann mit
Interrupts kombiniert werden, um eine Bereichs–Vergleichs– oder Grenzwert–
Steuerung durchzuführen, die unabhängig von der Zykluszeit der SPS arbeitet.
Zähleingang
Reset–Eingang
00000
00001
00002
Magnetspule
Sensor Drehwinkelgeber
Motor–
Steuerung
Betriebsart Eingangsfunktionen Eingangs–
Aufwärts–/
Abwärts
Inkremental 00000: Zähleingang
00000: A-Phaseneingang
00001: B-Phaseneingang
00002: Z-Phaseneingang
00001: siehe Hinweis
00002: Reset–Eingang
beschaltung
Phasen–Differenz,
4 Eingänge
Individuelle
Eingänge
Hinweis Während des Inkrementier–Betriebes kann dieser Eingang (00001) als nor-
maler Eingang verwendet werden.
Zähl–
Frequenz
2,5 kHz –32767
5,0 kHz 0
Zähl–
bereich
bis
32767
bis
65535
Regelarten
Grenzwert–Steuerung:
Bis zu 16 Werte und Grenz–
Interrupt–Unterprogramm–Nummern
können gespeichert werden.
Bereichs–Vergleichs–Steuerung:
Bis zu 8 Einstellungen von oberen
Grenzwerten, unteren Grenzwerten und
Interrupt–Unterprogramm–
Nummern können gespeichert werden.
13
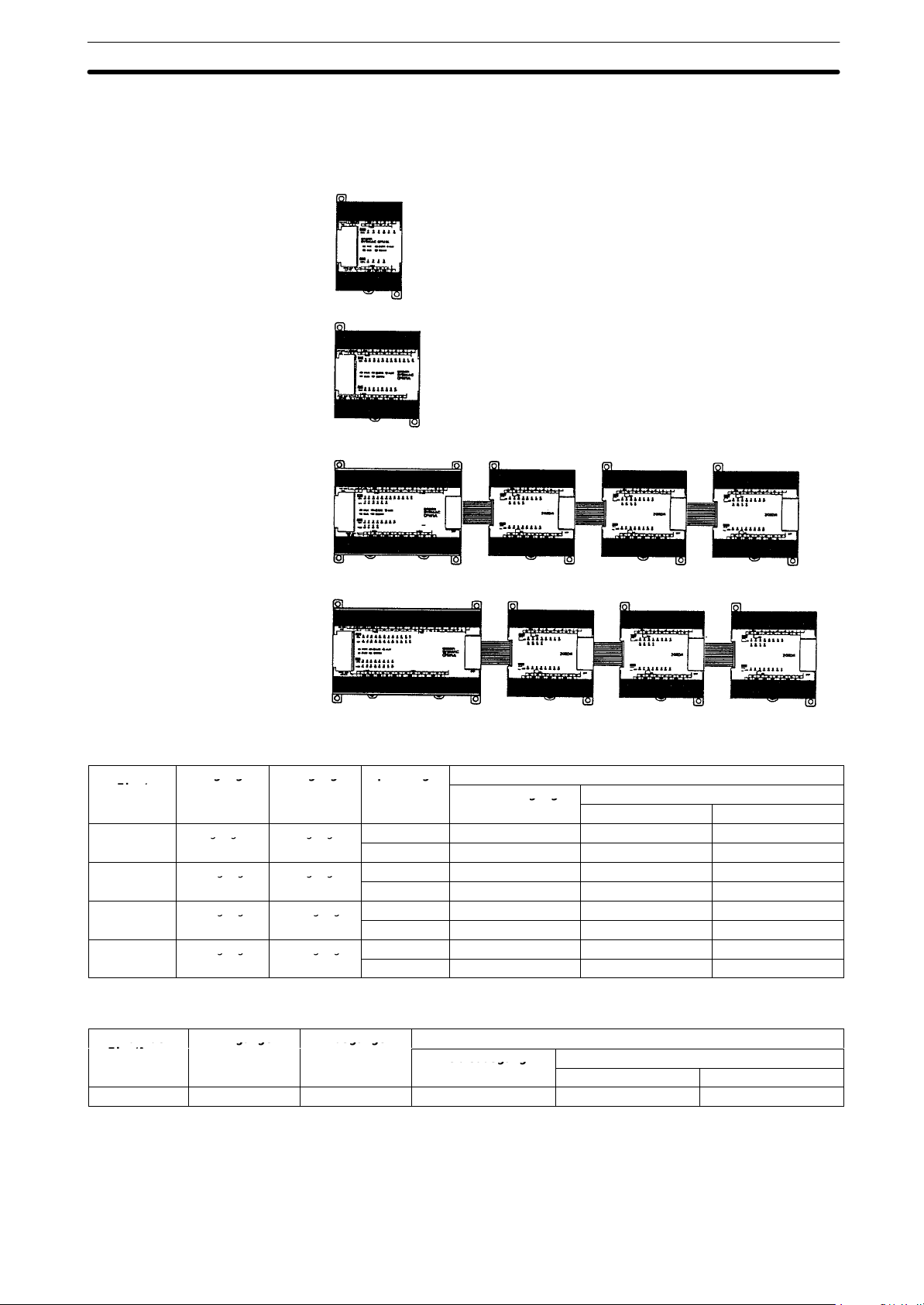
ade
gä ge
usgä ge
Spa u gs
A
e a sausga g
0
6gäge
usgä ge
0
gä ge
8 usgä ge
30
8gäge
usgä ge
0
gä ge
6 usgä ge
ade
gä ge
usgä ge
e a sausga g
Systemkonfiguration
1-2 Systemkonfiguration
1-2-1 CPU– und Erweiterungs–E/A–Baugruppen–Konfiguration
CPM1A CPU–Baugruppen
Erweiterungs–E/A–Baugruppen
Kapitel 1-2
CPM1A CPU–Baugruppen
Anzahl der
Ein–/
usgänge
10 6 Eingänge 4 Ausgänge
20 12 Eingänge 8 Ausgänge
30 18 Eingänge 12 Ausgänge
40 24 Eingänge 16 Ausgänge
Eingänge Ausgänge Spannungs-
versorgung
AC CPM1A-10CDR-A --- --DC CPM1A-10CDR-D CPM1A-10CDT-D CPM1A-10CDT1-D
AC CPM1A-20CDR-A --- --DC CPM1A-20CDR-D CPM1A-20CDT-D CPM1A-20CDT1-D
AC CPM1A-30CDR-A --- --DC CPM1A-30CDR-D CPM1A-30CDT-D CPM1A-30CDT1-D
AC CPM1A-40CDR-A --- --DC CPM1A-40CDR-D CPM1A-40CDT-D CPM1A-40CDT1-D
Relaisausgang
Typ
Transistorausgang
NPN PNP
CPM1A Erweiterungs–E/A–Baugruppe
Anzahl der
Ein–/Aus–
gänge
20 12 Eingänge 8 Ausgänge CPM1A-20EDR CPM1A-20EDT CPM1A-20EDT1
Eingänge Ausgänge
Relaisausgang
Typ
Transistorausgang
NPN PNP
14
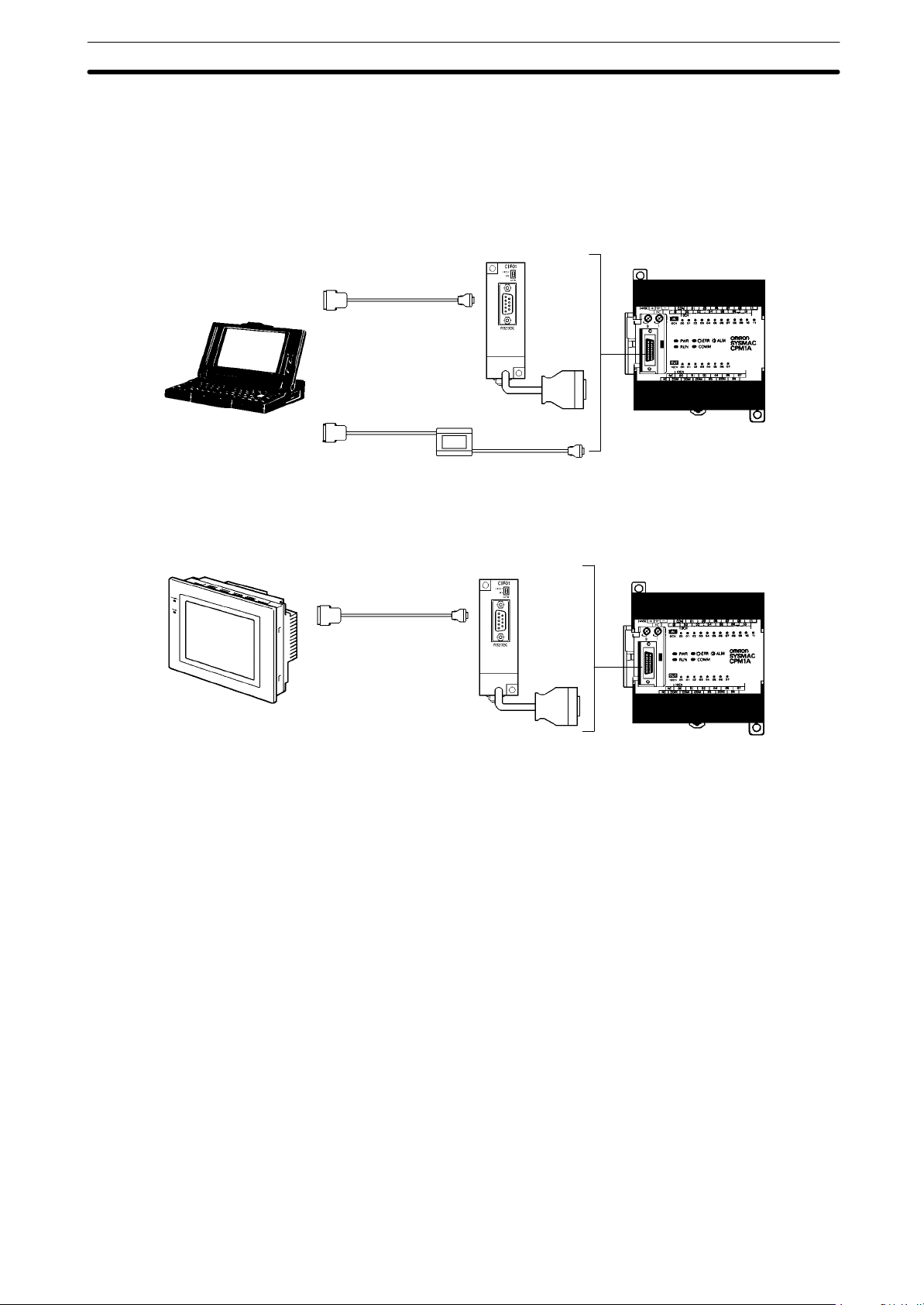
Systemkonfiguration
Kapitel 1-2
1-2-2 Host–Link–Kommunikation
Über die Host–Link–Kommunikation können bis zu 32 OMRON–SPS an einen
Hauptrechner angeschlossen werden. Sie benötigen dazu die Adapter
RS–232C bzw. RS–422.
1:1–Kommunikation Die folgende Abbildung zeigt die möglichen Systemkomponenten für einen
1:1–Anschluß zwischen einer CPM1A und einem PC/AT.
PC/AT oder
kompatibel
NT–Bedienterminal
anschließen
NT–Bedienterminal
RS-232C Adapter
RS-232C–Kabel
CQM1-CIF02
CPM1A CPU–Baugruppe
Die folgende Abbildung zeigt die möglichen Systemkomponenten für den Anschluß zwischen einer CPM1A und einem NT–Bedienterminal.
RS-232C Adapter
RS-232C–Kabel
CPM1A CPU–Baugruppe
15
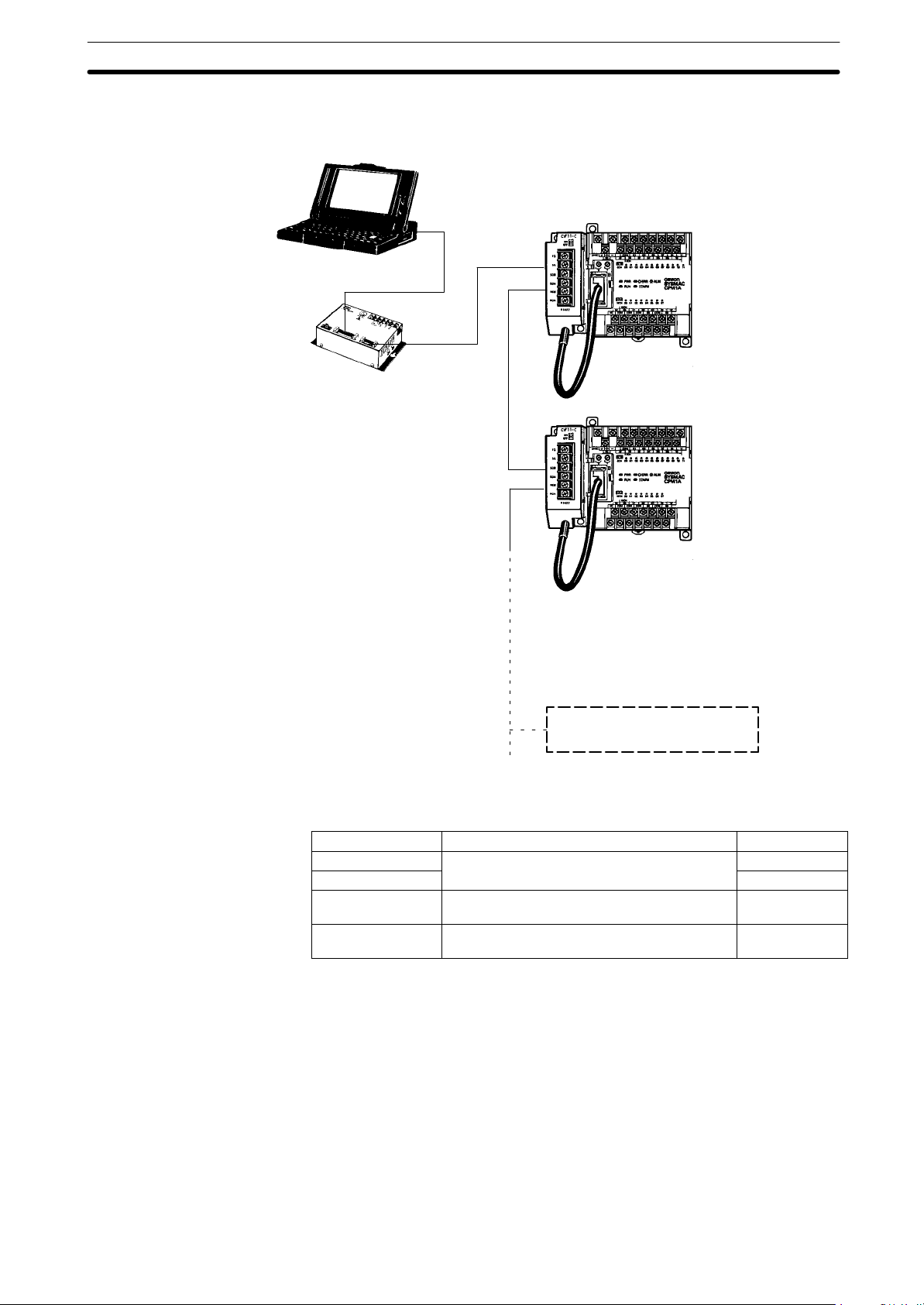
oeeau e eeSc see bee
Systemkonfiguration
Kapitel 1-2
1:N–Kommunikation Die folgende Abbildung zeigt die möglichen Systemkomponenten für den An-
schluß von bis zu 32 CPM1A und einem Host– PC
PC/AT oder kompatibel
3G2A9-AL004-E
Link Adapter
RS-232C–Kabel
RS-422–Kabel
RS-422
Adapter
CPM1A
CPU–Baugruppen
Die Kabellänge der RS–422 Schnittstellenkommunikation
darf max 500 m betragen.
OMRON CPM1A SPS
(max. 32 SPS)
Adapter und Kabel Die folgende Tabelle listet einige der Adapter und Kabel auf, die in der Host–
Link–Kommunikation verwendet werden.
Name Beschreibung Bestellnummer
RS-232C Adapter
RS-422 Adapter
Anschlußkabel
RS–323C
Link Adapter Datenkonvertierung zwischen RS–232C und
Konvertiert auf Peripherie–Schnittstellen–Ebene
Für den Anschluß an einen PC/AT
(Kabellänge 3,3 m)
RS–422
CPM1-CIF01
CPM1-CIF11
CQM1-CIF02
3G2A9-AL004-E
16
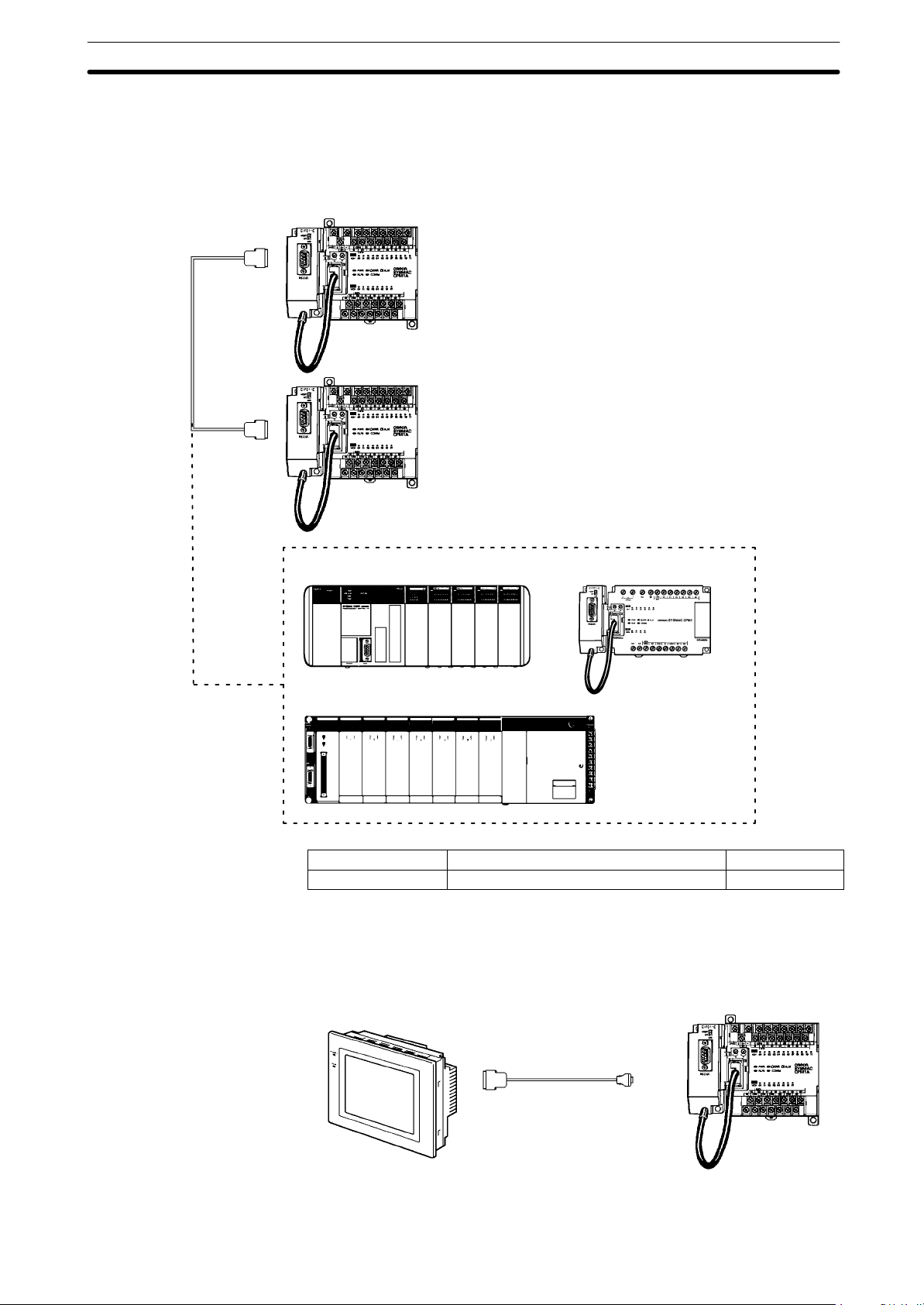
Systemkonfiguration
1-2-3 1:1 CPU–Link
RS-232C–Kabel
Kapitel 1-2
Eine Datenverbindung kann mit einem Datenbereich in einer anderen CPM1,
CQM1 oder C200Hj hergestellt werden. Der 1:1–Anschluß wird mittels des
RS–232C–Adapters hergestelllt.
CPM1A CPU–BaugruppeRS-232C Adapter
CQM1 CPM1 + RS-232C Adapter
C200HS/C200HX/HG/HE
Name Beschreibung Bestellnummer
RS-232C Adapter Konvertiert auf Peripherie–Schnittstellen– Ebene CPM1-CIF01
1-2-4 NT–Link–Kommunikation
Über die den RS–232C–Adapter können die SPS der CPM1A–Serie an die
NT–Bedienterminals angeschlossen werden.
NT–Bedienterminal
RS-232C
Adapter
CPM1A CPU
RS-232C–Kabel
17
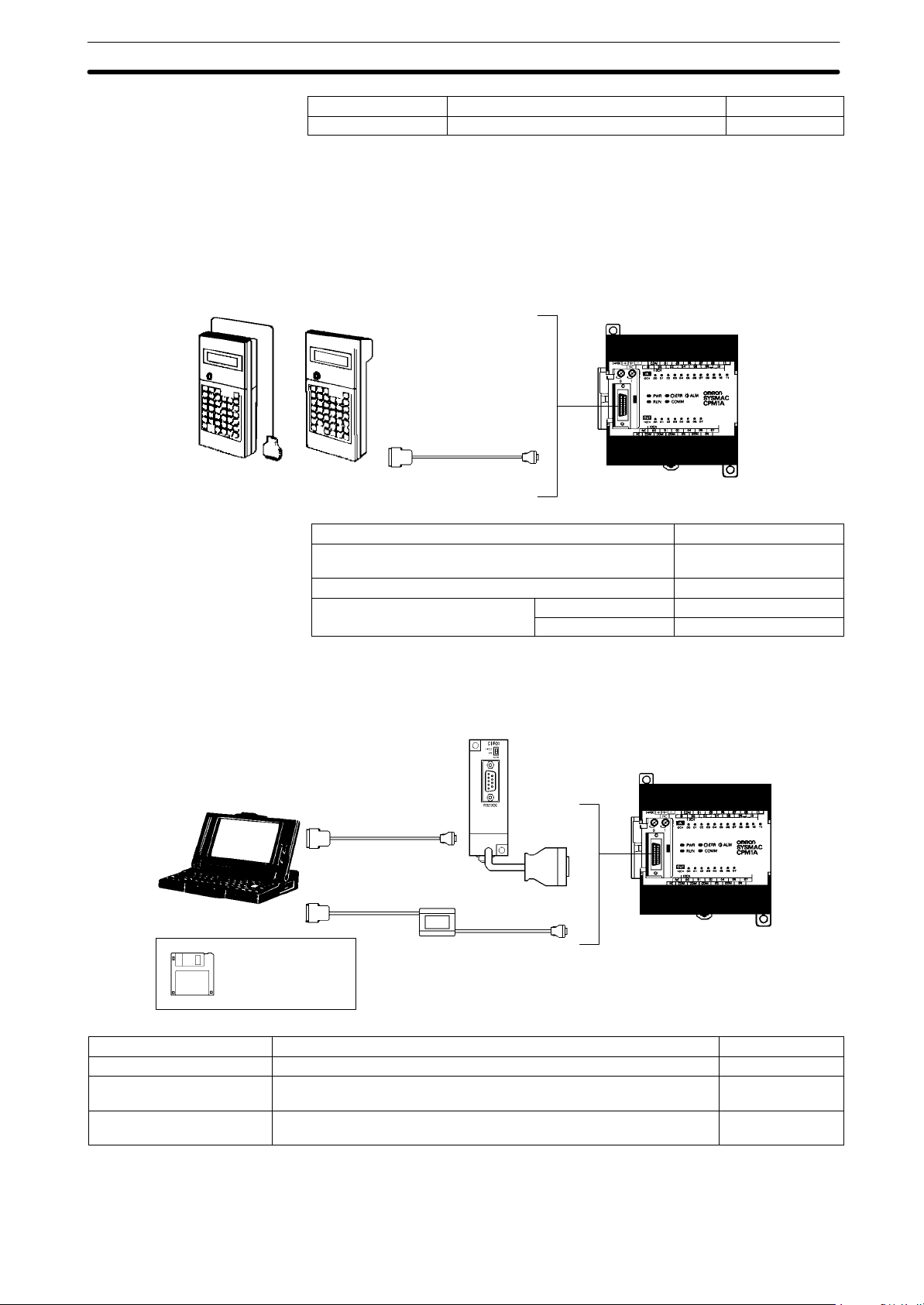
C 00 Se e sc uß abe
Systemkonfiguration
Name Beschreibung Bestellnummer
RS-232C Adapter Konvertiert auf Peripherie–Schnittstellen– Ebene CPM1-CIF01
Kapitel 1-2
1-2-5 Anschlüsse der Peripheriegeräte
Die CPM1A–Programmierung kann über einen PC/AT erfolgen, auf dem SYSWIN installiert ist. Weiterhin ist es möglich, Programme über die Programmierkonsole zu erstellen und zu ändern.
Programmierkonsolen Die CQM1–PRO01 E oder C200H–PRO27 E Programmierkonsole kann mit
der CPM1 verbunden werden, wie es im folgenden Diagramm gezeigt wird.
CPM1A CPU
C200H-CN222
CQM1-PRO01-E C200H-PRO27-E
SYSMAC–Programmier
–Software
PC/AT oder kompatibel
SYSWIN
Name
CQM1-Serie Programmierkonsole
(Anschlußkabel gehört zum Lieferumfang)
C200H/HS– und C200HX/HG/HE-Serie Programmierkonsole C200H-PRO27-E
C200H-Serie Anschlußkabel
Kabellänge: 2 m C200H-CN222
Kabellänge: 4 m C200H-CN422
Bestellnummer
CQM1-PRO01-E
An die CPM1A–SPS kann, wie unten dargestellt, ein PC/AT angeschlossen
werden, auf dem SYSWIN installiert ist. Für nähere Information zur Verdrahtung des RS–232C–Kabels siehe
RS-232C Adapter
RS-232C–Kabel
CQM1-CIF02
3-4-7 Host Link–Anschluß
.
CPM1A CPU
RS-232C–Adapter Konvertiert auf Peripherie–Schnittstellen–Ebene CPM1-CIF01
Anschlußkabel Zum Anschluß eines Industrie–PC/AT (Länge: 3,3 m) CQM1-CIF02
SYSMAC–
Programmiersoftware SYSWIN
18
Name Gebrauch Bestellnummer
(siehe Hinweis)
Für PC/AT oder Kompatible (3.5” disks, 3 HD) SYSWIN–E–V3.X
Hinweis Geben Sie bei Kauf eines Produkts immer die Bestellnummer an.

Kapitel 2
Spezifikation der Baugruppen
Dieses Kapitel beschreibt die technischen Spezifikationen der Baugruppen, ihre Installation sowie die Verdrahtung.
2-1 Leistungsmerkmale 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1-1 Allgemeine Merkmale 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1-2 Technische Daten 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-1-3 E/A Spezifikationen 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2 Beschreibung der Baugruppen 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-1 CPU–Baugruppen 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-2 Erweiterungs–E/A–Baugruppe 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2-2-3 Kommunikationsadapter 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
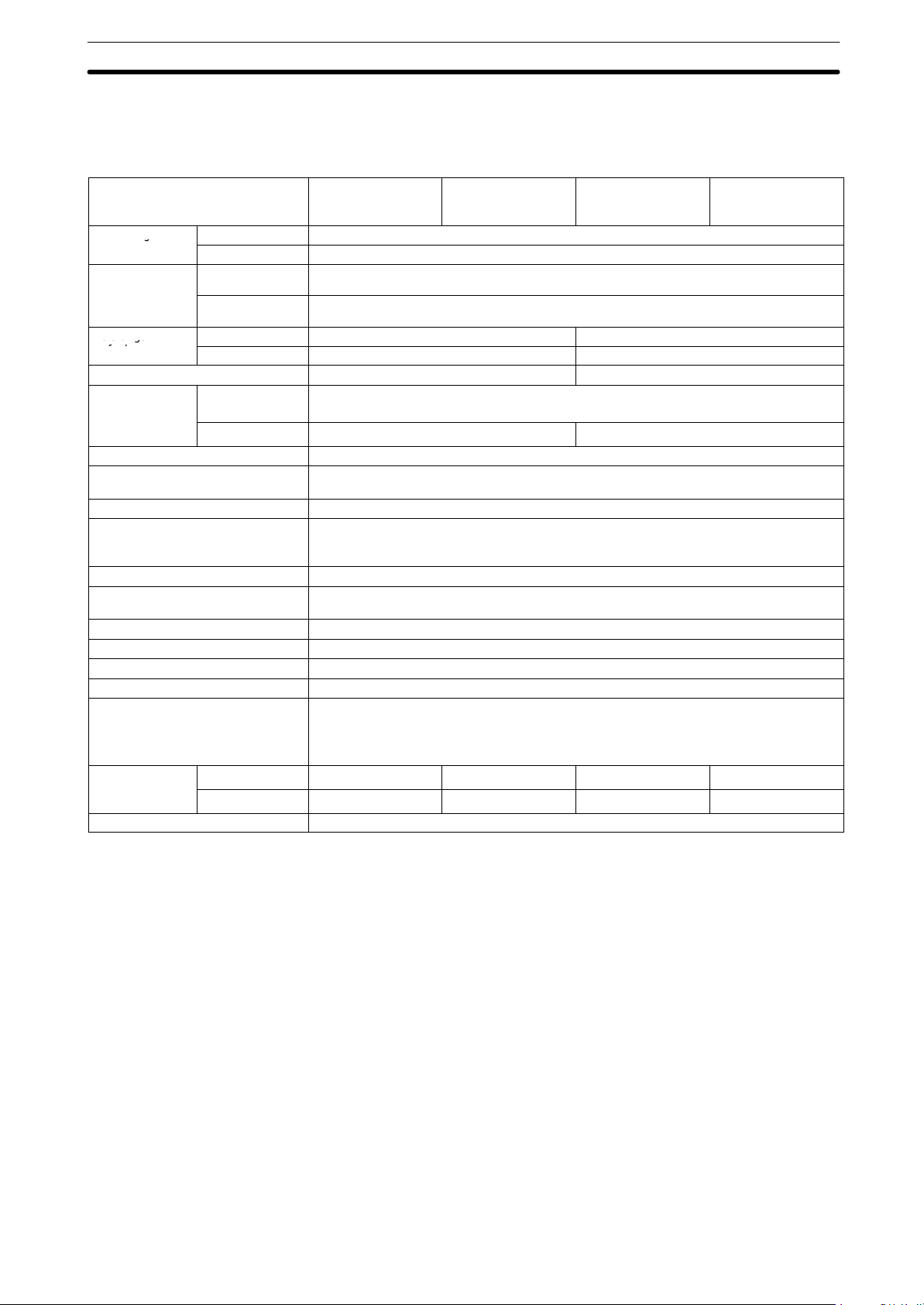
Sa ugs
bereich der
esu gs
C
Leistungsmerkmale Kapitel 2-1
2-1 Leistungsmerkmale
2-1-1 Allgemeine Merkmale
CPM1A-10CDR-j
CPM1A-10CDT-D
CPM1A-10CDT1-D
Spannungs–
versorgung
Toleranz–
bereich der
Versorgungs–
spannung
Leistungs–
aufnahme
Einschaltstrom max. 30 A max. 60 A
Externe
Spannungs–
versorgung
(nur AC–Typ)
Insolationswiderstand min. 20 MΩ bei 500 VDC zwischen den externen AC–Klemmen und dem Gehäuse
Prüfspannung 2.300 VAC 50/60 Hz für 1 min zwischen den externen AC–Klemme und dem Gehäuse;
Störfestigkeit 1.500 Vss, Impulsdauer: 0,1 bis 1 µs, Anstiegszeit: 1 ns (über Störsimulation)
Vibrationsfestigkeit 10 bis 57 Hz, 0,075-mm Amplitude, 57 bis 150 Hz, Beschleunigung: 9,8 m/s2 (1G) in X, Y und Z
Stoßfestigkeit 147 m/s2 (15G) jeweils drei Mal in X–, Y– und Z–Richtung
Umgebungstemperatur Betrieb: 0° bis 55°C
Luftfeuchtigkeit 10% bis 90% (ohne Kondensation)
Umgebungsbedingungen Keine ätzenden Gasen
Größe der Klemmenschrauben M3
Erdung nach EN60204
Spannungsunterbrechngszeit AC type: min.10 ms
Gewicht der
PU–
Baugruppe
Erweiterungs–E/A–Baugruppe max. 300 g
AC 100 bis 240 VAC, 50/60 Hz
DC 24 VDC
AC 85 bis 264 VAC
DC 20,4 bis 26,4 VDC
AC max. 30 VA max. 60 VA
DC max. 6 W max. 20 W
Versorgungs–
spannung
Ausgangsstrom 200 mA (siehe Hinweis 1) 300 mA (siehe Hinweis 2)
AC type max. 400 g max. 500 g 600 g max. max. 700 g
DC type max. 300 g max. 400 g max. 500 g max. 600 g
24 VDC
Leckstrom max. 10 mA
Richtungen für jeweils 80 Minuten
(Zeit–Koeffizient; 8 Minuten × Koeffizient Faktor 10 = Gesamtzeit 80 Minuten)
Lagerung: –20° bis 75°C
DC type: min. 2 ms
(Fällt die Spannungsversorgung unter 85 % der Nennspannung ab, tritt eine
Spannungsunterbrechung ein.)
CPM1A-20CDR-j
CPM1A-20CDT-D
CPM1A-20CDT1-D
CPM1A-30CDR-j
CPM1A-30CDT-D
CPM1A-30CDT1-D
CPM1A-40CDR-j
CPM1A-40CDT-D
CPM1A-40CDT1-D
Hinweis 1. Kommt es bei der externen Spannungsversorgung zu einer Überspan-
nung oder einem Kurzschluß ist Spannungsabfall die Folge. Der SPS–Betrieb wird unterbrochen.
2. Kommt es bei der externen Spannungsversorgung zu einer Überspannung
oder einem Kurzschluß ist Spannungsabfall die Folge. Der SPS–Betrieb wird
fortgesetzt.
20
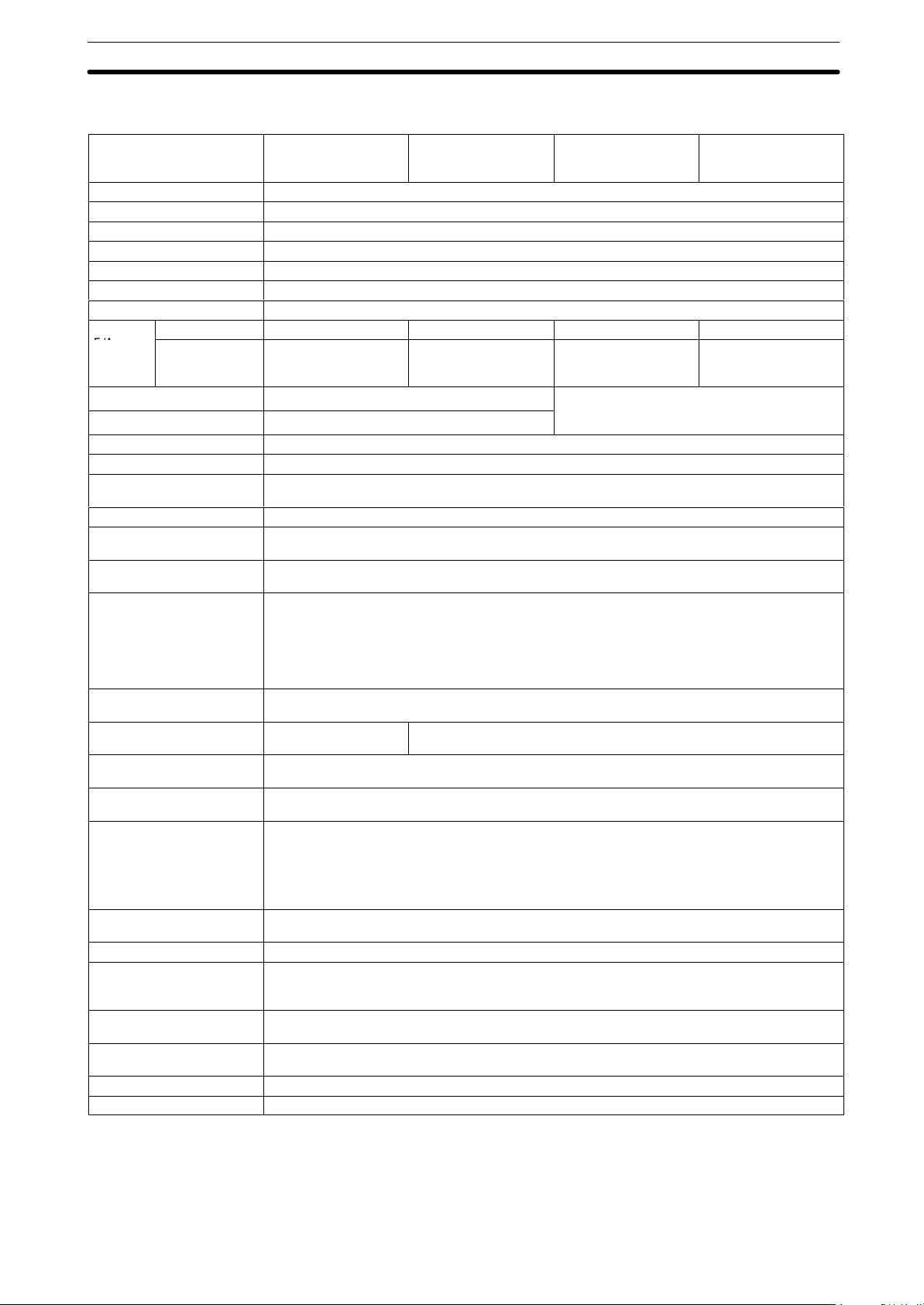
a
Leistungsmerkmale Kapitel 2-1
2-1-2 Technische Daten
Item CPM1A-10CDR-j
Steuerungsbetrieb Gespeicherte Programm–Methode
E/A–Steuerungsmethode Zyklisch, direkte Ausgänge und Interrupt–Verarbeitung möglich
Programmiersprache Kontaktplan
Befehlslänge 1 Adresse pro Befehl, 1 bis 5 Worte pro Befehl
Befehlsarten Basisbefehle: 14, Spezialbefehle: 77 Arten, 135 Befehle
Ausführungszeit Basisbefehle: 0,72 bis 16,2 µs, Spezialbefehle: 16,3 µs (MOV–Befehl)
Programmkapazität 2,048 words
Max.
E/A–
Kapazität
Eingangsbits 00000 bis 00915
Ausgangsbits 01000 bis 01915
Hilfsbits 512 Bits: 20000 bis 23115 (Worte IR 200 bis IR 231)
Systemmerker (SR area) 384 Bits: 23200 bis 25515 (Worte IR 232 bis IR 255)
Temporärmerker
(TR–Bereich)
Haftmerker (HR–Bereich) 320 Bits: HR 0000 bis HR 1915 (Worte HR 00 bis HR 19)
Erweiterte Systemmerker
(AR–Bereich)
Schnittstellenmerker
(LR–Bereich)
Zeitgeber/Zähler 128 Zeitgeber/Zähler (TIM/CNT 000 bis TIM/CNT 127)
Datenspeicher Lesen/Speichern: 1.024 Worte (DM 0000 bis DM 1023)
Interrupt–Verarbeitung
(siehe Hinweis 2)
Intervall–Zeitgeber–
Interrupts
Speicherschutz HR, AR und DM–Bereichsinhalt und Zählwerte bleiben während einer Spannungsunterbrechung
Backup–Speicher Flash–Speicher:
Selbst–Diagnose–
Funktionen
Programmprüfungen Kein END–Befehl, Programmfehler (fortlaufend während des Betriebes überprüft)
Schnelle Zähler 1 Schneller Zähler: 5 kHz 1–phasig oder 2,5 kHz 2–phasig (Linear–Zähler)
Impuls–Speicherungs–
Eingänge
Pulsausgang 1 Ausgang, 20 Hz bis 2 kHz (1–phasiger Ausgang)
Eingangszeit–Konstante Kann auf 1 ms, 2 ms, 4 ms, 8 ms, 16 ms, 32 ms, 64 ms oder 128 ms eingestellt werden
Analoge–Einstellungen 2 Analog–Regler (Werte von 0...200 BCD)
nur CPU 10 E/A 20 E/A 30 E/A 40 E/A
mit Erwei–
terungs–E/A–
Baugruppe
CPM1A-10CDT-D
CPM1A-10CDT1-D
––– ––– 50, 70 oder 90 E/A 60, 80 oder 100 E/A
8 Bits (TR0 bis TR7)
256 Bits: AR 0000 bis AR 1515 (Worte AR 00 bis AR 15)
256 Bits: LR 0000 bis LR 1515 (Worte LR 00 bis LR 15)
100-ms Zeitgeber: TIM 000 bis TIM 127
10-ms Zeitgeber (Schnelle Zähler): TIM 000 bis TIM 127 (siehe Hinweis 1)
(es werden die gleichen Zeitgebernummern wie für die 100 ms Zeitgeber
verwendet)
Dekrementierende oder reversible Zähler
Nur Lesen: 512 Worte (DM 6144 bis DM 6655)
Externe Interrupts: 2 Externe Interrupts: 4
1 (0,5 bis 319.968 ms im periodischen Interrupt–Modus oder Einzel–Interrupt–Modus)
erhalten.
Für die Datensicherung des Programms und des DM–Bereiches wird keine Batterie benötigt.
Datensicherung über Kondensator:
Der DM–(Nur Lesen/Speichern), HR–, AR–Bereich und Zählwerte werden über 20 Tage bei einer
Temperatur von 25_C gesichert. Die Sicherungszeit hängt stark von der Umgebungstemperatur ab.
Siehe Diagramm auf der nächsten Seite.
CPU–Fehler (Watchdog), E/A–Busfehler und Speicherfehler
Inkrementier–Betrieb: 0...65.535 (16 Bits)
Aufwärts/Abwärts–Betrieb: –32.767...32.767 (16 Bits)
Interrupt–Eingänge können auch als Impuls–Speicherungs–Eingänge genutzt werden. Eingangssignale
mit einer Pulsweite von 0,2 ms können erkannt werden.
Voreinstellung der Pulsrate (1 bis 16.777.215).
CPM1A-20CDR-j
CPM1A-20CDT-D
CPM1A-20CDT1-D
CPM1A-30CDR-j
CPM1A-30CDT-D
CPM1A-30CDT1-D
Worte, die nicht als Eingangs– oder Ausgangsbits
verwendet werden, können als Hilfsbits verwendet
werden.
CPM1A-40CDR-j
CPM1A-40CDT-D
CPM1A-40CDT1-D
Hinweis 1. Wenn unter Verwendung des Schnellen–Zeitgeber–Befehls Interrupt–Ver-
arbeitung durchgeführt werden soll, sind TIM 000 und TIM 003 zu
benutzen.
2. Die Eingangs–Interrupt–Antwortzeit beträgt max. 0,3 ms.
21
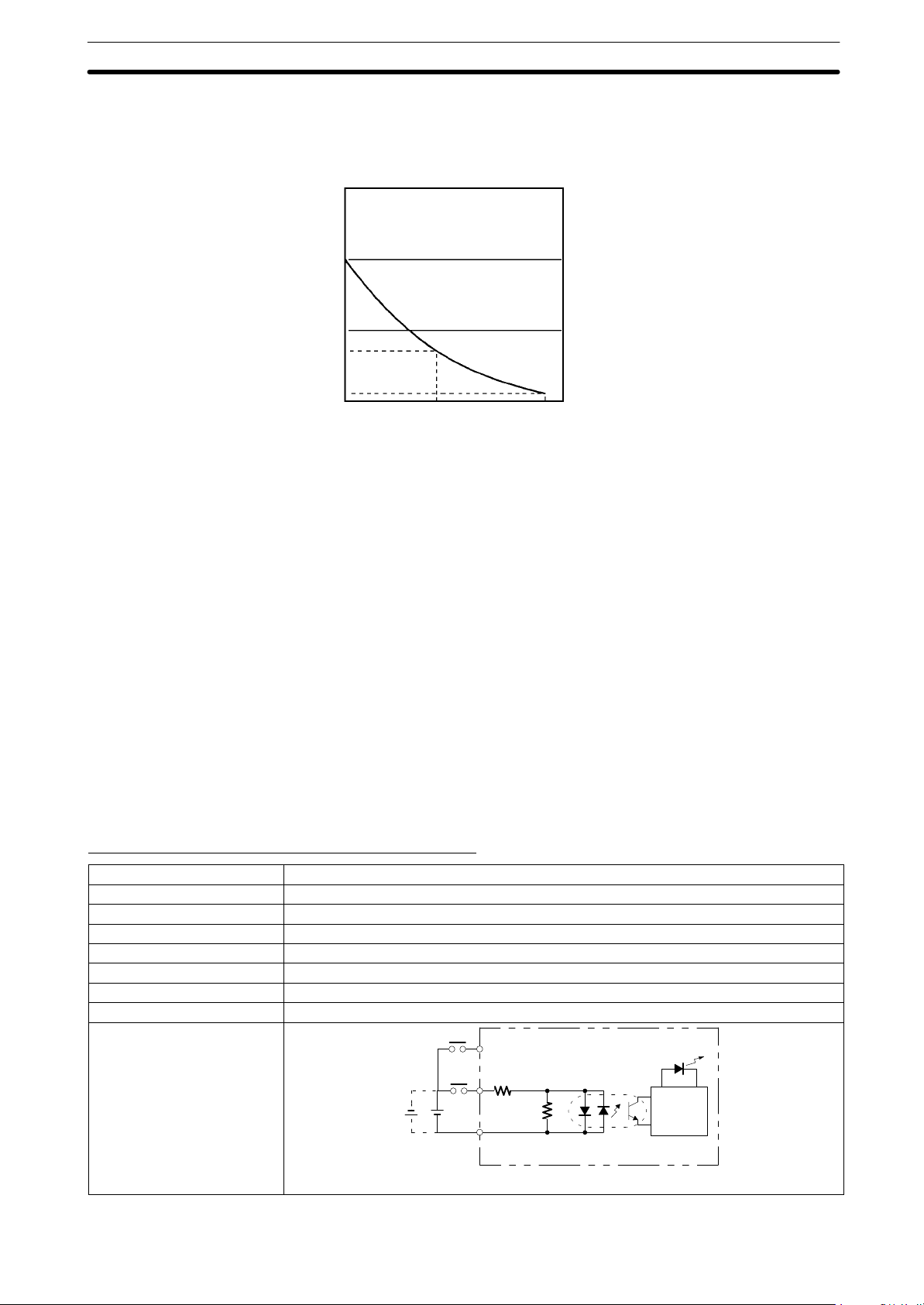
Leistungsmerkmale Kapitel 2-1
1.Temperaturabhängige Sicherungszeit
Ein Kondensator in der CPU wird dazu verwendet, das Programm, die Zählwerte und die Inhalte der DM–, HR– und AR–Bereiche zu speichern. Die Sicherungszeit hängt von der Umgebungstemperatur ab.
20
10
Sicherungszeit (Tage)
7
1
25 40 80
Umgebungstemperatur (_C)
Wenn die Spannungsunterbrechung über den nächsten Backup–Zyklus hinaus anhält, gehen die Daten des DM–, HR, AR– und CNT–Bereichs verloren
bzw. nehmen zufällige Werte an.
Wird der Inhalt des Programmbereichs der CPU gelöscht, wird das Programm, das in Flash–Speicher gespeichert ist, beim Starten der CPM1A in
den Programmbereich der CPU geladen. Das geschieht, weil der Inhalt des
Nur–Lese–Bereichs (DM 6144 bis DM 6599) und des SPS–Setups (DM 6600
bis DM 6655) in den Flash–Speicher gespeichert werden.
Sollte die Spannung unterbrochen sein, ohne, daß die Betriebsart nach
Durchführung der Änderungen im Nur–Lese–Bereich (DM 6144 bis DM 6599)
bzw. SPS–Setup (DM 6600 bis DM 6655) gewechselt wurde, werden die geänderten Werte nicht im Flash–Speicher gespeichert. Darum wird bei einer
Spannungsunterbrechung von mehr als 20 Tagen (bei 25_C) der geänderte
Dateninhalt (Inhalt des RAM) verloren gehen bzw. zufällige Werte annehmen.
Das Sichern der Änderungen kann entweder durch Wechsel der Betriebsart
auf RUN– bzw. MONITOR–Betrieb, oder durch Einschalten der CPM1A herbeigeführt werden.
2-1-3 E/A Spezifikationen
CPU–Baugruppen–Eingangsspezifikationen
Spezifikation
Eingangsspannung 24 VDC
Eingansgimpedanz IN00000 bis IN00002: 2 kΩ; andere Eingänge: 4,7 kΩ
Eingangsstrom IN00000 bis IN00002: 12 mA typical; andere Eingänge: 5 mA (typischer Wert)
Einschaltspannung min. 14,4 VDC
Ausschaltspannung max. 5,0 VDC
Einschaltverzögerung 1 bis 128 ms max. Vorgabewert: 8 ms (siehe Hinweis)
Ausschaltverzögerung 1 bis 128 ms max. Vorgabewert: 8 ms (siehe Hinweis)
Schaltungskonfiguration
+10%
/
–15%
IN
IN
COM
4.7 kΩ
(2 kΩ)
820 Ω
(510 Ω)
Eingangs–
LED
Interne
Schaltung
Werte in Klammern bezeiehen sich auf IN00000 bis IN00002.
22
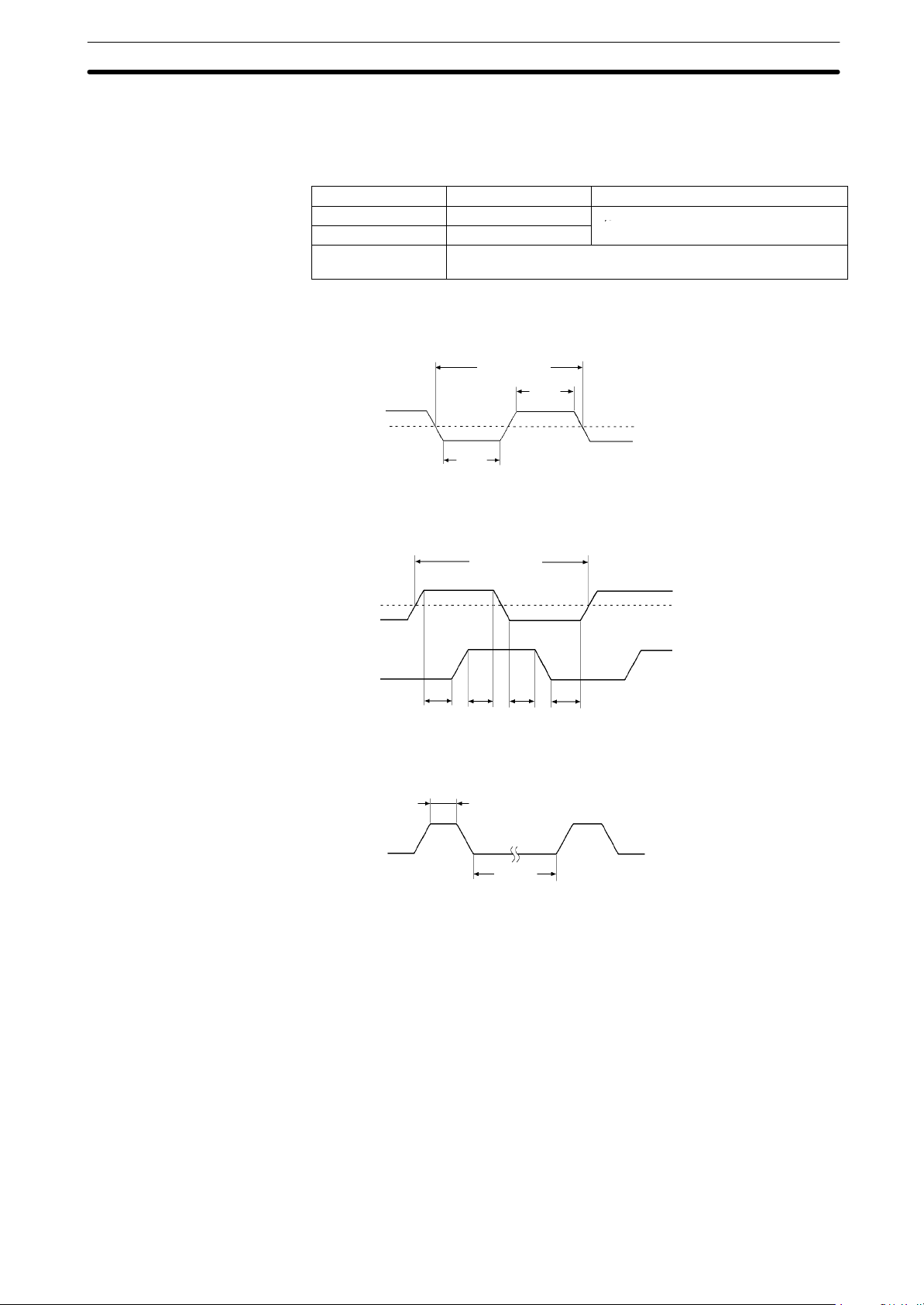
,5
Leistungsmerkmale Kapitel 2-1
Hinweis Die Eingangszeit–Konstante für Ein–/Ausschalt–Verzögerungen kann auf 1, 2,
4, 8, 16, 32, 64 oder 128 ms eingestellt werden. Die Eingangsverzögerungen
ändern sich entsprechend der nachfolgenden Tabelle, wenn die Eingänge
IN00000...IN00002 als Schnelle Zähler verwendet werden.
Eingang Inkremental–Betrieb Differential–Phasen–Betrieb
IN00000 (A-Phase) 5 KHz
IN00001 (B-Phase) normaler Eingang
IN00002 (Z-Phase) Ein–Verzögerung: min.100 µs;
Aus–Verzögerung: min. 500 µs
Die minimale Verzögerung ist nachfolgend dargestellt
Inkremental–Betrieb (max. 5 kHz)
200 µs min.
90 µs
min.
A–Phase
Ein
Aus
90 µs
min.
Differential–Phasen–Betrieb (max. 2,5 KHz)
IN00000 (A–Phase), IN00001 (B–Phase)
2,5 KHz
min. 400 µs
Ein
A–Phase
Aus
Ein
B–Phase
Aus
T
T
T
1
2
T
3
4
T
1
T
T
T
: min. 90 µs.
2
3
4
IN00002 (Z–Phase)
Ein
Z–Phase
Aus
min. 100 µs.
500 µ s
min.
Werden IN00003...IN00006 als Interrupt–Eingänge verwendet, beträgt die
Verzögerung max. 0,3 ms. Die Verzögerungszeit beschreibt den Zeitraum
vom Setzen des Eingangs bis zum Starten des Interrupt–Unterprogrammes.
23

Leistungsmerkmale Kapitel 2-1
Erweiterungs–Eingangs–Baugruppen–Spezifikationen
Spezifikationen
Eingangsspannung 24 VDC
Eingangimpedanz 4,7 kΩ
Eingangsstrom 5 mA typischer Wert
Einschaltspannung min 14,4 VDC
Ausschaltspannung max. 5,0 VDC
Einschaltverzögerung max. 1 bis 128 ms (Vorgabewert: 8 ms) (siehe Hinweis)
Ausschaltverzögerung max. 1 bis 128 ms (Vorgabewert: 8 ms) (siehe Hinweis)
Schaltungskonfiguration
+10%
/
–15%
IN
IN
4,7 kΩ
Eingangs–
LED
COM
820 Ω
Interne
Schaltung
Hinweis Die Eingangszeit–Konstante für Ein–/Ausschalt–Verzögerungen kann auf 1, 2,
4, 8, 16, 32, 64 oder 128 ms eingestellt werden.
Vorsicht Legen Sie keine Spannung oberhalb des Tolleranzbereiches an die Eingangs-
!
klemme an, da es ansonsten zu Zerstörungen der Baugruppe oder Brand
kommen kann.
CPU– und Erweiterungs–E/A–Baugruppen–Spezifikationen
Spezifikation
Ausgangstype Allle Ausgänge sind Relaisausgänge
Max. Schaltkapazität 2 A, 250 VAC (cosφ = 1)
Min. Schaltkapazität 10 mA, 5 VDC
Lebenszeit des Relais elektrisch: 300.000 Schaltspiele (R–Last) 100.000 Schaltspiele (induktive Last)
Einschaltverzögerung max.15 ms
Ausschaltverzögerung max.15 ms
Schaltungskonfiguration
2 A, 24 VDC
(4 A/Masse)
mechanisch: 20.000.000 Schaltspiele
Ausgangs–
LED
OUT
24
Interne
Schaltung
OUT
COM
Maximum
250 VAC: 2 A
24 VDC: 2 A

a Sca aa ä
a Sca aa ä
Leistungsmerkmale Kapitel 2-1
Transistorausgang (NPN)
Spezifikation
CPM1A-10CDT-D CPM1A-20CDT-D CPM1A-30CDT-D CPM1A-40CDT-D CPM1A-20EDT
Max. Schaltkapazität
Leckstrom max. 0,1 mA
Restspannung max. 1,5 V
Einschalt–
verzögerung
Ausschalt–
verzögerung
Sicherung 1,25 A/Bezugspunkt (kann nicht durch Anwender ausgetauscht werden)
Schaltungs–
konfiguration
24 VDC
0,9 A/Baugruppe 0,9 A/Bezugspunkt
max. 0,1 ms
OUT01000/01001: max. 0,2 ms (Laststrom: 100 bis 300 mA)
Andere als OUT01000/01001: max. 1 ms (Laststrom: 5 bis 300 mA)
+10%
/
, 0,3 A/Punkt (siehe Hinweis)
–5%
1,8 A/Baugruppe
max. 0,5 ms (Laststrom: 5 bis 100 mA)
0,9 A/Bezugspunkt
2,7 A/Baugruppe
Ausgangs–
LED
0,9 A/Bezugspunkt
3,6 A/Baugruppe
OUT
0,9 A/Bezugspunkt
1,8 A/Baugruppe
Interne
Schaltung
Hinweis Soll der Ausgang OUT01000 oder OUT01001 als Pulsausgang verwendet
werden, muß ein Widerstand zur Begrenzung der Laststromes auf 0,1 A oder
0,2 A verwendet werden. Liegt der Wert des Laststromes unter 0,1 A, wird die
EIN/AUS–Antwortzeit verlängert und schnelle Zählimpulse nicht ausgegeben.
Liegt der Laststrom andererseits über 0,2 A, können die internen Komponenten dadurch zerstört werden.
Transistorausgang (PNP)
Spezifikation
CPM1A-
10CDT1-D
Max. Schaltkapazität
Leckstrom max. 0,1 mA
Restspannung max. 1,5 V
Einschalt–
verzögerung
Ausschalt–
verzögerung
Sicherung 1,25 A/Bezugspunkt (kann nicht durch Anwender ausgetauscht werden)
Schaltungs–
konfiguration
24 VDC
0,9 A/Baugruppe 0,9 A/Bezugspunkt
max. 0,1 ms
OUT01000/01001: max. 0,2 ms (Laststrom: 100 bis 300 mA)
Andere als OUT01000/01001: max. 1 ms (Laststrom: 5 bis 300 mA)
+10%
/
, 0,3 A/Punkt (siehe Hinweis)
–5%
CPM1A-
20CDT1-D
1,8 A/Baugruppe
max. 0,5 ms (Laststrom: 5 bis 100 mA)
CPM1A-
30CDT1-D
0,9 A/Bezugspunkt
2,7 A/Baugruppe
Ausgangs–LED
Interne
Schaltung
OUT
COM (–)
0,9 A/Bezugspunkt
3,6 A/Baugruppe
COM (+)
OUT
24 VDC
CPM1A-
40CDT1-D
24 VDC
CPM1A-
20EDT1
0,9 A/Bezugspunkt
1,8 A/Baugruppe
OUT
Hinweis Soll der Ausgang OUT01000 oder OUT01001 als Pulsausgang verwendet
werden, muß ein Widerstand zur Begrenzung der Laststromes auf 0,1 A oder
0,2 A verwendet werden. Liegt der Wert des Laststromes unter 0,1 A, wird die
EIN/AUS–Antwortzeit verlängert und schnelle Zählimpulse nicht ausgegeben.
25

Beschreibung der Baugruppen
Liegt der Laststrom andererseits über 0,2 A, können die internen Komponenten dadurch zerstört werden.
Vorsicht Legen Sie keine Spannung an, die zu einer Überschreitung der max. Schalt-
!
kapazität der Ausgangsklemmen führt. Die Zerstörung des Produktes oder ein
Feuer kann die Folge sein.
2-2 Beschreibung der Baugruppen
2-2-1 CPU–Baugruppen
CPM1A-10CDR-j/10CDT-D/10CDT1-D: 10 Ein–/Ausgänge
2. Funktionale Erdungsklemmen (nur
AC Spannungsversorgung)
1. Spannungsversorgungsklemmen
Eingang
3. Erdungsklemmen
Kapitel 2-2
5. Eingangsklemmen
10. Analogregler
11. Peripherie–Schnittstelle
4. Spannungsversorung Ausgang (nur
AC–Spannungsversorgung)
CPM1A-20CDR-j/20CDT-D/20CDT1-D: 20 Ein–/Ausgänge
CPM1A-30CDR-j/30CDT-D/30CDT1-D: 30 Ein–/Ausgänge
8. Eingangsanzeige
7. SPS–Statusanzeige
9. Ausgangsanzeige
6. Ausgangsklemmen
26
12. Anschluß Erweiterungs–
E/A–Baugruppe

O(gü)
U(gü)
()
Beschreibung der Baugruppen
CPM1A-40CDR-j/40CDT-D/40CDT1-D: 40 Ein–/Ausgänge
Beschreibung der CPU–Baugruppen
1, 2, 3...
1. Spannungsversorgungs–Eingangs–Klemmen
Legen Sie 100...240 VAC oder 24 VDC an diese Klemmen an.
Kapitel 2-2
12. Erweiterter E/A–Baugruppen–
anschluß
2. Funktionelle Erdungsklemme (
)
Erdungsanschluß (AC–Typ) zur Unterdrückung von Störungen und zum
Schutz vor einem elektrischen Schlag.
3. Schutzerdungsklemme (
)
Zum Schutz vor einem elektrischen Schlag.
4. Spannungsversorgungs–Ausgangs–Klemmen
CPM1A–Baugruppen des AC–Typs stellen für andere Eingangsgeräte 24
VDC Versorgungsspannung zur Verfügung. (nur AC Typ)
5. Eingangs–Klemmen
An Eingangsschaltungen anzuschließen.
6. Ausgangs–Klemmen
An Ausgangsschaltungen anzuschließen.
7. SPS–Status– Anzeigen
Diese LEDs zeigen den Betriebszusand der CPM1A an:
Anzeige Status Bedeutung
POWER (grün)
RUN (grün)
ERROR/ALARM
(rot)
COMM (orange)
EIN Spannung ist eingeschaltet.
AUS Spannung ist nicht eingeschaltet.
EIN SPS arbeitet im RUN– oder MONITOR–Betrieb.
AUS SPS arbeitet im PROGRAMM–Betrieb oder ein
schwerwiegender Fehler ist aufgetreten.
EIN Ein schwerwiegender Fehler ist aufgetreten.
(SPS–Betrieb wird unterbrochen)
Blinkt Ein geringfügiger Fehler ist aufgetreten. (SPS–Betrieb
wird fortgesetzt)
AUS Zeigt Normalbetrieb an.
EIN Daten werden über die Peripherie–Schnittstelle
übertragen.
AUS Es findet keine Datenübertragung über die
Peripherie–Schnittstelle statt.
27

Beschreibung der Baugruppen
Kapitel 2-2
8. Eingangs–Anzeigen
Diese Anzeigen leuchten auf, wenn der entsprechende Eingang gesetzt
wird. Tritt ein schwerwiegender Fehler auf, ändern sich die Anzeigen wie
folgt:
CPU– oder E/A–Busfehler: Die Eingangsanzeige erlischt.
Speicher– oder Systemfehler: Die Eingangsanzeige behält den Status bei, der beim Auftreten des Feh-
lers vorhanden war, auch wenn sich der Status wieder ändert.
9. Ausgangs–Anzeigen
Diese Anzeigen leuchten auf, wenn der entsprechende Ausgang gesetzt
wird.
10. Analog–Regler
Dem Bereich IR 250 und IR 251 können BCD–Werte von 0...200 zugewie-
sen werden.
11. Peripherie–Schnittstelle
Anschluß der SPS an ein Peripherie–Gerät über RS-232C–Adapter oder
RS-422–Adapter.
12. Anschluß für Erweiterungs–E/A–Baugruppe
Über die Erweiterungs–E/A–Baugruppe kann die Anzahl der Ein–/Aus-
gänge um 12 Eingänge und 8 Ausgänge erhöht werden. Bis zu 3 Erweiterungs–E/A–Baugruppen können angeschlossen werden.
2-2-2 Erweiterungs–E/A–Baugruppe
1. Eingangsklemmen
5. Erweiterungs–
E/A–Baugruppen–Anschlußkabel
2. Ausgangsklemmen
3. Eingangs–Anzeigen
6. Erweiterungs–Anschluß
4. Ausgangs–Anzeigen
28
1, 2, 3...
1. Eingangsklemmen
An Eingangsschaltungen anzuschließen.
2. Ausgangsklemmen
An Ausgangsschaltungen anzuschließen.
3. Eingangsanzeigen
Diese Anzeigen leuchten, wenn der entsprechende Eingang gesetzt ist.
4. Ausgangsanzeigen
Diese Anzeigen leuchten, wenn der entsprechende Ausgang gesetzt ist.

Beschreibung der Baugruppen
5. Erweiterungs–E/A–Baugruppen–Anschlußkabel
Anschluß der Erweiterungs–E/A–Baugruppe an die CPU–Baugruppe.
6. Erweiterungs–Anschluß
Anschluß zusätzlicher Erweiterungs–E/A–Baugruppen (12 Eingänge/8
Ausgänge). Bis zu 3 Erweiterungs–E/A–Baugruppen können angeschlossen werden.
2-2-3 Kommunikationsadapter
RS-232C Adapter
1. Betriebsart–Schalter
3. RS-232C–Anschluß
2. Anschluß
Pin–Belegung RS-232C
1
FG
2
SD
3
RD
4
RTS
5
CTS
6
7
8
9
Kapitel 2-2
DCD
DSR
DTR
SG
RS-422 Adapter
1, 2, 3...
1. Betriebsartenwahlschalter
Wählen Sie die Einstellung “HOST”, falls Sie einen PC/AT über Host–Link
anbinden wollen. Wählen Sie die Einstellung “NT”, falls Sie ein NT–Bedienterminal anbinden wollen.
2. Anschluß
Anschluß an die Peripherie–Schnittstelle der CPU–Baugruppe.
3. RS-232C–Anschluß
Anschluß über ein RS-232C–Kabel zu einem PC/AT, einem Peripherie–
Gerät oder einem NT–Bedienterminal.
1. Endwiderstand–Schalter
3. RS-422–Anschluß
2. Anschluß
Pin–Belegung RS-422
FG
SG
SDB
SDA
RDB
RDA
1, 2, 3...
1. Endwiderstand–Schalter
Bei dem letzten Gerät eines RS 422–Netzwerkes muß der Endwiderstand
gesetzt werden.
29

Beschreibung der Baugruppen
2. Anschluß
3. RS-422–Anschluß
Hinweis Die CPM1-CIF01/CIF11 dürfen ausschließlich mit den CPM1A, CPM1 und
SRM1 benutzt werden. Keine Verwendung mit C200Hj PC oder anderen
SPS.
Kapitel 2-2
Anschluß an die Peripherie–Schnittstelle der CPU–Baugruppe.
Anschluß an das Host–Link–Netzwerk.
30

Kapitel 3
Installation und Verdrahtung
Dieses Kapitel beschreibt die Installation und Verdrahtung einer CPM1A. Beachten Sie vor der Installation und Verdrahtung die Vorsichtsmaßnahmen.
3-1 Vorsichtsmaßnahmen 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1-1 Verdrahtung der Spannungsversorgung 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1-2 Sicherheitstrennschalter 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1-3 Versorgungsspannung 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-1-4 CPM1A Spannungsunterbrechungen 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2 Installationsort 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2-1 Umgebungsbedingungen 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-2-2 Schalttafel/Schaltschrank–Installation 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3 Installion der CPM1A 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3-1 Anordnung der CPM1A 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3-2 Installation der CPM1A 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-3-3 Anschluß einer Erweiterungs–E/A–Baugruppe 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4 Verdrahtung und Anschlüsse 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4-1 Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen bei der Verdrahtung 39. . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4-2 Erdungsverdrahtung 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4-3 Verdrahtung der Spannungsversorgung 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4-4 Eingangsverdrahtung 43. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4-5 Ausgangsverdrahtung 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4-6 Peripheriegeräte–Anschluß 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4-7 Host–Link–Anschluß 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4-8 1:1–CPU–Link 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3-4-9 NT–Link–Anschluß 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31

Vorsichtsmaßnahmen Kapitel 3-1
3-1 Vorsichtsmaßnahmen
Beachten Sie beim Einbau einer CPM1A–SPS die nachfolgenden Sicherheitsvorkehrungen.
3-1-1 Verdrahtung der Spannungsversorgung
Verwenden Sie dabei getrennte Kabelkanäle für die Spannungsversorgung,
die Steuerungsleitungen und die E/A–Verdrahtung. Verwenden Sie zur Absicherung der Steuerschaltungen, die die Hauptbaugruppen mit Spannung versorgen, spezielle Schutzschaltungen oder Sicherungen.
3-1-2 Sicherheitstrennschalter
Installieren Sie einen Sicherheitstrennschalter, wenn die CPM1A–Ausgänge
wie in diesem Beispiel dazu benutzt werden, den Vorwärts–/Rückwärts–Betrieb eines Motors zu steuern. Durch Fehlfunktion hervorgerufene Unfälle und/
oder mechanischen Zerstörungen können durch die Installation eines Sicherheitstrennschalters vorgebeugt werden.
Die folgende Abbildung zeigt ein solches Schaltungsbeispiel mit einem Sicherheitstrennschalter.
Sicherheitstrennschalter
01005
MC2
MC1
Motor vorwärts
In der oberen Schaltung sind die Kontakte MC1 und MC2 nie gleichzeitig geschlossen, auch wenn durch einen fehlerhaften Betrieb die Ausgänge
01005/01006 gleichzeitig gesetzt werden (fehlerhafter SPS–Betrieb).
3-1-3 Versorgungsspannung
Vorsicht Legen Sie Spannung nur entsprechend der in
!
Spezifikationen
zu Bränden kommen. Bei Problemen mit der entsprechenden Nennspannung
müssen diese zunächst beseitigt werden. Ergreifen Sie Sicherheitsmaßnahmen wie z.B. den Einsatz von Unterbrechungsschaltern, um Kurzschlüssen in
der externen Verdrahtung vorzubeugen. Falls Sie irgendeine der nachfolgenden Maßnahmen durchführen, schalten Sie die Spannungsversorgung der
SPS zuvor ab. Bei Nichtbeachtung kann es zu Tod durch elektrischen Schlag,
Zerstörungen des Geräts und Fehlfunktionen kommen.
• Antschluß oder Entfernen von Erweiterungs–E/A–Baugruppen und CPU–
Baugruppen.
• Baugruppenmontage
• Anschluß von Kabeln und Verdrahten
CPM1
01006
MC1
MC2
Motor rückwärts
Kapitel 2 Baugruppen–
dargestellten Vorgabewerte an. Bei Nichtbeachtung kann es
3-1-4 CPM1A Spannungsunterbrechungen
Spannungsabfall
Fällt die Versorgungsspannung für einen definierten Zeitraum unter 85% der
Nennspannung ab, wird der SPS–Betrieb unterbrochen und die Ausgänge
zurückgesetzt.
Kurzfristige Spannungsschwankung
Ein nur kurzfristiger Spannungsabfall, unter 10 ms bei AC–Spannungsversorgung bzw. unter 2 ms bei DC–Spannungsversorung, wird nicht erkannt und
der SPS–Betrieb wird fortgesetzt.
32

Installationsort
Kapitel 3-2
Sollte der Spannungsabfall bei AC–Spannungsversorgung länger als 2 ms,
bei DC–Spannungsversorgung länger als 10 ms andauern, wird der SPS–Betrieb unterbrochen und die Ausgänge zurückgesetzt. Spannungsschwankungen werden ausgeglichen, solange die Toleranzen der Sollwerte (Dauer und
Höhe der Spannungsschwankung) eingehalten werden.
Wird eine kurzfristige Spannungsunterbrechung erkannt, wird der CPU–Betrieb unterbrochen und alle Ausgänge zurückgesetzt.
Automatische Betriebsaufnahme
Sobald die Versorungsspannung 85% der Nennspannung wieder überschreitet, wird der Betrieb automatisch fortgesetzt.
Dauer des Spannungsabfalls
(unterhalb 85% der Nennspannung)
Hinweis Es kann zu einem Start–/Stop–Betrieb kommen, falls die Versorgungsspan-
nung immer wieder unter die Nennspannung absinkt und dann wieder übersteigt.
Sollte es zu Folgeproblemen mit angeschlossenen Peripheriegeräten kommenn, sollten Sie durch eine entsprechende Schutzschaltung, die den Ausgang bei Versorgungsspannungabfall unter 85% der Nennspannung zurücksetzt, entsprechenden Schäden und Störungen vorbeugen.
Einschaltverzögerung
Die Zeit, die zwischen dem Einschalten der Spannungsvorgung und dem Betriebsstart liegt, hängt von den Betriebsparametern (Spannungsversorgung,
Systemkonfiguration, Umgebungstemperatur) ab, beträgt jedoch mindestens
300 ms.
3-2 Installationsort
Wählen Sie den Installationsort entsprechend der nachfolgend aufgeführten
Parameter. Dadurch wird eine maximale Betriebssicherheit und Zuverlässigkeit der CPM1A gewährleistet.
Absinken Anstieg
Normalbetrieb Betriebsunterbrechung
10 ms (2 ms)
Alle Ausgänge werden bei
Betriebsunterbrechung auf
AUS gesetzt.
Vorsicht Stellen Sie sicher, daß Sie die Installation korrekt unter Beachtung der Hin-
!
weise dieses Handbuches vornehmen. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen
kommen.
3-2-1 Umgebungsbedingungen
Hinweis Vermeiden Sie es, die CPM1A an Orten zu installieren, an denen folgende
Umweltbedingungen vorherrschen:
• direkte Sonneneinstrahlung
• Umgebungstemperaturen von weniger als 0°C oder mehr als 55°C
• relative Luftfeuchtigkeit unter 10% oder höher als 90%.
• Wasserkondensatbildungen als Folge erheblicher Termperatur–
schwankungen
• ätzende oder leicht endzündliche Gase
• Stäube (besonders Eisenstäube) und Salze
• starke Stöße oder Vibrationen.
• Wasser, Öl oder chemische Substanzen
33

Installationsort
Kapitel 3-2
Stellen Sie sicher, daß die grundsätzlichen Anforderung an die Installationsumgebung erfüllt sind. Für nähere Informationen siehe
Kapitel 2-1-1
Allgemeine Merkmale.
Sorgen Sie für ausreichende Abschirmung bei folgenden Umgebungsbedingungen:
• Auftreten von statischer Elektrizität oder anderen elektrischen Störungen
• Auftreten von starken elektromagnetischen Feldern
• Auftreten von Radioaktivität
• Nähe zu Stromleitungen
3-2-2 Schalttafel/Schaltschrank–Installation
Bei der Installation der CPM1A in einer Schalttafel oder einem Schaltschrank
sind folgende Parameter zu beachten.
Überhitzung Der Betriebs–Temperatur–Toleranzbereich für die CPM1A beträgt 0_C bis
55_C. Sorgen Sie für eine ausreichende Kühlung innerhalb der Schalttafel,
damit dieser Bereich nicht überschritten wird.
• Schaffen Sie Zwischenräume für die Luftzirkulation.
• Installieren Sie die CPM1 nicht in der Nähe von Geräten die erhebliche
Wärme abstrahlen wie z.B. Heizungen, Transformatoren oder große Widerstände.
• Installieren Sie einen Lüfter, um einen Anstieg der Temperatur über den
Grenzwert von 55_C hinaus zu verhindern.
Schalttafel
Ventilationsöffnung
Lüfter
CPM1A
Elektrische Störungen Netzleitungen und Geräte mit großer Leistung können den SPS–Betrieb stö-
ren.
• Installieren Sie die CPM1A nicht mit Hochspannungsgeräten in einem
Schaltschrank.
• Der Mindestabstand zu Netzleitungen beträgt wenigstens 200 mm.
min. 200 mm.
CPM1A
min 200 mm
34
Stellen Sie weiterhin sicher, daß die CPM1 für Wartungs– und Reparatureinsätze gut zugänglich ist.

Installion der CPM1A
3-3 Installion der CPM1A
3-3-1 Anordnung der CPM1A
Die CPM1A muß entsprechend der nachfolgenden Abbildung installiert werden, um eine ausreichende Kühlung sicherzustellen.
Installieren Sie die CPM1A nicht in einer der nachfolgend dargestellten Anordnungen.
Kapitel 3-3
Richtig
Falsch
Richtig
3-3-2 Installation der CPM1A
Die CPM1A kann auf einer Montagefläche oder einer DIN–Schiene installiert
werden.
Montagefläche Zur Installation auf einer Montagefläche müssen folgende Montagebohrungen
vorhanden sein.
CPM1A-10CDR-j/10CDT-D/10CDT1-D und
CPM1A-20CDR-j/20CDT-D/20CDT1-D
Zwei M4 Bohrungen
100 mm
Verwenden Sie Schrauben der Größe M4 x 15.
Der Abstand A zwischen den Montagebohrungen hängt von der gewählten
CPU–Baugruppe (CPM1A) ab.
CPM1A-10CDR-j/10CDT-D/10CDT1-D CPU–Baugruppe 56 mm
CPM1A-20CDR-j/20CDT-D/20CDT1-D CPU–Baugruppe 76 mm
CPU–Baugruppe
A 8 mm
Typ Lichter Abstand (A)
35

Installion der CPM1A
Kapitel 3-3
Verwenden Sie die folgenden Montageabstände bei der Installation der
CPM1A oder des Kommunikationsadapters.
21 mm
81 mm
Kommunikations–
Adapter
CPU
10 bis 15 mm
100 mm
CPM1A-30CDR-j/30CDT-D/30CDT1-D und
CPM1A-40CDR-j/40CDT-D/40CDT1-D
Vier M4 Bohrungen
100 mm
CPU
A
8 mm
Verwenden Sie Schrauben der Größe M4 x 15.
Der Abstand A zwischen den Montagebohrungen hängt von der gewählten
CPU–Baugruppe (CPM1A) ab.
Typ Lichter Abstand (A)
CPM1A-30CDR-j/30CDT-D/30CDT1-D CPU–Baugruppe 120 mm
CPM1A-40CDR-j/40CDT-D/40CDT1-D CPU–Baugruppe 140 mm
Erweiterungs–E/A–Baugruppe 76 mm
Verwenden Sie die folgenden Montageabstände bei der Installation der
CPM1A, der Erweiterungs–E/A–Baugruppe oder des Kommunikationsadapters.
21 mm
Erweiterungs–
E/A–Baugruppe
100 mm81 mm
Kommunikations –
Adapter
CPU
10 bis 15 mm 10 bis 15 mm
DIN–Schienen–Installation The CPM1A kann auf einer 35 mm DIN–Schiene installiert werden.
DIN–Schiene
Abschluß
(PFP-M)
PFP-100N (1 m)
PFP-50N (50 cm)
PFP-100N2 (1 m)
36

Installion der CPM1A
Kapitel 3-3
Installation
Heben Sie die CPM1A unten leicht an, setzen sie von oben in die DIN–
Schiene und drücken sie leicht herunter, bis sie einrastet.
Lösen
Lösen Sie die Verriegelung mit dem Schraubenzieher und heben die CPM1A
von der DIN–Schiene.
Schraubendreher
3-3-3 Anschluß einer Erweiterungs–E/A–Baugruppe
Bis zu drei Erweiteurngs–E/A–Baugruppen können an die CPU–Baugruppen
CPM1A-30CDR-j/ 30CDT-D/30CDT1-D und CPM1A-40CDR-j/40CDTD/40CDT1-D angeschlossen werden. Geben Sie bei der Installation entsprechend den nachfolgend dargestellten Handlungsschritten vor.
1, 2, 3...
1. Entfernen Sie Anschluß–Abdeckung von der CPU– oder Erweiterungs–
E/A–Baugruppe. Benutzen Sie dzu bei der Erweiterungs–E/A–Baugruppe
ein Flach–Schraubendreher.
Anschlußabdeckung
Erweiterungs–
E/A–Baugruppe
37

Installion der CPM1A
Kapitel 3-3
2. Schließen Sie die Erweiterungs–E/A–Baugruppe an die CPU– oder Erweiterungs–E/A–Baugruppe über das E/A–Verbindungskabel an.
3. Installieren Sie abschließend die Anschluß–Abdeckung wieder auf der
Erweiterungs–E/A–Baugruppe.
38

Verdrahtung und Anschlüsse
3-4 Verdrahtung und Anschlüsse
Nachfolgend wird sowohl die Verdrahtung der Netzteil–Baugruppe und der
Erweiterungs–E/A–Baugruppe sowie der Anschluß der Peripheriegeräte beschrieben.
3-4-1 Allgemeine Sicherheitsmaßnahmen bei der Verdrahtung
Vorsicht Vor oder während der Verdrahtung sollte der Aufkleber auf den Lüftungsschlit-
!
zen nicht entfernt werden. Er verhindert, daß während der Verdrahtung Verdrahtungsreste durch die Lüftungsschlitze in die Baugruppe gelangen. Daraus
resultierende Kurzschlüsse könnten die Baugruppe zerstören oder Fehlfunktionen auslösen. Ist die Verdrahtung abgeschlossen, muß der Aufkleber entfernt werden, um ein Überhitzen der Baugruppe zu vermeiden.
Aufkleber als Schutz
vor Verdrahtungsresten oder
Schmutz
Kapitel 3-4
Störungen über die E/A–Leitung
Verlegen Sie die CPM1A E/A–Leitungen nicht mit anderen stromführenden
Leitungen im gleichen Kanal.
Kabelkanäle
Beachten Sie den Mindestabstand von wenigstens 300 mm zwischen stromführenden Leitungen und der E/A–Steuerungsleitung, wie nachfolgend dargestellt.
CPM1A E/A–Leitungen
Steuerungsleitung
und stromführendes
Kabel der CPM1A
stromführende Leitung
Kabelkanäle im Fußboden
Beachten Sie den Mindestabstand von wenigstens 200 mm zwischen Ober-
min. 300 mm
min. 300 mm
39

Verdrahtung und Anschlüsse
Kapitel 3-4
kannte Verdrahtung und Abdeckung des Kabelkanals, wie nachfolgend dargestellt.
CPM1A E/A–Leitungen
Rohrleitungen
Verlegen Sie die CPM1A E/A–Leitungen, die Steuerleitungen und stromführenden Leitungen der CPM1A und andere stromführende Leitungen in getrennten Rohren, wie nachfolgend dargestellt.
3-4-2 Erdungsverdrahtung
Steuerungsleitungen
und stromführende
Leitung der CPM1A
CPM1A E/A–
Leitungen
Steuerungsleitung
und stromführende
Leitung der CPM1A
stromführende
Leitungen
Metallplatte (Eisen)
Stromführende
Leitungen
min. 200 mm.
Erdung Erden Sie zur Vermeidung von elektrischem Schlag und Betriebsstörung
durch elektrische Störungen die funktionelle Erdungsklemme und die
Schutzerdungsklemme nach EN 60204.
Erdung nach EN 60204
AC
Spannungsversorgung
Erdung nach EN 60204
DC
Spannungsversorgung
Hinweis Bei Durchschlagsspannungstests sollte die funktionelle Erdungsklemme ent-
fernt werden.
Verwenden sie M3–Klemmenschrauben, und ziehen Sie diese mit einem
Drehmoment von max. 0,5 Nm an.
Benutzen Sie ausschließlich die nachfolgend dargestellte Klemmenform.
Kabelschuhe
40
Vorsicht Verwenden Sie Kabelschuhe für die stromführenden Leitungen und die E/A–
!
Leitungen der CPM1A oder benutzen Sie statt verdrillter Leitungen 1–Drahtleitungen. Verdrillte Leitungen erhöhen das Kurzschlußrisiko und könnten dadurch einen Brand auslösen.

Verdrahtung und Anschlüsse
Verwenden sie M3–Klemmenschrauben, und ziehen Sie diese mit einem
Drehmoment von max. 0,5 Nm an.
Benutzen Sie ausschließlich die nachfolgend dargestellte Klemmenform.
Gabelform Ringform
6,2 mm max. 6,2 mm max.
3-4-3 Verdrahtung der Spannungsversorgung
Kapitel 3-4
100...240 VAC
Spannungsversorgung
AC
Spannungsversorgung
Unter–
brecher
Verwenden Sie eine getrennte Spanungsversorgung für die CPM1A. Dadurch
wird Spannungsabfall durch einen Einschaltstrom, der durch das Einschalten
anderer Geräte hervorgerufen werden könnte, vermieden.
Verwenden Sie mehrere CPM1, benutzen Sie mehrere Spannungsversorgungen. Auch hier wird dadurch ein Spannungsabfall im Einschaltmoment ausgeschlossen.
Um Störungen auszuschließen, verwenden Sie zur galvanischen Trennung
einen 1:1–Trenntransformator und eine verdrillte 2–Drahtleitung. Achten Sie
bei der Auslegung der Leitungsdicke auf einen ausreichenden Leitungsquerschnitt, um mögliche Spannungs– oder Stromspitzen abzufangen.
Verwenden Sie eine verdrillte
Trenn–
trans–
formator
2–Drahtleitung mit einem
Mindestquerschnitt von 1,25 mm
2
.
Kabelschuhe
Vorsicht Verwenden Sie Kabelschuhe für die stromführenden Leitungen und die E/A–
!
Vorsicht Ziehen Sie jede Klemmenschraube zur Verdahtung der AC–Spannungsver-
!
24 VDC Spannungsversorgung
Leitungen der CPM1A oder benutzen Sie statt verdrillter Leitungen 1–Drahtleitungen. Verdrillte Leitungen erhöhen das Kurzschlußrisiko und könnten dadurch einen Brand auslösen.
Verwenden sie M3–Klemmenschrauben.
Benutzen Sie ausschließlich die nachfolgend dargestellte Ringklemme für
jede Klemmenschraube.
Ringklemme
6,2 mm max.
sorgung mit einem Drehmoment von 0,5 Nm an. Bei der CPM1A können
Kurzschluß, Fehlfunktion oder Brand die Folge sein, wenn die Klemmenschrauben nicht ordnungsgemäß angezogen wurden.
Benutzen Sie eine DC–Spannungsversorgung mit ausreichender Leistung
und hoher Glättung sowie verstärkter Isolierung. Für die DC–Spannungsversorgung einer Baugruppe mit Transistorausgängen muß eine Netzteil–Bau-
41

Verdrahtung und Anschlüsse
Vorsicht Führen Sie keine Durchschlagsspannungstests durch. Solche Tests könnten
!
Kabelschuhe
Vorsicht Verwenden Sie Kabelschuhe für die stromführenden Leitungen und die E/A–
!
Kapitel 3-4
gruppe mit doppelter Isolation eingesetzt werden, um den Anforderungen der
Niederspannungsrichtlinie genüge zu leisten.
24 VDC
die internen Komponenten der SPS zerstören.
Leitungen der CPM1A oder benutzen Sie statt verdrillter Leitungen 1–Drahtleitungen. Verdrillte Leitungen erhöhen das Kurzschlußrisiko und könnten dadurch einen Brand auslösen.
Verwenden sie M3–Klemmenschrauben, und ziehen Sie diese mit einem
Drehmoment von max. 0,5 Nm an.
Benutzen Sie ausschließlich die nachfolgend dargestellte Klemmenform.
Gabelform Ringform
6,2 mm max. 6,2 mm max.
42

Verdrahtung und Anschlüsse
Kapitel 3-4
3-4-4 Eingangsverdrahtung
Verdrahten Sie die Eingänge der CPU– und Erweiterungs–E/A–Baugruppe
entsprechend der nachfolgenden Abbildung. Verwenden Sie dabei Kabelschuhe oder 1–Drahtleitungen. Die Spannungsversorgungs–Ausgangs–Klemmen können bei AC–CPU–Baugruppen verwendet werden.
Eingangskonfiguration In der nachfolgenden Abbildung ist die Eingangskonfiguration dargestellt.
CPM1A-10CDR-j/10CDT-D/10CDT1-D
24 VDC
CPM1A-20CDR-j/20CDT-D/20CDT1-D
CPM1A-20EDR/20EDT/20EDT1
24 VDC
CPM1A-30CDR-j/30CDT-D/30CDT1-D
24 VDC
Eingangsgeräte
Eingangsgeräte
Eingangsgeräte
CPM1A-40CDR-j/40CDT-D/40CDT1-D
24 VDC
Eingangs–
geräte
43

Verdrahtung und Anschlüsse
Kapitel 3-4
Eingangs–Verdrahungsbsp. Nachfolgend ist eine CPU–Baugruppe (AC–Typ) dargestellt. Die CPU–Bau-
gruppen (DC–Typ) verfügen über keine Versorgungs–Spanungsausgänge.
Eingangs–
geräte
COM
Externe Spannungsversorgung:
(Anwendbar bei CPU–Baugruppen mit 100...240 VAC Spannungsversorgung.)
24 VDC bei 200 mA/10-E/A und 20-E/A CPU–Baugruppen
24 VDC bei 300 mA/30-E/A und 40-E/A CPU–Baugruppen
44

Verdrahtung und Anschlüsse
Kapitel 3-4
Eingangsgeräte Die folgende Tabelle zeigt Schaltpläne für verschiedene Eingangsgeräte.
Gerät Schaltpläne
Relais–Ausgang
Relais
5 mA/12 mA
CPM1A
IN
COM (+)
NPN offener Kollektor
NPN Stromausgang
PNP Stomausgang
Spannungsausgang
Sensor
Konstantstrom–
Schaltung
+
Ausgang
Sensor−
Spannungs−
versorgung
5 mA/12 mA
0 V
Benutzen Sie für Eingang und Sensor die gleiche
Spannungsversorgung.
+
Ausgang
5 mA/12 mA
+
0 V
+
5 mA/12 mA
Ausgang
Sensor−
Spannungs−
versorgung
0 V
+
Ausgang
0 V
Sensor−
Spannungs−
versorgung
CPM1A
IN
COM (+)
CPM1A
IN
COM (+)
CPM1A
IN
COM (–)
CPM1A
COM (+)
IN
45

Verdrahtung und Anschlüsse
Kapitel 3-4
Leckstrom (24 VDC) Ein Leckstrom kann bei der Verwendung von Zweidraht–Sensoren (Nähe-
rungsschalter oder Fotoschalter) oder Grenzschalter mit LED falsche Eingaben verursachen.
Falls der Leckstrom 1,0 mA (2,5 mA für IN00000...IN00002) überschreitet,
fügen Sie einen Ableitwiderstand in die Schaltung ein, um die Eingangsimpedanz, wie in dem folgenden Diagramm gezeigt wird, zu reduzieren.
Eingangsspannungsversorgung
2-Draht–Sensor usw.
I: Leckstrom des Gerätes (mA)
R: Ableitwiderstand (kΩ)
W: Verlustleistung Ableitwiderstands (W)
L
5,0
C
R +
Die obige Gleichung wurde von folgenden Gleichungen abgeleitet:
I L
C
–5,0
Ableitwiderstand
max. kW
R
L
: Eingangsimpedanz CPM1A (kΩ)
C
I
: Eingangsstrom CPM1A (mA)
C
E
: Ausschaltspannung CPM1A (V)=5,0 V
C
2,3
R
min. W
W +
CPM1A
Eingangsspannung (24)
R
I
Wy
Für weitere Informationen zu den Werten von LC, IC, und E
Kapitel 2–1–3 E/A–Spezifikationen
Eingangsstrom (IC)
Eingangsspannung (24)
R )
Eingangsstrom (I
Eingangsspannung (24)
R
x Ausschaltspannung (EC:5.0)
)
C
Eingangsspannung (24) Toleranz (4)
siehe
C
.
Eingangsimpedanz, Eingangsstrom und Ausschaltspannung können je nach
Eingang varieren. (IN00000 durch IN00002 haben unterschiedliche Werte)
Induktive Lasten Beim Anschluß einer induktiven Last an eine E/A–Einheit sollte eine Diode
parallel zur Last geschaltet werden. Die Diode muß folgende Eigenschaften
erfüllen.
1, 2, 3...
1. Die Spitzen–Durchbruchsspannung muß mindenstens den 3–fachen Wert
der Lastspannung betragen.
2. Der gleichgerichtete Strom muß im Durchschnitt 1 A betragen.
IN
Diode
CPM1A
COM
Kabelschuhe
46
Vorsicht Verwenden Sie Kabelschuhe für die stromführenden Leitungen und die E/A–
!
Leitungen der CPM1A oder benutzen Sie statt verdrillter Leitungen 1–Drahtleitungen. Verdrillte Leitungen erhöhen das Kurzschlußrisiko und könnten dadurch einen Brand auslösen.
Verwenden sie M3–Klemmenschrauben, und ziehen Sie diese mit einem
Drehmoment von max. 0,5 Nm an.

Verdrahtung und Anschlüsse
Kapitel 3-4
Benutzen Sie ausschließlich die nachfolgend dargestellte Klemmenform.
Gabelform Ringform
6,2 mm max. 6,2 mm max.
47

Verdrahtung und Anschlüsse
3-4-5 Ausgangsverdrahtung
Verdrahtung der Relaisausgänge
Verdrahten Sie die Ausgänge der CPU– und Erweiterungs–E/A–Baugruppe
entsprechend der nachfolgenden Abbildung. Verwenden Sie dabei Kabelschuhe. Die Spannungsversorgungs–Ausgangs–Klemmen können bei AC–
CPU–Baugruppen verwendet werden.
• Verwenden Sie zur Verdrahtung 1–Drahtleitungen oder im Falle verdrillter
2–Drahtleitungen Kabelschuhe.
• Überschreiten Sie nicht die Ausgangskapazität oder den maximalen Strom.
Weitere Informationen hierzu, siehe Kaptiel
Ausgangskapazität 2 A (250 VAC oder 24 VDC)
Max. Kapazität 4 A/Bezugspunkt
Ausgangskonfiguration
CPM1A-10CDR-j
Kapitel 3-4
2-1-3 E/A–Spezifikationen.
Spezifikation
CPM1A-20CDR-j/CPM1A-20EDR
CPM1A-30CDR-j
CPM1A-40CDR-j
Last
Last
Bezugspunkt
Last
Last
Bezugspunkt
Last
Last
Bezugs–
punkt
Last
Last
Last
Last
Last
Bezugspunkt
Last
Last
Last
Bezugs–
punkt
Last
Last
Last
Last
Last
Last
Bezugs–
punkt
Last
Last
Last
Last
48
Last
Last
Last
Last
Last
Last
Last
Last
BezugspunktBezugspunkt Bezugspunkt
Last
Last
Last
Last
Last
Last
Bezugspunkt
Last
Last

Verdrahtung und Anschlüsse
Verdrahtung der Transistorausgänge (NPN–Typ)
Verdrahten Sie die Ausgänge der CPU– und Erweiterungs–E/A–Baugruppe
entsprechend der nachfolgenden Abbildung. Verwenden Sie dabei Kabelschuhe.
• Verwenden Sie zur Verdrahtung 1–Drahtleitungen oder im Falle verdrillter
2–Drahtleitungen Kabelschuhe.
• Überschreiten Sie nicht die Ausgangskapazität oder den maximalen Strom.
Weitere Informationen hierzu, siehe Kaptiel
Ausgangskapazität 300 mA (24 VDC)
Max. Kapazität 0,9 A/Bezugspunkt
Ausgangskonfiguration
CPM1A-10CDT-D
+10%
24 VDC
/
–15%
Last
Last
2-1-3 E/A–Spezifikationen.
Specifikation
Last
Last
Kapitel 3-4
CPM1A-20CDT-D/CPM1A-20EDT
24 VDC
CPM1A-30CDT-D
24 VDC
CPM1A-40CDT-D
+10%
+10%
/
–15%
/
–15%
Last
Last
Bezugs–
punkt
Last
Last
Bezugspunkt
Bezugspunkt
Last
Last
Last
Bezugs–
punkt
Last
Last
Last
Bezugs–
punkt
Last
Last
Last
Last
Last
Last
Bezugs–
punkt
Last
Last
Last
Last
+10%
24 VDC
Vorsicht Überprüfen Sie vor dem Einschalten die Polarität der Spannungsversorgung
!
/
–15%
Last
Last
Bezugspunkt
Last
Last
Last
Last
Last
Last
Last
Last
Last
Last
Last
BezugspunktBezugspunktBezugspunkt
der Last sehr gründlich.
Last
Last
49
Last

Verdrahtung und Anschlüsse
Verdrahtung der Transistorausgänge (PNP–Typ)
Verdrahten Sie die Ausgänge der CPU– und Erweiterungs–E/A–Baugruppe
entsprechend der nachfolgenden Abbildung. Verwenden Sie dabei Kabelschuhe.
• Verwenden Sie zur Verdrahtung 1–Drahtleitungen oder im Falle verdrillter
2–Drahtleitungen Kabelschuhe.
• Überschreiten Sie nicht die Ausgangskapazität oder den maximalen Strom.
Weitere Informationen hierzu, siehe Kaptiel
Ausgangskapazität 300 mA (24 VDC)
Max. Kapazität 0,9 A/Bezugspunkt
Ausgangskonfiguration
CPM1A-10CDT1-D
+10%
24 VDC
/
–15%
Last
Last
Specifikation
Last
Last
Kapitel 3-4
2-1-3 E/A–Spezifikationen.
CPM1A-20CDT1-D/CPM1A-20EDT1
24 VDC
CPM1A-30CDT1-D
+10%
24 VDC
CPM1A-40CDT1-D
+10%
/
–15%
/
–15%
Bezugspunkt
Last
Last
Bezugs–
punkt
Last
Last
Bezugspunkt
Last
Last
Last
Last
Lat
Last
Bezugs–
punkt
Last
Last
Bezugs–
punkt
Last
Last
Last
Last
Bezugs–
punkt
Last
Last
Last
Last
50
+10%
24 VDC
Vorsicht Überprüfen Sie vor dem Einschalten die Polarität der Spannungsversorgung
!
/
–15%
Last
Last
Last
Bezugs–
punkt
Last
Last
Bezugs–
punkt
Last
Last
Last
Bezugs–
punkt
Last
Last
Last
Last
Last
Bezugs–
punkt
der Last sehr gründlich.
Last
Last
Last

Verdrahtung und Anschlüsse
Kapitel 3-4
Sicherheitsmaßnahmen Beachten Sie die nachfolgend beschriebenen Sicherheitsvorkehrungen, um
die internen Komponenten der SPS zu schützen.
Kurzschlußschutz für Ausgang
Der Ausgang oder die internen Schaltkreise könnten beschädigt werden,
wenn es bei einer an den Ausgang angeschlossenen Last zu einem Kurzschluß kommt. Es ist daher zu empfehlen, eine entsprechende Schutzsicherung zu installieren.
Polarität der Spannungsversorgung der Last
Überprüfen Sie vor der Verdrahtung der Transistorausgänge die Polarität der
Spannungsversorgung der Last sehr gründlich. Bei falschem Anschluß kann
die Last eine Fehlfunktion hervorrrufen und die internen Komponenten können zerstört werden.
Induktive Lasten
Falls eine induktive Last an den Ausgang angeschlossen ist, sollte ein RC–
Glied oder eine Diode parallel zur Last geschaltet werden.
Darstellung RC–Glied:
Relaisausgang
OUT
CPM1A
COM
RC–Glied
Relaisausgang
Transistorausgang
(NPN–Typ)
OUT
Relaisausgang
Transistoraussgang
(PNP–Typ)
CPM1A
COM
OUT
CPM1A
COM
Diode
Diode
Die Diode sollte die folgenden Anforderungen erfüllen:
Die Spitzendurchbruchsspannung muß mindestens den dreifachen Wert
der Lastspannung betragen.
Der gleichgerichtete Strom muß im Durchschnitt 1 A betragen.
Einschaltstrom
Wenn eine Last mit einem hohem Einschaltstrom (z.B. Glühlampe) einer
CPM1A mit Relais– oder Transistorausgang geschaltet, sollte zur Begrenzung eine der nachfolgenden Konfigurationen benutzt werden.
Gegenmaßnahme 1
Gegenmaßnahme 2
OUT
R
COM
Reduzierung des Einschaltstromes
um ca. 1/3 durch Erzeugung eines
Blindstromes
OUT
COM
Reduzierung durch Strom–
begrenzungswiderstand
R
Absicherung bei Kurzschluß über Sicherung
Durch Kurzschluß der Last kann bei der CPM1A mit Transistorausgang ein
Brand ausgelöst werden. Aus diesem Grunde sollte seriell zur Last eine Sicherung installiert werden.
51

Verdrahtung und Anschlüsse
Kabelschuhe
Vorsicht Verwenden Sie Kabelschuhe für die stromführenden Leitungen und die E/A–
!
Leitungen der CPM1A oder benutzen Sie statt verdrillter Leitungen 1–Drahtleitungen. Verdrillte Leitungen erhöhen das Kurzschlußrisiko und könnten dadurch einen Brand auslösen.
Verwenden sie M3–Klemmenschrauben, und ziehen Sie diese mit einem
Drehmoment von max. 0,5 Nm an.
Benutzen Sie ausschließlich die nachfolgend dargestellte Klemmenform.
6,2 mm max. 6,2 mm max.
3-4-6 Peripheriegeräte–Anschluß
Für den Anschluß der Programmierkonsole C200H–PRO27–E an die CPM1A
können die Standard–Verbindungskabel C200H–CN222 (2 m) oder
C200H–CN422 (4 m) verwendet werden. Wenn Sie die Programmierkonsole
CQM1–PRO01 einsetzen, benötigen Sie kein separates Anschlußkabel. Im
Lieferumfang ist ein 2 m–Anschlußkabel enthalten.
Kapitel 3-4
Gabelform Ringform
52

Verdrahtung und Anschlüsse
Kapitel 3-4
3-4-7 Host–Link–Anschluß
Die Host–Schnittstelle dient der Datenübertragung zwischen Host und
CPM1A. Befehle werden vom Host an die CPM1A übertragen, und die
CPM1A sendet eine Rückmeldung an den Host. Über Host–Befehle können
Datenbereiche in der CPM1A gelesen und neue Daten in diesen Bereichen
gespeichert werden.
1:1 Host–Link–Anschluß An die CPM1A kann an einen PC oder ein NT–Bedienterminal angeschlossen
werden. Dazu wird zusätzlich ein RS–232C–Adapter benötigt. Dies ist in der
nachfolgenden Abbildung dargestellt.
NT–Bedienterminal
Antwort
RS-232C
Adapter
CPM1A CPU
Befehl
Antwort
RS-232C
Adapter
CPM1A CPU
Befehl
Nachfolgend ist die Anschlußbelegung der RS–232C–Schnittstelle dargestellt, wodurch die CPM1A an einen PC/AT oder NT–Bedienterminal angeschlossen werden kann.
PC/AT oder NT–Bedienterminal (9-Pin) RS-232C Adapter
Signal
CD
RD
SD
ER
SG
DR
RS
CS
CI
PIN–Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PinNr. Signal
1/Gehäuse
2
3
4
5
6
7
8
9
9
FG
SD
RD
RS
CS
–
–
–
SG
Beachten Sie beim Anschluß eines NT–Bedienterminals auf die unterschiedlichen Anschlußbelegungen der verschiedenen Typen von NT–Bedienterminals. Die genaue Anschlußbelegung finden Sie in dem entsprechenden Handbucher des jeweiligen NT–Bedienterminals.
Hinweis Ist die CPM1A an einen PC/AT oder ein NT–Bedienterminal angeschlossen,
muß der Betriebswahlschalter des RS-232C Adapter’s auf “HOST” geschaltet
werden.
Anschluß 1:N Host–Link Bis zu 32 CPM1A können an einen PC/AT oder ein NT–Bedienterminal ange-
schlossen werden. Für diesen Anschluß wird der Schnittstellen–Adapter
53

Verdrahtung und Anschlüsse
Kapitel 3-4
3G2A9–AL004–E und ein RS–422–Adapter benötigt. Die gesamte Schaltungskonfiguration ist in der nachfolgenden Abbildung dargestellt.
Link Adapter
3G2A9-AL004-E
RS-422
Adapter
CPM1A
CPU
RS-422
Adapter
CPM1A
CPU
RS-422
Adapter
CPM1A
CPU
54

Verdrahtung und Anschlüsse
3G2A9-AL004-E Link Adapter
25-poliger SUB–D
Anschluß
Direkte Ankopplung über
RS–232C–Kabel an PC/AT.
Kapitel 3-4
In der nachfolgenden Abbildung ist die PIN–Belegung der RS–422 für die
1:N–Kommunikation über den Link–Adapter 3G2A9–AL004–E dargestellt. Die
PIN–Belegung des Schnittstellen–Adapter 3G2A9–AL004–E entspricht gleichzeitig der PIN–Belegung des RS–422–Adapters (SG/RDA/RDB/SDA und
SDB).
9-poliger SUB–D Anschluß
Signal
RDB
–
SG
–
SDB
RDA
FG
–
SDA
Pin
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RS-422 Adapter
CPM1A CPU
SG
RDA
RDB
SDA
SDB
Hinweis 1. Die Maximallänge des RS–422–Anschlußkabels kann 500 m betragen.
2. Schalten Sie den Abschlußwiderstands–Schalter des Schnittstellen–
Adapters auf Position EIN. Nehmen Sie die Einstellung für jede Seite
(Host–Schnittstelle und RS–422–Adapter) vor.
Verwenden Sie für die Installation immer Kabelschuhe für die Verdrahtung der
RS–422–Adapter . Verwenden Sie M3–Klemmenschrauben und ziehen Sie
diese mit einem Drehmoment von 0,5 Nm an.
6,2 mm max.
Gabelklemme
6,2 mm max.
Ringklemme
55

Verdrahtung und Anschlüsse
3-4-8 1:1–CPU–Link
Kapitel 3-4
Eine CPM1 kann mit einer CPM1, CQM1 oder C200HS oder C200HX/HG/HE
über einen RS–232C– Adapter verbunden werden. Eine SPS arbeitet dabei
als Master und die andere als Slave. Bis zu 256 Bits können im LR–Bereich
(LR 0000...LR 1515) übertragen werden.
RS-232C–Kabel
RS-232C Adapter
(siehe Hinweis)
SPEICHERN
LESEN
RS-232C Adapter
LR 00
LR 07
LR 08
LR 15
CPM1A CPU
Schnittstellenmerker
SPEICHER–
Bereich
LESE–Bereich
(siehe Hinweis)
Schnittstellenmerker
LESE–Bereich
SPEICHER–
Bereich
CPM1A CPU
LR 00
LR 07
LR 08
LR 15
LESEN
SPEICHERN
Hinweis Für die 1:1–CPU–Link–Kommunikation wird immer ein RS–232C–Adapter
(CPM1–CIF01) benötigt.
Stellen Sie den DIP–Schalter des RS-232C Adapters (CPM1-CIF01) auf
NT–Betrieb.
In der folgenden Abbildung ist die PIN–Belegung für die 1:1–CPU–Link darge-
stellt.
RS-232C Adapter
PIN–Nr.Signal
1/Gehäuse
FG
SD
RD
RS
CS
–
–
–
SG
2
3
4
5
6
7
8
9
RS-232C Adapter
PIN–Nr. Signal
1/Gehäuse
2
3
4
5
6
7
8
9
9
FG
SD
RD
RS
CS
–
–
–
SG
56

Verdrahtung und Anschlüsse
3-4-9 NT–Link–Anschluß
Über den Direktzugriff mittels NT–Link zwischen CPM1A und einem NT–
Bedienterminal kann eine schnelle Kommunikation hergestellt werden.
Kapitel 3-4
NT–Bedienterminal
RS-232C–Kabel
RS-232C
Adapter
CPM1A CPU
Hinweis Die NT–Link–Baugruppe kann nur über einen RS-232C Adapter
(CPM1-CIF01) angeschlossen werden.
Stellen Sie den DIP–Schalter des RS-232C Adapters (CPM1-CIF01) auf
NT–Betrieb.
Nachfolgend ist die PIN–Belegung für den NT–Anschluß dargestellt.
NT–Bedienterminal
PIN–Nr.Signal
–
SD
RD
RS
CS
–
–
–
SG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
RS-232C Adapter
PIN–Nr. Signal
1/Gehäuse
2
3
4
5
6
7
8
9
9
FG
SD
RD
RS
CS
–
–
–
SG
57

Dieses Kapitel gibt Informationen zum Anschluß und Betrieb der Programmierkonsole.
4-1 Programmierkonsolenbetrieb 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1-1 Kompatible Programmierkonsole 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1-2 Anschluß der Programmierkonsole 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-1-3 Ändern der CPM1A–Betriebsart 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2 Programmierkonsolen–Funktion 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-1 Übersicht 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-2 Löschen des Speichers 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-3 Anzeigen/Löschen der Fehlermeldungen 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-4 Summton 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-5 Setzen und Anzeigen von Programmspeicher–Adressen 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-6 Befehls–Suche 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-7 Operanden–Bit–Suche 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-8 Einfügen und Löschen von Befehlen 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-9 Eingabe oder Editieren eines Programms 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-10 Überprüfen des Programms 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-11 Bit–/Wort–Überwachung 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-12 Flankenerkennungsüberwachung 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-13 Binärdaten–Überwachung 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-14 3-Wort Überwachung 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-15 Dezimale Überwachung mit Vorzeichen 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-16 Dezimale Überwachung ohne Vorzeichen 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-17 3-Wort–Datenänderung 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-18 Ändern der Zeitgeber/Zähler–Sollwerte 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-19 Hexadezimal–/BCD–Datenänderung 79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-20 Binärdaten–Änderung 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-21 Dezimale Datenänderung mit Vorzeichen 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-22 Dezimale Datenänderung ohne Vorzeichen 82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-23 Zwangssetzen, Zwangsrücksetzen 82. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-24 Aufheben der Zwangssetzungen/Zwangsrücksetzungen 83. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-25 Hex-ASCII Anzeigeumschaltung 83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-2-26 Zykluszeitanzeige 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3 Programmierbeispiel 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3-1 Vorbereitende Maßnahmen 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3-2 Beispiel–Programm 86. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3-3 Programmieren 87. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3-4 Programmüberprüfung 89. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4-3-5 Test–Lauf in der MONITOR–Betriebsart 90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitel 4
Peripheriegeräte
59

Programmierkonsolenbetrieb
4-1 Programmierkonsolenbetrieb
Dieses Kapitel beinhaltet Informationen über den Betrieb und Anschluß einer
Programmierkonsole. Für nähere Informationen zur Fehlerbehebung siehe
5-4 Programmierkonsolen Fehlermeldungen.
4-1-1 Kompatible Programmierkonsole
Für die CPM1A können zwei Programmierkonsolen, CQM1-PRO01-E und
C200H-PRO27-E, verwendet werden. Die Tastenfunktionen dieser Programmierkonsolen sind identisch.
Drücken Sie die [SHIFT]-Taste und halten Sie diese gedrückt, um den in der
linken oberen Ecke der Taste angezeigten Buchstaben einzugeben bzw. um
die obere Funktion einer Taste, die über zwei Funktionen verfügt, zu aktivieren. Mit der [AR/HR]-Taste der CQM1-PRO01-E können Sie beispielsweise
den AR- oder den HR-Bereich spezifizieren. Drücken Sie die [SHIFT]-Taste,
geben Sie sie anschließend wieder frei und drücken Sie dann die [AR/HR]-Taste, um den AR-Bereich zu spezifizieren.
Kapitel 4-1
CQM1-PRO01-E
2 m–Anschlußkabel gehört zum Lieferumfang
Die folgenden drei Tasten sind auf der CQM1-PRO01-E und der C200HPRO27-E unterschiedlich beschriftet. Der Betrieb der in der folgenden Tabelle
einander gegenübergestellten Tasten ist jedoch identisch.
LCD–Anzeige
Betriebsarten–
wahlschalter
Befehlstasten
Zifferntasten
Operations–
tasten
C200H-PRO27-E
Verwenden Sie das Anschlußkabel
C200H-CN222 (2 m) oder C200H-CN422 (4 m).
60
CQM1-PRO01-E Tasten C200H-PRO27-E Tasten
AR
HR
SET
RESET
HR
PLAY
SET
REC
RESET

Programmierkonsolenbetrieb
Kapitel 4-1
4-1-2 Anschluß der Programmierkonsole
Schließen Sie die Programmierkonsole, wie unten dargestellt, an die
Peripherie–Schnittstelle der CPM1A an.
Schalttafel–Installation Die Programmierkonsole C200H-PRO27-E kann in eine Schalttafel eingebaut
werden. (Die C200H-ATT01 Montageklammer muß gesondert bestellt werden.)
Montagebohrungen
Montage–Klammer
(DIN43700–Standard)
Zwei Schrauben
+1.1
186
–0
+0.8
92
Dicke: 1,0 bis 3,2 mm
–0
Der lichte Abstand für den Kabelanschluß oberhalb der Programmierkonsole
muß min. 80 mm betragen.
37
15
min. 80 mm lichter Abstand
Kabelanschluß
ca. 70 mm lichter Abstand
61

Programmierkonsolenbetrieb
4-1-3 Ändern der CPM1A–Betriebsart
Der Betriebsartenwahlschalter dient zur Einstellung der Betriebsart. Die entsprechende Betriebsart (<PROGRAM>, <MONITOR>, oder <RUN>) wird
dann auf der Anzeige dargestellt
• Solange die Betriebsartenanzeige aktiv ist, werden weitere Tastatureingaben nicht angenommen. Drücken Sie die [CLR]–Taste, um die Eingabe freizugeben.
• Wird die [SHIFT]–Taste gedrückt gehalten, während der Betriebswahlschalter gedreht wird, bleibt der ursprüngliche Inhalt der Anzeige erhalten und
die Betriebsart wird nicht angezeigt.
• Wurde ein Peripheriegerät wie z.B. eine Programmierkonsole angeschlossen, schaltet die CPM1A beim Einschalten automatisch in die RUN–Betriebsart.
Kapitel 4-1
MONITOR
RUN
Betriebsartenanzeige
<PROGRAM> BZ
PROGRAM RUN
MONITOR
PROGRAM
<MONITOR> BZ <RUN> BZ
Operation Operation
Ausgangsanzeige
CLR SHIFT CLR
00000
MONITOR
PROGRAMRUN
PROGRAM–Betriebsart Das CPM1A–Programm wird in der PROGRAM–Betriebsart ausgeführt. Die
PROGRAM–Betriebsart dient dem Erstellen und Editieren eines Programms,
dem Löschen des Speichers und der Überprüfung auf Programmfehler.
MONITOR –Betriebsart Das CPM1A–Programm wird in der MONITOR–Betriebsart ausgeführt. Ein–
und Ausgaben werden wie in der RUN–Betriebsart verarbeitet. Die MONITOR–Betriebsart dient dem Überwachen des CPM1A–Betriebsstatus, der
Zwangssetzung und Zwangsrückssetzung von E/A–Bits und dem Einstellen
der Soll– und Istwerte des Zeitgebers, Zählers usw.
RUN –Betriebsart Dies ist die Normalbetriebsart der CPM1A. Der CPM1A–Betriebsstatus kann
mittels eines Peripherie–Gerätes überwacht werden, jedoch könnnen
Zwangssetzungen und Zwangsrücksetzungen der E/A–Bits bzw. Soll– und
Istwerteinstellungen des Zeitgebers oder Zählers darüber nicht vorgenommen
werden.
Vorsicht Stellen Sie sicher, daß Veränderungen der Betriebsart zweckdienlich sind und
!
nicht zu unerwünschten Effekten führen.
62

Programmierkonsolen–Funktion
Kapitel 4-2
4-2 Programmierkonsolen–Funktion
4-2-1 Übersicht
Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Überwachungs– und
Programmierfunktionen der Programmierkonsole. Im Anschluß an die Tabelle
werden die einzelnen Funktionen ausführlich erläutert.
Name Funktion
Speicher löschen Löscht den gesamten Programmspeicher und alle Daten–Bereiche, sofern diese nicht dem
Anzeigen und Löschen der
Fehlermeldungen
Summerfunktion Schaltet den Summton ein und aus, der beim Drücken der Programmierkonsolentasten ertönt.
Setzen einer
Programmadresse
Anzeige einer
Programmadresse
Befehlssuche Sucht innerhalb des Programms nach dem entsprechenden Befehl.
Operanden–Bit–Suche Sucht innerhalb des Programms nach dem entsprechenden Operanden–Bit.
Einfügen und Löschen von
Befehlen
Erstellen oder Editieren eines
Programms
Überprüfen des Programms Überprüfen auf Programmierfehler und Anzeige der entsprechenden Programmadressen und Fehler.
Bit–/Wortüberwachung Anzeige des Status von bis zu 16 Bits und Worten. Dabei werden jedoch lediglich drei gleichzeitig
Mehrfach–Adressüberwachung Simultanüberwachung des Status von bis zu 6 Bits und Worten.
Flanken–Überwachung Überwachen des UP– und DOWN–Status eines bestimmten Bits.
Binär–Überwachung Überwacht den ON/OFF–Status eines 16–Bit–Wortes.
3-Wort–Überwachung Überwacht den Status dreier aufeinanderfolgender Worte.
Dezimale Überwachung mit
Vorzeichen
Dezimale Überwachung ohne
Vorzeichen
3-Wort–Datenänderung Ändern von einem oder mehr Worten von drei aufeinanderfolgenden Worten, die bei der
Sollwertänderung (1) des
Zeitgebers, Zählers
Sollwertänderung (2) des
Zeitgebers, Zählers
Hexadezimal– bzw.
BCD–Datenänderung
Binärdatenänderung Bitweise Änderung des Wertes des 16 Bit–Wortes. Der Bitstatus kann während der Überwachung
Dezimale Datenänderung mit
Vorzeichen
Dezimale Datenänderung ohne
Vorzeichen
Zwangsweises
Setzen/Rücksetzen
Aufhebung der
Zwangssetzung/Rücksetzung
Hex-ASCII–Anzeigewechsel Konvertieren der Wortanzeige von 4–stelliger Hexadezimalanzeige nach ASCII–Format und
Zykluszeit–Anzeige Anzeige der aktuellen Zykluszeit.
Nur–Lesen–Zugrif unterliegen.
Anzeigen und Löschen von Fehlermeldungen; Anzeige von MESSAGE–Befehl–Meldungen.
Setzt während des Lesens, Speicherns, Einfügens und Löschen im Programm die entsprechende
Programmadresse.
Lesen des Inhalts des Programmspeichers. Statusanzeige des aktuell angezeigten Bits in der
PROGRAM– und MONITOR–Betriebsart.
Einfügen und Löschen von Befehlen innerhalb des Programms.
Überschreiben des aktutellen Programmspeichers zum erstmaliges Eingeben eines Programms oder
Abändern eines bereits vorhandenen Programms.
angezeigt.
Bei diesem Betrieb werden hexadezimale Daten eines Wortes als hexadezimale
Zweierkomplement–Darstellung angesehen und für die Anzeige in Dezimaldaten mit Vorzeichen
konvertiert.
Bei diesem Betrieb werden hexadezimale Daten in einem Wort für die Anzeige in Dezimaldaten
konvertiert.
3–Wort–Überwachung angezeigt werden.
Ändern der Sollwerte des Zeitgebers/Zählers.
Feineinstellung des Sollwertes für Zeitgeber/Zähler.
Ändern des Wertes des BCD–oder Hexadezimal–Wortes, das bei der Bit–/Wort–Überwachung
angezeigt wird.
geändert werden.
Bei diesem Betrieb kann der Dezimalwert eines Wortes innerhalb eines Bereiches von –32.768 bis
32.767 geändert werden. Der Inhalt des spezifizierten Wortes wird automaisch in hexadezimale
Zweierkomplement–Darstellung konvertiert.
In diesem Betrieb kann der Dezimalwert eines Wortes innerhalb eines Bereiches von 0 bis 65.535
(ohne Vorzeichen) geändert werden. Das Umwandeln in Hexadezimaldaten geschieht automatisch.
Zwangsetzen eines Bits (auf Status ON); Zwangsrücksetzen eines Bits (auf Status OFF).
Rücksetzen aller zwangsgesetzten Bits.
umgekehrt.
63

Programmierkonsolen–Funktion
Kapitel 4-2
4-2-2 Löschen des Speichers
Diese Funktion dient dem Löschen des gesamten Programmspeichers der
SPS sowie aller Daten–Bereiche, sofern diese nicht dem Nur–Lesen–Zugriff
unterliegen. Sie kann nur in der Betriebsart PROGRAM ausgeführt werden.
RUN MONITOR PROGRAM
Nein Nein OK
Vor der erstmaligen Erstellen eines Programms oder der Installation eines
neuen Programms sollten alle Speicherbereiche gelöscht werden.
Vollständiges Löschen Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Speicher vollständig zu lö-
schen.
1, 2, 3...
1. Rufen Sie die Anfangsanzeige auf, indem Sie die [CLR]–Taste wiederholt
drücken.
2. Drücken Sie die [SET]–, [NOT]– und dann die [RESET]–Taste, um mit
dem Vorgang zu beginnen.
SET
NOT
00000 MEM CLR ?
RESET
HR CNT DM
3. Drücken Sie die [MONTR]–Taste, um den Speicher vollständig zu lö-
schen.
00000 MEM CLR
MONTR
END HR CNT DM
Vorsicht Auch das SPS–Setup (DM 6600 bis DM 6655) wird hierdurch gelöscht.
!
Teilweises Löschen Es ist möglich, die Daten in zuvor spezifzierten Bereichen oder Teile des Pro-
grammspeichers zu erhalten. Um die Daten des HR, TC oder DM–Bereichs
zu erhalten, drücken Sie nach [SET], [NOT] und [RESET] die den Datenbereich kennzeichnende Taste. Weitere Datenbereiche, die noch angezeigt werden, können durch Drücken der [MONTR]–Taste gelöscht werden.
Die [HR]–Taste spezifziert sowohl den AR– wie den HR–Bereich, die
[CNT]–Taste ist im Zusammenhang mit dem gesamten Zeitgeber/Zähler–Bereich zu benutzen und die [DM]–Taste dient der Funktionsausführung für den
DM–Bereich.
Ebenso ist es möglich, einen Teil des Programmspeichers mittels Spezifizierung über Adressen zu erhalten. Nachdem die zu erhaltenden Bereiche ausgewählt wurden, ist die erste Adresse anzugeben, ab welcher gelöscht werden soll. Geben Sie z.B. 030 ein, um die Adressen 000 bis 029 unberührt zu
lassen, aber den gesamten Speicher ab Adresse 030 zu löschen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um z.B. den Zeitgeber/Zähler–Bereich
und den Programmspeicher im Adressbereich 000 bis 122 zu erhalten.
64
1, 2, 3...
1. Drücken Sie die [CLR]–Taste, um zur Ausgangsanzeige zurückzukehren.
2. Drücken Sie die [SET]–, [NOT]– und dann die [RESET]–Taste, um den
Vorgang zu beginnen.
3. Drücken Sie die [CNT]–Taste, um den Zeigeber/Zähler–Bereich aus der
Anzeige zu entfernen.
00000 MEM CLR ?
CNT
HR DM
4. Drücken Sie [1],[2],[3], um die Start–Programm–Adresse festzulegen.
B
1C2
00123 MEM CLR ?
D
3
HR DM

Programmierkonsolen–Funktion
5. Drücken Sie die [MONTR]–Taste, um den festgelegten Bereich zu lö-
schen.
00000 MEM CLR
MONTR
END HR DM
4-2-3 Anzeigen/Löschen der Fehlermeldungen
Diese Funktion dient dem Anzeigen und Löschen von Fehlermeldungen. Geringfügige Fehler und Meldungen können in jeder Betriebsart, schwerwiegende Fehler nur in der PROGRAM–Betriebsart angezeigt und gelöscht werden.
RUN MONITOR PROGRAM
OK OK OK
Vor der Eingabe eines neues Programms sollten alle aufgezeichneten Fehlermeldungen aus dem Programmspeicher gelöscht werden. Es wird vorausgesetzt, daß die Ursachen dieser Fehler bereits beseitigt wurden. Sollte beim
Versuch eine Fehlermeldung zu löschen, ein Summton ertönen, ist zunächst
die Ursache der Fehlermeldung zu beseitigen. Erst dann kann die Meldung
gelöscht werden. (Für weitere Informationen siehe
lerbehebung.)
Kapitel 4-2
Kapitel 5 Testlauf und Feh-
Tastenabfolgen Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Fehlermeldungen anzuzeigen und
zu löschen.
1, 2, 3...
1. Drücken Sie die [CLR]–Taste, um in die Anfangsanzeige zurückzukehren.
2. Drücken Sie die [FUN]–Taste und die [MONTR]–Taste, um mit dem Vor-
gang zu beginnen. Falls keine Fehlermeldung aufgezeichnet wurden, erscheint die nachfolgende Anzeige:
FUN
OK
00000ERR CHK
MONTR
Sollten Fehlermeldungen aufgezeichnet worden sein, wird nach Drücken
der [MONTR]–Taste der schwerwiegendste Fehler zuerst angezeigt.
Durch erneutes Drücken der [MONTR]–Taste wird die aktuelle Anzeige
gelöscht und der nächste Fehler angezeigt. Fahren Sie mit dem Drücken
der [MONTR]–Taste fort, bis alle Meldungen abgearbeitet sind. Nachfolgend einige Bespiele für Fehlermeldungen:
Speicherfehler:
MEMORY ERR
MONTR
Systemfehler:
SYS FAIL FAL01
MONTR
Meldung:
4-2-4 Summton
MATERIAL USED UP
MONTR
Alle Meldungen gelöscht:
00000ERR CHK
MONTR
OK
Diese Funktion dient dem An– und Abstellen des Summtons, der bei Betätigen der Programmierkonsolen–Tastatur ertönt. Der Summton ertönt auch
dann, wenn ein Fehler im SPS–Betrieb auftritt. Die Fehleranzeigefunktion
des Summers wird durch die nachfolgend dargestellte Einstellfunktion nicht
berührt.
65

Programmierkonsolen–Funktion
Kapitel 4-2
Sie ist in jeder Betriebsart durchführbar.
RUN MONITOR PROGRAM
OK OK OK
Tastenabfolge Führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, um den Summton an– bzw. abzu-
schalten.
1, 2, 3...
1. Drücken Sie [CLR]–, [SHIFT]– und dann die [CLR]–Taste, um in die Mo-
dus–Anzeige zu wechseln. Im nachstehenden Fall arbeitet die SPS im
PROGRAM–Betrieb und die Summerfunktion ist aktiviert.
<MONITOR> BZ
2. Drücken Sie die [SHIFT]– und dann die [1]–Taste, um den Summer aus-
zuschalten.
SHIFT
1
<MONITOR>
B
3. Drücken Sie die [SHIFT]– und dann die [1]–Taste, um die Summerfunktion
wieder zu aktivieren.
SHIFT
1
<MONITOR> BZ
B
4-2-5 Setzen und Anzeigen von Programmspeicher–Adressen
Dieser Vorgang dient der Anzeige einer spezifizierten Programmadresse und
kann in jeder Betriebsart ausgeführt werden.
RUN MONITOR PROGRAM
OK OK OK
Beim erstmaligen Erstellen eines Programms wird das Programm grundsätzlich ab Adresse 000 gespeichert. Diese Adresse muß nicht spezifiziert werden, da sie nach Löschen der Anzeige automatisch erscheint.
1, 2, 3...
Sollte die Speicherbelegung ab einer anderen Adresse als 000 erfolgen oder
ein bereits vorhandenes Programm abgeändert werden, muß die gewünschte
Adresse gesetzt werden.
1. Drücken Sie die [CLR]–Taste, um in die Ausgangsanzeige zurückzukeh-
ren.
2. Geben Sie die gewünschte Adresse ein. Führende Nullen können dabei
weggelassen werden.
C
2A0
00200
A
0
3. Drücken Sie die [Pfeil–abwärts]–Taste.
00200READ OFF
↓
LD 00000
Hinweis Der ON/OFF–Status der angezeigten Bits wird dargestellt, falls die
SPS im RUN– oder MONITOR–Betrieb arbeitet.
4. Drücken Sie zum Rollen durch die Programmadressen die [Pfeil–aufwärts]
bzw. [Pfeil–abwärts]–Taste.
00201READ ON
↓
AND 00001
00200READ OFF
↑
LD 00000
66

Programmierkonsolen–Funktion
4-2-6 Befehls–Suche
Diese Funktion dient dem Auffinden eines spezifischen Befehls im Programm
und kann in jeder Betriebsart ausgeführt werden.
OK OK OK
Der ON/OFF–Status der angezeigten Bits wird dargestellt, wenn die SPS im
RUN– oder MONITOR–Betrieb arbeitet.
Kapitel 4-2
RUN MONITOR PROGRAM
1, 2, 3...
1. Drücken Sie die [CLR]–Taste, um zur Ausgangsanzeige zurückzukehren.
2. Geben Sie die Adresse ein, von der ab mit der Suche begonnen werden
soll, und drücken Sie die [Pfeil–abwärts]–Taste. Führende Nullen können
weggelasen werden.
B
1
3. Geben Sie den Befehl ein, nach dem gesucht werden soll, und drücken
Sie die [SRCH]–Taste. Im dargestellten Fall wird nach dem LD–Befehl
gesucht.
Der LD–Befehl liegt, wie unten dargestellt, auf Adresse 200.
4. Drücken Sie die [Pfeil–abwärts]–Taste zur Anzeige des Befehlsoperanden
und die [SRCH]–Taste, um das Programme auf weitere Verwendung diese
Befehls zu untersuchen.
5. Die Suche wird bis zum Erreichen einer END–Anweisung oder solange
bis der Programmspeicher erschöpft ist, fortgeführt. In diesem Fall wurde
bei Adresse 397 die END–Anweisung erreicht.
4-2-7 Operanden–Bit–Suche
A
0A0
00100
↓
TIM 001
LD
00200SRCH
SRCH
LD 00000
00397SRCH
SRCH
END(001)(00.4KW)
1, 2, 3...
Diese Funktion dient dem Auffinden eines spezifischen Operanden–Bits im
Programm und kann in jeder Betriebsart ausgeführt werden.
RUN MONITOR PROGRAM
OK OK OK
Der ON/OFF–Status der angezeigten Bits wird dargestellt, wenn die SPS im
RUN– oder MONITOR–Betrieb ist.
1. Drücken Sie die [CLR]–Taste, um in die Ausgangsanzeige zu wechseln.
2. Geben Sie die Adresse den Operanden ein. Führenden Nullen können
weggelassen werden.
SHIFT
5
#
CONT 00005
00000CONT SRCH
F
CONT
3. Drücken Sie die [SRCH]–Taste, um mit der Suche zu beginnen.
00200CONT SRCH
SRCH
LD 00005
4. Drücken Sie die [SRCH]–Taste erneut, um das Programm auf weitere Ver-
wendung dieses Operanden–Bits zu überprüfen.
67

Programmierkonsolen–Funktion
5. Die Suche wird bis zum Erreichen einer END–Anweisung oder bis zum
Programmspeicher fortgeführt. In diesem Fall wurde eine End–Anweisung
erreicht.
00397SRCH
SRCH
4-2-8 Einfügen und Löschen von Befehlen
Diese Funktion dient dem Einfügen und Löschen von Befehlen im Programm.
Sie ist ausschließlich im PROGRAM–Betrieb möglich.
RUN MONITOR PROGRAM
Nein Nein OK
Um diese Funktion zu veranschaulichen, soll eine IR 00105–Bedingung an
Adresse 00206 eingefügt werden und eine IR 00103–Bedingung von Adresse
00205 gelöscht werden. Näheres erläutert das nachstehende Ablauf–Diagramm.
Original–Programm
Kapitel 4-2
END(001)(00.4KW)
00100
00201
00101
00102
00103
Löschen
00104
00105
Einfügen
01000
Löschen
END(001)
Adresse Befehl Operanden
00205 AND 00103
00206 AND NOT 00104
00207 OUT 01000
00208 END(001) -
Einfügen Führen sie die folgenden Schritte aus, um die IR 00105–Bedingung an
Adresse 00206 einzufügen.
1, 2, 3...
1. Drücken Sie die [CLR]–Taste, um in die Anfangsanzeige zurückzukehren.
2. Geben Sie die Adresse ein, an der die Bedingung eingefügt werden soll
und drücken Sie die [Pfeil–abwärt]–Taste. Führende Nullen können weggelassen werden.
C
A
2
0 6
00206READ
↓
AND NOT 00104
3. Geben Sie den neuen Befehl ein und drücken Sie die [INS]–Taste.
AND
B
A
1
0F5
00206INSERT?
INS
AND 00105
4. Drücken Sie die [Pfeil–abwärts]–Taste, um den neuen Befehl einzufügen.
Einfügen
00207INSERT END
↓
AND NOT 00104
Hinweis Für Befehle, die mehrere Operanden erfordern (z.B. Werte setzen)
geben Sie zunächst die Operanden ein und drücken dann die
[Write]–Taste.
Löschen Führen sie die folgenden Schritte aus, um die IR 00103–Bedingung an
Adresse 00205 zu löschen.
1, 2, 3...
1. Drücken Sie die [CLR]–Taste, um zur Ausgangsanzeige zurückzukehren.
2. Geben Sie die Adresse des Befehls ein, der gelöscht werden soll, und
drücken Sie die [Pfeil–Abwärts]–Taste. Führende Nullen können weggelassen werden.
C
A
2
0F5
00205READ
↓
AND 00103
68

Programmierkonsolen–Funktion
3. Drücken Sie die [DEL]–Taste.
4. Drücken Sie die [Pfeil–aufwärts]–Taste, um den entsprechenden Befehl zu
Nachdem Sie Einfüge– und Löschvorgänge beendet haben, sollten Sie mit
der [Pfeil–abwärts]– bzw. [Pfeil–aufwärts]–Taste durch das Programm rollen,
um zu überprüfen, ob alle Änderungen korrekt durchgeführt wurden.
Korregiertes Programm
Kapitel 4-2
00205DELETE?
DEL
AND 00103
löschen.
Hat der Befehl mehrere Operanden, werden diese automatisch zusam-
men mit dem Befehl gelöscht.
00205DELETE END
↑
AND 00105
00100
00201
00102
0010500101
00104
01000
END(001)
Adresse Befehl Operanden
00205 AND 00105
00206 AND NOT 00104
00207 OUT 01000
00208 END(001) -
4-2-9 Eingabe oder Editieren eines Programms
Diese Funktion dient der Eingabe und dem Editieren eines Programms. Sie ist
nur in der Betriebsart PROGRAM ausführbar.
RUN MONITOR PROGRAM
Nein Nein OK
Die Vorgehensweise zur Eingabe eines neuen Programms oder zur Änderung
eines bereits vorhandenen Programms ist gleich. In jedem Fall wird der aktuelle Inhalt des Programmspeichers überschrieben.
Das im nachfolgenden Ablaufdiagramm dargestellte Programm soll eingegeben werden, um die Vorgehensweise zu veranschaulichen.
00002
TIM 000
#0123
MOV(021)
#0100
LR 10
ADB(050)
#0100
#FFF6
DM 0000
12,3 s
Adresse Befehl Operanden
00200 LD IR 00002
00201 TIM 000
00202 MOV(021)
00203 ADB(050)
#0123
#0100
LR 10
#0100
#FFF6
DM 0000
1, 2, 3...
1. Drücken Sie die [CLR]–Taste, um zur Ausgangsanzeige zurückzukehren.
2. Legen Sie die Adresse fest, an der das Programm beginnen soll.
69

Programmierkonsolen–Funktion
3. Geben Sie die Anfangsadresse ein, und drücken Sie die [Pfeil–ab-
Kapitel 4-2
wärts]–Taste. Führende Nullen können weggelassen werden.
C
A
2
0A0
00200
↓
4. Geben Sie den ersten Befehl samt Operanden ein.
00200
C
LD
2
LD 00002
5. Drücken Sie die [WRITE]–Taste, um den Befehl zu speichern. Die nächste
Programmadresse wird angezeigt.
00201READ
WRITE
NOP(000)
Sollte es zu einer fehlerhaften Eingabe gekommen sein, drücken Sie die
[Pfeil–aufwärts]–Taste, um zur vorhergehenden Adresse zurückzukehren
und wiederholen Sie Ihre Eingabe. Die Falscheingabe wird dabei überschrieben.
6. Geben Sie den zweiten Befehl samt Operanden ein. (Im vorliegenden Fall
ist es nicht notwendig, die Zeigeber–Zahl einzugeben, da diese 000 ist.)
Drücken Sie zum Abspeichern die [WRITE]–Taste.
TIM
Zeitgeber–
Nummer
00201 TIM DATA
WRITE
#0000
7. Geben Sie den zweiten Operanden (123, um 12,3 Sekunden zu spezifizie-
ren) ein, und drücken Sie die [WRITE]–Taste. Die folgende Programmadresse wird angezeigt.
B
C
1
2D3
WRITE
00202READ
NOP(000)
Kam es zu einer Fehleingabe, drücken Sie die [Pfeil–aufwärts]–Taste um
zum fehlerhaften Operanden zurückzukehren. Drücken Sie die
[CONT/#]–Taste und nochmals [1], [2], [3]. Der fehlerhafte Operand wird
überschrieben.
Hinweis Zähler werden in der gleichen Weise wie Zeitgeber editiert. Zu beach-
ten ist lediglich, daß statt der [CNT]–Taste die [TIM]–Taste zu benutzen ist.
8. Geben Sie den dritten Befehl samt Operanden ein. Drücken Sie zur Ein-
gabe des Befehls zunächst die [FUN]–Taste und dann den Funktions–
Code (in vorliegendem Fall 21).
FUN
2
1
MOV(021)
00202
B
C
Hinweis Zur Eingabe eines flankengesteuerten Befehls drücken Sie nach Ein-
gabe des Funktions–Codes die [NOT]–Taste. Das “@”–Symbol wird
neben dem flankengesteuerten Befehl angezeigt. Durch nochmaliges
Drücken der [NOT]–Taste wird der Vorgang rückgängig gemacht und
das “@”–Symbol verschwindet. Zum nachträglichen Ändern, können
Sie einfach durch das Programm rollen bis der gewünschte Befehl angezeigt wird und drücken dann die [Not]–Taste.
9. Drücken Sie die [WRITE]–Taste, um den Befehl zu speichern. Die Einga-
beanzeige für den ersten Operanden wird angezeigt.
70
00202 MOV DATA A
WRITE
000

Programmierkonsolen–Funktion
• Speichern Hexadezimale/BCD–Konstanten
10. Geben Sie den ersten Operanden ein.
Kapitel 4-2
CONT
#
B
1A0
00202 MOV DATA A
A
0
#0100
Drücken Sie die [WRITE]–Taste, um den Befehl im Programmspeicher zu
speichern. Die Eingabeanzeige für den zweiten Operanden wird angezeigt.
00202 MOV DATA B
WRITE
#0000
• Speichern einer Wort–Adresse
11. Geben Sie den zweiten Operanden ein.
B
LR
1
00202 MOV DATA B
A
0
LR 10
Drücken Sie die [WRITE]–Taste, um den Befehl zu speichern. Die folgende Programmadresse wird angezeigt.
00203READ
WRITE
NOP(000)
Hinweis Wenn der Befehloperand eingegeben wird, kann die Bit– oder Wortzu-
weisung weggelassen werden.
12. Geben Sie den nächsten Befehl ein.
FUN
F
5
A
0
00203
ADB(050)
Drücken Sie die [WRITE]–Taste, um den Befehl zu speichern.
00203 ADB DATA A
WRITE
#0000
• Speichern einer Dezimal–Zahl ohne Vorzeichen
13. Der erste Operand ist als ganze Zahl ohne Vorzeichen einzugeben.
CONT
#
SHIFT
TR
00203 ADB DATA A
NOT
#00000
Gegen Sie den Wert des Operanden im Bereich von 0 bis 65535 ein.
C
2F5 6
00203 ADB DATA A
#00256
Hinweis Falls es zu einer fehlerhaften Eingabe gekommen ist, drücken Sie die
[CLR]–Taste, um den Zustand vor der Eingabe wieder herzustellen.
Machen Sie dann die korrekte Eingabe.
14. Stellen Sie die Hexadezimalanzeige wieder her.
SHIFT TR
00203 ADB DATA A
#0100
Hinweis Falls eine Eingabe außerhalb des zulässigen Bereichs erfolgt, ertönt
ein Summton und die Hexadezimalanzeige wird nicht hergestellt.
00203 ADB DATA B
WRITE
000
15. Der zweite Operand ist als vorzeichenbehaftete ganze Zahl einzugeben.
CONT
#
SHIFT
00203 ADB DATA B
TR
#+00000
Geben Sie den Wert des Operanden im Bereich von –32.768 bis 32.767
ein. Benutzen Sie die [SET]–Taste zur Erzeugung eines positiven Vorzei-
71

Programmierkonsolen–Funktion
Hinweis Für den Fall einer fehlerhaften Eingabe, können Sie mit Hilfe der
16. Stellen Sie die Hexadezimalanzeige wieder her.
Kapitel 4-2
chens und die [RESET]–Taste zur Erzeugung eines negativen Vorzeichens.
00203 ADB DATA B
A
B
REC
1
RESET
[CLR]–Taste den Zustand vor der Eingabe wieder herstellen.
Machen Sie dann die korrekte Eingabe.
0
#-00010
Hinweis Sollte eine Eingabe außerhalt des zulässigen Bereichs erfolgen, er-
tönt ein Summton und die Hexadezimalanzeige wird nicht hergestellt.
17. Geben Sie den letzten Operanden ein und drücken Sie die [WRITE]–Ta-
ste.
4-2-10Überprüfen des Programms
Diese Funktion überprüft das Programm auf Programmierfehler und zeigt die
entsprechenden Fehler samt Adresse an. Sie ist nur im PROGRAM–Betrieb
ausführbar.
RUN MONITOR PROGRAM
Nein Nein OK
1, 2, 3...
1. Drücken Sie die [CLR]–Taste, um zum Ausgangsbildschirm zurückzukeh-
ren.
2. Drücken Sie die [SRCH]–Taste. Es erscheint eine Eingabeaufforderung
zur Auswahlt der gewünschten Prüfebene.
SHIFT TR
WRITE
WRITE
00203 ADB DATA B
00203 ADB DATA C
00203 ADB DATA C
DM
00204READ
NOP(000)
#FFF6
000
DM 0000
72
00000PROG CHK
SRCH
CHKLEVEL (0-2)?
3. Geben Sie die gewünschte Prüfebene ein (1, 2 oder 3). Danach beginnt
die Überprüfung und der erste Fehler wird angezeigt.
00178CIRCUIT ERR
A
0
OUT 00200
Hinweis Für weitere Informationen siehe
Kapitel 5-5 Fehlersuche.
4. Drücken Sie die [SRCH]–Taste, um mit der Suche fortzufahren. Der näch-
ste Fehler wird angezeigt. Durch wiederholtes Drücken der [SRCH]–Taste
wird die Suche immer weiter fortgesetzt.
Der Suchvorgang kann solange fortgesetzt werden, bis eine End–Anweisung erreicht wird oder die Programmkapazität erschöpft ist. Die nachfolgende Anzeige erscheint, wenn die Programmkapazität erschöpft ist:
00300NO END INST
SRCH
END

Programmierkonsolen–Funktion
Kapitel 4-2
Die nachfolgende Anzeige erscheint, wenn eine END–Anweisung erreicht
wird.
00310PROG CHK
SRCH
END(001)(00.3KW)
Falls Fehler angezeigt werden, muß das Programm zur Durchführung der
Korrekturen editert werden. Danach sollte eine erneute Programmüberprüfung stattfinden und zwar solange, bis alle Fehler beseitigt wurden.
4-2-11 Bit–/Wort–Überwachung
Diese Funktion dient der Überwachung von bis zu 16 Bits und Worten. Dabei
können jedoch nur 3 auf einmal angezeigt werden. Die Funktion ist in jeder
Betriebsart ausführbar.
RUN MONITOR PROGRAM
OK OK OK
Anzeigen, dann Überwachen Wird eine Programmadresse angezeigt, kann der Status des Bits oder Wortes
durch Drücken der [MONTR]–Taste überwacht werden.
1, 2, 3...
1. Drücken Sie die [CLR]–Taste, um zur Ausgangsanzeige zurückzukehren.
2. Geben Sie die gewünschte Programmadresse ein und drücken Sie die
[Pfeil–abwärts]–Taste.
C
A
2
0A0
00200READ
↓
TIM 000
3. Drücken Sie die [MONTR]–Taste, um mit dem Überwachungsvorgang zu
beginnen.
T000
MONTR
1234
Bei der Überwachung eines Bits, kann der Status mit Hilfe der Zwangs–
setzung bzw. Zwangsrücksetzung geändert werden.
Bei der Überwachung eines Wortes, kann der entsprechende Wert mit
Hilfe der Hexadezimal/BCD–Datenänderung verändert werden.
4. Drücken Sie die [CLR]–Taste, um die Überwachung zu beenden.
00200
CLR
TIM 000
Bit–Überwachung Führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, um den Status eines bestimmten
Bits zu überwachen.
1, 2, 3...
1. Drücken Sie die [CLR]–Taste, um zur Anfangsanzeige zurückzukehren.
2. Geben Sie die Bit–Adresse des gewünschten Bits ein und drücken Sie die
[MONTR]–Taste.
SHIFT
CONT
#
B
1
MONTR
00001
^ ON
Durch Drücken der [Pfeil–abwärts]– bzw. [Pfeil–aufwärts]–Taste kann der
Status des vorhergehenden bzw. nachfolgenden Bits angezeigt werden.
Der Status des angezeigten Bits kann mit Hilfe der Funktion zwangsweises Setzen bzw. zwangsweises Rücksetzen geändert werden.
3. Drücken Sie die [CLR]–Taste, um die Überwachung zu beenden.
00000
CLR
CONT 00001
Wort–Überwachung Führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, um den Status eines bestimmten
Wortes zu überwachen.
1, 2, 3...
1. Drücken Sie die [CLR]–Taste, um zur Anfangsanzeige zurückzukehren.
73

Programmierkonsolen–Funktion
2. Geben Sie die Wortadresse des gewünschten Wortes ein.
3. Drücken Sie die [MONTR]–Taste, um mit dem Überwachen zu beginnen.
4. Drücken Sie die [CLR]–Taste, um die Überwachung zu beenden.
Kapitel 4-2
00000
CH
SHIFT
*
Durch Drücken der [Pfeil–aufwärts]– bzw. [Pfeil–abwärts]–Taste kann der
Status des vorhergehenden oder nachfolgenden Wortes angezeigt werden.
Der Status des angezeigten Wortes kann mit der Hexadezimal/BCD–Datenänderung verändert werden.
B
LR
1
CHANNEL LR 01
cL01
MONTR
FFFF
00000
CLR
CHANNEL LR 01
Mehrfach
Adress–Überwachung
1, 2, 3...
Der Status von bis zu 6 Bits und Worten kann gleichseitig überwacht werden.
Jedoch können lediglich 3 Bits oder Worte gleichzeitig dargestellt werden.
1. Drücken Sie die [CLR]–Taste, um zur Ausgangsanzeige zurückzukehren.
2. Geben Sie die Adresse des ersten Bits oder Wortes ein und drücken dann
die [MONTR]–Taste.
TIM
0100
T000
MONTR
3. Wiederholen Sie Schritt 2 bis zu 6 Mal, zur Überwachung auch der folgen-
den Adressen.
SHIFT
CONT
#
B
1
DM
00001 T000
MONTR
^ OFF 0100
D0000 00001 T000
MONTR
0000 ^ 0FF 0100
Sollen 4 oder mehr Bits und Worte überwacht werden, können die aktuell
nicht dargestellten Bits und Worte durch Drücken der [MONTR]–Taste angezeigt werden. Wird die [MONTR]–Taste allein gedrückt, verschiebt sich
die Anzeige nach rechts.
Sollen mehr als sechs Bits und Worte eingegeben werden, muß die Überwachung der Bit– und Worteingabe zunächst abgebrochen werden.
4. Drücken Sie die [CLR]–Taste, um die Überwachung des äußerst links dar-
gestellten Bits abzubrechen und es aus der Anzeige zu löschen.
74
00001 T000
CLR
^ 0FF 0100
5. Drücken Sie die [SHIFT] + [CLR]–Taste, um das Überwachen insgesamt
zu beenden.
SHIFT CLR
00000
CHANNEL DM 0000
Hinweis Drücken Sie die [SHIFT] + [CLR]–Taste, um zur Anzeige mit unverändertem
Mehrfach–Adress–Überwachungs–Status zurückzukehren. Drücken Sie die
[SHIFT]– + [MONTR]–Taste, um nur den aufrecht erhaltenen Mehrfach–
Adress–Überwachungs–Status anzuzeigen. Der Überwachungsstatus kann
für 6 Bits und Worte erhalten werden.

Programmierkonsolen–Funktion
4-2-12Flankenerkennungsüberwachung
Diese Funktion dient zur Überwachung der auf– bzw. absteigenden Flanke
eines bestimmten Bits. Bei der Ausführung wird der entsprechende Status
angezeigt und ein Summton ertönt. Die Funktion kann in jeder Betriebsart
ausgeführt werden.
RUN MONITOR PROGRAM
OK OK OK
Kapitel 4-2
1, 2, 3...
1. Überwachen Sie den Status des gewünschten Bits entsprechend der un-
4-2-11 Bit–/Wortüberwachung
ter
dargestellten Vorgehensweise. Bei
Überwachung von 2 oder mehr Bits, sollte das gewünschte Bit äußerst
links angezeigt werden.
In vorliegendem Fall soll der Flankenstatus von LR 00 überwacht werden.
L000000001H0000
^OFF ^OFF ^OFF
2. Drücken Sie zur Spezifikation der aufsteigenden Flanke die [SHIFT]–Taste
und dann die [Pfeil–aufwärts]–Taste. Das Symbol “U@” wird angezeigt.
SHIFT
L0000 00001 H0000
↑
U@OFF ^OFF ^OFF
Zur Spezifikation der absteigenden Flanke drücken Sie die [SHIFT]–Taste
und dann die [Pfeil–abwärts]–Taste. Das Symbol “D@” wird angezeigt.
SHIFT
L000000001H0000
↓
D@OFF ^OFF ^OFF
3. Ein Summton ertönt, sobald das spezifizierte Bit von 0 auf 1 (aufsteigend)
bzw. 1 auf 0 (absteigend) wechselt.
L000000001H0000
^ON ^OFF ^OFF
4. Drücken Sie die [CLR]–Taste, um die Flankenerkennung zu beenden und
zur normalen Anzeige zurückzukehren.
4-2-13Binärdaten–Überwachung
Diese Funktion dient dem Überwachen des ON/OFF–Status der 16 Bits eines
Wortes. Sie kann in jeder Betriebsart ausgeführt werden.
RUN MONITOR PROGRAM
OK OK OK
1, 2, 3...
1. Überwachen Sie den Status des gewünschten Wortes entsprechend der
4-2-11 Bit–/Wortüberwachung
unter
Überwachung von 2 oder mehr Worten sollte das gewünschte Wort äußerst links angezeigt werden.
(Wort–Überwachung)
2. Drücken Sie die [SHIFT]–Taste und dann die [MONTR]–Taste, um mit der
Binärdaten–Überwachung zu beginnen. Der ON/OFF–Status der 16 Bits
des ausgewählten Wortes wird im unteren Bereich der Anzeige dargestellt. Eine 1 zeigt den ON–Status des Bits, eine 0 den OFF–Status an.
CLR
SHIFT MONTR
L000000001H0000
^OFF ^OFF ^OFF
dargestellten Vorgehensweise. Bei
C000
0000
C000 MONTR
0000000000000000
75

Programmierkonsolen–Funktion
C000 MONTR
000 S0000000 R0000
Kapitel 4-2
Zwangsgesetzte Bits werden durch “S” gekennzeichnet, zwangsrückgesetzte Bits durch “R,” wie nachfolgend dargestellt:
zwangsgesetztes Bit
Hinweis a) Der Status des angezeigten Bits kann verändert werden. Für
3. Drücken Sie die [CLR]–Taste, um die Binärdaten–Überwachung zu beenden und zur normalen Anzeige zurückzukehren.
4-2-143-Wort Überwachung
Diese Funktion dient der Überwachung des Status von drei aufeinander folgenden Worten. Sie ist in jeder Betriebsart ausführbar.
OK OK OK
1, 2, 3...
1. Überwachen Sie den Status des ersten von drei aufeinander folgenden
Worten entsprechend der unter
ten Vorgehensweise.
Sollen 2 oder mehr Worte überwacht werden, sollte das gewünschte Wort
äußerst links angezeigt werden.
zwangsrückgesetztes Bit
nähere Informationen siehe
4-2-20 Binärdaten–Änderung.
b) Mit Hilfe der [Pfeil–abwärts]– bzw. [Pfeil–aufwärts]–Taste kann
der Status des vorhergehenden bzw. nachfolgenden Bits angezeigt werden.
C000
CLR
0000
RUN MONITOR PROGRAM
4-2-11 Bit–/Wortüberwachung
dargestell-
C000
(Wort–Überwachung)
89AB
2. Drücken Sie die [EXT]–Taste, um mit der 3–Wort–Überwachung zu beginnen. Der Status des ausgewählten Wortes und der folgenden zwei Worte
wird, wie nachfolgend dargestellt, angezeigt. In vorliegendem Fall war DM
0000 ausgewählt.
C002 C001 C000
EXT
0123 4567 89AB
Mit der [Pfeil–abwärts]– und [Pfeil–aufwärts]–Taste können Sie um jeweils
eine Adresse vor– und zurückschalten.
Der Status des angezeigten Wortes kann während der Überwachung verändert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
4-2-17
3-Wort–Datenänderung.
3. Drücken Sie die [CLR]–Taste, um die 3–Wort–Überwachung zu beenden
und in die normale Anzeige zurückzukehren. Das in der 3–Wort–Überwachung äußerst rechts angezeigte Wort bleibt angezeigt.
76

Programmierkonsolen–Funktion
C000
CLR
89AB
4-2-15Dezimale Überwachung mit Vorzeichen
Diese Funktion dient der Konvertierung eines Wortes von hexadezimaler
Zweierkomplement–Darstellung in Dezimaldaten mit Vorzeichen. Sie kann
während der E/A–Überwachung, der Mehrfach–Adress–Überwachung oder
der 3–Wort–Überwachung ausgeführt werden.
RUN MONITOR PROGRAM
OK OK OK
Kapitel 4-2
1, 2, 3...
1. Überwachen Sie das Wort, das für die Dezimale Überwachung mit Vorzeichen ausgewählt wurde. Während des Vorgangs wird das jeweils äußerst
links angezeigte Wort konvertiert.
c000 cL00 20000
Mehrfach–Adress–Überwachung)
(
FFF0 0000 ^OFF
2. Drücken Sie die [SHIFT]– + [TR]–Tasten, um das äußerst links angezeigte
Wort Dezimal mit Vorzeichen darzustellen.
SHIFT TR
c000
-00016
Der Inhalt des angezeigten Wortes kann geändert werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
Vorzeichen.
3. Drücken Sie die [CLR]–Taste oder die [SHIFT]– + [TR]–Taste, um die Dezimale Überwachung mit Vorzeichen zu beenden und zur Normalanzeige
zurückzukehren.
c000 cL00 20000
CLR
FFF0 0000 ^OFF
4-2-16Dezimale Überwachung ohne Vorzeichen
Mit dieser Funktion kann die Hexadezimalanzeige der Daten eines Wortes in
eine dezimale Darstellung ohne Vorzeichen konvertiert werden. Sie kann
während der E/A–Überwachung, Mehrfach–Adress–Überwachung oder der
3–Wort–Überwachung ausgeführt werden.
4-2-21 Dezimale Datenänderung mit
1, 2, 3...
RUN MONITOR PROGRAM
OK OK OK
1. Überwachen Sie das Wort, das für die Dezimalüberwachung ohne Vorzeichen ausgewählt wurde. Während der Überwachung wird das äußerst
links angezeigte Wort konvertiert.
c000 cL00 20000
Mehrfach–Adress–Überwachung
FFF0 0000 ^OFF
2. Drücken Sie die [SHIFT] + [TR] + [NOT]–Taste , um das äußerst linke
Wort als Dezimale ohne Vorzeichen darzustellen.
SHIFT TR
NOT
c000
65520
Während des Vorgangs kann der Inhalt des angezeigten Wortes geändert
werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter
4-2-22 Dezimalda-
tenänderung ohne Vorzeichen.
77

Programmierkonsolen–Funktion
3. Drücken Sie die [CLR]–Taste oder die [SHIFT] + [TR]–Taste, um die Dezimalüberwachung ohne Vorzeichen zu beenden und zur normalen Anzeige
zurückzukehren.
4-2-17 3-Wort–Datenänderung
Diese Funktion dient der Änderung des Inhalts von einem oder mehreren von
drei aufeinander folgenden Worten, die bei der 3–Wort–Überwachung angezeigt werden. Sie kann nur im MONITOR– oder PROGRAM–Betrieb ausgeführt werden.
RUN MONITOR PROGRAM
No OK OK
c000 cL00 20000
CLR
FFF0 0000 ^OFF
Kapitel 4-2
1, 2, 3...
1. Überwachen Sie den Status den gewünschten Wortes entsprechend der
4-2-14 3-Wort–Überwachung
unter
dargestellten Vorgehensweise.
D0002 D0001 D0000
(3-Wort–Überwachung)
0123 4567 89AB
2. Drücken Sie die [CHG]–Taste, um mit der 3–Wort–Änderung zu beginnen.
Der Cursor wird neben dem äußerst linken Wort angezeigt.
D0002 3CHCHANG?
CHG
0123 4567 89AB
3. Geben Sie den neuen Wert für das äußerst linke Wort an und drücken Sie
die [CHG]–Taste erneut, falls weitere Änderungen durchgeführt werden
sollen.
(Sollen keine weiteren Änderungen durchgeführt werden, drücken Sie die
[WRITE]–Taste zum Speichern.)
B
1
D0002 3CHCHANG?
CHG
0001 4567 89AB
4. Geben Sie den neuen Wert für das mittlere Wort ein und drücken Sie die
[CHG]–Taste nur, wenn Sie auch das äußerst rechts angezeigte Wort ändern wollen. Drücken Sie die [WRITE]–Taste, um die Änderung zu speichern, wenn das äußerst recht Wort, wie im vorliegenden Fall, nicht geändert werden soll.
C
D
2
3E4
D0002 D0001 D0000
WRITE
0001 0234 89AB
Hinweis Wird die [CLR]–Taste vor der [Write]–Taste gedrückt, wird der gesamte Vor-
gang abgebrochen. Die Normalanzeige wird wieder hergestellt, ohne daß Änderungen im Datenspeicher erfolgt sind.
4-2-18Ändern der Zeitgeber/Zähler–Sollwerte
Diese beiden Funktionen dienen der Sollwerteinstellung von Zeitgeber und
Zähler. Sie können nur in MONITOR– oder PROGRAM–Betriebsart ausgeführt werden. In der MONITOR–Betriebsart kann der Sollwert während der
Programmausführung geändert werden.
RUN MONITOR PROGRAM
No OK OK
Der Zeitgeber– oder Zählersollwert kann entweder durch Eingabe eines
neues Wertes oder durch Inkrementieren bzw. Dekrementieren des aktuellen
Sollwertes geändert werden.
Vorsicht Stellen Sie sicher, daß eine Änderung der Sollwerte keine nachteiligen Folgen
!
hat.
78

Programmierkonsolen–Funktion
Kapitel 4-2
Eingabe einer neuen
Sollwertkonstante
1, 2, 3...
Diese Funktion dient sowohl zur Eingabe einer neuen Sollwert–Konstante als
auch zum Umwandeln einer Sollwert–Konstante in eine Wort–Aresse und umgekehrt. Das nachfolgende Beispiel veranschaulicht, wie eine Sollwertkonstante in eine Adresse umgewandelt wird.
1. Drücken Sie die [CLR]–Taste, um zur Ausgangsanzeige zurückzukehren.
2. Lassen Sie den gewünschten Zeitgeber oder Zähler anzeigen.
TIM
B
1
SRCH
00201SRCH
TIM 001
3. Drücken Sie die [Pfeil–abwärts]–Taste und dann die [CHG]–Taste.
↓
T001 #0123 #????
00201DATA?
CHG
4. Sie können jetzt eine neue Sollwert–Konstante eingeben oder die Sollwert–Konstante in eine Wort–Adresse umwandeln.
a) Geben Sie die neue Sollwert–Konstante ein und drücken Sie die
[WRITE]–Taste, um sie zu speichern.
B
C
1
2E4
00201 TIM DATA
WRITE
#0124
b) Zum Umwandeln in eine Wort–Adresse geben Sie die Wort–Adresse
ein und drücken Sie die [WRITE]–Taste.
SHIFT
CH
B
1A0
*
00201 TIM DATA
WRITE
010
Inkrementieren und
Dekrementieren einer
Sollwertkonstante
1, 2, 3...
Diese Funktion dient dem Inkrementieren und Dekrementieren einer Sollwert–
Konstante. Sie ist nur ausführbar, wenn der Sollwert zuvor als Konstante eingegeben wurde.
1. Drücken Sie die [CLR]–Taste, um zum Ausgangsanzeige zurückzukehren.
2. Lassen Sie den gewünschten Zeitgeber oder Zähler anzeigen.
TIM
TIM 000
00201SRCH
SRCH
3. Drücken Sie die [Pfeil–abwärts]–, die [CHG]– und dann die [EXT]–Taste.
↓
T000 #0123 #0123
00201DATA ? U/D
EXT
CHG
Die links angezeigte Konstante ist der alte Sollwert und der rechts angezeigte Wert wird die neue Sollwertkonstante, sobald Sie die Schritte bis
Punkt 5 ausgeführt haben.
4. Zum Inkrementieren und Dekrementieren der Konstante drücken Sie die
[Pfeil–abwärts] und [Pfeil–aufwärts]–Tasten. In vorliegendem Fall wurde
der Sollwert ein Mal inkrementiert.
00201DATA ? U/D
↑
T000 #0123 #0124
5. Drücken Sie die [CLR]–Taste zwei Mal, um den neuen Zeigeber–Sollwert
zu speichern.
CLR CLR
00201 TIM DATA
#0124
4-2-19Hexadezimal–/BCD–Datenänderung
Diese Funktion dient dem Ändern des BCD– oder hexadezimalen Wertes eines Wortes, das entsprechend der unter
stellten Vorgehensweise überwacht wird
PROGRAM–Betrieb ausführbar.
4-2-11 Bit–/Wortüberwachung
.
Sie ist nur im MONITOR– oder
darge-
79

Programmierkonsolen–Funktion
Nein OK OK
Die Worte SR 253 bis SR 255 können nicht geändert werden.
Vorsicht Stellen Sie sicher, daß das Ändern der Werte keine nachteiligen Folgen hat.
!
Kapitel 4-2
RUN MONITOR PROGRAM
1, 2, 3...
1. Überwachen Sie den Status des gewünschten Wortes entsprechend der
unter
den zwei oder mehr Worte überwacht, sollte das gewünschte Wort äußerst links angezeigt werden.
(Wort–Überwachung)
2. Drücken Sie die [CHR]–Taste, um mit der Hexadezimal–/BCD–Datenänderung zu beginnen.
3. Geben Sie den neuen Istwert ein und drücken Sie zum Speichern die
[WRITE]–Taste.
Danach wird der Vorgang beendet und die Normalanzeige wird wieder
hergestellt.
C
2
4-2-20Binärdaten–Änderung
Diese Funktion dient dem Ändern des Status der Bits eines Wortes, während
das Wort entsprechend der unter
ten Vorgehensweise überwacht wird. Sie ist nur in der MONITOR– oder PROGRAM–Betriebsart ausführbar.
4-2-11 Bit–/Wort–Überwachung
D0000
0119
PRES VAL?
CHG
D0000 0119 ????
A
0A0
WRITE
D0000
0200
4-2-13 Binärdaten–Überwachung
dargestellten Vorgehensweise. Wer-
dargestell-
RUN MONITOR PROGRAM
Nein OK OK
Die Bits SR 25300 bis SR 25507 und Zeitgeber–/Zählermerker können nicht
geändert werden.
Vorsicht Stellen Sie sicher, daß das Ändern der Werte keine nachteiligen Folgen hat.
!
1, 2, 3...
1. Überwachen Sie den Status des gewünschten Wortes entsprechend der
4-2-13 Binärdaten–Überwachung
unter
dargestellten Vorgehensweise.
c001 MONTR
(
Binärdaten–Überwachung)
1000010101010101
2. Drücken Sie die [CHG]–Taste, um mit der Binärdaten–Änderung zu beginnen.
c001 MONTR
CHG
0000010101010101
Ein blinkender Cursor erscheint auf Bit 15. Der Cursor zeigt an, welches
Bit geändert werden kann.
3. Das Bewegen des Cursors und die Änderung des Bit–Status erfolgt mit
Hilfe der nachstehend beschriebenen Tastenoperationen:
a) Benutzen Sie die [Pfeil–aufwärts]– bzw. [Pfeil–abwärts]–Taste, um den
Cursor nach links oder rechts zu bewegen.
80
↓ ↓
c001 CHG?
10 0010101010101

Programmierkonsolen–Funktion
b) Benutzen Sie die [1]– bzw. [0]–Taste, um den Status der Bits zu
ändern. Der Cursor bewegt sich danach jeweils um eine Stelle nach
rechts.
c001 CHG?
B
1
101 010101010101
c) Benutzen Sie die [SHIFT]– + [SET]–Taste, um ein Bit zwangszusetzen
und die [SHIFT]– + [RESET]–Taste, um es zwangsrückzusetzen. Der
Cursor wird sich jeweils um eine Stelle nach rechts bewegen. Drücken
der [NOT]–Taste bewirkt die Aufhebung aller Zwangssetzungen.
Hinweis Bits im DM–Bereich können nicht zwangs– bzw. zwangsrückgesetzt
werden.
4. Drücken Sie die [WRITE]–Taste zum Speichern und zur Rückkehr in die
Binärdaten–Überwachungs–Anzeige.
c001 MONTR
WRITE
1010010101010101
4-2-21Dezimale Datenänderung mit Vorzeichen
Diese Funktion dient dem Ändern des Dezimalwertes eines Wortes innerhalb
eines Bereiches von –32.768 bis 32.767 bei der dezimalen Überwachung mit
Vorzeichen. Es wird automatisch in einen hexadezimalen Zweierkomplement–
Wert konvertiert.
Die Worte SR 253 bis SR 255 können nicht geändert werden.
Kapitel 4-2
RUN MONITOR PROGRAM
No OK OK
Vorsicht Stellen Sie sicher, daß das Ändern der Werte keine nachteiligen Folgen hat.
!
1, 2, 3...
1. Überwachen Sie (dezimal mit Vorzeichen) den Stauts des Wortes, dessen
aktueller Wert geändert werden soll.
c000
(
Dezimale Überwachung mit Vorzeichen)
-00016
2. Drücken Sie die [CHG]–Taste, um die dezimale Datenänderung mit Vorzeichen zu beginnen.
PRES VAL?
CHG
c000 -00016
3. Geben Sie den neuen Istwert ein, und drücken Sie zum Speichern die
[WRITE]–Taste. Der Vorgang wird beendet, und die Anzeige für die Dezimale Überwachung mit Vorzeichen wird wiederhergestellt.
Der Istwert kann in einem Bereich von –32.768 bis 32.767 geändert werden. Zur Eingabe positiver Vorzeichen benutzen Sie die [SET]–Taste, zur
Eingabe negativer Vorzeichen die [RESET]–Taste.
REC
RESET
D
3C2 7 6 8
WRITE
c000
-32768
Drücken Sie die [CLR]–Taste oder die [SHIFT]– und [TR]–Taste, um zur
Normalanzeige zurückzukehren.
Sollte es zu einer Fehleingabe gekommen sein, drücken Sie die
[CLR]–Taste, um den Zustand vor der Eingabe wieder herzustellen. Machen Sie dann die korrekte Eingabe.
81

Programmierkonsolen–Funktion
4-2-22Dezimale Datenänderung ohne Vorzeichen
Diese Funktion dient der Änderung des Dezimalwertes eines Wortes innerhalb eines Bereichs von 0 bis 65.535 bei der Dezimaldaten–Überwachung
ohne Vorzeichen. Es wird automatisch in einen Hexadezimalwert konvertiert.
Die Worte SR 253 bis SR 255 können nicht geändert werden.
RUN MONITOR PROGRAM
Nein OK OK
Vorsicht Stellen Sie sicher, daß das Ändern der Werte keine nachteiligen Folgen hat.
!
Kapitel 4-2
1, 2, 3...
1. Überwachen Sie (dezimal ohne Vorzeichen) den Status eines Worts, dessen aktueller Wert geändert werden soll.
Dezimalüberwachung ohne Vorzeichen)
(
2. Drücken Sie die [CHG]–Taste, um die Dezimale Datenänderung zu beginnen.
CHG
3. Geben Sie den neuen Istwert ein, und drücken Sie zum Speichern die
[WRITE]–Taste. Der Vorgang wird beendet und die Normalanzeige wieder
hergestellt.
Der Istwert kann innerhalb eines Bereiches von 0 bis 65.535 geändert
werden.
D
C
3
2 7 6 8
Drücken Sie die [CLR]–Taste oder die [SHIFT]– und [TR]–Taste, um in die
Normalanzeige zurückzukehren.
Sollte es zu einer Falscheingabe gekommen sein, drücken Sie die
[CLR]–Taste, um den Zustand vor der Eingabe wiederherzustellen. Geben
Sie dann den korrekten Wert ein.
4-2-23Zwangssetzen, Zwangsrücksetzen
c000
65520
PRES VAL?
c000 65520
c000
WRITE
32768
Diese Funktion dient dem zwangsweisen Setzen der Bits (Status ON) oder
zwangsweisem Rücksetzen (Status OFF). Sie sollte beim Austesten des Programms oder beim Überprüfen der Ausgangs–Verdrahtung eingesetzt werden
und ist nur im MONITOR– oder PROGRAM–Betrieb möglich.
RUN MONITOR PROGRAM
Nein OK OK
Vorsicht Stellen Sie sicher, daß das Zwangssetzen keine nachteiligen Folgen hat.
!
1, 2, 3...
1. Überwachen Sie den Status des gewünschten Bits gemäß der unter
4-2-11 Bit–/Wortüberwachung
dargestellten Vorgehensweise. Werden
zwei oder mehr Worte überwacht, sollte das gewünschte Bit äußerst links
angezeigt werden.
00000 20000
Mehrfach–Adress–Überwachung)
(
^OFF ^ON
2. Drücken Sie die [SET]–Taste zum zwangsweisen Setzen des Bits auf ON
oder die [RESET]–Taste zum zwangsweisen Rücksetzen des Bits auf
OFF.
82

Programmierkonsolen–Funktion
00000 20000
SET
ON ^OFF
Der Cursor in der unteren, linken Ecke der Anzeige zeigt an, daß das
Setzen/Rücksetzen aktiviert ist. Der Status des Bits bleibt nur solange ON
oder OFF, wie die Taste gedrückt gehalten wird. Der Ursprungszustand
wird einen Zyklus nach Loslassen der Taste wiederhergestellt.
3. Drücken Sie die [SHIFT] + [SET]– oder die [SHIFT] + [RESET]–Taste, um
die Zwangssetzung auch nach Loslassen der Taste aufrechtzuerhalten.
Der zwangsgesetzte Status wird dann in der Anzeige mit “S”, der zwangsrückgesetzte Status mit “R” gekennzeichnet.
Um den ursprünglichen Status der Bits wieder herzustellen, drücken Sie
die [NOT]–Taste, oder führen Sie den unter
setzungen/Zwangsrücksetzungen
beschriebenen Vorgang aus.
4-2-24 Aufheben der Zwangs–
Der zwangsgesetzte Status wird auch durch Wechsel der SPS–Betriebsart aufgehoben, es sei denn, daß SR 25211 den Status EIN hat. Dann
erfolgt beim Wechsel von PROGRAM auf MONITOR–Betrieb keine Aufhebung. Bei Betriebsunterbrechung in Folge eines schwerwiegenden Fehlers wird der ursprüngliche Status der zwangsgesetzten Bits ebenfalls wiederhergestellt.
4-2-24Aufheben der Zwangssetzungen/Zwangsrücksetzungen
Kapitel 4-2
Diese Funktion dient dem Aufheben aller durchgeführten Zwangsetzungen
und Zwangsrücksetzungen. Sie ist nur im MONITOR– oder PROGRAM–Betrieb ausführbar.
RUN MONITOR PROGRAM
Nein OK OK
Vorsicht Stellen Sie sicher, daß die Aufhebung der Zwangssetzungen keine nachtei-
!
ligen Folgen hat.
1, 2, 3...
1. Drücken Sie die [CLR]–Taste, um in die Ausgangsanzeige zurückzukehren.
2. Drücken Sie die [SET]–Taste und dann die [RESET]–Taste. Sie werden
aufgefordert, die nachstehende Meldung zu bestätigen.
SET
00000FORCE RELE?
RESET
Hinweis Sollten Sie irrtümlich die falsche Taste gedrückt haben, können Sie
durch Drücken der [CLR]–Taste den Vorgang erneut beginnen.
3. Drücken Sie die [NOT]–Taste, um den zwangsgesetzten bzw. zwangsrückgesetzten Status der Bits aller Datenbereich aufzuheben.
00000FORCE RELE
NOT
END
4-2-25Hex-ASCII Anzeigeumschaltung
Diese Funktion dient der Umschaltung der Anzeige von 4–stellig hexadezimal
auf ASCII–Format. Sie ist in jeder Betriebsart ausführbar.
RUN MONITOR PROGRAM
OK OK OK
83

Programmierbeispiel
Kapitel 4-3
1, 2, 3...
1. Überwachen Sie den Status des gewünschten Wortes oder mehrerer
Mehrfach–Adress–Überwachung)
(
2. Drücken Sie die [TR]–Taste, um in ASCII–Format–Darstellung umzuschal-
4-2-26Zykluszeitanzeige
Diese Funktion dient der Anzeige der aktuellen Zykluszeit. Sie ist nur im
RUN– oder MONITOR–Betrieb während der Programmausführung möglich.
OK OK Nein
1, 2, 3...
1. Drücken Sie zur Rückkehr in die Ausgangsanzeige die [CLR]–Taste.
2. Drücken Sie zur Anzeige der Zykluszeit die [MONTR]–Taste.
Worte entsprechend der unter
4-2-11 Bit–/Wortüberwachung
dargestellten
Vorgehensweise.
D0000 D0001
4142 3031
ten. Durch Drücken der [TR]–Taste kann zwischen beiden Anzeigearten
hin– und hergewechselt werden.
D0000 D0001
TR
”AB” 3031
D0000 D0001
TR
4142 3031
RUN MONITOR PROGRAM
Bei wiederholter Benutzung der [MONTR]–Taste kann es zur Anzeige unterschiedlicher Werte kommen. Dies ist auf unterschiedliche Ausführungsbedingungen zurückzuführen.
4-3 Programmierbeispiel
Dieses Kapitel zeigt, wie mit der Programmierkonsole Programme geschrieben werden können.
4-3-1 Vorbereitende Maßnahmen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, wenn Sie erstmalig ein Programm für
die CPM1A erstellen (Speicher löschen).
1, 2, 3...
1. Stellen Sie den Betriebswahlschalter der Programmierkonsole auf
PROGRAM und schalten Sie die SPS–Spannungsversorgung ein. Die
Passwort–Eingabeaufforderung erscheint.
MONITOR
RUN
PROGRAM
2. Geben Sie das Passwort ein, drücken Sie die [CLR]– und dann die
[MONTR]–Taste.
00000SCAN TIME
MONTR
012.1MS
<PROGRAM>
PASSWORD!
84
CLR MONTR
<PROGRAM>
Sie können jetzt die [SHIFT]– und dann die [1]–Taste drücken, um die
Summerfunktion aus– oder einzuschalten.
3. Löschen Sie den Speicher der CPM1, indem Sie die Tasten [CLR], [SET],
[NOT], [RESET] und dann die [MONTR]–Taste drücken. Sollten Speicher–

Programmierbeispiel
Kapitel 4-3
Fehler angezeigt werden, drücken Sie die [CLR]–Taste mehrmals hintereinander.
00000
CLR
SET
NOT
00000 MEM CLR ?
RESET
HR CNT DM
00000 MEM CLR
MONTR
END HR CNT DM
4. Lassen Sie sich durch Drücken der Tasten [CLR], [FUN] und [MONTR] die
Fehlermeldungen anzeigen. Betätigen Sie die [MONTR]–Taste solange,
bis alle Fehlermeldungen angezeigt und gelöscht sind.
00000
CLR
00000
FUN
FUN(0??)
00000ERR CHK
MONTR
OK
5. Drücken Sie die [CLR]–Taste, um zur Ausgangsprogrammieranzeige zurückzukehren (Programmadresse 00000). Das neue Programm kann jetzt
erstellt werden.
00000
CLR
Vorsicht Stellen Sie sicher, daß vor Eingabe des Passwortes der Betriebswahlschalter
!
auf PROGRAM gestellt ist. Überprüfen Sie, um Unfälle beim ersten Porgrammstart zu vermeiden, das System gründlich.
85

( ) Se bs a eb
( ) Se u de e gebe
(3) Se u de e gebe
() 0e ä e
(5) c e usga g
Programmierbeispiel
4-3-2 Beispiel–Programm
Das nachfolgende Kontaktplan–Programm soll das Programmieren mit der
Programmierkonsole veranschaulichen. Ausgang IR 01000 flackert EIN/AUS
(eine Sekunde EIN, eine Sekunde AUS) und zwar 10 Mal, nachdem IR 00000
auf EIN gesetzt wurde.
Start Eingabe
C00000000
00000
20000
20000
Kapitel 4-3
Selbst–Halte–Bit
00004
00007
00010
00014
00017
20000
T00220000
TIM 001
T00220000
TIM 002
T00120000
Zähl–Signal
CP
R
CNT 000
#0010
#0020
#0010
1-Sekunden–Zeitgeber
2-Sekunden–Zeitgeber
10ner Zähler
Rücksetz–Signal
T00120000
01000
END(001)
Blinker–Ausgang (10 Mal)
EIN
AUS
1
S
In der nachfolgenden Tabelle ist die Mnemonik–Liste für das Beispielprogramm aufgelistet. Die zur Programmeingabe notwendigen Schritte sind im
Kapitel
4-3-3 Programmieren
Adresse Befehl Daten Programier–Beispiel
00000 LR 00000
00001 OR 20000
00002 AND NOT C 000
00003 OUT 20000
00004 LD 20000
00005 AND NOT T 002
00006 TIM 001
00007 LD 20000
00008 AND NOT T 002
00009 TIM 002
00010 LD 20000
00011 AND T 001
00012 LD NOT 20000
00013 CNT 000
00014 LD 20000
00015 AND NOT T 001
00016 OUT 01000
00017 END (001) --- (6) END(001) Befehl
beschrieben
# 0010
# 0020
# 0010
.
siehe
(1) Selbsthaltebit
(2) 1-Sekunden–Zeitgeber
(3) 2-Sekunden–Zeitgeber
(4) 10ner Zähler
(5) Blincker–Ausgang
(10 Vorgänge)
4-3-3
Programmieren
86

Programmierbeispiel
4-3-3 Programmieren
Kapitel 4-3
Die Programmeingabe erfolgt gemäß der Mnemonik–Liste in Kapitel
Beispiel–Programm.
mieranzeige anzeigen. Alle Speicher müssen vor Eingabe eines neuen Programms gelöscht werden.
(1) Eingabe Merkers für Selbsthaftung
1, 2, 3...
1. Geben Sie die Schließer–Bedingung IR 00000 ein.
(Führende Nullen können weggelassen werden.)
2. Eingabe der OR–Bedingung IR 20000.
C
OR
2
3. Eingabe der Öffner–AND–Bedingung C000.
(Führende Nullen können weggelassen werden)
4-3-2
Die Programmierkonsole sollte die Eingangsprogram-
00000
LD
LD 00000
00001READ
WRITE
NOP(000)
A
A
0
AND
A
0
NOT CNT
0
00001
A
0
OR 20000
00002READ
WRITE
NOP(000)
00002
AND NOT CNT 000
4. Eingabe des OUT–Befehls IR 20000.
A
C
OUT
2
0
(2) Eingabe des 1–Sekunden–Zeitgebers
1, 2, 3...
1. Eingabe der Schließer–Bedingung IR 20000.
C
LD
A
2
0
2. Eingaber der Öffner–AND–Bedingung T002.
(Führende Nullen können weggelassen werden.)
AND
3. Eingabe des 1–Sekunden–Zeitgebers T001.
A
0
A
0
NOT TIM
00003READ
WRITE
NOP(000)
A
0
A
0
00003
A
0
OUT 20000
00004READ
WRITE
NOP(000)
00004
A
0
LD 20000
00005READ
WRITE
NOP(000)
00005
C
2
AND NOT TIM 002
00006READ
WRITE
NOP(000)
TIM
00006
B
1
TIM 001
00006 TIM DATA
WRITE
#0000
87

Programmierbeispiel
Kapitel 4-3
4. Eingabe des Sollwertes für T001 (#0010 = 1,0 s).
(3) Eingabe des
2–Sekunden–Zeitgebers
1, 2, 3...
B
1
00006 TIM DATA
A
0
#0010
00007READ
WRITE
NOP(000)
Die nachfolgenden Tastenabfolgen sind zur Eingabe des 2–Sekunden–Zeitgebers notwendig.
1. Eingabe der Schließer–Bedingung IR 20000.
C
A
A
LD
2
0
A
0
0
A
0
WRITE
00007
LD 20000
00008READ
NOP(000)
2. Eingabe der Öffner–AND–Bedingung T002.
(Führende Nullen können weggelassen werden.)
00008
AND
NOT TIM
C
2
AND NOT TIM 002
00009READ
WRITE
NOP(000)
3. Eingabe des 2–Sekunden–Zeitgebers T002.
00009
C
TIM
2
TIM 002
(4) Eingabe des Zählers
(10 Vorgänge)
1, 2, 3...
00009 TIM DATA
WRITE
#0000
4. Eingabe des Sollwertes für T002 (#0020 = 1,0 s).
C
2
00009 TIM DATA
A
0
#0020
00010READ
WRITE
NOP(000)
Folgende Tastenabfolgen sind zu Eingabe des Zählers (10 Vorgänge) erforderlich.
1. Eingabe der Schließer–Bedingung IR 20000.
C
A
A
LD
2
0
A
0
0
A
0
WRITE
00010
LD 20000
00011READ
NOP(000)
2. Eingabe der Öffner–AND–Bedingung T001.
(Führende Nullen können weggelassen werden.)
TIM
B
1
AND TIM 001
00012READ
WRITE
NOP(000)
AND
00011
3. Eingabe der Öffner–Bedingung IR 20000.
88
A
NOT
C
2
LD
A
0
0A0
00012
A
0
LD NOT 20000
00013READ
WRITE
NOP(000)

Programmierbeispiel
4. Eingabe des Zählers 000.
CNT
0
CNT 000
00013 CNT DATA
WRITE
#0000
00013
A
5. Eingabe des Sollwerte für 000 (#0010 = 10 Zähler).
Kapitel 4-3
(5) Eingabe des Blinker–Ausgangs
1, 2, 3...
1. Eingabe der Schließer–Bedingung IR 20000.
C
LD
2
2. Eingabe der Öffner–AND Bedingung T001.
3. Eingabe des OUT–Befehls IR 01000.
OUT
B
1
A
A
0
A
0
0
00013 CNT DATA
A
0
#0010
00014READ
WRITE
NOP(000)
000014
A
0
LD 20000
00015READ
WRITE
NOP(000)
(Führende Nullen können weggelassen werden.)
00015
AND
NOT TIM
B
1
AND NOT TIM 001
00016READ
WRITE
NOP(000)
(Führende Nullen können weggelassen werden.)
B
1A0
A
0A0
00016
OUT 01000
(6) Eingabe des End(001)–
Eingabe END (001)
Befehls
4-3-4 Programmüberprüfung
Überprüfen Sie die Programmsyntax in der PROGRAM–Betriebsart, um sicherzustellen, daß das Programm korrekt eingegeben wurde.
1, 2, 3...
1. Drücken Sie die CLR–Taste, um zur Ausgangsanzeige zu wechseln.
2. Drücken Sie die [SRCH]–Taste. Zur Auswahl der gewünschten Prüfebene
erscheint die nachstehende Eingabeaufforderung:
00017READ
WRITE
NOP(000)
00017
FUN
FUN(0??)
B
1
WRITE
00017
FUN(001)
00018READ
NOP(000)
A
0
00000
00000PROG CHK
SRCH
CHKLEVEL (0-2)?
89

Programmierbeispiel
Kapitel 4-3
3. Geben Sie die gewünschte Ebene ein (0,1 oder 2). Die Überprüfung beginnt unverzüglich und der erste gefundene Fehler wird angezeigt.
00178CIRCUIT ERR
A
0
OUT 00200
Hinweis Für nähere Informationen siehe
4. Drücken Sie die [SRCH]–Taste, um mit der Überprüfung fortzufahren. Der
nächste Fehler wird angezeigt. Wiederholtes Drücken der [SRCH]–Taste
zeigt die weiteren Fehler an.
Die Suche kann bis zum Erreichen eines END–Befehls fortgesetzt werden
oder bis die Programmspeicherkapazität erschöpft ist.
Wenn Fehler angezeigt werden, sollten Sie das Programm editieren, um die
Fehler zu beseitigen und dann das Programm erneut überprüfen. Führen Sie
die Programmüberprüfung solange durch, bis alle Fehler beseitigt werden
konnten.
4-3-5 Test–Lauf in der MONITOR–Betriebsart
Wählen Sie an der CPM1A MONITOR–Betrieb und überprüfen sie die Ausführung des Programms.
1, 2, 3...
1. Stellen Sie den Programmierkonsolen–Betriebswahlschalter auf
MONITOR–Betrieb.
MONITOR
RUN
PROGRAM
<MONITOR> BZ
2. Drücken Sie die [CLR]–Taste, um zur Ausgangsanzeige zu wechseln.
5-5 Fehlersuche.
00000
CLR
3. Starten Sie das Programm, indem Sie das Start–Eingangs–Bit
(IR 00000) zwangssetzen.
00000
LD
LD 00000
00000
MONTR
^ OFF
00000
SET
ON
Der Cursor in der linken, unteren Ecke der Anzeige weist aus, daß das
Zwangssetzen aktiviert wurde. Das Bit wird, solange Sie die Taste gedrückt halten, den Status ON einnehmen.
4. Falls das Programm korrekt arbeitet, wird die Ausgangs–Anzeige für Ausgang 01000 zehn mal aufleuchten. Nach 10–maligem Aufleuchten muß
die Statusanzeige erlöschen.
Sollte die Ausgangs–Anzeige nicht aufleuchten, ist das Programm fehlerhaft. In diesem Fall müssen Sie das Programm überprüfen und dann mittels Zwangssetzung des Startbits einen erneuten Testlauf durchführen.
90

Kapitel 5
Testlauf und Fehlersuche
5-1 Systemüberprüfung und Testlauf 92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1-1 Systemüberprüfung 92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1-2 CPM1A Test–Lauf 92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-1-3 Flash–Speicher–Vorsichtsmaßnahmen 93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-2 Verarbeitungsablauf der CPM1A 93. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3 Selbstdiagnose–Funktion 95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3-1 Geringfügige Fehler 95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3-2 Schwerwiegende Fehler 95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3-3 Fehlersuche 96. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-3-4 Anwenderdefinierte Fehler 96. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-4 Programmierkonsolen–Fehlermeldungen 97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-5 Fehlersuche 97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-6 Ablaufdiagramm für Fehlerbehebung 99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-7 Wartung 106. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5-8 Vorsichtsmaßnahmen während des Betriebs 107. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
91

Systemüberprüfung und Testlauf Kapitel 5-1
5-1 Systemüberprüfung und Testlauf
5-1-1 Systemüberprüfung
Hinweis Überprüfen Sie nach Setup und Verdrahtung der CPM1A die nachfolgenden
Punkte. Legen Sie besonderes Augenmerk auf Anschlüsse und Verdrahtung.
Überprüfung
Spannungsversorgung und
E/A–Anschlüsse
Anschlußkabel Sind die Kabel ordnungsgemäß angeschlossen?
Staubschutzaufkleber
Hinweis 1. Stellen Sie vor der ersten Benutzung der CPM1A sicher, daß der interne
Speicher der CPM1A vollständig gelöscht wurde, da die Speicherbereiche
DM, HR, AR und CNT zufällige Speicherinhalte aufweisen können.
2. Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch, daß die Speicherbereiche
DM, HR, AR und CNT zufällige Dateninhalte haben können, wenn die Spannungsversorgung der CPM1A für einen Zeitraum ausgeschaltet war , der die
Backup–Zykluszeit des integrierten Kondensators überschritten hat.
Wurde ordnungsgemäß verdrahtet?
Wurden die Klemmen ordnungsgemäß festgezogen?
Können Kurzschlüsse an Steckern und Leitungen
ausgeschlossen werden?
Für weitere Informationen, siehe Kapitel
Anschlüsse.
Für weitere Informationen, siehe Kapitel
Anschlüsse.
Wurde der Staubschutzaufkleber entfernt?
Für weitere Informationen, siehe Kapitel
Anschlüsse.
3-4 Verdrahtung und
3-4 Verdrahtung und
3-4 Verdrahtung und
5-1-2 CPM1A Test–Lauf
1, 2, 3...
1. Versorgungsspannung
2. E/A–Verdrahtungs–Überprüfung
3. Test–Lauf
4. Austesten des Programms
5. Sichern des Programms
a) Überprüfen Sie Spannungsversorgung und die Klemmen–Anschlüsse.
b) Überprüfen Sie die Spannungsversorgung und Klemmen–Anschlüsse
der E/A–Geräte.
c) Legen Sie Versorgungsspannung an und überprüfen Sie, ob die Ver-
sorgungsspannungs–LED leuchtet.
d) Stellen Sie mittels der Programmierkonsole die CPM1 auf PROGRAM–
Betrieb.
a) Stellen Sie die CPM1A auf PROGRAM–Betrieb und überprüfen die
Ausgangsverdrahtung mit Hilfe der Zwangssetzen/Zwangsrücksetzen–
Funktion. Für nähere Informationen siehe
Kapitel 4-2-23 Zwangs-
setzen/Zwangsrücksetzen.
b) Überprüfen Sie die Eingangsverdrahtung mittels der CPM1–Eingangs–
LEDs oder mit Hilfe der Überwachungsfunktionen über ein Peripheriegerät.
a) Schließen Sie an die CPM1 ein Peripheriegerät an und schalten Sie
auf RUN– oder MONITOR–Betrieb. Überprüfen Sie, ob die
“RUN”–LED leuchtet.
b) Überprüfen Sie den Betrieb mit Hilfe der Funktion Zwangssetzen/
Zwangsrücksetzen usw.
Korrigieren Sie alle Programmierfehler, die festgestellt wurden.
a) Sichern Sie das Programm über ein Peripheriegerät auf einer Backup–
Diskette.
92

Verarbeitungsablauf der CPM1A
Section 5-2
b) Drucken Sie das Programm aus.
Hinweis Für weitere Informationen zum Programmierkonsolenbetrieb, siehe unter
pitel 4 Peripherie–Geräte
5-1-3 Flash–Speicher–Vorsichtsmaßnahmen
Beachten Sie unbedingt die nachfolgenden Vorsichtsmaßnahmen zur Absicherung des Flash–Speichers.
1, 2, 3...
1. Wird die Versorgungsspannung unterbrochen, ohne, daß nach Durchführung von Änderungen im DM–Speicherbereich–Nur–Lese–Zugriff (DM
6144 bis DM 6599) oder SPS Setup (DM 6600 bis DM 6655) die Betriebsart gewechselt wurde, werden die Änderungen nicht im Flash–Speicher
gesichert. Das bedeutet, daß falls die Spannungsversorung für mehr als
20 Tage (bei 25_C) unterbrochen wird, die Änderungen (Inhalt des RAM–
Bereichs) verloren gehen bzw. zufällige Werte annehmen.
2. Wird die CPM1A zum ersten Mal nach Änderung des Programms in Betrieb gesetzt, wird das Lesen der Daten im Nur–Lesezugriff–DM–Bereich
(DM 6144 bis DM 6599) oder im Setup (DM 6600 bis DM 6655) ca. 600
ms länger dauern als gewöhnlich. Ziehen Sie diese einmalige Start–Verzögerung unbedingt in Betracht.
3. Wird eine der nachfolgenden drei Funktionen im MONITOR– oder RUN–
Betrieb ausgeführt, wird sich die Zykluszeit um bis zu 600 ms verlängern
und die Interrupts werden für den Zeitraum, der zum Überspeichern der
Setup–Vorgabewerte benötigt wird, deaktiviert.
• Programmänderungen mit der Edit–Funktion im Online–Betrieb
• Änderungen im Nur–Lesen–DM–Bereich (DM 6144 bis DM 6599)
• Änderungen im SPS–Setup (DM 6600 bis DM 6655)
Ein “SCAN TIME OVER”–Fehler wird jedoch nicht angezeigt. Die Antwortzeit der CPM1A Ein–/Ausgänge kann durch die Ausführung der Edit–
Funktion im Online–Betrieb beeinflußt werden.
Ka-
5-2 Verarbeitungsablauf der CPM1A
Das nachfolgende Flußdiagramm zeigt die interne Verarbeitung der CPM1A.
Wird Versorgungsspannung angelegt, wird die CPM1A intern initiallisiert. Werden keine Fehler festgestellt, werden nacheinander Überwachungsfunktion,
Programmausführung, E/A–Auffrischung und die Anforderungsbearbeitung
externer Geräte ausgeführt (zyklisch). Die durchschnittliche Zykluszeit kann
über ein Peripheriegerät überwacht werden.
93

Verarbeitungsablauf der CPM1A
Anlegen der Spannungsversorgung
Section 5-2
Setzen der Fehlermerker
und Aktivieren der LEDs
Fehler oder Alarm?
ERROR–LED
(leuchtet)
ALARM–LED
(blinkt)
Initialisierungsvorgänge
Überprüfung von Hardware
und Programmspeicher
Nein
Überprüfung OK?
Ja
Voreinstellung der Zyklus–
und Überwachungszeit
Ausführung Anwenderprogramms
Programmende?
Ja
Überprüfung der
Zykluszeiteinstellung
Minimale
Zykluszeit?
Ja
Warten bis die minimale
Zykluszeit abgelaufen ist
Nein
Nein
Initialisierung
Überwachungsfunktion
Programm–
Ausführung
Zykluszeit–
Abarbeitung
Zyklus–
zeit
Berechnung der Zykluszeit
Auffrischung der Eingangsbits
und Ausgangs–Klemmen
Anforderungsbearbeitung der
Peripherie–Schnittstelle
E/A–
Auffrischung
Anforderungsbearbeitung
Peripherie–
schnittstelle
Hinweis Initialisierungs–V erarbeitung einschließlich Löschen der IR, SR und
AR–Speicherbereiche, Voreinstellung des Systemzeitgebers und Überprüfung
der E/A–Baugruppen.
94
 Loading...
Loading...