Page 1

LX20 0 A C F
1022 - DE - Meade LX200 ACF
BETRIEBSANLEITUNG
mit AutoStar-II Steuerung
Advanced
Coma Free
8˝ ACF • 10˝ ACF • 12˝ ACF • 14˝ ACF • 16˝ ACF
(c) nimax GmbH
Page 2

Hinweis: Wenn Ihnen daran
gelegen ist, Ihr Teleskop zum
erstenmal in Betrieb zu nehmen,
ohne die gesamte Betriebsanleitung gründlich durcharbeiten
zu müssen, so sehen Sie unter
der Kurzeinführung auf Seite 6
nach.
W A R N U N G !
Verwenden Sie ein
Teleskop niemals für
einen ungeschützten
Blick in die Sonne! Sobald Sie
direkt in die Sonne oder auch
nur in ihre unmittelbare
Umgebung blicken, riskieren Sie
sofortige und unheilbare
Schäden in Ihrem Auge. Diese
Schädigung des Auges geschieht zumeist schmerzfrei
und deshalb ohne jede Warnung
an den Beobachter, dass vielleicht alles schon zu spät ist und
dass sich ein Augenschaden
ereignet hat. Richten Sie deshalb niemals das Fernrohr oder
dessen Sucher auf oder neben
die Sonne. Blicken Sie niemals
durch das Teleskop oder dessen
Sucher, sobald es sich bewegt.
Während einer Beobachtung
müssen Kinder zu jeder Zeit
unter der Aufsicht Erwachsener
bleiben.
LX20 0 A C F
ALLGEMEINE INFO / INHALTSVERZEICHNIS
Kapitel Seite
Teleskopübersicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Schnellstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
optisches System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
AutoStar II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Aufbau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Beobachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
AutoStar-II - Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
AutoStar-II - Menüs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
AutoStar-II Funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Fotografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
Zubehör . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
Wartung und Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47
Anhang A: Parallaktische Ausrichtung . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
Anhang B: Tabellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
Anhang C: Erstellen von eigenen Streifzügen . . . . . . . . . . . .58
Anhang D: Antriebstraining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
Anhang E: Das Mondmenü . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
Anhang F: Besonderheiten 16“ LX200ACF . . . . . . . . . . . . . . .66
Anhang G: Besonderheiten 14“ LX200ACF . . . . . . . . . . . . . .70
Anhang H: Smart Mount . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .71
Anhang I: Astronomische Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . .74
Anhang J: Referenzsterne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
EG-Konformitätserklärung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
A C H T U N G Ver l e t z u n g s g e f a h r !
Treten Sie bei der Bewegung
des Teleskops stets ein wenig
zurück und bringen Sie keine
Gegenstände oder Körperteile
in die Nähe des Teleskops!
Quetschgefahr! Blicken Sie erst
wieder durch das Teleskop,
nachdem der Positioniervorgang vollständig abgeschlossen ist!
Wichtige Hinweise:
• Alle Meade Teleskope und Meade Zubehörteile stehen unter ständiger technischer
Weiterentwicklung. Geringfügige Änderungen der Produktspezifikationen, die der
Verbesserung des Produktes dienen, sind aus diesem Grunde vorbehalten.
• Füllen Sie bitte sogleich ihre Produktregistration aus und senden Sie sie an Meade
Instruments Europe, Rhede/Westfalen, zurück. Nur durch diese Registration bei
Meade Instruments Europe kommen Sie in den Genuss der Original Garantie!
• Diese Anleitung bitte nicht vernichten und zum weiteren Nachschlagen griffbereit
halten.
® Der Name „Meade“ und das Meade Logo sind Warenzeichen, die beim U.S. Patent Office und bei
entsprechenden Behörden vieler anderer Staaten registriert wurden. „LX200ACF“ ist ein Warenzeichen
der Meade Instruments Corporation.
Die vollständige oder teilweise Vervielfältigung der Inhalte dieses Dokuments außerhalb
des privaten Gebrauchs ist in jeder Form ausdrücklich verboten.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Texte, Bilder und Zeichen sind Eigentum der nimax GmbH und Meade Instruments.
(c) nimax GmbH
Page 3

Rückseite des
Gerätes
21
LX20 0 A C F
23
20
25
19
18
TELESKOPÜBERSICHT
Okular
1
Okularklemmschraube
2
11/4˝ Zenitprisma
3
Klemmschraube
4
Tubusanschluss
5
Fokusstellschraube
6
Gabelarme
7
Batteriefächer
8
Hauptspiegelklemmung
9
RA-Stellschraube
10
RA-Teilkreis
11
22
24
1
2
3
4
5
6
Autostar II
Handbox.
Siehe Seite 9
8
9
14
RA-Klemmung
12
Anschlussboard
13
Handboxhalterung
14
Tragegriffe
15
17
16
15
7
DEC-Stellschraube
16
DEC-Klemmung
17
Staubschutzdeckel
18
Optischer Tubus
19
DEC-Teilkreis
20
Sucherjustierschrauben
21
8x50 Sucher
22
GPS-Antenne
23
11/4˝ Okularhalterung
24
Tubusadapter
25
Ein/Aus Schalter und Anzeige
A
12V Stromversorgung
B
Fokussierer Anschluss
C
Fadenkreuzokular Anschluss
D
12V Ausgang
E
Handbox
F
Serieller Computeranschluss
G1
RS232-Ausgang
G2
für weitere Geräte wie z.b. Bildfeld-Derotator
Autoguider-Anschluss
H
10
11
12
13
C
A
B
Abb. 1: Das LX200 Teleskop mit Anschlussboard und AutoStar II Handbox
F G1
D
E
G2
H
(c) nimax GmbH
Page 4

LX20 0 A C F
TELESKOPÜBERSICHT
LX200ACF: Ihr persönliches Fenster zum Universum
Die Meade LX200ACF Teleskope sind sehr vielseitige, hochauflösende Teleskope. Mit der AutoStar-II-Steuerung, präziser
GPS-Ausrichtung, shiftingfreiem Mikrofokussierer, Level- und Nord-Sensoren, automatischer Nachführung von Himmelsobjekten, Korrektur des periodischen Schneckenfehlers in beiden Achsen sowie einer Datenbank von über 144.000
Objekten stellen diese Teleskope ein Maximum an Bedienungskomfort und Leistungsfähigkeit zur Verfügung. Studieren Sie
die Struktur einer Vogelfeder aus 50 Metern Entfernung oder beobachten Sie das Ringsystem des 1,25 Milliarden Kilometer
entfernten Planeten Saturn – die Meade LX200ACF Teleskope halten mit Ihren wachsenden Ansprüchen Schritt und sind
sowohl für den gelegentlichen Beobachter als auch für den ernsthaften Astrofotografen gleichermaßen ideal.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Okular: Setzen Sie das mitgelieferte 26 mm SuperPlössl-Okular in das Zenitprisma ein (Abb. 1, Nr. 3) und ziehen
Sie die Klemmschraube leicht an (Abb. 1, Nr. 2). Okulare vergrößern das Bild im Fokus des Teleskops und machen
es für das Auge sichtbar.
Okularklemmschraube: Sie hält das Okular sicher im Zenitprisma. Maximal handfest anziehen!
11/4˝ Zenitprisma: Sorgt für einen komfortablen, rechtwinkligen Einblick. Siehe auch Seite 14 für weitere
Informationen.
Klemmschraube für das Prisma: Sie hält das Zenitprisma im Mikrofokussierer.
Hinterer Tubusanschluss: Hier wird der Mikrofokussierer angebracht.
Manuelle Fokussierung: Bewegt den Hauptspiegel des Teleskops. Hiermit lassen sich Objekte von ca. 20m
Entfernung bis unendlich scharfstellen. Bei angezogener Spiegelklemmung (9) darf die Grobfokussierung nicht
mehr betätigt werden!
Gabelarme: Die Gabelarme halten den Tubus sicher in Position.
Batteriefächer: Hier werden die insgesamt acht Batterien untergebracht, die zum Feldbetrieb des Teleskops not-
wendig sind.
Hauptspiegelklemmung: Wenn sie in Richtung „Lock“ (Fest) angezogen wird, sind auch minimalste
Bewegungen des Hauptspiegels nicht mehr möglich. Eine Fokussierung ist dann nicht mehr möglich.
10
11
12
13
4
Manuelle Rektaszensionsbewegung: Wenn die AutoStar-Steuerung nicht benutzt werden soll, kann hiermit bei
gelöster bzw. leicht angezogener RA-Klemmung (12) das Teleskop manuell in der RA-Achse bewegt werden.
Nicht nach erfolgter Ausrichtung benutzen, da diese sonst verloren geht!
RA-Teilkreis: Siehe Anhang A (Seite 50) für weitere Informationen.
RA-Klemmung: Wenn diese gegen den Uhrzeigersinn gelöst wird, kann das Teleskop in der RA-Achse innerhalb
der Endanschläge frei von Hand bewegt werden. Ist diese Klemmung angezogen, kann das Teleskop nur noch
von den Motoren bewegt werden.
Anschlussboard (kleines Bild unten rechts):
A
B
C
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
Ein/Aus Schalter: Hiermit wird die Computersteuerung ein- und ausgeschaltet. Die Kontrollleuchte kann
über die Software deaktiviert werden (siehe Seite 27).
12V-Anschluss für Versorgungsspannung: Hieran kann das separat erhältliche Netzteil #547F bzw. das
Autobatteriekabel #607 angeschlossen werden. Siehe auch Sonderzubehör auf Seite 43. Der Plus-Pol ist
innen, der Minus-Pol außen.
Fokussierer-Anschluss: Schließen Sie hier den Mikrofokussierer an. Die Steuerung des Fokussierers
erfolgt über die Schnellzugriffstaste , siehe Seite 17 & 31.
FOCUS
4
(c) nimax GmbH
Page 5

LX20 0 A C F
TELESKOPÜBERSICHT
14
15
16
D
E
F
H
Schwenkbare Handbox-Halterung: Diese kann an einem der Tragegriffe (15) angebracht werden und hält die
Handbox in einer bequemen Stellung.
Tragegriffe: Hiermit kann das Teleskop bequem auf das Stativ gesetzt werden. Mit Hilfe der Tragegriffe lässt sich
das Teleskop außerdem leicht schwenken.
Manuelle Deklinations-Feinbewegung: Ermöglicht die Einstellung der Deklination von Hand; hierzu muss die
DEC-Klemmung angezogen sein. Eine manuelle Verstellung darf nur bei ausgeschaltetem Teleskop erfolgen!
Anschluss für beleuchtbares Fadenkreuzokular: Beleuchtbare Fadenkreuzokulare mit Kabel
(Sonderzubehör) können hier angeschlossen werden. Die Steuerung erfolgt über die Schnellzugriffstaste
*RET*, siehe Seite 31. Beleuchtbare Fadenkreuzokulare finden Sie unter dem ab Seite 42 vorgestellten
Sonderzubehör.
12V= Ausgang: Hier wird der Tubuslüfter des 16" LX200 ACF angeschlossen. Alternativ können auch
andere externe Geräte mit einer Stromaufnahme bis maximal 250mA angeschlossen werden.
AutoStar II Handbox („HBX“) Anschluss: Hier wird die AutoStar-II Handbox angeschlossen.
G2G1
+ RS232-Anschluss (2x): Mit dem linken Anschluss (G1) kann das LX200 mit einem PC verbunden werden,
um die Fernsteuerung des Teleskops oder ein Update der Software zu ermöglichen. Der rechte RS-232
Anschluss (G2) ist für zukünftige Entwicklungen vorgesehen.
Autoguider-Anschluss: Hier können Autoguider mit Relaisausgang angeschlossen werden. Weitere
Hinweise entnehmen Sie bitte der Betriebsanleitung des Autoguiders.
17
18
19
20
21
22
23
24
Deklinations-Klemmung: Wenn diese gegen den Uhrzeigersinn gelöst wird, kann das Teleskop in Deklination frei
geschwenkt werden. Im Uhrzeigersinn handfest angezogen wird die Motorsteuerung über den AutoStar-II ermöglicht. Hinweis: Sie sollte, ebenso wie die RA-Klemmung, nach dem Einrichten des LX200ACF nicht mehr gelöst
werden. Andernfalls geht die Ausrichtung verloren und muss neu durchgeführt werden!
Staubschutzdeckel: Dieser wird nach vorne abgezogen. Er sollte immer angebracht sein, wenn das Teleskop
nicht benutzt wird. Wenn die Korrektorplatte nach einer kühlen Nacht mit Tau beschlagen sein sollte, darf der
Deckel erst angebracht werden, nachdem die Feuchtigkeit verdunstet ist!
Optischer Tubus: Dies ist das Herzstück des LX200ACF. Das Linsen-/Spiegelsystem sammelt das einfallende
Licht und fokussiert es im Brennpunkt.
Deklinations-Teilkreis (am linken Gabelarm): Siehe Anhang A, Seite 50, für weitere Informationen.
Sucherjustierschrauben: Mit diesen Schrauben wird der Sucher parallel zur optischen Achse des Haupt-Tubus
ausgerichtet. Siehe Seite 15 für weitere Informationen.
8x50 Sucher: Ein niedrig vergrößerndes Fernrohr mit großem Gesichtsfeld. In seinem Fadenkreuz können Objekte
so vorzentriert werden, dass sie dann im Okular des Teleskops sichtbar sind.
GPS-Antenne: Sie empfängt die notwendigen Satellitendaten (Zeit, Datum, Standort) für die Ausrichtung des
Teleskops. Siehe Seiten 18 bis 21 für weitere Informationen.
11/4˝ Okularhalter: Ermöglicht die Verwendung von 11/4˝ Standard-Zubehör
25
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
Tubusadapter: Die optischen und mechanischen Achsen des LX200ACF wurden im Werk sorgfältig aufeinander
abgestimmt, um präzises Positionieren und Nachführen zu ermöglichen. Die Schrauben des Tubusadapters
dürfen auf keinen Fall verstellt werden, da sonst die ordnungsgemäße Funktion des Teleskops nicht mehr gewährleistet ist!
(c) nimax GmbH
5
Page 6

LX20 0 A C F
Für eine Beobachtung ist es ratsam, das LX200 auf dem mitgelieferten Stativ zu
befestigen. Üben Sie den Aufbau des Teleskops und die Inbetriebnahme des
1
Autostar zu Hause bei Licht. Auf diese Weise machen Sie sich mit den Bauteilen und
mit dem Betrieb vertraut, bevor Sie das Teleskop für eine Beobachtung in die
Dunkelheit nach draußen nehmen.
SCHNELLSTART
2
3
Gewinde
stange
Gewindestange
in Stativbasis
einführen
“C” Clip
Spreizplatte
1
2
Nehmen Sie das Stativ aus dem Versandkarton heraus. Stellen Sie es senkrecht mit den Stativfüßen nach unten auf. Das Stativ bleibt dabei noch vollständig zusammengeklappt. Ergreifen Sie zwei der Stativbeine und ziehen
sie diese Stativbeine vorsichtig bis zur voll geöffneten Position auseinander.
Das gesamte Stativgewicht lastet dabei inzwischen auf dem dritten
Stativbein.
Mit den Klemmhebeln können Sie die Höhe der inneren, ausziehbaren
Stativbein-Segmente verstellen. Ziehen Sie die Klemmhebel handfest an –
überdrehen Sie die Klemmung dabei aber nicht!
Hinweis: Handfestes Anziehen ist ausreichend! Überdrehen
kann sowohl die Klemmschrauben als auch die Stativbeine
beschädigen und führt zu keiner höheren Standfestigkeit!
3
4
4
E
ntfernen Sie die Gewindestange (siehe nebenstehende Darstellung) vom
Stativkopf. Nehmen Sie den kleinen Plastikbeutel ab, der an der
Gewindestange festgemacht ist. Dieser Beutel enthält eine Feder und zwei
Muttern.
Nehmen Sie die Spreizspange (siehe nebenstehende Darstellung) aus der
Verpackung. Schieben Sie die Spreizspange auf die Gewindestange.
Stecken Sie die Gewindestange wieder durch den Stativkopf. Stecken Sie
die Feder auf die Gewindestange und schrauben Sie die beiden Muttern bis
zur Feder herunter. Schrauben Sie die beiden Muttern am besten nacheinander hinauf, damit sie sich nicht gegenseitig verklemmen. Richten Sie die
Spreizspange so aus, dass ihre drei Arme mit den drei Stativbeinen zusammenpassen.
5
Spindelschraube
6
Batteriefach
am Bein
anlegen
Versteifung nicht
nach oben!
Hinweis: Die Stativbeine sind nicht völlig verwindungssteif. Sollte der Stativkopf nach dem Aufstellen nicht
gerade sein, so drücken sie die Stativbeine etwas zur
Seite, bis der Stativkopf gerade ist.
ACHTUNG: Montieren Sie die Spreizspange nicht verkehrt
herum – dadurch würde die Gewindestange zu weit in den
Teleskop-Sockel eingeschraubt und dort gravierende Schäden
anrichten, die durch die Garantie nicht gedeckt sind! Die
Versteifung auf der Spreizspange muss nach unten zeigen!
5
6
Entnehmen Sie das LX200 aus seiner Verpackung. Stellen Sie das Teleskop
auf den Stativkopf. Drehen Sie die Gewindestange in die zentrale Bohrung
an der Unterseite des Antriebsgehäuses Ihres Teleskops. Drehen Sie die
Spannschraube (siehe nebenstehende Darstellung) fest; ein handfestes
Anziehen der Spannschraube genügt für eine stabile Fixierung der
Stativbeine.
Nehmen Sie die Abdeckungen der Batteriefächer ab; diese befinden sich an
den Innenseiten der Gabelarme. Setzen Sie jeweils vier Baby-Zellen (weitere
Bezeichnungen: C / UM-2 / R14 /LR 14 / AM-2) in die Halter ein. Achten Sie
bitte auf die Polarität, die im Halter angegeben ist! Nun werden die
Batteriehalter wieder in die Fächer gesteckt und die Abdeckungen angebracht.
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
6
(c) nimax GmbH
Page 7

7
Ein / Aus Autostar II - Handboxanschluss
8
H
LX20 0 A C F
ACHTUNG: Setzen Sie die Batterien mit Sorgfalt so ein, wie es in
den Batteriehaltern symbolisch dargestellt ist. Beachten Sie die Anweisungen des Batterieherstellers. Setzen Sie die Batterien nicht verkehrt herum ein und kombinieren Sie nicht alte mit neuen Batterien.
Mischen Sie auch nicht Batterien verschiedenen Typs. Wenn diese
Hinweise nicht beachtet werden, können Batterien auslaufen, Feuer
fangen oder gar explodieren. Schäden, die hierdurch verursacht werden, fallen nicht unter die Gewährleistung. Wenn das Teleskop für län-
gere Zeit nicht benutzt wird, sind die Batterien zu entnehmen.
SCHNELLSTART
F
E
G
F
8a
G H
9
I
E
oder
I KJ
R.A.
Lock
L
Dec.
Lock
7
Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter auf „OFF“ (AUS) steht.
Nehmen Sie die AutoStar-II Handbox und das Anschlusskabel aus der
Verpackung und verbinden Sie die Handbox mit dem mit „HBX“
gekennzeichneten Anschluss auf dem Anschlussboard.
A
8
1 1/4˝ Zenitprisma anbringen: Entfernen Sie die Schutzkappe von der
Öffnung der Tubusrückseite und setzen Sie die Okularhalterung (B) auf.
Setzen Sie das Zenitprisma (G) in die Okularhalterung ein und fixieren
BDC
A
Sie beides mit der Feststellschraube (H).
Setzen Sie nun das SuperPlössl 26mm Okular (F) in das Zenitprisma ein
und fixieren Sie es mit der Feststellschraube (E).
8a
Montage des Mikrofokussierers (Optionales Zubehör – nur bei 16˝
Modell im Lieferumfang enthalten): Nehmen Sie die Staubschutzkappe
von der Tubusrückseite (A) ab und schrauben Sie den Adapterring (B)
auf das gerade freigelegte, rückwärtige Tubus-Gewinde auf. Stecken
Sie den Mikrofokussierer (C) auf den Adapterring und ziehen Sie die drei
Inbusschrauben (K) mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel an. Hinweis:
Der Adapterring (B) befindet sich bei Auslieferung am SC-Adapter (L).
Weitere Hinweise finden Sie unter „SC-Sonderzubehör“ auf Seite 14.
Benutzer des 11/4" Zenitprismas (G) setzen den 11/4" Adapterring (D) in
den Mikrofokussierer ein und ziehen die Klemmschrauben (I) leicht an.
Benutzer des 2“ Zenitspiegels können diesen direkt in den
Mikrofokussierer stecken und mit den Klemmschrauben (I) sichern.
10
Display
11
Positioniergeschwindigkeit:
Speed 9: schnell .
.
Speed 5: mittel .
.
Speed 1: langsam
Pfeiltasten
Geschwindigkeitstaste
Nummerntasten
9
10
11
Ziehen Sie die Klemmungen für die RA- und die DEC-Achse handfest an.
Schalten Sie das Teleskop mit dem Hauptschalter auf dem
Anschlussboard ein („ON“). Auf dem Display der AutoStar-II Handbox
erscheint zunächst die Copyright-Meldung.
Zuerst werden die Software-Version und eine Startmeldung angezeigt.
Es erscheint nun die Meldung .
Nach Betätigen der Taste bis zur Anzeige vor-
MODE
MODE fuer Menue0 zur Ausr. oder
Objekt
gehen. Sie können nun das Teleskop mittels der Pfeiltasten nach rechts,
links, oben und unten bewegen. Um die jeweilige Geschwindigkeit zu
ändern, drücken Sie erst die -Taste und dann eine der
Zahlentasten: ist die geringste und die höchste
SPEED
1
SPEED
1
NGC
9
Geschwindigkeit. Weiteres wird auf Seite 17 beschrieben.
Entfernen Sie die Staubschutzkappe von der Tubusvorderseite. Stecken Sie
das 26mm SuperPlössl-Okular (F) in das Zenitprisma (G) und
ziehen Sie die Sicherungsschraube (E) leicht an. Peilen Sie an der Seite des
Tubus entlang, um ein Objekt zu lokalisieren. Drehen Sie die
Hauptspiegelklemmung (Abb. 1, Nr. 9) in die „Unlock“ Position (Offen), bis
sie freigängig ist. Nun kann das Objekt mit dem Fokussiertrieb (Abb. 1, Nr.
6) scharfgestellt werden. Üben Sie das Zentrieren von Objekten mittels der
Pfeiltasten der AutoStar-II Handbox.
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
7
Page 8

LX20 0 A C F
262mm / 10.3˝
254mm / 10˝
254mm / 10˝
Blendrohr
Antireflexprofil
Hauptspiegel
2
Fangspiegel
Korrektorplatte
Brenn-
ebene
Fangspiegelblende
1
Das optische System des
Meade Advanced Coma Free
OPTISCHES SYSTEM
Beim Advanced Coma Free-Design der Meade LX200ACF Teleskope tritt das Licht von rechts durch eine dünne,
beidseitig asphärisch geschliffene Korrekturplatte und wird vom sphärischen Hauptspiegel auf den asphärischen
Sekundärspiegel gelenkt. Dieser vervielfacht die effektive Brennweite des Systems und bildet den Fokus, indem das Licht
durch die zentrale Bohrung des Hauptspiegels geleitet wird.
Die Meade LX200ACF Modelle besitzen einen vergrößerten Hauptspiegel, was ein wesentlich größeres unvignettiert
ausgeleuchtetes Bildfeld zur Folge hat, als es mit einem normalen Hauptspiegel möglich wäre. Beachten Sie hier den
Strahl (2), der ohne einen vergrößerten Hauptspiegel verloren wäre. Dies führt zu ca. 10% besserer Ausleuchtung
außerhalb der optischen Achse gegenüber normalen Cassegrain-Systemen. Das Antireflexprofil, das auf der Innenseite
des Blendrohres angebracht ist, verhindert zuverlässig Reflexionen; hierdurch wird der Bildkontrast erheblich verbessert.
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
8
(c) nimax GmbH
Page 9

LX20 0 A C F
AUTOSTAR II
Merkmale des AutoStar-II
Erforschen Sie das Universum per Knopfdruck
Die Steuerung des LX200ACF erfolgt über die AutoStar-II Handbox. Nahezu alle
Funktionen können über einige wenige Tastendrücke bedient werden. Da der
AutoStar-II über einen sog. „Flash-Speicher“ verfügt, lassen sich neue Elemente
und Programme nachladen. Laden Sie sich aus dem Internet die aktuellsten
Bahndaten von Satelliten herunter oder aktualisieren Sie Ihr System, wenn neue
Software-Versionen verfügbar sind, direkt über www.meade.de oder
www.meade.com.
Einige der Hauptmerkmale des AutoStar-II sind:
• Automatisches Positionieren auf jedes der mehr als 147.500 Objekte
in der Datenbank, inklusive:
NGC-Objekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.840
IC-Objekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.386
Uppsala Galaxy Catalog . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.940
Morphological Catalog of Galaxies . . . . . . . . . 12.939
General Catalog of Variable Stars . . . . . . . . . . 28.484
SAO und Hipparcos Sternkataloge . . . . . . . . . 42.277
Draper Star Catalog (HD) . . . . . . . . . . . . . . . . . 21.127
Yale Bright Star Catalog (BSC5) . . . . . . . . . . . . 6.150
Large Bright Quasars Survey (LBQS) . . . . . . . . 1.055
Messier-Objekte (M) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Caldwell-Objekte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Objekte mit Eigennamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
Herschel-Objekte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400
Abell Galaxien-Haufen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.712
Arp unregelm. Galaxien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 645
Hauptplaneten (Merkur bis Pluto) . . . . . . . . . . . . . . . 8
Monddetails . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.870
Asteroiden und Kometen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Satelliten im Erdorbit. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Sternbilder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
• Unternehmen Sie einen Streifzug zu den jeweils schönsten
Himmelsobjekten für jeden Ta g des Jahres
• Steuern Sie Ihr LX200ACF vom PC aus via RS-232 Interface-Kabel
• Richten Sie das Teleskop automatisch mit GPS-Unterstützung aus
• Betreiben Sie das LX200ACF im azimutalen Modus mit automatischer
Nachführung aller Objekte in beiden Achsen
Der AutoStar-II ermöglicht die Kontrolle nahezu jeder Teleskopfunktion. Die
Handbox hat weiche, auch mit Handschuhen gut bedienbare Tasten. Das rot
hintergrundbeleuchtete LCD-Display stört nachts die Dunkeladaption Ihrer
Augen nicht. Zusammen mit der Tastenanordnung und der übersichtlichen,
hierarchischen Menüstruktur macht dies den AutoStar-II besonders benutzerfreundlich.
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
9
(c) nimax GmbH
Page 10

LX20 0 A C F
AUTOSTAR II
111
2
3
5
6
7
Abb. 2: AutoStar II Handbox
4
8
9
10
1
Zweizeiliges LCD-Display: Es zeigt die AutoStar-II Menüs und
Informationen über das Teleskop an. Obere Zeile: Anzeige des
Primärmenüs. Untere Zeile: Zeigt anwählbare Untermenüs,
Statusinformationen oder eine auswählbare Funktion.
2
ENTER
Enter-Taste: Hiermit wird die nächste Menüebene an- oder eine
Funktion ausgewählt. Die Funktion ist mit der “Return”-Taste einer
Computertastatur vergleichbar. Siehe auch Seite 18 und 24 für weitere
Informationen.
3
MODE
Mode-Taste: Hiermit gelangt man auf die nächsthöhere
Menüebene zurück (die oberste Ebene heißt „Auswahl“). Die Funktion
ist mit der „Escape“-Taste eines Computers vergleichbar. Hinweis:
Wiederholtes drücken der -Taste führt aus jeder Funktion auf die
„Auswahl“-Ebene zurück. Wenn die -Taste länger als ca. zwei
MODE
MODE
Sekunden gedrückt wird, wird die sogenannte Statusanzeige aufgerufen. Hier lassen sich dann mittels der -Tasten (7) folgende
p q
Daten anzeigen:
• Momentane Koordinaten in RA und DEC
• Momentane Koordinaten in AZ und EL
• Lokale Uhr- und Sternzeit
• Stoppuhr- und Wecker-Status
• Datum
• Koordinaten des Beobachtungsortes
• Batteriezustand
MODE
Mit kann man wieder auf die vorherige Menüebene zurückkehren.
4
GOTO
GO TO-Taste: Nach Betätigung dieser Taste fährt das Teleskop
das zuvor ausgewählte Objekt an. Während das Teleskop positioniert,
kann die Bewegung durch Betätigung irgendeiner anderen Taste (also
außer ) wieder gestoppt werden. Wird erneut gedrückt, wird
die Positionierung fortgesetzt. Wenn nach erfolgter Positionierung
GOTO GOTO
GOTO
gedrückt wird, startet das LX200ACF eine Spiralsuche um die
Zielkoordinaten herum. Weitere Informationen siehe Seite 20.
5
Pfeiltasten: Diese haben mehrere Funktionen. Sie bewegen das
Teleskop bei azimutaler Aufstellung horizontal (AZ) bzw. vertikal (EL) in
die angezeigte Richtung. Bei parallaktischer Aufstellung erfolgt die
Bewegung entsprechend in RA und DEC. Darüber hinaus können die
Auf/Ab-Tasten als Auswahltasten bei Werteeingaben und die
Links/Rechts-Tasten als Cursortasten bei der Auswahl von Buchstaben
oder Ziffern genutzt werden.
6
Zifferntasten: Hiermit können Ziffern von 0 bis 9 eingegeben werden.
Desweiteren hat jede Taste auch eine Schnellzugriffsfunktion (siehe
auch Seite 31):
SPEED
1
SPEED: Setzt die Positionier-Geschwindigkeit für die
Pfeiltasten. Betätigen Sie *SPEED* und dann eine
Taste zwischen 1 (geringste) und 9 (höchste
CALD
2
CALD: Hiermit wird der Caldwell-Objektkatalog aufge-
M
3
M Hiermit wird der Messierkatalog aufgerufen.
FOCUS
4
FOCUS: Aufruf des Steuermenüs für den Mikrofokussierer.
SS
5
SS: Aufruf des Objektkatalogs „Sonnensystem“.
STAR
6
STAR: Aufruf der Sterndatenbank.
Geschwindigkeit)
rufen.
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
10
(c) nimax GmbH
Page 11

LX20 0 A C F
RET
7
RET: Aufruf des Kontrollmenüs für die Fadenkreuz-
I.C.
8
I.C.: Aufruf des Index Katalogs.
NGC
9
NGC: Aufruf des New General Catalogs.
LIGHT
0
LIGHT: Hiermit wird die rote Leseleuchte an der Stirnseite
AUTOSTAR II
beleuchtung. (Reticle)
der Handbox ein- und ausgeschaltet.
7
8
9
10
11
qp
SCROLL-Tasten: „Scroll“ = Blättern. Hiermit lassen sich
einzelne Optionen innerhalb eines Menüs anwählen; diese werden in der
unteren Zeile angezeigt. Bei längerer Betätigung der Tast e wird mit
höherer Geschwindigkeit durch die Punkte „gescrollt“. Desweiteren wird
mit den -Tasten die Geschwindigkeit des Lauftextes einge-
qp
stellt.
?
-Taste: Hiermit wird die Hilfedatei angezeigt; sie gibt weitere
Erläuterungen zum jeweils aufgerufenen Menü. Hierbei handelt es sich
im Grunde um eine kompakte Online-Bedienungsanleitung, die in jedem
Bedienungsschritt des Teleskops aufgerufen werden kann. Mit einem
Druck auf die -Taste kann das Hilfemenü wieder verlassen werden.
MODE
Kabelanschluss: Hier wird das Spiralkabel angeschlossen (10), das zur
„HBX“-Buchse (Abb. 1, F) des Teleskop-Sockels führt.
Spiralkabel: Verbindet die Handbox mit dem Teleskop.
LED: Mit dieser Leseleuchte können bei Dunkelheit Sternkarten und
Zubehörteile beleuchtet werden, ohne die Dunkeladaption Ihrer Augen
zu stören. Sie wird mit der Ta ste ein- und ausgeschaltet.
LIGHT
0
LX200ACF Tipps:
Werden Sie Mitglied in einem astronomischen Verein.
Besuchen Sie ein Teleskoptreffen!
Eine besonders angenehme Weise in die Astronomie einzusteigen besteht
darin, einem Astronomischen Verein beizutreten. Schauen Sie in Ihrer lokalen
Zeitung, bei Ihrem Teleskophändler oder im Internet z.B. unter www.astronomie.de/gad nach, ob sich in Ihrer Nähe eine entsprechende Organisation
befindet. Bei Vereinstreffen werden Sie andere astronomisch Begeisterte finden, mit denen Sie sich austauschen können. Diese Vereine bieten eine vorzügliche Möglichkeit, die Himmelsbeobachtung näher kennen zu lernen. Sie
erfahren dort, wo sich die besten Beobachtungsplätze befinden und wie sich
Teleskope und Zubehörteile am besten einsetzen lassen. Oft finden sich unter
den Vereinsmitgliedern auch exzellente Astrofotografen. Bei diesen werden
Sie nicht nur Beispiele deren Könnens betrachten, sondern sich auch viele
nützliche Tricks und Hinweise abschauen können. Diese können Sie dann an
Ihrem LX200ACF ausprobieren. Auf Seite 40 erfahren Sie mehr über die
Fotografie mit dem LX200ACF. Viele Gruppen veranstalten auch regelmäßig
Teleskoptreffen, bei denen Sie zahlreiche verschiedene Teleskope begutachten können. Einschlägige Zeitschriften wie z.B. „Sterne und Weltraum“,
„Interstellarum“ oder „Astronomie heute“ kündigen derartige Ereignisse in der
Regel in ihrem Veranstaltungskalender so manches Teleskoptreffen an.
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
11
Page 12

LX20 0 A C F
AUFBAU
Aufbau
1
4
2
3
6
Lieferumfang
Um das Teleskop für die Beobachtung vorzubereiten, bedarf es nur weniger
Minuten. Beim ersten Öffnen des Versandkartons prüfen Sie bitte den Inhalt auf
Vollständigkeit:
1. LX200ACF-Teleskop mit Gabelmontierung (Abb. 1)
2. AutoStar-II Handbox mit Spiralkabel (Abb. 2) und Handboxhalterung (Abb. 1, 14)
3.
Mikrofokussierer (optionales Zubehör – nur beim 16˝ Modell im Lieferumfang enthalten)
4. 8x50 Sucherfernrohr mit Halter (Abb. 1, 22)
5. 11/4" Zenitprisma und 11/4" Adapter (Abb. 1, 3) - 16" Modell mit 26mm Plössl-Okular
6. 26mm SuperPlössl-Okular mit Aufbewahrungsbox (Abb. 1, 1)
7. Felddreibeinstativ, höhenverstellbar (Abb. 3)
8. Ein Satz zöllige Inbusschlüssel, Betriebsanleitung sowie die AutoStar-Suite (AE)
Software
5
Abb. 3: Felddreibeinstativ
1
Stativkopf
2
Gewindestange
3
Spindelschraube
4
Spreizspange
5
Klemmhebel
6
6
Versteifungsspinne
Spreizspange
Versteifung
nicht
nach
oben!
Abb. 4: Montage des Teleskops
auf dem Stativ.
Bitte beachten sie die Lage der
Spreizspange. Spindelschraube nie
ohne oder mit falsch montierter
Spreizspange einschrauben!
Montage des Teleskops auf dem Stativ
Die Gabelmontierung wird bei azimutaler Aufstellung direkt auf dem Stativ
aufgesetzt. Das Stativ kann auch in Kombination mit der als Sonderzubehör
erhältlichen Polhöhenwiege (siehe Seite 51) für die Langzeit-Astrofotografie
genutzt werden. Hierdurch wird eine parallaktische Aufstellung mit Ausrichtung
auf den Himmelspol realisiert.
1. Nehmen Sie das Stativ aus dem Versandkarton. Stellen Sie es senkrecht mit den Füßen auf den Boden, aber lassen Sie die Beine noch
zusammen geschoben. Fassen Sie nun zwei der Beine so, dass das
Stativgewicht auf dem dritten Bein lastet und ziehen Sie die beiden
Beine im 120°-Winkel bis zur vollen Öffnung auseinander.
2. Die drei Klemmhebel sichern die inneren, ausziehbaren Beine. Hinweis:
Handfestes Anziehen ist ausreichend! Überdrehen kann sowohl die
Klemmschrauben als auch die Stativbeine beschädigen und führt zu
keiner höheren Standfestigkeit!
3. Ziehen Sie die Gewindestange (Abb. 3, Nr. 2) aus dem Stativkopf (Abb.
3, Nr. 1) heraus und entfernen sie die Kunststofffolie, die zur
Transportsicherung übergezogen ist (beim Großstativ befindet sich die
Gewindestange im Boden des Versandkartons).
4. Setzen Sie die Spreizspange (Abb. 4) auf die Gewindestange und stekken Sie diese von unten durch den Stativkopf. Die Spreizspange muss
dabei so positioniert werden, dass ihre Arme an den Stativbeinen anliegen.
ACHTUNG: Montieren Sie die Spreizspange nicht
verkehrt herum – dadurch würde die Gewindestange
zu weit in den Teleskop-Sockel eingeschraubt und dort
gravierende Schäden anrichten, die durch die Garantie
nicht gedeckt sind – siehe Abb. 4!
Platzieren Sie nun die beiden mitgelieferten Rändelmuttern im oberen
Drittel der Gewindestange. Hierdurch wird ein Herausfallen der Stange
aus dem Stativkopf verhindert.
5. Die Stativbeine sind nicht völlig verwindungssteif. Sollte der
Stativkopf nach dem Aufstellen nicht gerade sein, so drücken sie
die Stativbeine etwas zur Seite, bis der Stativkopf gerade ist.
6. Nehmen Sie das Teleskop aus der Verpackung und setzen Sie es auf
den Stativkopf. Drehen Sie die Gewindestange in den Teleskop-Sockel
ein und ziehen Sie sie handfest an (Abb. 4). Hierdurch werden sowohl
das Teleskop gesichert als auch das Stativ verspannt – das
Gesamtsystem erhält dadurch einen erheblichen Teil seiner Stabilität.
7. Um die Stativhöhe einzustellen, lockern Sie die sechs Klemmhebel am
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
12
(c) nimax GmbH
Page 13

Hinweis: Das Stativ lässt sich
ohne Kraftaufwand aufstellen
und zusammenlegen. Falls dies
nicht gelingen sollte, wenden
Sie bitte keinesfalls Gewalt an;
hierdurch würde die Mechanik
beschädigt werden. Bei genauer
Befolgung der obigen Punkte ist
ein leichtgängiger Umgang mit
dem Stativ in jedem Fall gewährleistet. Bitte achten Sie auch
darauf, dass die Spreizspange
(Abb. 3, Nr. 4) richtig herum ein-
gesetzt wird!
Abb. 5: Batteriemontage
ACHTUNG: Setzen Sie die
Batterien mit Sorgfalt so ein, wie
es in den Batteriehaltern symbolisch dargestellt ist. Beachten Sie
die Anweisungen des Batterieherstellers. Setzen Sie die Batterien nicht verkehrt herum ein und
kombinieren Sie nicht alte mit
neuen Batterien. Mischen Sie
auch nicht Batterien verschiedenen Typs. Wenn diese Hinweise
nicht beachtet werden, können
Batterien auslaufen, Feuer fangen
oder gar explodieren. Schäden,
die hierdurch verursacht werden,
fallen nicht unter die Gewährleistung. Wenn das Teleskop für
längere Zeit nicht benutzt wird,
sind die Batterien zu entnehmen.
LX20 0 A C F
AUFBAU
unteren Ende der Stativbeine, ziehen die Stativbeine bis zur gewünschten Länge heraus und ziehen die Klemmhebel wieder handfest an.
Zum Zusammenlegen des Stativs gehen Sie bitte wie folgt vor, nachdem das
Teleskop bzw. die Polhöhenwiege vom Stativkopf abgenommen worden sind:
1. Nehmen Sie das Teleskop bzw. die Polhöhenwiege vom Stativkopf ab.
2. Drehen Sie die Spreizspange um ca. 60°, so dass die Arme der Spange
zwischen die Stativbeine zeigen.
3. Zwischen den drei Ausziehpositionen der Stativbeine befindet sich eine
dreiarmige Versteifungsspinne mit einer runden Nabe in der Mitte (Abb.
3, Nr. 6). Ergreifen Sie mit der einen Hand den Stativkopf (Abb. 3, Nr. 1)
und mit der anderen die Nabe. Ziehen Sie nun die Nabe nach oben –
das Stativ zieht sich nun von alleine zusammen.
Zusammenbau des Teleskops
Für die Spannungsversorgung sind acht Batterien des Typs „C“ erforderlich
(nicht im Lieferumfang enthalten). Alternativ können auch das Netzteil #547F
oder das Autobatteriekabel #607 verwendet werden (siehe Sonderzubehör,
Seite 43). Diese werden am 12V-Anschluss (Abb. 1, Nr. 13 B) eingesteckt.
1. Einsetzen der Batterien: Richten Sie den Tubus des LX200ACF waagerecht aus. Öffnen Sie die Batteriefächer (Abb. 1, Nr. 8) und setzen Sie
jeweils vier Batterien in die Halter ein. Anmerkung: Besitzer des 14"
Modells beachten bitte Seite 70 für die Batterieinstallation. Legen Sie
nun die Batteriehalter, wie in Abb. 5 gezeigt, wieder in die Gabelarme ein
und schließen Sie die Abdeckungen (S.1, 8).
2. Anschluss der AutoStar-II Handbox: Stellen Sie sicher, dass der
Hauptschalter (Abb. 1, Nr. 13 A) auf „OFF“ steht (AUS). Stecken Sie nun
das Spiralkabel in die „HBX“-Buchse ein (Abb. 1, Nr. 13 F).
F
E
oder
C
L
B
A
Hinweis: Benutzer eines
LX200ACF 14” lesen bitte auf
Seite 70 die Installation der
Batterien nach.
G H
D
I
J
K
3. Montage des optionalen Mikrofokussierers (bei 16˝ Modell im
Hinweis: Die AutoStar-II
Handbox und der Mikrofokussierer benötigen keine
Batterien! Beide werden vom
Teleskop mit Strom versorgt.
Lieferumfang enthalten): Nehmen Sie die Staubschutzkappe von der
Tubusrückseite (Abb. 6 A) ab und schrauben Sie den Adapterring (Abb.
6 B) auf das gerade freigelegte, rückwärtige Tubus-Gewinde auf.
Stecken Sie den Mikrofokussierer (Abb. 6 C) auf den Adapterring und
ziehen Sie die drei Inbusschrauben (Abb. 6 K) mit dem mitgelieferten
Inbusschlüssel an. Hinweis: Der Adapterring (Abb. 6 B) befindet sich bei
Auslieferung am SC-Adapter (Abb. 6 L).
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
Abb. 6
13
Page 14

Aussparung
LX20 0 A C F
AUFBAU
4. Anbringen von Zenitprismen und anderem Zubehör: Das 11/4"
Zenitprisma (S.13 Abb. 6 G) wird mittels des Adapters (S.13 Abb. 6 D)
in den Mikrofokussierer eingesetzt. Achten Sie darauf, dass die
Klemmschraube des Adapters (S.13 Abb. 6 I) in der Aussparung am
Mikrofokussierer (S.13 Abb. 7a und b) laufen kann. Ziehen Sie die
Klemmschrauben (S.13 Abb. 6 H) handfest an.
Abb. 7: Mikrofokussierer
Aussparung Deckung
Abb. 8
Abb. 9: Mikrofokussierer am
LX200ACF 10˝
A B
C
Abb. 10: Handbox-Halterung
Anderes SC-Zubehör wie z.B. Off-Axis-Guider, Kameraadapter, etc.
werden mittels des SC-Adapters (Abb. 6 L) angebracht. Setzen Sie diesen so ein, dass eine Klemmschraube des Mikrofokussierers in die
Aussparung am SC-Adapter passt (Abb. 8a und b) und ziehen Sie dann
beide Klemmschrauben handfest an.
Der 2˝ Zenitspiegel kann ohne Adapter direkt in den Mikrofokussierer
gesteckt und mit den Klemmschrauben gesichert werden.
Der Mikrofokussierer selbst wird in die entsprechende Buchse am
Anschlussboard (Abb. 1, Nr. 13 C) eingesteckt. Anmerkung: Wenn eine
Kamera direkt am Mikrofokussierer angeschlossen werden soll, benötigen Sie einen optionalen T-Adapter (siehe Seite 42).
ACHTUNG: Der Mikrofokussierer ist im Werk sorgfältig
justiert worden. Wenn es im Laufe der Zeit einmal notwendig
werden sollte, diesen nachzujustieren, so darf dies nur durch
Fachpersonal erfolgen. Schäden, die durch nicht von Meade
autorisierte Eingriffe am Gerät erfolgten, fallen nicht unter die
Garantie bzw. Gewährleistung.
5. Okular einsetzen: Entnehmen Sie das 26mm Plössl-Okular (Abb. 1, Nr.
1) aus seiner Box und setzen Sie es in das Zenitprisma bzw. den
Zenitspiegel ein. Ziehen Sie die Klemmschraube handfest an. Vor der
Grobfokussierung muss in jedem Fall die Hauptspiegelklemmung (Abb.
1, Nr. 9) gelöst werden!
6. Staubschutzdeckel entfernen: Ziehen Sie den Staubschutzdeckel (Abb.
1, Nr. 18) nach vorne vom Tubus ab.
7. Anbau der Handbox-Halterung: Falls notwendig, lösen Sie die
Klemmschraube (Abb. 10, A) und setzen Sie die Klammer (Abb. 10, B)
an einen der Haltegriffe (Abb. 1, Nr. 15) an. Nun die Klemmschraube
handfest anziehen. Die Handbox kann entweder von oben in den Halter
eingeführt oder von vorne eingeschnappt werden (Abb. 10, C).
Nachdem die Klemmschraube leicht gelöst wurde, kann der Winkel des
Halters so eingestellt werden, dass die Handbox stets in einem bequemen Blick- und Bedienwinkel zum Benutzer liegt.
Auswahl des Okulars
Das Okular eines Teleskops vergrößert das Bild der Hauptoptik und macht es für
Abb. 10a: 26mm Super Plössl-
Okular der Serie 4000
Abb. 10b: 26mm Plössl-Okular
(nur beim 16˝ Modell enthalten)
14
der Serie 5000
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
den Betrachter sichtbar. Jedes Okular hat eine eigene Brennweite, die in mm
angegeben wird. Je geringer dieser Wert ist, desto höher ist die Vergrößerung,
die erzielt wird. So hat beispielsweise ein 9mm-Okular eine fast 3x höhere
Vergrößerung als ein 26mm-Okular. Ihr LX200ACF wird mit einem 26mm
SuperPlössl-Okular ausgeliefert, das ein großes, gut überblickbares Bildfeld bei
gleichzeitig guter Auflösung bietet. Okulare mit niedriger Vergrößerung
bieten große Gesichtsfelder, hohen Kontrast und einen angenehmen Augenabstand für lange Beobachtungen. Um ein Objekt aufzusuchen, sollte stets mit
einem niedrig vergrößernden Okular begonnen werden. Wenn das Objekt zentriert ist, kann zu höher vergrößernden Okularen gewechselt werden, sofern die
momentanen atmosphärischen Bedingungen („Seeing“) dies zulassen. Weitere
Informationen über gut zu Ihrem Teleskop passende Okulare finden Sie auf Seite
41.
(c) nimax GmbH
Page 15

Führungsschiene
Führung
Justier-
schrauben
Abb. 11: Suchermontierung
LX20 0 A C F
AUFBAU
Die Vergrößerung eines optischen Systems wird von der Brennweite des
Teleskops und der Brennweite des Okulars bestimmt. Um die Vergrößerung zu
berechnen, dividiert man die Brennweite des Teleskops durch die Brennweite
des Okulars. Die Brennweite Ihres Teleskops ist objektivseitig aufgedruckt und
findet sich zusätzlich unter den technischen Daten ab Seite 47.
Ein Beispiel: 8" LX200ACF, Okular 26mm SPL
2000mm / 26mm = 77
Die Vergrößerung beträgt also 77x
Eine Auflistung der Vergrößerungen von Teleskop-Okular-Kombinationen finden
Sie auf Seite 41.
GPS
Antenne
Abb. 12: Sucherjustierung
Abb. 13: Beispiel für gut gewählte
Vergrößerung (links) und schlecht
gewählte Vergrößerung (rechts)
Justier-
schrauben
Sucherokular
Hinweis: Bei einigen
Modellen befindet sich
hinten links statt einer
Justierschraube eine Kon-
terschraube.
Montage und Justierung des Suchers
Um den Sucher zu justieren, befolgen Sie die Schritte 1 bis 5 am besten tagsüber, Schritt 6 nachts.
1. Schieben Sie den Sucherhalter mit seiner Führung von vorne nach
hinten in die Führungsschiene des Halters am Teleskop, siehe Abb. 11.
Ziehen die Halteschrauben handfest an.
2. Falls noch nicht geschehen, setzen Sie das Okular in das Zenitprisma
des Teleskops ein.
3. Lösen Sie die RA- und DEC-Klemmungen, so dass sich das Teleskop
frei bewegen lässt.
4. Richten Sie das Teleskop auf einen markanten Punkt in mindestes 200m
Entfernung, z.B. einen Telegrafenmast, ein Verkehrsschild oder eine
Kirchturmspitze. Zentrieren Sie das Objekt in der Mitte des okularen
Gesichtsfelds und ziehen Sie die beiden Achsklemmungen wieder an.
5. Blicken Sie nun durch das Okular des Suchers (Abb. 12) und stellen Sie
den Sucher mit den 6 Justierschrauben so ein, dass das Zentrum des
Suchergesichtsfelds mit dem Zentrum des Teleskopgesichtsfelds
deckungsgleich ist.
6. Überprüfen Sie die Justierung an einem Himmelsobjekt, z.B. einem
markanten Stern, und führen Sie ggf. notwendige Feineinstellungen
durch.
LX200ACF Tipps:
Zu hohe Vergrößerung?
Kann man überhaupt zu hoch vergrößern? Ja! Einer der häufigsten
Fehler, der von Anfängern in der Astronomie gemacht wird, ist die Wahl einer
Vergrößerung, die der Öffnung des Teleskops oder den aktuellen Seeing-Bedingungen nicht mehr gerecht wird. Bedenken Sie, dass niedrigere Vergrößerungen gerade bei stärkerer Luftunruhe ruhigere und schärfere Bilder liefern
als zu hohe Vergrößerungen (siehe Abb. 13). Vergrößerungen über 400x
sollten nur unter absolut ruhigen atmosphärischen Bedingungen gewählt
werden. Der AutoStar-II kann Ihnen zum Objekt passende Okulare vorschlagen. Probieren Sie einmal den Okularrechner im Zubehörmenü aus!
Viele Beobachter besitzen drei oder mehr Okulare, um einen vernünftigen Ver-
größerungsbereich abzudecken. Geeignete Okulare finden Sie auf Seite 41.
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
15
Page 16

HINWEIS: Objekte, die durch
den Sucher gesehen werden,
erscheinen auf dem Kopf stehend und seitenverkehrt.
Objekte, die durch das Okular
beobachtet werden, das über
ein Zenitprisma am Teleskop
befestigt ist, erscheinen zwar
aufrecht, aber noch seitenverkehrt. Bei der Beobachtung von
astronomischen Objekten stört
dieser Effekt nicht. Im Übrigen
treten diese Effekte bei allen
astronomischen Teleskopen auf.
Während der Erdbeobachtung,
bei der aufrechte und seitenrichtige Bilder gewünscht sind,
muss ein #928 45° Amici-Prisma
eingesetzt werden. Sehen Sie
hierzu auf Seite 42 für optionalen
Zubehör nach.
LX20 0 A C F
Beobachten
Beobachten mit dem LX200ACF
Beobachten mittels manueller Teleskopbewegung
Wenn Sie ein entferntes Landobjekt, wie z.B. eine Bergspitze oder einen Vogel
beobachten möchten, können Sie dies am besten mittels manueller Teleskopbewegung, während Sie durch das Okular oder den Sucher blicken.
1. Lösen Sie die RA und DEC-Klemmung (Abb. 1, Nr. 12 + 17).
2. Bewegen Sie das Teleskop, bis das gewünschte Objekt im Bildfeld
erscheint.
3. Ziehen Sie nun die RA- und DEC-Klemmungen wieder an.
4. Nun können Sie das Teleskop mittels der manuellen Feinbewegungen
steuern (Abb. 1, Nr. 10 + 16) erfolgen. In RA ist hierbei die Klemmung
etwas zu lösen, in DEC nicht!
5. Die Bildschärfe kann mit dem Fokussierknopf (Abb. 1, Nr. 6) eingestellt
werden. Die Hauptspiegelklemmung vorher lösen (Abb. 1, Nr. 9)!
Auf die gleiche Weise können auch Himmelsobjekte beobachtet werden.
Beachten Sie jedoch, dass diese sich aufgrund der Erddrehung langsam aus
dem Gesichtsfeld heraus bewegen. Dies kann durch die Auto-Track-Funktion
des AutoStar-II kompensiert werden; siehe hierzu auch Seiten 18 und 20.
W A R N U N G !
Verwenden Sie niemals ein Teleskop für
einen ungeschützten
Blick auf die Sonne! Sobald Sie
direkt in die Sonne oder auch
nur in ihre unmittelbare Umgebung blicken, riskieren Sie sofortige und unheilbare Schäden
in Ihrem Auge. Diese Schädigung des Auges geschieht zumeist schmerzfrei und deshalb
ohne jede Warnung an den Beobachter, dass vielleicht alles
schon zu spät ist und dass sich
ein Augenschaden ereignet hat.
Richten Sie deshalb niemals das
Fernrohr oder dessen Sucher
auf oder neben die Sonne. Blicken Sie niemals durch das
Teleskop oder dessen Sucher,
sobald es sich bewegt. Während
einer Beobachtung müssen
Kinder zu jeder Zeit unter der
Aufsicht Erwachsener bleiben.
Erdbeobachtung
Die LX200ACF Teleskope sind auch für hochauflösende terrestrische
Beobachtungen geeignet. Bei terrestrischen Objekten „blickt“ das Teleskop
durch bodennahe Luftschichten, die durch die Sonnenwärme Turbulenzen
bilden. Diese werden zwangsläufig durch das Okular mitvergrößert, was
unscharfe und verschwommene Bilder zur Folge hat; je höher die Vergrößerung,
desto „verwaschener“ das Bild. Dies kann durch die Verwendung niedrig vergrößernder Okulare, z.B. dem 26mm Plössl, vermindert werden.
Beobachtungen in den Morgenstunden, bevor die Sonne den Boden aufgeheizt
hat, sind günstiger als Beobachtungen in den Nachmittagsstunden.
Beobachtungen unter Nutzung der AutoStar-Pfeiltasten
Das Teleskop kann auch bei terrestrischen Beobachtungen mit den Pfeiltasten
der AutoStar-II Handbox bewegt werden.
1. Ziehen Sie die RA- und DEC-Klemmungen an.
2. Stellen Sie sicher, dass die AutoStar-II Handbox an das Teleskop angeschlossen ist.
3. Schalten Sie das Teleskop ein. Das AutoStar-II Computersystem startet
und zeigt zunächst eine Copyright-Meldung auf dem Display. Der
AutoStar-II benötigt ein paar Augenblicke, um sich zu initialisieren und
Selbsttests durchzuführen.
4. Eine Sonnenwarnung erscheint auf dem Display; diese kann mit der
angegebenen Taste quittiert werden.
5. erscheint auf dem Display.
Drücken Sie , um das Menü zu verlassen.
6. Die Pfeiltasten sind nun aktiv. Mit diesen kann nun das Teleskop in alle
vier Richtungen bewegt werden.
7. Um die Positioniergeschwindigkeit zu ändern, drücken Sie erst die
SPEED
1
-Taste und anschließend eine Zifferntaste zwischen 1 und 9 (
für geringste, für maximale Geschwindigkeit).
8. Mit dem Sucher können Objekte mit höherer Geschwindigkeit vorzentriert und anschließend im Teleskop bei niedriger Geschwindigkeit
nachzentriert werden.
9. Stellen Sie das Objekt scharf (siehe folgende Seite).
MODE
NGC
MODE fuer Menue0 zur Ausr. oder
SPEED
9
1
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
16
(c) nimax GmbH
Page 17

LX20 0 A C F
Beobachten
Fokussieren mit dem Mikrofokussierer (optional)
Der shiftingfreie Mikrofokussierer des LX200ACF (Abb. 1, Nr. 24) ermöglicht ein
äußerst präzises Scharfstellen sowohl für visuelle Anwendungen als auch für
konventionelle und CCD-Fotografie. Objekte bleiben während des Fokussierens
selbst auf kleinsten CCD-Detektoren zentriert.
Benutzung des Mikrofokussierers
1. Führen Sie diesen ersten Punkt im Hellen ohne angeschlossene
Okulare, etc. durch. Drücken Sie am AutoStar die *FOCUS*-Taste und
anschließend die Auf- oder Ab-Pfeiltasten. Beachten Sie, wie sich der
Auszug des Fokussierers bewegt. Wenn eine Endstellung erreicht wird,
ändert sich das Motorgeräusch. Der maximale Hub beträgt ca. 10mm;
stellen Sie den Fokussierer so ein, dass er auf etwa der Hälfte des
Hubweges steht.
2. Schließen Sie nun Ihr visuelles oder fotografisches Zubehör an; siehe
hierzu auch Seiten 13 und 14.
3. Richten Sie das Teleskop auf ein Objekt.
4. Lösen Sie die Hauptspiegelklemmung und betätigen Sie den manuellen
Grobfokussierer, bis das Objekt in etwa scharf ist.
5. Nun wird die Hauptspiegelklemmung wieder handfest angezogen; der
Hauptspiegel bleibt jetzt in seiner Position fixiert.
6. Drücken Sie die -Taste. „Focus-Steuerung Geschw.=schnell“
erscheint auf dem Display. Mittels der -Tasten können Sie
verschiedene Geschwindigkeiten anwählen und anschließend mit
übernehmen. Alternativ lassen sich die Geschwindigkeiten auch mittels
der Zifferntasten vorgeben:
1 oder 2 = fein
3,4 oder 5 = langsam
6 oder 7 = mittel
8 oder 9 = schnell
7. Mittels der Pfeiltasten kann nun der Stern exakt scharfgestellt werden.
8. Beim Wechsel von Zubehör oder Okularen muss dieser Vorgang ggf.
wiederholt werden.
FOCUS
4
qp
ENTER
Tipp: Die langsamste Geschwindigkeit – 1x siderisch, die
Nachführgeschwindigkeit – kann
mit dem Menü „Nachführgeschw.“ geändert werden. Hier
haben Sie die Möglichkeit, einen
prozentualen Wert (kleiner/größer 100%) einzugeben. Dies
kann bei der Nachführung während der CCD-Fotografie oder
bei der Langzeitfotografie nützlich sein. Siehe hierzu auch auf
Seite 38 der Absatz „Nachführ-
geschwindigkeit“.
Positioniergeschwindigkeiten
Der AutoStar-II hat neun verschiedene Positionier-Geschwindigkeiten („slewing
speeds“), die jeweils proportional zur Sterngeschwindigkeit und zur Erfüllung
spezieller Funktionen dimensioniert sind. Nach einem Druck auf die -Taste
kann über die Zifferntastatur eine Geschwindigkeit ausgewählt werden; diese
bleibt für ca. zwei Sekunden im Display stehen und wird dann automatisch
übernommen. Diese neun Geschwindigkeiten sind verfügbar:
SPEED
1
= Guide (programmierbar, siehe Seite 30)
CALD
2
= 2x = 2fache Sterngeschwindigkeit oder 0,008°/s
M
3
= 4x = 8fache Sterngeschwindigkeit oder 0,033°/s
FOCUS
4
= 16x = 16fache Sterngeschwindigkeit oder 0,067°/s
SS
5
= 64x = 64fache Sterngeschwindigkeit oder 0,27°/s
STAR
6
= 128x = 30 Bogenminuten / Sekunde oder 0,5°/s
RET
7
= 1,5° = 1,5°/s
I.C.
8
= 3° = 3°/s
NGC
9
= Max = 8°/s
Die Geschwindigkeiten 1, 2 und 3 sind am besten geeignet, um ein Objekt in
einem hoch vergrößernden Okular (ab z.B. 200facher Vergrößerung) zu zentrieren.
Die Geschwindigkeiten 4, 5 oder 6 können gut zum Zentrieren in schwächeren
Okularen (z.B. 70 bis 120fach) benutzt werden.
Geschwindigkeit 7 oder 8 ist gut geeignet, um ein Objekt grob im Sucher zu
zentrieren.
Geschwindigkeit 9 ist für schnelle Bewegungen über den Himmel, von einem
Punkt zum anderen.
SPEED
1
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
17
Page 18

Erläuterung: Die Initialisierung ist ein Prozess, der sicherstellt, dass der Autostar-II korrekt arbeitet. Er ist nicht mit der
Initialisierung nach dem Einschalten des Autostar-II zu verwechseln, bei der das Betriebssystem geladen wird. Wenn Sie
den Autostar-II Handcomputer
das erste mal benutzen, kennt er
weder Uhrzeit und Datum, noch
die Koordinaten Ihres Beobachtungsstandortes. Während der
„Ein-Stern Ausrichtung“, der
„Zwei-Stern Ausrichtung“ oder
der „Einfachen Ausrichtung“
geben Sie diese Daten in den
Handcomputer ein. Während
der automatischen Ausrichtung
bekommt der Handcomputer
diese Daten vom GPS-Satelliten.
Der Autostar-II verwendet diese
Informationen, um die Position
von Himmelsobjekten (wie z. B.
Sterne und Planeten) exakt zu
berechnen und um Ihr Teleskop
für verschiedenste Anwendungen korrekt zu bewegen.
Tipp: Wenn in einem Menüpunkt mehrfache Auswahlmöglichkeiten vorhanden sind, dann
wird die gerade aktive Option mit
einem Pfeil > gekennzeichnet.
HINWEIS: Möchten Sie die
automatische Ausrichtung
abbrechen, so drücken Sie eine
beliebige Taste. Es erscheinen
dann die Eingabeaufforderungen für die manuelle Ausrichtung:
Datum, Uhrzeit, usw. Folgen Sie
den Eingabeaufforderungen
oder drücken Mode bis
Auswahl:
Objekt
erscheint.
WICHTIGER HINWEIS: Der
Menüpunkt „SOMMERZEIT“
aktiviert oder deaktiviert die Zeitdifferenz von 1 Stunde. Denken
Sie daran, diese Funktion an den
beiden Tage n im Jahr ein- bzw.
auszuschalten, an denen die
Uhrzeit umgestellt wird. Lesen
Sie hierzu auch im LX200ACFTipp auf Seite 23 nach.
LX20 0 A C F
Beobachten
Beobachtung des Mondes
Richten Sie Ihr Teleskop auf den Mond aus und üben Sie die Benutzung der
Pfeiltasten, des Mikrofokussierers und der verschiedenen Positioniergeschwindigkeiten, um die vielen verschiedenen Details des Mondes zu betrachten. Die
beste Zeit hierfür ist während der Halb- und Viertelphasen des Mondes, wenn
das Sonnenlicht in flachem Winkel auf die Mondoberfläche fällt und so eine
Unmenge von Kratern, Bergen und Rillen plastisch hervorhebt. Während der
Vollmondphase ist dieser eher uninteressant, da durch das senkrecht auffallende Licht kaum Kontraste entstehen und die Details im Licht „ertrinken“. Ziehen
Sie auch die Anschaffung eines Mondfilters in Erwägung (siehe Zubehör auf
Seite 42); er reduziert nicht nur die manchmal große Helligkeit, sondern verstärkt
auch die Kontrastwirkung.
Astronomische Beobachtungen
Als astronomisches Instrument eingesetzt hat das LX200ACF vielfältige optische und elektromechanische Möglichkeiten. Die astronomischen Bedingungen
sind es erst, die ein Teleskop seine volle Leistungsfähigkeit darstellen lassen; die
hier bestehenden Möglichkeiten werden letztlich nur durch den Beobachter
bzw. den Fotografen begrenzt.
Automatische Nachführung
Bedingt durch die Rotation der Erde scheinen die Sterne sich stets von Ost nach
West über den Himmel zu bewegen. Die Geschwindigkeit, mit der sie dies tun,
wird als Sterngeschwindigkeit oder auch siderische Geschwindigkeit bezeichnet. Das Teleskop kann so eingerichtet werden, dass es jedem Himmelsobjekt
automatisch folgt und es im Okular hält; würde es dies nicht tun, so würden
Objekte aus dem Gesichtsfeld driften. Um die Objekte automatisch nachführen
lassen zu können, muss das LX200ACF initialisiert und ausgerichtet werden.
Umgang mit den AutoStar-II Menüs
Die Datenbank des AutoStar-II ist in Menüebenen aufgebaut, um ein schnelles
und einfaches Navigieren zu ermöglichen.
• Mit der -Taste wird eine Auswahl bestätigt bzw. eine tiefere
Menüebene angezeigt.
• Mit der -Taste bewegt man sich in den Menüebenen wieder nach
ENTER
MODE
oben.
• Mit den -Tasten können verschiedene Optionen angewählt
werden. Die jeweils aktive Option (Bestätigung durch ) ist mit
qp
ENTER
einem kleinen Pfeil „>“ markiert.
• Mit den Pfeiltasten kann sowohl das Teleskop bewegt werden als auch
eine Werteauswahl in Form von Ziffern und Buchstaben erfolgen.
• Mit den Zifferntasten können ebenfalls direkt Zahlen eingegeben
werden.
Automatische Ausrichtung
Der AutoStar-II bietet verschiedene Methoden zur azimutalen Ausrichtung des
Instruments an. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie das LX200ACF mit
der automatischen Ausrichtung in Betrieb genommen wird. Alternative
Ausrichtungen werden auf den Seiten 37f beschrieben; die polare
(parallaktische) Ausrichtung ist im Anhang A ab Seite 50 erläutert.
Vorbereitung des Teleskops für die automatische Ausrichtung:
1. Ziehen Sie die RA- und DEC-Klemmungen an.
2. Stellen Sie sicher, dass die AutoStar II Handbox angeschlossen ist.
3. Schalten Sie das Teleskop mit dem Hauptschalter ein. Nach einem
kurzen Augenblick ist das Gerät betriebsbereit.
4. wird angezeigt.
MODE fuer Menue0 zur Ausr. oder
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
18
(c) nimax GmbH
Page 19

LX20 0 A C F
Beobachten
WICHTIGER HINWEIS: Die
Abfrage für Land, Stadt und
Teleskoptyp erfolgt, wenn nicht
schon durch unseren Service
vor der Auslieferung geschehen,
nur einmal, nach dem Sie das
Teleskop fabrikneu aus der
Verpackung entnommen haben.
Bei jedem weiteren Einschalten
werden die Schritte 4 und 5
übersprungen – eine erneute
Eingabe ist nicht nötig. Nur
wenn Sie ein Reset ausführen,
werden diese Daten über Ihren
Ort mit gelöscht und müssen
dann neu eingegeben werden.
Die Informationen über Ihren Ort
werden im Setup-Unterpunkt
„ORT“ gespeichert. Wenn Sie
das Teleskop nun einige Kilometer von Ihrem eingegebenen
Ort entfernt einschalten, wird
dies über die GPS-Lokal-isierung erkannt und der neue Ort
wird dem Unterpunkt hinzugefügt. Falls Sie manuell einen Ort
hinzufügen wollen, dann sehen
Sie auf Seite 30 & 32 nach.
WICHTIGER HINWEIS: Bitte
beachten Sie, dass Sie innerhalb
eines Gebäudes kein GPSSignal empfangen können. Es ist
ausserdem nötig, dass Sie für
die allererste Ausrichtung die
Sensoren kalibrieren. Wie Sie
das genau machen, wird auf
Seite 29 beschrieben.
WICHTIGER HINWEIS:
Während des Betriebs mit der
automatischen Nachführung
dürfen Sie das Teleskop nur mit
den Richtungstasten bewegen.
Sobald das Teleskop einmal ausgerichtet worden ist, ob manuell
oder automatisch spielt keine
Rolle, machen Sie die TeleskopKlemmungen (12 und 17, Abb.
1) nicht mehr auf. Ansonsten
geht Ihnen die Ausrichtung verloren. Auch darf die Basis des
Teleskops nun nicht mehr manuell verändert werden wenn Sie
Ihre Ausrichtung beibehalten
wollen.
HINWEIS: Permanentes
Anzeigen der Referenzsterne:
Siehe S.27 „hellster Stern“
5. Drücken Sie . Das Gerät führt nun die folgenden Routinen zur
ENTER
automatischen Ausrichtung aus (Hinweis: die Ausrichtung kann mit
Druck auf eine beliebige Taste gestoppt werden. Während der
Ausrichtung bewegt sich das Teleskop selbstständig. Bitte halten Sie
einen gewissen Abstand vom Teleskop und stellen Sie sicher, dass es
nirgendwo anstoßen kann):
Suche Grundpos.
a) : Hierbei stellt das Gerät seine Endanschläge und
Bewegungsgrenzen fest.
b) / / :
Best. VerkippungBestimme NeigungSuche Waagerecht
Hierbei stellt das Teleskop ein evtl. nicht waagerecht stehendes
Stativ fest und bestimmt die Ebene. Siehe hierzu auch die Infobox auf
Seite 21.
Suche wahren N
c) : Es wird die magnetische Nordrichtung bestimmt
und anschließend die wahre Nordrichtung berechnet. Siehe auch
Seite 21.
Empf. GPS-Daten
d) : Aus den Signalen der GPS Satelliten werden die
exakte Uhrzeit, das Datum und der Standort bestimmt. Dies kann
beim ersten Einschalten bzw. nach längerer Zeit oder ungünstigen
Empfangsbedingungen bis zu 15 Minuten dauern. Bei Druck auf die
MODE
-Taste wird der GPS-Empfang abgebrochen und der Benutzer
zur manuellen Eingabe von Ort, Datum und Uhrzeit aufgefordert. Bitte
bedenken Sie, dass in geschlossenen Räumen wie
Sternwartenkuppeln (insbesondere solche aus Metall) und
dergleichen in der Regel kein GPS-Empfang möglich ist. Siehe Seite
21 für weitere Informationen. Nach erfolgter Grundausrichtung kennt
der AutoStar-II nun:
• Die Endpositionen des Tubus
• Die Ebene der Basis
• Die Richtung des wahren Norden
• Die Koordinaten des Teleskopstandortes
• Die genaue Uhrzeit und Datum
e) Sternausrichtung: Der AutoStar-II sucht nun zwei Sterne für die
Ausrichtung aus, während „Suche…“ angezeigt wird. Der erste Stern
wird nun selbstständig angefahren. Es erscheint die Meldung
ENTER drueckenZentr.hellsten Stern
. Es ist möglich, dass er
noch nicht im Okular sichtbar ist. Um zu erfahren,
welcher Referenzstern genau gewählt wurde, drücken Sie auf die
?
–Taste. Der Stern wird nun mittels der Pfeiltasten in der Mitte
des Teleskopokulars zentriert (bei den Ausrichtungssternen handelt
es sich in der Regel um die hellsten Sterne des jeweiligen
Himmelsareals). Drücken Sie nun und wiederholen Sie den
ENTER
Vorgang mit dem zweiten Ausrichtungsstern.
LX200ACF Tipps:
Wecher Stern ist der Ausrichtungstern?
Es könnte sein, dass der Autostar-II einen Ausrichtungsstern gewählt hat, den Sie noch
nicht kennen. Wie können Sie sicherstellen, dass es sich bei dem Stern in Ihrem Okular auch wirklich um den richtigen Ausrichtungsstern handelt?
Als Faustregel gilt folgendes: Ein Ausrichtungsstern ist in der Regel der hellste Stern in der
entsprechenden Himmelsregion. Wenn Sie sich einen Ausrichtungsstern im Okular ansehen,
dann setzt er sich von den übrigen Sternen in der betreffenden Himmelsregion deutlich ab.
Wenn Ihre Sicht auf den Ausrichtungsstern durch ein Hindernis, sei es durch einen Baum oder ein
Gebäude, blockiert ist, oder wenn Sie Zweifel daran haben, ob der ausgewählte Stern auch
wirklich der richtige ist, dann ist dies nicht weiter tragisch. Drücken Sie ganz einfach auf die
q
-Taste
und der Autostar sucht für Sie einen anderen Ausrichtungsstern .
p
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
19
Page 20

LX20 0 A C F
Beobachten
Hinweis: Die Ausrichtungssterne können von Nacht zu
Nacht wechseln. Alles, was der
Beobachter tun muss, ist die
vorgegebenen Sterne im Okular
zu zentrieren.
Wichtiger Hinweis: Nach
einer erfolgten Ausrichtung darf
das Teleskop nur noch mittels
der Pfeiltasten bewegt werden.
Wenn die RA- oder DECKlemmung gelöst wird oder die
Teleskopbasis oder das Stativ
verschoben wird, geht die
Ausrichtung verloren. In einem
solchen Fall ist die Ausrichtung
dann zu wiederholen.
Hinweis: Saturn ist nicht immer sichtbar; Sie können auch
ein beliebiges anderes Objekt
auswählen; die Vorgehensweise
bleibt die gleiche.
Tipp: Neben den Objekten
aus der Datenbank kann
auch jede andere Himmelskoordinate angefahren
werden. Halten Sie die
MODE
-Taste für mindestens
zwei Sekunden gedrückt. Die
aktuellen Koordinaten in RA
und DEC werden angezeigt.
Drücken Sie nun .
GOTO
Jetzt können die gewünschten Koordinaten von Hand
eingegeben und jeweils mit
ENTER
bestätigt werden. Das
Teleskop fährt diese dann im
Anschluss automatisch an
und führt sie nach.
Hinweis: Die ausgewählten
Objekte können je nach Saison
und Uhrzeit verschieden sein.
Wenn die Prozedur korrekt durchgeführt wurde, erscheint kurz die
Anzeige . Falls nicht, so ist die Ausrichtung zu
Ausrichtung OK
wiederholen.
Beobachtung mit der automatischen Nachführung
Nachdem das Teleskop ausgerichtet wurde, können Himmelsobjekte automatisch nachgeführt werden. In diesem Beispiel wird ein Stern mit den
Pfeiltasten angefahren und von der automatischen Nachführung im Gesichtsfeld
gehalten.
1. Wenn die automatische Ausrichtung durchgeführt wurde, erscheint
MODE fuer Menue: 0 fuer Tour
auf dem Display.
2. Suchen Sie sich nun ein beliebiges Himmelsobjekt aus und holen Sie es
mit den Pfeiltasten und ggf. unter Zuhilfenahme des Suchers in die Mitte
des Gesichtsfelds. Die Nachführmotoren werden das Objekt nun
selbständig im Gesichtsfeld halten.
Go To Saturn
Dieses Beispiel zeigt, wie ein Himmelsobjekt (hier der Planet Saturn) aus der
Datenbank ausgesucht und angefahren wird.
1. Nach dem Ausrichten des Teleskops drücken Sie die Ta ste *SS*.
2. wird angezeigt. Drücken Sie
3. Drücken Sie . Es wird kurz angezeigt,
4. Drücken Sie nun .
Sonnensystem: Merkur
nun die -Taste, bis angezeigt wird.
q
ENTER
anschließend erscheinen und dessen aktuelle
Koordinaten.
Sonnensystem: Saturn
Berechne...
Saturn
GOTO
Saturn Positioniere...
erscheint und das Teleskop fährt nun selbstständig den Planeten an, bis
er im Okulargesichtsfeld erscheint und führt ihn automatisch nach. Es
kann sein, dass Saturn nicht mittig im Okular ist; dann kann er mittels
der Pfeiltasten zentriert werden.
Durchführen eines Streifzugs
Streifzüge sind eine einfache und unterhaltsame Methoden, die GoTo-Fähigkeiten des AutoStar-II zu erproben. Dieses Beispiel demonstriert es am
„Tonight’s Best“ Streifzug.
1. Drücken Sie die -Taste, bis
Objekt
erscheint.
2. Drücken Sie nun die -Taste, bis
Streifzug
3. drücken. erscheint.
ENTER
Drücken Sie . Wenn Sie andere Streifzüge ausprobieren möchten,
angezeigt wird.
Streifzug: Tonight’s best
ENTER
so drücken Sie vorher die -Tasten, um andere Streifzüge
auszuwählen.
4. erscheint.
5. Drücken Sie , um Informationen über das Objekt zu lesen und
6. Drücken Sie , um zur Streifzugliste zurückzukehren. Mit den
Tonight’s best: Suche
ENTER
GOTO
, um das Objekt anzufahren.
q
-Tasten können Sie andere Objekte auswählen und mit
MODE
bestätigen.
7. Um das Streifzugmenü zu verlassen, halten Sie die -Taste für ca.
zwei Sekunden gedrückt.
MODE
p q
Auswahl:
q
Auswahl:
p
ENTER
MODE
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
20
(c) nimax GmbH
Page 21

GPS
Empfänger
Abb. 14: GPS-Empfänger am
LX200ACF
LX20 0 A C F
Es sind auch andere Streifzüge verfügbar und z.B. mittels der AutoStar Update
Utility aus dem Internet herunterladbar. Wenn Sie über Programmierkenntnisse
verfügen, werden Sie evtl. einen eigenen Streifzug zusammenstellen wollen.
Siehe hierzu „Einen eigenen Streifzug erstellen“ ab Seite 58.
Beobachten
LX200ACF Tipps:
Das GPS: Global Positioning System
Das Global Positioning System (GPS) besteht aus einer Reihe von Satelliten,
die die Erde umkreisen und ständig ihre genaue Position und die aktuelle Zeit
senden. Das System ermöglicht hochpräzise weltweite Positionsbestimmung
und Navigationsinformation für ein breites Spektrum von Anwendungen. GPSEmpfänger auf der Erde empfangen das Signal von 3 bis 12 Satelliten und
bestimmen daraus die genaue geografische Breite, Länge und Zeit des
Empfängers. Die erreichbare Genauigkeit der Position kann sogar nur fünf bis
sieben Meter betragen. Da der Autostar-II aus diesen Informationen (Zeit, geografische Länge und geografische Breite) die genaue Position von
Himmelsobjekten berechnen kann, stellt GPS die ideale Eingabebasis für das
LX200ACF Teleskop dar.
Das Ausrichten auf die Waagerechte
Um die Lage der Teleskopbasis gegenüber der Horizontalen herauszufinden,
muss der Autostar-II an drei verschieden Schwenkpositionen die Neigung des
Teleskops überprüfen. Um herauszufinden, um wieviel das Teleskop geneigt
ist, muss eine Ebene berechnet werden. Drei Punkte sind notwendig, weil eine
Ebene nur durch drei Punkte festgelegt werden kann. Das ist der Konstruktion
eines Tisches nicht unähnlich: um fest von selber zu stehen, benötigt ein Tisch
mindestens drei Füße. Mit Hilfe der Schwerkraft bestimmt der Autostar-II dann
die exakte Lage des Teleskops.
Das Aufsuchen des wahren Nordens
Herauszufinden, wo genau Norden ist, ist eine der wichtigsten Vorgänge bei
der Ausrichtung eines Teleskops. Der wahre Norden ist der Ort, an dem die
Drehachse der Erde in den Himmel zeigt, und ist einer der wichtigsten Punkte,
um die Erdbewegung zu berechnen. Wenn Sie den Nachthimmel betrachten,
werden Sie bemerken, dass sich die Sterne zu bewegen scheinen.
Beobachten Sie lange genug (oder fotografieren Sie mit sehr langen
Beilichtungszeiten), dann sehen Sie, dass sich die Sterne um einen bestimmten Punkt drehen: den wahren Norden, oder Himmelspol. Sobald der AutostarII weiß, wo der Himmelspol ist, kann er mit den GPS-Angaben zusammen die
Position aller Himmelsobjekte berechnen. Früher wurde der Himmelspol
gefunden, indem man den Polarstern gesucht hat, der sehr nahe am
Himmelspol liegt. Auch mit Gyroskopen (Beschleunigungsmessern) kann der
Himmelspol lokalisiert werden. Das LX200ACF findet den wahren Norden mit
Hilfe eines Magnetsensors. Dieser elektronische Kompass findet den magnetischen Norden. Der magnetische Norden ist nicht der wahre Norden, sondern
entsteht durch die Messung der Magnetfeldlinien der Erde. Der magnetische
Norden kann sich um etliche Grad vom wahren Norden unterscheiden. Da das
LX200ACF aber die genaue Position über das GPS empfangen hat, kann es
den wahren Norden aus der Position des magnetischen Nordens berechnen.
Einige Gebiete auf der Erde sind Zonen magnetischer Störungen, und das
Magnetfeld der Erde ändert sich auch von Jahr zu Jahr ein wenig. Der
Autostar-II bietet über die Option „Sensoren Kalibrieren“ im Teleskop-Menü
aber die Möglichkeit, Störungen im Magnetfeld eines Ortes zu kompensieren.
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
21
Page 22
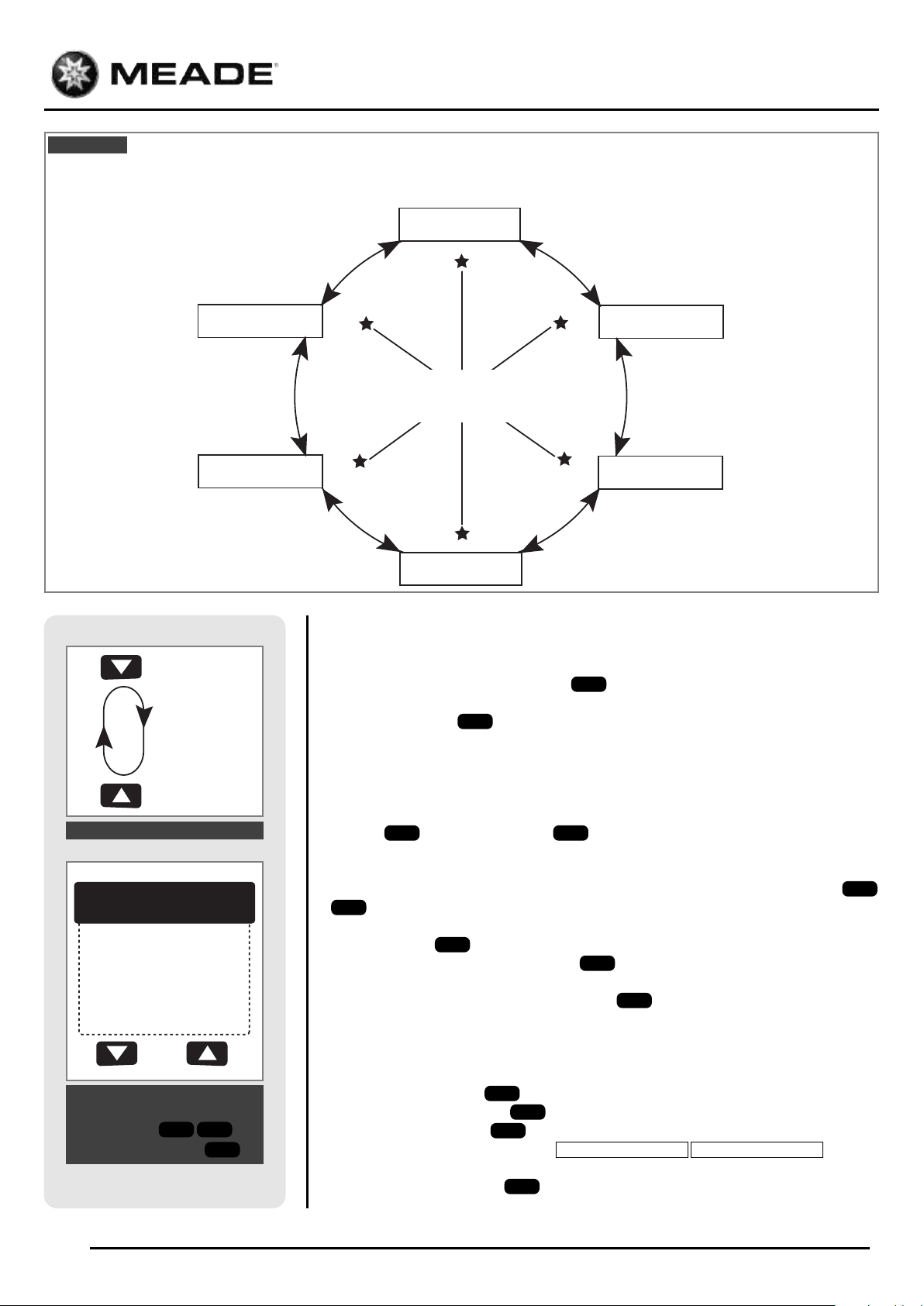
Das Universum des
AUTOSTAR II
Auswahl:
Setup
Auswahl:
Zubehör
Auswahl:
Glossar
Auswahl:
Streifzug
Auswahl:
Ereignisse
Auswahl:
Objekt
SETUP
Die schnelle und bequeme
Ausrichtung gestattet nach
einem nur zweiminütigen
Setup die Ausführung
sämtlicher Teleskopfunktionen.
ZUBEHÖR
Berechnung von Okularvergrößerungen; Einstellen des
Timers für eine Beobachtungssitzung; Veränderung der
Anzeigehelligkeit; Landobj.Übersicht
GLOSSAR
Entdecken Sie die Welt der Astronomie durch den alfabetisch
gegliederten Zugang zu astronomischen Fachausdrücken
OBJEKT
Wählen Sie aus den Grunddaten über 147.500 Objekte aus.
Drücken Sie auf GO TO, damit das Teleskop automatisch
auf das Objekt hinfährt und es in die Mitte des
Gesichtsfelds bringt.
EREIGNISSE
Verschaffen Sie sich Zugang zum
Zeitpunkt eines astronomischen
Ereignisses, wie z.B. der Auf- und
Untergangszeit des Mondes.
STREIFZUG
Bereisen Sie das Universum und lassen
Sie sich dabei vom Autostar zu den
schönsten Himmelsobjekten begleiten, die
an Ihrem Beobachtungsort gerade zu
sehen sind.
Objekt
Ereignisse
Streifzug
Glossar
Zubehör
Setup
Datum
Zeit
Sommerzeit
Teleskop
Ziele
etc.
Setup:
Ausrichtung
Abb. 15
LX20 0 A C F
AutoStar-II - Grundlagen
Abb. 16: Die Menüanordnung
Abb. 17: Menüoptionen werden in
Suchen Sie mit eine
aus und drücken Sie .
22
AutoStar-II - Grundlagen
Alle Menüs und Optionen sind in einer Schleife angeordnet (Abb. 16). Dies
bedeutet, dass bei Druck auf die -Taste alle möglichen Punkte nacheinander durchgeblättert werden und man anschließend wieder zum ersten Punkt
zurückkehrt. Die -Taste hat die gleiche Funktion, nur in umgekehrter
p
Richtung. Dies stellt eine einfache Möglichkeit dar, weiter unten liegende
Optionen schnell zu erreichen. Im folgenden Beispiel wird dies demonstriert:
Beispiel:
Erreichen des „Setup“-Menüs, wenn das „Objekte“-Menu angewählt ist: Drücken
q p
-Tasten kann man sich nun aufwärts bzw. abwärts die möglichen Optionen
ENTER
Sie die fünf Mal oder die ein Mal. Das Display in Abb. 17 hat zwei
Zeilen. Die obere Zeile zeigt das gegenwärtige Menü an; die untere Zeile zeigt die
erste der möglichen Optionen, die innerhalb dieses Menüs ausgewählt werden
können. Einige Optionen stellen nächstniedrigere Menüebenen dar. Mit den
q
jeweils einzeln anzeigen lassen. Wenn die gewünschte Auswahl angezeigt wird,
können Sie mit die Option anwählen oder in die untergeordnete Menüebene
einsteigen. Mit einem Druck auf die -Taste wird das jeweilige Menü wieder
verlassen. Hinweis: Unabhängig davon, in welcher Menüebene man sich gerade
befindet: Durch wiederholtes Drücken der -Taste gelangt man immer wieder
zum Einstiegsmenü „Auswahl: Objekt“ zurück.
Um zu zeigen, wie die AutoStar-II Menüstruktur arbeitet, wird in der folgenden
der zweiten Zeile angezeigt.
qp
ENTER
Übung die Zeit des Sonnenuntergangs berechnet.
1. Betätigen Sie , bis „Auswahl: Objekt“ angezeigt wird.
2. Betätigen Sie die -Taste, bis die Anzeige „Ereignisse“ erscheint.
3. Mit Druck auf wird nun das Menü ausgewählt und die nächste
Ebene angezeigt. wird
angezeigt.
4. Drücken Sie die -Taste, bis die Option ange-
MODE
q
ENTER
q
zeigt wird.
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
q
MODE
MODE
Ereignisse: Sonnenaufgang
Sonnenuntergang
(c) nimax GmbH(c) nimax GmbH
p
Page 23

LX20 0 A C F
AutoStar-II - Grundlagen
5. drücken.
ENTER
6. Der AutoStar-II berechnet nun anhand von Ort, Datum und Standort die
aktuelle Sonnenuntergangszeit und zeigt diese an.
7. Mit einem Druck auf gelangt man wieder auf die jeweils nächsthöhere Menüebene bis hin zu .
MODE
ObjektAuswahl:
Die AutoStar-II Menüs sind für eine einfache und schnelle Navigation wie folgt
organisiert:
• Drücken Sie , um tiefer in die Menüebenen zu gelangen.
• Drücken Sie , um in übergeordnete Menüs zurückzukommen.
• Mit der Ta s t e und einer Zifferntaste von 1 bis 9 im Anschluss
werden Positioniergeschwindigkeiten ausgewählt.
• Mit gelangen Sie direkt ins Fokusmenü.
• Mit gelangen Sie direkt ins Fadenkreuzmenü.
FOCUS
RET
• Mit den -Tasten wählen Sie verschiedene Optionen oder
ENTER
MODE
SPEED
1
4
7
qp
Listen aus.
• Mit den Pfeiltasten wird der Cursor auf dem Display bewegt.
• Mit der Hilfetaste wird die Online-Hilfe angezeigt.
?
LX200ACF Tipps:
„Zeitmaschine“ Autostar ...
Die Autostar-II Datums-Funktion im Setup-Menü ist noch viel mehr als
nur eine bloße Einstellung des heutigen Datums. Mit ihr können Sie astronomische Ereignisse weit in der Zukunft oder in längst vergangener Zeit errechnen. Der Autostar-II kann das Datum und die Uhrzeit von zukünftigen und in
der Vergangenheit liegenden astronomischen Ereignissen (außer
Sonnenfinsternisse in der Vergangenheit) errechnen, die auf unserem heutigen Kalendersystem basieren. Berechnen Sie z. B. wann die Frühlings-Tagund-Nachtgleiche im Jahre 1469 stattfand oder wann am 5. Juli 2069 die
Sonne aufgehen wird. Um das ausgesuchte Datum (nur Daten n. Chr.) einzugeben, gehen Sie ins Setup-Menü und suchen die Option „Datum“ aus oder
suchen sich ein entsprechendes Ereignis aus.
Der Autostar-II kann unter Verwendung des Ereignisse-Menüs das Datum und
die Uhrzeit für Sonnenaufgänge, Sonnenuntergänge, Mondauf- und untergänge, Mondphasen, Mond- und Sonnenfinsternisse für die nächsten 100
Jahre, Meteorschauer, Sonnenwenden, Tag-Nachtgleichen und das AlgolMinium berechnen.
Eines der der wohl meistbenutzten Funktionen im Menü Ereignisse-Menü ist
die Funktion „Sonnenuntergang“. Sie können so ganz verlässlich sehen, wann
Sie mit Ihrer Beobachtung anfangen können.
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
23
Page 24

LX20 0 A C F
AutoStar-II – Menüs
Abb. 18
Landobjekte
Identifizieren
Suchen
...
Wählen
Landestellen
...
Apollo 11
Wählen
Übersicht
...
Rima Arehytas
Täler, Rillen
...
...
Parameter ändern
Mare, Seen
...
Mons Argäns
Lacus Bonitatis
Suche starten
Berge
...
Abenezra
...
Krater
Benutzerobj.
Wählen
Hinzufügen
Löschen
Ändern
Mond
Satelliten
Stern
Nebel
...
Mit Namen
Hipparcos Kat.
...
Sonnenfinsternis
Mondfinsternis
Algol-Minima
Herbstäquinoktium
Frühlingsäquinoktium
Sommersonnenwende
Deep Sky
...
Obj. mit Namen
Galaxien
Meteorstrom
...
...
Quadrantiden
Sternbild
Asteroiden
Kometen
Andromeda
Mondkulmination
Monduntergang
Mondphasen
Nächster Vollmond
AUTOSTAR-II - MENÜS
Sonnensystem
...
Merkur
Mond
Sonnenuntergang
Mondaufgang
Sonnenaufgang
Sonnenkulmination
Auswahl:
Objekt
Auswahl:
Ereignisse
AutoStar-II – Menüs
Statistk
Reset
Benutzerinfo
Klonen
Download
Smart Mount
Konfiguration
Laden
...
Ziele
Ort
Astronomisch
Terrestrisch
Vertausche O/U
Home - Sensoren
GPS Ausrichtung
RA-PEC
DEC-PEC
Hoch-Präzision
Batterie-Alarm
Landob. Übersicht
Tel. Standby
Teleskop parken
Kalibr. Sensoren
Nachführgeschw.
Guide – Geschw.
Vertausche L/R
Piepston
Kontrast
Kontrollleuchte
Ext. 12V Auswahl
Helligkeit
Aus
Ein
Antriebstraining
Kalibr. Grundpos.
Anti- Backlash
Mont. Untergrenze
Parkposition
Max.Pos.Geschw.
Mont. Obergrenze
Mode für Menue
Hellster Stern
Vorschlag
Gesichtsfeld
Vergrößerung
Teleskop
Montierung
Modell
Brennweite
Willkommen
Wecker
Start/Stop
Stellen
Datum
Zeit
...
...
Stellen
Ein-Stern
0 für Ausrichtung
Okularrechner
...
GPS-UTC Diff.
Sommerzeit
Streifzug
Tour
Messier Marathon
Zubehör
Stoppuhr
Umgeb.- Temper.
Setup
Ausrichtung
Automatisch
Auswahl:
Auswahl:
Auswahl:
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
24
(c) nimax GmbH(c) nimax GmbH
Page 25

Wichtiger Hinweis: Das
Anfahren von Landobjekten
kann nur dann zufriedenstellend
funktionieren, wenn das
Teleskop an exakt demselben
Ort aufgestellt ist, an dem das
jeweilige Objekt auch abgespeichert wurde. Weitere Hinweise
finden Sie auf Seite 34.
LX20 0 A C F
AUTOSTAR-II - MENÜS
Objekt-Menü
Nahezu alle Beobachtungen mit dem AutoStar-II werden innerhalb des ObjektMenüs durchgeführt. Ausnahmen sind Streifzüge und Landobjekte; siehe auch Go
To Saturn und Streifzüge (Seite 20).
Der AutoStar-II enthält viele Datenbanken mit Beobachtungsobjekten wie
Sterne, Planeten, Kometen, Nebel, usw. Wenn eines dieser Objekte aus der
Datenbank ausgewählt wird, kann es – nach erfolgter Ausrichtung – durch den
AutoStar-II automatisch positioniert und nachgeführt werden. Sechs der am
häufigsten benötigten Kataloge können direkt über die Schnellzugriffstasten
angewählt werden.
Das Objekt-Menü enthält:
Sonnensystem: Die Planeten (Erde nicht mitgerechnet) von innen nach außen,
gefolgt von Mond, Asteroiden und Kometen.
Sternbild: Ein Verzeichnis aller 88 Sternbilder des Nord- und Südhimmels.
Nachdem diese Menüoption ausgewählt wurde, erscheint der Name des ersten
Sternbilds in alphabetischer Reihenfolge auf dem Display. Nach dem ersten
Druck auf erscheint der Name des hellsten Sterns dieses Sternbildes in
der zweiten Zeile. Mit einem zweiten Druck auf wird dieser Stern positioniert. Anschließend können mit den -Tasten die weiteren Sterne
dieses Sternbildes ausgewählt werden, vom hellsten bis zum schwächsten. Deep
Sky: Ein Verzeichnis von Objekten außerhalb unseres Sonnensystems; es enthält
u.a. Nebel, Sternhaufen, Galaxien und Quasare.
Stern: Ein in verschiedene Kategorien unterteilter Katalog von Sternen. Er
enthält Sterne mit Eigennamen, erdnahe, variable und Doppelsterne. Ebenso
enthalten sind Auszüge aus den Hipparchos-, SAO-, HD-, und HR-Katalogen. Das
Sternverzeichnis kann auch direkt über die Schnellzugriffstaste auf
der Handbox aufgerufen werden.
Satellit: Dies ist ein Verzeichnis ausgewählter künstlicher Satelliten wie z.B. der
ISS, dem Hubble-Weltraumteleskop, GPS-Satelliten sowie geostationäre
Satelliten. Weitere Hinweise zum Beobachten von Satelliten finden Sie auf Seite
34.
Über weitere Schnellzugriffstasten auf der Handbox können noch die folgenden
Kataloge angewählt werden: (Caldwell), (Messier), (Sonnensystem), (Index Catalog), (New General Catalog). Die Objekte dieser
Kataloge werden ausgewählt, indem der jeweilige Katalog aufgerufen und
anschließend mit der Zifferntastatur die Objektnummer eingegeben und mit
bestätigt wird. Ein Beispiel: Um NGC 6720 auszuwählen, drücken Sie , dann
STAR
6
vorhanden, den gebräuchlichen Namen und alternative Bezeichnungen des
Objekts an. Mit den -Tasten können nun Informationen über die
Objektklasse (Galaxie, Nebel, etc.), RA- und DEC- Koordinaten, Sternbild,
Helligkeit, Größe, Entfernung, Sternklassifizierung (bei Sternen) abgerufen
werden. Sofern weitere Informationen verfügbar sind, werden diese als Lauftext
angezeigt. Nach einem Druck auf wird das Objekt positioniert. Ein Druck auf
MODE
die -Taste führt zu den höheren Menüebenen zurück.
Benutzerobjekte: Hier können eigene Objekte im Deep-Sky-Verzeichnis
abgespeichert werden, falls sie nicht in der Datenbank vorhanden sein sollten.
Siehe auch „Erstellen eigener Objekte“ auf Seite 33.
Landobjekte: Hier können terrestrische Objekte in der Datenbank abgespeichert werden. Diese Funktion ermöglicht es, solche Objekte direkt anzufahren:
• Wählen: Bereits abgespeicherte Objekte können hier mittels der
• Hinzufügen: Mit dieser Option können Sie den Namen eines neuen
GOTO
GOTO
qp
STAR
SS
5
NGC
9
ENTER
GOTO
M
3
CALD
2
I.C.
8
LIGHT
CALD
RET
7
q
-Tasten ausgewählt und mit angefahren werden.
Objekts eingeben. Zentrieren Sie nun das Objekt im Gesichtsfeld und
drücken Sie .
0
2
und anschließend . Der AutoStar-II zeigt nun, soweit
ENTER
NGC
9
qp
GOTO
6
ENTER
p
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
25
Page 26

LX20 0 A C F
AUTOSTAR-II - MENÜS
Identifizieren: Nach erfolgter Ausrichtung des LX200ACF können Sie das
Teleskop mittels der Pfeiltasten frei über den Himmel bewegen. Sehen Sie ein
Objekt im Bildfeld (Stern oder Deep-Sky-Objekt), wissen aber nicht, um welches
es sich handelt, können Sie mit dieser Funktion das Objekt identifizieren.
Wichtiger Hinweis: Benutzen Sie nur die Pfeiltasten des AutoStar, um das
Teleskop zu bewegen. Wenn die RA- und/oder DEC-Klemmung gelöst wird,
geht die Ausrichtung verloren!
1. Wenn ein Objekt im Okular sichtbar ist, drücken Sie , bis
Auswahl: Objekt
ENTER
nun .
2. Wählen Sie mittels der -Tasten „Identifizieren“ aus und
bestätigen Sie mit .
ENTER
angezeigt wird. Drücken Sie
qp
MODE
3. Der AutoStar-II durchsucht nun seine Datenbanken, bis das zu den
Koordinaten passende Objekt gefunden ist.
4. Wenn der Position kein Objekt eindeutig zugeordnet werden kann,
zeigt der AutoStar-II das nächstliegende Objekt mit der entsprechenden
Winkelentfernung an. Dieses kann direkt per angefahren werden.
GOTO
Suchen: Hiermit können Sie die Datenbanken, wie mit einer Suchmaschine,
nach Objekten mit bestimmten Eigenschaften durchsuchen. Mit „Parameter
ändern“ können Sie Suchkriterien wie Objekttyp, minimale Höhe, Größe, etc.
vorgeben. Nachdem die Parameter eingestellt wurden, wählen Sie „Suche
starten“ an und drücken Sie . Die Suchergebnisse werden anschließend
ENTER
vom AutoStar-II angezeigt. Weitere Hinweise siehe Seite 36.
Hinweis: Mit „Kulmination“
(auch Transit genannt) wird die
Uhrzeit bezeichnet, zu der ein
Objekt genau durch den
Südmeridian des Beobachters
läuft und seine größte Höhe über
dem Horizont erreicht.
Hinweis: Meteore sind sehr
schnelle Objekte, die sich über
große Himmelsareale bewegen.
Sie können am besten mit dem
bloßen Auge beobachtet wer-
den.
W A R N U N G !
Teleskop NIEMALS auf die
Sonne! Siehe auch den
Warnhinweis auf Seite 3!
Richten Sie das
Ereignis-Menü
Das Ereignis-Menü bietet Zugriff auf Daten und Uhrzeiten bestimmter
astronomischer Ereignisse. Diese Datenbank enthält:
Sonnenaufgang, -kulmination und -untergang: Die entsprechenden
Uhrzeiten werden für den jeweiligen Tag und Standort berechnet. Sie können
auch vorher Datum oder Ort im entsprechenden Menü ändern und sich dann die
zu diesem Datum passenden Werte berechnen und anzeigen lassen.
Mondaufgang, -kulmination und -untergang: Die entsprechenden Uhrzeiten
werden für den jeweiligen Tag und Standort berechnet.
Mondphasen: Zeigt Datum und Uhrzeit des jeweils nächsten Vollmonds bzw.
von Neumond oder erstem und letztem Viertel an.
Meteorstrom: Zeigt Informationen über Meteorschauer an wie z.B. Perseiden,
Leoniden, etc. Es werden das Datum und die Uhrzeit des voraussichtlichen
Maximums angezeigt.
Sonnenfinsternis: Listet zukünftige Sonnenfinsternisse, inklusive Datum und
Typ (total, partiell, ringförmig) auf. Mit den -Tasten können alle Daten
abgefragt werden.
Mondfinsternis: Listet zukünftige Mondfinsternisse, inklusive Datum und Typ
(total, partiell, Halbschatten) auf. Mit den -Tasten können alle Daten
abgefragt werden.
Algol-Minima: Zeigt die Minima des stark veränderlichen Doppelsterns Algol
an; er steht mit einer Entfernung von ca. 100 Lichtjahren der Erde relativ nah.
Alle 2,8 Ta g e durchläuft Algol in einer zehnstündigen Periode eine große scheinbare Helligkeitsänderung, wenn eine Komponente des Doppelsternsystems
„hinter“ der anderen hindurchläuft. Die gemeinsame Helligkeit beträgt +2,1 mag
und sinkt auf +3,4 mag während der Bedeckung ab.
Herbst- und Frühjahrsäquinoktium: Berechnet Uhrzeit und Datum der Herbstund Frühjahrszeitgleiche für das gegenwärtige Jahr.
Winter- und Sommersonnenwende: Berechnet Uhrzeit und Datum der Winterund Sommersonnenwende für das gegenwärtige Jahr.
qp
qp
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
26
(c) nimax GmbH
Page 27

Hinweis: Sollte der Kontrast
einmal versehentlich so eingestellt werden, dass das Display
nicht mehr lesbar ist, so schalten
Sie das Teleskop aus und wieder
ein. Sobald die Version im
Display angezeigt wird (dies ist
von der Kontrasteinstellung
unabhängig), drücken Sie
MODE
.
LX20 0 A C F
AUTOSTAR-II - MENÜS
Glossar-Menü
Das Glossar-Menü bietet eine alphabetische Auflistung von Definitionen und
Beschreibungen der gängigen astronomischen Begriffe und AutoStar-II
Funktionen. Das Glossar kann direkt über das Menü oder über Hypertext-Worte
im Hilfetext erreicht werden. Ein Hypertext-Wort erscheint in [eckigen
Klammern]. Wenn ein Hypertext-Wort im Lauftext erscheint, wird durch Drücken
ENTER
der -Taste direkt der entsprechende Glossar-Eintrag aufgerufen. Innerhalb
des Glossars selbst können Sie sich mittels der -Tasten durch das
Alphabet bewegen. Am gewünschten Buchstaben wieder drücken, und
qp
ENTER
Sie können die einzelnen Begriffe auswählen.
Zubehör-Menü
Das Zubehör-Menü bietet Zugriff auf diverse Extra-Funktionen innerhalb des
AutoStar-II, inklusive eines Countdown und einer Alarmfunktion. Der Gesamtumfang ist wie folgt:
Umgebungstemperatur: Hier wird die aktuelle Temperatur (gemessen im linken
Gabelarm) angezeigt.
Stoppuhr: Wählt die Countdown-Funktion aus. Sie ist nützlich z.B. für die
Astrofotografie und für Satellitenbeobachtungen. Mit wird die Stoppuhr
und dann zwischen „Stellen“ und „Start/Stopp“ gewählt.
• Stellen: Geben Sie die Zeit in Stunden, Minuten und Sekunden ein, die
heruntergezählt werden soll. Anschließend mit bestätigen.
• Start/Stopp: Aktiviert die eingestellte Zeit. Mit den -Tasten
kann zwischen Ein und Aus gewählt werden; mit wird der
Countdown gestartet. Bei Ablauf der Zeit erklingen vier Pieptöne und
die Stoppuhr wird deaktiviert.
Wecker: Hiermit lässt sich die Zeit für ein Alarmsignal zu Erinnerungszwecken
einstellen. Mit wird der Wecker und dann zwischen „Stellen“ und
ENTER
„Start/Stopp“ gewählt.
• Stellen: Geben Sie die gewünschte Uhrzeit ein und bestätigen Sie sie
ENTER
mit .
• Start/Stopp: Aktiviert die eingestellte Weckzeit. Mit den Tasten wird zwischen Ein und Aus gewählt und die Weckzeit mit
aktiviert. Wenn die gewählte Uhrzeit erreicht wird, drücken Sie um
den Wecker zu deaktivieren.
Okularrechner: Berechnet Daten über die Okulare für den jeweiligen
Teleskoptyp.
• Gesichtsfeld: Scrollen Sie durch eine Liste verfügbarer Okulare. Bei
Auswahl eines Ty p s wird dessen tatsächliches Gesichtsfeld angezeigt.
• Vergrößerung: Scrollen Sie durch eine Liste verfügbarer Okulare. Bei
Auswahl eines Ty p s wird die Vergrößerung angezeigt.
• Vorschlag: Hier schlägt der AutoStar-II, abhängig vom jeweiligen
Teleskopmodell und gerade angefahrenen Objekt, ein passendes Okular
vor.
Hellster Stern: Mit dieser Option wird ausgewählt, ob während der Ausrichtung
„zentriere hellsten Stern“ oder der direkte Name des gewählten Sterns
angezeigt werden soll.
Helligkeit: Hier können Sie die Displayhelligkeit mit den - -Tasten
einstellen und anschließend mit speichern.
Kontrast: Hier können Sie den Kontrast des Displaytextes einstellen und
anschließend mit speichern. Eine Einstellung ist hier normalerweise nur
ENTER
ENTER
bei großen Temperaturunterschieden notwendig.
Handbox-LED: Hiermit lässt sich die Kontrollleuchte auf dem Anschlussboard
ausschalten, falls sie Sie im Dunkeln stören sollte.
Aux Port Power: Der 12V= Kontakt auf dem Anschlussboard kann hiermit
einund ausgeschaltet werden.
Pieps: Aktiviert bzw. deaktiviert den Piepston.
ENTER
ENTER
qp
ENTER
qp
ENTER
ENTER
qp
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
27
Page 28

Hinweis: Auch im ausgeschalteten Zustand dürfen die RAund DEC-Klemmungen nicht
gelöst werden, da sonst die
Ausrichtung verloren geht.
Wenn bei der Parkfunktion die
Abschaltmeldung erscheint,
kann das Teleskop nur durch
Aus- und Wiedereinschalten
reaktiviert werden.
Wichtiger Hinweis: Aus-
richtung nach Grundposition
Nur für fest montierte Teleskope.
Wenn „Kalibriere Grundposition“
(siehe Seite 29) durchgeführt
wurde, kann nach dem
Einschalten diese Funktion genutzt werden. Das LX200ACF ist
dann fertig ausgerichtet und
braucht die Grundpositions-,
Neigungs- und RichtungsPrüfungen nicht mehr durchzuführen, da deren Werte bei
„Kalibriere Grundposition“
abgespeichert werden.
LX20 0 A C F
AUTOSTAR-II - MENÜS
Batterie-Alarm: Hier kann eingestellt werden, ob unterhalb einer bestimmten
Betriebsspannung ein Warnton gegeben werden soll.
Landobjekte-Übersicht: Bei dieser Funktion fährt das Teleskop automatisch
alle eingespeicherten Landobjekte an, mit einem kurzen Stopp bei jedem Ziel.
Die Funktion wird mit gestartet. Während sich das Teleskop bewegt, kann
ENTER
mit einem kurzen Druck auf irgendeine Ta s te die Bewegung gestoppt und das
nächste Ziel angewählt werden. Möchten Sie ein bestimmtes Objekt länger
betrachten, so drücken Sie , solange das Teleskop gestoppt ist. Mit
MODE
kann die Übersicht wieder am ersten Objekt gestartet werden. Weitere
Informationen über Landobjekte siehe Seite 34.
Teleskop Stand-by: Dies ist eine Energiesparfunktion (vor allem für Batteriebetrieb), bei der das LX200ACF quasi abgeschaltet wird, ohne dass die
Ausrichtung verloren geht. Wenn „Teleskop Stand-by“ ausgewählt ist, drücken
ENTER
Sie * , um die Funktion zu aktivieren. Das Display und die Motoren werden
abgeschaltet, nur die interne Uhr und der RAM-Speicher laufen weiter. Mit
Druck auf irgendeine Taste (außer ) wird das Teleskop wieder „aufge-
ENTER
weckt“.
Teleskop parken: Diese Funktion ist für fest aufgestellte Teleskope. Wenn das
Teleskop einmal ausgerichtet ist, kann es mit dieser Funktion geparkt und abgeschaltet werden, ohne dass die Ausrichtung verloren geht. Bei Aktivierung dieser Funktion fährt das LX200ACF in eine vorbestimmte Parkposition; anschließend wird der Benutzer durch das Display aufgefordert, das Teleskop auszuschalten.
Setup-Menü
Die primäre Funktion des Setup-Menüs besteht in der manuellen Ausrichtung
des Teleskops (siehe auch Seite 37f). Darüber hinaus bietet das Setup-Menü
folgende weitere Einstellmöglichkeiten:
Datum: Hiermit lässt sich das Datum manuell eingeben und beliebig verändern.
Z.B. kann so festgestellt werden, wann in einem halben Jahr morgens die Sonne
aufgeht.
Zeit: Hiermit lässt sich die Uhrzeit manuell eingeben und beliebig verändern; Sie
ist jedoch, zusammen mit dem Datum, essentiell für die akkurate Funktion des
LX200ACF. Sie kann im 12-Stunden und 24-Stunden Format eingegeben werden. Hierzu bewegen Sie den Cursor nach rechts neben die Uhrzeit auf das
„AM“ oder „PM“ Symbol. Mit den -Tasten kann der Wert
umgeschaltet werden. Wenn kein Symbol erscheint, ist das 24-Stunden-Format
angewählt.
qp
ENTER
Sommerzeit: Wechselt zwischen Sommer- und Winterzeitangabe. Die interne
Uhr wird hiervon nicht beeinflusst.
Smart Mount: Siehe Anhang I auf Seite 72 für weitere Informationen.
Teleskop: Hier sind folgende Einstellungen durchführbar:
• Montierung: Umschaltbar zwischen „Az/El“ und „Parallaktisch“, je
nach dem ob das LX200ACF azimutal oder parallaktisch montiert ist.
Vom Werk ist „Az/El“ voreingestellt.
• Modell: Hiermit wird das jeweilige Teleskopmodell eingestellt.
• Brennweite: Zeigt die Brennweite des jeweiligen Teleskopmodells an.
• Maximale Positionier-Geschwindigkeit: Diese kann hier in Schritten von
0,1°/s vorgegeben werden. Der maximal mögliche Wert beträgt 8°/s.
• Montierung Obergrenze: Sie können hier einen Wert zwischen 0 und
90° einstellen, der bei automatischen Positionierungen als Maximalwert
dient. Diese Funktion ist nützlich, wenn z.B. eine Kamera oder länger
bauendes Zubehör hinten am Teleskop angeschlossen ist und bei
größeren Elevations- oder DEC-Werten an der Montierung anstoßen
könnte. Der maximal einstellbare Wert beträgt 90° (senkrecht). Bitte
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
28
(c) nimax GmbH
Page 29

Hinweis: Wenn der Mond per
GOTO
angefahren wird, schal-
tet der AutoStar-II automatisch
auf Mondgeschwindigkeit um.
Hinweis: Nachführgeschwindigkeit „Benutzerdefiniert“ Hier
lassen sich Werte von -999 (für 99,9%) bis 999 (für +99,9%) einstellen, jeweils bezogen auf die
normale Sterngeschwindigkeit.
Je geringer der Zahlenwert,
desto niedriger die Nachführgeschwindigkeit und umgekehrt. Wenn z.B. -99,9% eingegeben wird, steht das Teleskop
nahezu still. Bei Eingabe von
+99,9% führt das Teleskop mit
nahezu doppelter Sterngeschwindigkeit nach.
LX20 0 A C F
AUTOSTAR-II - MENÜS
beachten Sie, dass manuelle Bewegungen mittels der Pfeiltasten hiervon
nicht begrenzt werden!
• Montierung Untergrenze: Sie können hier einen Wert zwischen 0 und
-90° einstellen, der bei automatischen Positionierungen als Minimalwert dient.
Diese Funktion ist nützlich, wenn z.B. eine Tauschutzkappe oder dergl. vorne
am Teleskop angeschlossen ist und bei niedrigen Elevations- oder
DECWerten an der Gabel anstoßen könnte. Der minimal einstellbare Wert
beträgt -90° (senkrecht). Bitte beachten Sie, dass manuelle Bewegungen
mittels der Pfeiltasten hiervon nicht begrenzt werden!
• Park-Position: Nur für fest aufgestellte Teleskope. Nach der
Ausrichtung kann diese Funktion angewählt und das Teleskop
abgeschaltet werden. Die Ausrichtung wird gespeichert und beim
nächsten Einschalten wieder abgerufen. Wenn nach dem
Wiedereinschalten
AutomatischAusrichtung:
wird mit (nicht mit !) die Ausrichtung übersprungen und das
MODE
ENTER
erscheint,
LX200ACF kann sofort wieder genutzt werden. Dieser Menüpunkte bietet
zwei Optionen: „Letzte Position“ parkt das Teleskop in der letzten vom
Benutzer eingestellten Position; „Standard-Position“ bringt den Tubus
vorher in die Waagerechte und dreht ihn nach Norden.
• Kalibriere Grundposition: Nur für fest aufgestellte Teleskope. Nach der
erfolgten Ausrichtung kann diese Funktion angewählt werden und die
Ausrichtungsdaten (Waagerechte, Nord, Verkippung, etc.) werden
gespeichert. Wenn beim nächsten Einschalten „Ausrichtung nach
Grundposition“ ausgewählt wird, werden diese Werte wieder eingelesen
und das Ausrichten stark verkürzt. Siehe auch „Ausrichtung nach
Grundposition“ weiter oben. Anmerkung: Diese Methode ist nicht ganz so
genau wie die Parkfunktion.
• Anti-Backlash: Diese Option erlaubt es, das Getriebeumkehrspiel in RA
und DEC durch Werteangaben von 0 bis 199% zu kompensieren.
Hiermit wird beeinflusst, wie schnell das Teleskop – vor allem bei
niedrigen Geschwindigkeiten – auf Richtungsumkehrungen durch die
Pfeiltasten bzw. Autoguider-Befehle reagiert. Bei Werten nahe 0% ist die
Reaktion eher langsam, bei Werten nahe 199% ist eine schnelle
Reaktion da. Experimentieren Sie mit verschiedenen Werten, bis eine
geschmeidige Richtungsumkehr ohne nennenswerte Verzögerungen
einerseits und ohne Überreaktionen andererseits erfolgt.
• Antriebstraining: Das Antriebstraining ermöglicht es dem AutoStar-II, den
mechanisch unumgänglichen Getriebefreigang zu bestimmen und
auszugleichen. Diese Funktion sollte unbedingt bei der
Erstinbetriebnahme und dann im Abstand von jeweils einigen Monaten
durchgeführt werden. Siehe Anhang D – Antriebstraining – auf Seite 64.
• Kalibriere Sensoren: Hiermit lässt sich die Präzision, mit der die
Ausrichtsterne angefahren werden, verbessern. Magnetische Störfelder in
der Umgebung des Teleskops werden kompensiert und durch
Transport und dergleichen hervorgerufene Dejustierungen des Levelund
Magnetsensors ausgeglichen. Diese Funktion sollte vor der
Erstinbetriebnahme durchgeführt werden. Der AutoStar-II fährt hierbei den
Polarstern an. Nachdem dieser manuell mit den Pfeiltasten zentriert
wurde, drücken. Nun kann das Teleskop den wahren Norden und die
ENTER
Waagerechte genauer berechnen.
• Nachführgeschwindigkeit: Hiermit lässt sich die Geschwindigkeit, mit
welcher Himmelsobjekte nachgeführt werden, verändern.
a) Sterngeschwindigkeit: Grundeinstellung. Dies ist die
Geschwindigkeit, mit der sich alle Deep-Sky-Objekte scheinbar am
Himmel bewegen.
b) Lunar: Mondgeschwindigkeit. Hiermit lässt sich der Mond bei
längeren Beobachtungen besser im Gesichtsfeld halten.
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
29
Page 30

LX20 0 A C F
AUTOSTAR-II - MENÜS
c) Benutzerdefiniert: Erlaubt die Anwahl einer benutzerspezifischen
Geschwindigkeit; siehe Infobox links.
• Guide-Geschwindigkeit: Diese Funktion ist praktisch für die
Nachführkontrolle, vor allem mit Autoguidern. Die
Korrekturgeschwindigkeit kann hier in Werten von -99% bis +99%
der Sterngeschwindigkeit eingestellt werden. Siehe auch
unter „Positioniergeschwindigkeiten“, Seite 17.
• Vertausche L/R: Hiermit wird die Funktion der Pfeiltasten für links und
rechts vertauscht.
• Vertausche O/U: Hiermit wird die Funktion der Pfeiltasten für oben und
unten vertauscht.
• Home-Sensoren: Wenn gewünscht, lassen sich hiermit die Level- und
Nordsensoren bei Ein-Stern, Zwei-Stern und Easy-Ausrichtung
abschalten. Das Teleskop muss dann vor der Ausrichtung manuell in die
Waage gebracht und auf Nord gedreht werden. Werkseinstellung ist
„Ein“.
• GPS-Ausrichtung: Es sind drei Optionen verfügbar. Bei „Aus“ werden Ort,
Datum und Uhrzeit manuell abgefragt. Bei „Ein“ (Werkseinstellung) werden
diese Daten vom GPS übernommen. „Beim Einschalten“ kann angewählt
werden, wenn in jedem Fall direkt nach dem Einschalten die GPS-Daten
empfangen werden sollen.
• RA PEC und DEC PEC: Erlaubt die Korrektur des periodischen
Schneckenfehlers; diese kann mit einem möglichst hoch vergrößernden
Fadenkreuzokular oder einem Autoguider vorgenommen werden.
Detaillierte Hinweise hierzu finden Sie auf Seite 39.
• Hoch-Präzision: Diese Funktion ist für kritische fotografische
Anwendungen oder die Beobachtung sehr lichtschwacher Objekte
gedacht. Wenn sie aktiviert wird, fährt das LX200ACF nach einem Befehl zuerst einen Referenzstern in der Nähe des Zielobjektes an und
meldet „ENTER zum Synchronisieren“. Dieser Stern wird dann mittels der
Pfeiltasten zentriert und mit bestätigt. Im Anschluss wird dann das
ENTER
Zielobjekt mit besonders hoher Genauigkeit angefahren.
GOTO
Ziele: Hiermit kann zwischen astronomischen und terrestrischen Zielen
umgeschaltet werden. Wenn „astronomisch“ aktiviert ist, wird jedes Himmelsobjekt
nach erfolgter Ausrichtung nachgeführt. Ist „terrestrisch“ aktiviert, sind die
Nachführmotoren abgeschaltet.
Ort: Wenn kein GPS-Empfang möglich ist, können hier manuell Standorte aus der
Datenbank ausgewählt und bearbeitet werden.
• Wählen: Es wird der gegenwärtige Standort angezeigt. Mit den
q
-Tasten kann ein Ort ausgewählt und mit übernommen
ENTER
p
werden.
• Hinzufügen: Hiermit können der Datenbank eigene Standorte hinzugefügt
werden.
• Löschen: Löscht einen Standort aus der Datenbank.
• Ändern: Nach Auswahl eines Ortes können dessen Daten (Koordinaten,
Zeitzone, etc.) verändert werden.
Weitere Hinweise hierzu finden Sie auf Seite 32.
Benutzerinfo: Hier können Informationen über den Benutzer/Besitzer eingegeben
werden:
• Name: Mittels der Pfeiltasten kann man Vor- und Nachnamen eingeben und
mit speichern. Nutzen Sie die Pfeiltasten zur
ENTER
Buchstabenauswahl und die -Tasten, um den Cursor zu bewegen.
• Adresse: Hier können Strasse, Ort und Postleitzahl eingegeben
werden.
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
30
(c) nimax GmbH
Page 31

Hinweis: Falls ein Download
fehlschlagen sollte (PC-Absturz
oder dergl.), gehen Sie bitte wie
folgt vor: Teleskop aus- und wieder einschalten und direkt nach
dem Aufleuchten des Displays
„999“ drücken. Anschließend
den Download neu starten.
LX20 0 A C F
AUTOSTAR-II - MENÜS
Klonen / Download: Diese beiden optionalen Funktionen sind für Wartungszwecke durch Servicepersonal bestimmt. Wenn Sie selbst ein Update durchführen möchten, benutzen Sie das #507 Interface Kabel und die AutoStar Updater
Software. Nähere Informationen zum Update finden Sie im Support-Bereich
unter: www.meade.de. Einstellungen an der Handbox sind hierfür nicht erforderlich. Statistik: Hier lassen sich statistische Informationen über den AutoStar-II
abrufen:
• Freier Speicher: Anzeige in kB, wieviel Speicher noch für
Benutzerobjekte zur Verfügung steht.
• Version: Zeigt die geladene Firmware-Version des AutoStar-II an.
• Seriennummer: Zeigt die Seriennummer des Gerätes an.
Reset: Hiermit wird ein kompletter Reset des AutoStar-II durchgeführt. Es
werden alle Werte auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Im Anschluss ist
eine neue Initialisierung des Teleskops (siehe automatische Ausrichtung, Seite
18) erforderlich.
Schnellzugriffstasten
Zwei Menüs, sechs Objektdatenbanken und zwei Funktionen können einfach
und bequem über die Schnellzugriffstasten auf der Zifferntastatur erreicht
werden. Die beiden Funktionen (Geschwindigkeit und Leseleuchte) wurden
bereits weiter oben beschrieben.
FOCUS
Mikrofokussierer: Drücken Sie auf der Handbox. Mit den -
Tasten kann eine Geschwindigkeit ausgewählt und mit bestätigt werden.
4
ENTER
qp
Nun kann mit den Pfeiltasten genau fokussiert werden. Siehe auch Seite 17 für
weitere Informationen.
RET
Fadenkreuzbeleuchtung: Drücken Sie , um das Menü zu aktivieren.
„Fadenkreuz-Steuerung: Einstellen Helligkeit“ erscheint. Mit den Tasten können Sie nun den Ihnen passenden Wert einstellen. Anschließend mit
ENTER
Tasten die Blinkgeschwindigkeit von kurzem Blinken bis Dauerlicht einstellen
und wieder mit speichern. Mit nochmaligem Drücken von erscheint
Tasten das Verhältnis zwischen Blink- und Auszeit einstellen und wieder mit
ENTER
speichern. Mit nochmaligem Drücken von erscheint
PulsrateEinstellen:
ENTER
PulslaengeEinstellen:
. Nun können Sie mit den -
. Hier können Sie mit den -
speichern. Das Fadenkreuz-Menü verlassen Sie mit .
7
p q
RET
7
qp
RET
7
qp
MODE
Objektkataloge: Siehe Seite 25 für weitere Informationen
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
31
Page 32

LX20 0 A C F
AutoStar-II - Funktionen
Weiterführende AutoStar-II - Funktionen
Nachdem Sie nun die Grundfunktionen des AutoStar-II und dessen Bedienung
kennen gelernt haben, sollen auf den folgenden Seiten spezielle Funktionen und
Menüs vertieft werden. Es wird jeweils vorausgesetzt, dass das Teleskop
initialisiert und ausgerichtet wurde.
Hinweis: Bei GPS-Ausrichtung wird der exakte Standort
des Teleskops automatisch
erkannt und gespeichert. Bei
Standortwechseln wird dies
auch automatisch festgestellt
und nach Bestätigung aktualisiert. Ein manuelles Aktualisieren
ist hier nicht notwendig.
Hinzufügen von Standorten
Wenn Sie das Teleskop ohne GPS-Unterstützung an verschiedenen
geografischen Orten einsetzen möchten, so lassen sich für die Ausrichtung
verschiedene Orte im AutoStar-II einstellen. Diese können individuell bearbeitet
werden.
Hinzufügen eines Ortes aus der Datenbank zur benutzerdefinierten Liste:
In diesem Beispiel wird eine Stadt aus der Datenbank ausgewählt und der
Benutzerliste hinzugefügt.
1. Gehen Sie zum Menüpunkt und
drücken Sie .
2. „Hinzufügen“ auswählen und mit bestätigen.
ENTER
ENTER
3. Scrollen Sie durch die Liste der Staaten und wählen Sie den betreffenden aus.
4. Scrollen Sie nun durch die Liste der Städte und drücken Sie ,
wenn die nächstliegende angezeigt wird.
5. Um diese auszuwählen, gehen Sie zu „Setup“ > „Ort“ > „Wählen“ und
bestätigen Sie die Auswahl mit .
ENTER
Einen Ort bearbeiten:
In diesem Menüpunkt können Sie einen nicht in der Datenbank enthaltenen Ort
eingeben, indem Sie einen naheliegenden Ort bearbeiten (Namen, Koordinaten
und Zeitzone). Hierfür müssen die Koordinaten des betreffenden Ortes bekannt
sein.
1. Wählen Sie einen naheliegenden Ort aus dem Benutzerverzeichnis aus.
2. Scrollen Sie zu „Ort: Ändern“ und drücken Sie .
NameÄndern:
erscheint. Drücken Sie .
3. Es erscheint nun der Name des gewählten Ortes.
4. Mit den Pfeiltasten können Sie nun einen richtigen Namen eingeben und
mit bestätigen. Es erscheint anschließend wieder
5. Mit Druck auf die -Taste gelangen Sie nun zu „Ändern:
Breitengrad“. Mit bestätigen.
6. Mit den Zifferntasten können Sie nun den Breitengrad eingeben und mit
7. Nochmals betätigen und Sie gelangen zu
Geogr. Länge
8. Mit den Zifferntasten können Sie nun den Längengrad eingeben und mit
9. Mit nochmals kommen Sie nun zu
Zeitzone
ENTER
ENTER
ENTER
bestätigen.
q
bestätigen.
NameÄndern:
q
ENTER
. Drücken Sie .
q
ENTER
. drücken. Wenn der Ort in Ihrer Nähe liegt,
.
ENTER
braucht die Zeitzone nicht geändert zu werden. Andernfalls geben Sie
die Zeitzone in Differenz zu Greenwich wie folgt ein: Westlich von
Greenwich -1 pro Zeitzone, östlich +1 pro Zeitzone.
10. Nach Bestätigung mit erscheint wieder
Zeitzone
11. Drücken Sie , um auf zu
MODE
.
ENTER
kommen.
12. Mit den Pfeiltasten scrollen Sie nun zu
waehlen
und wählen den Ort aus der Liste, den Sie gerade
bearbeitet haben.
OrtSetup:
ENTER
ENTER
ENTER
Ändern:
Ändern:
Ändern:
AendernOrt:
Ort:
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
32
(c) nimax GmbH
Page 33

Tipp: Neben den Objekten
aus der Datenbank kann
auch jede andere Himmelskoordinate angefahren
werden. Halten Sie die
MODE
-Taste für mindestens
zwei Sekunden gedrückt. Die
aktuellen Koordinaten in RA
und DEC werden angezeigt.
Drücken Sie nun .
Jetzt können die gewünschten Koordinaten von Hand
eingegeben und jeweils mit
ENTER
bestätigt werden. Das
Teleskop fährt diese dann im
Anschluss automatisch an
und führt sie nach.
GOTO
LX20 0 A C F
AutoStar-II - Funktionen
Erstellen eigener Objekte
Sollte ein Objekt nicht in der Datenbank des AutoStar-II enthalten sein, können
Sie dieses dennoch manuell samt Namen und Koordinaten ergänzen. Zusätzlich
können Sie die Helligkeit und Größe des Objektes speichern. Obwohl der
AutoStar-II bereits eine sehr große Datenbank mit Himmelsobjekten (Sterne,
Nebel, Planeten, etc.) enthält, kann es manchmal notwendig sein, externe
Objekte hinzuzufügen. Diese können dann unter „Benutzerobjekte“ der
Datenbank hinzugefügt und per direkt angefahren werden. Um dieses
Menü nutzen zu können, benötigen Sie die Koordinaten in RA und DEC des
Objektes, das Sie abspeichern möchten. Diese können Sie z.B. astronomischen
Zeitschriften und Büchern, CD-ROMs, etc. entnehmen. Wenn Sie ein Objekt nur
einmalig betrachten möchten ohne es extra abzuspeichern, können Sie auch die
Koordinaten manuell anfahren.
Eingabe eines Objektes in die Benutzerdatenbank:
1. Stellen Sie sicher, dass der AutoStar-II initialisiert und das Teleskop
ausgerichtet ist.
2. Wählen Sie aus und drücken
3. erscheint. Drücken Sie die
4. erscheint; mit 1 Mal
ENTER
Sie .
p
-Taste, bis erscheint und
drücken Sie .
gelangen Sie zu . Drücken Sie
ENTER
.
SonnensystemObjekt:
ENTER
WaehlenBenutzerobjekt:
5. Es erscheint nun „Name“ auf der oberen Zeile mit einem blinkenden
Cursor auf der unteren. Nun können Sie mit den Cursortasten den
Namen des Objekts eingeben. Wenn Sie fertig sind, bestätigen Sie mit
ENTER
.
6. wird angezeigt. Mit den
00.00.0RA:
Zifferntasten können Sie nun die Koordinaten im Format
[Stunden.Minuten.Zehntelminuten] eingeben und mit bestätigen.
7. wird angezeigt. Mit den
+00°.00’Deklination:
Zifferntasten können Sie nun die Koordinaten im Format [ Grad .
Minuten ] eingeben und mit den Cursortasten zwischen + und - wechseln; anschließend mit bestätigen.
8. Der AutoStar-II fordert Sie nun zur Eingabe der Objektgröße auf; diese
Eingabe ist optional. Wenn Sie möchten, können Sie den Wert in
Bogenminuten eingeben und mit speichern. Wenn Sie nichts
eingeben möchten, drücken Sie ohne vorherige Eingabe.
9. Der AutoStar-II fordert Sie nun zur Eingabe der Objekthelligkeit auf;
dieser Schritt ist ebenfalls optional. Nachdem gedrückt wurde,
erscheint wieder auf dem
Display.
GOTO
ObjektAuswahl:
BenutzerobjektObjekt:
HinzufuegenBenutzerobjekt:
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
HinzufuegenBenutzerobjekt:
q
Ein Benutzerobjekt anfahren:
Hier können Sie ein selbst eingegebenes Objekt aussuchen und mittels
positionieren.
1. Wenn angezeigt wird, drücken
Sie einmal die -Taste. wird
angezeigt. drücken.
2. Falls nötig, mittels der -Tasten ein Objekt auswählen und mit
ENTER
bestätigen.
3. Objektname und Koordinaten werden angezeigt.
4. Wenn Sie nun drücken, wird das Objekt positioniert.
p
ENTER
GOTO
HinzufuegenBenutzerobjekt:
WaehlenBenutzerobjekt:
qp
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
GOTO
33
Page 34

Hinweis: Satellitenorbits sind
selten länger als ein paar
Wochen konstant. Sie sollten
daher vor der Beobachtung die
aktuellen Bahndaten mittels des
AutoStar Update Programms in
das LX200ACF laden.
Hinweis: Wenn die Stelle des
Aufgangs durch ein Gebäude
oder dergleichen verdeckt sein
sollte, drücken Sie , und
das Teleskop bewegt sich entlang der berechneten Satellitenstrecke. Sobald die Sicht frei ist,
drücken Sie erneut und
das Teleskop stoppt wieder.
ENTER
ENTER
LX20 0 A C F
AutoStar-II - Funktionen
Beobachtung von Satelliten
In dieser Übung bereiten Sie das Teleskop für die Beobachtung eines
Satellitendurchgangs vor.
1. Wählen Sie an und drücken Sie
2. Mit den können Sie durch die Liste verfügbarer Satelliten
ENTER
.
qp
blättern.
3. Wählen Sie einen Satelliten aus und drücken Sie .
4. und dann wird angezeigt. Wenn
der Satellit in Kürze erscheint, wird „Passage gefunden“ angezeigt.
5. Mit den können nun die Daten „AOS“ (Aquisition of Signal –
qp
Satellitenaufgang) und „LOS“ (Loss of Signal – Satellitenuntergang)
angezeigt werden. Die Zeitdifferenz ist die Zeit, wie lange der Satellit
sichtbar sein wird.
6. Auf dem Display erscheint . Nach Druck auf
wird die Alarmzeit automatisch auf eine Minute vor dem berechneten
Satellitenaufgang gesetzt. Bis dahin kann das Teleskop normal genutzt
werden.
7. Wenn der Wecker ertönt, kehren Sie in das Satellitenmenü zurück und
wählen Sie den betreffenden Satelliten aus.
8. Nach einem Druck auf fährt das Teleskop automatisch die Stelle
GOTO
an, an der der Satellit erscheinen sollte. Die Antriebe werden gestoppt
und ein Countdown erscheint.
9. Ca. 20 Sekunden vor dem Countdown-Ende blicken Sie durch den
Sucher und beobachten, wie der Satellit ins Gesichtsfeld eintritt.
10. Bei Eintritt drücken Sie und das Teleskop startet die Nachführung.
ENTER
11. Mit den Pfeiltasten des AutoStar können Sie den Satelliten im Okular
zentrieren.
SatellitObjekt:
ENTER
Nachfuehren...Berechne
Wecker
ENTER
Hinweis: Die Beobachtung
von Satelliten ist eine interessante Herausforderung. Die meisten Satelliten befinden sich in
einem niedrigen Orbit und
bewegen sich mit durchschnittlich 28.000 km/h. Nach dem
Aufgang ziehen sie sehr schnell
über den Himmel, was eine hohe
Nachführgeschwindigkeit des
Teleskops erfordert. Die beste
Beobachtungszeit ist nahe
Sonnenauf- oder -untergang,
wenn der Himmel noch dunkel
ist. Beobachtungen in der Mitte
der Nacht sind problematisch,
weil die Satelliten dann bei der
Passage in den Erdschatten eintreten und unsichtbar werden.
Wie eingangs beschrieben, sind Satellitenbahnen nicht langfristig konstant. Sind
die Bahndaten älter als ca. ein Monat, so können die Aufgangszeiten und
Bahnen evtl. nicht mehr mit denen vom AutoStar-II berechneten zusammenpassen. Führen Sie hier regelmäßig ein Update mittels der AutoStar Suite durch.
Landobjekte
Diese Option ermöglicht das Abspeichern von terrestrischen Objekten im
Landobjekte-Verzeichnis. Zuerst muss hier ein Landobjekt mittels der
„Hinzufügen“-Funktion gespeichert werden. Zur Beobachtung wird dann die
„Landobjekte-Überblick“ Funktion im Zubehörmenü genutzt werden.
Hinzufügen eines Landobjekts zur Datenbank:
In diesem Vorgang werden terrestrische Objekte der Datenbank des AutoStar-II
hinzugefügt.
1. Den genauen Standort und die Ausrichtung des LX200ACF merken
bzw. notieren für ein zukünftiges Anfahren des Objektes.
2. Wählen Sie „terrestrisch“ im Menü „Setup: Ziele“ aus und bestätigen
Sie mit . Hierdurch wird die Nachführung für astronomische
Objekte ausgeschaltet. Stellen Sie sicher, dass die Nachführung später
für astronomische Objekte wieder eingeschaltet ist.
3. Drücken Sie 1 Mal . wird
angezeigt.
4. Drücken Sie 1 Mal die -Taste, so dass
Objekt
WaehlenLandobjekt:
ENTER
Funktion benutzt. Es kann ebenso die
MODE
Auswahl: Setup
q
angezeigt wird und drücken Sie .
Auswahl:
ENTER
5. Drücken Sie die -Taste 2 Mal, es wird
Landobjekte
Landobjekt: Waehlen
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
34
p
angezeigt. Nach einem Druck auf erscheint
.
Objekt:
(c) nimax GmbH
ENTER
Page 35

LX20 0 A C F
AutoStar-II - Funktionen
6. Mit einem Druck auf die -Taste gelangen Sie nun zu
HinzufuegenLandobjekt:
7. Auf dem Display erscheint: . Mit
den Pfeiltasten können Sie nun einen Namen eingeben und mit
q
ENTER
. Mit bestätigen.
NameLandobjekt:
ENTER
bestätigen.
8. „Landobjekt zentrieren. ENTER
Landobjekt: Hinzufuegen
drücken“ erscheint. Mit den Pfeiltasten (das Teleskop nicht manuell
bewegen!) nun das Objekt im Gesichtsfeld zentrieren und mit
ENTER
bestätigen. Es ist nun in der Datenbank gespeichert.
9. erscheint. Wiederholen Sie die
HinzufuegenLandobjekt:
Schritte 5 bis 8, wenn Sie weitere Objekte speichern wollen.
Auswahl eines Landobjekts aus der Datenbank:
1. Stellen Sie sicher, dass das Teleskop exakt so aufgestellt und ausgerichtet ist, wie zu dem Zeitpunkt als das betreffende Objekt gespeichert
wurde.
2. Gehen Sie zur Menüoption und
drücken Sie * .
3. Mit den -Tasten können Sie nun unter den gespeicherten
Landobjekt:
ENTER
qp
Objekten wählen. Drücken Sie , wenn das gewünschte Objekt
erscheint.
4. Drücken Sie , um das Objekt anzufahren.
5. Mit können Sie das Menü wieder verlassen.
MODE
GOTO
Waehlen
ENTER
Durchführen eines Landobjekte-Überblicks:
Diese Funktion erlaubt es Ihnen, eine Tour zu allen abgespeicherten
Landobjekten zu machen. Bitte beachten Sie, dass dies nur funktioniert, wenn
sich Objekte bereits in der Datenbank befinden.
1. Gehen Sie zum Menüpunkt und
drücken Sie .
2. wird angezeigt. Das Teleskop
ENTER
Positioniere...Landobjekt:
Zubehoer:
Landobjekt
fährt das erste Landobjekt der Liste an und zeigt seinen Namen auf dem
Display.
3. Mit stoppen Sie den Überblick; mit kann er wieder am
MODE
ENTER
ersten Objekt neu gestartet werden.
Den noch verfügbaren Speicher des AutoStar-II prüfen:
Der freie Speicher des AutoStar-II ist begrenzt. Mit dem Abspeichern von
Benutzerobjekten verbrauchen Sie Speicher. So können Sie prüfen, wieviel
Speicher noch verfügbar ist:
1. Gehen Sie zum Menüpunkt „Setup: Statistik“ und drücken Sie .
2. wird z.B. angezeigt. Dies ist der
37,2k Char FreeStatistik:
ENTER
noch verfügbare Speicher in kB.
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
35
Page 36

Hinweis: Damit diese Funktion sinnvolle Ergebnisse liefert,
muss das LX200ACF vorher korrekt initialisiert und ausgerichtet
worden sein und darf nicht
manuell bewegt werden.
LX20 0 A C F
AutoStar-II - Funktionen
Identifizieren
Hiermit können Sie Himmelsobjekte, die Sie selbst z.B. mittels der Pfeiltasten
„entdeckt“ haben, vom AutoStar-II identifizieren lassen. Wenn das Objekt selbst
nicht enthalten ist, werden Informationen über das am nächsten liegende Objekt
inklusive Distanz angezeigt.
Im folgenden Beispiel ist ein Objekt im Okular zentriert worden; nun kann mittels der
„Identifizieren“ Funktion das Objekt herausgefunden und beschrieben werden.
1. Zentrieren Sie das betreffende Objekt im Okular.
2. Gehen Sie zum Menüpunkt und
drücken Sie .
ENTER
3. „Suche…“ erscheint. Nach Abschluss erscheint der Name des Objekts
bzw. des nächstliegenden Objekts im Display.
4. Mittels der -Tasten können weiterführende Informationen
p q
über das Objekt angezeigt werden:
Angezeigte Information: Beispiel:
Katalog- oder Eigenname Messier 107, NGC 6171, Orionnebel, etc.
Objekttyp Kugelsternhaufen, Nebel, Galaxie, etc.
RA 16:32:4
DEC 13° 03’
Sternbild Jungfrau, Orion, etc.
Helligkeit 3 [mag]
Größe 2’
Lauftext „Dieser Kugelsternhaufen ist ca. 10.000 LJ…“
Objekt: Identifizieren
Suchen
Mit dieser Funktion können Sie die Datenbanken nach Objekten mit bestimmten
Eigenschaften durchsuchen. „Parameter ändern“ gibt die gewünschten
Objekteigenschaften vor, „Suche starten“ aktiviert die Suche. Eine Suche kann
beispielhaft wie folgt aussehen:
1. Wählen Sie „Suchen“ im Objektmenü aus und drücken Sie .
Suche starten
2. Drücken Sie eine -Taste, so dass
angezeigt wird und drücken Sie wieder .
3. wird angezeigt. Drücken Sie
Param. aendern: Grösser als
ENTER
.
wird angezeigt.
p q
Param. aendern
ENTER
4. „Größer als“ und ein Wert werden angezeigt. Nachdem Sie einen Wert
(in Bogenminuten) eingegeben haben, werden nur noch Objekte bis
max. dieser Größe gesucht. Mit bestätigen.
5. Mit der -Taste kommen Sie nun zu
Kleiner als
q
. Hier können Sie ebenso einen Wert in
ENTER
Param. aendern:
Bogenminuten eingeben. Fahren Sie in dieser Weise mit den anderen
Parametern „Heller als“, „Schwächer als“ und „Höher als“ fort.
6. Zuletzt wird angezeigt. Wenn Sie z.B. keine
schwarzen Löcher in den Ergebnissen haben möchten, so drücken Sie
ENTER
und das „+“ neben dem entsprechenden Objekttyp wechselt zu
Objekttypen
einem „-“ und umgekehrt. Suchen Sie auf diese Weise die anderen
Objekttypen gemäß Ihren Wünschen aus.
7. Anschließend drücken Sie 2 Mal und 1 Mal . Nun befinden
Sie sich wieder bei „Suche starten“. drücken. „Suche starten:
Nächstes Objekt“ wird angezeigt. Mit bestätigen. Der AutoStar-II
MODE
q
ENTER
ENTER
durchsucht nun seine Datenbank und zeigt das erste Objekt an, das mit
Ihren zuvor eingestellten Kriterien übereinstimmt. Mit den -
Tasten können Sie weitere Informationen abrufen. Wiederholen Sie diesen Vorgang, um alle Objekte anzuzeigen. Mit Druck auf wird das
jeweilige Objekt angefahren.
8. Mit wiederholtem Druck auf verlassen Sie das Menü.
MODE
GOTO
ENTER
qp
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
36
(c) nimax GmbH
Page 37

LX20 0 A C F
AutoStar-II - Funktionen
Alternative azimutale Ausrichtmethoden
Wenn Sie Ihr Teleskop lieber ohne die automatische Methode ausrichten
möchten, bietet der AutoStar-II sowohl für die azimutale als auch für die parallaktische Aufstellung alternative Ausrichtmethoden an. Bei der Ein- und Zwei-SternAusrichtung müssen Sie, im Gegensatz zur „Easy“ und „Automatisch“ Methode,
das Teleskop manuell in die Grundposition bringen. Das Vorgehen für die
parallaktische Ausrichtung wird in Anhang A ab Seite 50 beschrieben; die drei
alternativen azimutalen Ausrichtungen werden im Folgenden dargestellt.
Initialisierung des AutoStar-II
Als erstes muss der AutoStar-II initialisiert werden.
1. Ziehen Sie die RA- und DEC-Klemmungen handfest an.
2. Stellen Sie sicher, dass die AutoStar-II Handbox am Teleskop
angeschlossen ist.
3. Schalten Sie das Teleskop ein und warten Sie den Selbsttest ab.
4. Bestätigen Sie die Sonnenwarnung mit einem Druck auf die angezeigte
Taste.
5. Es wird nun: angezeigt.
Ausrichtung: Automatisch
Sie können nun eine alternative azimutale Ausrichtung durchführen.
Easy (Zwei-Stern) Ausrichtung
Bei dieser Methode sucht der AutoStar-II selbsttätig zwei Ausrichtungssterne
aus seiner Datenbank aus und fährt diese automatisch an. Der Benutzer wird
wie gewohnt aufgefordert, diese zu zentrieren und zu bestätigen.
Hinweis: Wenn gewünscht,
können die Home-Sensoren, wie
auf Seite 30 beschrieben, abge-
schaltet werden.
Norden
Stativ
wagerecht
ausrichten
Abb. 19: Alt/Az Home Position
Abb. 20: Dec.-Teilkreis auf 0°
Dec. Position
Durchführung der Easy-Ausrichtung
1. Nach der Initialisierung auswählen und mit bestätigen.
ENTER
Ausrichtung: Easy
2. Das Teleskop fährt nun die Home-, Level- und Nordpositionen an.
3. Sternausrichtung: Der AutoStar-II fährt nun zwei Sterne zum Zentrieren und Bestätigen an. Siehe hierzu auch die Infobox auf Seite 19.
Nach erfolgter Ausrichtung wird
OKAusrichtung:
angezeigt; andernfalls ist die Ausrichtung zu wiederholen.
Zwei-Sterne-Ausrichtung
Diese Ausrichtung erfordert einige Kenntnisse des Nachthimmels. Der AutoStarII bietet hier eine Liste von hellen Sternen aus seiner Datenbank an, die vom
Benutzer frei gewählt werden können. Es wird keine Level-, Home- oder NordAusrichtung durchgeführt.
1. im Display.
2. Wählen Sie mit den -Tasten
Zwei-Sterne
3. Bringen Sie das Teleskop in die Home-Position.
a) Bringen Sie den Tubus auf 0° am DEC-Teilkreis.
b) Ziehen Sie die DEC-Klemmung handfest an.
c) Richten Sie den Stativkopf waagerecht aus.
d) Drehen Sie das Teleskop so, dass sich das Anschlussboard auf der
Südseite des Teleskops befindet.
e) Lösen Sie die RA-Klemmung und drehen Sie den Tubus so, dass er
nach Norden zeigt und ziehen Sie die RA-Klemmung wieder an.
f) Drücken Sie nun .
4. erscheint. Der AutoStar bietet Ihnen eine Auswahl
Stern waehlen
hellerer Sterne aus seiner Datenbank an. Wählen Sie einen gut zu
erkennenden Stern aus und drücken Sie .
5. Das Teleskop fährt den Stern nun grob an. Nach der Zentrierung im
Okular mittels der Pfeiltasten drücken Sie .
6. Wiederholen Sie den Vorgang mit dem zweiten Stern.
AutomatischAusrichtung:
qp
und drücken Sie .
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
Ausrichtung
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
37
Page 38

LX20 0 A C F
AutoStar-II - Funktionen
Ein-Stern-Ausrichtung
Die Ein-Stern-Ausrichtung erfordert einige Kenntnisse des Nachthimmels. Der
AutoStar-II bietet Ihnen auch hier eine Liste heller Sterne an. Die Ein-SternAusrichtung ist identisch mit der Zwei-Stern-Ausrichtung; es wird hier nur der
zweite Stern weggelassen.
LX200ACF Tipps:
Spieglein, Spieglein ...
Das LX200ACF ermöglicht eine präzise und feinfühlige Bedienung des
Hauptspiegels und der Fokussierung.
Eine dieser Funktionen ist die Hauptspiegelfixierung (9, Abb. 1). Diese
Einrichtung hilft, das Spiegelkippen zu verhindern. Spiegelkippen kann dann auftreten, wenn der Tubus z. B. von einer Himmelsrichtung zur genau gegenüberliegenden fährt. Der Spiegel verschiebt sich dann minimal, und die
Feinfokussierung und Positioniergenauigkeit sind dann verfälscht. Um dies zu
verhindern, drehen Sie nach Abschluß der Grobfokussierung den Knopf der
Hauptspiegelfixierung (9, Abb. 1) in Richtung „Lock“ (Feststellen) und ziehen ihn
handfest an.
Wichtiger Hinweis:
mehr an der Grobfokussierung (6, Abb. 1) drehen! Sie würden damit versuchen, den festgestellten Spiegel zu bewegen, würden ihn so samt
Mechanik verkanten und beschädigen.
Die zweite Funktion ist der „Shifting“-freie Mikrofokussierer (24, Abb. 1).
Der Mikrofokussierer erlaubt ein wackelfreies Fokussieren und darüberhinaus auch ein kipp-freies Fokussieren, bei dem das Bild nicht mehr aus
dem Gesichtsfeld des Okulars herauswandert („Shifting“).
Hier nun einige Tipps, wie Sie das Beste aus Ihrer Feinfokussierung
machen. Für detaillierte Angaben zum Mikrofokussierer sehen Sie bitte
auf Seite 17 nach.
1. Fahren Sie den Schlitten des Mikrofokussierers halb heraus. Drehen
Sie die Fixierung (9, Abb. 1) in Richtung „Unlock“ (freigeben) bis er
leichtgängig wird.
2. Zentrieren Sie einen hellen Stern im Okular und fokussieren Sie ihn
zunächst nur grob (6, Abb. 1).
3. Fixieren Sie nun den Hauptspiegel, bis der Knopf (9, Abb. 1) schwergängig wird.
4. Nun den Grobfokus (6, Abb. 1) NICHT mehr berühren. Drücken Sie am
Autostar-II und betätigen die Pfeiltasten.
5. Wenn gewünscht, verändern Sie die Fokussiergeschwindigkeit mit
den
6. Wiederholen Sie diese Vorgehensweise, wenn Sie das Okular gewechselt haben.
Da der Hauptspiegel nun fixiert ist, dürfen Sie nicht
FOCUS
4
qp
-Tasten
.
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
38
(c) nimax GmbH
Page 39

Hinweis: Die „Trainiere“-
Option überschreibt eventuelle
bisherige Korrekturmodelle.
LX20 0 A C F
AutoStar-II - Funktionen
Korrektur des periodischen Schneckenfehlers
Für die Astrofotografie mit längeren Belichtungszeiten ist es notwendig, die
unvermeidlichen minimalen Abweichungen im Lauf der Schneckengetriebe
auszugleichen um Objekte exakt auf einem Punkt zu halten. Die Korrektur des
periodischen Schneckenfehlers („Periodic Error Correction“, PEC) hilft Ihnen
hierbei. Für die Durchführung benötigen Sie ein hoch vergrößerndes
Fadenkreuzokular mit z.B.. 9mm Brennweite (siehe Seite 42). PEC ist für beide
Achsen verfügbar.
„Trainiere“ Menü-Option
Bei azimutaler Aufstellung kann (und soll!) das PEC-Training in beiden Achsen
durchgeführt werden. Bei parallaktischer Aufstellung ist es nur für die RA-Achse
erforderlich. Wenn das Training bei parallaktisch aufgestelltem Teleskop durchgeführt wird, stellen Sie bitte sicher, dass auch „Parallaktisch“ im Menüpunkt
„Setup“ > „Teleskop“ > „Montierung“ angewählt ist.
Für das Training in der DEC-Achse wählen Sie einen Stern, welcher im Osten
oder Westen ca. 20° über dem Horizont steht.
Für das Training in der RA-Achse wählen Sie einen Stern, welcher im Süden (für
Beobachter auf der Südhalbkugel: im Norden) ca. 30° über dem Horizont steht.
1. Wählen Sie „Trainiere“ vom PEC Menü („Setup“ > „Teleskop“ > „PEC“)
für die gewünschte Achse und drücken Sie .
2. Blicken Sie durch das Okular. Halten Sie den Stern mit den Pfeiltasten
genau in der Mitte des Fadenkreuzes, aber versuchen Sie keine
Luftunruhe (Sternflimmern) auszugleichen. Der AutoStar zeigt eine steigende Zahlenfolge von 0 bis 600 für eine ganze
Schneckenumdrehungen an; ein kompletter Zyklus dauert ca. 24
Minuten.
3. Drücken Sie , um das Menü zu verlassen.
MODE
ENTER
Menüoption Update
Mittels der Update-Funktion kann die bisherige PEC verbessert werden; es
empfiehlt sich, das Training auf diese Weise zwei bis drei Mal zu überarbeiten.
Das Update überschreibt die Daten nicht, sondern nimmt die zusätzlichen
Korrekturen zur „Verfeinerung“ des PEC her.
Menüoption Löschen
Hiermit wird das bisherige Korrekturmodell gelöscht.
Menüoption Ein/Aus
Hiermit wird die Fehlerkorrektur ein- und ausgeschaltet.
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
39
Page 40

123
Abb. 21: Das LX200ACF mit
montiertem 35 mm
Kleinbild-Kameragehäuse:
1
Kamera-Adapter #62
2
T-Ring
3
35 mm Kameragehäuse
Abb. 22: Ein typisches Beispiel
für Vignettierung:
Am Rande des Bildes sind
schwarze Ränder zu sehen.
LX20 0 A C F
Fotografie
Fotografie
Mit diesem Teleskop kann mit jeder handelsüblichen 35mm Spiegelreflexkamera
fotografiert werden. Auch die Benutzung digitaler Spiegelreflexkameras und
astronomischer CCD-Kameras ist problemlos möglich. Spiegelreflex-Kameras
können mittels des #64 T-Adapters und eines T-2 Rings direkt an das SCGewinde oder an den optional erhältlichen Mikrofokussierer angeschlossen werden; hierbei wirkt dann das Teleskop als Objektiv. Siehe auch Abb. 21.
Um die Kamera der Bildorientierung anzupassen, können Sie mit einem kleinen
Uhrmacherschraubendreher die radialen Klemmschrauben des T-2 Rings leicht
lösen, die Kamera dann drehen und die Schrauben wieder anziehen.
Wenn eine 35mm Spiegelreflex-Kamera an das Teleskop angeschlossen wird,
kann es zu einer Vignettierung am Rand des Bildfelds kommen (siehe Abb. 22).
Astrofotografie mit großen Brennweiten erfordert in hohem Masse Sorgfalt und
systematisches Vorgehen. Es empfiehlt sich hier die Anschaffung entsprechender Fachliteratur und der Besuch astronomischer Vereinigungen, wo man sich –
gerade als Einsteiger – sehr gut mit erfahrenen Astrofotografen austauschen
kann.
Ein paar Tipps für die Fotografie mit dem LX200ACF:
1. Benutzen Sie in jedem Fall das mitgelieferte Stativ oder eine feste Säule.
Bei einer Aufnahmebrennweite von 2000mm ruinieren selbst kleinste
Erschütterungen das Bild. Bei Belichtungszeiten länger als ca. 2-3
Minuten empfiehlt sich die Verwendung einer Polhöhenwiege bzw. des
Bildfeld-Derotators. Vorsicht: Wenn länger bauendes Zubehör hinten
am LX200ACF angeschlossen ist, kann dieses unter Umständen an der
Montierung anstoßen – vergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme über
die Grenzen der Bewegungsfreiheit mit angeschlossenem Zubehör.
2. Benutzen Sie einen Fernauslöser für die Kamera; ansonsten führen die
unvermeidlichen Erschütterungen beim Berühren der Kamera zu
verwackelten Bildern.
3. Verwenden Sie besondere Aufmerksamkeit auf die Fokussierung. Für
manche Kameramodelle sind spezielle Mattscheiben erhältlich, die die
Fokussierung des Bildes erleichtern.
4. Für die Belichtungszeiten können keine allgemein gültigen
Empfehlungen gegeben werden. Dies hängt in hohem Masse vom
Öffnungsverhältnis des Teleskops, von der Film- bzw. Chipempfindlichkeit und dem aufgenommenen Objekt ab. Hinweis: Die evtl.
vorhandene automatische Belichtungssteuerung von Kameras ist nicht
für astronomische Anwendungen ausgelegt und kann in diesem Bereich
keine befriedigenden Ergebnisse liefern.
5. Terrestrische Fotografie mit langen Brennweiten hängt ebenfalls wie die
astronomische Fotografie in starkem Ausmaß von der stets mehr oder
weniger vorhandenen Luftunruhe ab. Ein Standort außerhalb von
Ortschaften ist hier von Vorteil.
6. Die Fotografie des Mondes und der Planeten kann ebenfalls sehr
interessant sein; hierfür ist auch die Meade LPI Kamera besonders gut
geeignet.
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
40
(c) nimax GmbH
Page 41

Abb. 23a: Serie 4000
Super Plössl Okulare
Abb. 23b: QX Weitwinkelokulare
der Serie 4000
Abb. 23c: Serie 5000 Plössl
Okulare
Abb. 23d: Serie 5000
Superweitwinkelokulare
Abb. 23e: Serie 5000
Ultraweitwinkelokulare
LX20 0 A C F
Zubehör
Optionales Zubehör
Für die LX200ACF Teleskope ist ein großes Sortiment an Zubehör verfügbar,
welches in seiner Qualität mit der des Teleskops auf einem Niveau ist. Eine
genaue und detaillierte Übersicht hierüber bietet Ihnen der aktuelle
Meade-Hauptkatalog.
8
" f/10
Super Plössl Okulare der Serie 4000
Brenn- Steck Ver- Gesichts- Ver- Gesichts- Ver- Gesichts- Ver- Gesichts- Ver- Gesichts-
weite Ø größerung feld größerung feld größerung feld größerung feld größerung feld
6.4 mm 11/4" 313x 0.17° 391x 0.13° 476x 0.11° 555x 0.09° 634x 0.08°
9.7 mm 11/4" 206x 0.25° 258x 0.20° 314x 0.17° 366x 0.14° 419x 0.12°
12.4 mm 11/4" 161x 0.32° 202x 0.26° 246x 0.21° 287x 0.18° 327x 0.16°
15 mm 11/4" 133x 0.39° 167x 0.31° 203x 0.26° 237x 0.22° 271x 0.19°
20 mm 11/4" 100x 0.52° 125x 0.42° 152x 0.34° 178x 0.29° 203x 0.26°
26 mm 11/4" 77x 0.68° 96x 0.54° 117x 0.44° 137x 0.38° 156x 0.33°
32 mm 11/4" 63x 0.83° 78x 0.67° 95x 0.55° 111x 0.47° 127x 0.41°
40 mm 11/4" 50x 0.88° 63x 0.70° 76x 0.58° 89x 0.49° 102x 0.43°
56 mm 2" 36x 1.46° 45x 1.16° 54x 0.96° 63x 0.82° 73x 0.72°
QX Weitwinkel-Okulare der Serie 4000
Brenn- Steck Ver- Gesichts- Ver- Gesichts- Ver- Gesichts- Ver- Gesichts- Ver- Gesichts-
weite Ø größerung feld größerung feld größerung feld größerung feld größerung feld
15 mm 11/4" 133x 0.35° 167x 0.42° 203x 0.34° 237x 0.30° 271x 0.26°
20 mm 11/4" 100x 0.70° 125x 0.56° 152x 0.46° 178x 0.39° 203x 0.34°
26 mm 2" 77x 0.91° 96x 0.73° 117x 0.60° 137x 0.51° 156x 0.45°
30 mm 2" 67x 1.05° 83x 0.84° 102x 0.69° 119x 0.59° 135x 0.52°
36 mm 2" 56x 1.26° 69x 1.01° 85x 0.83° 99x 0.71° 113x 0.62°
Plössl Okulare der Serie 5000
Brenn- Steck Ver- Gesichts- Ver- Gesichts- Ver- Gesichts- Ver- Gesichts- Ver- Gesichts-
weite Ø größerung feld größerung feld größerung feld größerung feld größerung feld
5,5 mm 11/4" 364x 0.17° 455x 0.13° 554x 0.11° 646x 0.09° 738x 0.08°
9 mm 11/4" 222x 0.27° 278x 0.22° 339x 0.18° 395x 0.15° 451x 0.13°
14 mm 11/4" 143x 0.42° 179x 0.34° 218x 0.28° 254x 0.24° 290x 0.21°
20 mm 11/4" 100x 0.60° 125x 0.48° 152x 0.39° 178x 0.34° 203x 0.30°
26 mm 11/4" 77x 0.78° 96x 0.62° 117x 0.51° 137x 0.44° 156x 0.38°
32 mm 2" 63x 0.96° 78x 0.77° 95x 0.63° 111x 0.54° 127x 0.47°
40 mm 2" 50x 1.20° 63x 0.96° 76x 0.79° 89x 0.68° 102x 0.59°
Super-Weitwinkel-Okulare (SWA) der Serie 5000
Brenn- Steck Ver- Gesichts- Ver- Gesichts- Ver- Gesichts- Ver- Gesichts- Ver- Gesichts-
weite Ø größerung feld größerung feld größerung feld größerung feld größerung feld
16 mm 11/4" 125x 0.54° 156x 0.44° 191x 0.36° 222x 0.31° 254x 0.27°
20 mm 11/4" 100x 0.62° 125x 0.54° 152x 0.45° 178x 0.38° 203x 0.33°
24 mm 11/4" 83x 0.82° 104x 0.65° 127x 0.54° 148x 0.46° 169x 0.40°
28 mm 2" 71x 0.95° 89x 0.76° 109x 0.62° 127x 0.54° 145x 0.47°
34 mm 2" 59x 1.16° 74x 0.92° 90x 0.76° 105x 0.65° 119x 0.57°
40 mm 2" 50x 1.36° 63x 1.09° 76x 0.89° 89x 0.77° 102x 0.67°
Ultra-Weitwinkel-Okulare (UWA) der Serie 5000
Brenn- Steck Ver- Gesichts- Ver- Gesichts- Ver- Gesichts- Ver- Gesichts- Ver- Gesichts-
weite Ø größerung feld größerung feld größerung feld größerung feld größerung feld
4,7 mm 11/4" 426x 0.19° 532x 0.15° 649x 0.13° 756x 0.11° 864x 0.09°
6,7 mm 11/4" 299x 0.27° 373x 0.22° 455x 0.18° 531x 0.15° 606x 0.14°
8,8 mm 11/4" 227x 0.36° 284x 0.29° 346x 0.24° 404x 0.20° 461x 0.18°
14 mm 11/4" 143x 0.57° 179x 0.46° 218x 0.38° 254x 0.32° 290x 0.28°
18 mm 11/4" 111x 0.74° 139x 0.59° 169x 0.48° 198x 0.42° 226x 0.36°
24 mm 2" 83x 0.98° 104x 0.79° 127x 0.65° 148x 0.55° 169x 0.48°
30 mm 2" 67x 1.23° 83x 0.98° 102x 0.81° 119x 0.69° 135x 0.61°
10
" f/10
12
" f/10
14
" f/10
16
" f/10
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
41
Page 42

LX20 0 A C F
2x Barlowlinse #140 (Abb. 24a): Diese Barlowlinse verdoppelt als zweifach vergrößernde Linse
die Vergrößerung sämtlicher Okulare, mit denen sie kombiniert wird. Stecken Sie zuerst die
Barlowlinse in den Okularstutzen des Teleskops, dann bringen Sie das Zenitprisma oder das
entsprechende Okular an.
Zubehör
Abb. 24a:
Abb. 24b: Zoom Okular
Abb. 25a: Nebelfilter
Abb. 25b: Variabler Tele-Extender
Barlowlinse
Zoom Okular 8 -24 mm der Serie 4000
Eigengesichtsfeld von bis zu 55° (bei f=8 mm). Gravierte Skala in 1mm-Schritten zur leichten
Einstellung der effektiven Brennweite. Das Okular ist eigentlich für alle Teleskope
uneingeschränkt zu empfehlen!
Foto-visuelle Farbfilter der Serie 4000: Erhöhen signifikant den Kontrast und das
Detailerkennungsvermögen bei Mond- und Planetenbeobachtungen. Die Filter werden in das
untere Gewinde von 11/4" Okularen eingeschraubt und passen in die allermeisten Okulare fast
aller Hersteller.
Nebelfilter der Serie 4000
aus und lassen zum großen Teil nur das Licht der Himmelsobjekte durch. Diese
Interferenzfilter werden mittels neuester Bedampfungstechnologien hergestellt.
Variabler Tele-Extender
Schmidt-Cassegrain- oder Maksutov-Teleskop wird zuerst ein Okular in den Okularhalter des
Teleskops gesteckt und dann dieser Tele-Extender darübergeschraubt. Am hinteren Ende wird
wiederum ein T2-Ring für Ihre Kamera angesetzt. Auf diese Weise sind Fotografien von kleinen
Objekten (Planeten oder auch Details auf dem Mond) mit hoher Vergrößerung möglich. Durch
die Verschiebemöglichkeit der Hülsen lässt sich eine variable Projektionslänge erreichen, womit sich der Abbildungsmaßstab beeinflussen lässt. In Abb. 25b sehen Sie ein
Anwendungsbeispiel.
50,8mm Zenitspiegel #929; 45° Amici-Prisma #928: Der große Zenitspiegel mit 50,8mm Ø (als
Standard beim 12", 14" und 16" LX200ACF bereits enthalten) ermöglicht den Einsatz von
Großfeldokularen mit 50,8mm Ø und wird ebenfalls am rückwärtigen Ende der SchmidtCassegrains angeschraubt. Der Einsatz von solchen Okularen (z. B. dem Meade SWA 32 mm
oder SWA 40 mm Okular) eröffnet neue Möglichkeiten: Das Bildfeld wird jetzt wesentlich größer
als bei der Verwendung von 11/4" Okularen und größere, ausgedehnte Objekte passen ins
Gesichtsfeld, die vorher abgeschnitten oder nur ausschnittweise beobachtet werden konnten.
Jeder Zenitspiegel enthält einen Planspiegel aus optisch hochwertigem Pyrex-Glas,
plangeschliffen und aluminisiert. Normale Zenitspiegel und Zenitprismen richten die
Bildorientierung zwar wieder auf, belassen sie aber spiegelverkehrt. Für manche terrestrische
Anwendungen mag es wünschenswert sein, ein vollständig richtig orientiertes Bild zu haben.
Dies wird mit dem Amiciprisma #928 erreicht, das einen bequemen 45°-Einblick bietet und
genau wie ein normales 11/4" Zenitprisma in den 11/4" Okularhalter des Teleskops (serienmäßig bei
den 8" und 10" Schmidt-Cassegrains) gesteckt wird.
(Abb. 25a)
(Abb. 25b)
(Abb. 24b)
: Sie filtern das unerwünschte Licht von Straßenlampen
: Zur Fotografie in Okularprojektion mit einem
: Hervorragende 7-linsige Optik mit einem
Variables Polarisationsfiltersystem #905
dieser Hülse zu einer Einheit zusammengefaßt. Einer der Filter ist von außen drehbar, und
durch Verdrehen der beiden Filter gegeneinander wird eine unterschiedlich starke Lichtdurchlässigkeit bewirkt, von etwa 5% bis 25%. Das ist besonders hilfreich bei der Mondbeobachtung, wenn die Helligkeit auf einen angenehmen Wert reduziert werden soll. Das Polfiltersystem
wird wie ein Okular in das Zenitprisma gesteckt, gefolgt von einem beliebigen Okular (11/4").
Beleuchtete Fadenkreuzokulare (Abb. 26b): Die beleuchteten Fadenkreuzokulare von
Meade eignen sich für die besonders präzise Ausrichtung Ihres Teleskops auf den Himmelspol.
Abb. 26a: Variables Polfilter
Abb. 26b: Bel. Fadenkreuzokular
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
42
Sie werden bei langbelichteten Astrofotografien in Verbindung mit dem optionalen Meade „Off
Axis Guider“ eingesetzt. Hierbei überwacht man das Objekt durch das Teleskop, während es
bei geöffnetem Kameraverschluss aufgenommen wird. Zwei Ty pen sind erhältlich: Das 9mm
Plössl-Okular der Serie 4000 mit verstellbarem Doppelfadenkreuz oder das modifizierte
achromatische 12mm-Okular mit feststehendem Fadenkreuz. Beide Versionen können Sie
entweder mit oder ohne Kabel-Anschluss bekommen. Die Modelle ohne Kabel-Anschluss sind
mit einer stufenlosen Helligkeitsregelung ausgestattet. Ihre Stromversorgung läuft über
Batterie. Die Helligkeit der Modelle mit Kabel-Anschluss kann über den Autostar gesteuert
werden. Es ist ausserdem eine „Blinkfunktion“ möglich. Der Anschluss erfolgt direkt über die
„Reticle“ Buchse am Teleskop.
(Abb. 26a)
: Zwei Polarisationsfilter (Polfilter) sind in
(c) nimax GmbH
Page 43

LX20 0 A C F
#62 T-Adapter (Abb. 27a): Dieser T-Adapter stellt für die Fotografie im Primärfokus ein grundlegendes Werkzeug dar. Man kann mit ihm durch alle Meade SC und ACF-Teleskope hindurch
fotografieren. Schrauben Sie den T-Adapter an die Rückseite Ihres Teleskops. Montieren Sie
daran einen T2-Ring, der zu der Marke Ihrer Kleinbildkamera paßt. Auf diese Weise lässt sich
das Kameragehäuse fest mit dem Teleskop verbinden.
Zubehör
Abb. 27a: T-Adapter
Abb. 27b: Off-Axis-Guider
#777 Off-Axis-Guider
belichteten Astroaufnahmen eine wertvolle Unterstützung. Der Fotograf überwacht mit ihm die
Nachführung des Teleskops und stellt damit sicher, dass sein Teleskop fortwährend ganz
präzise auf das Objekt, das soeben fotografiert wird, ausgerichtet bleibt. Genau wie der
T-Adapter verbindet der Off-Axis-Guider das Kameragehäuse mit dem Te lesk o p. Er sorgt jedoch
dafür, dass ein kleiner Anteil des vom Leitstern eintreffenden Lichts abgefangen und senkrecht
abgelenkt wird. Dort lässt sich die Sternposition mit einem beleuchteten Fadenkreuzokular auf
Nachführfehler kontrollieren. Bei Bedarf können mit dem Autostar-II Nachführ-Korrekturen
vorgenommen werden.
Aufsattelbare Kamerahalterungen (Abb. 28): Bei der „Piggyback“-Fotografie handelt es sich
um die beliebteste und einfachste Methode, um in die Astrofotografie einzusteigen. Montieren
Sie Ihre Kleinbildkamera mit ihrem 35 mm-250 mm-Objektiv auf Ihr LX200ACF. Das LX200ACF
muss dabei im äquatorialen Modus aufgestellt sein. Die Nachführung Ihrer Kamera geschieht
durch das Hauptfernrohr. Auf diese Weise können Sie Weitwinkelaufnahmen des Himmels oder
unserer Milchstraße mit bemerkenswerter Detailfülle und Schärfe anfertigen.
Taukappe (Abb. 29): In Gebieten mit hoher Luftfeuchtigkeit kann es geschehen, dass sich die
in der Atmosphäre schwebenden Wassertröpfchen auf der Oberfläche der Korrekturplatte
Ihres Teleskops niederschlagen. Diese Taubildung lässt sich durch die Anbringung einer
Taukappe weitgehend unterbinden. Im Prinzip handelt es sich bei der Taukappe um ein
„Verlängerungsrohr“, das auf den vorderen Teil des Fernrohrtubus aufgesteckt wird.
#547 Wechselstrom-Adapter: Der optionale #547 Wechselstrom-Adapter ermöglicht Ihnen
die Stromversorgung des Teleskops über eine gewöhnliche 230V~ Haushaltssteckdose.
#607 Autobatteriekabel: Wenn Sie Ihr LX200ACF Tele s kop über die Steckdose eines AutoZigarettenanzünders mit Strom versorgen möchten, dann benötigen Sie das Stromkabel #607.
Das Kabel ist etwa 7,50 m lang. Es versorgt Ihr LX200ACF während einer kompletten
Beobachtungsnacht mit Strom. Das Risiko, dass dabei Ihre Autobatterie völlig entladen wird,
besteht nicht.
(Abb. 27b)
: Der Off-Axis-Guider bietet dem Fotografen bei lang-
Abb. 28: aufsattelbare
Kamerahalterung
Abb. 29: Tauschutzkappe
Abb. 29a: Mikrofokussierer
#1209 Mikrofokussierer: Der optionale #1209 Mikrofokussierer ermöglicht präzises
Scharfstellen bei visuellen, fotografischen und CCD-Anwendungen. Er lässt sich in 4
Geschwindigkeiten steuern und wird in den Fokussieranschluss eingesteckt.
LX200ACF Tipps:
Überlegungen zur Beobachtung
• Versuchen Sie einen Beobachtungstandort zu finden, der abseits von hellen
Lichtquellen wie Städten, Straßen oder Sportplätzen liegt. Ist dies nicht immer möglich dann
wählen Sie ein Ort, wo es etwas dunkler ist. Um so dunkler, um so besser.
• Geben Sie Ihren Augen etwa 10 Minuten, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen. Gönnen
Sie Ihren Augen auch etwa alle 10 bis 15 Minuten eine Beobachtungs-Pause, um tränende
Augen und Augenschmerzen zu vermeiden.
• Versuchen Sie während einer Beobachtung im Dunkeln kein weißes Licht zu verwenden.
Erfahrene Beobachter benutzen ausschließlich rotes Licht um die Gewöhnung des Auges an die
Dunkelheit nicht zu verlieren (Dunkeladaption des Auges). Sie benutzen entweder die Taschenlampe des Autostar-II, oder wickeln rote Spezialfolie um ihre Lampen. Beachten Sie auch, dass
wenn sich andere Beobachter in der Nähe befinden, sie nicht mit weißem Licht hantieren.
Leuchten Sie auch nie mit einer Lampe in ein Teleskop, durch das gerade beobachtet wird!
• Ziehen Sie sich warm an. Im sitzen kann es an kühlen Ta g en schnell zu Unterkühlung kommen.
• Üben Sie die Vorbereitung Ihrer Ausrüstung im Hellen, damit dann im Dunkeln jeder Handgriff sitzt.
• Verwenden Sie Ihr 26mm Okular für die Erdbeobachtung oder weit enfernte Gebiete am Sternhimmel,
wie etwa offene Sternhaufen (z. B. Plejaden M45). Benutzen Sie ein stärker vergrößerndes Okular, wie
z. B. ein 9mmum kleine Dinge, etwa die Ringe des Saturn oder um Krater auf dem Mond zu sehen.
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
43
Page 44

ACHTUNG: Verwenden
Sie keine duftimprägnierten, gefärbten oder mit
Lotion getränkten Tücher
– Sie würden ansonsten
Ihre Optik beschädigen.
LX20 0 A C F
WARTUNG UND SERVICE
Wartung und Service
Das LX200ACF ist ein optisches Präzisionsinstrument, das darauf ausgelegt ist,
Ihnen für sehr lange Zeit hochwertige Beobachtungen und Astrofotografie zu
gewährleisten. Wenn einem LX200ACF die jedem Präzisionsinstrument gebührende Sorgfalt und Aufmerksamkeit gewidmet wird, dann wird es nur sehr selten einen
werkseitigen Service oder eine entsprechende Wartung benötigen. Die allgemeinen
Wartungshinweise haben folgenden Inhalt:
a. Vermeiden Sie eine zu häufige Reinigung der Teleskopoptik: Ein klein wenig
Staub auf der Vorderseite der Korrekturplatte Ihres Teleskops verursacht praktisch keine Verringerung der Abbildungsqualität – ein bisschen Staub sollte
nicht zum Anlass genommen werden, die Linse zu reinigen.
b. Nur wenn es absolut unumgänglich wird, sollte der Staub von der Vorderseite
der Korrekturplatte mit vorsichtigen Bewegungen eines Kamelhaarpinsels weggeputzt werden; Sie können den Staub auch mit einem kleinen Blasebalg wegpusten. Verwenden Sie auf keinen Fall irgendwelche fotografischen
Linsenreiniger!
c. Organische Verschmutzungen (z. B. Fingerabdrücke) lassen sich von der
Frontplatte am besten mit einer Reinigungsflüssigkeit entfernen, die aus drei
Teilen destillierten Wassers und einem Teil Isopropylalkohol gemischt wird. Sie
dürfen pro halben Liter Reinigungsflüssigkeit noch einen kleinen Tropfen eines
biologisch abbaubaren Geschirrspülmittels beifügen. Verwenden Sie weiche,
weiße Gesichtspflegetücher und führen Sie kurze, radiale und vorsichtige
Wischbewegungen durch. Wechseln Sie die Tücher möglichst häufig aus.
d. Nehmen Sie NIEMALS die Korrekturplatte aus ihrer Fassung heraus, um sie zu
reinigen oder mit ihr irgend etwas anderes zu machen! Mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit werden Sie nicht mehr in der Lage sein, die Korrekturplatte
in ihrer korrekten Lage einzubauen. Dadurch ergibt sich eine dramatische
Verschlechterung der optischen Leistungsfähigkeit. Wenn Ihr Teleskop auf diese
Weise Schaden genommen haben sollte, erlischt der Garantieanspruch.
e. Wenn Sie Ihr LX200ACF während einer feuchten Nacht draußen einsetzen, kann
es vorkommen, dass sich die Oberfläche des Instrumentes mit Ta u beschlägt.
Normalerweise erleidet das Teleskop durch eine solche Nässe keinen Schaden,
doch es wird dringend empfohlen, das Teleskop jeweils vor der Aufbewahrung
mit einem geeigneten Tuch abzutrocknen. Wischen Sie aber niemals die
optischen Oberflächen trocken! Lassen Sie vielmehr das Fernrohr mit der
Öffnung nach unten und ohne Staubschutzkappe einige Zeit lang in einem
warmen Raum stehen, so dass die feuchten optischen Flächen von selbst
abtrocknen können.
f. Wenn Sie das LX200ACF für längere Zeit (für einen Monat oder länger) nicht
mehr benützen, dann ist es ratsam, die Batterien aus dem Teleskop zu entfernen. Batterien, die über einen längeren Zeitraum eingebaut bleiben, könnten
auslaufen und in den elektronischen Schaltkreisen des Teleskops schlimme
Schäden anrichten.
g. Vermeiden Sie es an heißen Tagen, Ihr LX200ACF über längere Zeit hinweg in
einem verschlossenen Auto zu belassen. Eine zu hohe Außentemperatur kann
die interne Schmierung und die elektronischen Schaltkreise Ihres Teleskops in
Mitleidenschaft ziehen.
h. Der optional erhältliche Mikrofokussierer wird ab Werk sorgfältig und präzise
justiert. Sollte es dennoch nötig werden, die Kugellager nochmals zu justieren,
so darf dies nur durch geschultes Technik-Personal bei Meade erfolgen.
Versuchen Sie nicht, den Mikrofokussierer selber zu justieren. Schlechte
Ergebnisse und Beschädigungen können die Folge sein, die nicht durch die
Meade Werksgarantie gedeckt sind.
i. Der Transport des Teleskops sollte immer in der Originalverpackung erfolgen.
Nur so ist ein sicherer und schonender Transport sichergestellt. Darüber hinaus
müssen beim Transport immer beide Achsklemmungen gelöst sein; ansonsten
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
44
(c) nimax GmbH
Page 45

Abb. 30: Die Kugellager des
Mikrofokussierers
LX20 0 A C F
kann es zu Schäden an den Schneckengetrieben kommen. Der Hauptspiegel
ist vor dem Transport in die hinterste Stellung zu bringen, indem man den
Fokussierknopf im Uhrzeigersinn bis kurz vor die Endstellung dreht. Die
Hauptspiegelklemmung sollte gelöst bleiben.
Kollimation
Die optische Kollimation (Justierung) eines Teleskops, das für eine ernsthafte
Beobachtung eingesetzt werden soll, spielt eine sehr große Rolle. Ganz besonders
im Fall der Coma Free-Bauweise Ihres 8", 10", 12", 14" oder 16" LX200ACF ist
jedoch die exakte Kollimation für eine gute Leistungsfähigkeit absolut
unverzichtbar. Legen Sie ganz besonders viel Wert darauf, dieses Kapitel
durchzulesen und zu verstehen. Nur dann kann Ihnen das LX200ACF seine ganze
optische Leistung bieten. Als Bestandteil der optischen Endkontrolle wird jedes
Meade Coma Free-Teleskop im Meade-Werk vor dem Versand präzise
kollimiert. Es kommt allerdings vor, dass sich das optische System durch
Vibrationen beim Transport verstellt. Bei der erneuten Justierung der Optik handelt
es sich jedoch um einen durchaus unproblematischen Vorgang. Wenn Sie die
Kollimation Ihres LX200ACF überprüfen wollen, dann stellen Sie sich einen hellen
Stern im Zenit ins Gesichtsfeldzentrum. Sie können dazu auch einen punktförmig
reflektierten Sonnenstrahl hernehmen – so etwas finden Sie zum Beispiel an einem
verchromten Gegenstand. Verwenden Sie dabei das standardmäßig mitgelieferte
26mm-Okular. Bevor Sie weitermachen, gestatten Sie es Ihrem Teleskop, sich an
die aktuelle Temperatur Ihres Beobachtungsortes anzugleichen.
Temperaturunterschiede zwischen der Optik und der Umgebungsluft können in
den Bildern Verzerrungen bewirken.
WARTUNG UND SERVICE
ACHTUNG: Ziehen Sie
die drei Kollimationsschrauben niemals gewaltsam über ihren normalen Anschlag fest.
Schrauben Sie die drei
Kollimationsschrauben nie
weiter als zwei volle Umdrehungen entgegen dem
Uhrzeigersinn auf – ansonsten könnte sich der
Fangspiegel in seiner Fassung lockern. Sie werden
rasch feststellen, dass die
Justierungen sehr feinfühlig vorgenommen werden
müssen. Um das
gewünschte Ergebnis zu
erzielen, reicht normalerweise allenfalls eine halbe
Schraubendrehung aus.
321
Abb. 31:
Sobald Sie den Stern oder den Reflex in die Bildmitte geholt haben, stellen Sie das
Bild unscharf. Sie werden erkennen, dass das unscharfe Sternbild wie ein Lichtring
aussieht, der einen dunklen, zentralen Fleck umgibt. Bei diesem dunklen, zentralen
Fleck handelt es sich in Wirklichkeit um den Schatten des Fangspiegels. Drehen
Sie den Fokussierknopf soweit, bis das Licht etwa 10% des OkulargesichtsfeldDurchmessers ausfüllt. Wenn der dunkle, zentrale Fleck nicht genau in der Mitte
des Lichtringes zu sehen ist – wenn er also nicht konzentrisch liegt – dann ist das
optische System Ihres Teleskops verstellt und bedarf einer Kollimation. Für die
Kollimation Ihres optischen Systems gehen Sie nach folgenden Schritten vor:
a. Die einzige Justierung, die beim LX200ACF möglich oder notwendig ist, kann
an den drei Schrauben vorgenommen werden (Abb. 32), die sich am Außenrand
der Fangspiegelfassung befinden.
b. Betrachten Sie das defokussierte Sternbildscheibchen. Stellen Sie fest, in
welche Richtung der dunkle Schatten innerhalb des Lichtrings verschoben ist.
Sie können auch darauf achten, an welcher Stelle der Lichtring am schmalsten
erscheint (Abb. 31, 1). Führen Sie Ihren Zeigefinger so vor das Teleskop, dass
er eine der Kollimations-Schrauben berührt. Sie können den Schatten Ihres
Fingers im Lichtring sehen. Bewegen Sie Ihren Finger entlang des Randes der
schwarzen Fangspiegelfassung soweit, bis der Schatten Ihres Fingers die Stelle
erreicht, wo der Lichtring am schmalsten erscheint. Jetzt schauen Sie vorne auf
Ihr Teleskop und ermitteln die Position, auf die Ihr Finger soeben deutet.
Entweder zeigt er unmittelbar auf eine Justierschraube oder er weist irgendwo
Abb. 32:
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
45
Page 46

R.A.
Dec.
Lock
Lock
Abb. 33
ACHTUNG:
Das LX200ACF stellt mit
seiner großen Masse (auch
in der Verpackung) eine
potentielle Gefahr dar.
Beim Transport in
Fahrzeugen sind daher
immer geeignete
Maßnahmen zur Ladungssicherung zu ergreifen;
andernfalls kann es bei
Unfällen oder auch schon
bei Notbremsungen zu
schweren bis tödlichen
Verletzungen der Fahrzeuginsassen durch umherfliegende Ladungs-
stücke kommen!
Hinweis zum sogenannten
„Taschenlampen-Test“: Wenn
Sie mit einer Taschenlampe oder
einer anderen intensiven
Lichtquelle in den Tubus des
Hauptteleskops hinein leuchten,
könnte es geschehen, dass Sie je
nach Blickwinkel oder
Einfallswinkel des Lichtes etwas
sehen werden, was wie irgendwelche Kratzer, dunkle oder helle
Flecken oder wie eine unregelmäßige Lackierung ausschaut; dies
könnte Ihnen den Anschein einer
nur minderwertigen Optik vortäuschen. Diese Effekte lassen sich
aber nur dann erkennen, wenn
eine intensive Lichtquelle durch
eine Linse scheint oder an einem
Spiegel reflektiert wird. Sie treten
auch bei jedem anderen hochwertigen optischen System auf, sogar
bei den gigantischen Teleskopen
der professionellen Forscher.
Die optische Qualität eines
Teleskops lässt sich mit diesem
„Taschenlampen-Test“ nicht beurteilen; eine zuverlässige Kontrolle
der optischen Qualität kann nur
durch eine sorgfältige Prüfung an
einem Stern erfolgen.
LX20 0 A C F
WARTUNG UND SERVICE
zwischen zwei Justierschrauben hindurch auf die Justierschraube, die sich auf
der gegenüberliegenden Seite der schwarzen Fangspiegelfassung befindet.
Dies ist jeweils die Justierschraube, die Sie jetzt verstellen müssen.
c. Mit den Pfeiltasten bewegen Sie bei geringst möglicher Geschwindigkeit das
defokussierte Bild an den Gesichtsfeldrand des Okulars (Abb. 31, 2) – und zwar
in die Richtung, in die auch der schwarze Schatten im Lichtring verschoben
erscheint.
d. Drehen Sie an der Justierschraube, die Sie mit der Zeigefinger-Prozedur
ermittelt haben. Blicken Sie währenddessen ständig durchs Okular. Sie können
sehen, wie sich dabei der Stern durch das Gesichtsfeld bewegt. Wenn nun der
defokussierte Stern beim Drehen der Justierschraube aus dem Bildfeld
verschwindet, haben Sie die Justierschraube falsch herumgedreht. Drehen Sie
die Justierschraube in die andere Richtung und holen Sie damit den Stern in die
Bildmitte zurück.
e. Wenn sich die Justierschraube, an der Sie gerade drehen, zusehends lockert,
ziehen Sie die beiden anderen Justierschrauben mit einer identischen Drehung
an. Sollte sich die Justierschraube, an der Sie gerade drehen, zu stark
festsetzen, lockern sie die beiden anderen Justierschrauben mit einer
identischen Drehung.
f. Wenn Sie das Bild in die Gesichtsfeldmitte geholt haben (Abb. 32, 3), über-
prüfen Sie sorgfältig die Gleichmäßigkeit des Lichtrings. Achten Sie darauf, ob
er exakt konzentrisch aussieht. Wenn Sie feststellen, dass das dunkle Zentrum
immer noch in derselben Richtung verschoben erscheint, dann drehen Sie die
Justierschraube in der ursprünglichen Richtung ein klein wenig weiter. Wenn der
zentrale Schatten jetzt aber in die andere Richtung verschoben erscheint, haben
Sie die Justierschraube zu weit gedreht. Sie müssen die Schraube nun ein
wenig in die Gegenrichtung drehen. Überprüfen Sie dabei fortwährend das Bild
im Gesichtsfeldzentrum des Okulars.
g. Es könnte nun der Fall eintreten, dass sich nach Ihrer bisherigen Justierarbeit
das dunkle Zentrum in eine neue Richtung verschoben hat. Dies kann zum
Beispiel bedeuten, dass die seitliche Ablage des Fangspiegels nun in eine
vertikale Ablage übergegangen ist. In diesem Fall wiederholen Sie die Schritte b
bis f, um die neue zutreffende Justierschraube zu ermitteln und zu bedienen.
h. Jetzt nehmen Sie sich ein Okular mit einer stärkeren Vergrößerung (z.B. 9mm
oder weniger) und wiederholen Sie die oben beschriebene Testprozedur. Wenn
sich an dieser Stelle noch irgendein Fehler bei der Kollimation abzeichnen
sollte, dann sind an den Justierschrauben nur noch ganz winzige Einstellungen
notwendig. Nach Beendigung dieser Maßnahme haben Sie eine gute
Kollimation des optischen Systems erreicht.
i. Als abschließenden Test für Ihre Justierung prüfen Sie ein scharf gestelltes
Sternbildchen mit einem möglichst stark vergrößernden Okular. Die Luft sollte
dabei möglichst ruhig sein. Der Stern muss nun als winziges zentrales
Scheibchen aussehen (es wird allgemein als „Beugungsscheibchen“ bezeichnet), um das sich ein Beugungsring herumzieht. Wenn Sie eine letzte, hochpräzise Kollimation anstreben, dann können Sie – falls erforderlich – durch
winzigste Drehungen an den Justierschrauben das „Beugungs-Scheibchen“ in
die Mitte des Beugungsrings zentrieren. Hiermit hätten Sie bei diesem Teleskop
die bestmögliche Justierung der Optik erzielt.
Kontrolle der Optik
Überprüfung der Teleskopbewegung
Eine häufige Beschwerde vieler frischgebackener Teleskop-Besitzer lautet so:
„Mein Teleskop bewegt sich nicht, wenn der Motorantrieb angeschaltet ist.“
Tatsächlich bewegt sich aber das Teleskop, sobald Sie die Batterien eingesetzt,
den Strom angeschaltet und die RA-Klemmung (Abb. 1, 12) festgezogen haben.
Diese Bewegung erfolgt jedoch mit der gleichen Geschwindigkeit wie die eines
Stundenzeigers an einer 24-Stundenuhr. Aus diesem Grund kann die Bewegung
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
46
(c) nimax GmbH(c) nimax GmbH
Page 47

LX20 0 A C F
TECHNISCHE DATEN
mit freiem Auge kaum wahrgenommen werden. Wenn Sie die Bewegung Ihres
Fernrohrs überprüfen wollen, beobachten Sie im Okular des Teleskops ein astronomisches Objekt. Hierzu muss das Teleskop auf den Himmelspol ausgerichtet
und der Motorantrieb angeschaltet sein. Falls das Objekt in der Mitte des Gesichtsfelds verharrt, arbeitet Ihr Teleskop einwandfrei. Sollte dies aber nicht der Fall sein,
dann vergewissern Sie sich, ob die RA-Klemmung festgezogen ist und ob Sie die
Stromversorgung am Steuerpult angeschaltet haben. Zusätzlich prüfen Sie nach,
ob in der „Ziele“-Option des Setup-Menüs auch wirklich die Funktion
„Astronomisch“ angewählt worden ist.
TECHNISCHE DATEN
8" LX200ACF
Optische Bauart Advanced Coma Free
Freie Öffnung 203 mm
Brennweite 2000 mm
Öffnungsverhältnis / fotografische Blende f/10
Maximale Auflösung 0,56" Bogensekunden
Vergütung UHTC
Montierung Aluminium-Guß, Gabelmontierung,
Doppelgabelmontierung „heavy duty“
Antrieb 12V= Servomotor, 185 Geschwindigkeiten
mikroprozessorgesteuert, 146 mm LX-
Schneckengetriebe mit Smart-Drive
Ausrichtung per GPS 16-Kanal GPS-Empfänger, elektronische
Sensoren für „True-Level“ und „True-North“
mit Ausgleich der magnetischer Missweisung
Einstellgenauigkeit 2 Bogenminuten im GO TO-Modus
1 Bogenminute im „High Precision Pointing“ Modus
Nachführgeschwindigkeiten Siderische Geschwindigkeit, Mondge-
schwindigkeit oder benutzerdefinierte
Auswahl aus 2000 variierbaren Stufen
Stativ höhenverstellbares Feldstativ
Zubehör 8x50 Geradesichtsucher
31,8mm-Zenitprisma
SuperPlössl 26 mm Okular
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
47
Page 48

LX20 0 A C F
TECHNISCHE DATEN
10" LX200ACF
Optische Bauart Advanced Coma Free
Freie Öffnung 254mm
Brennweite 2500 mm
Öffnungsverhältnis / fotografische Blende f/10
Maximale Auflösung 0,45" Bogensekunden
Vergütung UHTC
Montierung Aluminium-Guß, Gabelmontierung,
Doppelgabelmontierung „heavy duty“
Antrieb 12V= Servomotor, 185 Geschwindigkeiten
mikroprozessorgesteuert, 146 mm LX-
Schneckengetriebe mit Smart-Drive
Ausrichtung per GPS 16-Kanal GPS-Empfänger, elektronische
Sensoren für „True-Level“ und „True-North“
mit Ausgleich der magnetischer Missweisung
Einstellgenauigkeit 2 Bogenminuten im GO TO-Modus
1 Bogenminute im „High Precision Pointing“ Modus
Nachführgeschwindigkeiten Siderische Geschwindigkeit, Mondge-
schwindigkeit oder benutzerdefinierte
Auswahl aus 2000 variierbaren Stufen
Stativ höhenverstellbares Feldstativ
Zubehör 8x50 Geradesichtsuche
31,8mm-Zenitprisma
SuperPlössl 26mm Okular
12" LX200ACF
Optische Bauart Advanced Coma Free
Freie Öffnung 314mm
Brennweite 3000 mm
Öffnungsverhältnis / fotografische Blende f/10
Maximale Auflösung 0,38" Bogensekunden
Vergütung UHTC
Montierung Aluminium-Guß, Gabelmontierung,
Doppelgabelmontierung „heavy duty“
Antriebssystem RA und DEC in beiden Achsen: Servomotoren mit 185
Geschwindigkeiten, prozessorgesteuert,
12V= Servomotoren, 146 mm Schnecken-
getriebe mit Smart-Drive Software
Ausrichtung per GPS 16-Kanal GPS-Empfänger, elektronische
Sensoren für „True-Level“ und „True-North“
mit Ausgleich der magnetischer Missweisung
Einstellgenauigkeit 2 Bogenminuten im GO TO-Modus
1 Bogenminute im „High Precision Pointing“ Modus
Nachführgeschwindigkeiten Siderische Geschwindigkeit, Mondge-
schwindigkeit oder benutzerdefinierte
Auswahl aus 2000 variierbaren Stufen
Stativ höhenverstellbares Großstativ
Zubehör 8x50 Geradesichtsucher
50,8mm-Zenitspiegel
SuperPlössl 26mm Okular
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
48
(c) nimax GmbH
Page 49

LX20 0 A C F
TECHNISCHE DATEN
14" LX200ACF
Optische Bauart Advanced Coma Free
Freie Öffnung 355 mm
Brennweite 3550 mm
Öffnungsverhältnis / fotografische Blende f/10
Maximale Auflösung 0,33" Bogensekunden
Vergütung UHTC
Montierung Aluminium-Guß, Gabelmontierung,
Doppelgabelmontierung „heavy duty“
Antriebssystem RA und DEC in beiden Achsen: Servomotoren mit 185
Geschwindigkeiten, prozessorgesteuert,
12V= Servomotoren, 146 mm Schnecken-
getriebe mit Smart-Drive Software
Ausrichtung per GPS 16-Kanal GPS-Empfänger, elektronische
Sensoren für „True-Level“ und „True-North“
mit Ausgleich der magnetischer Missweisung
Einstellgenauigkeit 2 Bogenminuten im GO TO-Modus
1 Bogenminute im „High Precision Pointing“ Modus
Nachführgeschwindigkeiten Siderische Geschwindigkeit, Mondge-
schwindigkeit oder benutzerdefinierte
Auswahl aus 2000 variierbaren Stufen
Stativ höhenverstellbares Großstativ
Zubehör 8x50 Geradesichtsucher
50,8mm-Zenitspiegel
SuperPlössl 26 mm Okular
Hinweis zum Tubuslüfter des
16" LX200ACF:
Diese Optik ist mit einem Lüfter ausgestattet, welcher mittels des mitgelieferten Spiralkabels an den 12V=
Ausgang des Anschlussboards
angeschlossen wird. Mit dem Lüfter
wird der Temperaturausgleich zwischen Teleskop und Umgebungsluft
beschleunigt. Wie lange er laufen
sollte, hängt von den
Umgebungsbedingungen wie
anfänglicher Teleskoptemperatur
und Außentemperatur ab. Die
durchschnittlich erforderliche
Laufzeit beträgt ca. 15 bis 30
Minuten. Obwohl der Lüfter prinzipiell im Dauerbetrieb laufen kann,
sollte er nach erfolgtem
Temperaturausgleich (erkennbar am
nicht mehr vorhandenen TubusSeeing) per Ausstecken oder in der
Software (Zubehör > Aux port
power) abgeschaltet werden, um
feine Vibrationen zu vermeiden, die
bei höheren Vergrößerungen ggf. im
Bild sichtbar sind.
16" LX200ACF
Optische Bauart Advanced Coma Free
Freie Öffnung 406,4 mm
Brennweite 4064 mm
Öffnungsverhältnis / fotografische Blende f/10
Maximale Auflösung 0,28" Bogensekunden
Vergütung UHTC
Montierung Aluminium-Guß, Gabelmontierung,
schwere Doppelgabelmontierung
Antriebssystem RA und DEC in beiden Achsen: Servomotoren mit 165
Geschwindigkeiten, prozessorgesteuert,
18V= Servomotoren, 279,4 mm
Schneckengetriebe mit Smart-Drive
Software
Ausrichtung per GPS 16-Kanal GPS-Empfänger, elektronische
Sensoren für „True-Level“ und „True-North“
mit Ausgleich der magnetischer Missweisung
Einstellgenauigkeit 2 Bogenminuten im GO TO-Modus
1 Bogenminute im „High Precision Pointing“ Modus
Nachführgeschwindigkeiten Siderische Geschwindigkeit, Mondge-
schwindigkeit oder benutzerdefinierte
Auswahl aus 2000 variierbaren Stufen
Stativ höhenverstellbares schweres Großstativ
Zubehör 8x50 Geradesichtsucher
50,8mm-Zenitspiegel
Plössl 26 mm Okular
Mikrofokussierer
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
49
Page 50

Wichtiger Hinweis: Bei der im
folgenden beschriebenen Ausrichtung muss zuvor im „Setup“Menü unter „Teleskop“ >
„Montierung“ > „Parallaktisch“
angewählt werden und das
Teleskop auf einer Polhöhenwiege (Sonderzubehör) montiert
sein. Andernfalls ist keine paral-
laktische Ausrichtung möglich!
1
2
Abb. 34: Die Himmelskugel
Abb. 35: DEC-Teilkreis
Abb. 36: RA-Teilkreis
LX20 0 A C F
ANHANG A: PARALLAKTISCHE AUSRICHTUNG
ANHANG A:
PARALLAKTISCHE AUSRICHTUNG
Parallaktische Ausrichtung
Bei der parallaktischen (äquatorialen) Ausrichtung wird das Teleskop mechanisch so aufgestellt, dass seine Achsen parallel zu den Achsen des Äquatorsystems ausgerichtet sind. Hierzu ist es notwendig, die Koordinaten der
Himmelsobjekte und ihre Bewegung über den Himmel zu verstehen. In diesem
Abschnitt wird eine kurze Einführung in die Terminologie der äquatorialen
Koordinaten Rektaszension / Deklination und in das Auffinden des Himmelspols
gegeben.
Himmelskoordinaten
Das System der äquatorialen Koordinaten wurde erschaffen, um z.B. in
Sternkarten jedem Objekt einen eindeutigen Ort zuweisen zu können. Es ist
vergleichbar dem System der geografischen Koordinaten in Länge und
Breite, womit jeder Ort auf der Erde exakt festgelegt werden kann. Bei der
Darstellung der Erdoberfläche werden die Längengrade als Linien zwischen
Nord- und Südpol und Breitengrade als Linien parallel zum Äquator dargestellt.
Ebenso verhält es sich bei den Linien der Himmelskoordinaten. Die
Längengrade zwischen Himmelsnord- und Südpol werden als Rektaszension,
die Breitengrade parallel zum Himmelsäquator als Deklination bezeichnet. Die
Himmelspole sind als die Orte definiert, an denen die Erdachse scheinbar den
Himmel „durchstößt“. Der Himmelsäquator stellt den auf die Himmelsebene
projizierten Erdäquator dar. Siehe hierzu Abb. 34. Auf diese Weise kann jedem
Objekt am Himmel ein eindeutiger Ort zugewiesen werden, eben so wie auf
der Erde. So hat z.B. Hamburg auf der Erdkugel die Koordinaten 53,5°
Nord und 10° Ost. Der Ringnebel in der Leier hat die Koordinaten 18h in RA
und +33° in Deklination.
• Rektaszension (RA): Diese Himmelsversion des Längengrads wird in
Stunden, Minuten und Sekunden im 24-h-Format angegeben. Die Nulllinie
läuft hier durch den sog. Frühlingspunkt im Sternbild Fische. Eine Stunde in
RA entspricht 15°, der Zahlenwert steigt in Richtung Osten an.
• Deklination (DEC): Diese Himmelsversion des Breitengrades wird in Grad (°),
Minuten (') und Sekunden ('') angegeben. Nördliche Deklinationen werden
mit + (Plus) versehen, südliche mit – (Minus). Der Maximalwert beträgt jeweils
90° an den Himmelspolen, der Minimalwert 0° am Himmelsäquator.
Teilkreise
Die am LX200ACF angebrachten Teilkreise ermöglichen das Auffinden von
Himmelsobjekten, wenn die Go-To-Funktion nicht genutzt werden soll. Der
RA-Teilkreis (Abb. 1, Nr. 11 und Abb. 36) befindet sich an der Montierungsbasis.
Der Deklinationsteilkreis (Abb. 35) befindet sich am linken Gabelarm. Wenn das
Teleskop auf den Himmelspol ausgerichtet ist, sollte der DEC-Teilkreis 90°
anzeigen (ggf. einstellen). Jeder Strich auf dem DEC-Teilkreis stellt 1° dar. Der
RA-Teilkreis läuft von 0 bis 24 h und lässt sich in 5-Minuten-Inkrementen
ablesen.
Der Umgang mit Teilkreisen erfordert eine ausgereifte Technik. Wenn Sie das
erste Mal Teilkreise benutzen, versuchen Sie von einem hellen Stern mit
bekannten Koordinaten zu einem anderen zu „springen“. Üben Sie so, von
einem leicht auffindbaren Objekt zu einem Schwierigeren zu springen. Hierbei
wird deutlich, mit welcher Präzision das Teleskop mit der Polhöhenwiege
eingenordet und positioniert werden muss. Beachten Sie, dass der RA-Teilkreis
zwei Skalen besitzt: Die äußere Skala mit im Gegenuhrzeigersinn aufsteigenden
Zahlen ist für Benutzung auf der Nordhalbkugel; die innere Skala mit im
Uhrzeigersinn aufsteigenden Zahlen ist für Benutzer auf der Südhalbkugel.
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
50
(c) nimax GmbH
Page 51

LX20 0 A C F
Benutzung der Teilkreise, um ein visuell schwieriges Objekt anzufahren:
Nachdem Teleskop und Polhöhenwiege korrekt eingenordet wurden, stellen Sie
ein bekanntes Objekt im Teleskop ein und eichen Sie die Teilkreise auf dessen
Koordinaten. Lösen Sie nun die Klemmungen und stellen Sie die Koordinaten
des Zielobjekts durch eine entsprechende Bewegung des Teleskops ein. Ziehen
Sie die Klemmungen wieder an. Wenn dieser Vorgang sorgfältig durchgeführt
wurde und das Teleskop korrekt eingenordet ist, sollte das Objekt nun in einem
schwach vergrößernden Okular sichtbar sein. Wenn dies nicht der Fall ist,
suchen Sie die nähere Umgebung ab. Beachten Sie, dass das Gesichtsfeld
eines 8" LX200ACF mit einem 26mm Plössl-Okular nur ca. 0,5° beträgt, also nur
etwa Monddurchmesser! Hier kann der 8x50 Sucher aufgrund seines deutlich
größeren Gesichtsfelds gute Dienste beim Aufsuchen leisten. Genaue
Aufsuchergebnisse erfordern eine präzise Ausrichtung auf den Himmelspol;
siehe hierzu Seite 53.
ANHANG A: PARALLAKTISCHE AUSRICHTUNG
Die Polhöhenwiege
Für die parallaktische Ausrichtung des LX200ACF ist die optionale Polhöhenwiege erforderlich.
Wichtiger Hinweis: Für das 16˝ LX200ACF ist statt einer
Polhöhenwiege eine gewinkelte Säule (Breitengrad entspre-
chend) erhältlich.
Abb. 37: Polhöhenwiege
Hinweis: Für normale astrono-
mische Anwendungen (außer
Fotografie) ist eine einfache
Einnordung der Polhöhenwiege
ausreichend; lassen Sie sich
nicht durch eine – für visuelle
Zwecke nicht notwendige –
übergenaue Ausrichtung des
Teleskops und dem damit verbundenen Aufwand den Spaß
am Umgang mit diesem
Instrument verderben.
Mit der Polhöhenwiege ist die Astrofotografie mit langen Belichtungszeiten
möglich. Für den mechanischen Aufbau der Polhöhenwiege siehe deren
separate Bedienungsanleitung.
ACHTUNG: Die Meade Polhöhenwiegen sind ausschließ-
lich in Verbindung mit dem serienmäßigen Stativ zu benutzen.
Die Polhöhenwiegen dürfen keinesfalls alleine, z.B. auf einem
Tisch, aufgestellt werden. Das Teleskop kann stark aus der
Balance kommen und im Extremfall sogar umkippen.
Eigenschaften der Polhöhenwiege:
• Anschluss der Wiege an das Stativ durch nur eine Schraubverbindung.
• Schnelle Azimut-Grobeinstellung durch Lockern dieser Schraube.
• Dosenlibelle zum einfachen waagerechten Aufstellen der Polhöhenwiege.
• Geätzte Breitengradskala zum schnellen Voreinstellen des Breitengrads.
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
51
Page 52

Hinweis: Im Folgenden wird
die Ausrichtung auf den
Himmelsnordpol beschrieben.
Bei Standorten auf der
Südhalbkugel ist das Teleskop
auf den Himmelssüdpol auszurichten; ein passender
„Südpolarstern“ wird automatisch vom AutoStar-II vorgegeben. Der Rest des Vorgehens ist
analog zum Einnorden.
Kleiner Wagen
Großer Wagen
Abb. 38: Polarstern
A
B
Abb. 39: Teilkreis 0-Position
Norden
Abb. 40a: Polare Grundausrichtung
180°
Abb. 40a: Polare Grundausrichtung
Polarstern
Cassiopeia
C
Polarstern
180°
LX20 0 A C F
ANHANG A: PARALLAKTISCHE AUSRICHTUNG
Ausrichtung auf den Himmelspol
Himmelsobjekte scheinen sich um den Himmelspol zu drehen und innerhalb von 24
Stunden eine komplette Umdrehung mit dem Polarstern in der Mitte zu vollziehen.
Indem die Polachse des Teleskops auf den wahren Himmelspol ausgerichtet wird,
können die Objekte durch das Bewegen von nur einer Achse (Pol- oder auch
Stundenachse genannt) nachgeführt werden. Dies kann auch durch den elektrischen
Antrieb des LX200ACF erfolgen. Wenn das Teleskop gut auf den Himmelspol ausgerichtet ist, sind nur sehr geringe Korrekturen in Deklination erforderlich, um ein Objekt
im Gesichtsfeld zu halten. Nahezu die gesamte Nachführung wird durch den Antrieb
in der Stundenachse bewerkstelligt (bei perfekter Einnordung wären keinerlei
Korrekturen in DEC vonnöten). Für einfache astronomische Anwendungen ist eine
Ausrichtung mit einer Genauigkeit von 1-2° ausreichend. Auf diese Weise können
Objekte für 20-30 Minuten visuell ohne Korrekturen im Gesichtsfeld gehalten werden.
Beginnen Sie das Einnorden des Teleskops, indem Sie den Polarstern auffinden; Dies
ist sehr einfach. Fast alle Beobachter kennen den „Großen Wagen“. Dieser hat zwei
Sterne, die den Weg zu Polaris weisen (Abb. 38). Wenn der Polarstern einmal ausgemacht ist, lässt sich das grobe Einnorden des Teleskops einfach bewerkstelligen.
Für die Ausrichtung auf Polaris folgen Sie bitte der Anleitung. Die Ausrichtung der
Polhöhenwiege und die Montage des Teleskops hierauf sind in der Anleitung der
Polhöhenwiege beschrieben.
1. Wählen Sie „Setup“ > „Teleskop“ > „Montierung“ und aktivieren Sie
„Parallaktisch“. Das Teleskop ist nun im parallaktischen Modus.
2. Drücken Sie nun bis ange-
zeigt wird. Gehen Sie zu „Ausrichten“ und bestätigen Sie mit .
3. wird angezeigt. Scrollen Sie zu
AutoStar-II fordert Sie nun auf, das Teleskop in die parallaktische
Grundposition zu bringen.
a) Bringen Sie die Dosenlibelle der Polhöhenwiege durch Einstellen der
Stativbeine in die Waage.
b) Stellen Sie den Breitengrad Ihres Beobachtungsortes ein.
c) Der MEADE Autostar kann eine extrem hohe Genauigkeit bei der
Positionierung erzielen, sofern Sie eine Grundregel einhalten. Diese
Hauptregel betrifft die Einhaltung der Orthogonalität der
Deklinationsachse zur optischen Achse des Geräts. Das heißt: Die
optische Achse muss parallel zur mechanischen Achse des Geräts
verlaufen. Dies lässt sich mit wenigen Handgriffen prüfen und einrich-
ten. Die genauste orthogonale Ausrichtung erreicht man, indem man
das Teleskop in die parallaktische Grundposition stellt, d.h. die
Gabelarme stehen waagerecht (beide Markierungen am R.A.-Teilkreis
liegen übereinander) und der Sucher befindet sich auf der unteren Seite
des Tubus. Nun wird das System so ausgerichtet, dass der Tubus in
Richtung des Himmelspols zeigt (Abb. 40a). Der Polarstern wird in das
Gesichtsfeld des Suchers eingestellt (der Sucher sollte vorher parallel
zum Teleskop ausgerichtet sein). Nun schwenkt man das Teleskop um
180 Grad (Richtung Ost oder West) (Abb. 40b), so dass der Sucher statt
nach unten zum Boden, nach oben zum Himmel weist. Man schaut nun
im Sucher und prüft, ob der Polarstern während der Drehung „pendel-
te“, d.h. je nach Schwenk mal über oder unter dem Fadenkreuz des
Suchers liegt. Sollte dies der Fall sein, so schwenkt man manuell das
Teleskop am Deklinationsdrehknopf um entsprechend kleine Beträge
und wiederholt die beschriebene 180 Grad Messung bis die scheinbare
Polarsternbewegung im Sucher keine großen Positionsschwankungen
mehr aufweist.
d) Lösen Sie die RA-Klemmung und bringen Sie den Tubus in die 0h
Position, so dass die Markierungen A und B (siehe Abb. 39) übereinanderliegen.
e) Drücken Sie . Das Teleskop fährt die Koordinaten von Polaris an.
ENTER
MODE
EasyAusrichten:
Ein-SternAusrichten:
SetupAuswahl:
ENTER
und drücken Sie . Der
ENTER
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
52
(c) nimax GmbH
Page 53
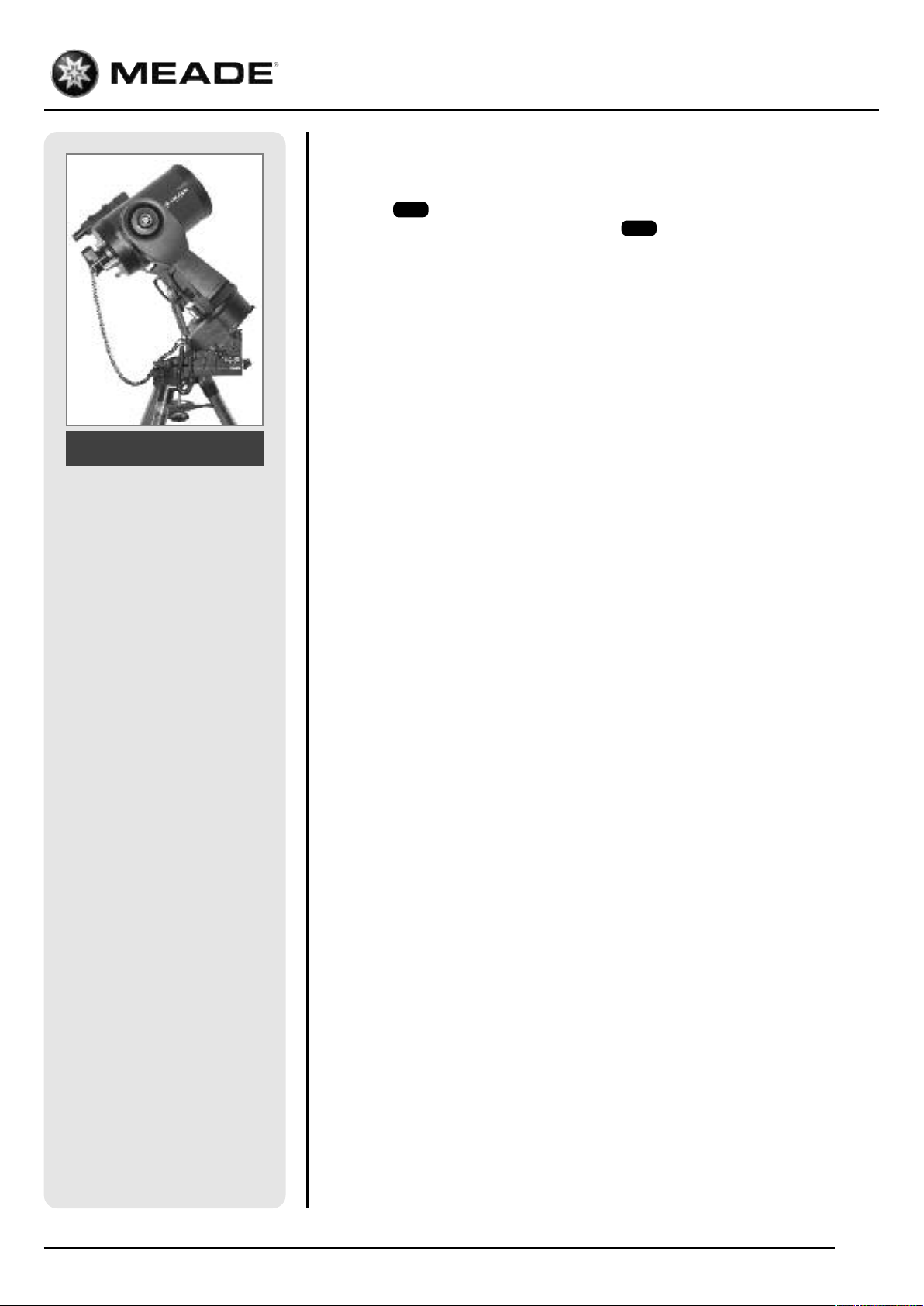
Abb. 40c: LX200ACF auf
Polhöhenwiege
LX20 0 A C F
f) Bringen Sie Polaris mit den Azimut- und Breitengradeinstellungen der
Polhöhenwiege in die Mitte des Gesichtsfeldes. Benutzen Sie nicht die
Pfeiltasten der AutoStar-II Handbox oder die Feinbewegungen in RA
und DEC des Teleskops. Nachdem Polaris zentriert wurde, drücken Sie
ENTER
. Das Teleskop fährt nun einen Referenzstern an, der mittels
Pfeiltasten zu zentrieren und mit zu bestätigen ist. Das Teleskop
ist nun ausgerichtet und eingenordet. Weitere Ausrichtmethoden sind
auf Seite 54 beschrieben.
An diesem Punkt ist die Polarausrichtung des Teleskops für visuelle Zwecke genau
genug. Es gibt jedoch Anwendungen wie z.B. die die Langzeit-Astrofotografie, bei
denen eine präzisere Ausrichtung auf den Himmelspol erforderlich ist.
Wenn die Polhöhe der Wiege einmal justiert wurde, ist es in der Regel nicht erforderlich, diese bei jeder Ausrichtung neu einzustellen. Lediglich bei neuen Standorten,
die sich in der Nord-Süd-Richtung unterscheiden, ist eine Neujustierung erforderlich
(der Unterschied beträgt ca. 1° pro 110 km in Nord-Süd-Richtung). Solange das Stativ
genau waagerecht ausgerichtet ist, bleibt auch die Breitengrad-Einstellung der
Polhöhenwiege erhalten, auch wenn die Polhöhenwiege zwischenzeitlich
abgenommen wird. Wenn das Teleskop das erste Mal parallaktisch ausgerichtet wird,
empfiehlt es sich, die Justierung des DEC-Teilkreises (Abb. 35) zu überprüfen.
Zentrieren Sie nach erfolgter Ausrichtung Polaris im Okular und lösen Sie die
Klemmung des DEC-Teilkreises am linken Gabelarm (Drehknauf). Stellen Sie nun den
Teilkreis auf 89,2°, die Deklination von Polaris, ein und ziehen Sie die Klemmung
wieder an. Wenn Sie manuell mit den Teilkreisen arbeiten möchten, so muss der
RA-Teilkreis (S. 50, Abb. 36) bei jeder neuen Beobachtung manuell kalibriert werden.
Richten Sie das Teleskop auf ein Objekt mit bekannten Koordinaten aus und stellen
Sie am RA-Teilkreis dessen Koordinate ein. Der äußere Teilkreis für die Nord-, der innere Teilkreis für die Südhemisphäre – siehe auch Abb. 39.
ANHANG A: PARALLAKTISCHE AUSRICHTUNG
ENTER
Exakte Ausrichtung auf den Himmelspol
Während eine einfache Ausrichtung auf den Himmelspol für visuelle Zwecke
ausreichend ist, wird für die Astrofotografie mit längeren Belichtungszeiten
(mehr als 2-3 Minuten) eine exakte Ausrichtung unverzichtbar. Die LX200ACF
Teleskope bieten zwar eine sehr genaue Nachführung, jedoch ist es für die
Astrofotografie um so besser, je weniger Korrekturen in DEC während einer
Belichtung notwendig werden. Die notwendige Anzahl dieser Korrekturen hängt
direkt von der Güte der Polausrichtung der Montierung ab.
Für die exakte Polausrichtung ist ein Fadenkreuzokular wie z.B. das 9mm von
Meade notwendig. Darüber hinaus empfiehlt sich die Verwendung einer
Barlowlinse zum weiteren Erhöhen der Vergrößerung. Die folgende Prozedur
lässt sich auch durchführen, wenn der Polarstern nicht sichtbar ist und ist als
Drift- oder Scheiner-Methode bekannt:
1. Richten Sie das Teleskop, wie eingangs beschrieben, parallaktisch aus
und setzen Sie das Fadenkreuzokular – ggf. auch mit Barlow-Linse – ein.
2. Richten Sie das Teleskop bei laufender Nachführung auf einen mittelhellen Stern dort, wo der Meridian und der Himmelsäquator sich kreuzen.
Für beste Ergebnisse sollte der Stern innerhalb ± 30 Minuten in RA vom
Meridian (lokaler Südpunkt) liegen und max. 5° vom Himmelsäquator
entfernt sein.
3. Achten Sie nun auf die Richtung, in die der Stern in Deklination driftet
(ignorieren Sie Drifts in RA): Driftet der Stern in Richtung Süden, steht
die Teleskopachse zu weit östlich. Driftet der Stern in Richtung Norden,
steht die Teleskopachse zu weit westlich. Beachten Sie dabei die unterschiedliche Bildumkehr im Okular bei Benutzung eines Zenitspiegels /
Zenitprismas!
4. Korrigieren Sie nun die Fehlstellung mit kleinen Korrekturen in der
Azimutverstellung der Polhöhenwiege so lange, bis kein Nord- oder
Süddrift mehr feststellbar ist, indem Sie die Punkte 3 und 4 über einen
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
53
Page 54

LX20 0 A C F
gewissen Zeitraum wiederholen.
5. Richten Sie das Teleskop nun auf einen mittelhellen Stern im Osten,
aber dennoch in der Nähe des Himmelsäquators. Für beste Ergebnisse
sollte der Stern 20 bis 30° über dem Osthorizont stehen und max. ± 5°
vom Himmelsäquator entfernt sein.
6. Achten Sie wieder auf die Drift in Deklination: Driftet der Stern nach
Süden, steht die Teleskopachse zu tief; driftet er nach Norden, steht die
Teleskopachse zu hoch.
7. Korrigieren Sie nun die Fehlstellung mit kleinen Korrekturen in der
Höhenverstellung der Polhöhenwiege so lange, bis kein Nord- oder
Süddrift mehr feststellbar ist, indem Sie die Punkte 6 und 7 über einen
gewissen Zeitraum wiederholen.
Die obige Methode führt zu einer sehr genauen Polausrichtung und minimiert
die notwendigen Korrekturen während der Aufnahmen.
ANHANG A: PARALLAKTISCHE AUSRICHTUNG
Alternative parallaktische Ausrichtmethoden
Der AutoStar-II bietet drei verschiedene parallaktische Ausrichtmethoden an:
Easy, Ein- und Zwei-Stern.
Easy Polarausrichtung
Vom AutoStar-II werden zwei Sterne, abhängig von Uhrzeit, Datum und
Standort, ausgewählt. Davor wird der Polarstern zur Ausrichtung der
Polhöhenwiege angefahren.
Ein-Stern Polausrichtung
Hier wird, wie auf Seite 52 beschrieben, zuerst Polaris zentriert und bestätigt
und anschließend ein Referenzstern angefahren. Diese Methode bietet bei
genauer Ausrichtung der Polhöhenwiege die höchste Positionier- und
Nachführgenauigkeit.
Zwei-Stern-Polausrichtung
Diese Methode erfordert gewisse Kenntnisse des Nachthimmels. Nach der
Ausrichtung auf den Polarstern sind zwei Referenzsterne auszuwählen, die dann
wie gehabt angefahren und zentriert werden.
LX200ACF Tipps:
Surfen im Internet
Eine der größten Informationsquellen zum Thema Astronomie ist das Internet. Hier
gibt es eine immense Vielfalt an Fotos, Hintergrundinformationen, Test- und
Erfahrungsberichten, Beobachtungstipps, Diskussionsforen und vieles mehr. Eine
kleine Auswahl von Seiten, die Sie interessieren könnten, ist im Folgenden
aufgelistet. Bitte beachten Sie, dass Meade für den Inhalt externer Seiten nicht
verantwortlich ist.
Astronomische Zeitschriften:
• Sterne und Weltraum www.suw-online.de
• Astronomie heute www.astronomie-heute.de
• Interstellarum www.interstellarum.de
• Sky&Telescope www.skyandtelescope.com
• ASTRONOMY www.astronomy.com
• NightSky www.nightsky-online.de
Informationsquellen, Foren, Vereinigungen:
• www.astronomie.de
• www.astrotreff.de
• www.heavens-above.com
• www.vds-astro.de
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
54
(c) nimax GmbH
Page 55

LX20 0 A C F
ANHANG B: TABELLEN
ANHANG B:
TABELLEN
ORTSTABELLEN
Zur Unterstützung der Verfahren für die Ausrichtung auf den Himmelspol (siehe
Seite 52) sind im folgenden die Breitengrade verschiedener Weltstädte
aufgeführt. Wenn Sie die geographische Breite Ihres Beobachtungsortes ermitteln möchten, der in dieser Tabelle nicht auftaucht, so suchen Sie sich eine
Stadt heraus, die in Ihrer Nähe liegt. Dann gehen Sie gemäß folgender Methode
vor:
Beobachter auf der Nördlichen Erdhalbkugel (N):
Wenn sich Ihr Beobachtungsplatz um 110 km nördlicher als die aufgeführte
Stadt befindet, addieren Sie pro 110 km je einen Breitengrad. Liegt Ihr Beobachtungsort um 110 km südlicher als die entsprechende Stadt, so ziehen Sie pro
110 km einen Breitengrad ab.
Beobachter auf der Südlichen Erdhalbkugel (S):
Wenn sich Ihr Beobachtungsplatz um 110 km nördlicher als die aufgeführte
Stadt befindet, subtrahieren Sie pro 110 km je einen Breitengrad. Liegt Ihr
Beobachtungsort um 110 km südlicher als die entsprechende Stadt, so addieren Sie pro 110 km einen Breitengrad.
EUROPA
Stadt Land Breite
Amsterdam Niederlande 52° N
Athen Griechenland 38° N
Berlin Deutschland 52° N
Bern Schweiz 47° N
Bonn Deutschland 50° N
Borken/Westf. Deutschland 52° N
Bremen Deutschland 53° N
Dresden Deutschland 51° N
Dublin Irland 53° N
Düsseldorf Deutschland 51° N
Frankfurt/M. Deutschland 50° N
Freiburg Deutschland 48° N
Glasgow Schottland 56° N
Hamburg Deutschland 54° N
Hannover Deutschland 52° N
Helsinki Finnland 60° N
Kopenhagen Dänemark 56° N
Köln Deutschland 51° N
Leipzig Deutschland 51° N
Lissabon Portugal 39° N
London Großbritannien 51° N
Madrid Spanien 40° N
München Deutschland 48° N
Nürnberg Deutschland 50° N
Oslo Norwegen 60° N
Paris Frankreich 49° N
Rom Italien 42° N
Saarbrücken Deutschland 49° N
Stockholm Schweden 59° N
Stuttgart Deutschland 49° N
Wien Österreich 48° N
Warschau Polen 52° N
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
55
Page 56

LX20 0 A C F
VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA
Stadt Land Breite
Albuquerque New Mexico 35° N
Anchorage Alaska 61° N
Atlanta Georgia 34° N
Boston Massachusetts 42° N
Chicago Illinois 42° N
Cleveland Ohio 41° N
Dallas Texas 33° N
Denver Colorado 40° N
Detroit Michigan 42° N
Honolulu Hawaii 21° N
Jackson Mississippi 32° N
Kansas City Missouri 39° N
Las Vegas Nevada 36° N
Little Rock Arkansas 35° N
Los Angeles Kalifornien 34° N
Miami Florida 26° N
Milwaukee Wisconsin 46° N
Nashville Tennessee 36° N
New Orleans Louisiana 30° N
New York New York 41° N
Oklahoma City Oklahoma 35° N
Philadelphia Pennsylvania 40° N
Phoenix Arizona 33° N
Portland Oregon 46° N
Richmond Virginia 37° N
Salt Lake City Utah 41° N
San Antonio Texas 29° N
San Diego Kalifornien 33° N
San Francisco Kalifornien 38° N
Seattle Washington 47° N
Washington District of Columbia 39° N
Wichita Kansas 38° N
ANHANG B: TABELLEN
SÜDAMERIKA
Stadt Land Breite
Asuncion Paraguay 25° S
Brasilia Brasilien 24° S
Buenos Aires Argentinien 35° S
Montevideo Uruguay 35° S
Santiago Chile 34° S
ASIEN
Stadt Land Breite
Peking China 40° N
Seoul Südkorea 37° N
Taipei Taiwan 25° N
Tokio Japan 36° N
Victoria Hongkong 23° N
AFRIKA
Stadt Land Breite
Kairo Ägypten 30° N
Kapstadt Südafrika 34° S
Rabat Marokko 34° N
Tunis Tunesien 37° N
Windhoek Namibia 23° S
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
56
(c) nimax GmbH
Page 57
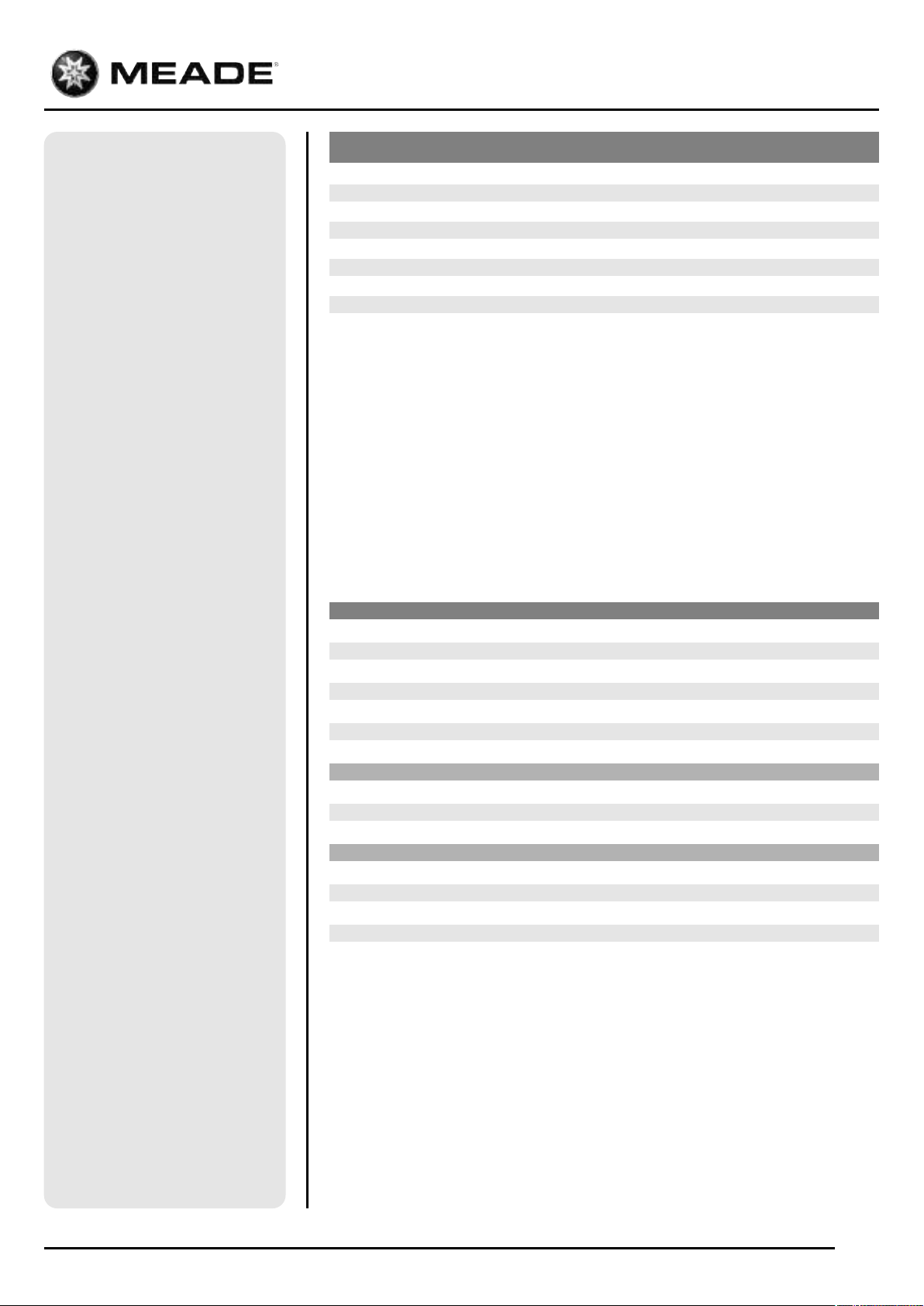
LX20 0 A C F
ANHANG B: TABELLEN
AUSTRALIEN
Stadt Land Breite
Adelaide Südaustralien 35° S
Brisbane Queensland 27° S
Canberra New South Wales 35° S
Alice Springs Northern Territory 24° S
Hobart Tasmanien 43° S
Perth Westaustralien 32° S
Sydney New South Wales 34° S
Melbourne Victoria 38° S
Aufsuchtabelle für markante Sterne
Im folgenden finden Sie eine Auflistung heller Sterne mit ihren Koordinaten in RA
und DEC, zusätzlich sind die Jahreszeiten der nördlichen Erdhalbkugel angegeben, während derer diese Sterne am Nachthimmel besonders auffällig sind.
Diese Liste kann dem Beobachter dabei helfen, für die verschiedenen Zeiten
eines Jahres geeignete Leitsterne zu finden. Wenn Sie zum Beispiel auf der
nördlichen Hemisphäre soeben einen Hochsommerabend erleben, dann würde
sich Ihnen der Deneb im Sternbild Schwan als vorzüglicher Leitstern anbieten.
Gleichzeitig könnten Sie sich jedoch nicht der Beteigeuze bedienen, denn sie
gehört zum Wintersternbild Orion und befindet sich aus diesem Grund momentan unterhalb des Horizontes.
Jahreszeit Sternname Sternbild RA DEC
Frühling Arkturus Bootes 14h 16m +19° 11
Frühling Regulus Löwe 10h 09m +11° 58
Frühling Spica Jungfrau 13h 25m -11° 10
Sommer Wega Leier 18h 37m +38° 47
Sommer Deneb Schwan 20h 41m +45° 17
Sommer Atair Adler 19h 51m +08° 52
Sommer Antares Skorpion 16h 30m -26° 26
Herbst Markab Pegasus 23h 05m +15° 12
Herbst Fomalhaut Südlicher Fisch 22h 58m -29° 38
Herbst Mira Cetus 02h 19m -02° 58
Winter Rigel Orion 05h 15m -08° 12
Winter Beteigeuze Orion 05h 55m +07° 25
Winter Sirius Großer Hund 06h 45m -16° 43
Winter Aldebaran Stier 04h 35m +16° 31
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
57
Page 58

LX20 0 A C F
ANHANG C: ERSTELLEN VON EIGENEN STREIFZÜGEN
ANHANG C:
ERSTELLEN VON EIGENEN STREIFZÜGEN
Wie Sie sich Ihren eigenen „Streifzug“ zusammenstellen können
Wenn Sie einen „Streifzug“ angewählt haben, fährt Ihr Teleskop eine vorgegebene Objektliste ab und zeigt für jedes Objekt nähere Informationen an. Dazu
gehören Objektklasse, dazugehöriges Sternbild, RA- und DEC-Koordinaten und
so weiter. Der Autostar-II bietet Ihnen ein paar Streifzüge, die werkseitig bereits
einprogrammiert wurden. Es steht einem Beobachter jedoch frei, weitere eigene
Streifzüge zu entwerfen und im Speicher des Autostar-II abzulegen.
Ein Streifzug besteht grundsätzlich aus einer ASCII-Textdatei, in der eine Liste
von Anweisungen und Beschreibungen enthalten ist. Jede Zeile einer
Rundreise-Datei kann aus einer Kommentarzeile, einer Befehlszeile oder einer
Beschreibungszeile bestehen.
Im Folgenden wird beschrieben, was Sie hierzu alles benötigen:
• Einen PC mit einem Text-Editor oder mit einem Textverarbeitungs-
programm. Die Rundreise muss als eine „Nur Text“-Datei oder als „MS-DOS
Textdatei“ gespeichert werden.
• Das Meade LX200ACF Interface-Kabel, mit dem Sie die Daten Ihrer
Rundreise in die Autostar-II Handbox übertragen können. Bitte erkundigen Sie
sich über die Systemvoraussetzungen und ob sie Ihr PC erfüllt.
Streifzug-Modus
Die Objekte, die Sie sich für einen Streifzug ausgesucht haben, werden entweder aus den Grunddaten des Autostar-II entnommen oder sie sind vorher mit
ihren RA- und DEC-Koordinaten eingegeben worden. Die Rundreise wird in zwei
Modi angeboten:
Der Automatische Modus: In der ersten Zeile erscheint der Name des Objekts,
auf der zweiten Zeile läuft ein beschreibender Te xt durch.
Der Interaktive Modus: In der ersten Zeile des Autostar-Anzeigefelds erscheint
der Titel des betreffenden Streifzugs. Der Name des Objekts wird in der zweiten
Zeile angezeigt. Wenn Sie sich die Textbeschreibung in diesem Modus ansehen
möchten, müssen Sie auf ENTER drücken.
Die Kommentarzeile der Streifzug-Textdatei
Hier befinden sich die Angaben zum Streifzug-Programm, die nicht angezeigt
werden. Dazu gehören Autor, Dokumentation der einzelnen Überarbeitungen,
Urheberrechte usw.. Alle Kommentarzeilen beginnen mit dem Zeichen „/“. Hier
ein Beispiel:
/Außergewöhnliche Objekte
/ © 2002 Meade Instruments Europe GmbH & Co. KG
Die Kommandozeile der Streifzug-Textdatei
In dieser Zeile befinden sich verschiedene Programm-Anweisungen. Dazu
gehören RA- und DEC-Koordinaten, ein Titel-Textblock, ein BeschreibungsTextblock und ein Kennwort.
Formate:
• RA: Geben Sie die Rektaszension eines Objektes mit folgendem Format ein:
HH:MM:SS, z.B. 18:51:05
• DEC: Geben Sie die Deklination eines Objektes mit folgendem Format ein:
DDdMMmSSs, z.B. –06d16m00s.
• Titel-Textblock: Der Te x t in einem Titel-Textblock wird als Name des Objekts
angezeigt. Ein Titel-Textblock darf aus insgesamt 16 Zeichen bestehen. Er
muss von zwei Anführungszeichen eingerahmt werden. Zwei Beispiele: „M64“
oder „Lieblingsstern“.
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
58
(c) nimax GmbH
Page 59

LX20 0 A C F
ANHANG C: ERSTELLEN VON EIGENEN STREIFZÜGEN
Im interaktiven Modus erscheint der Titel-Textblock solange auf der zweiten
Zeile, bis die -Taste gedrückt wird. Im Automatischen Modus oder nach
dem Anwählen des Interaktiven Modus erscheint der Titel-Textblock in der
ersten Zeile. Auf Zeile 2 läuft indessen die Beschreibung durch.
• Kennworte: Sie lösen Aktionen aus, die während einer geführten Rundreise
erforderlich sind. Der Autostar-II erkennt folgende Kennworte:
TITLE TEXT USER NGC
IC SAO MESSIER CALDWELL
PLANET MOON SATELLITE ASTEROID
COMET LUNAR ECLIPSE METEOR SHOWER DEEP SKY
CONSTELLATION STAR LANDMARK DEFINE
PICK ONE/PICK END AUTO SLEW ON/OFF #END
• Beschreibungs-Textblock: Hier ist die Beschreibung des Objekts enthalten.
Der Textblock muss von Anführungszeichen eingerahmt sein. Wenn die
Beschreibung länger als eine Zeile sein sollte, muss jede Zeile mit einem
Anführungszeichen und mit der „Return“-Taste abgeschlossen werden. Die
nächste Zeile muss wieder mit einem Anführungszeichen beginnen.
Falls die Beschreibung im Anzeigefeld mit Anführungszeichen dargestellt
werden soll, verwenden Sie zu Beginn und am Ende der entsprechenden Phrase
zwei Anführungszeichen. Hier ein Beispiel: "Der Orionnebel wird von vielen
Beobachtern als ""absolut umwerfend"" bezeichnet".
ENTER
Erstellung eines Streifzuges
Nun können Sie selbst einen ganz persönlichen Streifzug entwerfen, indem Sie
die oben aufgelisteten Kennworte anwenden. Wenn Sie am Anfang einer
Kommandozeile das Kennwort AUTO SELECT eingeben, aktivieren Sie damit
den Automatischen Modus. Wenn Sie diesen später anwählen, sucht der
Autostar-II das bestimmte Objekt und stellt es automatisch ein. Im Folgenden ist
eine Liste von Kommandozeilen mit allen Kennworten und den möglichen
Textblöcken aufgeführt:
TITLE
Nach einer eventuellen Kommentarzeile muss Ihre Rundreise mit dem Kennwort
TITLE beginnen; er darf nicht länger als 15 Zeichen sein. Wenn Sie die Option
Streifzüge aus den Autostar-Menüs wählen, wird dieser Titel angezeigt. Ein
Beispiel: TITLE „Die Milchstraße“
TEXT
„Titel-Textblock“ und „Beschreibungs-Textblock“ Dieser Befehl ermöglicht
Ihnen die Darstellung eines Titels oder einer Beschreibung im Anzeigefeld.
USER
„Titel-Textblock“ „Beschreibungs-Textblock“. Mit diesem Befehl verschaffen Sie
sich Zugang zu einem bestimmten Objekt Ihrer Wahl mit Ihrer eigenen
Beschreibung. Geben Sie zuerst USER ein, dann folgt die Eingabe von RA und
DEC, des Namens und der Beschreibung des gewünschten Objekts. Bei der
Eingabe verwenden Sie die Formate, die im Kapitel „Die Kommandozeile“ dargestellt sind. Die folgenden Befehle betreffen Objekte, die sich bereits in den
Grunddaten des Autostars befinden. Wenn diese Befehle hinter dem Kennwort
AUTO SELECT stehen, erscheint der Name des Objekts in der ersten Zeile.
Seine Beschreibung läuft in der zweiten Zeile durch. Fügen Sie keinen weiteren
Beschreibungs-Textblock an die im Folgenden aufgeführten Kommandozeilen
an. Diese Befehle führen zu allen Objekten, die sich bereits mit einer
Beschreibung in den Grunddaten des Autostar-II befinden.
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
59
Page 60

LX20 0 A C F
NGC xxxx
Geben Sie die Buchstaben „NGC“ und danach die gewünschte Nummer aus
dem New General Catalog ein. Der Autostar-II liefert Ihnen aus seinen
Grunddaten eine Beschreibung dieses Objekts. Ein Beispiel: NGC 4256.
IC xxxx
Geben Sie die Buchstaben „IC“ und danach die gewünschte Nummer aus dem
Index Catalog ein. Der Autostar-II liefert Ihnen aus seinen Grunddaten eine
Beschreibung dieses Objekts. Ein Beispiel: IC 1217.
SAO xxxxx
Geben Sie die Buchstaben „SAO“ zusammen mit der gewünschten SAONummer ein. Der Autostar-II liefert Ihnen aus seinen Grunddaten eine
Beschreibung dieses Objekts. Ein Beispiel: SAO 30200.
MESSIER xxx
Geben Sie die Buchstaben „MESSIER“ zusammen mit der gewünschten
Messier-Nummer ein. Der Autostar-II liefert Ihnen aus seinen Grunddaten eine
Beschreibung dieses Objekts. Ein Beispiel: M 101.
CALDWELL xxx
Geben Sie die Buchstaben „CALDWELL“ zusammen mit der gewünschten
Caldwell-Nummer ein. Der Autostar-II liefert Ihnen aus seinen Grunddaten eine
Beschreibung dieses Objekts. Ein Beispiel: CALDWELL 17.
ANHANG C: ERSTELLEN VON EIGENEN STREIFZÜGEN
PLANET „Name“
Geben Sie die Buchstaben „PLANET“ zusammen mit dem Namen des
gewünschten Planeten ein. Der Name des Planeten muss in Anführungszeichen
stehen. Der Autostar-II liefert Ihnen aus seinen Grunddaten eine Beschreibung
dieses Planeten. Ein Beispiel: PLANET „Pluto“.
MOON
Dieser Befehl liefert Ihnen aus den Grunddaten des Autostar-II Informationen
über den Mond.
SATELLITE „Name“
Geben Sie die Buchstaben „SATELLITE“ zusammen mit dem Namen des
gewünschten Satelliten ein. Der Name des Satelliten muss in
Anführungszeichen stehen. Der Autostar-II liefert Ihnen aus seinen Grunddaten
eine Beschreibung dieses Satelliten. Ein Beispiel: SATELLITE „Intl Space Stn“.
Aktuelle Satellitennamen entnehmen Sie bitte dem Internet z.B.
www.meade.com oder www.meade.de.
ASTEROID „Name“
Geben Sie die Buchstaben „ASTEROID“ zusammen mit dem Namen des
gewünschten Asteroiden ein. Der Name des Asteroiden muss in Anführungszeichen stehen. Der Autostar-II liefert Ihnen aus seinen Grunddaten eine
Beschreibung dieses Asteroiden. Ein Beispiel: ASTEROID „Ceres“.
COMET „Name“
Geben Sie die Buchstaben „COMET“ zusammen mit dem Namen des gewünschten Kometen ein. Der Name des Kometen muss in Anführungszeichen
stehen. Der Autostar-II liefert Ihnen aus seinen Grunddaten eine Beschreibung
dieses Kometen. Ein Beispiel: COMET „Halley“.
LUNAR ECLIPSE
Sollte der Titel LUNAR ECLIPSE Bestandteil der Rundreise sein, überprüft der
Autostar-II bei Aktivierung des Rundreise-Menüs jedesmal seine Grunddaten,
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
60
(c) nimax GmbH
Page 61

LX20 0 A C F
ANHANG C: ERSTELLEN VON EIGENEN STREIFZÜGEN
ob an diesem Abend eine Mondfinsternis sichtbar ist. Falls sich keine Mondfinsternis beobachten lässt, wird diese Option abgebrochen. Die Rundreise fährt
mit dem nächsten Objekt fort.
METEOR SHOWER
Sollte der Titel METEOR SHOWER Bestandteil der Rundreise sein, überprüft der
Autostar-II bei Aktivierung des Rundreise-Menüs jedesmal seine Grunddaten,
ob an diesem Abend ein Meteorschauer zu erwarten ist. Falls sich kein
Meteorschauer beobachten lässt, wird diese Option abgebrochen. Die
Rundreise fährt mit dem nächsten Objekt fort.
DEEP SKY „Name“
Geben Sie die Buchstaben „DEEP SKY“ und danach den Namen des gewünschten Objektes ein. Das Objekt muss in Anführungszeichen stehen. Ein
Beispiel: DEEP SKY „Kleine Magellansche Wolke“.
CONSTELLATION „Name“
Geben Sie die Buchstaben „CONSTELLATION“ und danach den Namen des
gewünschten Sternbilds ein. Das Sternbild muss in Anführungszeichen stehen.
Ein Beispiel: STERNBILD „Kleiner Löwe“.
STAR „Name“
Geben Sie die Buchstaben „STERN“ und danach den Namen des gewünschten
Sterns ein. Der Sternname muss in Anführungszeichen stehen. Ein Beispiel:
STERN „Vega“.
LANDMARK az alt „Titel“ „Beschreibung“
Geben Sie das Azimut (az) des gewünschten Objekts mit folgendem Format ein:
xxxdxxmxxs. Ein Beispiel: 123d27m00s. Nun geben Sie die Höhe (Altitude alt)
des gewünschten Objekts mit folgendem Format ein: xxdxxmxxs. Schließlich
erfolgt noch die Eingabe des Titel-Textblocks und des BeschreibungsTextblocks. Beide müssen mit Anführungszeichen eingerahmt sein. Hier ein Beispiel: LANDMARK 123d27m00s „Landobjekt 1“ „Nördliche Ecke des
Appartmenthauses“.
PICK ONE / PICK END
Diese beiden Anweisungen werden verwendet, um eine Liste von Einzelheiten
einzugrenzen, die der Autostar-II während einer Rundreise auswählen kann. Der
Autostar-II beginnt in der PICK ONE-Liste ganz oben und zeigt das erste Objekt
der Liste, das über dem Horizont steht, an. Der Rest wird ignoriert.
Die Befehle sind immer dann sehr hilfreich, wenn man Rundreisen entwerfen
möchte, die das ganze Jahr über präsentiert werden sollen. Für jede
Objektklasse, die Sie in Ihrer Rundreise ansteuern wollen, suchen Sie sich 10
oder 12 Objekte aus, die sich innerhalb des entsprechenden
Rektaszensionsbereichs befinden. Klammern Sie die Objekte mit dem Befehl
PICK ONE / PICK END ein.
Ein aktuelles Beispiel :
AUTO SELECT TEXT „Kugelsternhaufen“ „Kugelsternhaufen sind gewaltige,
kugelförmige Anhäufungen von Sternen.“ „Sie enthalten 50.000 bis
100.000 Sterne und liegen im Randbereich unserer“ „Milchstraße.“
PICK ONE
AUTO SELECT MESSIER 13
AUTO SELECT MESSIER 15
AUTO SELECT MESSIER 92
AUTO SELECT MESSIER 4
AUTO SELECT MESSIER 68
AUTO SELECT NGC 1234
AUTO SELECT TEXT „Keine verfügbar“ „Es tut mir leid. Es gibt momentan keine hellen“ „Kugelsternhaufen zu sehen.“
PICK END
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
61
Page 62

LX20 0 A C F
ANHANG C: ERSTELLEN VON EIGENEN STREIFZÜGEN
AUTO SLEW ON / AUTO SLEW OFF
Wenn der Befehl AUTO SLEW ON in einer Rundreise eingebaut ist, dreht das
Teleskop automatisch auf das Objekt und zeigt erst dann den Text mit der
Beschreibung an. Diese Funktion ist sehr nützlich, wenn Rundreisen erstellt
werden, bei denen die Beobachtung ganz bestimmter Objekte erforderlich ist.
Ein Beispiel: Ein Astronomie-Lehrer weist seine Schüler an, sechs Objekte zu
beobachten, wobei nur vier Objekte vom Autostar-II während einer Rundreise
automatisch angesteuert werden sollen. Die Studenten müssen jetzt die beiden
übrigen Objekte mit der Hand einstellen. Er würde hierzu den Befehl AUTO
SLEW ON vor das erste Objekt stellen. Hinter dem vierten Objekt käme dann der
Befehl AUTO SLEW OFF.
#END
Geben Sie den Befehl #END in eine eigene Zeile ganz zum Schluß der Rundreise
ein, um diese Rundreise abzuschließen.
Hier nun mal ein Beispiel, wie eine fertige Rundreise in der Textdatei
aussehen könnte.
//////////////////////////////////////////////////////////
// Default Factory tour for Autostar handboxes
//////////////////////////////////////////////////////////
TITLE "Abendliche Hits"
// Der Mond
Moon
// Beste Planeten
Planet "Venus"
Planet "Mars"
Planet "Jupiter"
Planet "Saturn"
// Moegliche Ereignisse
Meteor Showers
Lunar Eclipses
// Deep Sky Objekte
CALDWELL 106
MESSIER 32
MESSIER 31
DEEP SKY "Small Mag. Cloud"
CALDWELL 14
MESSIER 34
MESSIER 45
CALDWELL 41
DEEPSKY "Large Mag. Cloud"
MESSIER 79
MESSIER 38
MESSIER 42
MESSIER 36
MESSIER 37
MESSIER 35
SAO 234480
MESSIER 41
MESSIER 44
CALDWELL 53
CALDWELL 92
NGC 3377
CALDWELL 91
NGC 4261
MESSIER 68
CONSTELLATION "Coma Berenices"
CALDWELL 99
CALDWELL 94
CALDWELL 77
CALDWELL 80
MESSIER 51
MESSIER 04
MESSIER 13
MESSIER 92
MESSIER 06
MESSIER 07
MESSIER 08
MESSIER 22
MESSIER 11
MESSIER 57
CALDWELL 93
Deep Sky "Cygnus X-1"
MESSIER 27
MESSIER 15
MESSIER 02
CALDWELL 63
MESSIER 52
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
62
(c) nimax GmbH
Page 63

LX20 0 A C F
// Helle und interessante Sterne
STAR "ACHERNAR"
STAR "MIRA"
STAR "ALDEBARAN"
STAR "BETELGEUSE"
STAR "CANOPUS"
STAR "SIRIUS"
STAR "CASTOR"
STAR "REGULUS"
STAR "ACRUX"
STAR "SPICA"
STAR "ARCTURUS"
STAR "ANTARES"
STAR "VEGA"
STAR "ALTAIR"
STAR "ALBIREO"
STAR "DENEB"
STAR "ENIF"
STAR "FOMALHAUT"
// Sterne mit Planeten
AUTO SELECT TEXT "Stars w/planets" "Die folgenden Sterne"
"werden von Planeten umkreist. Dies sind die ersten Sterne, wo"
"wir den Beweis haben, dass Sonnensysteme wie unseres nicht“
„einzigartig sind."
SAO 100582
SAO 100706
SAO 234134
SAO 252838
SAO 31899
SAO 37362
SAO 43557
SAO 65024
SAO 80478
SAO 90896
AUTO SELECT TEXT "Quasars" "Diese Objekte sind Quasare. Das ist"
"Abk. für 'Quasi stellar objects.' Dies sind die vielleicht"
"entferntesten, mit Telesk. beobachtbaren Objekte von der Erde."
DEEP SKY "PG1011-040"
DEEP SKY "PG1012+008"
DEEP SKY "PG1216+069"
DEEP SKY "PG1435-067"
DEEP SKY "PG2112+059"
DEEP SKY "PHL909"
DEEP SKY "PKS0537-441"
DEEP SKY "V404 Cygni"
AUTO SELECT TEXT "Ende", "Danke für Ihr Interesse an 'Das Beste"
"der Nacht' (c)2001 Meade Instruments."
#END
ANHANG C: ERSTELLEN VON EIGENEN STREIFZÜGEN
Übertragen von Streifzügen in den Autostar
Sobald Sie eine Rundreise geschrieben und als ASCII-Datei gespeichert haben
(als „Nur Text“-Datei oder als „MS-DOS“-Datei), laden Sie die Rundreise in den
Autostar. Verwenden Sie hierzu die Autostar Update Utility die Sie vorher auf
Ihrem PC installiert haben. Sie bekommen dieses Programm übrigens gratis auf
unserer Homepage www.meade.de.
Sobald eine Rundreise in die Handbox heruntergeladen wird, überprüft der
Autostar-II die Programmierung. Wenn er eine Formulierung, die in dieser
Rundreise verwendet wird, nicht kennt, dann markiert er die unklare Stelle und
zeigt sie in einem „pop up“-Fenster auf Ihrem PC-Bildschirm an. Führen Sie die
erforderlichen Korrekturen aus und versuchen sie es erneut, die Daten zu
übertragen. In der Betriebsanleitung, die mit dem LX200 Interface-Kabel
mitgeliefert wird, und im Supportbereich auf www.meade.de finden Sie weitere
Informationen zum Herunterladen von Daten und zur Schnittstelle Autostar/PC.
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
63
Page 64

LX20 0 A C F
Druecke -> bis es
zentriert ist.
Druecke <- bis es
zentriert ist.
Antriebstrain.:
RA Train.
Antriebstrain.:
DEC Training
Antriebs-Train.:
Benutzen Sie......
Zentriere Ref.Objekt
ENTER
ENTER
ENTER
ENTER
Das Teleskop
schwenkt n. links.
Drücken d. rechten
Pfeiltaste, bis Objekt
wieder zentr. ist.
12
13
14
15
16
17
Das Teleskop
schwenkt n. rechts.
Drücken d. linken
Pfeiltaste, bis Objekt
wieder zentr. ist.
Sie kehren zum
Az.Training zurück.
Höhen- oder Altituden-Training
(vertikal)
Hinweis darauf,
ein terrestrisches
Objekt zu beobachten
Antriebstrain.:
DEC Train
Auswahl:
Objekt
Drücke bis es
zentriert ist.
Drücke bis es
zentriert ist.
ENTER
ENTE
R
MODE
18
19
20
21
Holen Sie das Ziel
mit den Pfeiltasten
in die Bildmitte
Das Teleskop
schwenkt n. unten.
Drücken d. obrigen
Pfeiltaste, bis Objekt
wieder zentr. ist.
Das Teleskop
schwenkt n. oben.
Drücken d. unteren
Pfeiltaste, bis Objekt
wieder zentriert ist.
Drücken Sie mehrmals auf die
MODE-Taste
ENTER
Auswahl:
Objekt
Auswahl:
Setup
Setup
Ausrichtung
Setup
Teleskop
3
4
6
ENTER
Drücken Sie einmal
SCROLL UP
Gehen Sie ins
Setup-Menü
Drücken Sie mehrfach SCROLL UP
Gehen Sie ins
Teleskop-Menü
5
ENTER
1
Teleskop
Montierung
Teleskop
Antriebstrain.
Antriebstrain.
RA Train.
Antriebs-Train.:
Benutzen Sie.....
Zentriere Ref.Objekt
ENTER
ENT
ER
ENTE
R
Drücken Sie mehrfach SCROLL UP
Gehen Sie ins
Antriebstr.-Menü
und wählen aus...
Azimut-Training
(horizontal)
7
8
9
10
11
Hinweis darauf,
ein terrestrisches
Objekt zu beob.
Holen Sie das Ziel
mit den Pfeiltasten
in die Bildmitte
EN
TER
1. Überprüfen Sie, ob die
INITIALISIERUNG des
Autostar abgeschlossen ist.
Drücken Sie die MODE,
bis "Punkt wählen: Objekt"
1
2
>
>
ANHANG D: ANTRIEBSTRAINING
ANHANG D:
ANTRIEBSTRAINING
Das Antriebstraining ist unbedingt vor der Erstinbetriebnahme des Teleskops
durchzuführen. Darüber hinaus sollte es, je nach Nutzung des Teleskops, etwa
alle 3 bis 6 Monate wiederholt werden. Führen Sie das Antriebstraining gemäß
der folgenden Anleitung an einem Landziel wie z.B. einer Kirchturmspitze, einem
Telegrafenmast oder dergl. durch.
Abb. 41
64
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
Page 65
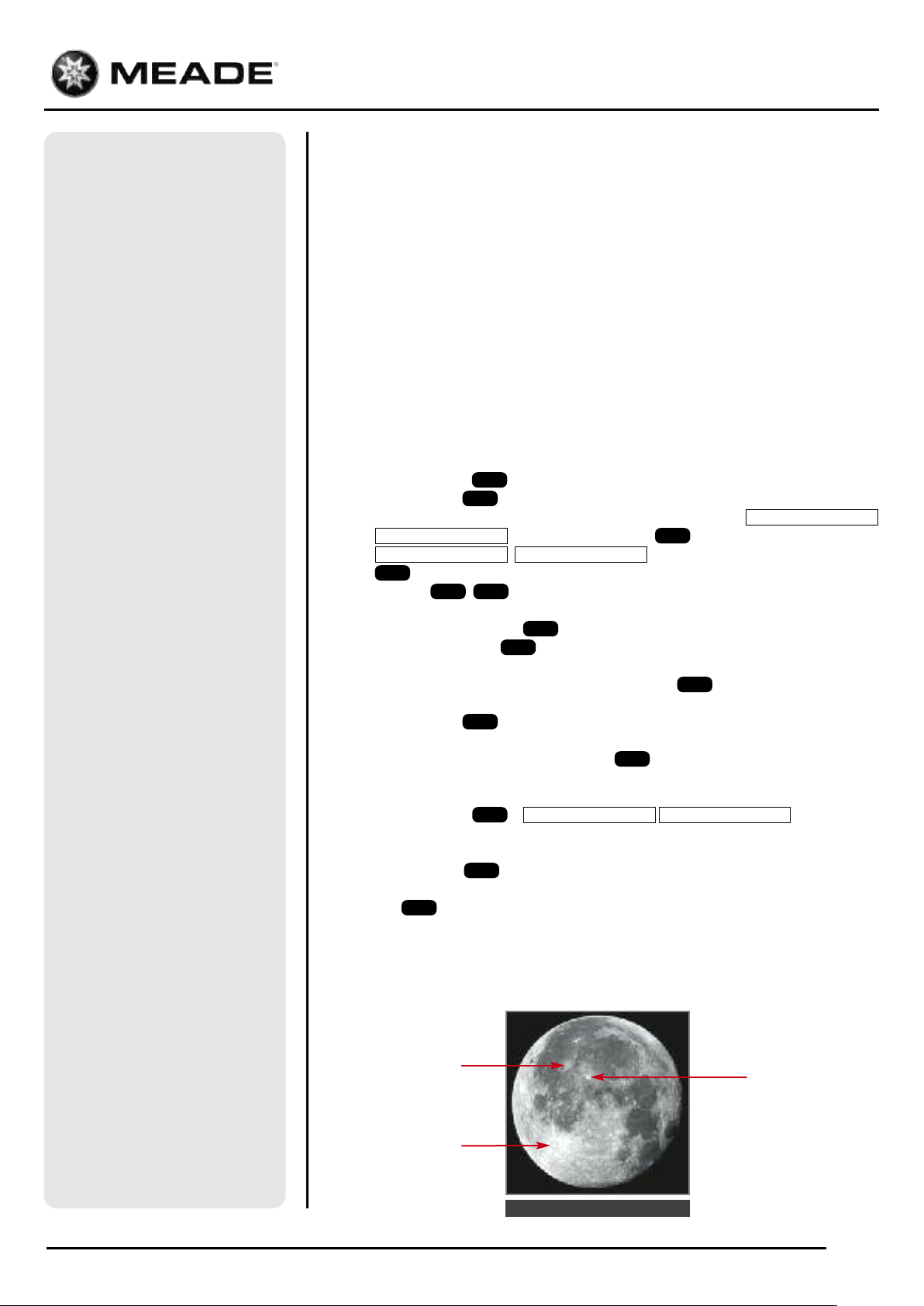
LX20 0 A C F
ANHANG E: DAS MONDMENÜ
ANHANG E:
DAS MONDMENÜ
Die Option „Mond“ aus dem Objektmenü ermöglicht es Ihnen, den Mond in
einer Weise zu beobachten, wie es bisher nicht möglich war. Sie können viele
spezifische Strukturen auf der Mondoberfläche wie Krater, Maria, Täler und
Berge anfahren. Eine Sonderfunktion führt Sie zu den sechs ApolloLandestellen. Es ist zwar nicht möglich, die Landefähren oder von den
Astronauten mitgebrachte Fahrzeuge direkt zu beobachten (die bestmögliche
Auflösung der Mondoberfläche von erdgebundenen Teleskopen beträgt ca. 500
m), jedoch können Sie Landeorte selber und deren Umgebung betrachten.
Wenn der AutoStar II auf ein Mondobjekt synchronisiert wird, schaltet das
Teleskop automatisch auf selenografische Koordinaten um.
Beispiel: Beobachtung der Apollo-15-Landestelle mittels des Mondmenüs
1. Führen Sie Initialisierung und Ausrichtung des Teleskops wie gewohnt
durch.
2. Drücken Sie um in das Sonnensystem-Menü zu kommen und
drücken Sie .
3. Wählen Sie mittels der Scrolltasten
Mond
4. wird angezeigt. Drücken Sie nun
GOTO
und der Mond wird angefahren.
5. Mit den können Sie nun verschiedene Untermenüs anwählen.
Wählen Sie nun einen markanten Krater wie z.B. Kopernikus oder Kepler
aus und drücken Sie .
6. Drücken Sie nun um das Objekt anzufahren. Es wird noch nicht
ausreichend zentriert sein. Holen Sie es nun mittels der Pfeiltasten in die
Mitte des Gesichtsfeldes und halten Sie für ca. 2-3 Sekunden
gedrückt. erscheint im Display. Nach einem erneuten
Druck auf ist das Teleskop nun auf die selenografischen
Koordinaten synchronisiert.
7. Nach zweifacher Betätigung der Taste gelangen Sie wieder zur
Auswahlliste. Mit den Scrolltasten können Sie nun „Landestellen“
auswählen.
8. Drücken Sie . wird angezeigt.
9. Wählen Sie mit den Scrolltasten „Apollo 15“ an.
10. Drücken Sie . Das Teleskop fährt nun die Landestelle von Apollo 15
an.
11. Mit können Sie wieder das Menü verlassen.
MODE
SS
5
ENTER
an und drücken Sie .
ÜberblickMond
qp
ENTER
GOTO
ENTER zum Sync.
ENTER
ENTER
GOTO
Sonnensystem:
ENTER
ENTER
MODE
Apollo 11Landestellen:
Mit dieser Methode können Sie auch alle anderen Interessanten Punkte des
Mondes aufsuchen. Mit der „?“ Taste können Sie sich weitere Informationen
zum jeweiligen Punkt anzeigen lassen und mit MODE zum Menü zurückkehren.
Kepler
Kopernikus
Tycho
Abb. 42: drei bekannte Krater
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
65
Page 66

LX20 0 A C F
ANHANG F: BESONDERHEITEN 16“ LX200ACF
ANHANG F:
BESONDERHEITEN 16“ LX200ACF
A
C
ACHTUNG: Neben der
Fokussiereinrichtung
befinden sich zwei rote
Schrauben, die ausschließlich der Transportsicherung dienen.
Ersetzen Sie diese durch
die beiliegenden Kunststoffkappen, bevor der
Fokussierknopf betätigt
wird. Das 16“ LX200ACF
sollte auf keinen Fall ohne
diese Transportsicherungen als Frachtgut versendet werden; für den privaten Transport sind diese
Sicherungen nicht notwendig.
B
18
Die Bedienung des 16“ LX200ACF ist zum größten Te il identisch mit den anderen Modellen dieser Baureihe. Die Abweichungen werden im Folgenden
beschrieben.
Anschlussboard
18V-Eingangsbuchse (Abb. 43 B): Hier wird das 18V-Netzteil aus dem MeadeZubehörprogramm angeschlossen.
De-Rotator-Anschluss (Abb. 43 G): Für alt/azimutal aufgestellte 16“ LX200ACF
ist ein spezieller Derotator verfügbar, welcher an diese Buchse angeschlossen
wird. Der Derotator kann im Zubehörmenü an- und abgeschaltet werden.
12V-Ausgangsbuchse (Abb. 43 E): Hier wird ein Tubuslüfters angeschlossen.
Versand als Frachtgut
Wenn das 16“ LX200ACF einmal als Frachtgut versendet werden sollte, gehen
Sie bitte wie folgt vor:
1. Drehen Sie den Fokussierknopf im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag;
hierdurch wird der Hauptspiegel in die hinterste Position gebracht.
2. Entfernen Sie die Kunststoffkappen und ziehen Sie die Schrauben nach dem
Einsetzen handfest an. Sollten die Schrauben verlegt worden sein, so
können auch handelsübliche Maschinenschrauben der Dimension1/4-20x1“
verwendet werden.
3. Beim Verpacken des Teleskops lösen Sie die RA- und DEC-Klemmungen,
um Getriebeschäden vorzubeugen.
Das Teleskop darf nur im originalen Versandkarton und unter Beachtung der der
vorherigen Anweisungen verschickt werden. Schäden, die aus Nichtbeachtung
der Anweisungen resultieren, fallen nicht unter die Garantie.
ACHTUNG: Vorsicht: Erschütterungen während des Transports können zu
schweren Getriebeschäden am Teleskop führen. Vor einem Transport oder
wenn das Teleskop im Versandkarton aufbewahrt wird, müssen daher in
jedem Fall die RA- und DEC-Klemmungen (Siehe Abb. 1 Nr. 12 und 17) gelöst
werden. Hierdurch können die Achsen bei Erschütterungen nachgeben. Die
optischen und mechanischen Achsen des Teleskops wurden im Werk sorgfältig aufeinander abgestimmt, die volle Positioniergenauigkeit zu ermöglichen.
Lösen Sie daher niemals die Tubusadapter (Abb. 1 Nr. 25) vom Teleskop. Bitte
betätigen Sie auch nicht den Fokussierknopf (Abb. 1 Nr. 6) bevor Sie den links
nebenstehenden Hinweis gelesen haben!
D
E
Abb. 43: Anschlussboard des 16˝ LX200ACF
F G H I
Aufbau des 16“ LX200ACF
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
66
(c) nimax GmbH
Page 67

LX20 0 A C F
ANHANG F: BESONDERHEITEN 16“ LX200ACF
Aufbau des 16“ Super-Feldstativs
1
2
4
3
7 6
5
Abb. 44: Das 16˝ LX200ACF Stativ
(1) Stativkopf; (2) Gewindestange; (3)
Spindelschraube; (4) Spreizspange; (5)
Klemmschrauben; (6) Stützstreben; (7) Nabe
1
Abb. 45: Das 16"-Stativ im
zusammengefaltetem Zustand.
Wichtiger Hinweis: Bedingt durch die Größe und das Gewicht des
Teleskops, ist beim Aus- und Verpacken, Aufbau, Abbau und Transport
besondere Vorsicht walten zu lassen. Diese Tätigkeiten sollten immer von
mindestens zwei Personen durchgeführt werden. Nichtbeachtung dieses
Hinweises kann zu Beschädigungen am Teleskop und schweren Verletzungen
führen!
Das 16“ Super-Feldstativ (Abb. 44 + 45) wird als komplett montierte Einheit
geliefert, mit Ausnahme der Spreizplatte (Abb. 44 Nr. 4) und der sechs Klemmschrauben (Abb. 44 Nr. 5). Für jedes Stativbein sind zwei Klemmschrauben
vorgesehen; mit ihnen kann die Höhe des Stativs eingestellt werden. Sie werden
zur Sicherheit separat verpackt geliefert. Für die meisten Beobachtungszwecke
wird das Teleskop direkt mit seiner Basis auf den Stativkopf alt/azimutal
montiert. Alternativ kann es auch auf einer permanenten Knicksäule, die speziell
für den Breitengrad Ihres Beobachtungsortes gefertigt wird, im parallaktischen
Modus betrieben werden. Siehe hierzu S. 50 ff. (Anhang A).
Nachdem das Stativ aus dem Versandkarton genommen wurde, wird es mit den
Füßen nach unten senkrecht aufgestellt und noch zusammengeklappt belassen
(Abb. 45). Lösen Sie nun die untere Schraube (Abb. 45 Nr. 1), wodurch die Nabe
der Spannstreben (Abb. 44 Nr. 7) freigegeben wird. Diese Schraube wird nur für
den Transport des Stativs benötigt. Ziehen Sie nun die Stativbeine einzeln
sorgfältig auseinander. Mit zunehmender Öffnung der Stativbeine wandert die
Nabe der Spannstreben nach unten, bis die Beine bis zum Anschlag auseinandergezogen sind. Schrauben Sie nun die jeweils zwei Schrauben in die
Stativbeine und ziehen Sie sie nach Einstellen der gewünschten Höhe handfest
an. Diese Schrauben bitte nicht überziehen: Übermäßiges Anziehen beschädigt
die Schrauben und Stativbeine und führt zu keiner größeren Stabilität. Lösen Sie
nun die Spannschraube (Abb. 44 Nr. 3) an der Gewindestange und führen Sie
die Spreizplatte (Abb. 44 Nr. 4) von unten ein. Anschließend ziehen Sie die
Schraube wieder handfest an. Auch hier keine Gewalt anwenden! (Siehe Abb.
46)
Abb. 46: Anziehen der Spreizspange
mittels der oberen Kontermutter.
Abb. 47: Entfernen Sie die
Spitzschrauben aus dem Sockel.
Abb. 48: Befestigen des Sockels
auf dem Stativkopf.
Zum Zusammenlegen des Stativs (nachdem das Teleskop abgenommen
wurde) gehen Sie wie folgt vor:
a) Lösen Sie die Spannschraube und drehen Sie die Spreizplatte um ca. 60°, so
dass sie zwischen die Stativbeine zeigt.
b) Führen Sie die Spreizplatte ganz nach oben und ziehen Sie die
Spannschraube wieder an.
c) Führen Sie die Stativbeine wieder zusammen, bis die Nabe der
Spannstreben wieder in die Gewindestange greift. Schrauben Sie nun die
untere Spannschraube wieder handfest an.
Montage der Antriebsbasis
a) Entfernen Sie die drei Bolzen, die das Verpackungsmaterial halten. Diese
Bolzen werden nur für Frachtzwecke, nicht für den Aufbau des Teleskops,
benötigt. Siehe Abb. 47.
b) Drehen Sie das Stativ so, dass ein Bein in etwa nach Süden zeigt.
c) Positionieren Sie die Antriebsbasis so auf dem Stativ, dass das
Anschlussboard auf der Südseite ist. Sichern Sie es mit drei1/4“-13x1-1/4“
Inbusschrauben, indem Sie sie von unten in den Stativkopf (Siehe Abb. 48)
schrauben und mit dem mitgelieferten Schlüssel fest anziehen.
c) Bringen Sie das Stativ in die Waagerechte, indem Sie die Stativbeine
entsprechend in der Länge anpassen.
d) Achten Sie auf den DB-15 Anschluss in der Mitte der Antriebsbasis
Aufbau der Gabel
a) Plazieren Sie die einteilige Gabel auf der Oberseite der Antriebsbasis. Auf der
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH(c) nimax GmbH
67
Page 68

Abb. 49: Befestigen der Gabel auf
dem Sockel.
Abb. 52: Positionieren der
Führungsschlitze über die Paßstifte.
Nach erfolgtem Einrasten wird der
Tubus entlang der Schlitze bis zum
Anschlag geschoben.
LX20 0 A C F
ANHANG F: BESONDERHEITEN 16“ LX200ACF
einen Seite der Gabel befindet sich ein Ausschnitt für die RA-Klemmung und
die manuelle RA-Verstellung (Siehe Abb. 1 Nr. 10 u. 12), welche sich auf der
Antriebsbasis befinden.
b) Schrauben Sie die Gabel mit den vier mitgelieferten 3/8“-16x3/4“
Inbusschrauben handfest an (Abb. 49)
c) Nun die Knopfschrauben von der quadratischen Abdeckplatte (Abb. 50) in
der Mitte der Gabel entfernen. Die Platte ebenfalls abnehmen.
d) Verbinden Sie den DB-15 Stecker mit der DB-15 Buchse der Antriebsbasis
und ziehen Sie die Sicherungsschrauben handfest an (Abb. 51).
e) Mit dem Teleskop wird eine fünfte 3/8“-16x3/4“ Schraube mitgeliefert.
Schrauben Sie diese, nur mit den Fingern, in das Gewindeloch (Siehe Abb.
51). Diese Schraube dient nur zur Sicherung des DB-15 Anschlusses vor
Beschädigung, wenn das Teleskop abmontiert wird. Die Gabel kann nicht
entfernt werden, solange der fünfte Bolzen eingeschraubt ist; da er sich
direkt neben dem DB-15 Anschluss befindet, dient er zur Erinnerung daran,
die Verbindung vorher zu trennen.
Montage des Optischen Tubus (Optical tube assembly – OTA)
Dieser Schritt erfordert zwei Personen die in der Lage sind, jeweils ca. 35 kg zu
Rändelschrauben
Abb. 50: Entfernen der vier Rändel-
schrauben in der Mitte der Gabel.
Fünfte Schraube
Abb. 51: Blick durch die Öffnung in
der Gabel von oben: Eindrehen der
fünften Schraube und Anschluss
des DB-15 Steckers.
DB-15 Buchse
im Sockel
Abb. 53: Festziehen der Inbusschrauben zum DEC-Gehäuse.
heben. Der OTA wiegt etwa 60 kg und ist zur Montage genau auf der Gabel zu
positionieren.
a) Auf der Oberseite der Gabel befinden sich zwei Passbolzen. Diese dienen zur
Ausrichtung des OTA. Auf der Innenseite der Deklinationslager sind zwei
Passbohrungen mit Schlitzen; achten Sie auf deren Lage, bevor Sie den OTA
aufsetzen. Beachten Sie, dass diese Bohrungen nur auf einer Seite sind; der
OTA kann daher nur in einer Richtung montiert werden.
b) Ziehen Sie die DEC-Klemmung (Abb. 1 Nr. 12) handfest an. Stellen Sie sich
nun mit einem Helfer links und rechts des OTA auf, fassen Sie die beiden
Handgriffe auf jeder Seite der Deklinationslager und heben Sie den OTA auf
die Gabel. Positionieren Sie die Passbohrungen genau über den Bolzen und
schieben Sie dann den abgesenkten OTA in den Führungsschlitzen bis zum
Anschlag zurück (Siehe Abb. 52).
c) Sichern Sie den OTA, indem Sie die vier 3/8“-16x3/4“ Inbusschrauben von
unten in die Deklinations-Lagerarme handfest einschrauben (Abb. 53).
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
68
(c) nimax GmbH
Page 69

Abb. 54: Verbinden der DB-9
Buchsen mittels der 20cm langen
Kabel.
LX20 0 A C F
ANHANG F: BESONDERHEITEN 16“ LX200ACF
Anbringen der Versorgungs- und Datenkabel
Mit dem 16“ LX200ACF werden diverse Anschlusskabel mitgeliefert. Diese soll-
ten komplett angeschlossen werden, bevor das Teleskop eingeschaltet wird.
a) Stellen Sie sicher, dass der Hauptschalter (Abb. 43 A) ausgeschaltet ist.
Schließen Sie das Netzteil an die Buchse (Abb. 43 B) an.
b) Die Verbindung zum DEC-Antrieb, den GPS- und Levelsensoren erfolgt
durch zwei kurze DB-9 Kabel. Stecken Sie diese jeweils in die Buchsen an
Gabel und Deklinationslager ein und ziehen Sie die Sicherungsschrauben
handfest an (Abb. 54).
c) Schließen Sie die AutoStar II Handbox an die Buchse (S.66, Abb. 43 F) an.
d) Verbinden Sie den Tubuslüfter mittels des Spiralkabels an den 12
V=
Ausgang (Abb. 43 E) an.
LX200ACF Tipps:
Überlegungen zur Beobachtung
• Versuchen Sie einen Beobachtungstandort zu finden, der abseits von hellen
Lichtquellen wie Städten, Straßen oder Sportplätzen liegt. Ist dies nicht immer
möglich dann wählen Sie ein Ort, wo es etwas dunkler ist. Um so dunkler, um so
besser.
• Geben Sie Ihren Augen etwa 10 Minuten, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen.
Gönnen Sie Ihren Augen auch etwa alle 10 bis 15 Minuten eine BeobachtungsPause, um tränende Augen und Augenschmerzen zu vermeiden.
• Versuchen Sie während einer Beobachtung im Dunkeln kein weißes Licht zu
verwenden. Erfahrene Beobachter benutzen ausschließlich rotes Licht um
die Gewöhnung des Auges an die Dunkelheit nicht zu verlieren (Dunkeladaption
des Auges). Sie benutzen entweder die Taschenlampe des Autostar-II, oder wickeln
rote Spezialfolie um ihre Lampen. Beachten Sie auch, dass wenn sich
andere Beobachter in der Nähe befinden, sie nicht mit weißem Licht hantieren.
Leuchten Sie auch nie mit einer Lampe in ein Teleskop, durch das gerade
beobachtet wird!
• Ziehen Sie sich warm an. Im sitzen kann es an kühlen Ta ge n schnell zu Unterkühlung
kommen.
• Üben Sie die Vorbereitung Ihrer Ausrüstung im Hellen, damit dann im Dunkeln jeder
Handgriff sitzt.
• Verwenden Sie Ihr 26mm Okular für die Erdbeobachtung oder weit enfernte Gebiete
am Sternhimmel, wie etwa offene Sternhaufen (z.B. Plejaden M45). Benutzen Sie ein
stärker vergrößerndes Okular, wie z.B. ein 9mm um nahe Dinge, etwa die Ringe des
Saturn oder um Krater auf dem Mond zu sehen.
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
69
Page 70

LX20 0 A C F
ANHANG G: BESONDERHEITEN 14“ LX200ACF
ANHANG G:
BESONDERHEITEN 14˝ LX200ACF
Die Bedienung des 14˝ LX200ACF ist zum größten Teil identisch mit den im
Hauptteil beschriebenen Teleskopen. Die Besonderheiten werden im Folgenden
beschrieben:
Abb. 54: Die Griffmulde einer
Batterieschublade.
Abb. 55: Eine der Schrauben, die
die Batterieschubladen vor dem
Herausrutschen sichert.
Abb. 56: Die Zubehör-Buchsen
am linken Gabelarm des 14"
LX200ACF.
Abb. 57: Die Kollimation erfolgt
über die drei inneren
Inbusschrauben.
Batteriefächer
Die Batteriefächer des 14˝ LX200ACF befinden sich unter den Querträgern der
Gabelarme (Abb. 55). Jedes Batteriefach hat auf seiner Unterseite eine
Griffmulde (Abb. 55), mit der es bequem herausgezogen werden kann.
Wichtiger Hinweis: Die Batteriefächer sind ausschließlich für Batterien
bestimmt. Bewahren Sie nichts anderes darin auf!
Bei parallaktischer Aufstellung werden die Batteriefächer mit zwei
Madenschrauben gesichert, die sich seitlich in den Querträgern befinden (Abb.
55). Vor dem Einsetzen der Batterien lösen Sie zuerst die Madenschrauben mit
dem mitgelieferten Inbusschlüssel. Ziehen Sie nun die Batteriefächer heraus
und setzen Sie die Batterien, wie in Schritt 2 auf S. 13 beschrieben, ein. Setzen
Sie die Batteriehalter wieder ein und schließen Sie die Fächer. Falls Sie vorhaben, das Teleskop parallaktisch aufzustellen, setzen Sie die Madenschrauben
wieder ein und ziehen Sie sie leicht an. Bei alt/azimutaler Aufstellung sind diese
Sicherungsschrauben nicht notwendig.
2˝ Zenitspiegel mit 11/4˝ Adapter
Das 14˝ LX200ACF wird mit einem 2˝ Zenitspiegel incl. Adapter geliefert. Auf den
Seiten 13 und 14 wird beschrieben, wie dieser an den Mikrofokussierer angeschlossen wird.
Aufbau / Transport
Der Aufbau des 14˝ LX200ACF erfolgt analog der Beschreibung auf S. 12f.
Wichtiger Hinweis: Aufgrund des Gewichts und der Größe dieses
Teleskops sollten Aufbau, Abbau und Transport dieses Teleskops nur mit großer Vorsicht und von mindestens zwei Personen erfolgen. Nichtbeachtung
dieses Hinweises kann schwere Verletzungen nach sich ziehen!
Vorsicht: Auf der Rückseite des Tubus befindet sich eine rote
Sicherungsschraube, die vor dem Benutzen der Fokussiereinrichtung in
jedem Fall zu entfernen ist; sie dient ausschließlich als Transportsicherung.
Nach dem Entfernen wird sie durch eine schwarze Gummiabdeckung
ersetzt, die sich im Zubehör befindet. Vor einer Versendung des Teleskops
als Frachtgut ist in jedem Fall der Hauptspiegel in die hinterste Position zu
bringen, indem der Fokussierer bei gelöster Klemmung im Uhrzeigersinn bis
kurz vor den Anschlag gedreht wird. Anschließend die Klemmung leicht verdrehen, bis sich die Sicherungsschraube eindrehen lässt.
Zubehöranschlüsse
Das 14˝ Modell bietet an der Innenseite des linken Gabelarms zusätzliche
Anschlüsse für Fokussierer und Fadenkreuzbeleuchtung (Abb. 56). Bei
Benutzung dieser zusätzlichen Anschlüsse lassen sich die Kabel am Teleskop
bequemer verlegen.
Kollimation
Die Kollimation des 14˝ Modells erfolgt ebenso wie auf S. 44-46 beschrieben.
Die Lage der Justierschrauben ist in Abb. 57 dargestellt.
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
70
(c) nimax GmbH
Page 71

LX20 0 A C F
ANHANG H: SMART MOUNT
ANHANG H:
SMART MOUNT
Einführung
Smart Mount verbessert die Genauigkeit des GoTo-Systems Ihres LX200ACF
Teleskops. Trotz der sorgfältigen Kalibrierung und Einrichtung von Teleskopen
können Objekte manchmal nicht präzise genug zentriert werden. Smart Mount
erlaubt Ihrem Teleskop, systematische Fehler in der Zentrierung zu erkennen
und zu korrigieren, unabhängig von der Ursache.
Da das Trainieren des AutoStars ein wenig Zeit benötigt, empfehlen wir die
Nutzung auf stationär montierten Geräten oder bei sehr hohen Genauigkeitsanforderungen wie z.B. Fotografie. Wenn das Smart Mount Training einmal
durchgeführt wurde, profitiert Ihr Teleskop davon solange wie es immer sorgfältig geparkt wird und keine Veränderungen an der Montierung vorgenommen
werden.
Bei ortsveränderlicher Aufstellung empfehlen wir das SMT-Training (für optimale
Ergebnisse) jedes Mal nach dem Einrichten durchzuführen.
Des weiteren empfiehlt sich die Benutzung eines beleuchteten Fadenkreuzokulares während des Trainingsprozesses. Je präziser die Objekte während des
Trainings zentriert werden, desto höher ist anschließend die erzielbare
Positionierungsgenauigkeit. Ein solches Okular kann bei Ihrem MeadeFachhändler erworben werden.
Bedienung
Der Unterpunkt „Smart Mount“ befindet sich im Setup-Menü des AutoStar II.
Um Smart Mount benutzen zu können, entwerfen Sie ein Korrekturmodell,
welches es Smart Mount erlaubt die Positioniergenauigkeit zu verbessern. Dies
geschieht normalerweise durch das Training der SMT. Wenn das Training einmal
abgeschlossen wurde, wird das Korrekturmodell gespeichert. Im AutoStar II
können mehrere Korrekturmodelle unter verschiedenen Namen abgespeichert
werden. Dadurch ist es z.B. möglich, ein Modell für schwere Kamerazuladung
und ein Modell für normale visuelle Beobachtung abzuspeichern.
Training
Führen Sie die folgenden Bedienungsschritte aus, um solide und wiederholbare
Resultate zu erhalten:
• Initialisierung und Ausrichtung durchführen
• Antriebstraining in beiden Achsen durchführen
Wenn Sie nun ein Korrekturmodell aufnehmen möchten, gehen Sie in das SMT
Hauptmenü. Wählen Sie „Lösche“ an, um das aktuelle Modell zu löschen.
Fahren Sie nun mit den unteren Schritten fort:
Hinweis: Wenn Sie das aktuelle Modell nicht löschen, wird durch das Training
nur das bisherige verfeinert.
• Wählen Sie „Trainiere“ im SMT Menü an und drücken Sie .
• Das Teleskop wählt ca. 40 Sterne aus und fährt sie an.
• Wenn Sie dazu aufgefordert werden, zentrieren Sie jeden Stern sorgfältig und
drücken Sie .
ENTER
ENTER
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
71
Page 72

LX20 0 A C F
Wenn ein Stern – z.B. weil er durch Bäume oder dergleichen verdeckt ist – nicht
zentriert werden kann:
• Kurz MODE drücken, um diesen Stern zu überspringen. Das Te leskop wählt
nun einen anderen aus.
Um die Trainingssequenz abzubrechen, bevor sie beendet wurde:
• MODE drücken und für ca. zwei Sekunden halten
Wenn die Trainingssequenz abgeschlossen wurde:
• Speichern Sie Ihr Modell, indem Sie ihm im „Speichern als“ Menü einen
Namen geben. Nun ist es gespeichert und bleibt angewählt, bis Sie „Aus“ im
SMT Konfigurationsmenü anwählen.
Teleskope auf permanenten Montierungen
Für permanent montierte Teleskope ist ein SMT-Modell ausreichend, solange
nicht durch schweres Zubehör u. ä. die Balance nennenswert beeinflußt wird.
ANHANG H: SMART MOUNT
Menüoptionen
Baumstruktur
Wählen Sie das AutoStar II Setup-Menü und dort Smart Mount. Die Smart
Mount Menükonfiguration sieht wie folgt aus:
• Setup
• Smart Mount
• Konfiguration
• Aus (es wird kein SMT Modell benutzt)
• Ein (benutzt das aktuelle Modell)
• Trainiere (führt das eingangs beschriebene Training durch)
• Update (verbessert das aktuelle Modell jedes Mal, wenn ein Stern
nachsynchronisiert wird)
• Speichern unter (speichert das aktuelle Modell im Flash-Speicher)
• Lösche (löscht das aktuelle Modell)
Speichern und laden von Modellen
Das Smart Mount System erlaubt es Ihnen, verschiedene Korrekturmodelle mit
dem „Speichern als“-Befehl abzuspeichern. Mit dem „Laden“-Befehl wählen Sie
das gewünschte Modell aus.
Smart Mount update
Der Update-Modus erlaubt es Ihnen, das gewählte Modell weiter zu verfeinern.
Nutzen Sie hierzu die in der Anleitung beschriebene NachsynchronisierFunktion. Speichern Sie nachher Ihr verfeinertes Modell ab, da sonst die
Änderungen nach dem Ausschalten verloren gingen.
Smart Mount Ein
Laden Sie ein Modell aus dem Speicher (siehe oben) und wählen Sie dann „SMT
ein“. Wenn SMT eingeschaltet ist, verwendet das Teleskop das derzeit angewählte Modell um die Positioniergenauigkeit zu verbessern. Das Modell selbst
jedoch wird nur verfeinert, wenn „SMT update“ angewählt wurde. Wenn SMT
beim Ausschalten des Teleskops eingeschaltet war, ist es auch beim nächsten
Start des LX200ACF wieder aktiv.
Smart Mount Aus
Wenn SMT ausgeschaltet wird, nutzt das Teleskop kein Korrekturmodell.
Löschen
Der „Löschen“-Befehl löscht die gegenwärtigen SMT-Tabellenwerte, damit ein
neues Modell aufgenommen werden kann.
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
72
(c) nimax GmbH
Page 73
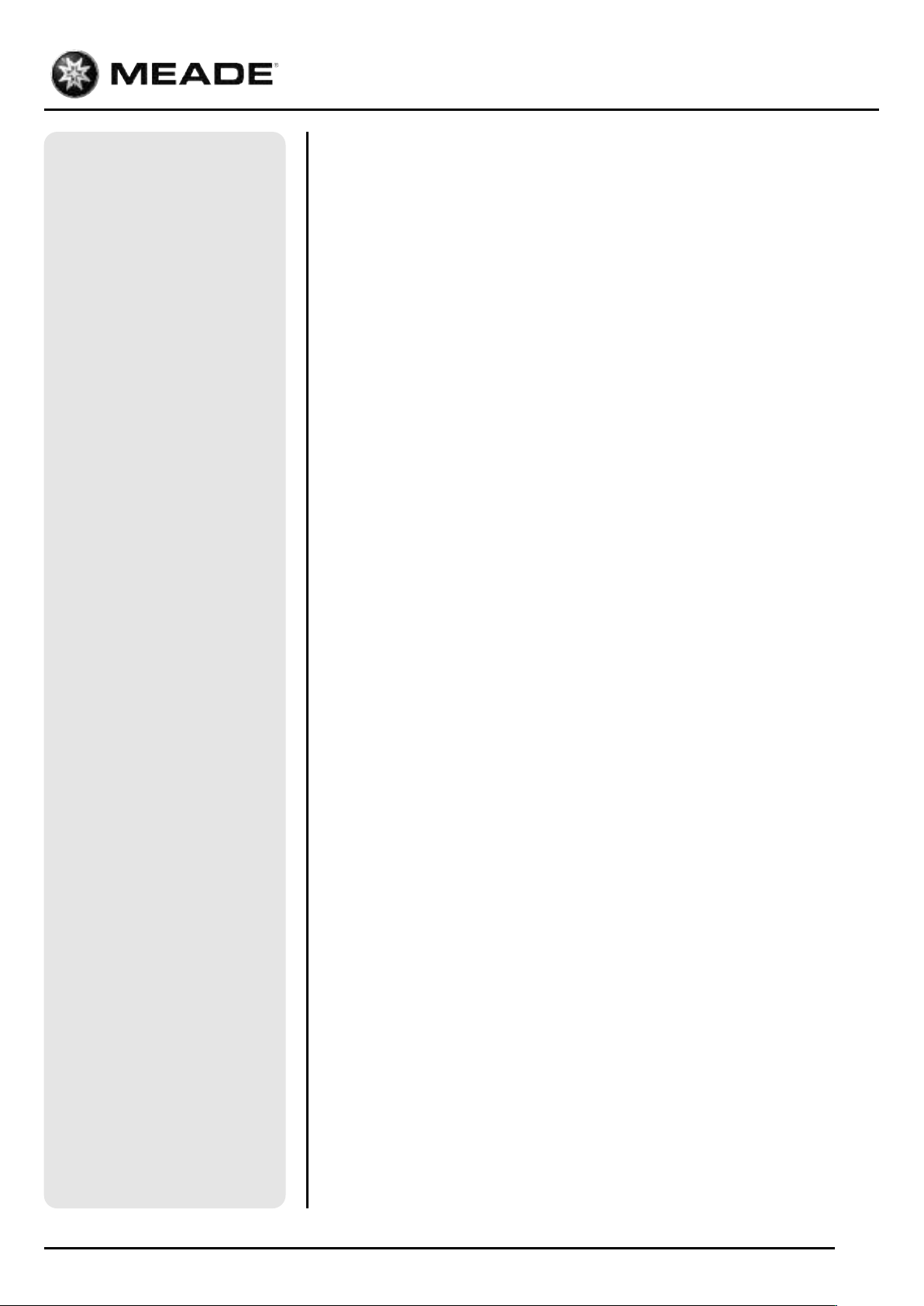
LX20 0 A C F
ANHANG I: ASTRONOMISCHE GRUNDLAGEN
ANHANG I:
ASTRONOMISCHE GRUNDLAGEN
Einführung
Zu Beginn des 17. Jahrhunderts nahm sich der italienische Wissenschaftler
Galileo Galilei ein primitives Fernrohr, das erheblich kleiner als Ihr LX200ACF
war, und richtete es nicht mehr auf ferne Bäume und Berge, sondern fing damit
an, den Himmel zu betrachten. Was er dort sah und was er aus seinen
Beobachtungen folgerte, veränderte die Weltsicht des Menschen für immer.
Versuchen Sie sich vorzustellen, wie man sich fühlt, wenn man als erster
Mensch die Monde um den Jupiter kreisen sieht oder die wechselnden
Venusphasen verfolgt! Aufgrund seiner Beobachtungen folgerte Galileo ganz
richtig, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Er brachte damit die moderne
Astronomie auf den Weg. Dennoch war das Fernrohr Galileis dermaßen
schlecht, dass er damit nicht einmal die Saturnringe richtig erkennen konnte.
Die Entdeckungen Galileis legten den Grundstein für das Verständnis der
Bewegung und Natur von Planeten, Sternen und Galaxien. Henrietta Leavitt
stützte sich auf diese Grundlagen und fand heraus, wie sich die Entfernung zu
den Sternen messen lässt. Edwin Hubble wagte einen Blick in die Ursprünge
des Universums. Albert Einstein enthüllte die Beziehung zwischen Zeit und
Licht. Nahezu täglich werden heute nach und nach die Geheimnisse des
Universums gelöst und entschlüsselt. Hierbei kommen die fortschrittlichsten
Nachfolger des primitiven Galileischen Fernrohrs zum Einsatz, darunter auch
das Weltraumteleskop Hubble. Wir dürfen im „goldenen Zeitalter der
Astronomie“ leben!
Ganz im Gegensatz zu anderen Naturwissenschaften sind in der Astronomie
auch Beiträge von Amateuren willkommen. Zahlreiche Erkenntnisse, die wir von
den Kometen, Meteorschauern, Veränderlichen Sternen, vom Mond und von
unserem Sonnensystem gewonnen haben, stammen ursprünglich aus
Beobachtungen von Amateurastronomen. Wenn Sie also durch Ihr LX200ACFTeleskop schauen, holen Sie sich die Erinnerung an Galilei zurück. Für ihn war
das Fernrohr nicht nur ein schlichter Apparat aus Glas und Metall, sondern viel,
viel mehr: Ein Fenster, durch das man das schlagende Herz des Universums
sehen kann – ein Funken, der den Verstand und die Vorstellungskraft in Brand
setzt.
Das Glossar des Autostar
Vergessen Sie nicht, dann und wann in das Glossar des Autostar zu sehen. Das
Glossar-Menü stellt Ihnen eine alphabetische Liste zur Verfügung, in der Sie
Definitionen und Beschreibungen geläufiger astronomischer Fachausdrücke
nachsehen können. Entweder gehen Sie direkt über das Glossar-Menü in die
Liste oder verschaffen Sie sich über die in den Autostar eingebetteten
Hypertext-Worte Zugang zur Liste. Für weitere Informationen sehen Sie im
Kapitel „Glossar-Menü“ auf Seite 27 nach.
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
73
Page 74

Abb. 61: Der Mond. Beachten Sie
die vielen Schatten in den Kratern.
LX20 0 A C F
ANHANG I: ASTRONOMISCHE GRUNDLAGEN
Beobachtungsobjekte im Weltraum
Im Folgenden sind ein paar der zahllosen astronomischen Objekte aufgeführt,
die sich mit dem LX200ACF betrachten lassen.
Der Mond
Der Mond ist von der Erde im Durchschnitt 380.000 km weit entfernt. Am allerschönsten lässt er sich immer dann beobachten, wenn er als Sichel oder
Halbmond erscheint. Dann trifft nämlich das Sonnenlicht unter einem flachen
Winkel auf seine Oberfläche und erzeugt lange Schlagschatten – sein Anblick
wirkt dadurch so richtig plastisch (Abb. 61). Während der Vollmondphase sind
auf der Oberfläche keine Schatten zu sehen, deshalb erscheint der nun überaus
helle Mond im Fernrohr flach und uninteressant. Bei der Mondbeobachtung ist
es oft ratsam, ein neutrales Mondfilter zu benützen. Dieses bewahrt Ihr Auge
einerseits vor der grellen Lichtflut des Mondes und hilft andererseits dabei, den
Kontrast zu verstärken. Dadurch wird der Anblick noch dramatischer.
Im LX200ACF können Sie glanzvolle Einzelheiten auf dem Mond bewundern; es
gibt, wie weiter unten beschrieben, hunderte von Mondkratern und Mondmeere,
sog. „Maria“ zu sehen. Bei den Kratern handelt es sich um kreisförmige MeteorAbsturzstellen. Sie bedecken nahezu die gesamte Mondoberfläche. Es gibt
weder eine Atmosphäre auf dem Mond, noch finden irgendwelche Wettererscheinungen statt – nur die Meteorabstürze sorgen für eine gewisse Erosion.
Unter diesen Bedingungen können Mondkrater viele Jahrmillionen überdauern.
Die „Maria“ (Mehrzahl von „Mare“) oder auch „Mondmeere“ erscheinen als
glatte, dunkle Zonen, die sich über die Mondoberfläche erstrecken. Diese
dunklen Gebiete gelten als ausgedehnte Beckenlandschaften, die vor langer
Zeit durch Abstürze von Meteoren oder Kometen entstanden sind. Als Folge
hiervon wurden sie später noch mit glutflüssiger Lava aus dem Mondinneren
aufgefüllt.
Zwölf Apollo-Astronauten haben in den späten sechziger und frühen siebziger
Jahren ihre Stiefelabdrücke auf dem Mond hinterlassen. Es gibt jedoch kein
einziges Teleskop auf Erden, das diese Fußspuren oder irgendwelche andere
Relikte zeigen könnte. Die kleinsten lunaren Einzelheiten, die mit dem größten
Fernrohr der Erde gerade noch erfaßt werden können, haben bestenfalls einen
Durchmesser von etwa 500m.
Die Planeten
Auf ihrem Weg um die Sonne verändern die Planeten fortwährend ihre Position
am Himmel. Ziehen Sie irgendeine monatliche Astrozeitschrift (Sky and
Tipp: Geben Sie in das
Datum-Menü ein Datum ein.
Damit können Sie herausfinden,
ob ein Planet in der Nacht des
eingegebenen Datums beobachtbar ist oder nicht. Sie müssen dazu nur seine Auf- und
Untergangszeiten überprüfen.
Telescope, Astronomy, Sterne und Weltraum) zu Rate, um Planeten am Himmel
ausfindig zu machen oder recherchieren Sie im Internet. Sie können natürlich
auch Ihren Autostar nach Informationen über die Planeten abfragen. Blättern Sie
dafür zum Menü und sehen Sie sich die
Liste der Planeten durch. Wenn ein Planet, der Sie ganz besonders interessiert,
im Anzeigefeld auftaucht, drücken Sie . Mit den -Tasten holen
Objekt Sonnensystem
ENTER
p q
Sie sich die Informationen über den Planeten. Hierzu gehören die Koordinaten
des Planeten und seine Auf- und Untergangszeiten.
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
74
(c) nimax GmbH
Page 75

Abb. 62: Der Planet Jupiter mit
seinen Monden, hier mit einer
geringen Vergrößerung abgebildet.
Abb. 63: Der Planet Jupiter, hier
mit einer hohen Vergrößerung
abgebildet. Die Wolkenstrukturen
sind deutlich zu erkennen. Die vier
großen Monde können jede Nacht
in einer anderen Konstellation
beobachtet werden. Auch die
Wolkenbänder sind in Bewegung.
LX20 0 A C F
ANHANG I: ASTRONOMISCHE GRUNDLAGEN
Im Folgenden finden Sie eine Auflistung der Planeten, die sich für eine
Beobachtung mit dem LX200ACF ganz besonders eignen:
Venus: Der Durchmesser der Venus beträgt etwa neun Zehntel des Erddurchmessers. Während die Venus um die Sonne herumkreist, kann der Beobachter
verfolgen, wie sie ständig ihre Lichtphasen wechselt: Sichel, Halbvenus, Vollvenus – also ganz ähnlich, wie man das vom Mond gewöhnt ist. Die Planetenscheibe der Venus erscheint weiß, denn das Sonnenlicht wird an einer kompakten Wolkendecke, die alle Oberflächendetails verhüllt, zurück gespiegelt.
Mars: Der Durchmesser des Mars beträgt etwa einen halben Erddurchmesser.
Der Mars erscheint in einem Teleskop als winziges, rötlich-oranges Scheibchen.
Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Hauch von Weiß erspähen, wenn Sie
auf eine der beiden vereisten Polkappen des Planeten blicken. Ungefähr alle
zwei Jahre werden auf der Planetenoberfläche zusätzliche Details und
Farbeffekte sichtbar. Dies geschieht immer dann, wenn sich Mars und Erde auf
ihren Umlaufbahnen am nächsten kommen.
Jupiter: Der größte Planet in unserem Sonnensystem heißt Jupiter, sein
Durchmesser ist elfmal größer als die Erde. Der Planet erscheint als Scheibe,
über die sich dunkle Linien hinziehen. Es handelt sich bei diesen Linien um
Wolkenbänder in der Atmosphäre. Schon bei schwächster Vergrößerung lassen
sich vier der 18 Jupitermonde (Io, Europa, Ganymed und Callisto) als „sternförmige“ Lichtpunkte erkennen (Abb. 62+63). Weil diese Monde den Jupiter
umkreisen, kann es immer wieder geschehen, dass sich die Anzahl der sichtbaren Monde im Lauf der Zeit verändert.
Der Saturn weist einen neunfachen Erddurchmesser auf und erscheint als kleine, rundliche Scheibe. An beiden Seiten dieser Scheibe ragen seine Ringe
hervor. Galilei, der im Jahr 1610 als erster Mensch den Saturn im Fernrohr
beobachtete, konnte noch nicht ahnen, dass das, was er sah, Ringe sein
sollten. Er glaubte, der Saturn hätte „Ohren“. Die Saturnringe bestehen aus
Milliarden von Eisteilchen, ihre Größenordnung dürfte sich vom winzigsten
Staubkörnchen bis zu den Ausmaßen eines Wohnhauses erstrecken. Die
größte Ringteilung innerhalb der Saturnringe, die sogenannte „Cassini-Teilung“,
lässt sich normalerweise im LX200ACF erkennen. Der größte der 22 Saturnmonde, der Mond Titan, ist ebenfalls als helles, sternförmiges Objekt unweit des
Planeten sichtbar. Unter guten Sichtbedingungen können bis zu 6 Saturnmonde
im LX200ACF beobachtet werden.
Deep-Sky-Objekte
Um Sternbilder, einzelne Sterne oder „Deep-Sky-Objekte“ ausfindig zu machen,
ist der Gebrauch einer Sternkarte anzuraten. Im Folgenden werden nun
verschiedene Beispiele von Deep-Sky-Objekten aufgeführt:
Bei den Sternen handelt es sich um riesige gasförmige Objekte, die
selbstständig leuchten, weil sie in ihrem Zentrum durch Kernfusion Energie
erzeugen. Aufgrund ihrer gewaltigen Entfernung erscheinen alle Sterne als
nadelscharfe Lichtpunkte, ganz unabhängig davon, wie groß das verwendete
Teleskop auch sein mag.
Die Nebel sind ausgedehnte interstellare Gaswolken und Staubschwaden, aus
denen neue Sterne entstehen. Als eindrucksvollster Nebel gilt ohne Frage der
Große Orionnebel (M42, Abb. 64)), ein diffuser Nebel, der wie eine lichtschwache,
Abb. 64: Ein favorisiertes
Winterbild – der große Orion-
Nebel M42 im Sternbild Orion.
faserige, graue Wolke aussieht. M42 ist 1600 Lichtjahre von der Erde entfernt.
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
75
Page 76

Abb. 65: Der offene Sternhaufen
der Plejaden (M45) mit einem
weitwinkligen Okular gesehen. Sie
gehören zu den schönsten
offenen Sternhaufen.
LX20 0 A C F
Ein Offener Sternhaufen besteht aus einer lockeren Gruppe jüngerer Sterne,
die alle erst kürzlich aus einem einzigen diffusen Nebel erstanden sind. Die
Pleiaden (Abb. 65) bilden einen offenen Sternhaufen in einer Entfernung von 410
Lichtjahren. Im LX200ACF lassen sich dort mehrere hundert Sterne betrachten.
Sternbilder sind flächige, imaginäre Sternenmuster, von denen die alten
Zivilisationen glaubten, sie seien himmlische Entsprechungen von Gegenständen, Tieren, Menschen oder Göttern. Diese Sternengruppen sind viel zu
groß, als dass man sie in ihrer Gesamtheit in einem Fernrohr überblicken
könnte. Wenn Sie die Sternbilder lernen möchten, fangen Sie mit einer
markanten Sternengruppe an – beispielsweise mit dem Großen Wagen im
Sternbild Großer Bär. Im Anschluss daran nehmen Sie sich eine Sternkarte zu
Hilfe, um die anderen Sternbilder zu entschlüsseln.
Bei den Galaxien handelt es sich um gigantische Ansammlungen von Sternen,
Nebeln und Sternhaufen, die alle durch ihre gegenseitige Schwerkraft
zusammengehalten werden. Sie sind zumeist spiralig geformt (dies trifft
übrigens auch für unsere Milchstraße zu), doch viele Galaxien können auch wie
elliptische oder unregelmäßige Lichtkleckse aussehen. Die Andromeda-Galaxis
(M31) ist die uns am nächsten stehende Spiralgalaxie. Der Anblick dieses
Milchstraßensystems gleicht dem einer verschwommenen Nebelspindel. In
einer Distanz von 2,2 Millionen Lichtjahren findet man sie im Sternbild
Andromeda. Sie steht halbwegs zwischen dem großen „W“ der Cassiopeia und
dem Sternenquadrat des Pegasus.
ANHANG I: ASTRONOMISCHE GRUNDLAGEN
Eine „Straßenkarte“ zu den Sternen
Der Nachthimmel ist voller Wunder und Rätsel. Auch Ihnen steht es frei, sich an
der Erforschung des Universums zu erfreuen. Sie brauchen nur einigen
Hilfslinien auf der „Straßenkarte“ zu den Sternen folgen.
Zu allererst machen Sie den Großen Wagen ausfindig, der als Teil des
Sternbildes Großer Bär anzusehen ist. Der Große Wagen lässt sich in
Nordamerika oder Europa gewöhnlich das ganze Jahr über recht einfach finden.
Wenn Sie am Himmel eine Linie ziehen, die aus dem Wagenkasten weit nach
„hinten hinaus“ verlängert wird, so kommen Sie irgendwann einmal zum
Sternbild Orion.
Der Orion fällt besonders durch den „Orion-Gürtel“ auf, einer Aufreihung dreier
Sterne. Der Orionnebel befindet sich südlich dieses „Gürtels“ und gehört zu den
meistbeobachteten Deep-Sky-Objekten der Amateurastronomie. Ausgehend
von den beiden „Zeiger-Sternen“ – den beiden hinteren Sternen des
Wagenkastens – ziehen Sie eine fünffache Verlängerung bis hin zum Polarstern.
Verlängern Sie diese Linie noch weit über den Polarstern hinaus, dann erreichen
Sie das große Sternenquadrat, das sich der Pegasus und die Andromeda
miteinander teilen. Das Sommerdreieck stellt eine auffallende Himmelsregion
links von der Deichsel des Großen Wagens dar. Dieses Dreieck besteht aus drei
sehr hellen Sternen: Vega, Deneb und Atair. Wenn Sie geradewegs in Richtung
der Wagendeichsel eine imaginäre Linie ziehen, dann kommen Sie zum
Sommersternbild Skorpion. Der Skorpion krümmt sich am Himmel wie ein
Skorpionschwanz nach links, er sieht auch ein wenig wie der Buchstabe „J“
aus.
Die amerikanischen Amateure haben den Spruch „Arc to Arcturus and spike to
Spica“ geprägt, auf Deutsch soviel wie „Bogen zum Arkturus und Spitze zur
Spika“. Sie beziehen sich damit auf eine Himmelsregion, die in der direkten
Verlängerung des Bogens liegt, welcher von der Deichsel des Großen Wagens
beschrieben wird. Folgen Sie dem Bogen zum Arkturus, dem hellsten Stern der
nördlichen Hemisphäre, und „spitzen“ Sie dann hinunter zur Spica, dem
16-hellsten Stern des Himmels.
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
76
(c) nimax GmbH
Page 77

LX20 0 A C F
„Entfernungen im Weltall“
ANHANG I: ASTRONOMISCHE GRUNDLAGEN
Abb. 66a
Die Entfernung zwischen Erde und Mond
Entfernung = 383.000 km
Erde
Mond
Die Entfernung zwischen den Planeten
Sonne
Sonne
Mars
Die Entfernung zwischen Erde und Sonne beträgt 149 Mio. km oder 1 Astronomische Einheit (AE).
Erde
Jupiter
Merkur
Saturn Uranus
Venus
Die elliptische Umlaufbahn des Pluto ist relativ stark exzentrisch
und sorgt dafür, dass der Planet in seinem sonnennächsten Punkt
sich noch innerhalb der Neptunbahn befindet.
Neptun
Mars
Pluto
Die Entfernung zwischen den Sternen
Die Entfernung von der Sonne zum nächsten Stern beträgt etwa 4,3 Lichtjahre oder etwa 40 Billionen km. Diese Distanz ist dermaßen gewaltig,
dass in einem Modell, in dem die Erde 25mm weit von der Sonne entfernt stünde, die Entfernung zum nächsten Stern über 6,5 km betragen würde!
Sonne
Erde
4 3 b sEEEnnntttfffeeerrrnnnuuunnnggg 44,,,33 LLLiiiccchhhjjjaaahhhrrreee bbiiiss zzzuuummm
nnnäääccchhhsssttteeennn SSSttteeerrrnnn
Alpha Centauri A + B
Unsere Heimatgalaxis, die Milchstraße, enthält zusammen mit unserer Sonne annähernd 100 Milliarden Sterne. Sie stellt
eine spiralförmige Sternenansammlung dar, die vermutlich einen Durchmesser von mehr als 100.000 Lichtjahren hat.
Die Entfernung zwischen den Galaxien
Milchstraße Andromeda Galaxis (M31) „Whirlpool“ Galaxis (M51)
Unsere Sonne
2,25 Mio. Lichtjahre 35 Mio. Lichtjahre
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
Abb. 66b
77
Page 78

Alderamin
Rigel
LX20 0 A C F
ANHANG J: REFERENZSTERNE
ANHANG J:
REFERENZSTERNE
Für die Ausrichtungsprozeduren sind im Autostar-II Referenzsterne gespeichert. Im
Auslieferungszustand des Autostar sind folgenden Sterne enthalten, die in der
Tabelle unten aufgelistet sind. Auf den folgenden Seiten finden Sie für Beobachtungen auf der Nordhalbkugel für jede Saison eine Sternkarte, die Ihnen helfen
soll, die Sterne am Himmel zu lokalisieren.
Referenzsterne Autostar-II
Stern Sternbild
Alamak Andromeda
Albireo Cygnus (Schwan)
Alcor Ursa Major (Großer Bär)
Alcyone Taurus (Stier)
Aldebaran Taurus (Stier)
Alderamin Cepheus
Algenib Pegasus
Algieba Leo (Löwe)
Algol Perseus
Alhena Gemini (Zwillinge)
Alioth Ursa Major
Alkaid Ursa Major
Alnath Taurus (Stier)
Alphekka Corona Borealis (Nördliche Krone)
Alpheratz Pegasus
Alshain Aquila (Adler)
Altair Aquila (Adler)
Antares Scorpius (Skorpion)
Arcturus Bootes (Bärenhüter)
Bellatrix Orion
Betelgeuse Orion
Capella Auriga (Fuhrmann)
Castor Gemini (Zwillinge)
Cor Caroli Canes Venatici (Jagdhunde)
Deneb Cygnus (Schwan)
Denebola Leo (Löwe)
Dubha Ursa Major
Enif Pegasus
Etamin Draco (Drache)
Hamal Aries (Widder)
Izar Bootes (Bärenhüter)
Kocab Ursa Minor (Kleiner Bär)
Markab Pegasus
Megrez Ursa Major (Großer Bär)
Menkar Cetus (Walfisch)
Merak Ursa Major (Großer Bär)
Mirach Andromeda
Mirphak Perseus
Mizar Ursa Major (Großer Bär)
Phad Columba (Taube)
Pollux Gemini (Zwillinge)
Procyon Canis Minor (Kleiner Hund)
Rasalgethi Hercules
Rasalhague Ophiuchus (Schlangenträger)
Regulus Leo (Löwe)
Rigel Orion
Scheat Pegasus
Shedir Cassiopeia
Sirius Canis Major (Grosser Hund)
Spica Virgo (Jungfrau)
Tarazed Aquila (Adler)
Thuban Draco (Drache)
Unukalhai Serpens Caput (Kopf der Schlange)
Vega Lyra (Leier)
Vindematrix Virgo (Jungfrau)
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
78
(c) nimax GmbH
Page 79

Regulus
Winter
LX20 0 A C F
ANHANG J: REFERENZSTERNE
O
Pollux
Procyon
Alhena
Beteigeuze
Sirius
Castor
Bellatrix
Rigel
Capella
Aldebaran
Mirphak
Alcyone
Menkar
Mira
Algol
Menkar
Alcyone
Alamak
Hamal
Mirach
Scheat
Alpheratz
Algenib
Rigel
Bellatrix
Abb. 67a: Himmelsanblick im
Aldebaran
ca. 22 Uhr), Richtung Süden
Beteigeuze
Winter (Anfang Januar,
Markab
W
Sirius
W
Deneb
Alpheratz
Scheat
Alderamin
Mirach
Shedir
Alamak
S
Algol
Polarstern
Kocab
Mirphak
Capella
Alioth
Mizar
Alnath
Dubhe
Pollux
Castor
O
Merak
Megrez
Abb. 67b: Himmelsanblick im
Winter (Anfang Januar,
ca. 22 Uhr), Richtung Norden
N
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
79
Page 80
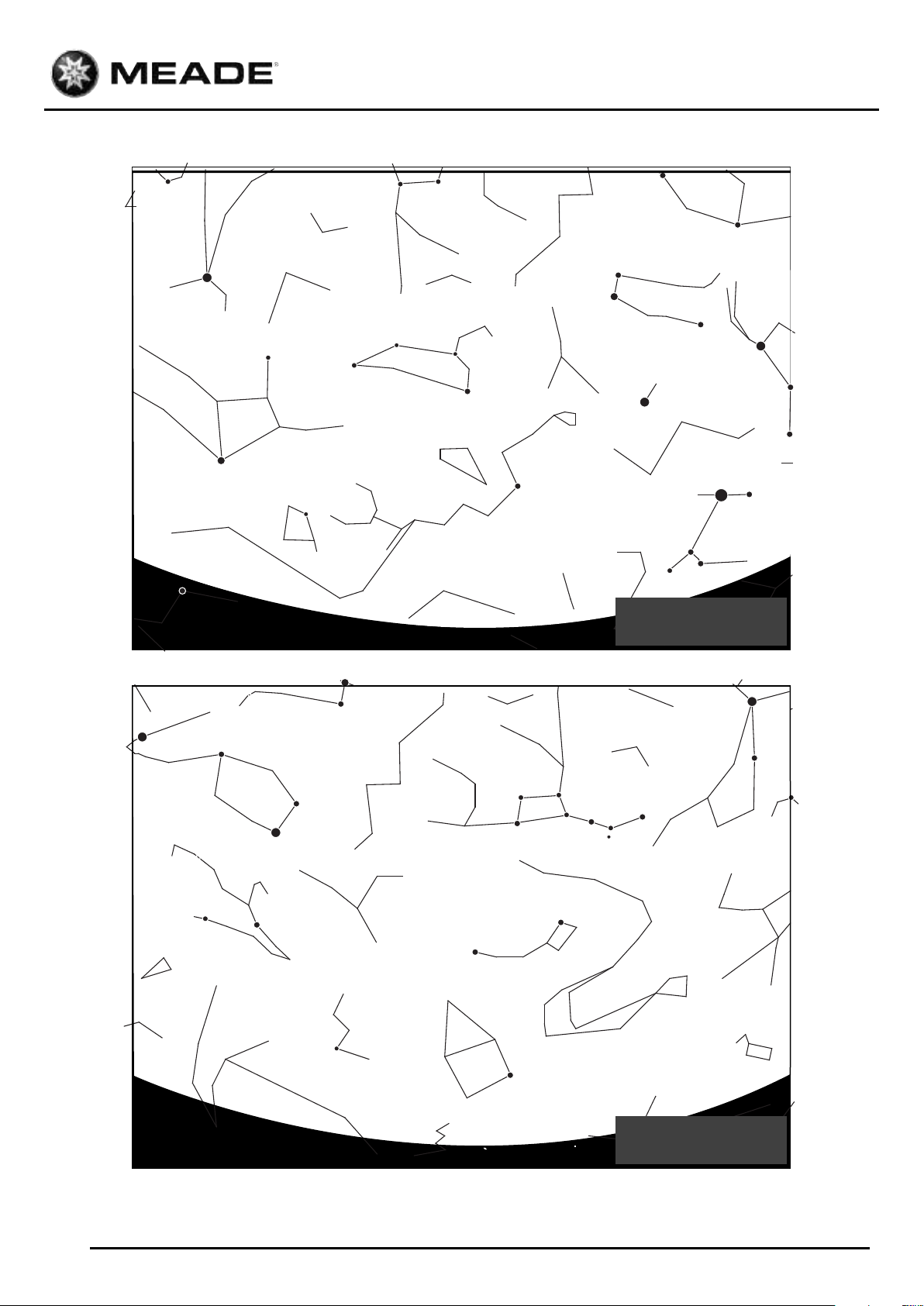
Frühjahr
O
Arcturus
LX20 0 A C F
Merak
Denebola
Algieba
Regulus
Castor
Pollux
ANHANG J: REFERENZSTERNE
Alnath
Althena
Beteigeuze
Procyon
W
W
Aldebaran
Spica
Sirius
Beteigeuze
Algol
Capella
Mirphak
Procyon
Castor
Alphard
Regulus
S
Polarstern
Merak
Dubhe
Alphard
Kocab
Megrez
Alioth
Sirius
Spica
Abb. 68a: Himmelsanblick im
Denebola
Frühjahr (Anfang April,
ca. 22 Uhr), Richtung Süden
Arcturus
Mizar
Alcor
Izar
O
Shedir
Alderamin
Abb. 68b: Himmelsanblick im
Frühjahr (Anfang April,
ca. 22 Uhr), Richtung Norden
N
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
80
(c) nimax GmbH
Page 81

Sommer
LX20 0 A C F
Deneb
Vega
ANHANG J: REFERENZSTERNE
Cor Caroli
O
Spica
Altair
Alshain
Arktur
Albireo
Rasalgethi
Rasalhague
Antares
S
Antares
Rasalhague
Vega
Alphekka
Izar
Arcturus
Spica
Abb. 69a: Himmelsanblick im
Altair
Sommer (Anfang Juli,
ca. 22 Uhr), Richtung Süden
W
W
Cor Caroli
Merak
Mizar
Alcor
Alioth
Megrez
Dubhe
Etamin
Deneb
Alderamin
Kocab
O
Polarstern
Shedir
Abb. 69b: Himmelsanblick im
Sommer (Anfang Juli,
ca. 22 Uhr), Richtung Norden
N
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
81
Page 82
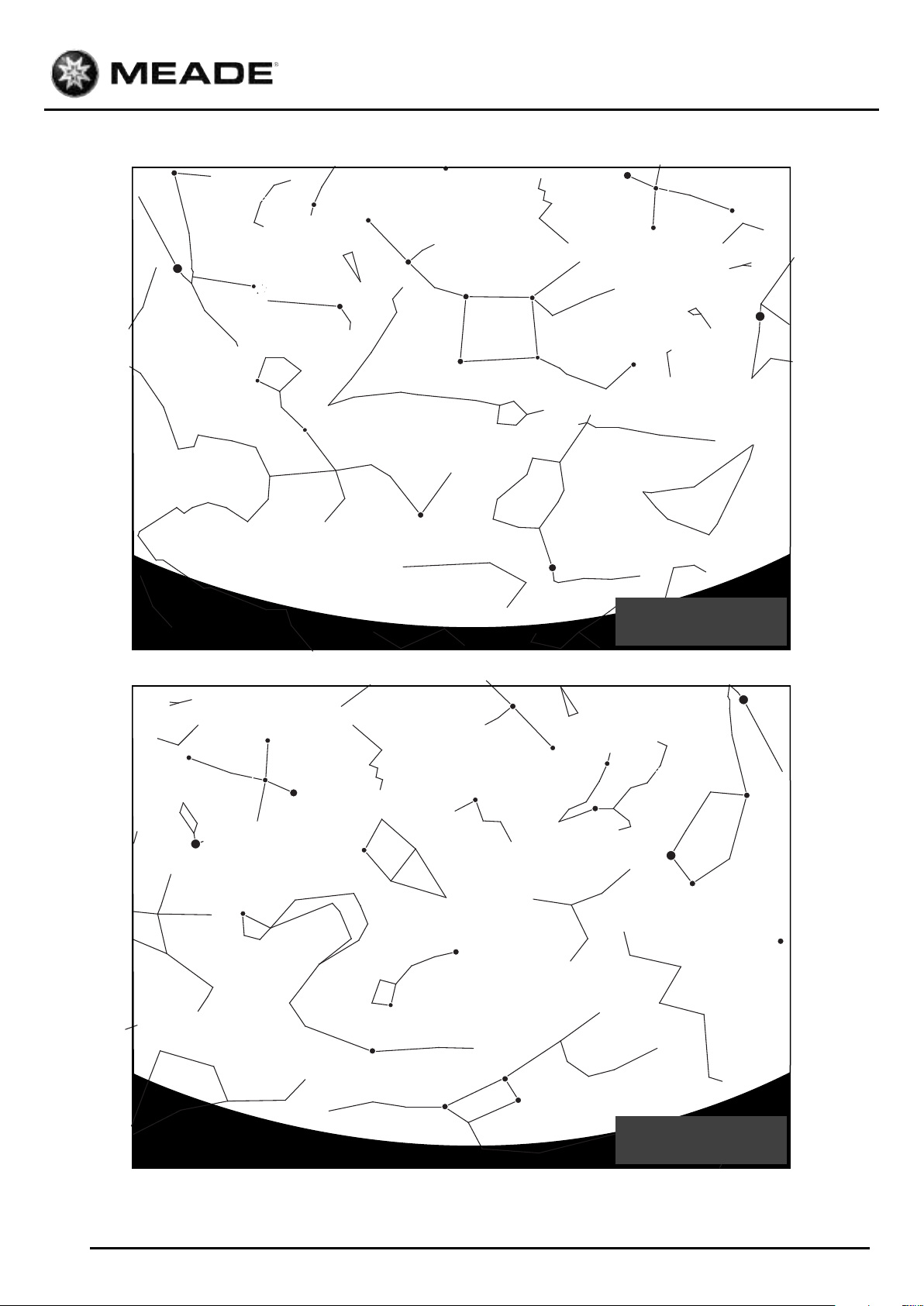
Herbst
LX20 0 A C F
Alamak
ANHANG J: REFERENZSTERNE
Deneb
Albireo
O
Aldebaran
Menkar
Alcyone
Hamal
Formalhaut
Mira
Mirach
Alpheratz
Algenib
S
Scheat
Mirach
Markab
Fomalhaut
Altair
Enif
W
Mira
Abb. 70a: Himmelsanblick im
Herbst (Anfang Oktober,
ca. 22 Uhr), Richtung Süden
Aldebaran
W
Albireo
Vega
Etamin
Deneb
Thuban
Kocab
Megrez
Shedir
Polarstern
Dubhe
N
Alamak
Merak
Mark
Algol
Alnath
ab
Capella
O
Abb. 70b: Himmelsanblick im
Herbst (Anfang Oktober,
ca. 22 Uhr), Richtung Norden
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
82
(c) nimax GmbH
Page 83
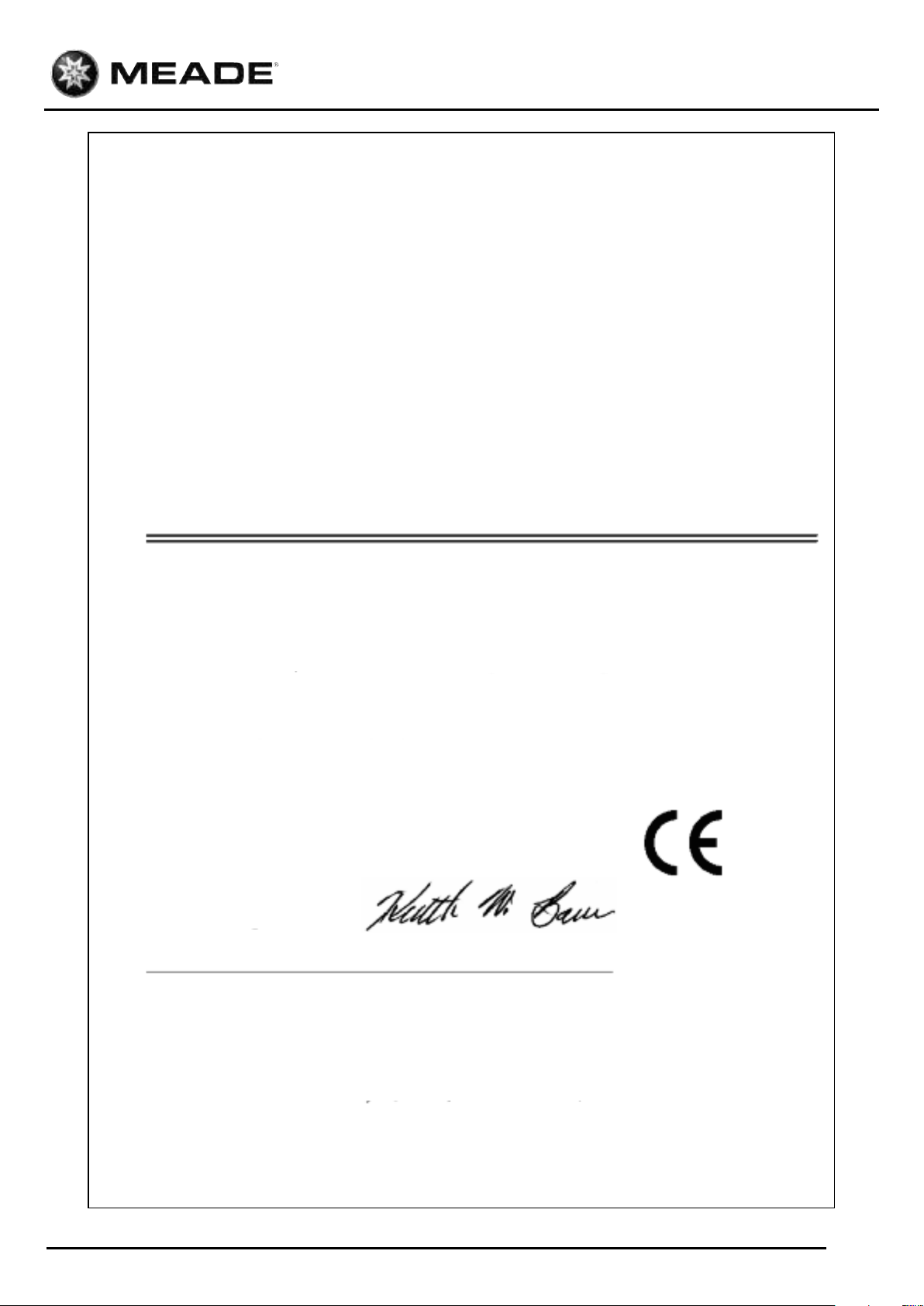
LX20 0 A C F
EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
EG-Konformitätserklärung
MEADE INSTRUMENTS CORPORATION declares that the equipment
described in this document is in conformance with the requirements of the
European Council Directives listed below:
89/336/EEC EMC Directive
93/68/EEC EMC Directive
On the approximation of the laws of Member States relating to
Electromagnetic Compatibility.
This declaration is based upon compliance of the product to the following standards:
EN 55022, CISPR 22B
EN 50082-1, IEC 801
Product Description: Telescope System
Model: LX200 GPS (all models)
Authorized Signature:
Kenneth W. Baun Sr. Vice President of Engineering
Meade Instruments Corporation
6001 Oak Canyon, Irvine, CA 92620-4205, USA
RF Emissions Control
Immunity to Electromagnetic Disturbances
Manufacturer: Meade Instruments Corporation
6001 Oak Canyon, Irvine, CA 92620-4205, USA
Niemals mit dem Teleskop in oder in die Nähe der Sonne blicken: ERBLINDUNGSGEFAHR!
(c) nimax GmbH
83
 Loading...
Loading...