Page 1

BANDTECHNIK
CoRunD)
Hi-Fi-Stereo-
Verstärker
SV 140
Das neue
GRUNDIG
3
SV 140
Innenaufbau
Hi-Fi-Programm
WELISPIT/ENKLASSE
Page 2
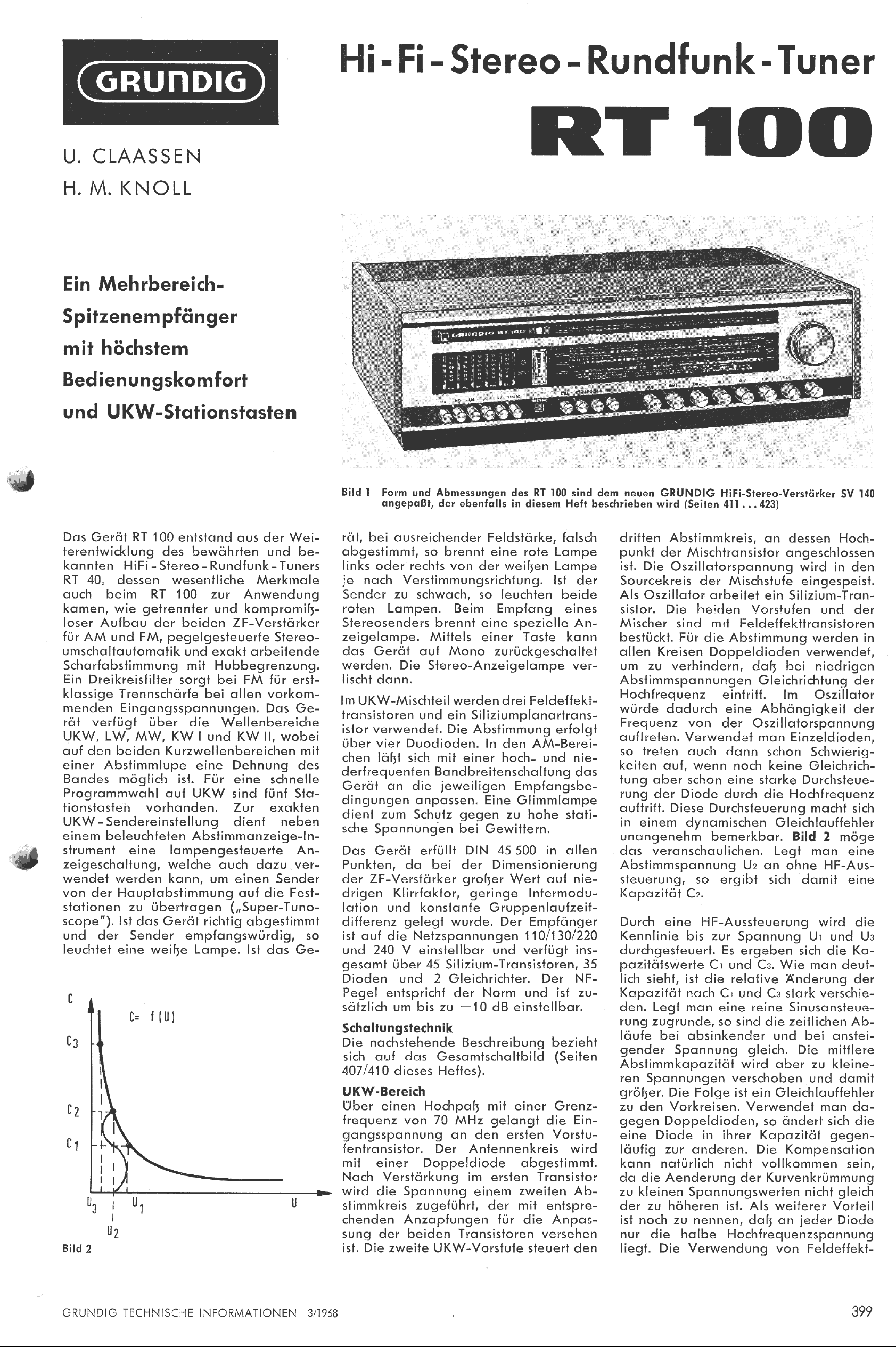
C
ort
unD
IG)
Hi Fi Stereo -
Rundfunk - Tuner
U. CLAASSEN
H. M. KNOLL
Ein Mehrbereich-
Spitzenempfänger
mit höchstem
Bedienungskomfort
und UKW-Stationstasten
RT 100
Das Gerät RT 100 entstand aus der Wei-
terentwicklung des bewährten und be-
kannten HiFi - Stereo - Rundfunk - Tuners
RT 40
auch beim RT 100 zur Anwendung
kamen, wie gefrennter und kompromi13-
loser Aufbau der beiden ZF-Verstärker
für AM und FM, pegelgesteuerte Stereo-
umschaltautomatik und exakt arbeitende
Scharfabstimmung mit Hubbegrenzung.
Ein Dreikreisfilter sorgt bei FM für erst-
klassige Trennschärfe bei allen vorkom-
menden Eingangsspannungen. Das Ge-
rät verfügt über die Wellenbereiche
UKW, LW, MW, KW 1 und KW 11, wobei
auf den beiden Kurzwellenbereichen mit
einer Abstimmlupe eine Dehnung des
Bandes möglich ist. Für eine schnelle
Programmwahl auf UKW sind fünf Sta-
tionsfasten vorhanden. Zur exakten
UKW - Sendereinstellung dient neben
einem beleuchteten Abstimmanzeige-In-
strument eine lampengesteuerte An-
zeigeschalfung, welche auch dazu ver-
wendet werden kann, um einen Sender
von der Hauptabstimmung auf die Fest-
stationen zu übertragen („Super-Tuno-
scope"). Ist das Gerät richtig abgestimmt
und der Sender empfangswürdig, so
leuchtet eine weif3e Lampe. Ist das Ge-
Bild 2
;
dessen wesentliche Merkmale
U2
Bild 1 Form und Abmessungen des RT 100 sind dem neuen GRUNDIG HiFi-Stereo-Verstärker SV 140
angepaßt, der ebenfalls in diesem Heft beschrieben wird (Seiten 411 ...423)
rät, bei ausreichender Feldstärke, falsch
abgestimmt, so brennt eine rote Lampe
links oder rechts von der weißen Lampe
je nach Verstimmungsrichtung. Ist der
Sender zu schwach, so leuchten beide
roten Lampen. Beim Empfang eines
Stereosenders brennt eine spezielle An-
zeigelampe. Mittels einer Taste kann
das Gerät auf Mono zurückgeschaltet
werden. Die Stereo-Anzeigelampe ver-
lischt dann.
Im UKW-Mischteil werden drei Feldeffekt-
transistoren und ein Siliziumplanartrans-
isfor verwendet. Die Abstimmung erfolgt
über vier Duodioden. In den AM-Berei-
chen läßt sich mit einer hoch- und nie-
derfrequenten Bandbreitenschalfung das
Gerät an die jeweiligen Empfangsbe-
dingungen anpassen. Eine Glimmlampe
dient zum Schutz gegen zu hohe stati-
sche Spannungen bei Gewittern.
Das Gerät erfüllt DIN 45 500 in allen
Punkten, da bei der Dimensionierung
der ZF-Verstärker großer Wert auf nie-
drigen Klirrfakfor, geringe Intermodu-
lation und konstante Gruppenlaufzeit-
differenz gelegt wurde. Der Empfänger
ist auf die Netzspannungen 110/130/220
und 240 V einstellbar und verfügt ins-
gesamt über 45 Silizium-Transistoren, 35
Dioden und 2 Gleichrichter. Der NF-
Pegel entspricht der Norm und ist zu-
sätzlich um bis zu —10 dB einstellbar.
Schaltungstechnik
Die nachstehende Beschreibung bezieht
sich auf das Gesamtschaltbild (Seiten
407/410 dieses Heftes).
UKW-Bereich
Über einen Hochpaf3 mit einer Grenz-
frequenz von 70 MHz gelangt die Ein-
gangsspannung an den ersten Vorstu-
fentransistor. Der Antennenkreis wird
mit
Nach Verstärkung im ersten Transistor
wird die Spannung einem zweiten Ab-
stimmkreis zugeführt, der mit entspre-
chenden Anzapfungen für die Anpas-
sung der beiden Transistoren versehen
ist. Die zweite UKW-Vorstufe steuert den
einer Doppeldiode abgestimmt.
dritten Abstimmkreis, an dessen Hoch-
punkt der Mischtransistor angeschlossen
ist. Die Oszillatorspannung wird in den
Sourcekreis der Mischstufe eingespeist.
Als Oszillator arbeitet ein Silizium-Tran-
sistor. Die beiden Vorstufen und der
Mischer sind mit Feldeffekttransistoren
bestückt. Für die Abstimmung werden in
allen Kreisen Doppeldioden verwendet,
um zu verhindern, daf3 hei niedrigen
Abstimmspannungen Gleichrichtung der
Hochfrequenz eintritt. Im Oszillator
würde dadurch eine Abhängigkeit der
Frequenz von der Oszillatorspannung
auftreten. Verwendet man Einzeldioden,
so treten auch dann schon Schwierig-
keifen auf, wenn noch keine Gleichrich-
tung aber schon eine starke Durchsfeue-
rung der Diode durch die Hochfrequenz
auftritt. Diese Durchsteuerung macht sich
in einem dynamischen Gleichlauffehler
unangenehm bemerkbar.
das veranschaulichen. Legt man eine
Abstimmspannung
steuerung, so ergibt sich damit eine
Kapazität
Durch eine HF-Aussteuerung wird die
Kennlinie bis zur Spannung Ui und
durchgesteuert. Es ergeben sich die Ka-
pazitätswerfe Ci und
lich sieht, ist die relative Änderung der
Kapazität nach Ci und
den. Legt man eine reine Sinusansteue-
rung zugrunde, so sind die zeitlichen Ab-
läufe bei absinkender und bei anstei-
gender Spannung gleich. Die mittlere
Abstimmkapazität wird aber zu kleine-
ren Spannungen verschoben und damit
größer. Die Folge ist ein Gleichlauffehler
zu den Vorkreisen. Verwendet man da-
gegen Doppeldioden, so ändert sich die
eine Diode in ihrer Kapazität gegen-
läufig zur anderen. Die Kompensation
kann natürlich nicht vollkommen sein,
da die Aenderung der Kurvenkrümmung
zu kleinen Spannungswerten nicht gleich
der zu höheren ist. Als weiterer Vorteil
ist noch zu nennen, daß an jeder Diode
nur die halbe Hochfrequenzspannung
liegt. Die Verwendung von Feldeffekt-
C2.
U2
C3.
Bild 2
an ohne HF-Aus-
Wie man deut-
C3
stark verschie-
möge
U3
GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN 311968
399
Page 3
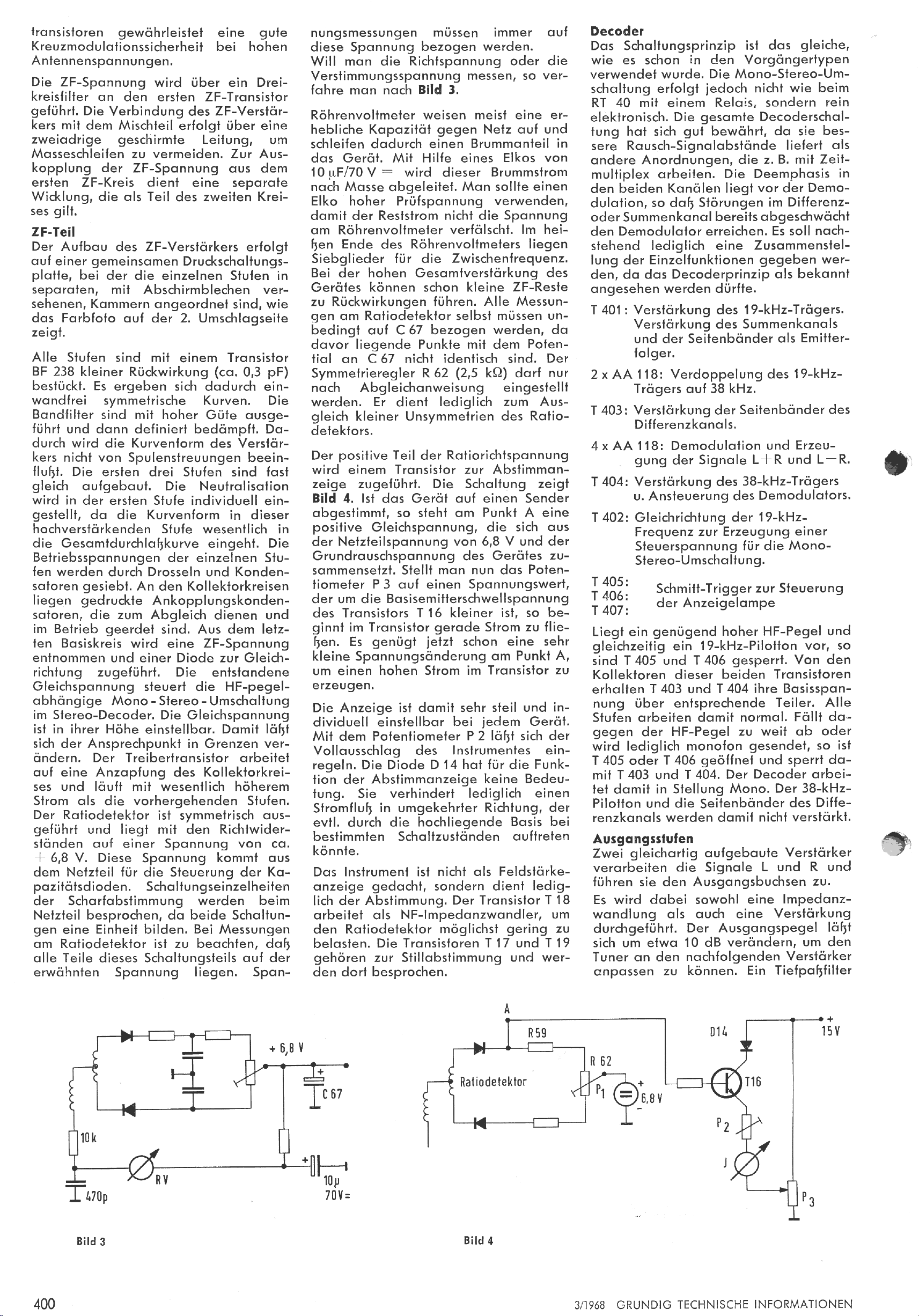
fransistoren gewährleistet eine gute
Kreuzmodulationssicherheit bei hohen
Antennenspannungen.
Die ZF-Spannung wird über ein Drei-
kreisfilter an den ersten ZF-Transistor
geführt. Die Verbindung des ZF-Verstär-
kers mit dem Mischteil erfolgt über eine
zweiadrige geschirmte Leitung, um
Masseschleifen zu vermeiden. Zur Aus-
kopplung der ZF-Spannung aus dem
ersten ZF-Kreis dient eine separate
Wicklung, die als Teil des zweiten Krei-
ses gilt.
ZF-Teil
Der Aufbau des ZF-Verstärkers erfolgt
auf einer gemeinsamen Druckschalfungs-
platte, bei der die einzelnen Stufen in
separaten, mit Abschirmblechen ver-
sehenen, Kammern angeordnet sind, wie
das Farbfoto auf der 2. Umschlagseite
zeigt.
Alle Stufen sind mit einem Transistor
BF 238 kleiner Rückwirkung (ca. 0,3 pF)
bestückt. Es ergeben sich dadurch ein-
wandfrei symmetrische Kurven. Die
Bandfilter sind mit hoher Güte ausge-
führt und dann definiert bedampft. Da-
durch wird die Kurvenform des Verstär-
kers nicht von Spulenstreuungen beein-
fluf3t. Die ersten drei Stufen sind fast
gleich aufgebaut. Die Neutralisation
wird in der ersten Stufe individuell ein-
gestellt, da die Kurvenform in dieser
hochverstärkenden Stufe wesentlich in
die Gesamtdurchialskurve eingeht. Die
Betriebsspannungen der einzelnen Stu-
fen werden durch Drosseln und Konden-
satoren gesiebt. An den Kollektorkreisen
liegen gedruckte Ankopplungskonden-
satoren, die zum Abgleich dienen und
im Betrieb geerdet sind. Aus dem letz-
ten Basiskreis wird eine ZF-Spannung
entnommen und einer Diode zur Gleich-
richtung zugeführt. Die entstandene
Gleichspannung steuert die HF-pegel-
abhängige Mono -Stereo -Umschaltung
im Stereo-Decoder. Die Gleichspannung
ist in ihrer Höhe einstellbar. Damit läflt
sich der Ansprechpunkt in Grenzen ver-
ändern. Der Treibertransisfor arbeitet
auf eine Anzapfung des Kollektorkrei-
ses und läuft mit wesentlich höherem
Strom als die vorhergehenden Stufen.
Der Ratiodetektor ist symmetrisch aus-
geführt und liegt mit den Richtwider-
ständen auf einer Spannung von ca.
+ 6,8 V. Diese Spannung kommt aus
dem Netzteil für die Steuerung der Ka-
pazitätsdioden. Schaltungseinzelheiten
der Scharfabstimmung werden beim
Netzteil besprochen, da beide Schaltun-
gen eine Einheit bilden. Bei Messungen
am Ratiodetektor ist zu beachten, daf3
alle Teile dieses Schaltungsteils auf der
erwähnten Spannung liegen. Span-
nungsmessungen müssen immer auf
diese Spannung bezogen werden.
Will man die Richtspannung oder die
Verstimmungsspannung messen, so ver-
fahre man nach
Röhrenvoltmeter weisen meist eine er-
hebliche Kapazität gegen Netz auf und
schleifen dadurch einen Brummanteil in
das Gerät. Mit Hilfe eines Elkos von
1011F/70 V = wird dieser Brummstrom
nach Masse abgeleitet. Man sollte einen
Elko hoher Prüfspannung verwenden,
damit der Reststrom nicht die Spannung
am Röhrenvoltmeter verfälscht. Im hei-
ßen Ende des Röhrenvoltmeters liegen
Siebglieder für die Zwischenfrequenz.
Bei der hohen Gesamtverstärkung des
Gerätes können schon kleine ZF-Reste
zu Rückwirkungen führen. Alle Messun-
gen am Ratiodetektor selbst müssen un-
bedingt auf C 67 bezogen werden, da
davor liegende Punkte mit dem Poten-
tial an C 67 nicht identisch sind. Der
Symmetrieregler R 62 (2,5 kQ) darf nur
nach Abgleicheinweisung eingestellt
werden. Er dient lediglich zum Aus-
gleich kleiner Unsymmetrien des Ratio-
detektors.
Der positive Teil der Ratiorichtspannung
wird einem Transistor zur Abstimman-
zeige zugeführt. Die Schaltung zeigt
Bild 4.
abgestimmt, so steht am Punkt A eine
positive Gleichspannung, die sich aus
der Netzteilspannung von 6,8 V und der
Grundrauschspannung des Gerätes zu-
sammensetzt. Stellt man nun das Pofen-
tiometer P 3 auf einen Spannungswert,
der um die Basisemifterschwellspannung
des Transistors T 16 kleiner ist, so be-
ginnt im Transistor gerade Strom zu flie-
ßen. Es genügt jetzt schon eine sehr
kleine Spannungsänderung am Punkt A,
um einen hohen Strom im Transistor zu
erzeugen.
Die Anzeige ist damit sehr steil und in-
dividuell einstellbar bei jedem Gerät.
Mit dem Pofenflomeier P 2 laf3t sich der
Vollausschlag des Instrumentes ein-
regeln. Die Diode D 14 hat für die Funk-
tion der Abstimmanzeige keine Bedeu-
tung. Sie verhindert lediglich einen
Stromflug in umgekehrter Richtung, der
evtl. durch die hochliegende Basis bei
bestimmten Schaltzuständen auftreten
könnte.
Das Instrument ist nicht als Feldstärke-
anzeige gedacht, sondern dient ledig-
lich der Abstimmung. Der Transistor T 18
arbeitet als NF-Impedanzwandler, um
den Ratiodetektor möglichst gering zu
belasten. Die Transistoren T 17 und T 19
gehören zur Stillabstimmung und wer-
den dort besprochen.
Ist das Gerät auf einen Sender
Bild 3.
Decoder
Das Schaltungsprinzip ist das gleiche,
wie es schon in den Vorgängertypen
verwendet wurde. Die Mono-Stereo-Um-
schaltung erfolgt jedoch nicht wie beim
RT 40 mit einem Relais: sondern rein
elektronisch, Die gesamte Decoderschal-
tung hat sich gut bewährt, da sie bes-
sere Rausch-Signalabstände liefert als
andere Anordnungen, die z. B. mit Zeit-
multiplex arbeiten. Die Deemphasis in
den beiden Kanälen liegt vor der Demo-
5 Störungen im Differenz-
dulation, so dar
oder Summenkanal bereits abgeschwächt
den Demodulator erreichen. Es soll nach-
stehend lediglich eine Zusammenstel-
lung der Einzelfunktionen gegeben wer-
den, da das Decoderprinzip als bekannt
angesehen werden dürfte.
T 401: Verstärkung des 19-kHz-Trägers.
Verstärkung des Summenkanals
und der Seitenbänder als Emitter-
folger.
2 x AA 118: Verdoppelung des 19-kHz-
Trägers auf 38 kHz.
T 403:
4 x AA 118: Demodulation und Erzeu-
T 404:
T 402: Gleichrichtung der 19-kHz-
T 405:
T 406:
T 407:
Liegt ein genügend hoher HF-Pegel und
gleichzeitig ein 19-kHz-Pilotton vor, so
sind T 405 und T 406 gesperrt. Von den
Kollektoren dieser beiden Transistoren
erhalten T 403 und T 404 ihre Basisspan-
nung über entsprechende Teiler. Alle
Stufen arbeiten damit normal. Fällt da-
gegen der HF-Pegel zu weit ab oder
wird lediglich monoton gesendet, so ist
T 405 oder T 406 geöffnet und sperrt da-
mit T 403 und T 404. Der Decoder arbei-
tet damit in Stellung Mono. Der 38-kHz-
Pilotton und die Seifenbänder des Diffe-
renzkanals werden damit nicht verstärkt.
Verstärkung der Seitenbänder des
Differenzkanals.
gung der Signale L+R und
Verstärkung des 38-kHz-Trägers
u. Ansteuerung des Demodulators.
Frequenz zur Erzeugung einer
Steuerspannung für die Mono-
Stereo-Umschaltung.
Schmitt-Trigger zur Steuerung
der Anzeigelampe
-
Ausgangsstufen
Zwei gleichartig aufgebaute Verstärker
verarbeiten die Signale L und R und
führen sie den Ausgangsbuchsen zu.
Es wird dabei sowohl eine Impedanz-
wandlung als auch eine Verstärkung
durchgeführt. Der Ausgangspegel läßt
sich um etwa 10 dB verändern, um den
Tuner an den nachfolgenden Verstärker
anpassen zu können. Ein Tiefpceilter
L
—R.
400
Bild 3
Bild 4
3/1968 GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN
Page 4

siebt die Reste des Pilotträgers und der
Seitenbänder
Differenzkanals her-
des
aus. Es arbeitet primärseitig mit der Ver-
drahtungskapazität und sekundärseitig
mit einer diskreten Kapazität von 100 pF.
Der Ausgang des Tuners hat eine Im-
pedanz von etwa 2 kQ und darf mini-
mal mit 22 kQ belastet werden. Für Ton-
bandaufnahmen sind entsprechende An-
paf3widerstände vorgesehen.
AM-Bereiche
Bei der Entwicklung eines AM-Spulen-
satzes für ein Transistorgerät tritt ein
Problem auf, das bei Röhrengeräten
kaum besteht. Es ist der unerwünschte
Empfang von Kurzwellensendern auf
Mittel- oder Langwelle bei Betrieb mit
Auf3enantenne. Es ist ungemein schwie-
rig, eine einwandfreie Verkopplung der
Antenne mit dem Vorkreis zu erreichen,
ohne daß Anfennenspannungen die
Selektionsmittel umgehen und direkt die
Transistorbasis erreichen. Mit Oberwel-
len des Oszillators wäre ein Empfang
dieser Kurzwellen möglich. Bei der Ent-
wicklung des RT 100 wurde sehr viel
Mühe aufgewendet, um dieses genannte
Problem zu meistern. Das Gerät erfüllt
zusätzlich die Störstrahlungsbedingun-
gen, wie sie in manchen Ländern auch
schon auf den AM-Bereichen gestellt
werden. Es mußten dabei sehr niedrige
Grenzwerte erfüllt werden, da eine hun-
dertprozentige Kontrolle in der Ferti-
gung sehr aufwendig wäre.
ZF
Der Antenneneingang ist mit einer
Glimmlampe gegen statische Aufladun-
gen
geschützt. Ein Widerstand
ke verhindert ein Flackern
von 330
der Lampe.
Über eine Drossel-Widerstandskombi-
nation wird die Antennenspannung in
den 5pulensatz geführt. Die Ankopplung
an den Vorkreis erfolgt auf allen Berei-
chen hochinduktiv. Nach der Selektion
im Vorkreis wird die Hochfrequenz über
Anpassungswicklungen der Basis des
Mischers zugeführt. Die Prinzipschaltung
zeigt
Bild 5.
Ohne Regelung läuft der
Mischer mit kleinem Strom, der Emitter-
eingangswiderstand ist hoch. Es tritt
kaum eine Teilung der Oszillatorspan-
nung auf. Die Mischverstärkung ist hoch.
Wird nun der Kollektorstrom erhöht, so
sinkt der Emittereingangswiderstand ab
und damit auch die Oszillatorspannung.
Die Mischverstärkung wird kleiner. Diese
Art der Mischschaltung zeigt gute Kreuz-
modulationsfestigkeit bei hoher Regel-
fähigkeit. Ein Saugkreis im Emitter be-
seitigt die Gegenkopplung für die Zwi-
schenfrequenz. Der Oszillator arbeitet
in Basisschaltung mit entsprechenden
Linearisierungswiderständen an den
Kreiswicklungen.
Zwischen Mischer und erstem ZF-Trans-
istor liegt ein Dreifachbandfilter, das für
eine gute Selektion durch hohe Flanken-
steilheit sorgt. Auf den ersten ZF-Trans-
istor folgt ein kapazitiv in der Band-
breite geregeltes Zweifachfilfer. Die Ka-
pazitäten ändern sich dabei so, dc113 die
richtige Abstimmung der Kreise bei
Variation der Koppelkapazität gewähr-
leistet bleibt.
Während der Mischer aufwärtsgeregelt
wird, erfolgt bei der ersten ZF-Stufe
Abwärtsregelung. Die zweite ZF-Stufe
arbeitet ungeregelt, um eine hohe Nie-
derfrequenz- und Regelspannung zu er-
halten. Der Demodulator liefert zwei
Regelspannungen, eine positive für die
Aufwärtsregelung und eine negative für
die Abwärtsregelung. Zwischen Demo-
dulator und Mischer liegt ein Transistor
BC 148 (T 101) als Regelspannungsver-
stärker. Die Gesamtregelschaltung zeigt
Bild 6.
Die Abstimmanzeige wird mit dem glei-
chen Instrument vorgenommen, das auch
bei UKW verwendet wird. Es liegt bei
den AM-Bereichen in einer Brücken-
schaltung, wie aus Bild 6 ersichtlich ist.
Mit einer Diode 1 N 60 und einem Wider-
stand (470 Q) wird die Anzeige in der
Weise verändert, daß sowohl schwache
als auch starke Stationen einwandfrei
eingestellt werden können. Der Demo-
dulator liefert die Niederfrequenz an
einen lmpedanzwandler
(T 103),
Trennstufe für die nachfolgenden Tief-
pässe wirkt. Es handelt sich dabei um
zwei wahlweise einschaltbare Filter,
deren Grenzfrequenz so gelegt ist, daß
in den meisten Fällen noch ein brauch-
barer Empfang möglich ist, obwohl
Nachbarsender durch Pfeiftöne die Wie-
dergabe des gewünschten Senders be-
einträchtigen. Die Tiefpässe sind als sog.
m-versteilerte Filter ausgeführt. Physika-
lisch gesehen handelt es sich um Pässe
üblicher Art, denen durch eine Parallel-
kapazität zur lnduktivität eine zusätz-
liche Polstelle gegeben wurde. Primär-
seitig sind die Filter mit einem Wider-
sfand von 22 Id.2 abgeschlossen. Sekun-
därseitig bildet der Transistor T 106 mit
seinem Basisteiler und dem Wechsel-
stromeingangswiderstand den Abschluß.
Nach Verstärkung in diesem Transistor
wird die Niederfrequenz dem bereits er-
wähnten Ausgangsverstärker zugeführt.
Die Eingänge dieses auch bei FM-
Stereo verwendeten Zweikanalverstär-
kers werden bei AM parallelgeschaltet,
so dar) die Niederfrequenz auf beiden
Kanälen am Ausgang erscheint.
„Supertunoscope" mit Stillabstimmung
Wie schon eingangs erwähnt lassen sich
mit dem Supertunoscope zwei Vorgänge
wahlweise ausführen:
Exakte Abstimmung der UKW-Statio-
1.
nen mittels Anzeigelampen. Dabei
kann die Stillabstimmung in Betrieb
sein; sie muf3 es aber nicht.
Übertragung einer UKW-Station von
2.
der Hauptscala auf eine beliebige
Feststationstaste. Dabei ist die Still-
abstimmung immer in Betrieb. Der
richtige Abstimmzustand wird dabei
wie unter (1) mit Lampen angezeigt.
Die Steuerspannung wird für (1) vom
Ratiodetektor zur Nulldurchgangsan-
zeige und vorn Abstimminstrument zur
Berücksichtigung des HF-Pegels abge-
nommen.
Für (2) kommt die Steuerspannung als
Differenzspannung der beiden Schleifer
der als
2 20s1
470A 1N60
270
Demodulator
IH
001
,5k
3,
"
A A119
im
10k
Anzeige
47k
47k
15k
25k
Bild 6
GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN 311968
401
Page 5

(Hauptabstimmung und Feststations-
laste) zustande. Es handelt sich dabei
um Gleichspannungen in der Größe von
etwa 50 mV, die zur Schaltung der Lam-
pen ausreichen müssen. Der Eingangs-
widerstand des Anzeigeverstärkers muh
sehr hoch sein, da die Potentiometer
Widerstände von etwa 100 ke haben.
Ein Null-Punkt-Fehler wirkt sich dabei
direkt als Fehlabstimmung aus. Ein
Gleichspannungsverstärker scheidet nach
dem oben Gesagten wegen zu hoher
Kosten aus. Gewählt wurde deshalb ein
Chopperverstärker, bei dem die Gleich-
spannung in eine proportionale Wech-
selspannung umgeformt und dann erst
verstärkt wird. Bei dieser Umformung
muh natürlich die Phase berücksichtigt
werden, damit nachher mit einer phasen-
richtigen Wiedergleichrichtung die Rich-
tung der Fehlabstimmung erkannt wer-
den kann. Vor allen Dingen ist bei der
Übertragung der Stationen von der
Hauptabstimmung auf die Stationstasten
die Anzeige der nötigen Drehrichtung
sehr wichtig, da man bei einer geringen
Verstimmung der Feststationsfaste zur
Hauptabstimmung nicht erkennen kann,
in welcher Richtung die Verstimmung
liegt. Man wäre auf Probieren angewie-
sen.
Bild 7
Supertunoscope für die beiden Betriebs-
arten. Der Ratiodetektor ist auf +6,8 V =-
angehoben. Der Sinn dieser Anhebung
wird bei der Besprechung des Netzteils
für die Diodenabstimmung näher erläu-
tert. Das Supertunoscope muh bei Ver-
wendung als Abstimmanzeige auf diese
Spannung bezogen werden. Da der Ein-
gang für die Programmierung der Sta-
tionstasten symmetrisch sein muh, ist
die Anhebung des Ratiodetektors auf
6,8 V —; nicht als Schwierigkeit zu wer-
ten.
Wie man aus dem Blockschaltbild
ersieht, erfolgt die Speisung des Chop-
pers und der phasenrichtigen Gleich-
richter über einen gemeinsamen Trans-
zeigt das Blockschaltbild des
Ratio
(Bild 7)
+6,8V
Bild 8
formator mit getrennten Wicklungen aus
dem Hauptnetztransformator. Die Ver-
wendung eines kleinen Zwischentrafos
ist nötig, da sonst eine Beherrschung der
kapazitiven Fehlspannungen schwierig
wird. Es würde sich durch diese Fehl-
spannung eine Nullpunktsverschiebung
und damit eine Fehlabstimmung erge-
ben. Nach Umwandlung der Gleichspan-
nung in eine 50-Hz-Wechselspannung
erfolgt eine Verstärkung und danach die
phasenrichtige Wiedergleichrichtung in
zwei getrennten Gleichrichtern. Diese
Gleichrichter steuern zwei Schmitt-Trig-
ger, die zusätzlich auch noch den HF-
Pegel berücksichtigen. Ausgangsseitig
speisen die Trigger drei Lampen.
Jeweils eine der roten Lampen leuchtet
bei Verstimmung. Die weihe leuchtet bei
richtiger Abstimmung. Sie wird mit einem
getrennten Transistor geschaltet. Die
Steuerspannung für diesen Transistor
dient auch der Oeffnung oder Sperrung
des Stillabstimmungstransistors, der den
NF-Weg beeinflußt.
Schaltungseinzelheiten
Chopperstufe
Dieser Stufe kommt die phasenrichtige
proportionale Umwandlung der Gleich-
spannung in eine Wechselspannung (50
Hz) zu. Es soll einer positiven Gleich-
spannung eine bestimmte Phasenlage
Bild 9
(t}
F1
der Wechselspannung zugeordnet wer-
den und einer negativen eine um 180°
phasenverschobene.
sammenhänge. Der doppelten Gleich-
spannung soll eine doppelt so hohe
Wechselspannung folgen. Man könnte
diese Aufgabe in einfacher Weise mit
einem mechanischen Zerhacker nach
Bild 9
im Rhythmus einer Wechselspannung
zwischen zwei Schaltstellungen hin und
her. Die Gleichspannung gelangt da-
durch mit wechselnder Polarität an den
Punkt A. Eine doppelt so hohe Gleich-
spannung ruft dann eine doppelt so
hohe Spannung am Punkt A hervor.
Nehmen wir an, der Schalter bliebe in
der oberen Schaltstellung genau so
lange wie in der unteren, dann ergäbe
sich ein symmetrisches Rechteck am Aus-
gang. Sind die Verweilzeiten dagegen
verschieden, so wäre ein unsymmetri-
sches Rechteck die Folge
Flächen Ft und
schieden. Ein nachfolgender Gleichrich-
ter, der entweder nur die positive oder
nur die negative Halbwelle berücksich-
tigt, würde verschieden hohe Gleich-
spannungen aus den einzelnen Halb-
wellen erzeugen.
Man muh also bei der Auslegung des
Zerhackers diesen Umstand beachten.
Nun ist ein mechanischer Zerhacker wohl
für ein Meßgerät tragbar, aber nicht für
ein Gerät, das jahrelang ohne Wartung
arbeiten muh. Es wurde deshalb eine
Schaltung mit Halbleitern vorgezogen,
für die es verschiedene Schaltungsvari-
anten gibt. Eine wenig bekannte Mög-
lichkeit ist die Anwendung einer Dioden-
lösen. Der Schalter „S" pendelt
Bild 10
Bild 8
(Bild 10).
wären dann stark ver-
F2
zeigt die Zu-
Die
Chopper
6,3 V
Bild 7
+30V
•
fi
Ch
Trafo 2
Gleichrichter 1
El
Gleichrichter2
Trigger 1
Trigger 2
rot
—0-1
rot
Bild 11
brücke nach
Gleichspannung wird das Potentiometer
P auf minimale Wechselspannung am
Ausgang abgeglichen (Brückengleichge-
wicht!). Führt man nun eine Gleichspan-
nung den Dioden zu, so gerät die eine
weiß
Diode mehr in Sperrichtung. Wird die
1--
Stillabstimmung
Bild 11.
Ohne angelegte
402
3/1968
Bild 12
GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONFM
Page 6

Gleichspannung umgepolt, so vertauscht
sich auch die Rolle der Dioden. Es wird
damit entweder die eine Halbwelle oder
die andere am Ausgang erscheinen. Die
Schaltung ist einfach, hat aber den Nach-
teil, da13 sie für jedes Diodenpaar ge-
sondert symmetriert werden muf3. Die
maximal anlegbare Gleichspannung, bis
zu der eine Proportionalität zwischen
Eingangs- und Ausgangsspannung be-
steht, ist gleich der Schleusenspannung
der Dioden. Das Verhältnis von Nutz-
zu Störspannung ist nicht sehr gut. Für
das Verständnis der im RT 100 verwen-
deten Schaltung ist die Diodenbrücke
gut geeignet, da die Arbeitsweise ähn-
lich ist. Bei der Transistor-Chopperschal-
fung ist das Verarbeiten beider Polari-
täten nicht ohne weiteres möglich. Ein
Transistor könnte an sich nur für eine
Speisungsrichtung als Schalter wirken.
Bild 12
stärker geschaltet; UE ist die Eingangs-
spannung als Gleichspannung, Ute, ist
die Wechselspannung, welche den Trans-
istor immer voll öffnet. Die Ausgangs-
wechselspannung UA ist damit propor-
tional der Speisespannung UE, die in
positiver Richtung anliegt. Es wird ledig-
lich eine Halbwelle verarbeitet. Die in-
nere Ersatzschaltung zeigt
Bild 13
Basis-Emitterstrecke ist in Durchlahrich-
tung, während die Kollektor-Basisstrecke
in Sperrichtung arbeitet. Diese Strecke
wird dadurch leitend, daf3 Ladungsträ-
ger aus der Emitterdiode durch die
Basiszone in die Kollektorstrecke wan-
dern. Die Basiswechselspannung wird
durch die Emitterdiode begrenzt. Würde
man die Ansteuerung der Basisstrecke in
der Polarität umdrehen und dasselbe
mit der Eingangsspannung UE tun, so
gelangt die Emitterdiode in Sperrichtung
und die Kollektorstrecke in den Durch-
lar3. Man kann dann erwarten, dar; der
Transistor nicht in gewohnter Weise ver-
stärkt. (Siehe
gleich.) Die Basiswechselspannung wird
Bild 14
zeigt einen Transistor als Ver-
Bild 14
und
Bild 13
Bild 13.
als Ver-
Die
nicht mehr durch die Basis-Emitterdiode
begrenzt. Sie steigt stark an und ver-
sucht, über die Kollektorstrecke auch bei
fehlender Spannung UE einen Strom zu
treiben. Die Schaltung arbeitet also nicht
in gewohnter Weise. Ändert man die
Schaltung nach
Bild 15
ab, so ergeben
H °A
Bild 15
sich neue Gesichtspunkte. Es tritt jetzt
durch die hinzugefügte Diode D eine
Begrenzung der negativen Halbwelle
ein. Die positive wird nach wie vor von
der Emitterdiode begrenzt. Wird jetzt
die Eingangsspannung UE (Gleichspan-
nung) zu Null und entspricht die Schleu-
senspannung der zusätzlichen Diode D
der Schleusenspannung der Kollektor-
strecke, so tritt am Ausgang keine Wech-
selspannung auf. Wird jetzt eine posi-
tive Spannung an den Kollektor gelegt,
so arbeitet der Transistor normal und
verstärkt die eine Halbwelle. Legt man
dagegen eine negative Spannung UE an,
so wirkt die Schaltung wie eine Dioden-
brücke nach Bild 11. Die Kollektordiode
gelangt in Durchlal3richtung und läßt die
andere Halbwelle passieren. Die Aus-
gangsspannung kann bei Betrieb mit
negativer Betriebsspannung natürlich
nicht höher werden als die Basissteuer-
spannung, da der Transistor nicht als
Verstärker arbeitet. Bei Betrieb mit posi-
tiver Spannung UE wird die Ausgangs-
spannung UA mit steigender Spannung
UE immer gröf3er. Eine Proportionalität
in negativer Richtung ist deshalb nur bis
etwa 600 mV (bei Siliziumtransistoren)
gegeben. Man sollte im Interesse einer
Gleichheit der Ausgangsspannungen für
beide Polaritäten von UE nicht höher als
0,5 V aussteuern. Untersucht man die
Transistoren bei Vertauschung von Ba-
sis-Emitter und Kollektorstrecke, so zei-
gen sich günstigere Werte für die Rest-
störspannung, wenn man Kollektor- und
Emitterstrecke vertauscht und die Schal-
tung nach
Bild 16
stand R dient wie in den vorher gezeig-
ten Schaltungen als Strombegrenzer. An
Bild 16
aufbaut. Der Wider-
der Basis liegt eine etwa rechteckförmige
Steuerspannung. Am Ausgang erschei-
nen bei fehlender Spannung UE lediglich
spitze Nadelimpulse geringen Energien-
inhalfes. Die Schaltung braucht nicht wie
die Diodenbrücke symmetrierf zu wer-
den. Sie zeigt eine sehr gute Konstanz
bei Temperaturänderungen, da Kollek-
tor- und Emitterstrecke die gleiche Tem-
peratur annehmen. Die Eingangswech-
selspannung ist von untergeordne-
ter Bedeutung. Sie muf3 lediglich so groß
sein, daf3 ein genügender Abstand zur
Basisschleusenspannung besteht. Die
Spannung Ur beträgt beim RT 100 6 V.
Das ist zehnmal mehr als die Schleusen-
spannung (600 mV). Eine Abhängigkeit
von der Netzspannung ist daher nicht zu
beobachten. Die Diode „D" ist in der
Nähe des Transistors montiert, damit sie
die gleiche Temperatur annimmt. Um
eine universelle Verwendbarkeit zu ge-
währleisten, wurde in der Schaltung die
Wicklung
und nur kapazitiv geerdet (siehe
Bild
17
Es lassen sich dann auch symmetrische,
erdfreie Betriebsfälle verwirklichen.
Zu beachten ist lediglich, dell3 die kapa-
zitive Erdung über C 2 gut ist, da sonst
Störspannungen über das Netz einge-
schleust werden. In dieser Form findet
die Schaltung im RT 100 Verwendung.
Wie vorher schon erwähnt, ist der Null-
punkt des Ratios nicht auf Masse be-
zogen, sondern liegt wegen der Dioden-
abstimmung auf + 6,8 V Bei der
Übertragung der Stationen von der
Hauptabstimmung auf die Stationsfasten
ist ebenfalls der Spannungsnullpunkt
nicht Masse, sondern auf ein Potential
von maximal + 30 V angehoben (siehe
Blockschaltung
nach Bild 17 ist darin aber keine Schwie-
rigkeit zu sehen, da der Nullpunkt des
Choppers beliebig hochgelegt werden
kann. Nachdem mit der Umwandler-
schaltung aus der Gleichspannung eine
Wechselspannung wechselnder Phase
geworden ist, muf, diese Spannung ver-
stärkt werden, da die entstandene
Wechselspannung sehr klein ist. Bei der
Übertragung der Stationen auf den
„Preomaten" müssen Gleichspannungen
von nur 50 mV verarbeitet werden. In
Bild 18
und Gleichrichterschaltung gezeigt. Bei
n" von der Masse getrennt
u
R2
R3
ist im Auszug die Verstärker-
2
Bild 7).
—C2
Mit der Schaltung
Bild 17).
GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN 3/1968
6V
403
Page 7

270,9,
6V
T108
Bild 19
der ersten Stufe handelt es sich um einen
im Emitter gegengekoppelten Verstär-
ker, der einen hohen Eingangswider-
stand hat und den Chopper nur gering
belastet. Die nachfolgende Stufe mit
T 353 übernimmt die Hauptverstärkung.
Der Emitter dieser Stufe ist mit zwei Reg-
lern für die Verstärkungseinstellung ver-
sehen. Vom Kollektor dieser Stufe wer-
den die phasenrichtigen Gleichrichter
angesteuert. Die Transistoren werden
im Kollektor aus 6-V-Wicklungen ge-
speist, die mit der Chopperwicklung zu-
sammen auf einem Trafo angeordnet
sind. Die beiden Gleichrichter-Wicklun-
gen weisen eine Phasenverschiebung
von 180° auf. Die Gleichrichtertransisto-
ren sind im Ruhezustand gesperrt. Am
Emitter steht keine Gleichspannung. Mit
der positiven Halbwelle wird der Trans-
istor von der Basis her geöffnet, dessen
Kollektorwicklung gerade positiv ist. Am
Emitter entsteht dann eine positive
Gleichspannung. Wird am Chopper die
Gleichspannung und damit auch die
Phase der Wechselspannung um 180°
verschoben, so öffnet der andere Gleich-
richter, und der erste wird gesperrt. Am
Emitter des jetzt geöffneten Transistors
entsteht damit wieder eine positive
Gleichspannung. Ein Teil dieser Gleich-
spannung wird als Gegenkoppluitg auf
die Basis zurückgeführt. Es Iaht sich da-
durch die Verstärkung der Gleichrichter
verändern. Die Gleichspannung wird ge-
siebt und der nachfolgenden Trigger-
schaltung zugeführt, welche die entspre-
chenden Lampen schaltet
Lampen werden nicht in Reihe zu den
Kollektoren geschaltet, sondern im
Parallelbetrieb. Man spart dadurch eine
sonst notwendige Phasenumkehr am
Eingang der Triggerstufe. Die Trigger-
endstufen sind ohne Signal gesperrt!
Auf diese Weise ist es außerdem möglich,
von den Kollektoren der Endstufen den
Stillabstimmungstransistor zu schalten.
Die Dioden D 102 und D 105 haben fol-
gende Bedeutung. Im Prinzip könnte
man die Triggerendstufen auch ohne
Dioden nach
nung an Punkt A würde dann zwischen
Bild 20
schalten. Die Span-
(Bild 191.
rot
Die
Bild 20
Stillabstimmung
Bild 22
weiß
6 V und etwa 0,6 V (Restspannung)
springen. Mit diesem Hub müf3te die
Steuerung des Stillabstimmungstrans-
istors auskommen. Wie wir später sehen
werden, ist das wegen der NF-Aussteue-
rung nicht möglich. Schaltet man die
Anordnung nach
Punkt A bei Sperrung des Transistors
bis zur Betriebsspannung hochlaufen.
Der Spannungshub wird damif theore-
tisch 0,6 — 15 V. In der Praxis wird durch
die Last am Punkt A dieser Hub auf 12 V
begrenzt. Die beiden Dioden D 103 und
D 104 dienen zur Verknüpfung der bei-
den Sfeuerspannungen, die von den
Triggerendstufen geliefert werden. Eine
Rückwirkung von einem Kollektor auf
den anderen ist damit ausgeschlossen.
Über diese beiden Dioden wird der
Transistor T 105 geschaltet, der die mitt-
lere, weif3e Lampe steuert. Gleichzeitig
führt diese Steuerspannung zu der Basis
des Stillabstimmungstransistors. Die linke
und die rechte rote Lampe sind über
einen gemeinsamen Widerstand von 18 9
(R 131) an Masse gelegt. Brennt eine
der roten Lampen, so würde die andere
wegen der Restspannung schwach glim-
men. Über R 131 wird diese Restspan-
nung kompensiert. Die weiße Lampe
kann nicht glimmen, da T 105 keinen
Emitter-Widerstand besitzt, an dem eine
Fehlspannung entstehen könnte.
Bei allen Betrachtungen wurde die Wir-
kung des HF-Pegels auf3er Betracht ge-
lassen und nur die Verstimmung unter-
sucht. Die Außenwiderstände der Trans-
istoren T 102 und T 108 werden nicht
direkt von der Betriebsspannung, son-
dern über T 17 gespeist. Dieser Trans-
istor ist bei genügend hohem HF-Pegel
voll geöffnet und läßt damit die Trigger
arbeiten, Beim Absinken des HF-Pegels
geht der Strom im Instrumententransistor
zurück und sperrt T 17. Es leuchten dann
beide roten Lampen, die weilte ver-
löscht. Die Ansprechschwelle ist in Gren-
zen einstellbar.
Bild 21,
so kann der
Stillabstimmung
Wie der Name sagt, soll während des
Abstimmvorganges das Gerät still sein.
Bild 25
Der NF-Weg wird unterbrochen, um stö-
rende Geräusche zu unterdrücken. Dazu
ist eine Stufe erforderlich, die sich ohne
Potentialsprung öffnen und sperren läßt.
Würde man nach
kerstufe sperren oder voll öffnen, so er-
gäbe sich ein Sprung in der Kollektor-
Gleichspannung von mindestens der
halben Betriebsspannung. Ein Emitfer-
folger verhält sich genau so. Es ist wei-
terhin erwünscht, daf3 der Niederfre-
quenzweg schnell unterbrochen, aber
nicht abrupt geöffnet wird. Das bedeutet
verschiedene Zeitkonstanten. Ein Trans-
istor nach
positive Halbwelle gesperrt sein, er
würde aber die negative über die Kol-
lektor-Basisdiode ableiten, da die Er-
satzschaltung für einen npn-Transistor
nach
gen die Schaltung nach
sich der Transistor für beide Halbwellen
sperren. Wird die Basisansfeuerspan-
nung Null, so ist auch die Kollektordiode
über die Emittervorspannung mit ca. 4 V
gesperrt. Der NF-Weg ist offen. Der Kol-
lektor ist mit einem hochohmigen Wider-
stand auf den Emitter bezogen, so daf3
die Kollektorspannung bei allen Be-
triebszuständen der Emitterspannung
entspricht. Das öffnen des Transistors
geschieht schnell über eine in Durchlaf3
geschaltete Diode. Die Sperrung erfolgt
langsam, da die Diode dann nicht leitet.
Diese Schaltung wurde in ähnlicher
Weise schon im RT 50 verwendet. Beim
Offnen muf3 mindestens die Sperrspan-
nung mit 4 V überwunden werden. Diese
relativ hohe Sperrspannung ist nötig, da
die Niederfrequenz mit ihren Spitzen-
spannungen nicht in den Durchlag der
Kollektordiode gelangen darf. Jetzt wird
auch verständlich, warum bei der An-
steuerung dieses Transistors ein relativ
grof3er Spannungshub nötig ist.
Bild 24
Bild 24
Bild 23
Bild 22
Bild 23
gilt. Erweitert man dage-
könnte zwar für die
Bild 25,
Bild 21
eine Verstär-
•
so läßt
404
3/.1968 GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN
Page 8

Die Schaltung arbeitet ohne Umschalt-
geräusche und ist von den Transistor-
exemplaren unabhängig. Die Sperr-
dämpfung erreicht sehr hohe Werte. Die
Durchlaf3dämpfung ist praktisch Null. Im
Interesse einer geringen Phasendrehung
für tiefe Frequenzen müssen große An-
koppelkapazitäten (2,2 tuF) verwendet
werden. Eine zu große Phasendrehung
bringt Schwierigkeiten mit der Über-
sprechdämpfung im Decoder, da die
Stillabstimmung vor dem Decoder liegt.
Beim Umschalten der Stationstasten wird
über einen Schaltkontakt der NF-Weg
ebenfalls vor dem Decoder unterbro-
chen.
Netzteil für die Abstimmdioden
Die Abstimmung des Gerätes mit Kapa-
zitätsdioden hat den großen Vorteil, daf3
die Stationswahl mit Potentiometern er-
folgen kann. Man braucht keine auf-
wendigen, mechanischen Tastenaggre-
gate und kann beim Aufbau meist gün-
stigere Erdungsverhältnisse schaffen als
beim Drehkondensator. Das soll aber
alles nicht darüber hinwegtäuschen, clafs
ein neues Problem aufgetaucht ist, wel-
ches bei mechanischen Senderwahltasten
von völlig untergeordneter Bedeutung
war, nämlich eine hohe Konstanz der
Betriebsspannung, sowohl bei Netzspan-
nungs- als auch Temperaturschwankun-
gen. Die Abstimmspannung für die Ka-
pazitätsdioden soll weiterhin möglichst
sofort nach dem Einschalten die endgül-
tige Höhe erreichen, damit die Scharf-
abstimmung nicht auf dem vorhergehen-
den Sender einrastet. Da die Auflade-
geschwindigkeit der Kondensatoren
wegen der hohen geforderten Brumm-
siebung nicht beliebig hoch sein kann,
hat das Gerät zusätzlich eine Automatik,
welche die Verstärkung während des
Hochlaufens der Abstimmspannung zu
Null macht. Dadurch wird das „Vorbei-
laufen" der Sender unhörbar. Die Schal-
tung wird im nächsten Abschnitt bespro-
chen. Die für das Netzteil entwickelte
Schaltung zeigt im Auszug Bild 26.
In das Netzteil wird vom Ratiodetektor
in die Punkte A, B eine Nachstimmspan-
nung als Scharfabstimmung eingespeist.
Durch diese Art der direkten Netzteilbe-
einflussung ist das Verhältnis von Ab-
stimmspannung und Nachstimmung an
der Diode selbst immer gleich. Der Nach-
stimmhub bleibt dadurch über den Be-
reich etwa konstant. Ein kleiner Fehler
tritt durch die Krümmung der Span-
nungs-Kapazitäts-Kennlinie der Diode
auf. Bei der Betrachtung der Netzteil-
funktion soll die Nachstimmspannung
Null sein. Es liegt damit nur eine hoch-
ohmige Last zwischen den Punkten A
und B. Vom Netzgleichrichter wird eine
Gleichspannung von ca. 50 V an das
Netzteil geliefert.
Diese Spannung ist bereits durch einen
Widerstand von 2,2 kg2 und einen Sieb-
kondensator vorgesiebt. Über den
wird diese Spannung
Längstransistor T
auf 30 V abgesenkt und durch den
hohen Wechselstromwiderstand des
Transistors von allen Brummresten be-
freit. Am Ausgang des Netzteils liegt
ein Spannungsteiler, der die Basis des
Quertransistors T 2 steuert. Der Emitter
dieses Transistors liegt auf der Bezugs-
spannung von 6,2 V, die durch eine Z-
Diode stabilisiert wird. Der Spannungs-
teiler ist mit einem Kondensator über-
brückt, um die am Ausgang noch vorhan-
dene Brummspannung weiter zu verklei-
nern. Der Kollektor von T 2 steuert die
1
T
Bild 26
Basis von T
der Z-Diode wird durch den Temperatur-
gang der Basis-Emitterdiode des Trans-
istors T 2 kompensiert. Um das Brücken-
gleichgewicht für die Nachstimmung
auch bei Temperaturänderung zu erhal-
ten, muf3 zusätzlich eine Diode D am
Einspeisepunkt der Scharfabstimmung
eingefügt werden (Bild 27). Da der Basis-
1.
Der Temperaturkoeffizient
Ratiodetektor
B
ezugsspannung
US
Basis-
!' diode
JD
Ratio -
detektar
Bild 27
strom des Transistors T 2 geringer ist, als
der Strom in der Z-Diode, muf3 der Strom
in der Diode D gröf3er sein als IB. Es
muf3 deshalb der Punkt B um einen klei-
nen Betrag höher gelegt werden in der
Spannung als die Basis von T 2. Für die
Funktion der Schaltung hat das keine
Bedeutung.
wird die Streuung der Z-Diode und der
übrigen Bauteile ausgeglichen. Das
Brückengleichgewicht für die Nachstim-
mung wird durch Verändern von P nicht
gestört, da der Basispunkt von T 2 im-
mer die Schleusenspannung der Emitter-
diode als Spannungsunterschied zum
Emitter und damit auch zu Punkt A auf-
weist, der lediglich um eine konstante
Spannung
Die Punkte A und B haben damit immer
konstantes Potential zueinander. Bild 28
veranschaulicht die Verhältnisse. Aus
dieser Einspeisungsart der Scharfabstim-
mung resultiert, daf3 der Ratiodetektor
nicht auf Nullpotential, sondern auf
+
6,8 V liegt. Der Nachstimmhub wird
über eine Doppeldiode 9476 begrenzt,
so daf3 Fang- und Ziehbereich etwa
übereinstimmen. Ein Umspringen des
Empfängers auf einen Nachbarsender
wird damit vermieden.
Bei einem Ersatz der Netzteiltransistoren
ist darauf zu achten, daf3 nur gleiche
Typen mit der vorgeschriebenen Strom-
verstärkungsgruppe verwendet werden.
Da eine Z-Diode eine endliche Steilheit
Mit
einem Potentiometer P
zum Emitter versetzt ist.
Up
z
JB
I--
2--
hat und deshalb niemals eine hundert-
prozentige Ausregelung der Netzspan-
nungsschwankungen bewirken kann, ist
eine zusätzliche Kompensation dieser
Änderungen dadurch erreicht worden,
daf3 ein Teil der Eingangsspannung
direkt auf den Spannungsteiler am Aus-
gang über 2,2 MS2 geführt wird. Bei
sorgfältiger Dimensionierung erreicht
man eine vollkommene Ausregelung der
primären Netzspannungsschwankungen.
In den Basisleitungen der Transistoren
T 1 und T 2 liegen 10-9-Widerstände,
da die Siliziumtransistoren sehr hohe
Grenzfrequenzen haben und deshalb
leicht zum Schwingen neigen.
+50V
A
Ü\
•
1.
i
ag
9476
I R [-
Ratio-
detektor
Elektronische Einschaltgeräusch-
unterdrückung
Wie schon erwähnt, tritt bei der Abstim-
mung mit Kapazitätsdioden eine Schwie-
rigkeit auf, wie sie bei Geräten mit Dreh-
koabstimmung kaum zu beobachten ist.
Die Abstimmspannung erreicht ihren vol-
len Wert erst nach einer gewissen, wenn
auch kurzen Zeit. Es wird dadurch das
Durchlaufen der Sender hörbar. Das Ge-
rät wurde deshalb mit einer Hilfsschal-
tung versehen, welche die Verstärkung
solange reduziert, bis die Abstimmspan-
nung steht. Es wird dazu die Ausgangs-
spannung des Netzteils über einen Kon-
densator der Basis eines Transistors zu-
geführt, der damit geöffnet bleibt, bis
die Abstimmspannung sich nicht mehr
ändert. Bild 29 zeigt die Schaltung. Der
Kollektor des Transistors T 1 belastet
+ 30 V
T2
Bild 28
RV
D
RV
GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN 3/1968
405
Page 9

über Enfkopplungsdioden und Wider-
stände die Spannungsteiler für die Basis-
spannung der ersten beiden ZF-Trans-
istoren, deren Verstärkung damit Null
wird.
Gerätenetzteil
Um den hohen Störabstandsforderungen
gerecht zu werden, erfolgt die Speisung
aller kritischen Stufen aus einem stabi-
lisierten und besonders brummarmen
Netzteil.
Schaltung. Mit Hilfe einer Z-Diode wird
eine stabilisierte Spannung von ca. 16 V
erzeugt. aber einen als Stromverstärker
geschalteten BC 147 wird der Leistungs-
transistor T 2987 gespeist. Am Emitter
dieses Transistors erscheint eine sehr gut
gesiebte und konstante Spannung von
ca. + 15 V. Parallel zur Z-Diode liegt
ein Kondensator von 1000 i.F, der ein-
mal den dynamischen Innenwiderstand
des Netzteils verringert und die Siebung
verbessert und zum anderen das nieder-
frequente Rauschen der Diode kurz-
schlief3t, Bei einer im Durchbruch arbei-
tenden Diode entstehe bekanntlich ein
Rauschen, das bis in das UKW-Gebiet
reichen kann. Die hochfrequenten Stö-
rungen werden durch eine in Reihe zur
Diode liegende Drossel beseitigt.
Die Speisung des NF-Ausgangsverstär-
kers wird vom Ladekondensator vorge-
nommen. Die NF-Stufen müssen hohe
Wechselspannungen mit kleinem Klirr-
faktor verarbeiten und kommen deshalb
Bild 30
zeigt im Auszug die
Bild 29
nicht mit 15 V aus. Mit zu-
sätzlichen Siebkondensato-
ren werden in diesem Fall + •
die geforderten Störab- 30V
stände erreicht. Die Spei-
sung aller Netzteile und
der Skalenlampen erfolgt
über einen gemeinsamen
Netztransformator, der mit
der Lampenwicklung auch
den Zwischentransformator
für das Supertunoscope
versorgt.
Das Netzteil für die Ver-
sorgung der Kapazitäts-
dioden und das Geräte-
netzteil sind bis auf den
Leistungstransistor T 2087
auf einer gemeinsamen
Druckplatte untergebracht.
Bild 30
Auf den Seiten 424/425 dieses
Hinweise für den RT 100 gegeben.
Heftes
werden Service-
Technische Daten
Transistoren und Dioden
45 Transistoren. Mischteil mit 3
effekt-Transistoren) ausgerüstet. 35 Dioden.
2 Gleichrichter.
FM-Empfangsbereich
87,5-108 MHz. Dazu 6 elektronisch wählende
Programmtasten, die nach Vorwahl 5 UKW-
Sender jederzeit einschalten können. Mit der
6. Taste wird auf die Abstimmskala und
Handabstimmung umgeschaltet.
AM-Empfangsbereiche
Langwelle
Mittelwelle 510 — 1620 kHz = 587
Kurzwelle I 3,15 — 8,8 MHz = 99 — 34 m
Kurzwelle II 8,6 — 22,5 MHz = 35 — 13,5 m
KW-Lupe
Feinabstimmung der Kurzwellenbereiche mit
± 50 kHz Abstimmbereich.
Kreise
FM: 17, davon 4 abstimmbar, 11 ZF-Kreise,
Nebenwellensperre mit 2 Kreisen.
AM: 10, davon 2 abstimmbar, 4 ZF-Kreise
fest, 2 ZF-Kreise mit Bandbreitenum-
schaltung, 2 ZF-Saugkreise.
Empfindlichkeiten
FM: 1,4 [iV
abstand.
AM: Mittelwelle:
Langwelle:
Kurzwelle:
ZF-Festigkeit
FM: besser als 86 dB
AM: besser als 50 dB
Spiegelselektion
FM: 58 bis 66 dB
AM: Mittelwelle: 56 — 46 dB
Langwelle: 46 — 56 dB
Kurzwellen: 12 — 26 dB
145 — 350 kHz = 2050 — 680 m
für 15 kHz Hub und 26 dB Rausch-
6,5 ?..tV
8 H,V
5-12 ju.V (für 10 rnV am
des RT
FET
Ausgang)
(Feld-
185 m
100
Capture ratio (Gleichwellen-Selektion)
2 dB bei 1 mV Antennenspannung und 75 kHz
Hub.
Verstimmung und Klirrfaktor
(Mittenfrequenzabweichung)
Bis zu 50 kHz Verstimmung bleibt der Klirr-
faktor kleiner als
Eingangsspannung und 75 kHz Hub.
Bandbreite
FM-ZF: 160 — 200 kHz
AM-ZF: schmal 4,5 kHz, breit 7 kHz
FM-Ratiodetektor: 650 kHz, Breitband-Ratio-
filter mit Phasen-Kompensation.
AM-Unterdrückung
Besser als 58 dB bei 1 kHz, gemessen bei
22,5 kHz Hub, 30 °/o AM-Modulation und
1 mV Antennenspannung.
Zwischenfrequenzen
FM: 10,7 MHz
Drift
1 kHz pro Grad Celsius, wird durch auto-
matische Scharfabstimmung ausgeglichen.
Automatische UKW-Scharfabstimmung
Abschaltbar, Fangbereich ± 250 kHz.
Fremdspannungs-Abstand
Bei 40 kHz Hub und Stereo: mindestens 65 dB
von Antenne bis Ausgang.
Geräuschspannungsabstand
Bei 40 kHz Hub und Stereo: mindestens 65 dB.
Pilotton-Unterdrückung
40 dB bei 19 kHz — 60 dB bei 38 kHz
—
Deemphasis
50 ilsec. nach Norm.
NF-Frequenzgang
Besser als DIN 45500, von Antenne bis
Ausgang.
40 — 50 Hz ± 1,5 dB
50 — 6300 Hz ± 0,5 dB
6,3 12,5 kHz ± 1,5 dB
1 °A,
AM: 460 kHz
gemessen bei 1 mV
Klirrfaktor
Kleiner als 0,5 °/o bei 40 kHz Hub, gemessen
nach DIN 45500.
Stereo-Decoder
Integriert mit pegelgesteuerter Mono/Stereo-
Umschaltung (Pegel von 6 60 I.J.V an 240 52
einstellbar) und Leuchtanzeige bei Stereo-
Programmen. Decodierung nach dem Matrix-
Prinzip.
Stereo-Ubersprechdämpfung
Von Antenne bis Ausgang:
von 250 Hz bis 6300 Hz = 26 dB
von 6300 Hz bis 12500 Hz = 20 dB
bei 1 kHz mindestens 35 dB
Antennen
FM: UKW:Dipol 240 9
AM: Außenantenne und Erde. Ferritantenne.
Audio-Selektor
Höhenfilter (Tiefpaß) für NF-Bandbreite, um-
schaltbar auf schmal und breit: Die „Schmal"-
Taste schaltet zugleich die AM-Bandbreite
kontaktlos auf „Schmal" (ca. 3 kHz).
NF-Ausgangsspannung
FM: 0,65 V für 40 kHz Gesamthub.
AM: 0,8 V für 30 O/o Modulation.
Innenwiderstand 2 k9, kleinster Abschluß-
widerstand 22 1(9.
Stereo/Mono
Mittels Drucktaste umschaltbar.
Stromversorgung
Für Netze von 110/130/220/240 Volt 50-60 Hz.
Leistungsaufnahme ca. 14 Watt.
Kostenloses Zubehör
Sicherung 250 mA träge für 110 Volt.
NF-Anschlußkabel.
Störstrahlungssicherheit
Für alle europäischen Normen und IEC-For-
derungen störstrahlungssicher.
Ausführung
Edelholzgehäuse in Nußbaum mattiert, Teak
natur oder Palisander mattiert.
Frontplatte aus gebürstetem Aluminium.
Abmessungen: ca. 50 x 15 x 31 cm.
Gesamtschaltbild des GRUNDIG Hi-Fi-Stereo- Rundfunk-Tuner
406
wir loo
3/1968 GRUNDIG TECHNISCHE INFORMATIONEN
 Loading...
Loading...