Page 1

R&S®HMO1002 Serie
R&S®HMO1202 Serie
Digital Oszilloskop
Benutzerhandbuch
5800530103
Version 04
Test & Measurement
Benutzerhandbuch
Page 2
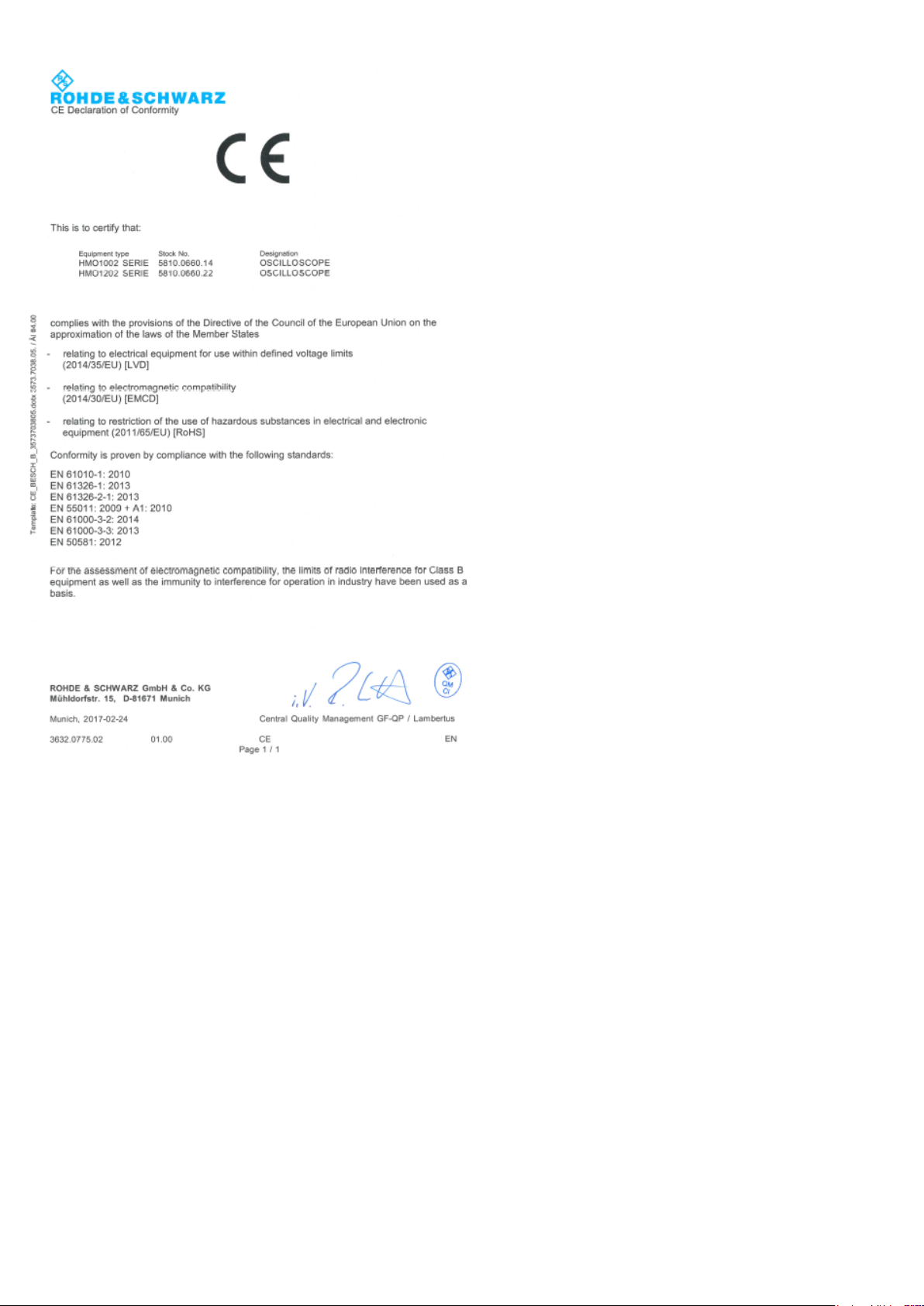
Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung
Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung
ROHDE & SCHWARZ Messgeräte erfüllen die Bestimmungen der EMV
Richtlinie. Bei der Konformitätsprüfung werden von ROHDE & SCHWARZ die
gültigen Fachgrund- bzw. Produktnormen zu Grunde gelegt. In Fällen, wo
unterschiedliche Grenzwerte möglich sind, werden von ROHDE & SCHWARZ
die härteren Prüfbedingungen angewendet. Für die Störaussendung werden
die Grenzwerte für den Geschäfts- und Gewerbebereich sowie für Kleinbetriebe angewandt (Klasse 1B). Bezüglich der Störfestigkeit finden die für
den Industriebereich geltenden Grenzwerte Anwendung. Die am Messgerät
notwendigerweise angeschlossenen Mess- und Datenleitungen beeinflussen
die Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte in erheblicher Weise. Die Verwendeten Leitungen sind jedoch je nach Anwendungsbereich unterschiedlich. Im praktischen Messbetrieb sind daher in Bezug auf Störaussendung
bzw. Störfestigkeit folgende Hinweise und Randbedingungen unbedingt zu
beachten:
1. Datenleitungen
Die Verbindung von Messgeräten bzw. ihren Schnittstellen mit externen
Geräten (Druckern, Rechnern, etc.) darf nur mit ausreichend abgeschirmten Leitungen erfolgen. Sofern die Bedienungsanleitung nicht eine
geringere maximale Leitungslänge vorschreibt, dürfen Datenleitungen
(Eingang/Ausgang, Signal/Steuerung) eine Länge von 3m nicht erreichen
und sich nicht außerhalb von Gebäuden benden. Ist an einem Geräteinterface der Anschluss mehrerer Schnittstellenkabel möglich, so darf jeweils
nur eines angeschlossen sein. Bei Datenleitungen ist generell auf doppelt
abgeschirmtes Verbindungskabel zu achten. Als IEEE-Bus Kabel ist das von
ROHDE & SCHWARZ beziehbare doppelt geschirmte Kabel HZ72 geeignet.
2. Signalleitungen
Messleitungen zur Signalübertragung zwischen Messstelle und Messgerät
sollten generell so kurz wie möglich gehalten werden. Falls keine geringere
Länge vorgeschrieben ist, dürfen Signalleitungen (Eingang/Ausgang, Signal/
Steuerung) eine Länge von 1m nicht erreichen und sich nicht außerhalb von
Gebäuden benden. Alle Signalleitungen sind grundsätzlich als abgeschirmte Leitungen (Koaxialkabel - RG58/U) zu verwenden. Für eine korrekte Masseverbindung muss Sorge getragen werden. Bei Signalgeneratoren müssen
doppelt abgeschirmte Koaxialkabel (RG223/U, RG214/U) verwendet werden.
3. Auswirkungen auf die Messgeräte
Beim Vorliegen starker hochfrequenter elektrischer oder magnetischer Felder
kann es trotz sorgfältigen Messaufbaues über die angeschlossenen Kabel
und Leitungen zu Einspeisung unerwünschter Signalanteile in das Gerät
kommen. Dies führt bei ROHDE & SCHWARZ Geräten nicht zu einer Zerstörung oder Außerbetriebsetzung. Geringfügige Abweichungen der Anzeige –
und Messwerte über die vorgegebenen Spezikationen hinaus können durch
die äußeren Umstände in Einzelfällen jedoch auftreten.
4. Störfestigkeit von Oszilloskopen
4.1 Elektromagnetisches HF-Feld
Beim Vorliegen starker hochfrequenter elektrischer oder magnetischer Felder
können durch diese Felder bedingte Überlagerungen des Messsignals sicht-
Allgemeine
bar werden. Die Einkopplung dieser Felder kann über das Versorgungsnetz,
Mess- und Steuerleitungen und/oder durch direkte Einstrahlung erfolgen.
Sowohl das Messobjekt, als auch das Oszilloskop können hiervon betroffen
sein. Die direkte Einstrahlung in das Oszilloskop kann, trotz der Abschirmung
durch das Metallgehäuse, durch die Bildschirmöffnung erfolgen. Da die
Bandbreite jeder Messverstärkerstufe größer als die Gesamtbandbreite des
Oszilloskops ist, können Überlagerungen sichtbar werden, deren Frequenz
wesentlich höher als die –3dB Messbandbreite ist.
Hinweise zur
CE-Kennzeich-
4.2 Schnelle Transienten / Entladung statischer Elektrizität
Beim Auftreten von schnellen Transienten (Burst) und ihrer direkten Einkopplung über das Versorgungsnetz bzw. indirekt (kapazitiv) über Mess- und
Steuerleitungen, ist es möglich, dass dadurch die Triggerung ausgelöst wird.
Das Auslösen der Triggerung kann auch durch eine direkte bzw. indirekte
statische Entladung (ESD) erfolgen. Da die Signaldarstellung und Triggerung
durch das Oszilloskop auch mit geringen Signalamplituden (<500 µV) erfolgen soll, lässt sich das Auslösen der Triggerung durch derartige Signale
(> 1 kV) und ihre gleichzeitige Darstellung nicht vermeiden.
2
Page 3

Inhalt
1 Wichtige Hinweise ......................4
1.1 Symbole ..................................4
1.2 Auspacken .................................4
1.3 Aufstellung des Gerätes .......................4
1.4 Sicherheit ..................................4
1.5 Bestimmungsgemäßer Betrieb ................4
1.6 Umgebungsbedingungen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
1.7 Gewährleistung und Reparatur .................5
1.8 Wartung ...................................5
1.9 Messkategorie ..............................5
1.10 Netzspannung ...............................6
1.11 Batterien und Akkumulatoren/Zellen .............6
1.12 Produktentsorgung ...........................6
2 Einführung ............................ 8
2.1 Vorderansicht ...............................8
2.2 Bedienpanel ................................8
2.3 Bildschirm ..................................9
2.4 Allgemeines Bedienkonzept ....................9
2.5 Grundeinstellungen und integrierte Hilfe .........10
2.6 GerätermwareUpdate ......................10
2.7 Optionen / Voucher ..........................10
2.8 Selbstabgleich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.9 Education Mode ............................12
2.10 Geräterückseite .............................12
3 Schnelleinstieg ........................ 13
3.1 Aufstellen und Einschalten des Gerätes ..........13
3.2 Anschluss eines Tastkopfes und Signal-
erfassung .................................13
3.3 Betrachten von Signaldetails ..................13
3.4 Cursor-Messungen ..........................14
3.5 Automatische Messungen ....................14
3.6 Mathematikeinstellungen .....................15
3.7 Daten abspeichern ..........................15
4 Vertikalsystem ........................ 16
4.1 Kopplung ..................................16
4.2 Verstärkung, Y-Position und Offset .............16
4.3 Bandbreitenbegrenzung und Invertierung ........16
4.4 Tastkopfdämpfung und Einheitenwahl
(Volt/Ampere) ..............................17
4.5 Schwellwerteinstellung ......................17
4.6 Name für einen Kanal ........................17
5 Horizontalsystem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
5.1 Erfassungsbetriebsart RUN und STOP ..........18
5.2 Zeitbasiseinstellungen .......................18
5.3 Erfassungsmodi ............................18
5.4 Interlace-Betrieb ............................21
5.5 ZOOM-Funktion ............................21
5.6 Navigation-Funktion .........................22
5.7 Marker-Funktion ............................22
6 Triggersystem .........................23
6.1 Triggermodi Auto, Normal und Single ...........23
6.2 Triggerquellen ..............................23
6.3 Triggertypen ...............................23
6.4 Trigger Events ..............................26
Inhalt
6.5 Trigger Extern (R&S®HMO1202) ................26
7 Anzeige von Signalen ................... 27
7.1 Anzeigeeinstellungen ........................27
7.2 Nutzung des virtuellen Bildschirms .............27
7.3 Signalintensitätsanzeige und Nachleucht-
funktion ...................................28
7.4 XY-Darstellung .............................28
8 Messungen ........................... 29
8.1 Cursor-Messfunktionen ......................29
8.2 Auto-Messfunktionen ........................30
9 Analyse .............................. 33
9.1 Mathematik-Funktionen ......................33
9.2 Frequenzanalyse (FFT) .......................35
9.3 Quick View ................................37
9.4 PASS/FAIL Test basierend auf Masken ..........37
9.5 Komponententester .........................38
9.6 Digitalvoltmeter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
10 Signalerzeugung .......................40
10.1 Funktionsgenerator ..........................40
10.2 Mustergenerator ............................40
11 Dokumentation, Speichern und Laden .....42
11.1 Geräteeinstellungen .........................42
11.2 Referenzen ................................43
11. 3 Ku rve n ....................................44
11.4 Bildschirmfoto ..............................45
11.5 DenitionderFILE/PRINT-Taste ................46
12 Mixed-Signal-Betrieb ...................46
12.1 Logiktrigger für digitale Eingänge ..............46
12.2 Anzeigefunktionen für die Logikkanäle ..........46
12.3 Anzeigen der Logikkanäle als BUS ..............47
12.4 Cursor-Messfunktionen für Logikkanäle .........48
12.5. Auto-Messfunktionen für Logikkanäle ..........48
13 Serielle Busanalyse ....................48
13.1 Software-Optionen (Lizenzschlüssel) ............48
13.2 KongurationseriellerBusse ..................48
13.3 Parallel / Parallel Clocked BUS .................50
13.4 I2C BUS ...................................50
13.5 SPI / SSPI BUS .............................52
13.6 UART / RS-232 BUS .........................54
13.7 CAN BUS ..................................56
13.8 LIN BUS ..................................58
14 Remote Betrieb ........................60
14.1 USB VCP ..................................60
14.2 USB TMC .................................61
14.3 USB MTP ..................................62
14.4 Ethernet ...................................63
15 Technische Daten ...................... 66
16 Anhang ..............................70
16.1 Abbildungsverzeichnis .......................70
16.2 Stichwortverzeichnis ........................71
3
Page 4

Wichtige Hinweise
1 Wichtige
Hinweise
1.1 Symb o le
(1) (2) (3) (4)
(5) (6) (7)
1.4 Sicherheit
Dieses Gerät ist gemäß VDE 0411 Teil 1, Sicherheitsbestimmungen für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte gebaut, geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Es entspricht
damit auch den Bestimmungen der europäischen Norm
EN 61010-1 bzw. der internationalen Norm IEC 61010-1.
Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen
Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Hinweise
und Warnvermerke beachten, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind. Gehäuse, Chassis und alle Messanschlüsse sind mit dem Netzschutzleiter verbunden. Das
Gerät entspricht den Bestimmungen der Schutzklasse I.
Die berührbaren Metallteile sind gegen die Netzpole mit
2200 V Gleichspannung geprüft. Das Gerät entspricht der
Überspannungskategorie II.
Symbol 1: Achtung, allgemeine Gefahrenstelle –
Produktdokumentation beachten
Symbol 2: Gefahr vor elektrischem Schlag
Symbol 3: Erdungsanschluss
Symbol 4: Schutzleiteranschluss
Symbol 5: EIN-/AUS Versorgungsspannung
Symbol 6: Stand-by-Anzeige
Symbol 7: Masseanschluss
1.2 Auspacken
Prüfen Sie beim Auspacke
ständigkeit (Messgerät, Netzkabel, evtl. op-tionales
Zubehör). Nach dem Auspacken sollte das Gerät auf
transportbedingte und mechanische Beschädigungen
überprüft werden. Falls ein Transportschaden vorliegt, bitten wir Sie sofort den Lieferant zu informieren. Das Gerät
darf dann nicht betrieben werden.
1.3 Aufstellung des Gerätes
Wie den Abbildungen zu entnehmen ist, lassen sich kleine
Aufsteller aus den Füßen herausklappen, um das Gerät
leicht schräg aufzustellen. Bitte stellen Sie sicher, dass die
Füsse komplett ausgeklappt sind, um einen festen Stand
zu gewährleisten.
n den Packungsinhalt auf Voll-
Das Auftrennen der Schutzkontaktverbindung innerhalb
oder außerhalb des Gerätes ist unzulässig!
Das Gerät darf aus Sicherheitsgründen nur an vorschriftsmäßigen Schutzkontaktsteckdosen betrieben werden. Der
Netzstecker muss eingeführt sein, bevor Signalstromkreise
angeschlossen werden. Benutzen Sie das Produkt niemals,
wenn das Netzkabel beschädigt ist. Überprüfen Sie regelmäßig den einwandfreien Zustand der Netzkabel. Stellen
Sie durch geeignete Schutzmaßnahmen und Verlegearten
sicher, dass das Netzkabel nicht beschädigt werden kann
und niemand z.B. durch Stolperfallen oder elektrischen
Schlag zu Schaden kommen kann.
Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht
mehr möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen
und gegen unabsichtlichen Betrieb zu sichern.
Diese Annahme ist berechtigt:
❙ wenn das Messgerät sichtbare Beschädigungen hat,
❙ wenn das Messgerät nicht mehr arbeitet,
❙ nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen
(z.B. im Freien oder in feuchten Räumen),
❙ nach schweren Transportbeanspruchungen (z.B. mit einer
Verpackung, die nicht den Mindestbedingungen von Post,
Bahn oder Spedition entsprach).
Abb. 1.1: Betriebspositionen
Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass die Betätigung
der Netztrennung jederzeit uneingeschränkt möglich ist.
4
1.5 Bestimmungsgemäßer Betrieb
Das Messgerät ist nur zum Gebrauch durch Personen bestimmt, die mit den beim Messen elektrischer Größen verbundenen Gefahren vertraut sind. Das Messgerät darf nur
an vorschriftsmäßigen Schutzkontaktsteckdosen betrieben
werden, die Auftrennung der Schutzkontaktverbindung ist
unzulässig. Der Netzstecker muss kontaktiert sein, bevor
Signalstromkreise angeschlossen werden.
Das Messgerät ist nur mit dem ROHDE & SCHWARZ OriginalMesszubehör, -Messleitungen bzw. -Netzkabel zu verwenden.
Verwenden sie niemals unzulänglich bemessene Netzkabel. Vor
Beginn jeder Messungsind die Messleitungen auf Beschädigung
zu überprüfen und ggf. zu ersetzen. Beschädigte oder verschlissene Zubehörteile können das Gerät beschädigen oder zu Verletzungen führen.
Page 5

Wichtige Hinweise
Das Produkt darf nur in den vom Hersteller angegebenen
Betriebszuständen und Betriebslagen ohne Behinderung
der Belüftung betrieben werden. Werden die Herstellerangaben nicht eingehalten, kann dies elektrischen Schlag,
Brand und/oder schwere Verletzungen von Personen,
unter Umständen mit Todesfolge, verursachen. Bei allen
Arbeitensinddieörtlichenbzw.landesspezischenSicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.
Das Messgerät ist für den Betrieb in folgenden Bereichen
bestimmt: Industrie-, Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereich sowie Kleinbetriebe. Das Messgerät darf jeweils
nur im Innenbereich eingesetzt werden. Vor jeder
Messung ist das Messgerät auf korrekte Funktion an einer
bekannten Quelle zu überprüfen.
Zum Trennen vom Netz muss der rückseitige Kaltgerätestecker
gezogen werden.
1.6 Umgebungsbedingungen
Der zulässige Arbeitstemperaturbereich während des Betriebes reicht von +5 °C bis +40 °C (Verschmutzungsgrad
2). Die maximale relative Luftfeuchtigkeit (nichtkondensierend) liegt bei 80%. Während der Lagerung oder des
Transportes darf die Temperatur zwischen –20 °C und
+70 °C betragen. Hat sich während des Transports oder der
Lagerung Kondenswasser gebildet, sollte das Gerät ca. 2
Stunden akklimatisiert werden, bevor es in Betrieb genommen wird. Das Messgerät ist zum Gebrauch in sauberen,
trockenen Räumen bestimmt. Es darf nicht bei besonders
großem Staub- bzw. Feuchtigkeitsgehalt der Luft, bei Explosionsgefahr, sowie bei aggressiver chemischer Einwirkung betrieben werden. Die Betriebslage ist beliebig, eine
ausreichende Luftzirkulation ist jedoch zu gewährleisten.
Bei Dauerbetrieb ist folglich eine horizontale oder schräge
Betriebslage (Aufstellfüße) zu bevorzugen.
Das Gerät darf bis zu einer Höhenlage von 2000 m betrieben werden. Nenndaten mit Toleranzangaben gelten nach
einer Aufwärmzeit von mindestens 30 Minuten und bei
einer Umgebungstemperatur von 23 °C (Toleranz ±2 °C).
Werte ohne Toleranzangabe sind Richtwerte eines durchschnittlichen Gerätes.
Die Lüftungslöcher dürfen nicht abgedeckt werden.
1.7 Gewährleistung und Reparatur
ROHDE & SCHWARZ Geräte unterliegen einer strengen
Qualitätskontrolle. Jedes Gerät durchläuft vor dem Verlassen der Produktion einen 10-stündigen „Burn in-Test“. Anschließend erfolgt ein umfangreicher Funktions- und Qualitätstest, bei dem alle Betriebsarten und die Einhaltung der
technischen Daten geprüft werden. Die Prüfung erfolgt
mit Prüfmitteln, die auf nationale Normale rückführbar kalibriert sind. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen des Landes, in dem das ROHDE & SCHWARZ
Produkt erworben wurde. Bei Beanstandungen wenden
Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das ROHDE &
SCHWARZ Produkt erworben haben.
Abgleich, Auswechseln von Teilen, Wartung und Reparatur darf nur von ROHDE & SCHWARZ autorisierten Fachkräften ausgeführt werden. Werden sicherheitsrelevante
Teile (z.B. Netzschalter, Netztrafos oder Sicherungen)
ausgewechselt, so dürfen diese nur durch Originalteile
ersetzt werden. Nach jedem Austausch von sicherheitsrelevanten Teilen ist eine Sicherheitsprüfung durchzuführen
(Sichtprüfung, Schutzleitertest, Isolationswiderstands-,
Ableitstrommessung, Funktionstest). Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Produkts erhalten bleibt.
Das Produkt darf nur von dafür autorisiertem Fachpersonal geöffnet werden. Vor Arbeiten am Produkt
oder Öffnen des Produkts ist dieses von der Versorgungsspannung zu trennen, sonst besteht das Risiko
eines elektrischen Schlages.
1.8 Wartung
Die Außenseite des Messgerätes sollte regelmäßig mit einem
weichen, nicht fasernden Staubtuch gereinigt werden.
Die Anzeige darf nur mit Wasser oder geeignetem Glasreiniger (aber nicht mit Alkohol oder Lösungsmitteln)
gesäubert werden, sie ist dann noch mit einem trockenen,
sauberen, fusselfreien Tuch nach zu reiben. Keinesfalls darf
dieReinigungsflüssigkeitindasGerätgelangen.DieAnwendung anderer Reinigungsmittel kann die Beschriftung
oderKunststoff-undLackoberflächenangreifen.
Bevor Sie das Messgerät reinigen stellen Sie bitte sicher, dass es
ausgeschaltet und von allen Spannungsversorgungen getrennt ist
(z.B. speisendes Netz oder Batterie). Keine Teile des Gerätes dürfen mit chemischen Reinigungsmitteln, wie z.B. Alkohol, Aceton
oder Nitroverdünnung, gereinigt werden!
1.9 Messkategorie
Dieses Oszilloskop ist für Messungen an Stromkreisen
bestimmt, die entweder gar nicht oder nicht direkt mit
dem Netz verbunden sind. Das Gerät wird in keine Messkategorie eingestuft; die Eingangsspannung der analogen
Eingänge CH1/CH2 darf 200 V (Spitzenwert) bzw. 150 V
RMS
bei1MΩEingangswiderstandnichtüberschreiten.Beim
externen Triggereingang (TRIG. EXT.) darf die Eingangsspannung von 100 V (Spitzenwert) nicht überschritten
werden. Transiente Überspannungen dürfen 200 V (Spitzenwert) nicht überschreiten. Es dürfen nur Tastköpfe
verwendet werden, die entsprechend DIN EN 61010-031
gebaut und geprüft sind, um transiente Überspannungen
am Messeingang zu unterbinden. Der AUX OUT Anschluss
ist ein Multifunktionsausgang, der als Komponententester, Trigger-Ausgang, Pass-Fail und Funktionsgenerator
genutzt werden kann. Bei Messungen in Messkreisen der
Messkategorien II, III oder IV muss der verwendete Tast-
5
Page 6

Wichtige Hinweise
kopf die Spannung so reduzieren, dass keine transienten
Überspannungen auftreten. Direkte Messungen (ohne
galvanische Trennung) an Messstromkreisen der Messkategorie II, III oder IV sind unzulässig. Die Stromkreise eines
Messobjekts sind dann nicht direkt mit dem Netz verbunden, wenn das Messobjekt über einen Schutz-Trenntransformator der Schutzklasse II betrieben wird. Es ist auch
möglich, mit Hilfe geeigneter Wandler (z.B. Stromzangen),
welche die Anforderungen der Schutzklasse II erfüllen,
quasi indirekt am Netz zu messen. Bei der Messung muss
die Messkategorie – für die der Hersteller den Wandler
spezizierthat–beachtetwerden.
Die Messkategorien beziehen sich auf Transienten auf
dem Netz. Transienten sind kurze, sehr schnelle (steile)
Spannungs- und Stromänderungen, die periodisch und
nicht periodisch auftreten können. Die Höhe möglicher
Transienten nimmt zu, je kürzer die Entfernung zur Quelle
der Niederspannungsinstallation ist.
❙ Messkategorie IV: Messungen an der Quelle der
Niederspannungsinstallation (z.B. an Zählern).
❙ Messkategorie III: Messungen in der Gebäudeinstalla-
tion (z.B. Verteiler, Leistungsschalter, fest installierte
Steckdosen, fest installierte Motoren etc.).
❙ Messkategorie II: Messungen an Stromkreisen, die
elektrisch direkt mit dem Niederspannungsnetz
verbunden sind (z.B. Haushaltsgeräte, tragbare
Werkzeuge etc.)
❙ 0 (Geräte ohne bemessene Messkategorie): Andere
Stromkreise, die nicht direkt mit dem Netz verbunden
sind.
1.10 Netzspannung
Das Gerät arbeitet mit 50 und 60 Hz Netzwechselspannungen im Bereich von 100 V bis 240 V (Toleranz ±10%) . Eine
Netzspannungsumschaltung ist daher nicht vorgesehen.
Die Netzeingangssicherung ist von außen zugänglich.
Netzstecker-Buchse und Sicherungshalter bilden eine
Einheit. Ein Auswechseln der Sicherung darf und kann (bei
unbeschädigtem Sicherungshalter) nur erfolgen, wenn
zuvor das Netzkabel aus der Buchse entfernt wurde. Dann
muss der Sicherungshalter mit einem Schraubendreher
herausgehebelt werden. Der Ansatzpunkt ist ein Schlitz,
dersichaufderSeitederAnschlusskontaktebendet.Die
Sicherung kann dann aus einer Halterung gedrückt und
muss durch eine identische ersetzt werden (Angaben zum
Sicherungstyp nachfolgend) . Der Sicherungshalter wird
gegen den Federdruck eingeschoben, bis er eingeras-
tetist.DieVerwendung,,geflickter“Sicherungenoder
das Kurzschließen des Sicherungshalters ist unzulässig. Dadurch entstehende Schäden fallen nicht unter die
Gewährleistung.
Sicherungstyp: IEC 60127-T2.5H 250V
(Größe 5 x 20mm)
Bleibt das Gerät für längere Zeit unbeaufsichtigt, muss das Gerät
aus Sicherheitsgründen am Netzschalter ausgeschaltet werden.
1.11 Batterien und Akkumulatoren/Zellen
Werden die Hinweise zu Batterien und Akkumulatoren/Zellen
nicht oder unzureichend beachtet, kann dies Explosion, Brand
und/oder schwere Verletzungen von Personen, unter Umständen
mit Todesfolge, verursachen. Die Handhabung von Batterien und
Akkumulatoren mit alkalischen Elektrolyten (z.B. Lithiumzellen)
muss der EN 62133 entsprechen.
1. Zellen dürfen nicht zerlegt, geöffnet oder zerkleinert
werden.
2. Zellen oder Batterien dürfen weder Hitze noch Feuer
ausgesetzt werden. Die Lagerung im direkten Sonnenlicht ist zu vermeiden. Zellen und Batterien sauber und
trocken halten. Verschmutzte Anschlüsse mit einem
trockenen, sauberen Tuch reinigen.
3. Zellen oder Batterien dürfen nicht kurzgeschlossen
werden. Zellen oder Batterien dürfen nicht gefahrbringend in einer Schachtel oder in einem Schubfach
gelagert werden, wo sie sich gegenseitig kurzschließen
oder durch andere leitende Werkstoffe kurzgeschlossen werden können. Eine Zelle oder Batterie darf erst
aus ihrer Originalverpackung entnommen werden,
wenn sie verwendet werden soll.
4. Zellen und Batterien von Kindern fernhalten. Falls eine
Zelle oder eine Batterie verschluckt wurde, ist sofort
ärztliche Hilfe in Anspruch zu nehmen.
5. Zellen oder Batterien dürfen keinen unzulässig starken,
mechanischen Stößen ausgesetzt werden.
6. Bei Undichtheit einer Zelle darf die Flüssigkeit nicht mit
der Haut in Berührung kommen oder in die Augen gelangen. Falls es zu einer Berührung gekommen ist, den
betroffenen Bereich mit reichlich Wasser waschen und
ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen.
7. Werden Zellen oder Batterien unsachgemäß ausgewechselt oder geladen, besteht Explosionsgefahr. Zellen oder Batterien nur durch den entsprechenden Typ
ersetzen, um die Sicherheit des Produkts zu erhalten.
8. Zellen oder Batterien müssen wiederverwertet werden
und dürfen nicht in den Restmüll gelangen. Akkumulatoren oder Batterien, die Blei, Quecksilber oder
Cadmium enthalten, sind Sonderabfall. Beachten
SiehierzudielandesspezischenEntsorgungs-und
Recycling-Bestimmungen.
1.12 Produktentsorgung
Abb. 1.2:
Produktkennzeichnung nach EN 50419
Das ElektroG setzt die folgenden EG-Richtlinien um:
❙ 2002/96/EG (WEEE) für Elektro- und Elektronikaltgeräte
und
❙ 2002/95/EG zur Beschränkung der Verwendung
bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektronikgeräten
(RoHS-Richtlinie).
6
Page 7

Am Ende der Lebensdauer des Produktes darf dieses Produkt nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.
Auch die Entsorgung über die kommunalen Sammelstellen
für Elektroaltgeräte ist nicht zulässig. Zur umweltschonenden Entsorgung oder Rückführung in den Stoffkreislauf
übernimmt die ROHDE & SCHWARZ GmbH & Co. KG die
PflichtenderRücknahme-undEntsorgungdesElektroG
für Hersteller in vollem Umfang.
Wenden Sie sich bitte an Ihren Servicepartner vor Ort, um
das Produkt zu entsorgen.
Wichtige Hinweise
7
Page 8
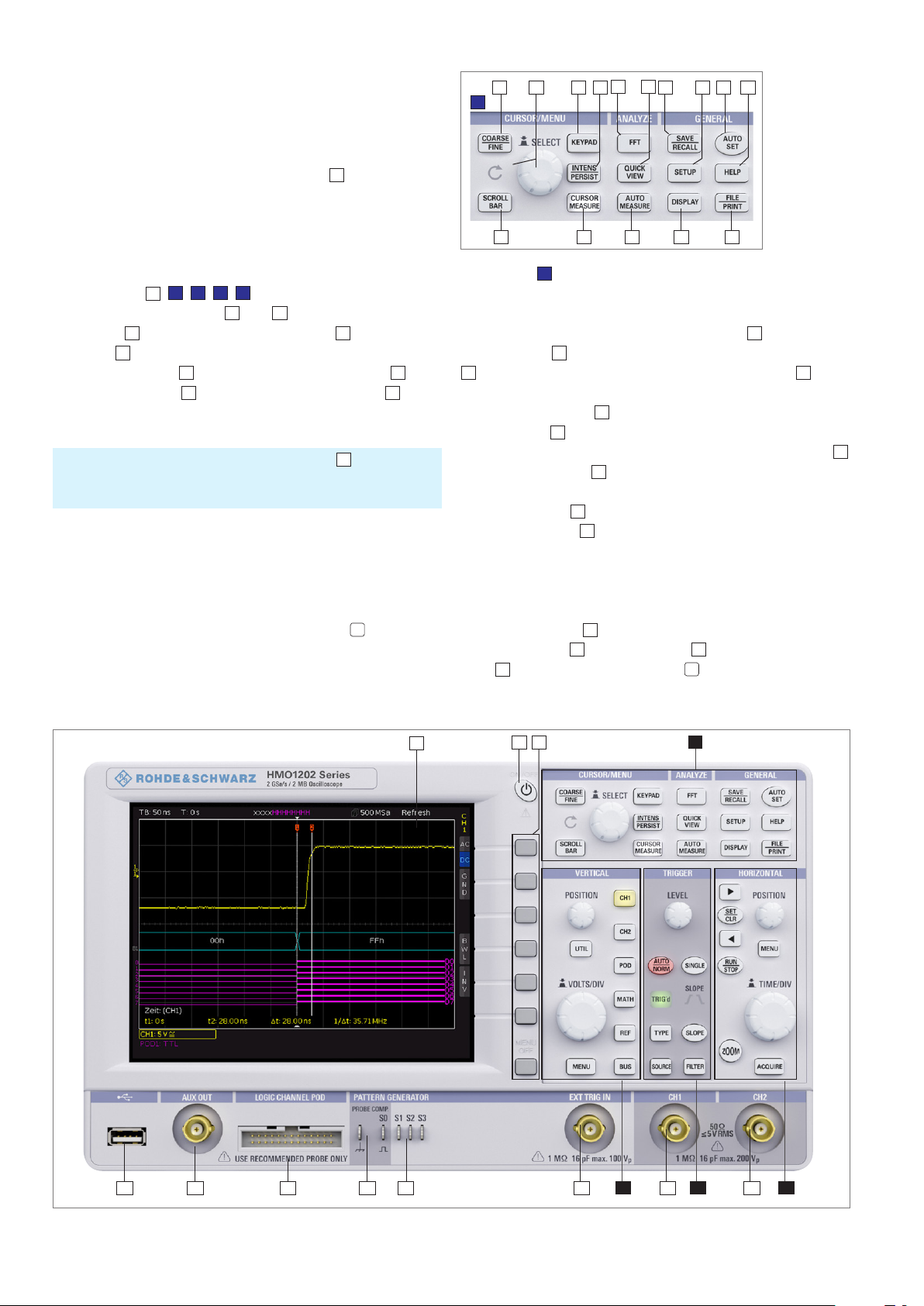
Einführung
2 Einführung
2.1 Vorderansicht
AnderFrontseitebendetsicheineTaste1, um den Ruhezustandein-oderauszuschalten.BendetsichdasGerät
im Ruhemodus, leuchtet diese Taste rot. Wenn das Gerät
mit dem Schalter auf der Rückseite ausgeschaltet wird,
erlischt diese LED (dies dauert einige Sekunden). Ebenfalls
aufderFrontseitebendetsichdasBedienfeldfürdie
Einstellungen 2, A, B, C, D, die BNC Anschlüsse der
analogen Eingangskanäle 45 und 46, der externe Trigger
Anschluss 47, die Tastkopfkompensations- 49 und Bussignalquelle 48, die Anschlüsse für den optionalen Logiktastkopf ¸HO3508 50, ein USB Port für USB-Sticks 52 und
der TFT-Bildschirm 53. Über die Buchse AUX OUT 51 kann
u.A. ein Pass/Fail Test oder auch ein Komponententest
durchgeführt werden.
An den Anschluss für den aktiven Logiktastkopf 50 darf nur ein
Logiktastkopf vom Typ ¸HO3508 angeschlossen werden, ansonsten besteht die Gefahr der Zerstörung der Eingänge!
2.2 Bedienpanel
Mit den Tasten auf dem Bedienpanel haben Sie Zugriff auf
die wichtigsten Funktionen. Erweiterte Einstellungen sind
komfortabel mittels Menüstruktur und den grauen Softmenütasten erreichbar. Der Ruhezustandsknopf 1 ist deutlich
durch die Form hervorgehoben. Die wichtigsten Knöpfe
sind mit farbigen LED’s hinterlegt, damit man sofort die
jeweilige Einstellung erkennen kann. Das Bedienpanel ist
in vier Abschnitte gegliedert.
3
A
5
Abschnitt
7
6
4
8
A
11
12 13
14
15
16
Abb. 2.2:
17
Bedienfeldabschnitt A
9
10
Dieser Abschnitt umfasst die drei Bereiche CURSOR/
MENU, ANALY Z E und GENERAL. Im Bereich CURSOR/
MENUbendensichdieCursorfunk-tionen8, der Universaldrehgeber 4, der Intensitäts/Persistence Einstellknopf
7
, die Taste zum Aufrufen einer virtuellen Tastatur 6, der
UmschalterzwischenGrob-undFeinauflösungfürden
Universaldrehgeber 4 sowie die Anwahl des virtuellen
Bildschirmes 5. Der ANALY ZE Bereich ermöglicht direkten Zugriff auf die Umschaltung in den Frequenzbereich
9
, auf die Quickview 10 Anzeige (alle wichtigen Parameter
der aktiven Kurve) sowie die Einstellungen zur automatischen Messung 11 . Im Bereich GENERALbendetsichdie
Taste Save/Recall 12, mit der alle Einstellungen zum Laden
und Abspeichern von Geräteeinstellungen, Referenzkurven, Kurven und Bildschirmfotos möglich sind.
Weitere Tasten ermöglichen den Zugriff auf die allgemeinen Einstellungen 13 (z.B. Sprache), die Einstellfunktionen
des Bildschirms 14, das Autosetup 15 sowie die integrierte
Hilfe 16 und die Taste FILE/PRINT 17 welche je nach Programmierung das direkte Abspeichern von Geräteeinstellungen, Kurven oder Bildschirmfotos ermöglicht.
49 48
1
55
2
B C D
47 46 45505152
A
Abb. 2.1: Frontansicht R&S®HMO1202
8
Page 9

Einführung
Abschnitt B:
ImBereichVERTICALbendensichalleEinstellmöglichkeiten der analogen Kanäle, wie die Y-Position 18, die Umschaltung in den XY Anzeigebetrieb und den Komponententester
(UTIL Menü) 19, die vertikale Verstärkung 20 , weitergehende
Menüs 21, die Kanalwahl 22 bis 23 , sowie des optionalen Logiktastkopfes ¸HO3508 24.Außerdembendetsichhier
der Zugang zur Mathematik 25 , den Referenzkurven- 26 und
den Buseinstellungen 27.
Abschnitt C:
Der Abschnitt TRIGGER stellt alle Funktionen zum Einstellen
des Triggerpegels 28 , der Umschaltung zwischen Auto- und
Normalbetrieb 29, des Trigger-
B
typs 31, der Quelle 32 , der einmaligen Triggerauslösung 33 ,
der Umschaltung der Trigger-
22
18
19
flanke35 sowie Einstellungen
zurTriggerlterbedingung
23
36
zur Verfügung. Zusätzlich
stehen Statusanzeigen zur
24
Verfügung, ob ein Signal die
Triggerbedingungen erfüllt 30
25
20
21
und welche der Flanken ge-
26
nutzt werden 34.
27
Abschnitt D:
Im Abschnitt HORIZONTAL
erfolgt die Einstellung der Ho-
C
rizontalposition des Triggerzeitpunktes oder das Setzen und
Navigieren von Markern über
28
Drucktasten 37 38 39 in Schritten oder variabel mit dem kleineren Drehknopf 41. Zusätzlich
lässt sich im Menü eine Such-
29
33
funktion nach Ereignissen
34
30
kongurieren.DieAuswahl
des Run- oder Stop Modus
31
32
35
erfolgt mit der hinterleuchteten Taste 39, wobei im Stop
36
Modus die Taste rot leuchtet.
Die Zoom-Aktivierung 40 , die
D
37
38
37
39
Auswahl der Erfassungsmodi
44
, die Zeitbasiseinstellung 43
sowie den Zugriff auf das Zeitbasismenü 42 sind ebenfalls in
41
diesem Abschnitt verfügbar.
Zusätzlichbendensichrechts
42
neben dem Bildschirm die
Softmenütasten 2, mit denen
die Menüsteuerung erfolgt.
43
2.3 Bildschirm
40
Die R&S®HMO1002 bzw.
R&S®HMO1202 Serie ist mit
44
einem 6,5 Zoll (16,51 cm),
Abb. 2.3:
Die Bedienfelder B, C und D
mit LED hinterleuchtetem
TFT Farbbildschirm mit einer
VGAAuflösung(640x480Pixel)ausgestattet.InderNormaleinstellung (ohne eingeblendete Menüs) verfügt der
Bildschirm über 12 Skalenteile auf der Zeitachse. Diese
wird bei Einblendung von Menüs auf 10 Skalenteile reduziert.Am linken Rand der Anzeige werden Informationen zum Bezugspotential der Kanäle mit kleinen Pfeilen
markiert. Die Zeile oberhalb des Gitters enthält Status und
Einstellungsinformationen, wie die eingestellte Zeitbasis,
die Triggerverzögerung und sonstige Triggerbedingungen, die aktuelle Abtastrate und die Erfassungsart. Rechts
neben dem Gitter wird ein Kurzmenü für die wichtigsten
Einstellungen des jeweils aktiven Kanales dargestellt, welche mit den Softmenütasten ausgewählt werden können.
Im unteren Bildschirmteil werden die Messergebnisse der
automatischen Messungen und Cursors, sowie die vertikalen Einstellungen der eingeschalteten Kanäle, Referenzen
und Mathematikkurven angezeigt. Im Gitter selbst werden
die Signale der eingeschalteten Kanäle dargestellt. Dieses
stellt 8 Skalenteile gleichzeitig dar, verfügt aber über eine
virtuelle Erweiterung auf 20 Skalenteile, welche mit Hilfe
der Taste Scroll/Bar 5 angezeigt werden können.
2.4 Allgemeines Bedienkonzept
Das allgemeine Bedienkonzept beruht auf einigen wenigen
Grundprinzipien, die sich bei verschiedensten Einstellungen und Funktionen wiederholen.
❙ Tasten, die kein Softmenü öffnen (wie z.B. SCROLL BAR),
schalten eine bestimmte Funktion ein. Das nochmalige
Drücken dieser Taste schaltet die Funktion wieder aus.
❙ Tasten, mit denen beim einfachen Druck ein Softmenü
geöffnet wird, schließen dieses beim zweiten Druck
wieder.
❙ Der Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld
dient in den Menüstrukturen je nach Erfordernissen dazu,
Zahlenwerte einzustellen, Unterpunkten zu wählen und
ggfs. durch Druck zu bestätigen. Außerdem dient er bei
eingeschalteten Cursor-Messungen zur Auswahl des
Cursors.
❙ Die unterste Softmenütaste MENU OFF schließt das
aktuelle Menü oder schaltet zurück auf die nächsthöhere
Ebene.
❙ Kanäle werden, wenn der Kanal ausgeschaltet ist, durch
Druck der entsprechenden Taste eingeschaltet. Wenn der
jeweilige Kanal schon eingeschaltet ist, aber ein anderer
Kanal ausgewählt wird (Taste leuchtet), so springt die Auswahl auf den Kanal, dessen Taste betätigt wurde.
❙ DieCOARSE/FINE-Tastedientdazu,dieAuflösungdes
Universaldrehgebers im CURSOR/MENU Bedienfeld
zwischen grob und fein umzuschalten. Wenn die Taste
leuchtet,istdiefeineAuflösungaktiv.
IndenSoftmenüsgibteseinigehäugverwendeteNavi-
gationselemente, die im folgenden beschrieben werden.
Entweder wird das jeweilige Element mit der zugehörigen Softmenütaste ausgewählt und blau hinterlegt oder
ein Druck der Softmenütaste bewirkt ein Umschalten
zwischen den Funktionsmöglichkeiten. Wenn es sich um
Funktionen handelt, die eingeschaltet und auch Werteein-
9
Page 10

Einführung
stellungen erfordern, wird zwischen AUS und Einstellwert
umgeschaltet (z.B. Funktion ZEIT-OFFSET). Der runde Pfeil
im Menüfenster deutet darauf hin, dass zum Einstellen
des Wertes der Universaldrehgeber im CURSOR/MENU
Bedienfeld genutzt werden kann. Wenn die jeweilige
Funktion eine weitere Menüebene enthält, so wird dies mit
einem kleinen Dreieck rechts unten im Menüpunkt angezeigt. Sind weitere Menüseiten verfügbar, so wird zur Navigation auf dieser Ebene der unterste Menüpunkt genutzt.
Er beinhaltet die Anzahl der Menüseiten auf dieser Ebene
und gibt die aktuelle Seitenzahl an. Mit dem Druck auf die
entsprechende Softmenütaste wird immer eine Seite weitergeschaltet, nach der Letzten folgt immer die Erste.
2.5 Grundeinstellungen und integrierte Hilfe
Wichtige Grundeinstellungen, wie die Sprache der BenutzeroberflächeunddieintegrierteHilfe,allgemeineEinstellungen sowie Schnittstelleneinstellungen werden mittels
SETUP-Taste im GENERAL Bedienfeld vorgenommen.
Auf der ersten Seite des Menüs kann die Sprache der Be-
dienoberflächeundHilfeausgewähltwerden.DerMenüpunktSCHNITTSTELLEführtzudenSchnittstellenkongu-
rationen (USB oder Ethernet). Der Menüpunkt DRUCKER
umfasst Einstellungen für POSTSCRIPT und PCL kompatible
Drucker. Nach dem Drücken dieser Softmenutaste öffnet
sich ein Untermenü, in welchem das Papierformat und der
Farbmodus eingestellt werden können. Mit dem obersten
Menüpunkt PAPIERFORMAT kann mit der zugeordneten
Softmenütaste zwischen den Formaten A4, A5, B5, B6, Executive, Letter und Legal in Hoch und Querformat gewählt
werden. Mit dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU
Bedienfeld wird das gewünschte Format ausgewählt, welches anschließend auf der Softmenütaste aufgeführt ist.
Mit der Softmenütaste FARBMODUS kann mit derselben
Einstellungsmethode zwischen Graustufen, Farbe und Invertiert gewählt werden. Der Graustufenmodus wandelt das
Farbbild in ein Graustufenbild, welches auf einem SchwarzWeiß-Postscriptdrucker ausgegeben werden kann. Im
Modus Farbe wird das Bild farblich wie auf dem Bildschirm
angezeigt ausgedruckt (schwarzer Hintergrund). Der Modus
Invertiert druckt ein Farbbild mit weißem Hintergrund auf
einem Farbdrucker aus, um Toner bzw. Tinte zu sparen.
Das Softmenü GERÄTEINFORMATIONEN öffnet ein Fenster mit detaillierten Informationen über Hardware und
Software des Messgerätes. Mit der Softmenütaste GERÄ-
TENAMEkanneinNamemitmax.19Buchstabendeniert
werden, welcher bei Bildschirmausdrucken mit aufgeführt
wird. Im Softmenü MENÜ AUS kann gewählt werden, ob
die Softmenüs manuell oder nach 4-30 s automatisch geschlossen werden sollen. Mit der Softmenütaste GERÄTELOGO IM AUSDRUCK kann gewählt werden, ob das R&S
Logo im Ausdruck oben rechts erscheinen soll oder nicht.
DasSoftmenüAKTUALISIERUNGfürdieGerätermware
und LIZENZEN für das Upgrade von Softwareoptionen
werden in den folgenden Kapiteln ausführlich beschrieben.
Das Softmenü DATUM & ZEIT dient zum Einstellen von
Datum und Uhrzeit. Das Softmenü SOUND dient zum Ein-
stellen der Sound-Optionen. Es kann ein Ton als Kontrollton
bei Einstellungen, im Fehlerfall und bei Trigger aktiviert
werden.
Die integrierte Hilfe wird durch Druck auf die HELP-Taste
im GENERAL Bedienfeld aktiviert. Es wird ein Fenster mit
Erklärungstexten geöffnet. Der Text im Hilfefenster wird
dynamisch mit den Beschreibungen der jeweils aufgerufenen Einstellung oder Funktion aktualisiert. Wird die Hilfe
nicht mehr benötigt, so wird diese durch erneuten Druck
auf die HELP-Taste deaktiviert. Dadurch erlischt die TastenLED und das Textfenster für die Hilfe wird geschlossen.
2.6 GerätermwareUpdate
Die R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202 Serie wird ständig weiterentwickelt. Die aktuelle Firmware kann unter
www.rohde-schwarz.com heruntergelden werden. Die
Firmware ist in eine ZIP-Datei gepackt. Ist die ZIP-Datei
heruntergeladen, wird diese auf einen USB Stick in dessen
Basisverzeichnis entpackt. Anschließend wird der USBStick mit dem USB Port am Oszilloskop verbunden und
die Taste SETUP im GENERAL Bedienfeld betätigt. Das
SoftmenüAKTUALISIERUNGbendetsichaufSeite2|2.
Nach Anwahl dieses Softmenüs öffnet sich ein Fenster, in
dem die aktuell installierte Firmwareversion mit Angabe
der Versionsnummer, des Datums und der Build-Informa-
tionangezeigtwird.GerätermwareoderHilfekönnenhier
aktualisiert werden. Wird die Softmenütaste zur Geräte-
rmwareaktualisierungbetätigt,sowirddieentsprechende
Datei auf dem Stick gesucht und die Informationen der
neu zu installierenden Firmware auf dem USB Stick unter
der Zeile NEU: angezeigt. Sollte die Firmware auf dem
Gerät der aktuellsten Version entsprechen, so wird die
Versionsnummer rot angezeigt, ansonsten erscheint die
Versionsnummer in grün. Nur in diesem Falle sollte die Aktualisierung durch Drücken der Softmenütaste AUSFÜHREN gestartet werden.
2.7 Optionen / Voucher
Die R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202 Serie verfügt über
Optionen, mit denen die Anwendungsbreite des Gerätes
vergrößert werden kann (wie z.B. Bandbreiten-Upgrade oder
Busanalyse Funktionen). Derzeit sind für die R&S®HMO1002
Serie die Optionen R&S®HOO10/HOO11/HOO12 bzw.
R&S®HOO512/HOO712/HOO572 und für die R&S®HMO1202
Serie die Optionen R&S®HOO10/HOO11/HOO12 bzw.
R&S®HOO312/HOO313/HOO323 verfügbar. Die Bandbreiten-Optionen R&S®HOO572, R&S®HOO512, R&S®HOO712,
R&S®HOO312, R&S®HOO313 und R&S®HOO323 bzw. die
Busanalyse-Funktionen R&S®HOO10, R&S®HOO11 und
R&S®HOO12 können ab Werk mit einem R&S®HMO1002
bzw. R&S®HMO1202 erworben werden. Die BandbreitenUpgrade Voucher R&S®HV572, R&S®HV512, R&S®HV712,
R&S®HV312, R&S®HV313 und R&S®HV323 bzw. die Busanalyse-Upgrade Voucher R&S®HV110, R&S®HV111 und
R&S®HV112 dagegen ermöglichen ein nachträgliches Upgrade über einen Lizenzschlüssel. Die installierten Optionen
bzw. Voucher können unter Geräteinformationen im SETUP
Menü überprüft werden.
10
Page 11
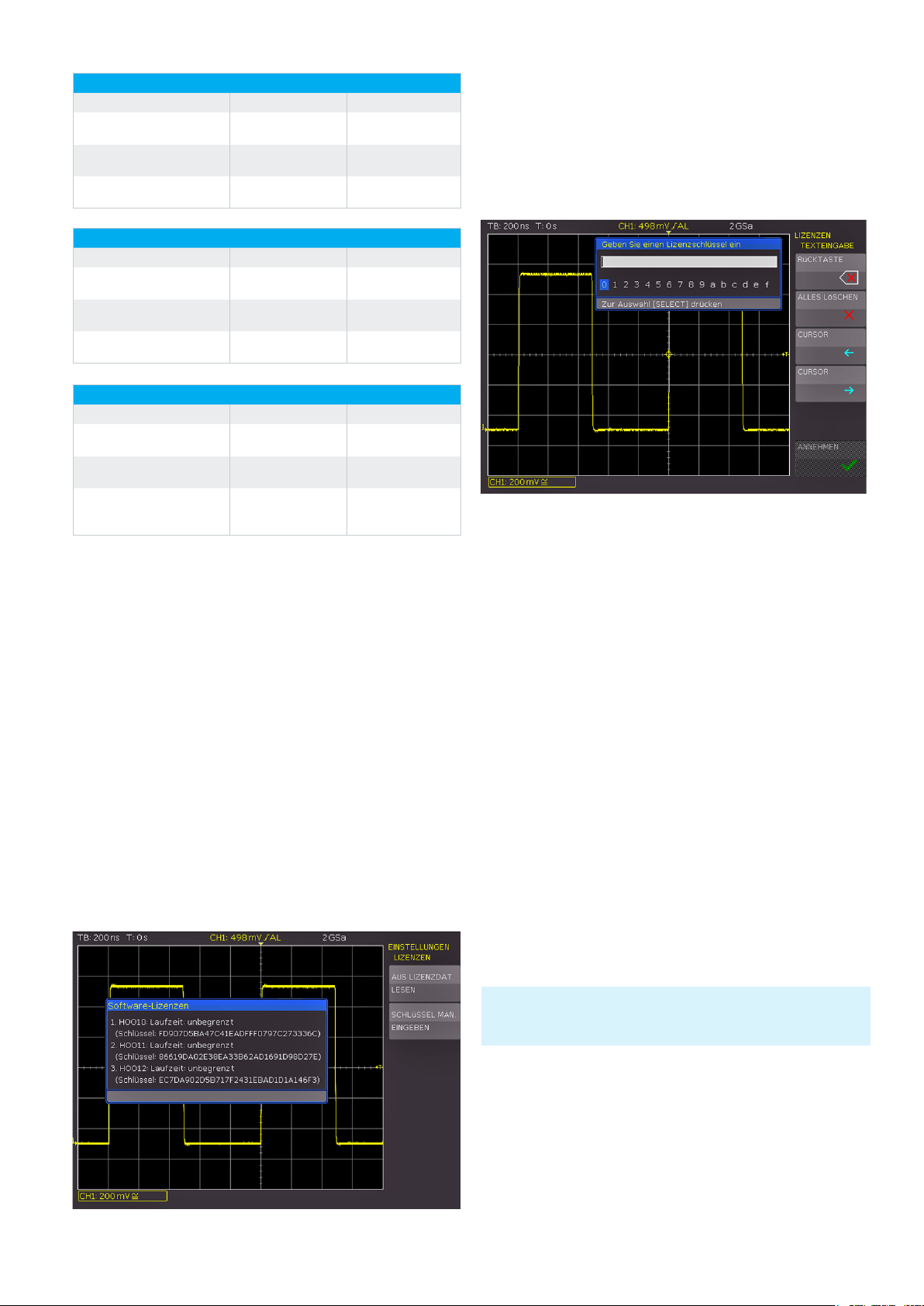
Einführung
Bandbreiten-Upgrades R&S®HMO1002 Serie
Beschreibung Optionen Voucher
Bandbreiten-Upgrade
50 MHz auf 70 MHz
Bandbreiten-Upgrade
50 MHz auf 100 MHz
Bandbreiten-Upgrade
70 MHz auf 100 MHz
R&S®HOO572 R&S®HV572
R&S®HOO512 R&S®HV512
R&S®HOO712 R&S®HV712
Bandbreiten-Upgrades R&S®HMO1202 Serie
Beschreibung Optionen Voucher
Bandbreiten-Upgrade
100 MHz auf 200 MHz
Bandbreiten-Upgrade
100 MHz auf 300 MHz
Bandbreiten-Upgrade
200 MHz auf 300 MHz
HOO312 R&S®HV312
HOO313 R&S®HV313
HOO323 R&S®HV323
Busanalyse Optionen
Beschreibung Optionen Voucher
2
C, SPI, UART/RS-232 auf
I
Analog- und Logikkanälen
2
C, SPI, UART/RS-232 auf
I
allen Analogkanälen
CAN und LIN auf Analogund Logikkanälen (nur
HMO1002, HMO1202)
Tab. 2.1: Übersicht Optionen/Voucher für R&S®HMO1002/HMO1202 Serie
1) nur bei Bestellung zusammen mit einem R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202
2) nachträgliche Freischaltung der R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202 Optionen
durch Upgrade Voucher
R&S®HOO10 R&S®HV110
R&S®HOO11 R&S®HV111
R&S®HOO12 R&S®HV112
Ein Lizenzschlüssel kann über die Homepage http://voucher.hameg.com nach Eingabe des Voucher-Code generiert („SERIENNUMMER.hlk“). Diese Datei ist eine ASCII
Datei und kann mit einem Editor geöffnet werden. Darin
kann der eigentliche Schlüssel im Klartext gelesen werden.
Um die gewünschte Option mit diesem Schlüssel im Gerät
freizuschalten gibt es zwei Verfahren: das automatisierte
Einlesen oder die manuelle Eingabe. Die schnellste und
einfachste Möglichkeit ist das automatisierte Einlesen über
einen USB Stick. Die Lizenzdatei wird auf einem USB Stick
gespeichert und anschließend über den FRONT-USBAnschluss in das Gerät geladen. Nach Betätigen der Taste
SETUP im GENERAL Bedienfeld des R&S®HMO öffnet sich
dasSETUP-Menü.AufSeite2|2bendetsichdasMenü
LIZENZEN. Die Softmenütaste AUS LIZENZDAT. LESEN
öffnet den Dateimanager. Mit dem Universaldrehgeber im
CURSOR/MENU Bedienfeld kann die entsprechende Lizenzdatei ausgewählt und anschließend mit der Softmenütaste LADEN geladen werden. Nun wird der Lizenzschlüssel geladen und die Option steht nach einem Neustart des
Gerätes umgehend zur Verfügung.
Abb. 2.5: manuelle Eingabe des Lizenzschlüssels
Alternativ kann der Lizenzschlüssel manuell eingegeben
werden. Dazu wird die Softmenütaste SCHLÜSSEL MAN.
EINGEBEN gewählt. Dies öffnet ein Eingabefenster, in dem
man mit dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU
Bedienfeld den Lizenzschlüssel manuell eingeben kann. Ist
der gesamte Schlüssel eingegeben, wird die Eingabe mit
der Softmenütaste ANNEHMEN übernehmen. Nach einem
Neustart des Gerätes ist die Option aktiviert.
Die R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202 Serie ist vorbereitet für den Mixed-Signal-Betrieb und verfügt an
der Vorderseite über den notwendigen Steckverbinder.
Dieser Stecker kann mit einem 8-Kanal-Logiktastkopf
(R&S®HO3508) verbunden werden.
2.8 Selbstabgleich
Die R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202 Serie verfügt
über einen integrierten Selbstabgleich, um die höchstmögliche Genauigkeit zu erzielen.Im allgemeinen Selbstabgleich werden die vertikale Ge-nauigkeit, der Offset, die
Zeitbasis sowie einige Triggereinstellungen justiert und die
ermittelten Korrekturwerte im Gerät abgespeichert.
Abb. 2.4: UPGRADE Menü
Das Gerät muss warmgelaufen sein (mind. 20 Minuten eingeschaltet) und alle Eingänge müssen „frei“ sein, d.h. angeschlossene Kabel oder Tastköpfe müssen entfernt werden.
ImMenüSETUPwirdaufSeite1|2mitderSoftmenütaste
SELBSTABGL. der Selbstabgleich durch Drücken der
Softmenütaste START gestartet. Die Abgleichprozedur
dauert etwa 5-10 Minuten, wobei die gerade durchgeführten Schritte dargestellt und der jeweilige Fortschritt über
Balken angezeigt werden.
11
Page 12

Einführung
Abb. 2.6: Erfolgreicher Selbstabgleich
Sollte beim Selbstabgleich ein Fehler auftreten, obwohl der Abgleich wie beschrieben durchgeführt wurde, so schicken Sie bitte
eine exportierte .log Datei (siehe Selbstabgleichmenü) an
customersupport@rohde-schwarz.com. Diese lässt sich auf einem
USB Stick speichern.
2.8.1 Selbstabgleich Logiktastkopf
Im Selbstabgleich für den optionalen Logiktastkopf
R&S®HO3508 werden vorrangig die Schaltpegel abgeglichen. Um den Selbstabgleich des Logiktastkopfes zu
starten, muss ein Logiktastkopf R&S®HO3508 an das
Oszilloskop angeschlossen sein. Allerdings dürfen die Bitleitungen nicht kontaktiert sein. Im Menü SETUP wird auf
Seite1|2imSelbstabgleichmenümitderSoftmenütaste
LOGIK PROBE der Selbstabgleich gestartet. Der Ablauf ist
ähnlich dem allgemeinen Geräteabgleich, dauert allerdings
nur einige Sekunden.
Softmenütaste EDUCATION MODE erneut betätigt und die
blaue Markierung erlischt.
2.10 Geräterückseite
AufderRückseitedesGerätesbendetsichdieEthernet-/
USB Schnittstelle, welche fest im Gerät installiert ist.
Optionale Schnittstellen sind nicht verfügbar.
Abb. 2.8: Geräterückseite
Abb. 2.7: Selbstabgleich Logiktastkopf
2.9 Education Mode
Der Education Mode bietet die Möglichkeit, die AUTOSET,
QUICK VIEW- und Auto-Messfunktionen zu deaktivieren.
Beim Aktivieren dieses Modus (Funktion blau markiert) erscheint ein Hinweisfenster auf dem Bildschirm. Zusätzlich
wird im Startbildschirm, in den Geräteinformationen und
auf einem Screenshot auf den aktivierten Education Mode
hingewiesen. Zum Deaktivieren dieses Modus wird die
12
Page 13

3 Schnelleinstieg
Im folgenden Kapitel werden Sie mit den wichtigsten
Funktionen und Einstellungen mit der R&S®HMO1002 bzw.
R&S®HMO1202 Serie vertraut gemacht, so dass Sie das
Gerät umgehend einsetzen können. Als Signalquelle wird
der eingebaute Adjust-Ausgang genutzt, so dass Sie keine
zusätzlichen Geräte für die ersten Schritte benötigen.
3.1 Aufstellen und Einschalten des Gerätes
Ergonomisch gut ist das Gerät aufgestellt, wenn die Füße
ausgeklappt sind, so dass das Display leicht nach oben
geneigt ist. Stecken Sie nun das Stromkabel in die Buchse
auf der Geräterückseite. Durch Drücken des Ein/Aus Schalters auf der Rückseite und ggfs. der Ruhezustandtaste 1
auf der Vorderseite schalten Sie das Gerät ein. Nach wenigen Sekunden erscheint die Anzeige und das Oszilloskop
ist messbereit. Halten Sie jetzt bitte die AUTOSET-Taste 15
gedrückt, bis ein Signalton ertönt. Dadurch setzen Sie die
wichtigsten Einstellungen des Oszilloskops auf die jeweiligen Standardeinstellungen zurück.
9
10
3
A
4
7
6
12 13
15
16
Schnelleinstieg
1 und verriegeln diesen durch Drehen nach rechts, bis er spürbar einrastet. Am rechten Bildschirmrand sehen Sie das Kurzmenü von CH1, mit dem Sie oft genutzte Einstellungen sofort
mit der jeweiligen Softmenütaste ändern können. Drücken Sie
einmal die oberste Softmenütaste, um die Eingangskopplung
auf DC umzuschalten.
Abb. 3.3: Bildschirm nach Umstellen auf DC Kopplung
Zum Abschluss drücken Sie einmal kurz die AUTOSETTaste 15. Nach wenigen Sekunden hat das Oszilloskop die
Verstärker-, Zeitbasis- und Triggereinstellungen automatisch vorgenommen. Sie sehen nun ein Rechtecksignal.
Abb. 3.1:
5
8
11
14
17
Bedienfeldabschnitt A
3.2 Anschluss eines Tastkopfes und Signal-
erfassung
Die passiven Tastköpfe sollten vor dem ersten Einsatz abgeglichen
werden. Die Vorgehensweise entnehmen Sie bitte den Tastkopfbeschreibungen. Legen Sie den Tastkopf dazu in die vorgesehene
Auage des ADJ.-Ausgangs.
Entnehmen Sie nun einen mitgelieferten Tastkopf und entfernen die Schutzkappe von der Spitze. Stecken Sie die Kompensationsbox des Tastkopfes auf den BNC Anschluss von Kanal
Abb. 3.2: Bildschirm nach Anschluss des Tastkopfes
Abb. 3.4: Bildschirm nach Autosetup
D
37
38
37
39
40
Abb. 3.5: Teil D des
Bedienfeldes mit Zoomtaste
41
42
43
44
3.3 Betrachten von Signaldetails
Mit dem Zeitbasisknopf 43
können Sie das aufgenommene Zeitfenster verändern.
Durch Drehen nach links vergrößern Sie die Zeitbasis. Drehen Sie den Zeitbasisknopf
solange nach links, bis Sie
links oben auf dem Bildschirm
„TB:5ms“ ablesen. Drücken
Sie jetzt die Taste ZOOM 40.
Sie erhalten eine ZweifensterDarstellung. Im oberen Fenster sehen Sie das gesamte
aufgenommene Signal, darun-
13
Page 14
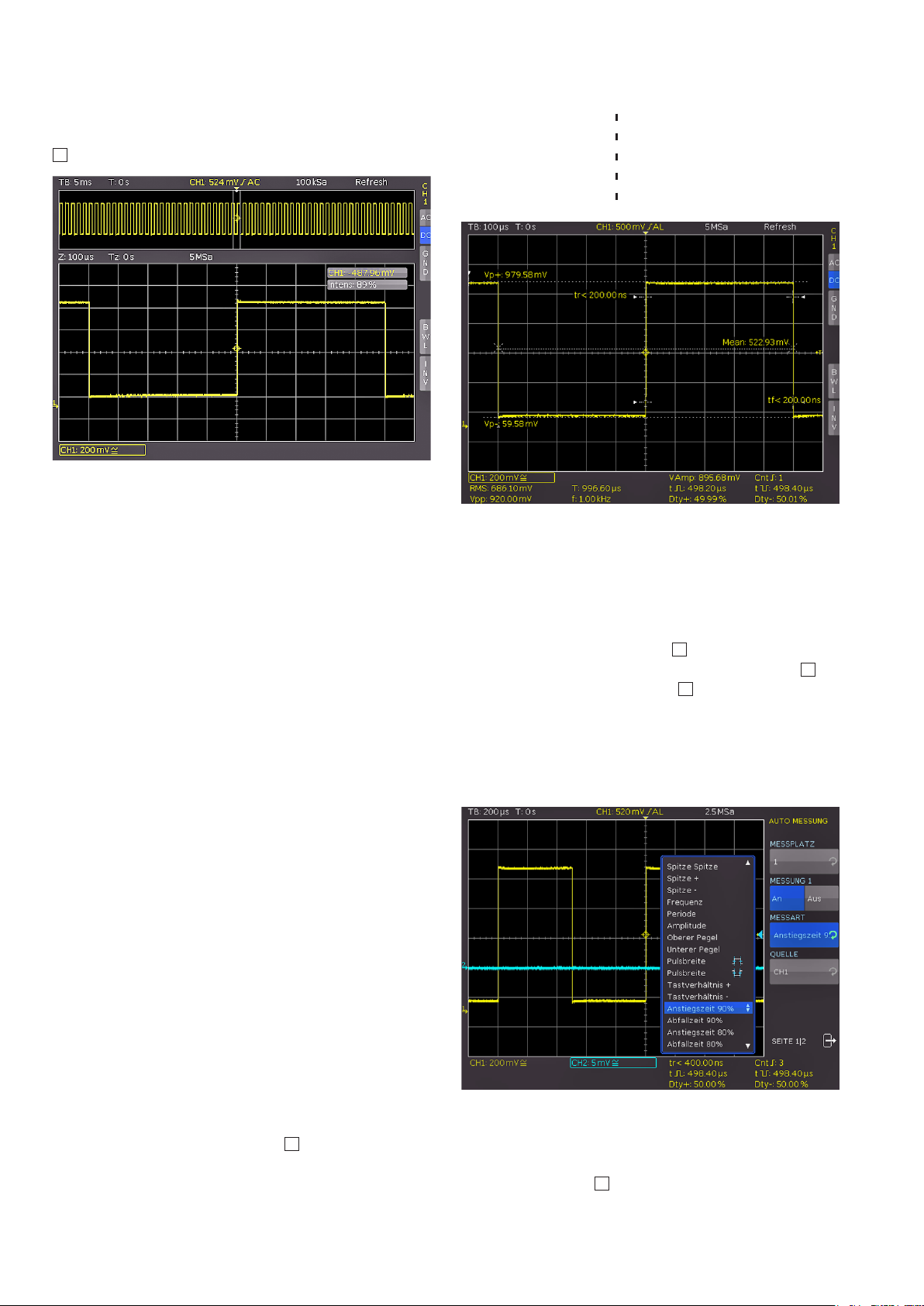
Schnelleinstieg
ter einen vergrößerten Ausschnitt. Mit dem Zeitbasisknopf
können Sie jetzt den Dehnungsfaktor einstellen und mit
dem kleinen Drehknopf die X-Position des Ausschnittes
justieren. Mit einem erneuten Druck auf die ZOOM-Taste
40
schalten Sie diesen Modus wieder aus.
Abb. 3.6: Zoomfunktion
3.4 Cursor-Messungen
Nachdem Sie das Signal auf dem Bildschirm dargestellt
und auch im Detail angesehen haben, soll es mit den
Cursors vermessen werden. Drücken Sie erneut kurz
die AUTOSET-Taste und anschließend die CURSOR/
MEASURE-Taste. Nun können Sie im geöffneten Menü
die Art des Messcursor auswählen. Dazu drücken Sie die
oberste Softmenütaste MESSART, um das entsprechende
Auswahlmenü zu öffnen. Mit dem Universaldrehgeber
im CURSOR/MENU Bedienfeld wählen Sie den Eintrag
V-MARKER. Schließen Sie das Menü mit der MENU
OFF-Taste. Jetzt werden zwei Cursors im Signal sowie
die Messergebnisse angezeigt. Wählen Sie den aktiven
Cursor mit Druck auf den Universaldrehgeber aus und positionieren ihn. Die Messwerte der Cursors können Sie im
Bild unten rechts entnehmen. Dort werden im gewählten
Fall des V-Marker die Spannungen an beiden Cursorpositionen, deren Differenz, sowie die zeitliche Differenz der
Cursorpositionen angezeigt. Das Ausschalten der Cursors
erfolgt durch erneutem Druck auf die CURSOR MEASURE
Taste.
Unter dem Messgitter werden 10 weitere Parameter
angezeigt:
❙ RMS, Spitze-Spitze Spannung,
❙ Frequenz, Periodendauer,
❙ Amplitude, Anzahl steigender Flanken
❙ pos. Pulsbreite, neg. Pulsbreite,
❙ pos. Tastverhältnis, neg. Tastverhältnis,
Abb. 3.7: Quickview Parametermessung
Somit haben Sie mit einem Tastendruck alle verfügbaren
Parameter im Blick, die das Signal charakterisieren. Diese
Funktion wird immer auf den gerade aktiven Anzeigekanal
angewendet. Sie können auch Parameter von unterschiedlichen Kurven anzeigen. Dazu schalten Sie durch erneuten
Druck auf die Taste QUICKVIEW 10 diesen Modus wieder
aus, schalten den CH2 durch Drücken der Taste CH2 23 ein
und öffnen das AUTO MEASURE 11 Menü: Die Softmenütaste MESSPLATZ öffnet eine Liste und sie können mit
dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld
den entsprechenden Messplatz auswählen. Die Parameter
werdenuntenimBildschirmangezeigtundkönnendeniert werden.
3.5 Automatische Messungen
Neben den Cursor-Messungen sind die wichtigsten Kennwerte einer Signalkurve durch automatische Messungen
darstellbar. Ihr Oszilloskop bietet Ihnen zwei Möglichkeiten:
❙ dieDenitionderDarstellungvon6Parameternauchaus
unterschiedlichen Quellen,
❙ die schnelle Darstellung aller wichtigen Parameter
innerhalb einer Quelle mit der QUICK VIEW-Funktion.
Bitte ändern Sie die Zeitbasis auf 100 µs pro Skalenteil und
drücken dann die Taste QuickView 10. Die wichtigsten Parameter werden eingeblendet:
❙ positive und negative Spitzenspannung,
❙ Anstiegs- und Abfallzeit,
❙ Mittelwert.
14
Abb. 3.8: Parameterauswahl
Nachdem Sie mit der entsprechenden Softmenütaste
einen Parameter ausgewählt haben, nutzen Sie den
Universaldrehgeber 4 im CURSOR/MENU Bedienfeld, um
die Auswahl vorzunehmen. Dieses Verfahren wird in allen
Softmenüs, in denen Auswahlmöglichkeiten existieren, an-
Page 15
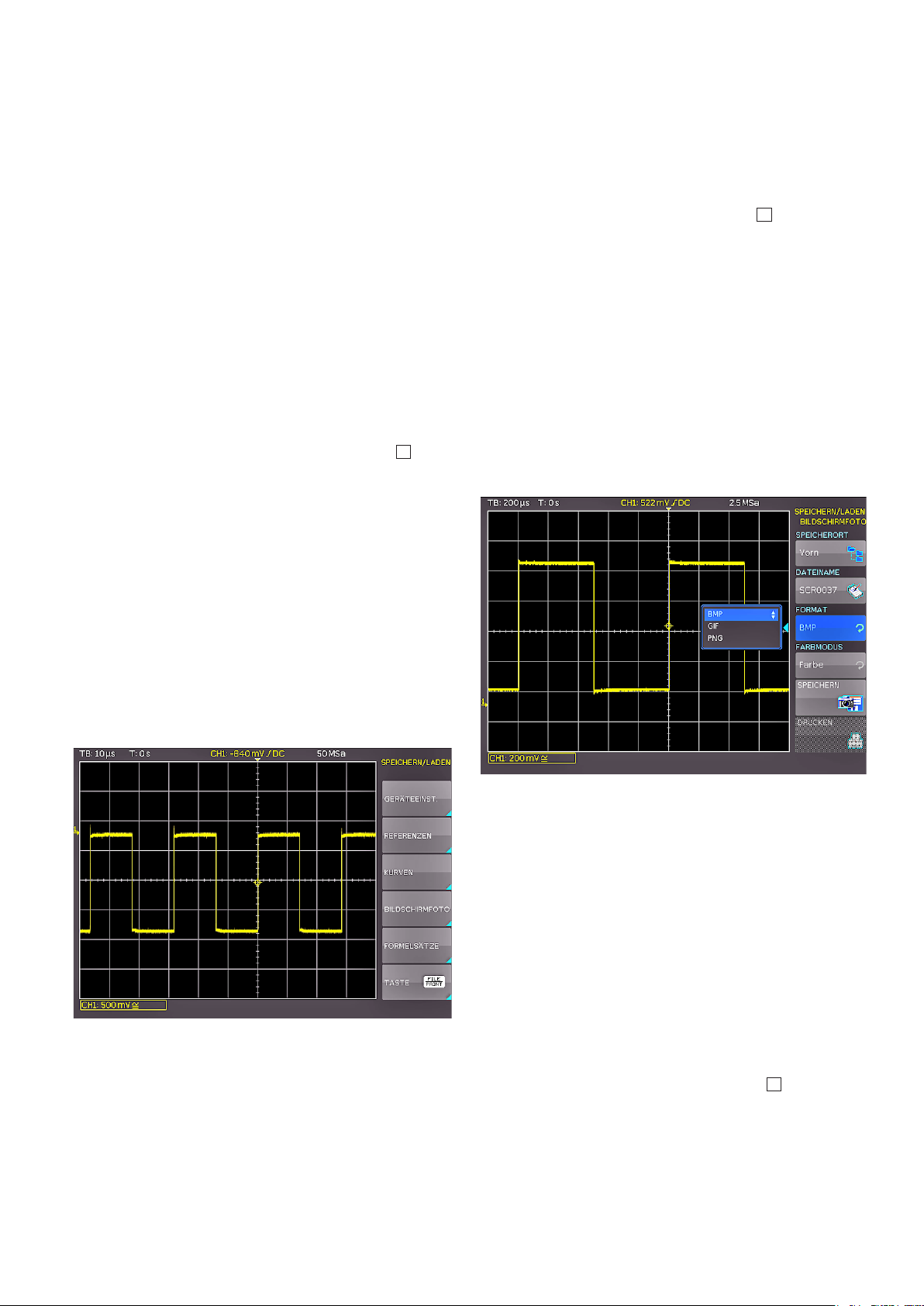
Schnelleinstieg
gewendet. In diesem Beispiel drücken Sie die Softmenütaste MESSART und wählen mit dem Universaldrehgeber
als Parameter die Anstiegszeit.
Drücken Sie jetzt die Taste CH2 im VERTICAL Bedienfeld
und schalten damit den Kanal 2 ein. Gehen Sie durch
DrückenderTasteAUTOMEASUREindasDenitionsmenü zurück. Wählen Sie Messplatz 1, Messart Mean und
Quelle CH1. Nun wählen Sie mit der oberen Softmenütaste
MESSPLATZdenzweitenMessplatz.Diesendenieren
Sie jetzt wie zuvor als RMS-Wert der Spannung von CH2.
Nach dem Schließen des Menüs kann man die Parameter
eindeutig zuordnen, da sie in der Farbe des Quellsignales (hier gelb für Kanal 1 und blau für Kanal 2) dargestellt
werden.
3.6 Mathematikeinstellungen
Neben den Cursor- und automatischen Messungen können auch mathematische Operationen auf die Signale angewandt werden. Der Druck auf die Taste MATH 26 öffnet
ein Kurzmenü, mit dem man eine Addition, Subtraktion,
Multiplikation oder Division zweier analoger Kanäle vornehmen kann und schaltet die Anzeige der Mathematikkurve ein. Die oberste Softmenütaste ermöglicht dabei die
Auswahl des einen Operanden, die darunterliegende wählt
den Operator und die darunterliegende Softmenütaste den
zweiten Operanden aus. Für die Operanden sind nur die
Kanäle verfügbar, die auch eingeschaltet sind und damit
angezeigt werden. Es müssen die entsprechend in der
Funktion gewählten Quellen eingeschaltet sein, damit die
Mathematikkurve berechnet und die Ergebniskurve angezeigt werden kann.
speichern. Alle anderen Einstellungen lassen sich sowohl
aufeinemUSB-Stick,alsauchinternineinemnichtflüchtigen Speicher im Gerät ablegen. Um die gewünschten
Daten speichern zu können, müssen Sie die Art und das
Speicherziel festlegen. Verbinden Sie zunächst einen USBStick mit dem vorderen USB-Anschluss Ihres Oszilloskops.
Drücken Sie nun die Taste SAVE/RECALL 12, um das
entsprechende Menü zu öffnen. Wählen Sie nun die gewünschte Speicherart durch Drücken der entsprechenden
Softmenütaste (in unserem Beispiel Bildschirmfoto), um
in das Einstellungsmenü zu gelangen. Achten Sie darauf,
dass im obersten Menü der Speicherort VORN ausgewählt ist (durch Druck auf die Softmenütaste öffnet sich
ein Menü, in welchem Sie diese Einstellung vornehmen
können). Dazu muss ein USB-Stick mit dem vorderen USBAnschluss Ihres Oszilloskops verbunden und vom Gerät
erkannt worden sein. Durch Drücken der Softmenütaste
SPEICHERN können Sie nun ein Bildschirmfoto mit dem
voreingestellten Namen abspeichern (den aktuellen Dateinamen sehen Sie in dem Menüeintrag DATEINAME).
3.7 Daten abspeichern
Abb. 3.9: Speichern und Laden Menü
Die R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202 Serie kann 4 verschiedene Arten von Daten abspeichern:
❙ Geräteeinstellungen
❙ Referenzsignale
❙ Kurven
❙ Bildschirmfotos
Abb. 3.10: Bildschirmfoto Einstellungsmenü
Sie können der Zieldatei auch einen Namen mit maximal 8
Buchstaben vorgeben. Dazu wählen Sie den Menüpunkt
DATEINAME und geben mit Hilfe des Universaldrehgebers
den Namen vor (in unserem Beispiel „TRC“). Nach dem
Betätigen der Softmenütaste ANNEHMEN übernimmt das
Oszilloskop den Namen und kehrt in das Einstellungsmenü
zurück. Dort können Sie sofort das aktuelle Bild abspeichern, indem Sie die Softmenütaste SPEICHERN drücken.
Sie können auch im Menü eine Ebene zurückgehen (mit
der untersten Menu OFF-Taste) und dort den Menüpunkt
TASTE FILE PRINT wählen. Im folgenden Menü drücken
Sie die Softmenütaste BILDSCHIRMFOTO und weisen damit die Funktion Bildschirmausdruck mit den vorgenommenen Einstellungen der Taste FILE/PRINT 17 zu. Nun sind
Sie in der Lage, zu jedem Zeitpunkt und aus jedem Menü
heraus einen Bildschirmausdruck auf dem USB-Stick
durch Drücken der FILE/PRINT Taste zu generieren.
Von diesen Datenarten lassen sich nur Kurven und Bildschirmfotos auf einem angeschlossenen USB-Stick ab-
15
Page 16

Vertikalsystem
4 Vertikalsystem
B
18
19
20
21
Abb. 4.1: Bedienfeld B des
Vertikalsystems
Bildschirm umrandet und heller dargestellt. Das jeweilige
Kurzmenü ist immer sichtbar, das erweiterte Menü wird
durch Druck auf die Taste MENU 21 geöffnet.
Abb. 4.2: Kurzmenü für vertikale Einstellung
4.1 Kopplung
Der Eingangswiderstand der analogen Eingänge be-
trägt1MΩoder50ΩbeiderR&S®HMO1202Serie.Die
R&S®HMO1002Seriebesitztkeine50ΩEingänge.
Die 50 Ω Eingänge dürfen nicht mit Effektivspannungen größer
5 Volt beaufschlagt werden!
Die50Ω-Eingängesolltennurverwendetwerden,wenn
ineiner50Ω-Umgebunggemessenwird,alsoz.B.ein
Generatormit50Ω-Ausgangsimpedanzangeschlossen
wurde und das Oszilloskop am Ende des Signalpfades den
Leitungsabschluss darstellt. In allen anderen Einsatzfällen
wird die Kopplungmit1MΩEingangswiderstand gewählt.
Hierbei wird unterschieden, ob der Eingang DC gekoppelt, also die im Signal enthaltene Gleichspannung mit
angezeigt wird, oder AC gekoppelt ist. Bei AC-Kopplung
unterdrückteinEingangsltervon2HzdieAnzeigevon
Für die vertikalen Einstellungen stehen die Drehgeber für
Y-Position und Verstärker-
22
einstellungen, ein ständig
eingeblendetes Kurzmenü
23
sowie ein erweitertes Menü
zur Verfügung.
24
Die Einstellungen des jewei-
25
ligen Kanals werden mittels
Kanaltaste (CH1, CH2) vorge-
26
nommen. Die Aktivierung der
27
Kanaltaste wird durch das
Leuchten einer farbigen LED
gekennzeichnet. Zusätzlich
wird die Kanalbezeichnung
des aktivierten Kanales im
Gleichspannungen.Andie1MΩEingängedürfenSignale
mit bis zu 200 V (Spitzenwert) direkt angeschlossen werden. Höhere Spannungen sind über externe Tastköpfe
(bis zu 40 kV Spitzenspannung) messbar, diese sollten
nur mit DC Kopplung verwendet werden. In den allgemein üblichen Anwendungen werden die mitgelieferten
Tastköpfe angeschlossen. Bei der R&S®HMO1002 Serie
sind die Tastköpfe HZ154 im Lieferumfang enthalten, die
1:1/10:1 umschaltbar sind. Das entsprechende Teilerverhältnis wird im jeweiligen Kanalmenü eingestellt. Bei der
R&S®HMO1202 Serie sind die Tastköpfe RT-ZP03 im Lieferumfang enthalten.
Für die Einstellung der Kopplung steht das Kurzmenü
oder das Kanalmenü zur Verfügung, in welchem mit einfachem Tastendruck auf die entsprechende Softmenütaste
die Kopplung eingestellt werden kann. Das Menü gilt
jeweils für den aktiven Kanal. Welcher Kanal aktiv ist,
zeigt die beleuchtete Kanaltaste. Die Kanalbezeichnung
des aktiven Kanals wird oben im Kurzmenü angezeigt.
Das Umschalten erfolgt durch Drücken der gewünschten
Kanaltaste.
4.2 Verstärkung, Y-Position und Offset
Die Verstärkung der analogen Eingänge kann mit dem
großen Drehgeber (VOLTS/DIV) im VERTICAL-Bereich
des Bedienfeldes in 1-2-5 Schritten von 1mV/Skalenteil
bis 10V/Skalenteil eingestellt werden. Hier gilt der Drehgeber für den gerade aktiven Kanal, der durch Drücken
der Kanaltaste gewählt wird. Eine Umschaltung auf eine
stufenlose Verstärkereinstellung erfolgt durch einmaliges
Drücken des Drehgeberes. Mit dem kleineren Drehgeber
(POSITION) im VERTICAL-Bereich des Bedienfeldes kann
die Y-Position des aktiven Kanal eingestellt werden. Durch
Drücken der MENU Taste werden erweiterte Funktio-
nenaufgerufen.AufSeite2|2diesesMenüskannein
ZEIT-OFFSET mit dem Universaldrehgeber oder mittels
KEYPAD Taste im CURSOR/MENU Bedienfeld eingestellt
werden. Mit der Softmenütaste ZEIT-OFFSET kann jeder
Analogkanal zeitlich verschoben werden (±32 ns). Diese
Einstellung dient dem Ausgleich von Laufzeitunterschieden bei der Nutzung unterschiedlich langer Kabel oder
Tastköpfe.
4.3 Bandbreitenbegrenzung und Invertierung
Im Kurz- und erweiterten Menü kann ein analoger 20 MHz
TiefpasslterindenSignalpfadeingefügtwerden.Damit
werden alle höherfrequenten Störungen eliminiert. Die
Einschaltung im Kurzmenü erfolgt durch Druck auf die
Softmenütaste BWL. Im erweiterten Menü (Taste Menu)
wird der Filter über die Softmenütaste BANDBREITE aktiviert. Ist der Filter aktiviert, so wird der Menüeintrag blau
unterlegt und im Kanalbezeichnungsfenster erscheint ein
BW. Eine Invertierung der Signalanzeige kann ebenfalls im
Kurz- und erweiterten Menü vorgenommen werden. Ist
die Signalinvertierung aktiviert, so wird die Softmenütaste
INV oder der Menüeintrag INVERTIEREN blau unterlegt.
Im Kanalbezeichnungsfenster erscheint ein Strich oberhalb
des Kanalnamens.
16
Page 17

Vertikalsystem
4.4 Tastkopfdämpfung und Einheitenwahl
(Volt/Ampere)
Die R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202 Serie verfügt
nicht über eine automatische Tastkopf-Teilererkennung.
Die Teilung wird über die MENU Taste mit dem Softmenü
TASTKOPFeingestellt.DiesistinvordeniertenSchritten
x1,x10,x100,x1000,sowiebenutzerdeniertüberdieSoft-
menütaste NUTZER und dem Universaldrehgeber bzw. der
KEYPAD Taste im CURSOR/MENU Bedienfeld von x0.001
bis x1000 frei wählbar.
Wird eine Stromzange angeschlossen, so kann mittels
Softmenütaste EINHEIT die Einheit Ampere (A) gewählt
werden. Wird die Einheit A gewählt, so werden die am
meisten genutzten Umrechnungsfaktoren im Menü wählbar (1V/A, 100mV/A, 10mV/A, 1mV/A). Auch hier kann ein
benutzerdenierterWertüberdieSoftmenütasteNUTZER
mit dem Universaldrehgeber oder der KEYPAD Taste im
CURSOR/MENU Bedienfeld gewählt werden. Selbstverständlich kann diese Einstellung auch angewendet werden, wenn ein Strom über einem Shunt gemessen wird.
In diesem Fall erfolgen alle Messungen in der richtigen
Einheit und werden korrekt skaliert.
4.4.1 Tastkopfabgleich
geschlossenen Tastköpfen kann mit der Softmenütaste
NÄCHSTER KANAL der Kanal gewechselt werden. Mit
VERLASSEN kann nach dem erfolgreichen Tastkopfabgleich der Wizard verlassen werden. Ist ein manueller Abgleich ohne Abgleich-Wizard gewünscht, so kann dieser
über das UTIL Menü im VERTICAL Bedienfeld mit der Softmenütaste MUSTERGEN. über das Softmenü RECHTECK
erfolgen (siehe Kap. 10.2.1).
4.5 Schwellwerteinstellung
AufSeite2|2deserweitertenMenüs(MENU)istesebenfalls möglich, einen Schwellwert einzustellen. Dieser legt
fest, welcher Pegel für die Erkennung von High und Low
bei Nutzung der analogen Kanäle als Quelle für die serielle
Busanalyse oder den Logiktrigger gilt. Nachdem dieser
Softmenüeintrag angewählt wurde, kann der Schwellwert mit dem Universaldrehgeber oder mittels KEYPAD
Taste im CURSOR/MENU Bedienfeld eingestellt werden.
Mit dem Softmenü HYSTERESIS kann die obere bzw.
untere Grenze des Schwellwerts vergrößert (GROß) oder
verkleinert (KLEIN) werden. Alle Signale, die sich nun in
diesem „Schwellwert-Band“benden,werdensomitkorrekt erfasst. Mittels Softmenütaste PEGEL FINDEN wird
das entsprechende Signal analysiert und der Schwellwert
automatisch gesetzt.
Passive Tastköpfe sollten vor dem ersten Einsatz bzw. nach einer
längeren Messpause, Gerätewechsel oder auch Kanalwechsel
abgeglichen werden.
Der Tastkopfabgleich kann entweder über den AbgleichWizard oder manuell erfolgen. Über die SETUP Taste im
GENERAL Bedienfeld kann mit der Softmenütaste TKAbgleich der Wizard geöffnet werden. Dieser AbgleichWizard führt durch alle wichtigen Punkte des Tastkopfabgleichs. Nach Anschluss eines Tastkopfes kann mit der
Softmenütaste KANAL 1 (CH1) oder KANAL 2 (CH2) der
jeweilige Analogkanal ausgewählt werden. Mit dem beiliegenden Tastkopf-Trimmstift können die Tastkopf-Trimmer
auf eine optimale Rechteckwiedergabe eingestellt werden.
4.6 Name für einen Kanal
Mit dem Softmenü NAME kann ein Kanalname vergeben
werden. Dieser wird im Messgitter angezeigt und auch
ausgedruckt. Der Kanalname kann mit der Softmenütaste
NAME an- (AN) bzw. ausgeschaltet werden (AUS). Ist
der Name aktiviert, so erscheint dieser rechts neben der
Kanalanzeige. Mit der Softmenütaste BIBLIOTHEK kön-
nenvordenierteNamenausgewähltwerdenundmittels
NAME EDITIEREN angepasst werden. Maximal sind 8 Zeichen erlaubt. Mit der Taste ANNEHMEN wird der Name im
Editor bestätigt und somit auf dem Bildschirm angezeigt.
Der Name ist an das Signal gebunden und wandert mit
einem evtl. eingestellten Offset entsprechend mit.
Abb. 4.3: Tastkopf Wizard
Der Abgleich erfolgt bei 1 kHz (LF) und 1 MHz (HF). Mit
der Softmenütaste GANZER BILDSCH. können die Wizard
Hilfetexte ausgeblendet werden. Mit WEITER wechselt
der Wizard in den 1 MHz HF Abgleich. Bei mehreren an-
Abb. 4.4: Namensvergabe
17
Page 18

Horizontalsystem
werden.DesweiterenbendetsichhierdieEinstellungder
5 Horizontalsystem
D
37
38
37
39
40
Abb. 5.1: Bedienfeld D des
Horizontalsystems
eine separate Taste. Für die Markerfunktionen werden die
Pfeiltasten 37 sowie die SET/CLR Taste genutzt.
5.1 Erfassungsbetriebsart RUN und STOP
Die Betriebsart der Erfassung lässt sich mit der RUN/STOP
Taste 39 einfach umschalten. In der Betriebsart RUN werden je nach eingestellten Triggerbedingungen Signale auf
dem Bildschirm angezeigt und bei jeder neuen Erfassung
die Alten verworfen. Wenn ein aufgenommenes Signal
auf dem Bildschirm analysiert, aber nicht überschrieben
werden soll, muss die Erfassung mit der RUN/STOP-Taste
angehalten werden. Im STOP-Modus wird keine neue Signalerfassung zugelassen und die Taste leuchtet rot.
5.2 Zeitbasiseinstellungen
Die Umstellung der Zeitbasis erfolgt mit dem großen
TIME/DIV Drehgeber im HORIZONTAL Bedienfeld. Links
oben im Display, oberhalb des Anzeigegitters, wird die
jeweils aktuelle Zeitbasiseinstellung angezeigt (z.B. „TB:
500 ns“). Rechts daneben erfolgt die Anzeige der Triggerzeitposition – bezogen auf die Normaleinstellung. In der
Normaleinstellung ist der Triggerzeitpunkt in der Mitte der
Anzeige, d. h. 50% Vor- und 50% Nachlauf. Mit dem X-Position-Drehgeber 41 kann dieser Wert stufenlos eingestellt
werden. Die zulässigen Maximalwerte sind zeitbasisabhängig. Unabhängig von der gewählten Einstellung wird durch
Drücken der Taste SET/CLR der Wert wieder auf den Bezugszeitpunkt zurückgesetzt, wenn die Marker- oder Suchfunktion nicht aktiviert wurde. Die Pfeiltasten 37 verändern die X-Position fest um 5 Skalenteile in die jeweilige
Richtung. Mit der Taste MENU 42 wird ein Menü geöffnet,
in dem die Funktion der Pfeiltasten 37 und der SET/
CLR-Taste bestimmt werden kann. Wie oben beschrieben,
können diese Tasten zur Einstellung der X-Position, zur
Markierung von Ereignissen im Signal oder zur Navigation
zwischen den maximal 8 Markierungen genutzt werden.
Im Untermenü NUMER.EINGABE kann eine beliebige
X-Position direkt eingeben kann. Zusätzlich können in diesem Menü auch Suchfunktionen aktiviert und eingestellt
Der Bereich des Horizontalsystems umfasst neben der
Zeitbasiseinstellung für die
Erfassung, der Positionie-
41
rung des Triggerzeitpunktes,
der Zoomfunktionen, der
42
möglichen Erfassungsmodi
und den Markerfunktionen
auch die Suchfunktionen. Die
Einstellung der Zeitbasis und
43
des Triggerzeitpunktes erfolgen über die entsprechenden
44
Drehgeber, die Auswahl der
Erfassungsmodi über ein entsprechendes Menü. Um den
ZOOM einzuschalten gibt es
TRIGGERREF.-ZEIT (Position für den Bezug des Triggerzeitpunktes von –6 Skalenteile bis +6 Skalenteile, 0 ist die
Mitte und Standard).
5.3 Erfassungsmodi
Die Wahl der Erfassungsmodi erfolgt durch Drücken
der Taste ACQUIRE 44. Dies öffnet ein Menü, in dem die
grundlegenden Modi der Einzelerfassung eingestellt werden können.
5.3.1 Rollen
Diese Erfassungsart ist speziell für sehr langsame Signale,
das Signal „rollt“ von rechts nach links ungetriggert über
den Bildschirm (setzt Signale langsamer als 200 kHz voraus). Die R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202 Serie verwendet zum Speichern der Kurvenwerte im Rollen-Modus
einen Ringspeicher. Das heißt, vereinfacht gesprochen,
dass das Gerät die erste Division in den ersten Speicherplatz schreibt, die zweite Division in den zweiten usw..
Sobald der Speicher voll ist, überschreibt das Gerät den
ersten Speicherplatz mit den Daten des aktuellsten Messwerts. So entsteht der „Ring“ bzw. der Durchlaufeffekt,
ähnlich wie bei einer Laufschrift.
5.3.2 Arithmetik
Das Softmenü ARITHMETIK bietet verschiedene
Auswahlmöglichkeiten:
❙ NORMAL:
❙ HÜLLKURVE:
❙ MITTELWERT:
❙ GLÄTTUNG:
❙ FILTER:
Die ZOOM-Funktion ist im Rollen-Modus nicht verfügbar (siehe
auch Kap. 5.5 ZOOM-Funktion).
Hier erfolgt die Erfassung und Darstellung der aktuellen
Signale.
Hierbei werden neben der normalen Erfassung jedes
Signales auch die Maximal- und Minimalwerte jeder
Erfassung dargestellt. Damit entsteht über die Zeit eine
Hüllkurve um das Signal.
Wird dieser Modus gewählt, kann man mit dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld die Anzahl der
Mittelwertbildungen in Zweierpotenzen von 2 bis 1024
einstellen (setzt sich wiederholende Signale voraus).
Die Funktion GLÄTTUNG berechnet einen Mittelwert aus
mehreren benachbarten Abtastpunkten. Das Ergebnis ist
eine geglättete Wellenform. Diese Funktion wird für
nichtperiodische Signale verwendet.
Dieser Modus ermöglicht es, durch einen Tiefpasslter
mit einstellbarer Grenzfrequenz unerwünschte hochfrequente Störungen zu unterdrücken. Die Grenzfrequenz
kann in Abhängigkeit der Abtastrate eingestellt werden.
Der kleinste Wert ist 1/100 der Abtastrate, der größte
Wert ist 1/4 der Abtastrate. Die Einstellung kann mit dem
Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld
vorgenommen werden.
18
Page 19

Horizontalsystem
5.3.3 Spitzenwert
Wird bei sehr großen Zeitbasiseinstellungen eingesetzt,
um auch kurze Signaländerungen noch erkennen zu
können. Diese Funktion kann ausgeschaltet (AUS) oder
in einen automatischen Zuschaltmodus (AUTO) gebracht
werden. Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, damit
die Betriebsart SPITZENWERT aktiviert werden kann:
❙ Funktion HOCHAUFLÖSEND deaktiviert
❙ keine seriellen oder parallelen Busse aktiv
Bei der Spitzenwerterfassung unterscheidet das Oszilloskop zwischen Erfassungsspitzenwerterfassung und
Speicherspitzenwerterfassung.
❙ Erfassungsspitzenwerterfassung:
Auch wenn nicht mit voller Abtastrate in den
Erfassungsspeicher geschrieben wird, z.B. bei langsamen
Zeitbasen, wandelt jeder ADC mit voller Abtastrate (kein
Interlace-Betrieb). Die nicht benutzten Wandlerwerte
werden bei eingeschalteter Spitzenwerterfassung zum
Detektieren von minimalen und maximalen Amplituden
bewertet. Dabei werden die so ermittelten Minima und
Maxima mit einem Abtastintervall in den Erfassungsspeicher geschrieben. Im Erfassungsspeicher stehen somit
Datenpärchen, die den Signalverlauf im Abtastintervall
repräsentieren. Der kleinste erkennbare Impuls ist die
Periodendauer der maximalen Abtastrate (kein
Interlace-Betrieb).
❙ Speicherspitzenwerterfassung:
Wird mit maximaler Abtastrate des ADC‘s in den
Erfassungsspeicher geschrieben, ist eine hardwareseitige
Spitzenwerterkennung nicht möglich. Bei langsamen
Zeitbasen und einer eingestellten Wiederhohlrate von
AUTOMATIK oder maximaler Wiederholrate (MAX.
WDH.-RATE) werden nicht alle im Erfassungsspeicher
stehenden Daten auf dem Bildschirm angezeigt. Die
übersprungenen Daten werden bei eingeschalteter
Spitzenwerterkennung während des Auslesens zur
Bildung eines Minimum- und eines Maximumwertes
herangezogen. Der kleinste erkennbare Impuls ist die
Periodendauer der Abtastrate, mit der in den
Erfassungsspeicher geschrieben wurde.
kleineren als der maximale Abtastrate möglich. Ist die Betriebsart HOCHAUFLÖSEND eingeschaltet und die aktuelle
Geräteeinstellung ermöglicht deren Anwendung, so wird
dies durch „HR“ vor der Erfassungsbetriebsart rechts oben
im Display gekennzeichnet. Folgende Bedingungen müssen erfüllt sein, damit die Betriebsart HOCHAUFLÖSEND
aktiviert werden kann:
❙ Abtastrate kleiner als die maximale Abtastrate (kein
Interlace-Betrieb)
❙ Spitzenwerterkennung deaktiviert
❙ kein Logikpod aktiv
❙ keine seriellen oder parallelen Busse aktiv
Alle genannten Funktionen sind standardmäßig
deaktiviert.
5.3.5 Interpolation
Die Softmenütaste INTERPOLATION ermöglicht die
Auswahl von SIN X/X, LINEAR oder SAMPLE-HOLD als
mögliche Interpolation bei der Darstellung der Erfassungspunkte. Die SIN X/X Interpolation ist die Standardeinstellung und am besten für die Darstellung analoger Signale
geeignet. Bei der linearen Interpolation (LINEAR) werden
die erfassten Datenpunkte mit einer Linie verbunden. Die
Darstellung SAMPLE-HOLD erlaubt eine genauere Beurteilung der Lage der Signalerfassungspunkte.
5.3.6 Aufnahmemodus
Folgenden Auswahlfunktionen stehen zur Verfügung:
5.3.6.1 MAX. WDH.-RATE
Kommt eine der beiden Spitzenwerterfassungsarten oder
die Kombination aus Beiden zur Anwendung, so wird dies
durch „PD“ vor der Erfassungsbetriebsart rechts oben im
Display gekennzeichnet.
5.3.4Hochauösend
In diesem Modus wird mit einen Boxcar Averaging über
benachbarte Erfassungspunkte (der Wandler läuft mit der
maximalen Abtastrate)dievertikaleAuflösungaufbiszu
16 Bit erhöht. Diese Funktion kann ausgeschaltet (AUS)
oder in einen automatischen Zuschaltmodus (AUTO) gebracht werden. Durch eine Mittelwertbildung mehrerer
benachbarter Abtastwerte entsteht ein Wert mit einer
höheren Genauigkeit als die Eingangsdaten.Die so entstandenenDatenbezeichnetmanalsDatenmithoherAuflösung. Durch das Zusammenführen mehrerer Abtastwerte
zu einem neuen Wert, ist dieses Verfahren nur mit einer
Abb. 5.2: AM moduliertes Signal mit maximaler Wiederholrate
Damit wird die Wahl der Speichertiefe und Abtastrate so
getroffen, dass eine höchstmögliche Triggerwiederholrate
erzielt wird. Bei der Funktion maximaler Wiederholrate
wird das Oszilloskop so eingestellt, dass eine maximale
Anzahl von Erfassungen pro Sekunde im Kurvenfenster
abgebildet werden kann. Die angezeigte Datenanzahl beträgt pro Bildspalte im Kurvenfenster ein erfasstes Datum.
Bei aktivierter Spitzenwerterfassung wird pro Bildspalte
ein Min/Max-Paar abgebildet. Bei der R&S®HMO1002 bzw.
R&S®HMO1202 Serie ist das Kurvenfenster 600x480 Pixel
groß (Yt ohne Zoom). Somit werden 600 Datenpunkte pro
Erfassung angezeigt. Bei aktivierter Spitzenwerterfassung
19
Page 20

Horizontalsystem
sind es 600 Min/Max-Paare und somit 1200 Daten. Die
Speichertiefe ist mindestens das abgebildete Zeitfenster
(Zeitbasis x Kurvenfensterrasterteile in X-Richtung) multipliziert mit der aktuellen Abtastrate. Die untere Grenze
wird durch die maximale Abtastrate und durch die maximale Kurvenwiederholrate des Oszilloskops bestimmt. Die
angezeigte Abtastrate entspricht der aktuellen Abtastrate
dividiert durch die Anzahl der beim Auslesen aus dem
Erfassungsspeicher übersprungenen Daten. Bei aktivierter
Spitzenwerterfassung entspricht die angezeigte Abtastrate
der aktuellen Abtastrate.
5.3.6.2 MAX. ABTASTRATE
maximalen Erfassungsspeicher. Die angezeigte Abtastrate
entspricht der aktuellen Abtastrate.Bendensichimabgebildeten Zeitfenster mehr als 40x Kurvenfensterbildspalten Daten im Erfassungsspeicher oder Min/Max-Daten
im Erfassungsspeicher, so wird die Spitzenwerterfassung
angewandt.
Der gesamte Speicher des Oszilloskops kann nur im STOP Modus
und aktivierter maximaler Abtastrate ausgelesen werden.
5.3.6.3 AUTOMATIK (Standardeinstellung)
Abb. 5.4: AM moduliertes Signal mit automatischer Einstellung
Abb. 5.3: AM moduliertes Signal mit maximaler Abtastrate
Diese Funktion stellt den besten Kompromiss aus maximaBei dieser Funktion wird immer die maximal mögliche
Abtastrate eingestellt unter Ausnutzung des maximal verfügbaren Speichers eingestellt. Ist diese Funktion gewählt,
so wird immer die maximal mögliche Abtastrate unter Ausnutzung des maximal verfügbaren Speichers eingestellt.
Es wird immer die maximal mögliche Abtastrate genutzt
und eine maximale Datenanzahl abgebildet.Die angezeigte
Datenanzahl pro Bildspalte im Kurvenfenster beträgt bis
zu 40 erfasste Daten (begrenzt durch die Rechenleistung
des verwendeten Prozessors). Die aktuelle angezeigte
Datenanzahl ist abhängig vom abgebildeten Zeitfenster
und der aktuellen Abtastrate. Es werden bei aktivierter
Spitzenwerterfassung bis zu 20 Min/Max-Paare pro Bildspalte angezeigt. Die Speichertiefe entspricht immer dem
ler Wiederholrate und maximaler Abtastrate (Speichertie-
fenwahl) dar. Die angezeigte Datenanzahl pro Bildspalte im
Kurvenfenster beträgt bis zu 10 erfasste Daten. Die aktu-
elle angezeigte Datenanzahl ist abhängig vom abgebilde-
ten Zeitfenster und der aktuellen Abtastrate. Es werden bei
aktivierter Spitzenwerterfassung bis zu 5 Min/Max-Paare
pro Bildspalte angezeigt. Die Speichertiefe ist mindestens
der doppelter Speicher wie bei der Einstellung maximale
Wiederholrate (begrenzt durch den maximalen Erfas-
sungsspeicher). Die angezeigte Abtastrate entspricht der
aktuellen Abtastrate dividiert durch die Anzahl der beim
Auslesen aus dem Erfassungsspeicher übersprungenen
Daten. Bei aktivierter Spitzenwerterfassung entspricht die
angezeigte Abtastrate der aktuellen Abtastrate.
Einstellung Vorteile Nachteile Anwendung
Maximale Wiederholrate: ı Viele Aufnahmen in einem Bild
ı Seltene Ereignisse werden in Ver-
bindung mit Nachleuchten schneller
gefunden
ı Schnelle Reaktion auf Bedienung oder
Signaländerung
ı Geringes Rauschband
Maximale Abtastrate: ı Maximale Detailtreue
ı Geringste Aliasinggefahr
ı Hohe Messgenauigkeit
Automatik: ı Mittlere Kurvenupdaterate
ı NochflüssigeBedienung
ı Gute Messgenauigkeit
ı Geringes Rauschband
ı Hohe Aliasinggefahr
ı Geringe Detailtreue
ı Geringe Messgenauigkeit durch
reduzierte Datenanzahl
ı Träge Reaktion auf Bedienung
oder Signaländerung
ı Kleine Kurvenupdaterate
ı Rauschen mehr sichtbar
ı Aliasing möglich ı Standardanwendung
ı Zur Suche von seltenen Ereignissen
ı Bei der Darstellung modulierter
Signale
ı Bei Signalen mit hohen
Frequenzanteilen
ı Zur Untersuchung von kleinen
Signaldetails
Tab. 5.1: Vor- und Nachteile Softmenü Wiederholrate
20
Page 21

Horizontalsystem
In allen Einstellungen ist die aktuelle Abtastrate (Abtastrate, mit der in den Erfassungsspeicher geschrieben
wird) immer gleich. Zusätzlich ist es im STOP Modus
möglich, die Menüpunkte zu wechseln. Dies hat keinen
EinflussaufdieaktuelleSpeichertiefe,dieAnzahlder
angezeigten Daten wird jedoch angepasst. Die Spitzenwerterfassung ist ebenfalls im STOP Modus wirksam
(Zeitbasis im Microsekundenbereich). In Zeitbasen, in der
jeder Abtastpunkt angezeigt wird, verhalten sich alle drei
Einstellungen, bis auf die verwendete Speichertiefe und
damit der Kurvenupdaterate, gleich. Die Vor- und Nachteile der einzelnen Einstellungsmöglichkeiten werden in
Tabelle 5.1 gezeigt. Abschließend bleibt zu erwähnen,
dass dieses Menü die bei anderen Herstellern übliche
einstellbare Speichertiefe ersetzt. Bei einer wählbaren
Speichertiefe sollte der Anwender immer den Zusammenhang zwischen Speichertiefe, Zeitbasis und Abtastrate
kennen und Vor- sowie Nachteile abschätzen können. Mit
dieser Menümethode erfasst das Oszilloskop immer mit
einer maximal möglichen Abtastrate. Ein nachträgliches
Hineinzoomen im STOP Modus ist somit immer gegeben,
auch bei maximaler Wiederholrate. Ein Herauszoomen ist
bei maximaler Wiederholrate ebenfalls möglich, wenn der
STOP Modus bei schnellen Zeitbasen ausgeführt wurde.
Kann man, wie bei anderen Herstellern, nur durch eine
geringe Speichertiefe eine hohe Wiederholrate erzielen,
ist ein nachträgliches Zoomen im STOP Modus fast nicht
möglich.
5.4 Interlace-Betrieb
Im Interlace-Betrieb werden die Wandler (ADC) und die
Speicher zweier Kanäle zusammengeschaltet. Dadurch
verdoppelt sich die Abtastrate und der Erfassungsspeicher.
Ein Kanal gilt auch als aktiviert, wenn er ausgeschaltet,
aber als Triggerquelle fungiert. Ist ein Kanal aktiviert, so
leuchtet die entsprechende LED neben der Eingangsbuchse. Weitere Bedingungen, um den Interlace-Betrieb
zu aktivieren:
❙ kein Logikpod aktiv
❙ keine seriellen oder parallelen Busse aktiv
❙ Logiktrigger nicht aktiv
Der Interlace-Betrieb wird automatisch aktiviert.
5.5 ZOOM-Funktion
Die R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202 Serie verfügt
über eine Speichertiefe von 1MSa bzw. 2 MSa. Damit lassen sich lange und komplexe Signale aufzeichnen, die mit
der Zoom-Funktion im Detail untersucht werden können.
Um diese Funktion zu aktivieren, drücken Sie die ZOOMTaste 40. Daraufhin wird der Bildschirm in zwei Gitter unterteilt. Das obere Fenster ist die Darstellung des gesamten Zeitbasisfensters, das untere Gitter zeigt einen entsprechend vergrößerten Ausschnitt des oberen Fensters. Der
Signalausschnitt, der gezoomt wird, ist im Originalsignal
(oberes Fenster) durch zwei blaue Cursors markiert. Wenn
mehrere Kanäle im Zoom Modus aktiviert sind, werden alle
angezeigten Kanäle gleichzeitig um den gleichen Faktor
und an der gleichen Stelle „gezoomt“.
In Abb. 5.5 ist zu erkennen, dass das Zoom-Fenster mit
100 µs pro Skalenteil dargestellt ist. Das Signal wurde
über ein Zeitfenster von 12 ms aufgenommen. Zusätzlich
werden im Zoom-Bereich (unteres Gitter) die Parameter
für Zoom-Zeitbasis und Zeit oberhalb des Zoom-Fensters
angegeben. Z beschreibt die Zoom-Zeitbasis (Zoom-Faktor) und bestimmt die Breite des Zoom-Bereichs, der im
Zoom-Fenster angezeigt wird (10 Divisionen x Skalierung
pro Teilung). Tz beschreibt die Zoom-Zeit und bestimmt die
Position des Zoom-Bereichs.
Abb. 5.5: Zoomfunktion
Die Zeitbasiseinstellung oben links in der Anzeige ist grau
hinterlegt, die Zoom-Zeitbasis oberhalb des Zoom-Fensters weiß. Der große Drehgeber im HORIZONTAL Bedienfeld verändert den Zoom-Faktor. Dieser Drehgeber verfügt
ebenfalls über eine Tasterfunktion. Wird der Drehgeber
gedrückt, so wird die Zeitbasiseinstellung weiß dargestellt
und die Zoom-Zeitbasis grau. Nun ist der Drehgeber wieder für die Einstellung der Zeitbasis verantwortlich. Damit
können Zeitbasiseinstellungen verändert werden, ohne
den Zoom Modus verlassen zu müssen. Ein nochmaliges
Drücken des Drehgebers hebt die Begrenzungscursors
des Zoom-Bereichs weiß hervor und der Zoom-Ausschnitt
kann nun mit dem Drehgeber geändert werden. Die Position des „gezoomten“ Ausschnitts lässt sich nun mit Hilfe
des kleinen Drehgeberes im HORIZONTAL Bedienfeld über
das gesamte Signal verschieben. Wenn durch Drücken des
großen Drehgebers dieser, wie oben beschrieben, wieder
die Zeitbasis und nicht den Zoom-Faktor einstellt, besitzt
der kleine Drehgeber die Funktion den Triggerzeitpunkt zu
verschieben und damit das Verhältnis von aufgenommener
Vor- und Nachgeschichte einzustellen.
Die ZOOM-Funktion ist im Rollen-Modus nicht verfügbar.
Im Erfassungsmodus ROLLEN ist es prinzipiell nicht möglich, „in den Speicher hineinzuzoomen“, da die Signalwerte
der X-Achse immer mit der maximalen Speichertiefe aufgezeichnet werden. Im Erfassungsmodus NORMAL be-
ndensichimmermehrSamplesimSpeicher,alsaufdem
Display dargestellt werden. Daher ist es hier möglich, in
den Speicher „hineinzuzoomen“. Bei den Werten der YAchse (Amplitude) verhält sich dies anders. Diese Werte
21
Page 22

Horizontalsystem
beziehen sich auf eine festgelegte Achse und sind daher
auch im Rollen-Modus „skalierbar“.
5.6 Navigation-Funktion
Die X-POS.-Funktion (Taste MENU im HORIZONTAL Bedienfeld) ermöglicht eine leichtere Handhabung der
Triggerzeit sowie deren numerische Eingabe. Mit den einzelnen Softmenütasten kann die Triggerzeit z.B. auf den
minimalen/maximalen Wert oder auf Null gesetzt werden.
Mit der Softmenütaste TRIGGERREF.-ZEIT wird der Trig-
gerpunktimKurvenfensterdeniert.DieSkalierungder
Signalkurve erfolgt um diesen Referenzpunkt. Mit dem
Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld kann
die gewünschte Einstellung gewählt werden.
5.7 Marker-Funktion
Mit Markern können bestimmte Positionen auf dem Bildschirm markiert werden, z.B. eine steigende oder fallende
Flanke, ein unerwarteter Signalwert oder ein Suchergeb-
nis.AnschließendkönnendieMarkerzurIdentikation
bestimmter Signalbereiche genutzt werden, die im Zoom
Modus näher betrachtet und die Daten analysiert werden
sollen. Die Markerfunktion wird über die Taste MENU im
HORIZONTAL Bedienfeld geöffnet. Ist die Markerfunktion aktiviert (Softmenütaste MARKER blau markiert), so
kann durch Drücken der SET/CLR-Taste im HORIZONTAL
Bedienfeld ein Zeitmarker an der 6. Zeiteinheit (bei ausgeschaltetem Menü in der Gittermitte) gesetzt werden. Die
Zeitmarker werden durch einen blauen, senkrechten Strich
markiert. Mit dem X-Position Drehgeber kann die Kurve
(inklusive dem gesetzten Marker) verschoben werden.
IsteinewichtigeSignalpositionidentiziertundmitdem
Positionsknopf auf die Bildschirmmitte gesetzt, so kann
ein weiterer Marker durch erneutem Druck auf die SET/
CLR Taste gesetzt werden. Auf diese Art können bis zu 8
interessante Stellen im Signal markiert werden. Mit einem
Druck auf die Pfeiltasten 37 kann zwischen den einzelnen Marker gewechselt und in der Mitte des Bildschirmes
zentriert werden.
lich. Durch die Zentrierung der Marker über die Pfeiltasten
ist zum Beispiel ein schneller Vergleich von markierten
Signalbereichen im ZOOM Modus sehr schnell und einfach
möglich. Soll ein Marker gelöscht werden, so wird dieser
in der Bildschirmmitte zentriert und durch erneutes Drücken der Taste SET/CLR entfernt. Mit der Softmenütaste
TRIGGERZEIT AUF NULL SETZEN wird die Triggerzeit auf
0s gesetzt. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, alle Zeitmarker gleichzeitig zu löschen (Softmenütaste ALLE MARKER
LÖSCHEN).
Abb. 5.6: Marker im Zoom Modus
Durch die Zentrierung der Marker über die Pfeiltasten ist
zum Beispiel ein schneller Vergleich von markierten Signalbereichen im ZOOM Modus sehr schnell und einfach mög-
22
Page 23

6 Triggersystem
Das Triggersystem der
R&S®HMO1002 bzw.
R&S®HMO1202 Serie lässt
sich einfach handhaben. Es
gibt vier Tasten, die jeweils
einehäuggenutzteEinstellung anwählen:
❙ TYPE: Auswahl Trigger-Typ
Flanke, Impuls, Logik, Video
sowie Trigger Hold Off Zeit
❙ SLOPE: Art der Flanke
❙ SOURCE: Festlegung der
Triggerquelle
❙ FILTER: Festlegung der
exakten Triggerbedingung.
Abb. 6.1: Bedienfeld des
Triggersystems
Hinzu kommen die Tasten
für die Auswahl der Triggermodi (AUTO, NORMAL und
SINGLE).
6.1 Triggermodi Auto, Normal und Single
Die grundlegenden Triggermodi sind mit der Taste AUTO/
NORM 29 direkt umschaltbar. Wenn der Auto-Modus aktiviert ist, leuchtet die Taste nicht. Drückt man die Taste,
so wird der NORMAL-Modus aktiviert und die Taste wird
mit einer roten LED hinterleuchtet. Im AUTO Modus wird
immer ein Signal auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn ein
Signal anliegt, welches die Triggerbedingung erfüllt, so
synchronisiert sich das Oszilloskop auf dieses Ereignis und
triggert beim Eintreten der eingestellten Bedingung. Sollte
ein Signal anliegen, welches die Triggerbedingung nicht
erfüllt (im einfachsten Fall wäre dies eine Gleichspannung),
so generiert das Oszilloskop selbst ein Triggerereignis.
Damit wird sichergestellt, dass man die Eingangssignale
unabhängig von der Triggerbedingung immer im Überblick
hat.
C
28
29
30
31
32
33
34
35
36
Triggersystem
6.2 Triggerquellen
Als Triggerquellen (Taste SOURCE) stehen die zwei analogen Kanäle sowie der externe Triggereingang (AC/DC) zur
Verfügung. Ist die optionale Erweiterung mit den aktiven
Logiktastköpfen R&S®HO3508 mit 8 digitalen Eingängen
angeschlossen, so lassen sich auch diese bis zu 8 digitalen
Eingänge als Triggerquelle einsetzen. Mit der Softmenütaste NETZ lässt man den Trigger auf Netzfrequenz
triggern. Das Triggersignal wird hierbei intern aus dem
Netzteil gewonnen.
6.3 Triggertypen
Der Triggertyp kann mit der Taste TYPE 31 im Trigger
Bedienfeld eingestellt werden. Es öffnet sich ein Menü mit
den Auswahlmöglichkeiten.
6.3.1 Flankentrigger
DereinfachsteundmitAbstandamhäugsteneingesetzte
Trigger ist der Flankentrigger. Das Oszilloskop triggert,
wenn innerhalb des im SOURCE Menü gewählten Signals,
die mit der SLOPE Taste eingestellte(n) Flanke(n) auftreten.
DieSignalflankemussdabeideneingestelltenTriggerpegel
durchlaufen. Diese Triggerart wird auch vom Autosetup
(Taste AUTO-SET) gewählt. Wird zum Beispiel der Impulstrigger aktiviert und auf die AUTO SET-Taste gedrückt,
so wird die Einstellung auf Flankentrigger gesetzt. Ist der
Triggertyp Flanke noch nicht aktiv (blau hinterlegt), so
kann dieser durch Drücken der dazugehörigen Softmenütaste gewählt werden (Standardeinstellung). Die Art der
Flanke (steigende, fallende oder beide) kann direkt mit der
Taste SLOPE 35 eingestellt werden. Diese schaltet jeweils
eine Einstellung weiter, d. h. von steigender auf fallende
Flanke, auf beide Flanken und ein weiterer Tastendruck
bewirkt wieder die Triggerung auf die steigende Flanke. In
der Mitte der Statuszeile oben im Display und der Anzeige
oberhalb der SLOPE-Taste 35 erkennt man, welche Flankenart gewählt wurde.
Im NORMAL Modus wird nur dann ein Signal erfasst
und dargestellt, wenn eine Triggerbedingung erfüllt
ist. Liegt kein neues Signal an, welches die eingestellte
Triggerbedingung erfüllt, so wird das letzte getriggerte
Signal angezeigt. Möchte man sicherstellen, dass nur ein
Signal, welches die Triggerbedingung erfüllt, aufgenommen und angezeigt wird, so muss dieser Modus durch
Drücken der Single-Taste 33 aktiviert werden. Diese Taste
leuchtet weiß, wenn der SINGLE Modus aktiv ist. Damit
ist das Erfassungs- und Triggersystem der R&S®HMO1002
bzw. R&S®HMO1202 Serie eingeschaltet und die RUN/
STOP-Taste 39 blinkt. Tritt die Triggerbedingung ein, löst
das Triggersystem aus, der Speicher wird gefüllt und
das Oszilloskop geht anschließend in den STOP-Modus
(erkennbarandemdauerhaftrotenAufleuchtenderRUN/
STOP-Taste).
Abb. 6.2: Kopplungsarten bei Flankentrigger
Mit der Taste FILTER 36 kann für die Triggerschaltung festgelegt werden, wie das Signal eingekoppelt wird:
❙ AUTO LEVEL: Automatische Filtereinstellungen
(Standardeinstellung).
23
Page 24

Triggersystem
❙ AC: Das TriggersignalwirdübereinenHochpassltermit
einer unteren Grenzfrequenz von 5 Hz angekoppelt,
welches den Gleichspannungsanteil des triggernden
Signals unterdrückt. Der Triggerpegel bleibt bei einem
sich veränderten Gleichspannungsanteil auf dem eingestellten Punkt innerhalb des Wechselstromsignals. Bei der
Triggerart AUTO (AUTO/NORM Taste) ist zudem ein
Peak-Peak-Modus aktiv, welcher den Trigger innerhalb
des Wechselstromsignals begrenzt. Dadurch ist bei dieser
Einstellung für ein beliebig angelegtes Signal die Triggerbedingung erfüllt, ohne dass der Pegel eingestellt werden
muss. Bei der Triggerart NORM (AUTO/NORM Taste) ist
der Peak-Peak-Modus deaktiviert und der Triggerpegel
kann über die Spitzenwerte des Signals hinaus verschoben werden.
❙ DC: Das Triggersignal wird mit allen Signalanteilen
(Gleich- und Wechselspannung) an die Triggerschaltung
gekoppelt. Hierbei wird das triggernde Signal nicht
beeinflusst.
❙ HF: Das TriggersignalwirdmiteinemHochpassltermit
einer unteren Grenzfrequenz (-3 dB) von 30 kHz
angekoppelt und ebenfalls bei Normaltriggerung der
Pegel automatisch begrenzt. Diese Kopplungsart sollte
nur bei sehr hochfrequenten Signalen angewendet
werden.
❙ TIEFPASS: Das Triggersignal wird über einen Tiefpass
mit einer oberen Grenzfrequenz von 5 kHz eingekoppelt.
Dieses Filter entfernt höhere Frequenzen und ist mit
AC-und DC-Kopplung verfügbar.
❙ RAUSCHUNTER.: Der Triggerverstärker wird mit einem
TiefpassltermiteineroberenGrenzfrequenz von
100 MHz in seinem Rauschverhalten verbessert. Dieses
Filter entfernt höhere Frequenzen und ist mit AC-und
DC-Kopplung verfügbar.
Die Kopplungsarten Tiefpass- und Rauschunterdrückung können
nicht zusammen aktiviert werden
6.3.2 Impulstrigger
Der Impulstrigger ermöglicht das Triggern auf bestimmte
Pulsbreiten von positiven oder negativen Pulsen, bzw.
auf Pulsbreitenbereiche. Das Oszilloskop triggert, wenn
innerhalb des im SOURCE Menü gewählten Signals ein
Impuls mit den im FILTER Menü gewählten Eigenschaften auftritt. Erfüllt ein Impuls die Triggerbedingungen, so
triggertdasOszilloskopaufdessenRückflanke,d.h.bei
einem positiven Impuls auf die fallende Flanke und bei
einem negativen Impuls auf eine steigende Flanke.
❙ ti = t: Die Impulsdauer ti, die den Trigger auslöst, ist
gleich einer einstellbaren Vergleichszeit t. Die
Vergleichszeit setzt sich zusammen aus der Zeit t plus
eine einstellbare Abweichung.
❙ ti≠t: Die Impulsdauer ti, die den Trigger auslöst, ist
ungleich einer einstellbaren Vergleichszeit t. Die
Vergleichszeit setzt sich zusammen aus der Zeit t plus
eine einstellbare Abweichung.
❙ t1<ti<t2: Die Impulsdauer ti, die den Trigger auslöst, ist
kleiner als eine einstellbare Vergleichszeit t2 und größer
als eine einstellbare Vergleichszeit t1.
❙ Not(t1<ti<t2): Die Impulsdauer, die den Trigger auslöst,
ist größer als eine einstellbare Vergleichszeit t2 und kleiner
als eine einstellbare Vergleichszeit t1.
Die jeweilige Vergleichszeiten lassen sich im Bereich von
16nsbis10seinstellen,wobeibis1msdieAuflösung2ns
und danach 1 µs beträgt. Die einstellbare Abweichung
lässtsichimBereich±8nsbis657,5µsmiteinerAuflösung von 8ns einstellen. Die ZEIT bzw. ABWEICHUNG
(erlaubter Toleranzbereich) kann mittels Universaldrehgeber oder der KEYPAD Taste im CURSOR/MENU Bedienfeld
eingestellt werden. Die POLARITÄT aller ImpulstriggerEinstellungen kann auf positiv (POS.) oder negativ (NEG.)
polarisierte Pulse eingestellt werden. Bei einem positiv polarisierten Puls wird in diesem Zusammenhang die Breite
von der steigenden zur fallenden Flanke bestimmt, bei einem negativ polarisierten entsprechend von der fallenden
zur steigenden Flanke. Prinzipbedingt wird immer auf der
zweiten Flanke des Pulses getriggert.
6.3.3 Logiktrigger
Alle Logiktrigger-Einstellungen können auch ohne angeschlossenen aktiven Logiktastkopf R&S®HO3508 vorgenommen werden.
Die Auswahl des LOGIK-Triggers bewirkt die Umschaltung
der Triggerquelle auf die digitalen Eingänge. Wenn nach
Auswahl dieses Triggertyps die SOURCE-Taste 32 gedrückt
wird, erscheint ein Softmenü mit weiteren Einstellmöglichkeiten sowie ein Fenster für deren übersichtliche
Darstellung. Mit der Softmenütaste LOGIKKANAL und dem
Der Impulstrigger wird durch das Drücken der TYPE-Taste
31
im Trigger Bedienfeld aktiviert. Anschließend können
weitere Einstellungen für den Impulstrigger im Softmenü
nach Drücken der FILTER-Taste 36 vorgenommen werden.
Es gibt grundsätzlich sechs Arten der Einstellungen:
❙ ti > t: Die Impulsdauer ti, die den Trigger auslöst, ist
größer als eine einstellbare Vergleichszeit t.
❙ ti < t: Die Impulsdauer ti, die den Trigger auslöst, ist
kleiner als eine einstellbare Vergleichszeit t.
24
Abb. 6.3: Menü zur Logiktriggereinstellung
Page 25

Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld kann
ein Logikkanal ausgewählt werden, für den der Triggerzustand festgelegt werden soll. Im Übersichtsmenü wird die
gewählte digitale Leitung blau hinterlegt und der Triggerzustand (ZUSTAND) mit High (H), Low (L) oder unbedeutend
(X) markiert. Die Auswahl des Zustandes erfolgt mit der entsprechenden Softmenütaste. Die Softmenütaste VERKNÜPF.
wählt die logische Verknüpfung der digitalen Kanäle. Zur
Auswahl stehen logisch UND bzw. ODER. Werden die Logikkanäle UND verknüpft, müssen die ein-gestellten Zustände
aller Kanäle gleichzeitig im Eingangssignal auftreten, damit
die Verknüpfung ein logisches High (H) als Ergebnis liefert.
BeiderODERVerknüpfungmussmindestenseinederdenierten Pegelvorgaben erfüllt werden. Mittels Softmenütaste
TRIGGER AUF wird festgelegt, ob am Beginn der Zustandsverknüpfung (WAHR) oder am Ende der Zustandsverknüpfung (UNWAHR) der Trigger gesetzt werden soll.
Ist das gewünschte Muster eingestellt, so können mit
der FILTER-Taste 36 weitere Einstellungen vorgenommen
werden. In dem sich öffnenden Softmenü kann die TRIGGER AUF Funktion zeitlich beschränkt werden. Ein Druck
auf die oberste Softmenütaste schaltet die DAUER hinzu.
Diese Funktion vergleicht die Zeitdauer t des Ausgangsimpulses der Verknüpfung mit einer eingestellten Zeitdauer
ti. Mit dem Softmenü VERGLEICH kann das Vergleichskriterium gewählt werden. Folgende sechs Kriterien stehen
zur Auswahl:
❙ ti > t: Die Dauer des anliegenden Bitmusters, die den
Trigger auslöst, ist größer als eine einstellbare Vergleichszeit.
❙ ti < t: Die Dauer des anliegenden Bitmusters, die den
Trigger auslöst, ist kleiner als eine einstellbare Vergleichszeit.
❙ ti = t: Die Dauer des anliegenden Bitmusters, die den
Trigger auslöst, ist gleich einer einstellbaren Vergleichszeit.
❙ ti≠t: Die Dauer des anliegenden Bitmusters, die den
Trigger auslöst, ist ungleich einer einstellbaren Vergleichszeit.
❙ t1<ti<t2: Die Impulsdauer ti, die den Trigger auslöst, ist
kleiner als eine einstellbare Vergleichszeit t2 und größer
als eine einstellbare Vergleichszeit t1.
❙ Not(t1<ti<t2): Die Impulsdauer, die den Trigger auslöst,
ist größer als eine einstellbare Vergleichszeit t2 und kleiner
als eine einstellbare Vergleichszeit t1.
❙ Timeout: Der Trigger löst aus, wenn die Verknüpfung
nachdereingestelltenZeitnochgültigist.Zeittdeniert
die Zeitgrenze für die Zeitüberschreitung, bei der das
Gerät auslöst.
Bei gleicher (ti = t) oder ungleicher Zeitdauer (ti≠t)ist das
Einstellen einer ABWEICHUNG∆tmöglich.Liegttinnerhalb dieser Grenzen, ist die Triggerbedingung erfüllt. Die
ZEIT bzw. ABWEICHUNG (erlaubter Toleranzbereich) kann
mittels Universaldrehgeber oder der KEYPAD Taste im
CURSOR/MENU Bedienfeld eingestellt werden.
Triggersystem
Abb. 6.4: Einstellungen der Logikkanalanzeige
Sollen die Schwellwerte für die Erkennung der logischen
Eins- und Null-Zustände geändert werden, so sind Einstellungen im Kanalmenü (MENU Taste im VERTICAL Bedienfeld) notwendig. Dazu wird der POD ausgewählt (POD
Taste 24). Ist der Logikbetrieb aktiviert, so werden die digitalen Kanäle auf dem Display angezeigt und POD im Kanalanzeigebereich (POD:xxxV) umrahmt. Neben der POD
Kanalanzeige wird zusätzlich der Zustand des Signals angezeigt (High/Low). Wird bei aktiviertem Logikbetrieb die
MENU-Taste 21 im VERTICAL Bedienfeld betätigt, so kann
eine von fünf voreingestellten Logikpegeleinstellungen aktiviert werden. Von diesen sind drei fest mit den Pegeln für
TTL, CMOS und ECL vorgegeben. Mit den Softmenütasten
NUTZER1undNUTZER2könnenzweibenutzerdenierte
Logikpegeleinstellungen mit dem Universaldrehgeber
oder numerisch mit der KEYPAD Taste im CURSOR/MENU
Bedienfeld von –2 V bis 8 V eingestellt werden. Auf Seite
2|2desMenüsschaltetdieSoftmenütastePOS.&GRÖßE
ZURÜCKSETZEN die Anzeige aller digitalen Kanäle unter
Benutzung von Standardwerten für deren vertikale Position und Größe ein. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, eine
BezeichnungfürdieaktuellfokusierteKurvezudenieren
(Softmenü NAME). Eine Bibliothek stellt eine Liste von vordeniertenNamenbereit.DerNamekannan-/ausgeschaltet bzw. editiert werden.
6.3.4 Videotrigger
Der Videotrigger ermöglicht das Triggern auf PAL, NTSC
SECAM Standard Videosignale sowie auf HDTV Signale.
Wenn nach Auswahl dieses Triggertyps die SOURCE-Taste
32
gedrückt wird, erscheint ein Softmenü mit weiteren
Einstellmöglichkeiten Die Wahl der Quelle erfolgt mittels
SOURCE-Taste 32. Mit dem Menü FILTER 36 können alle
weiteren Einstellungen vorgenommen werden. Das Oszilloskop triggert, wenn das im SOURCE Menü gewählte
FBAS-Signal (Farb-Bild-Austast-Synchron-Signal) die
im FILTER Menü eingestellten Eigenschaften aufweist.
Zunächst wird mit der Softmenütaste STANDARD der
gewünschte Standard ausgewählt. Die Auswahl erfolgt mit
dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld
oder durch wiederholtes Drücken der Softmenütaste. Es
sind folgende Modi auswählbar:
25
Page 26

Triggersystem
❙ PAL
❙ NTSC
❙ SECAM
❙ PAL-M
❙ SDTV 576i Interlaced
❙ HDTV 720p Progressive
❙ HDTV 1080p Progressive
❙ HDTV 1080i Interlaced
Abb. 6.5: Videotriggermenü
Die Polarität des Synchronimpulses (POS. oder NEG.) wird
mit der Softmenütaste SIGNAL eingestellt. Bei positiver
Videomodulation (der größte Helligkeitswert im Bild wird
durch die maximale Signalspannung repräsentiert) sind die
Synchronimpulse negativ, bei negativer Modulation positiv.
Die Flanken der Synchronimpulse werden zur Triggerung
genutzt. Daher kann eine falsche Einstellung der Polarität
zu einer unregelmäßigen Auslösung des Triggers durch
die Bildinformationen führen. Mit der Softmenütaste
MODUS kann zwischen Bild- (BILD) und Zeilentriggerung
(ZEILE) gewählt werden. Bei Wahl der ZEILE kann die
exakt gewünschte Zeile von der 1ten bis zur 625ten mit
dem Universaldrehgeber oder numerisch mit der KEYPAD
Taste im CURSOR/MENU Bedienfeld eingestellt werden.
Die Softmenütaste ALLE ZEILEN ermöglicht, dass das Oszilloskop auf den Beginn der Zeilen im Videosignal triggert.
Diese Taste wählt alle Zeilen aus, d.h. auch wenn die anderen Triggerbedingungen erfüllt sind, triggert das Oszilloskop auf jede Zeile. Wird die Bildtriggerung mit BILD ausgewählt, kann auf die UNGERADEN oder nur die GERADEN
Halbbilder getriggert werden. Das Oszilloskop triggert
hierbei auf den Beginn der Halbbilder im Videosignal. Auch
wenn die anderen Triggerbedingungen erfüllt sind, triggert
das Oszilloskop auf jedes ungerade (gerade) Halbbild.
Eine Änderung der Zeitablenkung hat keinen Einuss auf die eingestellte HOLD OFF ZEIT.
Die HOLD OFF ZEIT kann mit dem Universaldrehgeber
oder numerisch mittels KEYPAD-Taste im CURSOR/MENU
Bedienfeld eingegeben werden. Eine Werteeingabe von
50ns bis 10s ist möglich. Mit der unteren Zeile der Softmenütaste AUS (blau hinterlegt) wird die Funktion HOLD OFF
ZEIT deaktiviert.
6.4 Trigger Events
Über das UTIL Menü im VERTICAL Bedienfeld auf Seite
2|2kannmittelsSoftmenütasteACQ.TRIGGEREV.ein
Puls für jedes Trigger Event an der AUX OUT Buchse ausgegeben werden (Ausgabe der Triggerfrequenz).
6.5 Trigger Extern (R&S®HMO1202)
Die Einstellungen für den externen Trigger Eingang
(Buchse EXT TRIG IN) erfolgen über das POD Menü. Nach
Betätigen der POD Taste kann über das Kurzmenü der
externe Trigger aktiviert werden (Softmenütaste EXT). Ist
der externe Trigger aktiviert (AN), so können danach die
Einstellungen über das MENU Menü im VERTICAL Bereich
des Bedienfeldes erfolgen. Über die Softmenütaste EXT.
SCHWELLE kann der Schwellwert für ein externes
Triggersignal eingestellt werden. Ein externes Triggersignal
kann z.B. als CS (Chip Select) für einen SPI BUS genutzt
werden (dargestellt als grüne Linie).
Abb. 6.6: Externes Triggersignal
6.3.5 Trigger Hold Off Zeit
Die Trigger HOLD OFF ZEIT gibt an, wie lange das Oszilloskop nach einem Trigger wartet, bis das Triggersystem
wieder bereit ist. Erst nach Ablauf der Trigger HOLD OFF
ZEIT ist das Triggersystem wieder aktiv. Somit kann diese
Funktion für eine stabile Triggerung sorgen, wenn auf unerwünschte Ereignisse getriggert wird. Idealerweise wird
die HOLD OFF ZEIT zum Triggern auf periodische Signale
mit mehreren Flanken verwendet.
26
Page 27

7 Anzeige von
Signalen
Im folgenden Kapitel werden die Auswahl und Anzeige
von Signalen verschiedener Quellen, sowie die möglichen
Anzeigemodi erläutert.
7.1 Anzeigeeinstellungen
Die R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202 Serie verfügt
über ein hochwertiges, mit LED Hintergrundbeleuchtung ausgestattetes, TFT Display mit VGA (640x480Pixel)
Auflösung.GrundlegendeEinstellungendesBildschirms
können mit der Taste DISPLAY 14 im GENERAL Bedienfeld
eingestellt werden. Ist der VIRTUAL SCREEN aktiviert, so
erscheint rechts neben dem Anzeigegitter im Display ein
Rollbalken, mit dem der Anzeigebereich innerhalb der 20
Skalenteile des virtuellen Bildschirmbereichs mit Hilfe des
Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld hochund heruntergefahren werden kann. Nähere Erläuterungen zur Funktion VIRTUAL SCREEN folgen in Kapitel 7.2.
Folgende Einstellungen können ebenfalls vorgenommen
werden:
❙ NUR PUNKTE:
Die Datenpunkte (Erfassungspunkte) aller Kurven werden
nicht mit senkrechten Linien verbunden. Ist diese
Funktion deaktiviert (AUS), so wird auch auch die
Interpolation der Datenpunkte angezeigt.
❙ INVERSE HELL.:
Diese Einstellung invertiert den Helligkeitsverlauf der dargestelltenSignale.ImNormalfallwerdenhäuggetrof-
fene Punkte heller dargestellt als seltene. Die Funktion
INVERSE HELL. kehrt den Sachverhalt um. Seltene
Ereignisseweisengegenüberhäugauftretendeneine
höhere Helligkeit auf. Um seltene Ereignisse innerhalb
eines Signales aufzuspüren, kann diese Einstellung in
Verbindung mit Nachleuchten genutzt werden.
❙ FALSCHFARBEN:
Diese Einstellung wandelt die Helligkeitsstufen der dargestellten Signale in eine Farbskala um (von Blau über
Magenta, Rot und Gelb bis Weiß). Der sich daraus erge
bende höhere Kontrast ermöglicht eine verbesserte
Wahrnehmung der im Signal enthaltenden Details. Diese
Einstellung wirkt auf alle Kurven gleichzeitig.
❙ GITTER:
In diesem Softmenü kann die Anzeige des Gitters als
LINIEN (Unterteilung des Gitters mit horizontalen und
vertikalen Linien, die die Skalenteile darstellen), FADENKREUZ (Anzeige von einer horizontalen und einer vertikalen Nulllinie, die die Skalenteile als Punkte darstellt) oder
AUS(diegesamteGitterflächeenthältkeinePunkteoder
Linien) gewählt werden.
❙ INFOFENSTER:
Dieses Softmenü beinhaltet Einstellmöglichkeiten über
die Anzeige von Informationsfenstern. Informationsfenster sind kleine Fenster, die je nach Anwendung auf dem
Anzeige von Signalen
Bildschirm erscheinen (z.B. Einblendung der Werte bei
Änderung des Offsets). Die Einstellung der TRANSPARENZ von 0% bis 100% erfolgt mit dem Universaldrehgeber oder numerisch mittels KEYPAD-Taste im
CURSOR/MENU Bedienfeld 4. Je größer der eingestellte
Prozentwert, desto durchsichtiger das Informationsfenster). Weiterhin ist das Informationsfenster der POSITION
und KURVENHELL. ein- und ausschaltbar. Ist die
Funktion POSITION aktiviert (AN), so wird bei einer Änderung der Y-Position der entsprechende Wert, auf dem
sichdieNullliniebendet,angezeigt.IstdieFunktion
KURVENHELL. aktiviert (AN), so wird bei einer Änderung
der Kurvenhelligkeit der entsprechende Wert angezeigt.
Dem Nutzer wird je nach eingestellter Triggerart eine
Information über den Zustand der Erfassung angezeigt
(Softmenütaste ERF. STATUS). Die Anzeige erfolgt nur,
wenn die Signalveränderungen auf dem Bildschirm
längere Zeit andauern können. Ist die Triggerbedingung
erfüllt, so wird ein Informationsfenster mit einer Fortschrittsanzeige des Post- und Pre-Triggers angezeigt. Ist
die Triggerbedingung nicht erfüllt, wird im Informationsfenster die Zeit seit dem letzten Triggerereignis angezeigt
(Trig?). Bei der Triggerart AUTOMATIK wird nach einem
längeren ungetriggerten Zustand in die ungetriggerte
Erfassung umgeschaltet. In dieser Erfassungsart wird
kein Informationsfenster angezeigt, weil die momentan
erfassten Daten dargestellt werden.
❙ HILFSCURSORS:
Dieses Softmenü bietet Einstellungsmöglichkeiten für
Hilfscursors. Durch Betätigen der Softmenütasten AN/
AUS ist ein Ein- und Ausschalten der Cursors möglich.
Die Softmenütaste STANDARDEINST. stellt die Standardeinstellungen wieder her.
7.2 Nutzung des virtuellen Bildschirms
Abb. 7.1: Schema und Beispiel der Virtual Screen Funktion
Das Anzeigegitter der R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202
Serie umfasst im vertikalen Bereich 8 Skalenteile, verfügt
aber über einen virtuellen Anzeigebereich von 20 Skalenteilen. Diese 20 Skalenteile können von den optionalen
digitalen Kanälen D0 bis D7, den Mathematikkanälen, den
BUS-Signalen und den Referenzkurven genutzt werden.
Die analogen Kanäle können bis zu ±10 Skalenteile um die
vertikale Nulllinie nutzen. In Abb. 7.1 ist die Funktionsweise
27
Page 28

Anzeige von Signalen
des Virtual Screen’s dargestellt. Der auf dem Bildschirm
sichtbare Bereich von 8 vertikalen Skalenteilen ist hier grau
gefärbt. In diesem Bereich können die analogen Signale
angezeigt werden. Neben dem Gitter ist ein kleiner Balken,
der die Position der 8 sichtbaren Skalenteile innerhalb der
möglichen 20 Skalenteile angibt. Wird die Taste SCROLL
BAR 5 im CURSOR/MENU Bedienfeld betätigt, so wird
dieser Balken aktiviert. Die 8 sichtbaren Skalenteile (grauer
Bereich) können nun mit dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld über die möglichen 20 Skalenteile
verschoben werden. Dies ermöglicht eine einfache und
übersichtliche Darstellung von vielen Einzelsignalzügen.
7.3 Signalintensitätsanzeige und Nachleuchtfunktion
In der Standardeinstellung (Taste INTENS/PERSIST 7
leuchtet) lässt sich die Intensität der Signalanzeige mit
dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld
im Bereich von 0% bis 100% variieren. Wird die Taste INTENS/PERSIST 7 betätigt (LED erlischt), so öffnet sich ein
Menü zum Einstellen der Kurven-/Rasterhelligkeit, Hintergrundbeleuchtung und Nachleuchtfunktion.
Die Softmenütasten KURVE, RASTER und HINTERGR.BEL. ermöglichen die Helligkeitseinstellung der Kurve,
des Rasters und der Hintergrundbeleuchtung mit dem
Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld. Das
Softmenü EINSTELLUNGEN ermöglicht die Nachleuchteinstellung der Kurven auf dem Bildschirm. Die Funktion
Nachleuchten bewirkt, dass Signale bei der Aktualisierung
des Bildschirms nicht ersetzt, sondern für eine gewisse
Dauer auf dem Bildschirm verweilen und langsam verblassen. Diese Darstellungsform kommt der eines Analogoszilloskop sehr nahe und eignet sich besonders bei sich verändernden Signalen. Mit der Einstellung AUTOMATISCH
wirddieautomatischeKongurationdesNachleuchtens
gewählt. Das Messgerät versucht in dieser Einstellung die
optimale Zeit selbst zu wählen. Mit Aus wird die Nachleuchtfunktion deaktiviert.
mit dem Universaldrehgeber oder numerisch mit der KEYPAD Taste im CURSOR/MENU Bedienfeld einstellbar. Wird
eine endliche Zeit gewählt, so werden innerhalb dieser Zeit
neue Signale auf dem Bildschirm übereinandergeschrieben, wobei die selten auftretenden Signale dunkler darge-
stelltwerdenalshäugen.Werdenz.B.300mseingestellt,
so werden die Aufnahmen in 50 ms Schritten dunkler dargestellt und 300 ms gelöscht.
Die Softmenütaste HINTERGRUND aktiviert (AN) oder deaktiviert (AUS) einen Modus, bei dem ältere Kurven nach
der eingestellten Nachleuchtzeit nicht gänzlich verschwinden, sondern im Hintergrund mit geringer Helligkeit weiterhin angezeigt werden. Diese Anzeige ermöglicht zum
Beispiel die Analyse der Extremwerte mehrerer Signale.
7.4 XY-Darstellung
Bei der XY-Darstellung werden zwei Signale im Koordinatensystem gegeneinander aufgetragen. Praktisch bedeutet
dies, dass die Zeitablenkung X durch Amplitudenwerte
einer zweiten Quelle ersetzt wird. Die daraus folgenden
Kurven werden bei harmonischen Signalen Lissajous-Figuren genannt und gestatten die Analyse der Frequenz- und
Phasenlage dieser beiden Signale zueinander. Bei nahezu
gleicher Frequenz dreht sich die Figur. Bei genau gleicher
Frequenz bleibt die Figur stehen und die Phasenlage lässt
sich nach ihrer Form ablesen.
Die XY-Darstellung wird über die UTIL Taste 19 (Softmenütaste XY) im VERTICAL Bedienfeld aktiviert. Die
Bildschirmanzeige wird in einen großen und drei kleine
Anzeigebereiche geteilt. Das große Rasterbild stellt die XYDarstellung dar, wobei die kleinen Rasterbilder die Quelle
für X und Y darstellen. In den kleinen Fenstern werden die
Signale klassisch als Y- über der Zeit dargestellt. Als Quelle
für X und Y können Kanal 1 (CH1) und Kanal 2 (CH2) gewählt werden.
Abb. 7.2: Nachleuchtfunktion
Zusätzlich kann mit der Softmenütaste MANUELL eine
künstliche Alterung der Signale herbeigeführt werden.
Hierbei ist eine Nachleuchtdauer von 50 ms bis unendlich
28
Page 29

8 Messungen
Es wird zwischen zwei Arten von Signalmessungen unterschieden: Cursor-Messungen und Auto-Messungen. Alle
Messungen erfolgen auf einem Pufferspeicher, der größer
als der Bildschirmspeicher ist. Der eingebaute Hardwarezähler zeigt für den ausgewählten Eingang die Frequenz
oder Periodendauer an.
8.1 Cursor-Messfunktionen
DieamhäugstengenutzteMessmöglichkeitaneinem
Oszilloskop ist die Cursor-Messung. Je nach eingestellter Messart werden bis zu drei Cursors zur Verfügung
gestellt. Durch Drücken der Taste CURSOR MEASURE
wird das Menü der Cursor-Messungen geöffnet. Das
Menü CURSOR MEASURE erlaubt die Auswahl von Cursor
bezogenen Messungen für eine aktivierte Signalquelle
des Oszilloskops. Die jeweilige MESSART wird mit dem
Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld ausgewählt. Folgende Messarten können ausgewählt werden:
SPANNUNG: Dieser Modus stellt zwei Cursors
bereit, um drei unterschiedliche Spannungen zu
messen. Die Werte V1 und V2 entsprechen der
Spannung zwischen der Nulllinie der ausgewählten Kurve
und der aktuellen Position des ersten oder zweiten Cur-
sors.DerWertΔVentsprichtdemBetragderSpannung
zwischen beiden Cursors.
ZEIT: Dieser Modus stellt zwei Cursors bereit,
um drei verschiedene Zeiten und eine äquiva-
lente Frequenz zu messen. Die Werte t1 und t2
entsprechen der Zeit zwischen dem Trigger und der aktuel-
lenPositiondeserstenoderzweitenCursors.DerWertΔt
entspricht dem Betrag der Zeit zwischen beiden Cursors.
VERHÄLTNIS X: Dieser Modus stellt drei
Cursors bereit, um ein Verhältnis in X-Richtung
(z.B. ein Tastverhältnis) zwischen den ersten
beiden, sowie dem ersten und dem dritten Cursor zu messen. Der Messwert wird in vier unterschiedlichen Versionen (als Gleitkommawert, in Prozent, Grad und Bogenmaß)
angezeigt.
VERHÄLTNIS Y: Dieser Modus stellt drei Cur-
sors bereit, um ein Verhältnis in Y-Richtung (z.B.
ein Überschwingen) zwischen den ersten beiden, sowie dem ersten und dem dritten Cursor zu messen.
Der Messwert wird in zwei unterschiedlichen Versionen
(als Gleitkommawert und in Prozent) angezeigt.
ZÄHLEN: Dieser Modus stellt drei Cursors be-
reit, um Signalwechsel zu zählen, die innerhalb
einer mit den ersten beiden Cursors einstellbaren Zeitspanne die mit dem dritten Cursor einstellbare
Schaltschwelle überschreiten. Der Messwert wird in vier
unterschiedlichen Versionen (als Anzahl der steigenden
Messungen
und fallenden Flanken, sowie als Anzahl von positiven und
negativen Impulsen) angezeigt.
SPITZENWERTE: Dieser Modus stellt zwei
Cursors bereit, um die minimale und die maxi-
male Spannung eines Signals innerhalb der mit
den beiden Cursors einstellbaren Zeitspanne zu messen.
Die Werte Vp- und Vp+ entsprechen der minimalen bzw.
der maximalen Spannung. Der Spitzenwert (Vpp) entspricht
dem Betrag der Spannung zwischen dem minimalen und
maximalen Wert.
RMS,MITTELW.,STD.ABWEICHUNGσ:
Dieser Modus stellt zwei Cursors bereit, um
den Effektivwert (RMS = Root Mean Square),
den Mittelwert sowie die Standardabweichung innerhalb
einer mit den beiden Cursors einstellbaren Zeitspanne zu
messen.
TASTVERHÄLTNIS: Dieser Modus stellt drei
Cursors bereit, um das Tastverhältnis zwischen
den beiden horizontalen Begrenzungscursors zu
ermitteln. Der dritte Cursor legt die Schwelle fest, bei der
das Tastverhältnis gemessen wird.
BURSTBREITE: Dieser Modus ermittelt die
Dauer eines Burst-Paketes von der ersten bis
zur letzten Flanke (Bst).
ANSTIEGSZEIT 90%: Dieser Modus stellt
zwei Cursors bereit, um Anstiegs- und Abfallzeit
der jeweils ganz linken Flanke innerhalb einer
mit den beiden Cursors einstellbaren Zeitspanne automatisch zu messen. Hier wird die Anstiegszeit von 10% bis
90% gemessen.
ANSTIEGSZEIT 80%: Dieser Modus stellt
zwei Cursors bereit, um Anstiegs- und Abfallzeit
der jeweils ganz linken Flanke innerhalb einer
mit den beiden Cursors einstellbaren Zeitspanne automatisch zu messen. Hier wird die Anstiegszeit von 20% bis
80% gemessen.
V-MARKER: Dieser Modus
stellt zwei Cursors bereit, um
drei unterschiedliche Spannungen und eine Zeit zu messen. Die Werte V1 und V2
entsprechen der Spannung zwischen der Nulllinie der
ausgewählten Kurve und der aktuellen Position des ersten
oderzweitenCursors.DerWertΔVentsprichtdemBetrag
derSpannungzwischenbeidenCursors.DerWertΔtent-
spricht dem Betrag der Zeit zwischen beiden Cursors.
CREST FAKTOR: Der Crest Faktor bzw. der Scheitelfaktor wird aus dem Verhältnis des Maximalwertes zum RMS
Wert der Kurve berechnet (Crest).
Um die Cursors zu bewegen, wird der gewünschte Cursor
durch Druck auf den Universaldrehgeber im CURSOR/
29
Page 30

Messungen
MENU Bedienfeld ausgewählt und durch Drehen des
Universaldrehgebers positioniert. Das Ergebnis der CursorMessung wird, je nach eingestellter Messquelle (Softmenütaste QUELLE), in der jeweiligen Kanal-Schriftfarbe
angezeigt.DieErgebnissebendensichamunterenRand
des Bildschirms. Wird „n/a“ angezeigt, so ist die Messung
auf das Signal nicht anwendbar. Das ist z.B. bei einer
Spannungsmessung auf einem POD der Fall, weil hierbei
nur logische Zustände ohne Spannungsbezug dargestellt
werden. Wird ein „?“ angezeigt, so liefert die Anzeige
kein vollständiges Messergebnis. Beispielsweise ist die zu
messende Periode nicht vollständig dargestellt und kann
dadurch nicht ermittelt werden.
8.2 Auto-Messfunktionen
Die R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202 Serie verfügt
neben den Cursor-Messungen auch über verschiedene
Auto-Messfunktionen, welche über die Taste AUTO MEASURE 11 im ANALYZE Bedienfeld aktiviert werden können.
Dieses Menü erlaubt die Einstellungen von bis zu sechs
Auto-Messfunktionen, die mit der Softmenütaste MESSPLATZ und dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU
Bedienfeld ausgewählt werden können. Folgende AutoMessarten stehen zur Verfügung:
MITTELWERT: Dieser Modus misst den Mittelwert der Signalamplitude (Mean). Ist das Sig-
nal periodisch, wird die erste Periode am linken
Bildschirmrand für die Messung verwendet. Die Messung
erfolgt jeweils nur für den ausgewählten Kanal.
EFFEKTIVWERT: Dieser Modus ermittelt den
Effektivwert aus dem dargestellten Ausschnitt
der Signalkurve (RMS). Ist das Signal periodisch, so wird die erste Periode für die Messung verwendet. Der Effektivwert ist nicht auf ein Sinussignal bezogen,
sondern wird direkt berechnet (sog. TrueRMS). Die Messung erfolgt jeweils nur für den ausgewählten Kanal.
Abb. 8.1: Auswahlmenü zu Cursormessungen
Ist die Funktion AUTOM. QUELLE aktiviert (An), wird automatisch der aktuell fokusierte Kanal als Quelle für die Messung verwendet. Bei deaktivierter Einstellung (Aus) gilt der
unter QUELLE eingestellte Kanal, auch wenn er nicht im
Fokus steht. Durch Drücken der Softmenütaste SETZEN
werden die gerade eingestellten Cursors bestmöglich auf
der Signalkurve positioniert. Dies ermöglicht eine sehr
schnelle und meist optimale (automatische) Positionierung
der Cursors. Damit sind im Idealfall nur noch Feinjustierungen nötig und lästige Grobeinstellungen der Cursors entfallen. Sollte aufgrund von sehr komplexen Kurvenverläufen
das automatisierte SETZEN nicht das gewünschte Ergebnis liefern, so können die Cursors mittels Softmenütaste
ZENTRIERENineinedenierteAusgangspositiongebracht
werden. Somit können beispielsweise weit entfernte Cursors wieder zurück auf den Bildschirm geholt werden. Die
Softmenütaste KLEBEN bewirkt, dass die Cursors auf dem
eingestellten Datenpunkt bleiben und bei einer Änderung
der Skalierung die Position im Messsignal nicht ändern
(Cursors werden an das Signal „geklebt“). Diese Funktion
kann ein- oder ausgeschaltet werden. Ist die Funktion
Kleben deaktiviert, verweilt der Cursor bei einer Skalierung
in seiner Position auf dem Bildschirm. Bei deaktivierten
Kleben ändert sich der gemessene Wert, bei aktiviertem
Kleben nicht.
Durch Druck auf die Taste CURSOR MEASURE werden die
Cursors deaktiviert und das Menü der Cursor-Messungen
geschlossen.
SPITZE–SPITZE: Dieser Modus misst die
Spannungsdifferenz zwischen dem maximalen
und dem minimalen Spitzenwert des Signals
innerhalb des dargestellten Ausschnitts (Vpp).
SPITZE + : Dieser Modus misst den maxima-
len Spannungswert im dargestellten Bereich
des Bildschirms (Vp+). Die Messung erfolgt
jeweils nur für den ausgewählten Kanal.
SPITZE – : Dieser Modus misst den minimalen
Spannungswert im dargestellten Bereich des
Bildschirms (Vp-). Die Messung erfolgt jeweils
nur für den ausgewählten Kanal.
FREQUENZ: Dieser Modus ermittelt die Frequenz des Signals aus dem reziproken Wert der
ersten Signalperiode T (f). Die Messung erfolgt
nur für den gewählten Kanal.
PERIODE: Dieser Modus misst die Dauer der
Signalperiode T. Die Periode kennzeichnet die
Zeitdauer zwischen zwei gleichen Werten eines
sich zeitlich wiederholenden Signals.
AMPLITUDE: Dieser Modus misst die Amplitude eines Rechtecksignals (V
). Dabei wird
Amp
die Spannungsdifferenz zwischen dem oberen
und unteren Pegel (V
Base
und V
) gebildet.
Top
Die Messung erfolgt jeweils nur für den ausgewählten
Kanal und benötigt mind. eine komplette Periode eines
getriggerten Signals.
30
Page 31

Messungen
CREST FAKTOR: Der Crest Faktor bzw. der Scheitelfak-
tor wird aus dem Verhältnis des Maximalwertes zum RMS
Wert der Kurve berechnet (Crest).
OBERER PEGEL: Dieser Modus misst den
mittleren Spannungspegel eines oberen Rechteck-Daches (V
). Es wird der Mittelwert der
Top
Dachschräge gebildet (ohne Überschwingen). Die Messung
erfolgt jeweils nur für den ausgewählten Kanal und benötigt
mind. eine komplette Periode eines getriggerten Signals.
UNTERER PEGEL: Dieser Modus misst den
mittleren Spannungspegel des unteren Rechteck-Daches (V
). Es wird der Mittelwert der
Base
Dachschräge gebilded (ohne Überschwingen). Die Messung erfolgt jeweils nur für den ausgewählten Kanal und
benötigt mind. eine komplette Periode eines getriggerten
Signals.
POSITIVES ÜBERSCHWINGEN: Dieser Modus ermittelt das positive Überschwingen eines
Rechtecksignales, welches aus den Messwerten
Spitze+, oberer Pegel und Amplitude errechnet wird (+Ovr).
NEGATIVES ÜBERSCHWINGEN: Dieser
Modus ermittelt das negative Überschwingen
eines Rechtecksignales, welches aus den Messwerten Spitze-, unterer Pegel und Amplitude errechnet
wird (-Ovr).
PULSBREITE +: Dieser Modus misst die Breite
des positiven Pulses. Ein positiver Puls besteht
aus einer steigenden Flanke gefolgt von einer
fallenden Flanke. Bei dieser Messart werden die beiden
Flanken ermittelt und aus deren Zeitdifferenz die Pulsbreite
errechnet (t). Die Messung erfolgt jeweils nur für den ausgewählten Kanal und benötigt mindestens einen komplett
dargestellten Puls eines getriggerten Signals.
PULSBREITE –: Dieser Modus misst die
Breite des negativen Pulses. Ein negativer Puls
besteht aus einer fallenden Flanke gefolgt von
einer steigenden Flanke. Bei dieser Messart werden die
beiden Flanken ermittelt und aus deren Zeitdifferenz die
Pulsbreite errechnet (t). Die Messung erfolgt jeweils nur für
den ausgewählten Kanal und benötigt mindestens einen
komplett dargestellten Puls eines getriggerten Signals.
TASTVERHÄLTNIS +: Dieser Modus misst
das positive Tastverhältnis. Dabei werden die
positiven Signalanteile über eine Periode ermittelt und zur Signalperiode ins Verhältnis gesetzt. Das
Ergebnis Dty+ wird als Prozentwert der Signalperiode
ausgegeben. Die Messung erfolgt jeweils nur für den ausgewählten Kanal und benötigt mindestens eine komplette
Periode eines getriggerten Signals.
TASTVERHÄLTNIS –: Dieser Modus misst das
negative Tastverhältnis. Dabei werden die ne-
gativen Signalanteile über eine Periode ermittelt
und zur Signalperiode ins Verhältnis gesetzt. Das Ergebnis
Dty- wird als Prozentwert der Signalperiode ausgegeben.
Die Messung erfolgt jeweils nur für den ausgewählten Kanal und benötigt mindestens eine komplette Periode eines
getriggerten Signals.
ANSTIEGSZEIT 90%: Dieser Modus misst die
Anstiegszeit der ersten steigenden Flanke im
dargestellten Bereich des Bildschirms (tr). Die
Anstiegszeit kennzeichnet die Zeit, in der das Signal von
10% auf 90% seiner Amplitude ansteigt.
ABFALLZEIT 90%: Dieser Modus misst die
Abfallzeit der ersten fallenden Flanke im darge-
stellten Bereich des Bildschirms (tf). Die Abfallzeit kennzeichnet die Zeit, in der das Signal von 90% auf
10% seiner Amplitude abfällt.
ANSTIEGSZEIT 80%: Dieser Modus misst die
Anstiegszeit der ersten steigenden Flanke im
dargestellten Bereich des Bildschirms (t
r80
). Die
Anstiegszeit kennzeichnet die Zeit, in der das Signal von
20% auf 80% seiner Amplitude ansteigt.
ABFALLZEIT 80%: Dieser Modus misst die
Abfallzeit der ersten fallenden Flanke im dargestellten Bereich des Bildschirms (t
f80
). Die
Abfallzeit kennzeichnet die Zeit, in der das Signal von 80%
auf 20% seiner Amplitude abfällt.
σ-STD.ABWEICHUNG: Dieser Modus misst
die Standardabweichung der Signalamplitude
imdargestelltenBereichdesBildschirmes(σ).
Die Standardabweichung ist ein Maß für die Abweichung
eines Signals von seinem Mittelwert. Ein geringes Ergebnis zeigt an, dass die Werte nahe um den Mittelpunkt
liegen. Ein größeres Ergebnis verdeutlicht, dass die Werte
durchschnittlich weiter entfernt liegen.
VERZÖGERUNG: Die Messung der Verzögerung misst den zeitlichen Versatz zwischen der
eingestellten Messquelle und der Referenzquelle (Dly). Dabei wird die am nächsten zur Zeitreferenz
liegende Flanke der Messquelle gesucht und von diesem
Zeitpunkt beginnend die am nähesten liegende Flanke der
Referenzquelle gesucht. Aus diesem Zeitunterschied ergibt sich das Messergebnis. Die Einstellungen der Mess-,
Referenzquelle und der Flanken sind im Softmenü DELAY
EINST. möglich.
PHASE: Dieser Modus misst die Phase zwi-
schen den Flanken zweier Kanäle im dargestell-
ten Bereich des Bildschirms (Phs). Die Messung
der Phase misst das Verhältnis des zeitlichen Versatzes
zwischen den eingestellten Quellen zur Signalperiode
der Messquelle. Es wird die am nähesten zur Zeitreferenz
31
Page 32

Messungen
liegende Flanke der Messquelle gesucht und von diesem
Zeitpunkt beginnend die am nähesten liegende Flanke der
Referenzquelle gesucht. Aus diesem Zeitunterschied und
der Signalperiode ergibt sich das Messergebnis in Grad.
Die Einstellungen der Mess- und Referenzquelle sind mit
den Softmenütasten MESSQUELLE bzw. REFERENZQUELLE möglich.
BURSTBREITE: Dieser Modus ermittelt die
Dauer eines Burst-Paketes von der ersten bis
zur letzten Flanke (Bst).
ZÄHLEN + : Dieser Modus zählt positive Impulse im dargestellten Bereich des Bildschirms
(Cnt). Ein positiver Impuls besteht aus einer
steigenden Flanke, gefolgt von einer fallenden
Flanke. Aus der Amplitude des Messsignals wird der
Mittelwert gebildet. Eine Flanke wird gezählt, wenn das
Signal den Mittelwert durchläuft. Ein Impuls mit nur einem
Durchgang durch den Mittelwert wird nicht gezählt. Die
Messung erfolgt jeweils nur für den ausgewählten Kanal.
ZÄHLEN – : Dieser Modus zählt negative Im-
pulse im dargestellten Bereich des Bildschirms
(Cnt). Ein negativer Impuls besteht aus einer
fallenden Flanke, gefolgt von einer steigenden Flanke. Aus
der Amplitude des Messsignals wird der Mittelwert gebildet. Eine Flanke wird gezählt, wenn das Signal den Mittelwert durchläuft. Ein Impuls mit nur einem Durchgang
durch den Mittelwert wird nicht gezählt. Die Messung
erfolgt jeweils nur für den ausgewählten Kanal.
ZÄHLEN +/ : Dieser Modus zählt Signalwech-
sel (Flanken) vom Low Level zum High Level
im dargestellten Bereich des Bildschirms (Cnt).
Aus der Amplitude des Messsignals wird der Mittelwert
gebildet. Eine Flanke wird gezählt, wenn das Signal den
Mittelwert durchläuft. Die Messung erfolgt jeweils nur für
den ausgewählten Kanal.
Abb. 8.2: Menü zum Einstellen der Automessfunktion
Das Ergebnis der Auto-Messung wird, je nach eingestellter
Messquelle (Softmenütaste QUELLE), in der jeweiligen
Kanal-Schriftfarbeangezeigt.DieErgebnissebendensich
am unteren Rand des Bildschirmes. Wird „n/a“ angezeigt,
so ist die Messung auf das Signal nicht anwendbar. Das ist
z.B. bei einer Spannungsmessung auf einen POD der Fall,
weil hierbei nur logische Zustände ohne Spannungsbezug
dargestellt werden. Wird ein „?“ angezeigt, liefert die Anzeige kein vollständiges Messergebnis. Beispielsweise ist
die zu messende Periode nicht vollständig dargestellt und
kann dadurch nicht ermittelt werden.
Aufgelistet werden nur die aktuell ausgewählten Quellen (mögliche Quellen sind die analogen, die digitalen und die Mathematikkanäle).
Die Softmenütaste ALLE AUS schaltet alle zuvor aktivierten Auto-Messungen aus.
ZÄHLEN –/ : Dieser Modus zählt Signalwech-
sel (Flanken) vom High Level zum Low Level
im dargestellten Bereich des Bildschirms (Cnt).
Aus der Amplitude des Messsignals wird der Mittelwert
gebildet. Eine Flanke wird gezählt, wenn das Signal den
Mittelwert durchläuft. Die Messung erfolgt jeweils nur für
den ausgewählten Kanal.
TRIGGERFREQUENZ: Dieser Modus misst die
Frequenz des Triggersignals basierend auf der
Periodendauer (fTr). Die Quelle für die Messung
ist die aktuell eingestellte Triggerquelle. Die Frequenz wird mit einem Hardwarezähler ermittelt, der eine
hohe Genauigkeit von 5 Stellen hat.
TRIGGERPERIODE: Dieser Modus misst die
Dauer der Perioden des Triggersignals mit ei-
nem Hardwarezähler (TTr).
32
Page 33

9 Analyse
Die R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202 Serie verfügt
über verschiedene Analysefunktionen für erfasste Datensätze, die auf dem Bildschirm angezeigt werden. Einfache
mathematische Funktionen können mit der „Quick Mathematik“, komplexere Funktionen sowie die Verkettung von
Funktionen können mit dem Formeleditor durchgeführt
werden (nur R&S®HMO1202 Serie). Das MATH Menü
beinhaltet Rechenfunktionen für die aufgenommenen Signalformen. Die mathematischen Funktionen verfolgen die
Änderungen der beinhalteten Signale und beziehen sich
nur auf den sichtbaren Bereich. Zusätzlich lässt sich die
Frequenzanalyse (FFT) mit einem Tastendruck aktivieren.
Für einen schnellen Überblick über die Signaleigenschaften sorgt die QUICK VIEW Funktion. Ein maskenbasierter
PASS/FAIL Test erlaubt die automatisierte Überwachung
von Signalen.
9.1 Mathematik-Funktionen
Das MATH Menü im VERTICAL Bedienfeld beinhaltet
einfache Rechenfunktionen für aufgenommene
Signalformen. Die mathematischen Funktionen verfolgen
die Änderungen der beinhalteten Signale und beziehen
sich nur auf den sichtbaren Bereich des Bildschirms. Wird
ein Signal am Bildschirmrand abgeschnitten, kann auch
die zugehörige Mathematikkurve abgeschnitten sein. Ist
eine Mathematik-Funktion aktiviert, so kann diese mittels
VOLTS/DIV Drehgeber skaliert werden.
Analyse
9.1.1 Quick Mathe matik (QM)
Nach dem Drücken der MATH-Taste im VERTICAL-Bedienfeld wird ein Kurzmenü aktiviert. Die untersten Softmenütasten QM oder MA aktivieren die Quick Mathematik
(QM) oder den Formeleditor (MA). Im QM Kurzmenü kann
mitdenSoftmenütastendieKongurationderMathe-
matik-Funktion vorgenommen werden. Wird die Taste
MENU im VERTICAL Bedienfeld betätigt, so wird eine
ausführlichere Darstellung des Menüs geöffnet. Die
Softmenütasten OPERAND 1 und OPERAND 2 wählen den
jeweiligen Kanal (Quelle) für die Mathematik-Berechnung.
Es können nur Analogkanäle ausgewählt werden, die
aktiviert sind. Mit der Softmenütaste OPERATOR wird die
Berechnungsart ausgewählt. Folgende Berechnungsarten
können gewählt werden
Addition
(ADD)
Subtraktion
(SUB)
Die Operanden bzw. der Operator werden mit dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld ausgewählt.
Multiplikation
(MUL)
Division
(DIV)
Abb. 9.1: Beispiel einer Mathematikkurve
Das Mathematik-Menü ist unterteilt in Quick Mathematik
(QM) und Formelsatz (MA). Die Quick Mathematik ist für
einfache und schnelle Rechnungen gedacht. Mit dem
Formelsatz hingegen sind kompliziertere Verknüpfungen
möglich. Im Mathematik Kurzmenü kann mit den
SoftmenütastendieKongurationderMathematik-Funktion vorgenommen werden.
Die R&S®HMO1002 Serie unterstützt nur die Quick Mathematik
(QM).
Abb. 9.2: Quickmathematik Menü
9.1. 2 Formeleditor (MA)
Das Formeleditor-Menü der R&S®HMO1202 Serie
(Softmenütaste MA) ermöglicht das Ein- und Ausschalten der mathematischen Gleichungen, die innerhalb des
ausgewähltenFormelsatzesdeniertundsichtbarsind.
Es werden nur Gleichungen aufgelistet, die sichtbar sind.
Die Taste MENU im VERTICAL Bedienfeld öffnet ein
MenüzurAuswahldesFormelsatzesundzurDenition
der zugehörigen Formeln. Die R&S®HMO Kompakt Serie
verfügt über fünf mathematische Formelsätze. In jedem
dieser Formelsätze stehen wiederum fünf Formeln zur
Verfügung, die mit einem Formeleditor bearbeitet werden,
umauchverknüpftemathematischeFunktionendenieren
zu können. Diese sind mit MA1 bis MA5 bezeichnet. Der
Formelsatz wird mit dem Universaldrehgeber im CURSOR/
MENU Bedienfeld eingestellt. Im Formelsatz-Editor (Soft-
33
Page 34

Analyse
Abb. 9.3: Formeleditor für Formelsatz
menütaste BEARBEITEN) sind die bereits vorhandenen
Gleichungen aufgelistet und können bearbeitet werden.
Die ausgewählte Gleichung ist mit einem blauen Balken
markiert. Hierbei wird zwischen der Bearbeitung der Anzeige und der Parameter unterschieden. Die gewünschte
Gleichung wird mit dem Universaldrehgeber im CURSOR/
MENU Bedienfeld ausgewählt und mit der Softmenütaste
SICHTBAR aktiviert. Eine aktivierte, sichtbare Gleichung
ist innerhalb des Formel-Editors durch ein ausgefülltes
Auge gekennzeichnet und im Kurzmenü aufgelistet. Im
Softmenü EINHEIT können mit dem Universaldrehgeber
im CURSOR/MENU Bedienbereich folgende Einheiten gewählt werden:
❙ V (Volt)
❙ A (Ampere)
❙ Ω (Ohm)
❙ V/A (Volt pro Ampere)
❙ W (Watt)
❙ VA (Volt Ampere)
❙ VAr (Blindleistung)
❙ dB (dezibel)
❙ m (Milli, 10-3)
❙ µ (Mikro, 10-6)
❙ n (Nano 10-9)
❙ p (Piko, 10
❙ f (Femto, 10
❙ a (Atto, 10
❙ z (Zepto 10
❙ y (Yokto, 10
-12
-18
-21
-24
)
-15
)
)
)
)
❙ K (Kilo, 103)
❙ M (Mega, 106)
❙ G (Giga, 109)
❙ T (Tera, 1012)
❙ P (Peta, 1015)
❙ E (Exa, 1018)
❙ Z (Zetta 1021)
❙ Y (Yotta, 1024)
❙ dBm (dezibel milliwatt)
❙ dBV (dezibel Volt)
❙ Hz (Hertz)
❙ F (Farad)
❙ H (Henry)
❙ % (Prozent)
❙ º (Grad)
❙ π (Pi)
❙ Pa (Pascal)
❙ m (Meter)
❙ g (Beschleunigung)
❙ ºC (Grad Celsius)
❙ K (Kelvin)
❙ ºF (Grad Fahrenheit)
❙ N (Newton)
❙ J (Joule)
❙ C (Coulomb)
❙ Wb (Weber)
❙ T (Tesla)
❙ (dez) (dezimal)
❙ (bin) (binär)
❙ (hex) (hexadezimal)
❙ (oct) (octal)
❙ DIV (Division, Skalenteil)
❙ px (pixel)
❙ Bit (Bit)
❙ Bd (Baud)
❙ Sa (Sample)
❙ s (Sekunde)
Die Einheit der Gleichung wird für die Kanalbezeichnung
und Cursor-/Automessarten übernommen. Die Soft-
menütaste LÖSCHEN entfernt die Gleichung aus dem
Formelsatz. Eine Gleichung besteht aus einem Operator
(Rechenfunktion) und bis zu zwei Operanden. Als Operatoren lassen sich mit dem Universaldrehgeber im CURSOR/
MENU Bedienbereich auswählen:
❙ Addition
❙ Subtraktion
❙ Multiplikation
❙ Division
❙ Maximum
❙ Minimum
❙ Quadrat
❙ Wurzel
❙ Betrag
❙ negativer Anteil
❙ Reziprok
❙ Invertiert
❙ dekadischer Logarithmus
❙ natürlicher Logarithmus
❙ Ableitung
❙ Integral
❙ IIR Tiefpasslter
❙ IIRHochpasslter
❙ Positiver Anteil
Als OPERANDEN (Quellen) sind für die jeweilige Gleichung
die Eingangskanäle CH1, CH2, CH3, CH4, sowie eine
einstellbare Konstante zugelassen. Bei der Formel MA2
kommt Quelle MA1, bei MA3 kommt MA2, bei MA4 entsprechend MA3 und schließlich bei MA5 noch MA4 hinzu.
Es lassen sich von diesen fünf Gleichungen insgesamt fünf
verschiedene Sätze erstellen, abspeichern und abrufen.
Neue Gleichungen lassen sich hinzufügen, indem mittels
Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld der
Menüpunkt „neu...“ im Formelsatz-Editor ausgewählt wird.
Durch Drücken der Softmenütaste HINZUFÜGEN kann die
neue Gleichung bearbeitet werden.
Abb. 9.4: Eingabe von Konstanten und Einheiten
Eine Konstante kann durch Drücken der Taste KONSTANTE
EDIT. und anschließender Auswahl mit dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienbereich aus folgenden
Konstanten gewählt werden:
❙ Pi
❙ 2x Pi
❙ 0,5 x Pi
❙ Nutzer 1 bis 10(max.10benutzerdenierteKonstanten)
Wird z.B. NUTZER1 als Konstante gewählt, so kann nach
Drücken der Softmenütaste ZAHLENWERT mit dem
Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienbereich
ein Zahlenwert eingestellt werden. Nach der gleichen Me-
34
Page 35

Analyse
thode kann ein DEZIMALPUNKT gesetzt und zusätzlich ein
SI-Präxeingegebenwerden(SoftmenütasteVORSATZ).
AlsEINHEITstehendiegleichenSI-PräxezurAuswahl,
die im Softmenü BEARBEITEN zur Verfügung stehen. Mit
SPEICHERN werden diese Einstellungen unter dem Namen
NUTZER 1 abgespeichert und ins Menü zur Bearbeitung
der Gleichung zurückgekehrt. Beim Speichern eines Formelsatzes kann zusätzlich ein Kommentar (Softmenütaste
KOMMENTAR) und ein Name (Softmenütaste NAME) mit
max. 8 Zeichen vergeben werden. Der Wunschname kann
mit dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld vergeben und mit der Taste ANNEHMEN gespeichert
werden. Die Namensvergabe kann für alle Gleichungen
separat durchgeführt werden. Der Name der Gleichung
ist im Formelsatz-Editor und als Beschriftung im Kurvenfenster aufgeführt. Wenn alle Gleichungen, Konstanten
und Namen eingegeben sind, kann dieser Formelsatz
ebenfalls mit einem Namen versehen werden, indem die
Taste NAME im Formelsatzmenü gedrückt und der Name
eingegeben wird. Ebenfalls ist möglich, ein Formelsatz zu
laden (interner Speicher oder USB Stick) oder zu speichern
(intern oder USB Stick). Durch Drücken der Taste SPEICHERN wird ein Formelsatz mit dem gewählten Namen
und Kommentar an den gewählten Ort gespeichert. Diese
abgespeicherten Formelsätze lassen sich jederzeit wieder
laden. Dazu wird das Mathematik-Menü durch Druck auf
die MATH-Taste aktiviert und anschließend die MENUTaste unter dem VOLTS/DIV Drehgeber betätigt. In diesem
Menü erscheint ein Menüpunkt LADEN. Dadurch wird der
Dateimanager gestartet, der den internen Speicherplatz
oder den eingesteckten USB Stick als möglichen Speicherplatz anzeigt. Dort wird die gewünschte Formelsatzdatei
ausgewählt und durch die Taste LADEN geladen.
dortdieGleichungMA1deniert.NachdemBetätigender
Softmenütaste BEARBEITEN können die entsprechenden
Funktionen mit dem Universaldrehgeber im CURSOR/
MENU Bedienfeld ausgewählt werden. In diesem Beispiel
wird Kanal CH1 mit einer Konstanten (0.1) multipliziert und
die Einheit A (Ampere) zugewiesen. Damit wird sichergestellt, dass sowohl die Skalierung als auch die Einheiten bei
Cursor- und Auto-Messungen korrekt angezeigt werden.
Die Gleichung MA1 kann zusätzlich mittels Softmenütaste
NAME in „STROM“ umbenannt werden.
Anschließend wird eine neue Gleichung MA2 eingefügt
und entsprechend so eingestellt, dass das Ergebnis der
Berechnung der Gleichung MA1 „STROM“ und der Kanal
CH2 miteinander multipliziert werden. Dies ergibt eine
Leistungskurve MA2. Die Gleichung MA2 kann zusätzlich
mittels Softmenütaste NAME in „LEISTUNG“ umbenannt
werden. Abschließend wird eine weitere Gleichung MA3
zum Formelsatz hinzugefügt, die als das Integral der Glei-
chungMA2„LEISTUNG“deniertwird.DieGleichung
MA3 kann zusätzlich mittels Softmenütaste NAME in
„ENERGIE“ umbenannt werden.
9.1.3 Beispiel für die erweiterte Mathematik
(R&S®HMO1202 Serie)
Abb.9.5:DenitionderStromgleichung
In diesem Beispiel soll eine Energiekurve dargestellt werden. Dazu wird die Spannung über dem Verbraucher mit
einem aktiven Differenztastkopf an Kanal 2 und der Strom
mit einer Stromzange an Kanal 1 aufgenommen. Zunächst
wird der Umrechnungsfaktor der Stromzange (100mV/A)
eingegeben. Hierzu wird der Formelsatz 1 aufgerufen und
Abb.9.6:DenitionderEnergiegleichung
JetztsindalleDenitionenerfolgtunddieErgebnissekön-
nen dargestellt und weiter analysiert werden. Die Analyse
kann mit den Cursor- oder auch mit den Auto-Messfunktionen schnell und einfach durchgeführt werden. Alle Messergebnisse sind richtig skaliert und zeigen die korrekte
Einheiten Ampere, Watt und Joule.
9.2 Frequenzanalyse (FFT)
Grundsätzlich unterscheidet sich die FFT in einem Oszilloskop von einem Spektrumanalysator und richtet sich neben
der Zeitbasiseinstellung auch nach der verfügbaren Anzahl
der verwendeten Erfassungspunkte bei der FFT Berechnung. Es können bis zu 128k Punkte in die FFT einbezogen
werden.
Für eine Analyse von sehr langsamen Signalen (Hz-Bereich) ist
die FFT ungeeignet; hierfür wird der klassische Oszilloskopmodus verwendet.
Das FFT Menü im ANALYZE Bedienfeld ermöglicht eine
schnelle Fourier-Transformation, welche das Frequenz-
35
Page 36

Analyse
spektrum des gemessenen Signals darstellt. Die veränderte Darstellungsweise ermöglicht die Ermittlung der
im Signal hauptsächlich vorkommenden Frequenzen und
deren Amplitude. Nach der Aktivierung des FFT Menüs
wird der Bildschirm wird in zwei Gitter unterteilt. Im oberen Bereich wird die Spannungs-Zeitkurve angezeigt, im
unteren Bereich das Ergebnis der Fourier-Analyse. In der
AnzeigeobenlinksbendensichdieInformationenzu
den Einstellungen im Zeitbereich, zwischen dem oberen
und unteren Fenster die Zoom- und Positionsangaben und
unterhalb des großen FFT Anzeigefensters die Einstellungen (Span und Center) im Frequenzbereich. Das untere
FFT Anzeigefenster ist nach dem Aktivieren der FFT weiß
umrandet. Diess bedeutet, dass der große Drehknopf im
HORIZONTAL Bedienfeld den Span einstellt. Der Span wird
in der Einheit Hz (Hertz) angegeben und kennzeichnet die
Breite des dargestellten Frequenzbereiches. Die Position
des Spans kann über den Wert von Center mittels des POSITION Drehgebers im HORIZONTAL Bedienfeld eingestellt
werden. Der dargestellte Frequenzbereich erstreckt sich
von (Center - Span/2) bis (Center + Span/2).
Die minimale Schrittweite ist abhängig von der Zeitbasis. Je
größer die Zeitbasis, desto kleiner der Span. Wichtige Voraussetzung für die FFT ist die Einstellung max. Abtastrate im ACQUIRE
Menü.
Mit der Softmenütaste MODUS können folgende Anzeigearten gewählt werden:
❙ NORMAL:
Die Berechnung und Darstellung der FFT erfolgt ohne
zusätzliche Bewertung oder Nachbearbeitung der
erfassten Daten. Die neuen Eingangsdaten werden
erfasst, angezeigt und überschreiben dabei die vorher
gespeicherten und angezeigten Werte.
❙ HÜLLKURVE:
Im Modus Hüllkurve werden zusätzlich zum aktuellen
Spektrum die maximalen Auslenkungen aller Spektren
separat gespeichert und bei jedem neuen Spektrum
aktualisiert. Diese Maximalwerte werden mit den
Eingangsdaten angezeigt und bilden eine Hüllkurve die
zeigt, in welchen Grenzen das Spektrum liegt. Es bildet
sich eine Fläche oder ein Schlauch mit allen jemals
aufgetretenen FFT Kurvenwerten. Bei jeder Änderung der
Signalparameter wird ein Rücksetzen der Hüllkurve
veranlasst.
❙ MITTELWERT:
Dieser Modus bildet den Mittelwert aus mehreren
Spektren und ist zur Rauschunterdrückung geeignet. Mit
der Softmenütaste MITTELW. und dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld wird die Anzahl der
Spektren für die Mittelwertbildung in 2er Potenzen von 2
bis 512 eingestellt.
Die Softmenütaste PUNKTE erlaubt die Einstellung der
maximal in die FFT Berechnung einbezogene Anzahl der
Erfassungspunkte mit Hilfe des Universaldrehgebers im
CURSOR/MENU Bedienfeld. Die möglichen Einstellungen
sind 2048, 4096, 8192, 16384, 32768, 65536, 131072
Abb. 9.7: FFT
Punkte. Mehr Punkte bei einem gleichbleibenden Span
resultieren in einer kleineren Frequenzschrittweite der FFT.
Die Punkteanzahl der Ausgangsdaten ist halb so groß,
wie die der Eingangsdaten. Die Softmenütaste FENSTER
verbessert die FFT-Darstellung bei Unstetigkeiten an den
Grenzen des Messintervalls. Unstetigkeiten werden von
einem Rechenalgorithmus als Sprung ausgewertet und
überlagern das Messergebnis. Im Falle einer glockenförmigen Fensterfunktion werden die Grenzen mit niedrigeren
WertenmultipliziertundderEinflussgedämpft.Folgende
Darstellungsformen können gewählt werden:
HANNING: Die Hanning-Fensterfunktion ist
glockenförmig. Sie ist im Gegensatz zu der
Fensterfunktion Hamming am Rand des Messintervals gleich Null. Daher wird der Rauschpegel im Spektrum reduziert und die Breite der Spektrallinien vergrößert.
Diese Funktion kann z.B. für eine amplitudengenaue Messung eines periodischen Signals genutzt werden.
HAMMING: Die Hamming-Fensterfunktion
ist glockenförmig. Sie ist im Gegensatz zur
Hanning- und Blackman Fensterfunktion am
Rand des Messintervalls ungleich Null. Daher ist die
Höhe des Rauschpegels im Spektrum größer als bei der
Hanning- oder Blackman-Fensterfunktion, aber kleiner als
bei der Rechteck-Fensterfunktion. Die Spektrallinien sind
hingegen im Vergleich zu den anderen glockenförmigen
Funktionen schmaler. Diese Funktion kann z.B. für eine
amplitudengenaue Messung eines periodischen Signals
genutzt werden.
BLACKMAN: Die Blackman-Fensterfunktion
ist glockenförmig und besitzt den steilsten Ab-
fall in ihrer Kurvenform unter den verfügbaren
Funktionen. Sie ist an den beiden Enden des Messintervalls Null. Mittels der Blackman-Fensterfunktion sind die
Amplituden sehr genau messbar. Die Frequenz hingegen
ist aufgrund der breiten Spektrallinien schwieriger zu bestimmen. Diese Funktion kann z.B. für eine amplitudengenaue Messung eines periodischen Signals genutzt werden.
36
Page 37

RECHTECK: Die Rechteck-Fensterfunktion
multipliziert alle Punkte mit Eins. Daraus resultiert eine hohe Frequenzgenauigkeit mit dünnen
Spektrallinien und erhöhtem Rauschen. Diese
Funktion kann bei Impulsantwort-Tests verwendet werden,
wenn die Anfangs- und Endwerte Null sind.
Mit der Softmenütaste Y-SKALIERUNG kann die FFT in der
Amplitude logarithmisch (dBm / dBV) oder linear (V
eff
) skaliert dargestellt werden. Die Einheit dBm (Dezibel-Milliwatt)
bezieht sich dabei auf 1 mW. Die Einheit dBV (Dezibel-Volt)
bezieht sich auf 1 V
. Die angezeigten Werte beziehen
eff
sichaufeinen50ΩAbschlusswiderstand.Dabeikannein
externer Abschlusswiderstand parallel zum hochohmigen
Eingang angeschlossen werden.
Die FFT Funktion kann durch Drücken der Softmenütaste
FFT AUS oder durch nochmaliges Drücken der FFT-Taste
im ANALYZE Bedienfeld deaktiviert werden.
9.3 Quick View
Nach dem Drücken der QUICK VIEW-Taste im ANALYZE
Bedienfeld werden einige grundlegende, automatische
Messungen aktiviert. Diese Funktion zeigt einen schnellen
Überblick über die typischen Signalgrößen. Die Ergebnisse
der Messungen werden am unteren Bildschirmrand
angezeigt. Folgende fünf Messwerte werden direkt am
Signal angezeigt:
❙ Maximaler Spannungswert (Vp+)
❙ Mittlerer Spannungswert (Mean)
❙ Minimaler Spannungswert (Vp-)
❙ Anstiegszeit (tr)
❙ Abfallzeit (tf)
Zehn weitere Messwerte werden am unteren Bildschrimrand angezeigt:
❙ RMS Wert Periodendauer (T)
❙ Spitze-Spitze Spannung (Vpp) Frequenz (f)
❙ Amplitude (V
) Anzahl pos. Flanken (Cnt)
Amp
❙ pos. Pulsbreite neg. Pulsbreite
❙ pos. Tastverhältnis (Dty+) neg. Tastverhältnis (Dty-)
Mittels AUTO MEASURE Taste können die sechs Messparameter rechts unter dem Bildschirm verändert werden. Diese
Änderungen werden erst durch ein RESET bzw. das Laden
der Standardeinstellungen rückgängig gemacht. Im Quick
View Modus kann immer nur ein Kanal aktiv sein. Alle Messungen erfolgen auf dem aktiven Kanal. Ein erneuter Druck
auf die QUICK VIEW-Taste schaltet den Modus aus.
9.4 PASS/FAIL Test basierend auf Masken
Mit Hilfe des Pass/Fail-Tests kann ein Signal darauf unter-
suchtwerden,obessichinnerhalbdenierterGrenzenbendet.DieseGrenzenwerdendurcheinesogenannte
Maske gesetzt. Überschreitet das Signal die Maske, liegt ein
Fehler vor. Diese Fehler werden zusammen mit den erfolgreichen Durchläufen und den gesamten Durchläufen am
Analyse
Abb. 9.8: PASS/FAIL Maskentest
unteren Rand des Bildschirms angezeigt. Zusätzlich ist es
möglich bestimmte Aktionen bei einem Fehler auszuführen.
AufSeite2|2desUTILMenüsimVERTICALBedienfeld
kann das PASS/FAIL Menü geöffnet werden. Bevor ein
Maskentest mit der Softmenütaste TEST gestartet wird
(AN), muss eine Maske erstellt / geladen und eine Aktion
gewählt werden. Masken werden auf dem Bildschirm als
grau-weiße Kurven dargestellt. Wurde eine Maske kopiert
oder geladen, können die Ausdehnungen der Signalform
und damit die Grenzen für den Test mittels der Menüpunkte
verändert werden. Um eine neue Maske zu erstellen, wird
die Softmenütaste NEUE MASKE betätigt. In diesem Menü
wird mit der Softmenütaste KANAL KOPIEREN das aktuelle Signal in einen Maskenspeicher kopiert. Diese Maske
ist weiß und liegt genau auf dem Ausgangssignal. Mit den
Softmenütasten Y-POSITION und STRECKUNG Y kann
diese Kurve vertikal verschoben oder vergrößert werden.
BREITE Y und BREITE X ermöglichen die Toleranzeinstellung der Maske. Mit dem Universaldrehgeber oder der
KEYPAD-Taste im CURSOR/MENU Bedienbereich lassen
sichdieWertemiteinerAuflösungvon1/100Skalenteil
eingeben. Eine Maske hat zu jedem erfassten Datum ein
Minimum- und Maximumwert. Für eine Quellkurve, die
nur einen Wert pro Datum aufweist, sind Minimum- und
Maximumwert gleich. Die Breite bezeichnet den Abstand
der Randpunkte vom Originalpunkt. Umso größer der gewählte Wert ist, desto größer können die Abweichungen
der Kurve in der Amplitude sein. Die Toleranzmaske wird
auf dem Bildschirm im Hintergrund weiß angezeigt. Die
erzeugte und bearbeitete Maske kann sofort für den Test
verwendetwerden,istabernurflüchtigimArbeitsspeicher
des Gerätes abgelegt. Mit der Softmenütaste SPEICHERN
kann die Maske dauerhaft auf einem USB Stick oder intern
gespeichert werden. Ein Druck auf die MENU OFF Taste
führt wieder zum Masken-Menü.
Die Softmenütaste MASKE LADEN öffnet einen Dateibrowser, mit dem zuvor abgespeicherte Masken für den
Test geladen werden können (Dateiendung .HMK). Eine
geladene Maske kann innerhalb des Menüs NEUE MASKE
verändert werden. Änderungen werden nur für die Datei
übernommen, wenn die Maske nach dem Bearbeiten ge-
37
Page 38

Analyse
speichert wird. Das Softmenü AKTIONEN bietet folgende
Optionen:
❙ Ton bei Verletzung
❙ Stopp bei einstellbarer (1. bis >10000.) Verletzung
❙ Impuls bei Verletzung (gibt am AUX OUT bei Verletzung
der Maske einen Impuls aus)
❙ Bildschirmausdruck bei Verletzung auf USB Stick
❙ Bildschirmausdruck bei Verletzung auf angeschlossenen
Drucker
Eine Aktion wird ausgeführt, wenn ihre Bedingung (z.B.
eine gewisse Anzahl von Maskenverletzungen) erfüllt ist.
Jede Aktion hat eine eigene Bedingung, die getrennt von
denanderenAktionendeniertwerdenkann.Diejeweilige
Bedingung kann innerhalb des Menüs der jeweiligen Aktion
eingestellt werden. Die gewünschte Aktion wird durch
Druck auf die entsprechende Softmenütaste ausgewählt.
Mit der MENU OFF Taste wird in das Hauptmenü zurückgekehrt und der Maskentest kann gestartet werden. Rechts
unter dem Anzeigefenster werden die Gesamtanzahl und
die Gesamtzeitdauer der Tests in Weiß, die Anzahl der
erfolgreichen Tests und deren prozentualer Anteil in Grün,
sowie die Anzahl der Fehler und deren prozentualer Anteil
in Rot angezeigt. Wurde ein Test gestartet (AN), so wird
die bisher nicht anwählbare Softmenütaste PAUSE aktiv.
Wird die PAUSE-Taste gedrückt, so wird der Test unterbrochen, die Erfassung von Signalen und die Gesamtzeitdauer
laufen jedoch weiter. Wird die PAUSE-Taste erneut gedrückt, so wird der Test fortgesetzt und alle Ereigniszähler
werden weiter hochgezählt. Wird ein Test mit der Softmenütaste TEST deaktiviert (AUS), so werden die Ereignisund Zeitzähler angehalten. Wird ein neuer Test gestartet,
so werden alle Zähler zurückgesetzt und beginnen wieder
bei Null. Der PASS/FAIL Modus wird durch Drücken der
Softmenütaste PASS/FAIL AUS beendet.
9.5 Komponententester
Die R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202 Serie verfügt
über einen eingebauten Komponententester, der im UTIL
Menü (VERTICAL Bedienfeld) mit der Softmenütaste
COMP. TEST aktiviert werden kann. Der zweipolige Anschluss des zu prüfenden Bauelementes erfolgt über die
AUX OUT Buchse mittels Adapter BNC auf Banane (z.B.
HZ20).
Nur entladene Kondensatoren dürfen getestet werden!
Es dürfen Signalspannungen an den Front-BNC-Buchsen
der Kanäle weiter anliegen, wenn einzelne nicht in SchaltungenbendlicheBauteile(Einzelbauteile)getestetwerden. Nur in diesem Fall müssen die Zuleitungen zu den
BNC-Buchsen nicht gelöst werden (siehe Kap. 9.5.1). Das
Testprinzip beruht auf einem integrierten Sinusgenerator,
welcher ein Signal mit max. 10 V Amplitude und einer Frequenz von 50 Hz oder 200 Hz (±10%) bereitstellt. Sie speist
eine Reihenschaltung aus Prüfobjekt und eingebautem
Widerstand. Ist das Prüfobjekt eine reelle Größe (z.B. ein
Widerstand), so sind beide Spannungen phasengleich.
Auf dem Bildschirm wird ein mehr oder weniger schräger
Strich dargestellt.
Sollen Bauteile getestet werden, die sich in Testschaltungen
bzw. Geräten benden, müssen die Schaltungen bzw. Geräte
unter allen Umständen vorher stromlos gemacht werden. Soweit
Netzbetrieb vorliegt ist auch der Netzstecker des Testobjektes zu
ziehen. Damit wird sichergestellt, dass eine Verbindung zwischen
Oszilloskop und Testobjekt über den Schutzleiter vermieden wird.
Sie hätte falsche Testergebnisse zur Folge.
Ist das Prüfobjekt kurzgeschlossen, so wird ein senkrechter Strich auf dem Bildschirm gezeigt. Ohne Prüfobjekt
oder bei Unterbrechung zeigt sich eine waagerechte Linie.
Die Schrägstellung des Striches ist ein Maß für den Widerstandswert. Damit lassen sich ohmsche Widerstände
zwischenΩundkΩtesten.KondensatorenundInduktivitäten (Spulen, Drosseln, Trafowicklungen) bewirken eine
Phasendifferenz zwischen Strom und Spannung. Dies
ergibt ellipsenförmige Bilder. Lage und Öffnungsweite der
Ellipse sind kennzeichnend für den Scheinwiderstandswert
bei einer Fre quenz von 50 Hz (bzw. 200 Hz). Kondensatoren
werden im Bereich µF bis mF angezeigt. Eine Ellipse mit
horizontaler Längsachse bedeutet hohe Impedanz (kleine
Abb. 9.9: HZ20 Adapter verbunden mit AUX OUT
38
Abb. 9.10: Komponententest-Beispiel.
Page 39

Analyse
Kapazität oder große Induk ti vität). Eine Ellipse mit vertikaler Längsachse bedeutet niedrige Impedanz (große Kapazität oder kleine Induktivität). Eine Ellipse in Schräglage
bedeutet einen relativ großen Verlustwiderstand in Reihe
mit dem Blindwiderstand.
dass die Anschlussumpolung eines Halbleiters eine 0 Drehung des Testbilds um 180° um den Rastermittelpunkt des
Bildschirms bewirkt. Wichtiger noch ist die einfache Gut-/
Schlecht-Aussage über Bauteile mit Unterbrechung oder
Kurzschluss, die im Service-Betrieb erfahrungsgemäß am
häugstenbenötigtwird.
Bei einzelnen MOS-Bauelementen sollte in Bezug auf statische
Auadung oder Reibungselektrizität entsprechend sorgsam gearbeitet werden.
9.5.1 Tests direkt in der Schaltung
Direkte Tests in einer Schaltung sind in vielen Fällen
möglich, aber nicht so eindeutig. Durch Parallelschaltung
reeller und/oder komplexer Größen – besonders wenn
diese bei einer Frequenz von 50 Hz/200 Hz relativ niederohmig sind – ergeben sich meistens große Unterschiede
gegenüber Einzelbauteilen. Wird oft mit Schaltungen
gleicher Art gearbeitet (Service), dann hilft auch hier ein
Vergleich mit einer funktionsfähigen Schaltung. Dies geht
sogar besonders schnell, weil die Vergleichsschaltung
gar nicht unter Strom gesetzt werden muss (und darf!).
Mit den Testkabeln sind die identischen Messpunktpaare
nacheinander abzutasten und die Schirmbilder zu vergleichen. Unter Umständen enthält die Testschaltung selbst
schon die Vergleichsschaltung, z.B. bei Stereo-Kanälen,
Gegen taktbetrieb, symmetrischen Brücken schal tungen. In
Zweifelsfällen kann ein Bauteilanschluss einseitig abgelötet
werden.
Abb. 9.11: Komponententester Testbilder
Bei Halbleitern sind die spannungsabhängigen Kennlinienknicke beim Übergang vom leitenden in den nichtleitenden
Zustand erkennbar. Soweit spannungsmäßig möglich, werden Vorwärts- und Rückwärts-Charakteristik dargestellt
(z.B. bei einer Z-Diode unter ca. 9 V). Es handelt sich immer
um eine Zweipol-Prüfung. Aus diesem Grund kann z.B.
die Verstärkung eines Transistors nicht getestet werden,
aber die einzelnen Übergänge B-C, B-E, C-E. Da der Teststrom nur einige mA beträgt, können die einzelnen Zonen
fast aller Halbleiter zerstörungsfrei geprüft werden. Eine
Bestimmung von Halbleiter-Durchbruch- und Sperrspannung > ca. 9 V ist nicht möglich. Das ist im Allgemeinen
kein Nachteil, da im Fehlerfall in der Schaltung grobe
Abweichungen auftreten, die eindeutige Hinweise auf das
fehlerhafte Bauelement geben. Recht genaue Ergebnisse
werden beim Vergleich mit sicher funktionsfähigen Bauelementen des gleichen Typs und Wertes erzielt. Dies gilt
insbesondere für Halbleiter. Damit kann z.B. der kathodenseitige Anschluss einer Diode oder Z-Diode mit unkenntlicher Bedruckung, die Unterscheidung eines p-n-p-Transistors vom komple men tären n-p-n-Typ oder die richtige
Gehäuseanschluss folge B-C-E eines unbekannten Transistortyps schnell ermittelt werden. Zu beachten ist hierbei,
9.6 Digitalvoltmeter
Das Digitalvoltmeter erfasst lückenlos Eingangsdaten
mitdereingestelltenvertikalenEmpndlichkeitundder
zugrundelegenden Genauigkeit des ADC. Das Digitalvoltmeter ist von Erfassungseinstellungen und Nachbearbeitungen der Wandlerwerte unabhängig. Die Werteermittlung erfolgt über das Messinterval,umdendenierten
Frequenzbereich von 20 Hz bis 100 kHz zu garantieren. Das
Messintervall des Digitalvoltmeters entspricht nicht dem
Erfassungszeitintervall. Dadurch können sich andere Messwerte gegenüber den AUTO Messfunktionen ergeben.
Die Analysefunktion DIG. VOLTMETER kann über das UTIL
Menü im VERTICAL Bedienfeld aktiviert werden. Das Digitalvoltmeter bietet eine 3-stellige Spannungsanzeige als
Siebensegmentanzeige unter Verwendung der Analogka-
näle.VierfreikongurierbareMessanzeigensindmöglich,
wobei zwei Messwertanzeigen für Kanal 1 (CH1) und zwei
Messwertanzeigen für Kanal 2 (CH2) verfügbar sind. Pro
Kanal sind die Messwertanzeigen in einen primären (Softmenütaste KANAL 1 / KANAL 2)und einen sekundären
Messplatz unterteilt (Softmenütaste SECONDARY). Die
primäre Messwertanzeige wird groß, die sekundäre Messwertanzeige klein dargestellt.
Alle Messwertanzeigenn sind voneinander unabhängig
kongurierbar.Folgendeprimärebzw.sekundäreMesswertanzeigen stehen zur Auswahl:
39
Page 40

Analyse
❙ AUS: Messwertanzeige deaktiviert
❙ DC: Mittelwert
❙ DC RMS: Effektivwert
❙ AC RMS: Standardabweichung
❙ CREST FAKTOR:Scheitelfaktor(|X|
❙ SPITZE SPITZE: Maximum-Minimum
❙ SPITZE +: Maximum
❙ SPITZE -: Minimum
Abb. 9.12: Digital Voltmeter.
Mit der Softmenütaste POSITION kann die Anzeigeposition des Digitalvoltmeters auf dem Bildschirm verändert
werden. Während dem XY-Modus ist die Anzeigeposition
des Digitalvoltmeter fest vorgegeben und nicht veränderbar. Die Softmenütaste VOLTMETER OFF deaktiviert die
Digitalvoltmeter-Funktion und schließt das Menü.
max/XRMS
)
10 Signalerzeugung
10.1 Funktionsgenerator
Die R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202 Serie besitzt
einen integrierten Funktionsgenerator, welcher z.B.
Eingangssignale beim Testen von Schaltkreisen erzeugen
kann. Der Funktionsgenerator kann über das UTIL Menü
im VERTICAL Bedienfeld mit der Softmenütaste FUNKTIONSGEN. aktiviert werden. Folgende Signalformen können generiert und an der AUX OUT Buchse bereitgestellt
werden:
❙ DC
❙ SINUSFÖRMIG: Frequenzbereich von 0,1 Hz bis 50 kHz
❙ RECHTECK: Frequenzbereich von 0,1 Hz bis 50 kHz
❙ PULS: Frequenzbereich von 0,1 Hz bis 10 kHz
❙ DREIECK: Frequenzbereich von 0,1 Hz bis 10 kHz
❙ RAMPE: Frequenzbereich von 0,1 Hz bis 10 kHz
Mit der Softmenütaste FREQUENZ kann die Signalfrequenz, mit der Softmenütaste AMPLITUDE die Signalamplitude mit dem Universaldrehgeber oder numerisch mit der
KEYPAD Taste im CURSOR/MENU Bedienfeld eingestellt
werden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, einen DC Offset zu wählen (Softmenütaste OFFSET). Ein Informationsfeld zeigt die entsprechende Signalform mit den eingestellten Parametern als Vorschau. Mit der Softmenütaste AUS
wird der Funktionsgenerator deaktiviert und das Menü
geschlossen.
10.2 Mustergenerator
Der Mustergenerator beinhaltet die Ausgabe von parallelen
Mustern auf den vier Pins S0 bis S3 an der Gerätevorderseite. Ihm liegt ein 2048 Bit (Samples) breiter Speicher
zugrunde, welcher zyklisch / einzeln ausgegeben werden
kann. Alle Unterfunktionen des Mustergenerator berufen
sich auf diesen Speicher. Die parallele Ausgaben mehrerer
Funktionen ist nicht möglich. Die zu verwendeten Pins
werden in einem Informationsfenster gezeigt. Das Mustergenerator-Menü bietet verschiedene Auswahlmöglichkeiten und wird über das UTIL Menü im VERTICAL Bedienfeld
mit der Softmenütaste MUSTERGEN. geöffnet.
40
Funktion Einstellmöglichkeiten
Rechteck Frequenz / Periode, Polarität, Tastverhältnis
Zähler Frequenz, Zählrichtung
Arbitrary Timing, Pattern-Eingabe
Manuell Manuelles Schalten der 4 Einzelleitungen
UART Polarität, Einstellung der Bitrate
SPI / I2C / CAN / LIN Einstellung der Bitrate
Tab. 10.1: Einstellmöglichkeiten des Pattern-Generators
10.2.1 Rechteck
Mit dem Softmenü RECHTECK kann ein ein manueller
Tastkopf-Abgleich ohne Abgleich-Wizard erfolgen. Die
Rechteckfunktion verwendet ein 100 Samples breites Pattern (100 Zustände). Zusätzlich kann die POLARITÄT und
das DUTY CYCLE (1% bis 99%) geändert werden.
Page 41

Signalerzeugung
10.2.2 Zähler
Es wird ein 4 Bit breites Zählpattern
ausgegeben. Der Nutzer kann die
Zählrichtung (Softmenütaste RICHTUNG) und die Frequenz (Softme-
Pin Frequenz
S0 f/2
S1 f/4
S2 f/8
S3 f/16
nütaste FREQUENZ) bestimmen. Die
Nutzerfrequenz f bezieht sich stets
Tab. 10.2: Zähler
auf den Wechsel des Patternzustandes. Damit ergeben sich für die einzelnen Pins Rechtecksignale, wie in Tab. 10.2 beschrieben.
10.2.3 Arbiträr
Der Benutzer kann ein 4 Bit breites und 2048 Sample tiefes
MusterüberdasSoftmenüARBITRÄRdenieren.Dieerstellten Muster können gespeichert bzw. geladen werden.
Ist die Arbitrary-Funktion aktiv, bleibt das vorhergehende
Pattern, welches ggf. automatisch erzeugt wurde, erhalten. Dies bedeutet, dass z.B. ein SPI-Muster betrachtet
und nach eigenen Bedürfnissen angepasst werden kann.
Abb. 10.1: Arbitrary Menü
Folgende Einstellungsmöglichkeiten sind verfügbar:
❙ MUSTEREINST.:
Mit der Softmenütaste MUSTERLÄNGE kann die Tiefe
des Musters bestimmt werden. Mit dem INDEX können
mit dem Universaldrehgeber oder der KEYPAD Taste im
CURSOR/MENU Bedienfeld die einzelnen Samples
ausgewählt werden. Das ausgewählte Sample wird im
Informationsfenster als hellblaue Linie gezeigt. Die
Sample-Auswahl erfolgt ebenfalls mit dem Universaldrehgeber oder der KEYPAD Taste. Die Darstellung des
Pattern-Verlaufs erfolgt im Fenster für alle 4 Bits. Es
werden um den Index herum ±8 Bits angezeigt. Mit der
Softmenütaste WERT kann der Wert des gewählten
Samples geändert werden. Mittels Softmenütaste
ZEICHNEN können große Mengen von Samples mit dem
gleichen Wert „gezeichnet“ werden. Hierbei bleibt die
WERT-Einstellung erhalten und wird auf alle angewählten
Indize angewandt. Wird das Pattern gelöscht (Softmenütaste ALLES LÖSCHEN), so wird dessen Länge auf 1
zurückgesetzt. Alle Leitungen werden auf ‚0‘ gesetzt.
Abb. 10.2: Arbitrary Mustereinstellungen
❙ ZEITEINSTELLUNG:
Mit der Softmenütaste BITZEIT wird die Zeit eingestellt,
die jedes Sample angelegt sein soll. Die Zeit ist für alle
Samples gleich. Die einstellbare PERIODE bezieht sich auf
das gesamte Pattern und errechnet sich aus dessen
Länge multipliziert mit der Bitzeit (Zeit eines Samples). Ist
die BURST-Funktion aktiv (AN), so wird nach jeder
Pattern-Ausgabe die TOTZEIT abgewartet. Erst danach
wird das Muster erneut ausgegeben. Die Angabe von
N-ZYKLEN erlaubt es dem Benutzer das Pattern genau
<n> mal auszugeben. Die Zeit eines Samples kann von
20 ns bis 42 s mit einer Schrittweite von 10 ns angegeben
werden. Die Implementierung erfolgt in Form eines 32
Bit-Zählers. Die TOTZEIT zwischen den Pattern kann von
20 ns bis 42 s mit einer Schrittweite von 10 ns angegeben
werden. Sie ist ebenfalls als 32 Bit-Zähler implementiert.
Die Werteeingabe erfolgt mit dem Universaldrehgeber
oder der KEYPAD Taste im CURSOR/MENU Bedienfeld.
❙ SPEICHERN/LADEN:
Das manuell erstellte Pattern kann mit dem Softmenü
SPEICHERN bzw. LADEN gespeichert bzw. geladen
werden. Das Pattern kann entweder intern oder auf einem
extern angeschlossenen USB Stick gespeichert werden.
Das Pattern-Muster und die Zeiteinstellungen werden
gespeichert.
❙ ARB. TRIGGER:
Die Softmenütaste ARB. TRIGGER stellt drei mögliche
Triggerfunktionen zur Verfügung. Die Einstellung KONT.
(kontinuierlicher Trigger) gibt das Pattern kontinuierlich
aus. Ist die BURST-Funktion aktiv, so wirkt nur die
TOTZEIT zwischen den Pattern. Die Einstellung N-ZYKLEN
wird durch die kontinuierliche Ausgabe ausgehebelt. Bei
der Einstellung EXT. (externer Trigger) erfolgt die
Pattern-Ausgabe durch eine Flanke am externen Eingang
des Oszilloskops (TRIG. EXT.). Ist die BURST-Funktion
aktiv, so wird das Pattern <n> mal ausgegeben (siehe
N-ZYKLEN). Zusätzlich kann die Richtung der auslösenden
Flanke bestimmt werden. Ist die Flankenrichtung BEIDE
gewählt, so sind beide Flanken gleichwertig. Die erste
Flanke löst das Pattern aus. Es erfolgt keine Alternierung
der Flanken. Bei der Einstellung MAN. erfolgt die
Pattern-Ausgabe durch manuellen Tastendruck. Ist die
BURST-Funktion aktiv, so wirken TOTZEIT und N-ZYKLEN.
41
Page 42

Signalerzeugung
10.2.4 Manuell
Im manuellen Pattern-Modus werden die Betriebszustände
der einzelnen Pins S0 bis S3 separat geschaltet. Jedes Pin
wird einer Softmenütaste zugeordnet und somit der Zustand HIGH (H) oder LOW (L) ausgewählt.
10.2.5 BUS Signalquelle
Über die Pattern Generator-Anschlüsse an der Gerätevorderseite können je nach Einstellung folgende BUS Signale
(bei Messungen ohne Messobjekt) generiert werden:
❙ SPI: Datenrate 100 kBit/s, 250 kBit/s oder 1 MBit/s
❙ I2C: Datenrate 100 kBit/s, 400 kBit/s, 1 MBit/s oder
3,4 MBit/s
❙ UART: Datenrate 9600 Bit/s, 115,2 kBit/s und 1 MBit/s
❙ CAN: bis zu 50 MBit/s
❙ LIN: bis zu 50 MBit/s
Die BUS Signalquelle ist nicht frei programmierbar, sie gibt ein
pseudo Zufallspattern aus. Lediglich die Protokollart sowie die
Übertragungsgeschwindigkeit kann ausgewählt werden.
11 Dokumentation,
Speichern
und Laden
Das Oszilloskop ermöglicht, alle Bildschirmdarstellungen,
die Benutzereinstellungen (wie zum Beispiel die Triggerbedingung und Zeitbasiseinstellung), Referenzen und
Kurven abzuspeichern. Es steht intern im Gerät ein
Speicher für Referenzkurven und Geräteeinstellungen zur
Verfügung. Bildschirmfotos sowie Kurvendaten lassen sich zusätzlich auf einem angeschlossenen USB Stick ablegen.
Der USB Stick sollte nicht größer als 4GB und FAT (FAT16/32)
formatiert sein. Eine große Anzahl von Dateien auf dem USB
Stick sollte vermieden werden.
Dabei ist der Anschluss links immer Masse und die Signalpegel betragen etwa 1 V. Die folgende Tabelle zeigt die
Belegung der vier Ausgänge S1, S2, S3 und je nach
Signal.
Signal S1 S2 S3 S0/
SPI Clock MOSI MISO Chip Select
I2C Data SDA unbenutzt unbenutzt Clock SCL
UART RX unbenutzt unbenutzt TX
CAN CAN L unbenutzt unbenutzt CAN H
LIN Low unbenutzt unbenutzt High
Tab. 10.3: Pin-Belegung der BUS Signalquelle
Zu jeder Betriebsart wird ein Informationsfenster mit der
entsprechenden Anschlussbelegung eingeblendet. Durch
Druck auf die jeweilige Softmenütaste wird ein Untermenü
mit der Bitrateneinstellung der gewählten Betriebsart
geöffnet.
Über das SAVE/RECALL Menü können im Softmenü
GERÄTEEINST. über die Softmenütaste LADEN bereits
vordenierteEinstellungsdateienfürdieBUSSignalquelle
für SPI/SSPI, I2C, UART, CAN und LIN aus dem internen
Speicher geladen werden.
Das Hauptmenü für das Speichern und Laden von Funktionen wird durch Druck auf die Taste SAVE/RECALL im
GENERAL Bedienfeld aufgerufen.
11.1 Geräteeinstellungen
Abb. 11.1: Basismenü für Geräteeinstellungen
Im Softmenü GERÄTEEINST. können die aktuellen Geräteeinstellungen gespeichert, bereits gespeicherte Einstellungen geladen oder Geräteeinstellungen im- oder
exportiert werden.
42
Geräteeinstellungen einer alten Firmwareversion im SCP Format
können mit einer neuen Firmwareversion wieder geladen werden
Das Softmenü SPEICHERN öffnet das Speichermenü, in
dem mittels Softmenütaste SPEICHERORT ein möglicher
Speicherort (interner Speicher oder vorderer USB-Anschluss) ausgewählt werden, auf dem die Geräteeinstellungen gespeichert werden sollen. Ein Dateimanager
öffnet sich. Der DATEINAME kann an die jeweilige Einstellung angepasst bzw. verändert werden (SET ist die
Standardbezeichnung). Über die Softmenütaste
KOMMENTAR kann ein Kommentar eingegeben werden,
Page 43

Dokumentation, Speichern und Laden
der in der Fußzeile des Dateimanagers erscheint, wenn
eine Datei ausgewählt wurde. Mit SPEICHERN werden die
Einstellungen gespeichert.
Abb. 11.2: Geräteeinstellungen speichern
Um abgespeicherte Geräteeinstellungen wieder zu laden,
wird das Softmenü LADEN durch Druck der entsprechenden Softmenütaste geöffnet. Es öffnet sich der Dateimanager, in welchem mit dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld die gewünschte Datei ausgewählt
werden kann. Ist der Speicherort und die entsprechende
Einstellungsdatei ausgewählt, so kann diese mit der Softmenütaste LADEN geladen werden. Zum Entfernen von
nicht mehr benötigten Dateien wird die entsprechende Einstellungsdatei mit dem Universaldrehgeber im CURSOR/
MENU Bedienfeld ausgewählt und mit der Softmenütaste
DATEI LÖSCHEN entfernt. Bei einem angeschlossen USB
Stick können zusätzlich Verzeichnisse gewechselt und
gelöscht werden. Mittels der Softmenütaste SORTIERUNG
können mehrere Einstellungsdateien nach Name, Typ,
Größe oder Datum sortiert werden.
Um Geräteeinstellungen zu im- oder exportieren, muss ein
USB Stick angeschlossen sein, ansonsten ist das Menü nicht
auswählbar.
Das Softmenü IMPORT/EXPORT dient zum Kopieren einer
Datei von einem internen in ein externes Speichermedium
(USB Stick) oder umgekehrt. Mit den Softmenütasten
QUELLDATEI und ZIELPFAD werden Quelle und Ziel für
den Kopiervorgang ausgewählt. Hier wird jeweils ein Dateimanager geöffnet, in dem mit dem Universaldrehgeber
im CURSOR/MENU Bedienfeld der Speicherort festgelegt
wird. Ein ZIELNAME kann ebenfalls vergeben werden.
Durch Druck auf die Softmenütaste IMPORT/EXPORT wird
gemäß der Voreinstellung die gewählte Einstellungsdatei
kopiert.
11. 2 Referenzen
Referenzen sind Datensätze, die aus den Einstellungsinformationen und den AD-Wandlerdaten bestehen. Diese können sowohl intern als auch extern abgespeichert und zurückgeladen werden. Das Zurückladen erfolgt in einen der
maximal 4 Referenzspeicher (RE1 bis RE4), die auch angezeigt werden können. Das Hauptmerkmal von Referenzen
ist, dass beim Speichern und Rückladen alle Informationen
(wie vertikale Verstärkung, Zeitbasiseinstellungen etc. und
die AD-Wandlerdaten) mit übertragen werden und damit
das Ursprungssignal mit seinen Werten verglichen werden
kann.
Im Softmenü REFERENZEN können Referenzkurven nur
im- oder exportiert werden (Softmenü IMPORT/EXPORT).
Damit ist das Übertragen von Referenzkurven auf andere
HMO Geräte möglich. Dieses Menü dient zum Kopieren einer Datei von einem internen in ein externes Speichermedium (USB Stick) oder umgekehrt. Mit den Softmenütasten QUELLDATEI und ZIELPFAD werden Quelle und Ziel
für den Kopiervorgang ausgewählt. Hier wird jeweils ein
Dateimanager geöffnet, in dem mit dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld der Speicherort festgelegt wird. Ein ZIELNAME kann ebenfalls vergeben werden.
Als ZIELFORMAT kann das Dateiformat BIN (MSB/LSB),
FLT (MSB/LSB), CSV, HRT oder TXT mit dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld gewählt werden. Durch Druck auf die Softmenütaste IMPORT/EXPORT
wird gemäß der Voreinstellung die gewählte Einstellungsdatei kopiert.
Für das Speichern und Laden von Referenzen ist ein eigenes Referenzmenü verfügbar, welches über die Taste
REF im VERTICAL Bedienfeld geöffnet wird. Mittels der
Softmenütaste RE1 bis RE4 können die bis zu vier möglichen Referenzkurven eingeschaltet werden. Mit der
Softmenütaste QUELLE kann mit dem Universaldrehgeber
im CURSOR/MENU Bedienfeld die Quelle für die zu speichernde Referenz ausgewählt werden. Auswählbar sind
aktivierte Kanäle und Mathematikkurven. Die Softmenütaste ANZEIGEN stellt die gewählte Referenzkurve in Weiß
dar bzw. aktualisiert die bestehende Referenzkurve.
Zusätzlich bietet die Softmenütaste STANDARDEINST. die
Möglichkeit, die werksseitig vorgegebenen Standardeinstellungen zu laden.
Abb. 11.3: Referenzen laden und speichern
43
Page 44

Dokumentation, Speichern und Laden
Um eine Referenz von einem USB Stick oder aus dem
internen Speicher zu laden, wird das Softmenü LADEN geöffnet. Das Softmenü LADEN zeigt nun ein Fenster mit den
intern abgespeicherten Referenzen. Mit der Softmenütaste
LADEN kann die gewünschte Datei im Dateimanager ausgewählt werden. Endgültig geladen und angezeigt wird die
Referenz nach dem erneuten Druck auf die Softmenütaste
LADEN im Dateimanagermenü. Werden Referenzkurven
gespeichert, so werden gleichzeitig auch die Geräteeinstellungen gespeichert. Mit der Softmenütaste EINST. LADEN
werden somit die Geräteeinstellungen der ausgewählten
Referenzkurve geladen. Um eine Referenzkurve abzuspeichern, wird das Softmenü SPEICHERN geöffnet, die
gewählte Quelle und der gewählte Speicherort sowie der
vergebene Dateiname kontrolliert und die Kurve durch Drücken der Softmenütaste SPEICHERN gespeichert. Der DATEINAME kann an die jeweilige Einstellung angepasst bzw.
verändert werden (REF ist die Standardbezeichnung). Über
die Softmenütaste KOMMENTAR kann ein Kommentar
eingegeben werden, der in der Fußzeile des Dateimanagers
erscheint, wenn eine Datei ausgewählt wurde.
11. 3 K u rve n
Neben Referenzkurven können auch nur die AD-Wandlerdaten abgespeichert werden. Kurven können nur auf
einem extern angeschlossenen USB Stick (nicht intern)
abgespeichert werden. Je nach eingestellter Zeitbasis und
Abtastrate im ACQUIRE Menü (AUTOMATIK, MAX.
ABTASTRATE oder MAX. WIEDERHOLRATE) variiert die
Anzahl der maximalen auslesbaren Messwertpunkte.
Der gesamte Erfassungsspeicher kann nur ausgelesen werden,
wenn im ACQUIRE Menü die maximale Abtastrate gewählt wurde
und sich das Gerät im STOP Modus bendet. .
Als Speicherort ist bereits der USB Stick Anschluss auf
der Gerätevorderseite ausgewählt. Ist das Softmenü SPEICHERORT ausgegraut, so ist kein USB Stick angeschlossen oder der USB Stick wurde nicht erkannt. Wird ein USB
Stick erkannt, so können Verzeichnisse gewechselt, erstellt
oder Dateien gelöscht werden. Mittels der Softmenütaste
SORTIERUNG können mehrere Einstellungsdateien nach
Name, Typ, Größe oder Datum sortiert werden. Die Wahl
des Zielverzeichnisses wird mit VERZ. ANNEHMEN bestätigt und kehrt automatisch wieder in das Kurven-Hauptmenü zurück.
Das Speichern von allen sichtbaren Kanälen ist auf das Format CSV
beschränkt. Ein anderes Format kann nicht ausgewählt werden.
Mittels Softmenütaste KURVE und dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld erfolgt die Auswahl des
Kanals, der als Kurve abgespeichert werden soll. Es können nur die Kanäle ausgewählt werden, die auch mit den
Kanaltasten aktiviert wurden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit alle sichtbaren Kanäle gleichzeitig abzuspeichern.
Die Softmenütaste DATEINAME öffnet das Nameneingabemenü, in dem mit dem Universaldrehgeber im CURSOR/
MENU Bedienfeld ein Name eingegeben und mit ANNEH-
Abb. 11.4: Menü zum Abspeichern von Kurven
MEN bestätigt werden kann (TRC ist die Standardbezeichnung). Automatisch erscheint wieder das Kurven-Hauptmenü. Mittels Softmenütaste FORMAT und dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld ermöglicht
die Auswahl des Dateiformates. Folgende Formate können
ausgewählt werden:
❙ BIN (MSB/LSB): In einer Binärdatei kann jeder beliebige
Bytewert vorkommen. Die aufgenommenen Kurvendaten
werden ohne Zeitbezug abgespeichert.
❙ FLT (MSB/LSB): Eine FLT-Datei enthält die erfassten
Daten als Spannungswerte. Im Gegensatz zu einer
FLT-Datei ist die erfasste Datenmenge bei einer CSV-Datei
rund 16fach größer. Die Spannungswerte werden im
Format Float abgespeichert (4 Byte Float, binär, Big
Endian). Diese Datei kann z.B. in selbst geschriebenen
Programmen weiterverwendet werden.
❙ CSV (Comma Separated Values): In CSV Dateien werden
die Kurvendaten in Tabellenform abgespeichert. Die unterschiedlichen Tabellenzeilen sind durch ein Komma
voneinander getrennt.
Beispiel: Kurve mit allen sichtbaren Kanälen
[s],CH1[V],CH2[V]
-4.99500E-07,-2.601E-03
-4.99000E-07,-6.012E-04
-4.98500E-07,-6.012E-04
-4.98000E-07,1.399E-03
Ist im ACQUIRE Menü die maximale Abtastrate ausgewählt,
so werden beim CSV Export zwei Zeilen mit einem Zeitstempel
ausgegeben, da diesem Zeitwert ein Mininmal- und ein Maximalwert zugeordnet werden muss. Um einen Amplitudenwert pro
Zeitstempel zu erhalten, wird im ACQUIRE Menü „Automatik“
gewählt.
❙ TX T: TXT-Dateien sind ASCII-Dateien, die nur Amplitu-
denwerte (keine Zeitwerte) enthalten. Die Amplitudenwerte werden durch ein Komma getrennt. Die Wertepaare
sindalsEinzelwerteohneIdentikationaufgelistet.
Beispiel:
1.000E-02,1.000E-02,1.000E-02,1.000E-02,3.000E-02
44
Page 45

Dokumentation, Speichern und Laden
Mit der Softmenütaste PUNKTE und dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld ausgewählt werden,
ob der Bildschirm- oder der gesamte Erfassungsspeicher ausgelesen werden soll. Über die Softmenütaste
KOMMENTAR kann ein Kommentar eingegeben werden,
der in der Fußzeile des Dateimanagers erscheint, wenn
eine Datei ausgewählt wurde. Sind alle Eingaben getätigt,
wird nach dem Drücken der Softmenütaste SPEICHERN
die gewählte(n) Kurve(n) entsprechend den Einstellungen
abgespeichert.
11.4 Bildschirmfoto
Die wichtigste Form des Abspeicherns im Sinne der Dokumentation ist das Bildschirmfoto. Ein Bildschirmfoto
ist eine Bilddatei, in der die, zum Zeitpunkt des Abspeicherns, aktuellen Bildschirminhalte zu sehen sind. Als
SPEICHERORT ist bereits der USB Stick Anschluss auf
der Gerätevorderseite ausgewählt. Ist das Softmenü SPEICHERORT ausgegraut, so ist kein USB Stick angeschlossen oder der USB Stick wurde nicht erkannt. Wird ein USB
Stick erkannt, so können Verzeichnisse gewechselt, erstellt
oder Dateien gelöscht werden. Mittels der Softmenütaste
SORTIERUNG können mehrere Einstellungsdateien nach
Name, Typ, Größe oder Datum sortiert werden. Die Wahl
des Zielverzeichnisses wird mit VERZ. ANNEHMEN bestätigt und kehrt automatisch wieder in das BildschirmfotoHauptmenü zurück. Die Softmenütaste DATEINAME öffnet
das Nameneingabemenü, in dem mit dem Universaldrehgeber oder der KEYPAD Taste im CURSOR/MENU Bedienfeld ein Name eingegeben und mit ANNEHMEN bestätigt
werden kann (SCR ist die Standardbezeichnung). Automatisch erscheint wieder das Bildschirmfoto-Hauptmenü.Das
DateiformateinerGrakdatei(SoftmenütasteFORMAT)
bestimmt die Farbtiefe und die Art der Komprimierung. Die
QualitätderFormateunterscheidetsichbeidenGraken
des Oszilloskops nicht. Folgende Dateiformate stehen zur
Auswahl:
❙ BMP = Windows Bitmap Format
❙ GIF = Graphics Interchange Format
❙ PNG = Portable Network Graphic
Der Druck auf die Softmenütaste SPEICHERN löst eine
sofortige Speicherung des aktuellen Bildschirms an den
eingestellten Speicherort, mit dem eingestellten Namen
und dem eingestellten Format aus.
11.4.1 Drucker
Wird ein Drucker erkannt, ist die Softmenütaste DRUCKEN
nicht mehr ausgegraut. Die Softmenütaste DRUCKEN
bietet die Möglichkeit, einen Bildschirmausdruck sofort
auf einem angeschlossenen Drucker auszugeben. PCL-5,
PCL-XL (= PCL-6) und Postscript Einstellungen werden als
„Druckersprache“ unterstützt (kein PCL-3). Wird ein Drucker erkannt, ist die Softmenütaste DRUCKEN nicht mehr
ausgegraut. Der unterstützte Drucker wird im Softmenü
GERÄTEINFOS angezeigt. Die Meldung „This printer is
supported“ ist kein Garant dafür, dass der angeschlossene
Drucker unterstützt wird. Diese Meldung sagt nur aus,
dass eine USB Kommunikation mit dem Drucker möglich
ist und die wichtigsten Eigenschaften vorhanden sind (z.B.
PCL oder PCLX als „Druckersprache“). Die Implementierung dieser Drucker ist aber von Hersteller zu Hersteller
und auch innerhalb eines Herstellers bei verschieden Produktreihen nicht immer gleich, was z.B. im Windowstreiber abgefangen wird und am PC damit nicht auffällt.
Abb. 11.5: Beispiel eines unterstützten Druckers
Sollte ein Druckeranschluss nicht funktionieren, so kann
die Software HMScreenshot (Softwaremodul der
HMExplorer Software) genutzt werden. Die kostenlose
Software HMScreenshot ermöglicht es, über eine
Schnittstelle Bildschirmausdrucke im Bitmap Format vom
Gerät auf einen angeschlossenen PC zu transferieren und
dort abzuspeichern bzw. auszudrucken. Weitere Hinweise
zurSoftwarendenSieimHMExplorerSoftwareManual.
Mit der Softmenütaste FARBMODUS und dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld kann zwischen
folgenden Farbmodi gewählt werden:
❙ GRAUSTUFEN: Bei Graustufen werden die Farben beim
Abspeichern in Graustufen gewandelt.
❙ FARBE: Bei Farbe erfolgt das Abspeichern in Farbe (wie
auf dem Bildschirm zu sehen).
❙ INVERT (HG): Bei Invertiert (HG) wird die Signalform in
Farbe mit invertiertem Hintergrund abgespeichert.
❙ INVERT (BG, GRAY): Bei INVERTIERT (BG, GRAY) wird
die Signalform in grauer Farbe mit invertiertem
Hintergrund abgespeichert.
❙ INVERT (ALLES): Bei Invertiert (Alles) werden
Signalform und Hintergrund invertiert abgespeichert.
❙ INVERT (ALL, GRAY): Bei Invert (all, gray) werden
Signalform und Hintergrund in Grautönen abgespeichert.
Abb. 11.6: Screenshot-Modul
Durch Drücken der RUN/STOP-Taste sollte vor dem Drucken die
Erfassung gestoppt werden, damit ein korrekter Ausdruck erfolgt.
45
Page 46

Dokumentation, Speichern und Laden
11.5 DenitionderFILE/PRINT-Taste
Die FILE/PRINT-Taste im GENERAL Bedienfeld ermöglicht
es, mit einem Tastendruck Geräteeinstellungen, Kurven,
Bildschirmfotos, sowie Bildschirmfotos und Einstellungen
gemeinsam abzuspeichern. Dazu müssen zunächst, wie in
den vorangegangenen Kapiteln beschrieben, die entsprechenden Einstellungen zu Speicherort, Name etc. eingegeben werden. Zur Auswahl stehen folgende Aktionen:
❙ GERÄTEEINST: speichert Einstellungen ab
❙ KURVEN: speichert Kurven ab
❙ BILDSCHIRMFOTO: speichert Bildschirmfotos ab
❙ BILD & EINST.: speichert Bildschirmfoto und
Einstellungen ab
❙ DRUCKEN: druckt direkt auf eine kompatiblen Drucker
(Postscript, einige PCL und PCLX fähige Drucker)
Nach Aktivierung der gewünschten Aktion durch Druck
der entsprechenden Softmenütaste wird dieses Menü blau
unterlegt. Mit der MENU OFF-Taste wird das Auswahlmenü verlassen. Wird die FILE/PRINT-Taste nun gedrückt,
wird die gewählte Funktion ausgeführt.
12 Mixed-Signal-
Betrieb
Die R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202 Serie ist standardmäßig mit den Anschlüssen für einen Logiktastkopf
R&S®HO3508 ausgerüstet, um 8 digitale Logikeingänge
hinzuzufügen. Sämtliche Software zur Unterstützung des
Mixed-Signal-Betriebes ist bereits in der Firmware der
R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202 Serie enthalten,
lediglich der aktive Logiktastkopf R&S®HO3508 (8 Kanäle)
muss erworben und angeschlossen werden. Bei Aktivierung des POD wird bei der R&S®HMO1002 Serie der
analoge Kanal 2 automatisch deaktiviert. Es können somit
nur 1 analoger Kanal plus 8 Logikeingänge gleichzeitig auf
dem Bildschirm angezeigt werden. Bei der R&S®HMO1202
Serie können 2 analoge Kanäle plus 8 Logikeingänge
gleichzeitig auf dem Bildschirm angezeigt werden.
Abb.11.7:DenitionderFILE/PRINT-Taste
Abb. 12.1: Optionaler Logiktastkopf R&S®HO3508
12 .1 Logiktrigger für digitale Eingänge
Die Einstellungsmöglichkeiten des Logiktriggers ist in Kap. 6.3.3
beschrieben.
12.2 Anzeigefunktionen für die Logikkanäle
Durch Druck auf die POD Taste im VERTICAL Bedienfeld
werden die digitalen Kanäle 0 bis 7 aktiviert und auf dem
Bildschirm angezeigt. Eine logische Eins wird bei den Logikkanälen mit einem zwei Pixel breiten Strich angezeigt,
eine logische Null mit einer Pixelbreite. Der eingestellte
Schwellwert wird neben dem POD Namen im Informationsfeld links unten am Bildschirmrand angezeigt. Neben
derAnzeigedesSchwellwertsbendetsicheinekleine
schematische Darstellung, welche die logischen Zustände
(1/0) skizziert. Spannungswerte oberhalb des Schwellwerts
Bei aktiviertem POD kann der Schwellwert zur Unterscheidung
der logischen Zustände (High/Low) im VERTICAL Menü eingestellt werden.
46
Page 47

Mixed-Signal-Betrieb
werden als HIGH (1), Werte unterhalb des Schwellwerts
als LOW (0) interpretiert. Die Y-Position und Größe der Logikkanaldarstellung lässt sich nun, wie von den analogen
Kanälen gewohnt, mit den Y-POSITION und VOLTS/DIV
Drehgebern im VERTICAL Bedienfeld einstellen. Wenn
weniger als 8 Logikkanäle angezeigt oder die Position und
Größe einzelner Logikkanäle geändert werden sollen, so
können diese Einstellungen über das Kurzmenü in Verbindung mit den Softmenütasten (Kanal 0 bis 7) und den
Y-POSITION bzw. VOLTS/DIV Drehgebern im VERTICAL
Bedienfeld vorgenommen werden. Die Kanalauswahl kann
mit den und Softmenütasten vorgenommen werden.
Somit lassen sich alle einzelnen Kanäle individuell vergrößern und positionieren.
AufSeite2|2desPOD-MenüskanndievertikalePosition
und Größe der einzelnen Logikkanäle zurückgesetzt werden (Softmenütaste POS. & GRÖßE ZURÜCKSETZEN). Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, mit dem Softmenü NAME
die einzelnen Bits des Logikkanals zu beschriften. Dieser
wird dann im Messgitter angezeigt und auch ausgedruckt.
Der Name der einzelnen Bits D0 bis D7 kann mit der Softmenütaste NAME an- (AN) bzw. ausgeschaltet werden
(AUS). Ist der Name aktiviert, so erscheint dieser rechts
neben den einzelnen Logikkanälen. Mit der Softmenütaste
BIBLIOTHEKkönnenvordenierteNamenausgewählt
werden und mittels NAME EDITIEREN angepasst werden.
Maximal sind 8 Zeichen erlaubt. Mit der Taste ANNEHMEN
wird der Name im Editor bestätigt und somit auf dem Bildschirm angezeigt. Der Name ist an das Signal gebunden
und wandert mit einem evtl. eingestellten Offset entsprechend mit.
Abb. 12.2: 8 Bit DAC Signalwechsel
12.3 Anzeigen der Logikkanäle als BUS
Weiterhin gibt es die Möglichkeit, digitale Kanäle zu einem BUS zu gruppieren, die dann als Waben auf dem
Bildschirm dargestellt werden. Grundsätzlich sind zwei
unabhängige Busse möglich. So lassen sich z.B. ein 8 Bit
Adress- und 8 Bit Datenbus jeweils zusammenfassen.
Die BUS-Einstellungen werden über das BUS Menü im
VERTICAL Bedienfeld vorgenommen. Nach dem Aktivieren der BUS Funktion wird die MENU Taste im VERTCAL
Bedienfeld betätigt und der jeweilige BUS (Softmenütaste
B1 oder B2) ausgewählt. Mit der Softmenütaste BUS TYP
kann der BUS Typ für die Darstellung und Analyse festgelegt werden. Der BUS Typ kennzeichnet den Aufbau
des Busses und unterscheidet sich durch die Gleiderung
in Seriell/Parallel oder durch die Anzahl der Daten und
Taktleitungen. Mit dem Universaldrehgeber im CURSOR/
MENU Bedienfeld kann der jeweilige BUS Typ PARALLEL
oder PARALLEL CLOCKED ausgewählt werden. Mit dem
Softmenü KONFIGURATION können die Quellen und der
Aufbau des Busses festgelegt werden. Der Inhalt des Menüs ist auf den ausgewählten BUS Typ abgestimmt. Mittels
Softmenütaste BUSBREITE und dem Universaldrehgeber
im CURSOR/MENU Bedienfeld kann die Anzahl der Bits (1
Bit bis 8 Bit) eingestellt werden. Das Informationsfenster
mit der Bit-Zuordnungstabelle wird dynamisch an die BitAuswahl angepasst. Jedes Bit des dargestellten Busses
hat eine Quelle. Diese Quelle bezieht sich auf die einzelnen
Bits des POD. Anhand des Messaufbaus können die Quellen mit der Softmenütaste QUELLE und dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld zugeordnet
werden.
Mit den Softmenütasten NACHST./VORH. BIT kann die
Position des Auswahlbalkens für die Quelle der einzelnen
Bits verschoben werden. Das momentan ausgewählte Bit
ist mit einem blauen Balken hinterlegt. Das Informationsfenster zeigt die Reihenfolge der Bits, oben beginnend mit
Bit 0 (= LSB). Mit dem Universaldrehgeber im CURSOR/
MENU Bedienfeld kann dem gewählten BUS Bit ein Logikkanal zugeordnet werden. Wird als BUS TYP PARALLEL
CLOCKED gewählt, kann zusätzlich mit der Softmenütaste
STEUERLEIT. die Quellen für CHIP SELECT und CLOCK mit
dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld
ausgewählt werden. Die Softmenütaste AKTIV legt fest,
ob das Chip-Select-Signal High- oder Low-Aktiv ist. Die
Softmenütaste FLANKE schaltet zwischen steigender,
fallender und beider Flanken des Taktsignals. Die Auswahl
wird im Informationsfenster angezeigt. Die Softmenütaste
MENU OFF schließt das Kongurationsmenüundführtin
das BUS-Hauptmenü zurück. Mit dem Softmenü ANZEIGE
können Einstellungen für die BUS- Darstellungsform gewählt werden. Mit der Softmenütaste ANZEIGE wird mit
dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld
das Format zur Dekodierung der Buswerte gewählt. Zur
Auswahl stehen folgende Formate:
❙ Binär
❙ Hexadezimal
❙ Dezimal
❙ ASCII
Die dekodierten Werte werden im jeweiligen Format in
den BUS-Waben angezeigt. Mit der Softmenütaste BITS
kann die Anzeige der einzelnen Bits ein- (AN) bzw. ausgeschaltet werden (AUS). Die Position oder Größe eines
Busses kann nun mit dem POSITION Drehgeber (Position
der BUS-Anzeige auf dem Bildschirm) bzw. mit dem VOLT/
DIV Drehgeber (Größe der Wabenanzeige ) im VERTICAL
Bedienfeld eingestellt werden. Dies kann insbesondere bei
47
Page 48

Mixed-Signal-Betrieb
der binären Darstellung hilfreich sein, da auch bei kurzen
Zustandswaben der komplette Wert über bis zu vier Zeilen
angezeigt werden kann.
13 Serielle
12.4 Cursor-Messfunktionen für Logikkanäle
Sind die Logikkanäle aktiviert, so lassen sich mit den
Cursor-Messfunktionen einige Parameter bestimmen. Für
die gesamte Anzahl der eingeschalteten POD Logikkanäle
lassen sich folgende Messarten bestimmen:
❙ ZEIT: Es wird die zeitliche Position beider Cursors zum
Triggerzeitpunkt, die zeitliche Differenz beider Positionen,
sowie die daraus resultierende Frequenz angezeigt.
❙ VERHÄLTNIS X: In dieser Messart wird mit drei Cursors
ein zeitliches Verhältnis zwischen den ersten Beiden und
dem Ersten und Dritten Cursor angezeigt. Die Anzeige
erfolgt als Gleitkommawert, in Prozent, in Grad und in
Bogenmaß.
❙ V-MARKER: Bei dieser Messart wird der logische Wert
des ausgewählten POD’s in Hexadezimal- und in
Dezimalwerten am jeweiligen Cursor gemessen und
dargestellt.
12.5. Auto-Messfunktionen für Logikkanäle
Sind die Logikkanäle aktiviert, so lassen sich mit den
Cursor-Messfunktionen einige Parameter bestimmen. Für
die gesamte Anzahl der eingeschalteten POD Logikkanäle
lassen sich folgende Messarten bestimmen:
❙ FREQUENZ
❙ PERIODE
❙ PULSBREITE +/-
❙ TAST VERHÄLTNIS +/-
❙ VERZÖGERUNG
❙ PHASE
❙ BURSTBREITE
❙ ZÄHLEN PULS +/-
❙ ZÄHLEN (Flanke pos./neg.)
Busanalyse
13.1 Software-Optionen (Lizenzschlüssel)
Die R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202 Serie kann mit
Optionen / Vouchern zum Triggern und Dekodieren von
seriellen Bussen aufgerüstet werden:
❙ R&S®HOO10 / R&S®HV110:
Die Option R&S®HOO10 bzw. der Voucher R&S®HV110
erlaubt die Triggerung und Dekodierung von I2C, SPI und
UART/RS-232 Bussen auf den digitalen Kanälen (Option
Logiktastkopf R&S®HO3508 notwendig) und den
analogen Eingängen. Mit dieser Option können zwei
serielle Busse zeitsynchron dekodiert werden.
❙ R&S® HOO11 / R &S ®HV111:
Die Option R&S®HOO11 bzw. der Voucher R&S®HV111
erlaubt das Triggern und Dekodieren von I2C, SPI und
UART/RS-232 Bussen auf den analogen Eingängen. Mit
dieser Option ist nur ein serieller BUS dekodierbar.
❙ R&S®HOO12 / R&S®HV112:
Die Option R&S®HOO12 bzw. der Voucher R&S®HV112
erlaubt das Triggern und Dekodieren von CAN und LIN
Bussen auf den digitalen Kanälen (Option Logiktastkopf
R&S®HO3508 notwendig) und den analogen Eingängen.
Mit dieser Option können zwei serielle Busse zeitsynchron
dekodiert werden.
Die Optionen R&S®HOO10, R&S®HOO11 und R&S®HOO12
können ab Werk mit einem R&S®HMO1002 erworben
werden. Die Upgrade Voucher R&S®HV110, R&S®HV111
und R&S®HV112 dagegen ermöglichen ein nachträgliches
Upgrade über einen Lizenzschlüssel (siehe Kap. 2.7).
Die Analyse von parallelen und seriellen Daten besteht aus
drei wesentlichen Schritten:
❙ Protokoll-Konguration(BUSTyp/protokollspezische
Einstellungen)
❙ Dekodierung (Anzeige der dekodierten Daten / Zoom /
BUS-Tabelle)
❙ Trigger (Start / Stopp / serielle Muster)
48
Die serielle Busanalyse erfolgt mit 1/8 der Abtastrate.
13.2 KongurationseriellerBusse
Vor der BUS Konguration ist die Einstellung des Schwellwertes notwendig (siehe Kap. 4.5). Die Standardeinstellung liegt bei
50 0 mV.
Für die Einstellungen der seriellen Trigger- und Dekodier-
funktionenwirdeinBUSdeniert.BiszuzweiBusseB1
undB2könnenjenachOptiondeniertwerden.DasBUS
KongurationsmenüwirdüberdieTasteBUSimVERTICAL
Bedienfeld geöffnet. In dem sich öffnenden Kurzmenü
wird entweder mit der jeweiligen Softmenütaste B1 oder
B2 der BUS direkt gewählt oder die MENU-Taste im VERTI-
Page 49

Serielle Busanalyse
CAL Bedienfeld gedrückt. Mit der Softmenütaste BUS TYP
können je nach installierten Optionen folgende BUS Typen
ausgewähltundkonguriertwerden:
❙ PARALLEL (Standard)
❙ PARALLEL CLOCKED (Standard)
❙ SSPI (nu r ve rfü gb ar mi t R &S ®HOO10/ HV110 /HO O11/ HV 111)
❙ SPI (nur v er fü g bar m it R& S® HOO10/ HV 110 /H OO11/ HV111)
❙ I2C (n ur ve rfü gb ar mi t R & S®H O O10/ HV110 /HO O11/ HV 111)
❙ UART (n u r v er fü gbar mi t R &S ®HO O10 / HV110/ HO O11/ HV111)
❙ CAN (nur verfügbar mit R&S®HOO12/HV112)
❙ LIN (nur verfügbar mit R&S®HOO12/HV112)
individuellen BUS-Typ aktiviert werden. Die Softmenütaste
BUS-TABELLE aktiviert (blau markiert) bzw. deaktiviert die
Listendarstellung. In der Standardeinstellung erfolgt die
Anzeige der Tabelle am unteren Rand des Bildschirmes.
Grundsätzlich erfolgt die Darstellung einer kompletten
Nachricht eines Protokolls in einer Zeile. In den Spalten
sind je nach Protokoll die wichtigen Informationen, wie z.B.
Adresse und Daten der jeweiligen Nachricht, aufgeführt.
Die Anzahl der Zeilen in der Tabelle entspricht der Anzahl
der kompletten Nachrichtentelegramme im Speicher. Die
Dekodierungsergebnisse können als CSV-Datei mittels
Softmenütaste SPEICHERN gespeichert werden (z.B. auf
einem USB Stick).
Abb.13.1:MenüzumDenierenvonBussen
Mit der Softmenütaste KONFIGURATION wird ein vom
gewählten Bustyp abhängiges Menü aufgerufen. Diese
werdenindenKapitelnderjeweiligenBUSKonguration
beschrieben. Das Softmenü ANZEIGE ist für alle Busse
identisch und ermöglicht die Auswahl des Dekodierungsformats. Es stehen folgende Formate zur Auswahl:
❙ Binär
❙ Hexadezimal
❙ Dezimal
❙ ASCII
Mit der Softmenütaste BITS kann die Darstellung einzelner
Bitleitungen (oberhalb der Wabendarstellung) an- (AN)
oder ausgeschaltet werden (AUS). Mit der Softmenütaste
NAME kann ein BUS umbenannt werden. Dieser wird im
Messgitter angezeigt und auch ausgedruckt. Der BUSName kann mit der Softmenütaste NAME an- (AN) bzw.
ausgeschaltet werden (AUS). Ist der Name aktiviert, so
erscheint dieser rechts neben der BUS-Anzeige. Mit der
SoftmenütasteBIBLIOTHEKkönnenvordenierteNamen
ausgewählt werden und mittels NAME EDITIEREN angepasst werden. Maximal sind 8 Zeichen erlaubt. Mit der
Taste ANNEHMEN wird der Name im Editor bestätigt und
somit auf dem Bildschirm angezeigt. Der Name ist an das
Signal gebunden.
13.2.1 BUS-Tabelle
DasSoftmenüBUS-TABELLEermöglichtdieKonguration bzw. das Exportieren einer Liste mit allen dekodierten
Nachrichten im Speicher. Der Inhalt der Tabelle ist proto-
kollspezischunddieAnzeigederTabellekannfürjeden
Abb. 13.2: Beispiel I2C BUS mit BUS-Tabelle
Es sollte immer eine komplette Nachricht eines seriellen Protokolles auf dem Bildschirm sichtbar sein, damit die Dekodierung
funktionieren kann. Details einzelner Nachrichten lassen sich
über die ZOOM-Funktion anzeigen.
Beispiel einer I2C BUS-Tabelle:
„Bustabelle: BUS1 (I2C: Takt SCL = D0, Daten SDA = D1)“
Frame,Mark,Startzeit[s],Typ,ID,Länge,Datum,Zustand
1,,-197.89200e-6,Read,0x2D,5,0xF110E55D31,OK
2,,28.00000e-9,Write,0x42,8,0xEB8DC599AE5D6FC0,OK
3,,217.74000e-6,Write,0x3B,6,0xA113B7263E5B,OK
4,,376.07200e-6,Read,0x0E,6,0x55C3EB71D9E8,OK
5,,613.58000e-6,Write,0x66,8,0x91B86EE6655E2300,Data Error
Die Softmenütaste FRAME FOLGEN dient dazu, beim
Scrollen durch die BUS-Tabelle mit dem Universaldrehgeber gleichzeitig zur jeweiligen Position im Speicher zu
springen und diese auf dem Bildschirm darzustellen. Dies
funktioniert natürlich nur dann, wenn die Erfassung
gestoppt ist. Im BUS Kurzmenü erfolgt dies zusätzlich mit
der Softmenütaste TRK (= Track). Wird die Softmenütaste
FRAME ZEIT-DIFFERENZ aktiviert (blau markiert), wird in
der BUS-Tabelle die Zeitdifferenz zum vorherigen Frame
(Datenpaket) angezeigt. Die Spalte wird in der Tabelle mit
ZEITDIFF. angezeigt. Ist diese Funktion deaktiviert, wird die
absolute Zeit in Bezug auf den Triggerpunkt in der Spalte
START ZEIT angezeigt. Im BUS Kurzmenü kann mit der
Softmenütaste TAB die BUS-Tabelle aktiviert bzw.
deaktiviert werden, ohne ein Menü zu öffnen. Mit der
49
Page 50

Serielle Busanalyse
Softmenütaste POSITION kann die Tabelle an den oberen /
unteren Bildschirmrand verschoben werden. Zusätzlich
gibt es die Möglichkeit, die BUS-Tabelle als Vollbild
anzuzeigen. Die Auswahl der Position erfolgt mit dem
Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld im
BUS-Menü oder direkt über die Softmenütaste POS im
BUS-Kurzmenü.
Das Abspeichern einer BUS-Tabelle ist nur im STOP Modus
möglich.
13.3 Parallel / Parallel Clocked BUS
Die R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202 Serie besitzt
standardmäßig den PARALLEL und PARALLEL CLOCKED
BUS und kann hierbei bis zu 7 Bit-Leitungen analysieren.
Die Anzahl der Bit-Leitungen wird mit der Softmenütaste
BUSBREITE und dem Universaldrehgeber im CURSOR/
MENU Bedienfeld eingestellt. Mit den Softmenütasten
NACHST./VORH. BIT kann die Position des Auswahlbalkens für die Quelle der einzelnen Bits verschoben werden.
Das momentan ausgewählte Bit ist mit einem blauen
Balken hinterlegt. Das Informationsfenster zeigt die Reihenfolge der Bits, oben beginnend mit Bit 0 (= LSB). Mit
dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld
kann dem gewählten BUS Bit ein Logikkanal zugeordnet
werden.
Um auf parallele Busse zu triggern, wird der Logiktrigger
empfohlen. Für weitere Informationen zum Logiktrigger
siehe Kap. 6.3.3).
13.4 I2C BUS
Die I2C-Triggerung und Dekodierung erfordert die Option
R&S®HOO10 bzw. R&S®HOO11 oder die Upgrade Voucher
R&S®HV110 bzw. R&S®HV111.
Der I2C Bus ist ein Zweidrahtbus, welcher von Philips
(heute NXP Semiconductor) entwickelt wurde. Ein I2C BUS
besitzt folgende Eigenschaften:
❙ Zweidrahtbus (2-wire): Takt (SCL) und Daten (SDA)
❙ Master-Slave Kommunikation: der Master gibt den Takt
vor und wählt den Slave
❙ Addressierung: jeder Slave ist durch eine eindeutige
Adresse adressierbar; mehrere Slave‘s können
miteinander verbunden und vom gleichen Master
angesprochen werden
❙ Lesen/Schreiben Bit: Master wird Daten lesen (=1) oder
schreiben (=0)
❙ Acknowledge: erfolgt nach jedem Byte
Das Format einer einfachen I2C Nachricht (Frame) mit 7 Bit
Adresslänge ist wie folgt aufgebaut:
❙ Start-Bedingung: fallende Flanke auf SDA (Serial Data),
während SCL (Serial Clock) HIGH ist
❙ 7-Bit-Adresse (Slave schreiben oder lesen)
❙ Lesen/Schreiben Bit (R/W): gibt an, ob die Daten
geschrieben oder aus dem Slave gelesen werden sollen
❙ Acknowledge Bit (ACK): wird durch den Empfänger des
vorherigen Bytes ausgegeben, wenn die Übertragung
erfolgreich war (Ausnahme: bei Lesezugriff beendet der
Master die Datenübertragung mit einem NACK Bit nach
dem letzten Byte)
❙ Daten: eine Reihe von Daten-Bytes mit einem ACK-Bit
nach jedem Byte
❙ Stopp-Bedingung: steigende Flanke auf SDA (Serial
Data), während SCL (Serial Clock) HIGH ist.
Abb. 13.3: Beispiel Parallel BUS mit BUS-Tabelle
Wird als BUS TYP PARALLEL CLOCKED gewählt, kann
zusätzlich mit der Softmenütaste STEUERLEIT. die Quellen
für CHIP SELECT und CLOCK mit dem Universaldrehgeber
im CURSOR/MENU Bedienfeld ausgewählt werden. Die
Softmenütaste AKTIV legt fest, ob das Chip-Select-Signal
High- oder Low-Aktiv ist. Die Softmenütaste FLANKE
schaltet zwischen steigender, fallender und beider Flanken
des Taktsignals. Die Auswahl wird im Informationsfenster
angezeigt. Die Softmenütaste MENU OFF schließt das
KongurationsmenüundführtindasBUS-Hauptmenü
zurück.
Spalte Beschreibung
Start Time Frame Startzeit in Bezug auf den Triggerzeitpunkt
Data Datenbytes
Tab. 13.1: Aufteilung PARALLEL BUS Tabelle
50
Abb. 13.4: I2C 7-Bit-Adresse
13 . 4.1 I2CBUSKonguration
Vor der BUS Konguration ist die Einstellung des Schwellwertes notwendig (siehe Kap. 4.5). Die Standardeinstellung liegt bei
50 0 mV.
Um den I2C Bus zu dekodieren, wird bei der BUS Kon-
gurationfestgelegt,welcherKanalandenTakt(SCL)
und welcher an die Datenleitung (SDA) angeschlossen
Page 51

ist. Diese Einstellung erfolgt nach Auswahl des BUS TYP
I2C im BUS Menü und anschließendem Druck auf die
Softmenütaste KONFIGURATION. In dem sich öffnenden
wird mit der obersten Softmenütaste TAKT SCL und dem
Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld der
Quellkanal ausgewählt. Die Zuweisung des Eingangskanals
zu DATEN SDA folgt analog dazu. Mit der Softmenütaste
7BIT ADRESSE kann ausgewählt werden, ob die Adresse
inklusive Read/Write-Bit (ADDR.+RW) oder nur die Adresse (ADDR.ONLY) interpretiert werden sollen. Ein Informationsfenster zeigt die aktuellen Einstellungen. Zweimaliges Drücken der Softmenütaste MENU OFF schließt das
Kongurationsmenü.
Serielle Busanalyse
Ist die Option R&S®HOO11 bzw. der Voucher R&S®HV111 installiert, so können nur analoge Kanäle als Quelle gewählt werden.
Ist die Option R&S®HOO10 bzw. der Voucher R&S®HV110 installiert, so sind sowohl analoge als auch digitale Kanäle als Quelle
auswählbar.
Bestimmte Teile der I2C Nachrichten werden farbig hervorgehoben, um diese einfach unterscheiden zu können. Sind
die Datenleitungen zusammen mit der Wabendarstellung
gewählt, werden auch die entsprechenden Bereiche farbig
gekennzeichnt:
❙ Leseadresse: Gelb
❙ Schreibadresse: Magenta
❙ Daten: Cyan
❙ Start: Weiß
❙ Stopp: Weiß
❙ Kein Acknowledge: Rot
❙ Acknowledge: Grün
13.4.2 I2C Bus Triggerung
NachdemderBUSkonguriertwurde,kannaufverschiedenste Ereignisse getriggert werden. Dazu wird die Taste
TYPE im TRIGGER Bedienfeld betätigt und dort die Softmenütaste SERIELLE BUSSE gewählt. Anschließend wird
die Taste SOURCE im TRIGGER Bedienfeld gedrückt und
I2C Bus ausgewählt. Der I2C BUS ist im SOURCE Menü nur
auswählbar,wennderBUSvorherkonguriertwurde.Mittels FILTER-Taste im TRIGGER Bedienfeld können nun die
möglichen I2C Triggerbedingungen ausgewählt werden.
Abb. 13.5: I2C LESEN/SCHREIB Triggermenü
❙ LESEN/SCHREIB.: Das LESEN/SCHREIBEN Menü bietet
weitere Triggermöglichkeiten. Mit der Softmenütaste
MASTER kann die Triggerbedingung zwischen Lese- (LESEN) und Schreibzugriff (SCHREIB.) des Masters umgeschaltet werden. Das 8te Bit der ersten Dateneinheit (je
nach Adresslänge) dient zur Unterscheidung zwischen
dem Lese- und Schreibzugriff. Die ausgewählte Bedingung wird im Informationsfenster angezeigt. Die
ADRESS-LÄNGE (in Bit) legt die maximale Anzahl der
Slave-Adressen des Busses fest. Bei einer 7 Bit Adresslänge stehen maximal 112 Adressen zur Verfügung. Die 10
Bit Adressierung ist durch Nutzung von 4 der 16 reservierten Adressen abwärtskompatibel zur 7 Bit Adressierung und kann mit dieser gleichzeitig verwendet werden.
Bei 10 Bit Adresslänge stehen insgesamt 1136 Adressen
(1024 + 128 - 16) zur Verfügung. Die höchste 10 Bit
Adresse ist 1023 (0x3FF). Die ausgewählte Adresslänge
wird im I2C Informationsfenster angezeigt. Die SLAVE
ADRESSE ist die Adresse, durch die auf dem BUS
unterschieden wird, mit welchem Slave der Master
kommunizieren soll. Mit dem Universaldrehgeber im
CURSOR/MENU Bedienfeld wird die Adresse des zu
beobachtenden Busteilnehmers, auf den getriggert
werden soll, ausgewählt. Mit dem Softmenü DATEN
könnenzusätzlichzurAdressenochspezischeDaten
eingeben kann. Dieses Menü bietet die Möglichkeit, auf
FolgendeTriggerbedingungenkönnendeniertwerden:
❙ START: Das Oszilloskop triggert auf die Start-Sequenz.
Das Startsignal ist eine fallende Flanke auf SDA-Daten,
während der SCL-Takt high ist. Beim Triggern wird ein
Neustart wie eine Startbedingung interpretiert.
❙ STOPP: Das Oszilloskop triggert auf die Stopp-Sequenz
aller Nachrichten. Das Startsignal ist eine steigende
Flanke auf SDA-Daten, während SCL-Takt high ist.
❙ NEUSTART: Das Oszilloskop triggert, wenn vor einer
Stoppbedingung eine weitere Startbedingung auftritt. Das
Neustart-Signal ist ein wiederholtes Startsignal.
❙ NOT-ACKNOWLEDGE: Das NOT-ACKNOWLEDGE-Bit
ist das 9te Bit innerhalb einer Daten-oder Adresseinheit
der SDA-Leitung. Bei einem NOT-ACKNOWLEDGE ist das
Acknowledge-Bit auf SDA high, obwohl es low sein sollte.
Abb. 13.6: I2C BUS
51
Page 52

Serielle Busanalyse
konkret festgelegte Datenbytes (Farbe Cyan) innerhalb
der Übertragung zu triggern und damit uninteressante
Übertragungenherauszultern.EinOffsetvon0bis4095
zur Adresse ist erlaubt (Softmenütaste BYTE OFFSET). In
den meisten Fällen wird das Byte Offset Null sein, wenn
auf die maximal 24 ersten Bits nach der Adresse
getriggert werden soll. Mit der Softmenütaste
BYTEANZAHL wird festgelegt, wieviele Bytes für die
Triggerbedingung ausgewertet werden sollen. Es kann
auf maximal 24 Bit (3 Byte) Daten getriggert wer-
den. Die Eingabe kann binär oder hexadezimal erfolgen
(PATTERNEINGABE). Wird die binäre Eingabe gewählt,
können die einzelnen Bits mit der Softmenütaste BIT
WÄHLEN und dem Universaldrehgeber im CURSOR/
MENU Bedienfeld einem beliebigen Zustand zugeordnet
werden. Mit der Softmenütaste ZUSTAND wird für jedes
Bit der Zustand H (=1), L (=0) oder X (ohne Wertung)
festgelegt. Der Zustand X kennzeichnet einen beliebigen
Zustand. Bei der hexadezimalen Eingabe kann nur das
gesamte Byte auf X gesetzt werden. Wird die hexadezi-
male Eingabe gewählt, wird mit der Softmenütaste
WERT und dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU
Bedienfeld der jeweilige Bytewert festgelegt. Mit der
Softmenütaste BYTE WÄHLEN werden die verschie-
denen Bytes (Byte 1 zu Byte 2 zu Byte 3 etc.) der Reihe
nach für die Bearbeitung ausgewählt (abhängig von der
eingestellten BYTE-ANZAHL). Das jeweils aktive Byte
wird im Anzeigefenster der Triggerbedingung mit einem
grünen Rand versehen.
Durch mehrmaliges Drücken der MENU OFF Softmenütaste schließt alle Menüs und das Oszilloskop triggert
auf die eingestellte Adresse und Daten. Bei Messungen
ohne Messobjekt siehe Kap. 10.2.5.
Spalte Beschreibung
Start Time Frame Startzeit in Bezug auf den Triggerzeitpunkt
Typ e R/W Bit Typ (Read/Write)
ID Adresswert
Length Anzahl der Bits innerhalb eines Frames
Data Datenbytes
State ı Frame Status:
ı OK = Frame o.k.
ı DATA = bei Erfassungsanfang/-ende wurde nur
der Framestart oder das Frameende dekodiert
und es sind noch keine Daten vorhanden
ı ADDR. ERR. = unvollständige Dekodierung
eines Frames
ı INS = ein „angerissener“ Frame sitzt am Ende
der Erfassung und das eigentliche Ende wurde
nicht dekodiert
Tab. 13.2: Aufteilung I2C BUS Tabelle
13.5 SPI / SSPI BUS
Die SPI/SSPI-Triggerung und Dekodierung erfordert die Option
HOO10 bzw. HOO11 oder die Upgrade Voucher HV110 bzw.
HV111.
Das Serial Peripheral Interface SPI wird für die Kommunikation mit langsamen Peripheriegeräten verwendet,
insbesondere für die Übertragung von Datenströmen.
Der SPI Bus wurde von Motorola (heute Freescale) entwickelt, ist aber nicht förmlich standardisiert. Es ist im allgemeinen ein Bus mit Takt- und Datenleitung und einer Auswahlleitung (3-wire). Wenn nur ein Master und ein Slave
vorhanden sind, kann die Auswahlleitung entfallen, diese
wird auch SSPI (Simple SPI) genannt (2-wire). Ein SPI BUS
besitzt folgende Eigenschaften:
❙ Master-Slave Kommunikation
❙ Keine Geräteadressierung
❙ Kein Acknowledge zur Bestätigung des Datenempfangs
❙ Duplex-Fähigkeit
13.4.3 I2C BUS Tabelle
Abb. 13.7: I2C BUS Tabelle
Die Dekodierung der Adresse erfolgt als 7 Bit Wert. Das 8. Bit zur
Schreib-Leseunterscheidung wird in der Farbe dekodiert, nicht im
HEX Wert der Adresse.
Die meisten SPI Busse haben 4 gemeinsame Leitungen,
2 Daten- und 2 Steuerleitungen:
❙ Taktleitung zu allen Slaves (SCLK)
Abb.13.8:MenüzumDeniereneinesSPIBusses
52
Page 53

Serielle Busanalyse
❙ Slave Select oder Chip-Select-Leitung (SS oder CS)
❙ Master-Out-Slave-In, Slave-Data-Input (MOSI oder SDI)
❙ Master-In-Slave-Out, Slave-Data-Output (MISO or SDO)
Wenn der Master einen Takt erzeugt und einen Slave auswählt, so können Daten in eine oder beide Richtungen
gleichzeitig übertragen werden (nur mit
R&S®HOO10/R&S®HV110 möglich)..
Abb.13.9:EinfacheKongurationeinesSPIBUS
13.5.1 SPI/SSPIBUSKonguration
Vor der BUS Konguration ist die Einstellung des Schwellwertes notwendig (siehe Kap. 4.5). Die Standardeinstellung liegt bei
500 mV. Der externe Triggereingang wird bei 3-wire SPI als CS
(Chip Select) verwendet. Die Schwelle kann im BUS-Kongurationsmenü mit der Softmenütaste EXTERNE SCHWELLE eingestellt
werden.
Um eine korrekte Dekodierung eines SPI/SSPI Busses zu
gewährleisten, wird zunächst mit der Softmenütaste BUS
TYP festgelegt, ob ein SPI System mit oder ohne Chipselect (also 2-Draht SSPI oder 3-Draht SPI) vorliegt. Anschließend wird das KongurationsmenüüberdieSoftmenütaste KONFIGURATION geöffnet. Mit der Softmenütaste
QUELLE wird die entsprechende Quelle und mit der
darunter liegenden Softmenütaste der jeweilige Kanal für
Chip-Select (CS), Takt (Clk) und Daten mit dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld ausgewählt. Im
Falle des SSPI BUS wird anstelle der Chip-Select-Quelle
die mögliche TOTZEIT gewählt. Innerhalb der Totzeit sind
Daten und Taktleitung auf Low. Wird die Totzeit erreicht,
beginnt ein neuer Frame. Sind die zeitlichen Abstände der
Datenpakete zueinander kürzer als die Totzeit, so gehören
diese zum gleichen Frame. Die Totzeit kann entweder mit
dem Universaldrehgeber oder numerisch mittels KEYPAD Taste im CURSOR/MENU Bedienfeld erfolgen. Zur
Kontrolle wird ein Informationsfenster zu den aktuellen
Einstellungen auf dem Bildschirm gezeigt.
Ist die Option R&S®HOO11 bzw. der Voucher R&S®HV111 installiert, so können nur analoge Kanäle als Quelle gewählt werden.
Ist die Option R&S®HOO10 bzw. der Voucher R&S®HV110 installiert, so sind sowohl analoge als auch digitale Kanäle als Quelle
auswählbar.
Neben der Quellen-Zuordnung können folgende Einstellungen mit der Softmenütaste AKTIV vorgenommen werden:
❙ CS: Chip-Select High oder Low aktiv (Low aktiv =
Standardeinstellung)
❙ CLK: Datenübernahme auf steigender oder fallender
Flanke (steigende Flanke = Standardeinstellung)
❙ DATA: Daten High oder Low aktiv (High aktiv =
Standardeinstellung)
Bestimmte Teile der SPI/SSPI Nachrichten werden farbig hervorgehoben, um diese einfach unterscheiden zu
können:
❙ Weiß: Start/Stopp einer dekodierten Nachricht
❙ Rot: Nachricht konnte nicht komplett dekodiert
werden; ggf. Einstellungen im Horizontal
system oder Triggerzeitpunkt anpassen
❙ Cyan: Dekodierte Nachricht
Mit der Softmenütaste BIT REIHENFOLGE kann festgelegt
werden, ob die Daten der einzelnen Nachrichten mit dem
MSB(MostSignicantBit)oderLSB(LeastSignicantBit)
beginnen sollen. Die Softmenütaste WORTGRÖßE erlaubt
in Verbindung mit dem Universaldrehgeber im CURSOR/
MENU Bedienfeld die Einstellung, wieviele Bits eine Nachricht beinhaltet. Es sind Werte von 1Bit bis 32Bit möglich.
13.5.2 SPI / SSPI BUS Triggerung
NachdemderSPI/SSPIBUSkonguriertwurde,kannauf
verschiedenste Ereignisse getriggert werden. Dazu wird
die Taste TYPE im TRIGGER Bedienfeld betätigt und dort
die Softmenütaste SERIELLE BUSSE gewählt. Anschließend wird die Taste SOURCE im TRIGGER Bedienfeld
gedrückt und der SPI/SSPI BUS ausgewählt. Der SPI/
SSPI BUS ist im SOURCE Menü nur auswählbar, wenn
derBUSvorherkonguriertwurde.MittelsFILTER-Taste
im TRIGGER Bedienfeld können nun die möglichen SPI/
SSPI Triggerbedingungen ausgewählt werden. Folgende
Triggerbedingungenkönnendeniertwerden:
❙ FRAME START: Setzt das Triggerereignis auf den Start
des Frames. Der Frame beginnt beim Wechsel des
Chip-Select (CS) Signals auf den ausgewählten aktiven
Zustand.
❙ FRAME ENDE: Setzt das Triggerereignis auf das Ende
des Frames. Der Frame endet beim Wechsel des
Chip-Select (CS) Signals vom ausgewählten aktiven zum
inaktiven Zustand.
❙ BIT: Mit dem Universaldrehgeber oder numerisch mit der
KEYPAD Taste im CURSOR/MENU Bedienfeld kann der
Triggerzeitpunkt auf das eingestellte Bit innerhalb der
eingestellten Bitfolge gesetzt werden.
❙ SER. BITFOLGE: Es kann eine bestimmte Reihenfolge
vonBitsinnerhalbdesFramesdeniertwerden,diedas
Triggerereignis auslöst. Mit der Softmenütaste
BIT-OFFSETkanndasersteBitderdeniertenBitfolge
innerhalb des Frames festgelegt werden. Eine Werteeingabe von 0 bis 4095 ist mit dem Universaldrehgeber
oder numerisch mit der KEYPAD Taste im CURSOR/
MENU Bedienfeld möglich. Die Bits davor haben keinen
EinflussaufdasTriggerereignis (z.B. bei Bit Offset = 2
werden Bit 0 und Bit 1 nach CS ignoriert und das Muster
beginnt mit Bit 2). Die Softmenütaste BIT ANZAHL legt
fest, wieviele Bits für die Triggerbedingung ausgewertet
werden sollen. Die Werteeingabe von 1 bis 32 Bit erfolgt
mit dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU
Bedienfeld. Die Eingabe der seriellen Bitfolge (PATTERNEINGABE) kann binär oder hexadezimal erfolgen. Wird die
binäre Eingabe gewählt, so können die einzelnen Bits
innerhalb der Daten zur Bearbeitung mit der Softmenü-
53
Page 54

Serielle Busanalyse
taste BIT WÄHLEN und dem Universaldrehgeber im
CURSOR/MENU Bedienfeld ausgewählt werden. Mit der
Softmenütaste ZUSTAND wird jedem Bit ein logischer
Zustand zugeordnet (High = H = 1, Low = L = 0 oder X =
ohne Wertung). Der Zustand X kennzeichnet einen be-
liebigen Zustand. Wird die hexadezimale Eingabe ge-
wählt, wird mit der Softmenütaste WERT und dem
Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld der
Wert für das jeweilige Nibble (4 Bit) festgelegt. Bei der
hexadezimalen Eingabe kann nur das gesamte Nibble auf
X gesetzt werden. Mit der Softmenütaste NIBBLE
WÄHLEN kann von Nibble zu Nibble geschaltet werden.
Das jeweils aktive Nibble wird im Anzeigefenster der
Triggerbedingung mit einem grünen Rand versehen.
Mehrmaliges Drücken auf die Softmenütaste MENU OFF
schließt alle Menüs und das Oszilloskop triggert auf die
eingestellte Bitfolge. Bei Messungen ohne Messobjekt
siehe Kap. 10.2.5.
13.5.3 SPI/SSPI BUS Tabelle
Protokolle. Das RS-232 Protokoll ist eines davon. Es besteht aus einem Rahmen mit Startbit, fünf bis neun Datenbits, einem Paritäts- und einem Stoppbit. Das Stoppbit
kann die 1-fache, die 1½-fache oder die 2-fache Länge
eines normalen Bits haben.
Abb. 13.11: UART Bitfolge
13.6.1 UART/RS-232BUSKonguration
Vor der BUS Konguration ist die Einstellung des Schwellwertes notwendig (siehe Kap. 4.5). Die Standardeinstellung liegt bei
50 0 mV.
Nachdem der BUS TYP UART gewählt wurde, wird das
KongurationsmenüüberdieSoftmenütasteKONFIGURATION geöffnet. Mit der Softmenütaste DATENQUELLE und
dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld
wird der gewünschte Kanal ausgewählt.
Ist die Option R&S®HOO11 bzw. der Voucher R&S®HV111 installiert, so können nur analoge Kanäle als Quelle gewählt werden.
Ist die Option R&S®HOO10 bzw. der Voucher R&S®HV110 installiert, so sind sowohl analoge als auch digitale Kanäle als Quelle
auswählbar.
Abb. 13.10: SSPI BUS Tabellenbeispiel
Spalte Beschreibung
Start Time Frame Startzeit in Bezug auf den Triggerzeitpunkt
Length Anzahl der Bits innerhalb eines Frames
Data Datenbytes
State
Tab. 13.3: Aufteilung SPI/SSPI BUS Tabelle
Frame Status:
ı OK = Frame o.k.
ı DATA = bei Erfassungsanfang/-ende wurde nur
der Framestart oder das Frameende dekodiert
und es sind noch keine Daten vorhanden
ı INS = ein „angerissener“ Frame sitzt am Ende
der Erfassung und das eigentliche Ende wurde
nicht dekodiert
13.6 UART / RS-232 BUS
Die UART/RS-232-Triggerung und Dekodierung erfordert die
Option R&S®HOO10 bzw. R&S®HOO11 oder die Upgrade Voucher
R&S®HV110 bzw. R&S®HV111.
Der UART (Universal Asynchronous Receiver Transmitter)
BUS ist ein generelles Bussystem und Grundlage für viele
Die Softmenütaste AKTIV legt fest, ob die auf dem BUS
übertragenden Daten aktiv High (High = 1) oder aktiv Low
(Low = 1) sind (bei RS-232 ist hier Low zu wählen). Mit
der Softmenütaste SYMBOLGRÖßE und dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld können die Bits,
welche ein Symbol bilden, von 5 Bit bis 9 Bit eingestellt
werden. Paritätsbits dienen zur Fehlererkennung während
einer Übertragung. Folgende Paritätseinstellungen sind
möglich:
❙ KEINE: Kein Paritätsbit verwenden.
❙ GERADE (GER.): Das Paritätsbit wird auf „1“ gesetzt,
wenn die Anzahl der „Einsen“ in einem bestimmten Satz
von Bits ungerade ist (ohne Paritätsbit).
❙ UNGERADE (UNGER.): Das Paritätsbit wird auf „1“
gesetzt, wenn die Anzahl der „Einsen“ in einem
bestimmten Satz von Bits gerade ist (ohne Paritätsbit).
Mit der Softmenütaste STOPPBITS wird die Länge des
Stoppbits festgelegt (1 = 1-fach, 1.5 = 1½-fach oder
2=2-fach).AufSeite2|2desUART BUS Kongurationsmenü kann die BITRATE (Symbolrate) mittels Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld eingestellt
werden. Die Bitrate beschreibt die gesendeten Bits pro
Sekunde. Gebräuchliche Zahlenwerte stehen zur Auswahl.
Über die Softmenütaste NUTZER können dagegen eigene
Bitraten mit dem Universaldrehgeber oder numerisch mit
derKEYPADTasteimCURSOR/MENUBedienfelddeniert
werden. Die RUHEZEIT stellt die minimale Zeit zwischen
dem Stopp-Bit der letzten Daten und dem Start-Bit der
neuen Daten dar. Die Ruhezeit dient ausschließlich dazu,
den Start einer Übertragung und damit den genauen Start
eines Frames (ein oder mehrere Symbole, meist Byte) zu
bestimmen. Nur mit dieser Information ist ein korrektes
54
Page 55

Abb. 13.12: Triggermenü UART Daten
dekodieren und triggern (egal welche Triggerart) möglich.
Ein Start-Bit innerhalb der Ruhezeit wird nicht erkannt.
Die Werteeingabe erfolgt mit Universaldrehgeber oder
numerisch mit der KEYPAD Taste im CURSOR/MENU
Bedienfeld. Zur Kontrolle wird ein Informationsfenster zu
den aktuellen Einstellungen auf dem Bildschirm gezeigt.
Abb.13.13:Seite2|2UART BUS Kongurationsmenü
Bestimmte Teile der UART Nachrichten werden farbig hervorgehoben, um diese einfach unterscheiden zu können:
❙ Weiß: Start/Stopp einer dekodierten Nachricht
❙ Rot: Nachricht konnte nicht komplett dekodiert
werden; ggf. Einstellungen im Horizontal
system oder Triggerzeitpunkt anpassen
❙ Cyan: Dekodierte Nachricht
13.6.2 UART/RS-232 BUS Triggerung
Nachdem der UART/RS-232BUSkonguriertwurde,kann
auf verschiedenste Ereignisse getriggert werden. Dazu
wird die Taste TYPE im TRIGGER Bedienfeld betätigt und
dort die Softmenütaste SERIELLE BUSSE gewählt. Anschließend wird die Taste SOURCE im TRIGGER Bedienfeld
gedrückt und der UART BUS ausgewählt. Der UART BUS
ist im SOURCE Menü nur auswählbar, wenn der BUS vor-
herkonguriertwurde.MittelsFILTER-TasteimTRIGGER
Bedienfeld können nun die möglichen UART Triggerbedingungen ausgewählt werden. Folgende Triggerbedingun-
genkönnendeniertwerden:
Serielle Busanalyse
❙ STARTBIT: Das Start-Bit ist das erste 0-Bit, das auf ein
Stopp-Bit oder eine Ruhezeit folgt.
❙ FRAME START: Stellt das erste Start-Bit nach einer
Ruhezeit dar.
❙ SYMBOL<N>:Denierteinausgewähltesn-tesSymbol
als Triggerereignis.
❙ BEL. SYMBOL: In diesem Menü kann ein beliebiges
Symboldeniertwerden,aufwelchesgetriggertwerden
soll. Das Symbol kann sich dabei an einer beliebigen
StelleinnerhalbeinesFramesbenden.DieEingabeder
seriellen Bitfolge (PATTERNEINGABE) kann binär oder
hexadezimal erfolgen. Wird die binäre Eingabe gewählt,
können die einzelnen Bits innerhalb der Daten zur
Bearbeitung mit der Softmenütaste BIT WÄHLEN und
dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld
ausgewählt werden. Mit ZUSTAND wird jedem Bit ein
logischer Zustand zugeordnet (High = H = 1, Low = L = 0
oder X = ohne Wertung). Der Zustand X kennzeichnet
einen beliebigen Zustand. Wird die hexadezimale Eingabe
gewählt, so wird mit der Softmenütaste WERT und dem
Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld der
Wert für das jeweilige Symbol festgelegt. Bei der
hexadezimalen Eingabe kann nur das gesamte Symbol auf
X gesetzt werden. Mit der Softmenütaste SYMBOL
WÄHLEN kann von Symbol zu Symbol geschaltet
werden.
❙ DATEN: Dieses Softmenü bietet weitere UART
Triggereinstellmöglichkeiten. Mit der Softmenütaste
SYMBOL OFFSET kann mit dem Universaldrehgeber oder
der KEYPAD Taste im CURSOR/MENU Bedienfeld die
Anzahl an unrelevanten Symbolen festgelegt werden, die
innerhalb des Frames vor dem für das Triggerereignis
relevanten Muster stehen. Eine Werteeingabe von 0 bis
4095 Symbolen nach dem Start-Bit ist möglich. Mit der
Softmenütaste ANZ. DER SYMB. und dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld kann die Größe
desMustersdeniertwerden.DieLängederSymbole(5
bis9Bit)wurdebeiderBusdenitionbereitsfestgelegt
und hier im Triggermenü entsprechend berücksichtigt.
Die Werteeingabe der Symbole kann wieder (wie zuvor
beschrieben) binär oder hexadezimal erfolgen und wird
bestimmt durch die Softmenütaste PATTERNEINGABE.
Wird die binäre Eingabe gewählt, können die einzelnen
Bits mit der Softmenütaste BIT WÄHLEN und dem
Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienbereich
ausgewählt werden. Die Softmenütaste ZUSTAND legt
den Zustand für jedes Bit fest (1, 0 oder X). Wird die
hexadezimale Eingabe gewählt, wird mit der Softmenütaste WERT und dem Universaldrehgeber im CURSOR/
MENU Bedienfeld der Wert für das jeweilige Symbol
festgelegt. Mit der Softmenütaste SYMBOL WÄHLEN
schaltet man von Symbol zu Symbol. Das jeweils aktive
Byte wird im Anzeigefenster der Triggerbedingung mit
einem grünen Rand versehen.
❙ PARITÄTSFEHLER: Triggern bei einem Paritätslter
❙ FRAME FEHLER: Triggern bei einem Frame-Fehler
❙ BREAK: Triggern bei einem Break. Die Break-Bedingung
ist erfüllt, wenn nach einem Start-Bit nicht innerhalb eines
55
Page 56

Serielle Busanalyse
bestimmten Zeitraumes ein Stop-Bit folgt. Während des
Breaks sind die Stop-Bits Low aktiv.
Abb. 13.14: UART Triggermenü Seite 2
Mehrmaliges Drücken auf die Softmenütaste MENU OFF
schließt alle Menüs und das Oszilloskop triggert auf die
eingestellte Bitfolge. Bei Messungen ohne Messobjekt
siehe Kap. 10.2.5.
13.6.3 UART BUS Tabelle
Sensoren eingesetzt. Dieses Bussystem ist vermehrt auch
in der Luftfahrt-, Medizin- und in der allgemeinen Automatisierungsindustriezunden.DasSignalistaufderphysikalischen Ebene ein differentielles Signal. Es wird daher
zum Dekodieren ein differentieller Tastkopf (z.B. Hameg
HZO40) empfohlen, auch wenn es mit den Standardtastköpfen möglich ist, die Signale aufzunehmen. Eine CAN
Nachricht besteht im wesentlichen aus einem Startbit, der
Frame ID (11 oder 29 Bit), dem Data Length Code DLC,
den Daten, einem CRC, Acknowledge und Endbit.
13.7.1 CANBUSKonguration
Vor der BUS Konguration ist die Einstellung des Schwellwertes notwendig (siehe Kap. 4.5). Die Standardeinstellung liegt bei
50 0 mV.
Nachdem der BUS TYP CAN gewählt wurde, wird das
KongurationsmenüüberdieSoftmenütasteKONFIGURATION geöffnet. Mit der Softmenütaste DATA und dem
Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld wird
der gewünschte Kanal ausgewählt. Grundsätzlich kann ein
analoger oder digitaler Kanal an CAN-High oder CAN-Low
angeschlossen werden. Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, einen differentiellen Tastkopf (z.B. Hameg HZO40) an
einen analogen Kanal anzuschließen. Bei Nutzung eines
differentiellen Tastkopfes ist CAN High zu wählen, wenn
der Plus Eingang des Tastkopfes an CAN-H und der Minus
Eingang an CAN L angeschlossen ist. Wird der Tastkopf
mit umgekehrter Polarität angeschlossen, mus CAN L gewählt werden.
Abb. 13.15: UART BUS Tabellenbeispiel
Spalte Beschreibung
Start Time Frame Startzeit in Bezug auf den Triggerzeitpunkt
Data Datenbytes
State Frame Status:
❙ OK = Frame o.k.
❙ DATA = bei Erfassungsanfang/-ende wurde nur
der Framestart oder das Frameende dekodiert
und es sind noch keine Daten vorhanden
❙ INS = ein „angerissener“ Frame sitzt am Ende
der Erfassung und das eigentliche Ende wurde
nicht dekodiert
Tab. 13.4: Aufteilung UART BUS Tabelle
13.7 CAN BUS
Die CAN-Triggerung und Dekodierung erfordert die Option
R&S®HOO12 oder den Upgrade Voucher R&S®HV112.
Der CAN BUS (Controller Area Network) ist ein Bussystem
vorrangig für die Automobiltechnik und wird zum Datenaustausch zwischen Steuergeräten untereinander und mit
56
Abb.13.16:CANBUSKonguration
Die Softmenütaste ABTASTPUNKT bestimmt den
Zeitpunkt innerhalb der Bit-Zeit, an dem der Wert für das
aktuelle Bit „gesamplet“ wird. Die Werteeingabe in Prozent (25% bis 90%) erfolgt mit dem Universaldrehgeber
oder numerisch mit der KEYPAD Taste im CURSOR/MENU
Bedienfeld. Die BITRATE beschreibt die gesendeten Bits
pro Sekunde und erlaubt mit dem Universaldrehgeber im
CURSOR/MENU Bedienfeld die Auswahl von Standarddatenraten. Mit der Softmenütaste NUTZER können ei-
geneBitratendeniertwerden.DieWerteeingabeerfolgt
mittels Universaldrehgeber oder KEYPAD Taste im CURSOR/MENU Bedienfeld.
Page 57

Bestimmte Teile der CAN Nachrichten werden farbig hervorgehoben, um diese einfach unterscheiden zu können:
❙ Weiß: Datenlänge (DLC)
❙ Cyan: Datennachricht
❙ Magenta: Identier
❙ Rot: Frame Error
13.7.2 CAN BUS Triggerung
NachdemderCANBUSkonguriertwurde,kannaufverschiedenste Ereignisse getriggert werden. Dazu wird die
Taste TYPE im TRIGGER Bedienfeld betätigt und dort die
Softmenütaste SERIELLE BUSSE gewählt. Anschließend
wird die Taste SOURCE im Trigger Bedienfeld gedrückt
und der CAN Bus ausgewählt. Der CAN BUS ist im
SOURCE Menü nur auswählbar, wenn der BUS vorher konguriertwurde.MittelsFILTER-TasteimTRIGGERBedienfeld können nun die möglichen CAN Triggerbedingungen
ausgewählt werden. Folgende Triggerbedingungen können
deniertwerden:
❙ FRAME START: Triggern auf die erste Flanke des
SOF-Bit (Synchronisationsbit).
❙ FRAME ENDE: Triggern auf das Ende des Frames.
❙ FRAME LESEDATEN: Dieses Softmenü bietet
verschiedene Auswahlmöglichkeiten, wie das Triggern auf
FEHLER (allgemeiner Frame-Fehler), ÜBERLAST (Triggern
auf CAN Overload-Frames) oder DATEN (Triggern auf
Daten-Frames). Mit der Softmenütaste LESEDATEN wird
auf Lese-Frames getriggert. Mittels Softmenütaste LESEN/
SCHREIBEN:wird auf Lese- und Daten-Frames getriggert.
Mit der Softmenütaste ID TYP und dem Universaldrehge-
berimCURSOR/MENUBedienfeldkannderIdentiertyp
(11 Bit, 29 Bit oder beliebig) ausgewählt werden.
❙ FEHLER S: IdentiziertverschiedeneFehlerineinem
Frame. Es können eine oder mehrere Fehlermeldungstypen als Trigger-Bedingung ausgewählt werden. Mittels
Softmenütaste STOPFBIT (Stuff Bit) werden die einzelnen
Frame-Segmente (wie Frame-Start etc.) vom „Bit
Stufng“-Verfahrencodiert.DerTransmitterfügtauto-
matisch ein komplementäres Bit im Bitstrom ein, wenn er
fünf aufeinanderfolgende Bits mit gleichem Wert in dem
zu übertragenden Bitstrom erkennt. Ein „Stuff“-Fehler
tritt auf, wenn die sechste aufeinanderfolgende gleiche
Bit-Ebene in den genannten Bereichen erkannt wird. Ein
FORM-Fehler tritt auf, wenn ein festes Bitfeld ein oder
mehrere unzulässige Bits enthält. Ein Bestätigungsfehler
tritt auf, wenn der Transmitter keine Bestätigung
empfängt (Acknowledge). CAN BUS verwendet eine
komplexe Prüfsummenberechnung (CRC-Cyclic
Redundancy Check). Der Transmitter berechnet die CRC
und sendet das Ergebnis in einer CRC-Sequenz. Der
Empfänger berechnet die CRC in der gleichen Weise. Ein
CRC-Fehler tritt auf, wenn das berechnete Ergebnis von
der empfangenen CRC-Sequenz abweicht.
❙ IDENTIFIER: Kennzeichnet die Priorität und die logische
Adresse einer Nachricht. Mit der Softmenütaste FRAME
TYP (Daten allgemein, Lesedaten bzw. Lese/Schreibdaten)
kann mit dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld der Typ ausgewählt werden. Mit dem Softmenü
ADRESS-SETUP kann mit der Softmenütaste ID TYP die
Serielle Busanalyse
Abb. 13.17: CAN BUS
LängedesIdentiertypsmitdemUniversaldrehgeberim
CURSOR/MENU Bedienfeld eingestellt werden (11 Bit
Basis oder 29 Bit für erweiterte CAN Frames). Die
Softmenütaste VERGLEICH setzt die Vergleichsfunktion.
Wenn das Pattern mindestens ein X (ohne Wertung)
enthält, kann auf gleich oder ungleich des angegebenen
Wertes getriggert werden. Wenn das Pattern nur 0 oder 1
enthält, kann auf einen Bereich größer oder kleiner des
angegebenen Wertes getriggert werden. Die PATTERNEINGABE kann binär oder hexadezimal erfolgen. Wird
die binäre Eingabe gewählt, können die einzelnen Bits
innerhalb der Daten zur Bearbeitung mit der Softmenütaste BIT und dem Universaldrehgeber im CURSOR/
MENU Bedienfeld ausgewählt werden. Mit ZUSTAND
wird jedem Bit ein logischer Zustand zugeordnet (High =
H = 1, Low = L = 0 oder X = ohne Wertung). Der Zustand
X kennzeichnet einen beliebigen Zustand. Wird die
hexadezimale Eingabe gewählt, so wird mit der Softmenütaste WERT und dem Universaldrehgeber im
CURSOR/MENU Bedienbereich der Wert für das jeweilige
Byte festgelegt. Bei der hexadezimalen Eingabe kann nur
das gesamte Byte auf X gesetzt werden. Mit der Softmenütaste BYTE kann von Byte zu Byte geschaltet
werden.
❙ ADRESSE UND DATEN: Dieses Softmenü bietet die
gleichen Einstellmöglichkeiten wie das Softmenü
IDENTIFIER (siehe oben). Mit der Softmenütaste FRAME
TYP (Daten allgemein bzw. Lesedaten) kann mit dem
Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld der
Typ ausgewählt werden. Im Softmenü ADRESS-SETUP
wird die Adresse des entsprechenden Musters eingeben.
Das Softmenü DATEN SETUP erlaubt die Eingabe des
Datenbitmusters bzw. der HEX Werte für bis zu 8 Byte
(nur einstellbar, wenn als Frame Typ DATEN gewählt
wurde). Als Vergleiche für Adress- und Datenwerte stehen
jeweils wieder GRÖßER und KLEINER GLEICH, GLEICH
sowie UNGLEICH zur Verfügung.
Mehrmaliges Drücken auf die Softmenütaste MENU OFF
schließt alle Menüs und das Oszilloskop triggert auf die eingestellte Bitfolge. Bei Messungen ohne Messobjekt siehe
Kap. 10.2.5.
57
Page 58

Serielle Busanalyse
13.7.3 CAN BUS Tabelle
Abb. 13.8: CAN BUS Tabellenbeispiel
Spalte Beschreibung
Start Time Frame Startzeit in Bezug auf den Triggerzeitpunkt
Typ e Fra me Typ:
❙ DATA = Daten Frame
❙ REMOTE = initiiert die Übertragung von Daten
von einem anderen Knoten (Remote Frame)
❙ E RR-F. = Fehler in der Übertragung (Error
Frame)
❙ O VL-F. = Overload Frame
ID Frame ID
DLC Datenlänge
Data Datenbytes
CRC Cyclic Redundancy Check
State Frame Status:
❙ OK = Frame o.k.
❙ CRC = das berechnete Ergebnis weicht von der
empfangenen CRC-Sequenz (CRC-Cyclic
Redundancy Check) ab
❙ NACK = fehlende Bestätigung (Not
Acknowledge)
❙ CRC+NACK = abweichende Prüfsumme
gefolgt von fehlender Bestätigung
❙ STUFF=BitStufngFehler
❙ INS = ein „angerissener“ Frame sitzt am Ende
der Erfassung und das eigentliche Ende wurde
nicht dekodiert
Tab. 13.5: Aufteilung CAN BUS Tabelle
Die Daten werden in Bytes ohne Parität übertragen (basierend auf UART). Jedes Byte besteht aus einem Startbit, 8
Datenbits und einem Stop-Bit.
Abb. 13.19: Aufbau LIN Byte-Struktur
13.8.1 LINBUSKonguration
Vor der BUS Konguration ist die Einstellung des Schwellwertes notwendig (siehe Kap. 4.5). Die Standardeinstellung liegt bei
50 0 mV.
Nachdem der BUS TYP LIN gewählt wurde, wird das
KongurationsmenüüberdieSoftmenütasteKONFIGURATION geöffnet. Mit der Softmenütaste DATA und dem
Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld wird
der gewünschte Kanal ausgewählt. Die Softmenütaste
POLARITÄT schaltet zwischen High (H) und Low (L) um.
Grundsätzlich kann ein analoger oder digitaler Kanal an
LIN-High oder LIN-Low angeschlossen werden. Mit der
Softmenütaste VERSION und dem Universaldrehgeber
im CURSOR/MENU Bedienfeld können die verschiedenen
Versionen des LIN-Standards eingestellt werden. Die BITRATE legt die Anzahl der übertragenen Bits pro Sekunde
fest. Mittels Universaldrehgeber im CURSOR/MENU
BedienfeldkannzwischenvordeniertenStandard-DatenratenundnutzerdeniertenDatenraten(NUTZER)gewählt
werden.DiemaximalmöglichenutzerdenierteDatenrate
beträtgt4MBit/s.DienutzerdenierteWerteeingabeer-
folgt mittels Universaldrehgeber oder numerisch mit der
KEYPAD Taste im CURSOR/MENU Bedienfeld.
Bestimmte Teile der LIN Nachrichten werden farbig hervorgehoben, um diese einfach unterscheiden zu können:
❙ Weiß: Synchronisationsbyte / Checksum
❙ Cyan: Datennachricht
❙ Gelb: Identier
❙ Grün: Paritätsbit
❙ Rot: Frame Error
13.8 LIN BUS
Die LIN-Triggerung und Dekodierung erfordert die Option
R&S®HOO12 oder den Upgrade Voucher R&S®HV112.
Der LIN BUS (Local Interconnect Network) ist ein einfaches Master/Slave Bussystem für die Automobiltechnik
und wird zum Datenaustausch zwischen Steuergeräten
und Sensoren bzw. Aktoren eingesetzt. Das Signal wird
auf einer Leitung mit Massebezug zur Fahrzeugmasse
übertragen. Ein LIN BUS besitzt folgende Eigenschaften:
❙ Serielles Single-Wire Kommunikationsprotokoll
(byte-orientiert)
❙ Master-Slave Kommunikation (in der Regel bis zu 12
Knoten)
❙ Mastergesteuerte Kommunikation (Master initiiert /
koordiniert die Kommunikation)
58
Abb. 13.20: LIN BUS Menü
Page 59

Abb. 13.21: LIN Daten Triggermenü
13.8.2 LIN BUS Triggerung
NachdemderLINBUSkonguriertwurde,kannaufverschiedenste Ereignisse getriggert werden. Dazu wird die
Taste TYPE im TRIGGER Bedienfeld betätigt und dort die
Softmenütaste SERIELLE BUSSE gewählt. Anschließend
wird die Taste SOURCE im TRIGGER Bedienfeld gedrückt
und der LIN BUS ausgewählt. Der LIN BUS ist im SOURCE
Menünurauswählbar,wennderBUSvorherkonguriert wurde. Mittels FILTER-Taste im TRIGGER Bedienfeld
können nun die möglichen LIN Triggerbedingungen ausgewählt werden. Folgende Triggerbedingungen können
deniertwerden:
❙ FRAMESTART: Triggert auf das Stoppbit des
Synchronisationsfeld.
❙ WAKE UP: Triggert nach einem „Wake up“ Frame.
❙ FEHLER C: In diesem Menü können eine oder mehrere
Fehlermeldungstypen als Trigger-Bedingung ausgewählt
werden. Ein LIN BUS verwendet eine komplexe
Prüfsummenberechnung (CRC - Cyclic Redundancy
Check). Der Transmitter berechnet die CRC und sendet das
Ergebnis in einer CRC-Sequenz. Der Empfänger berechnet
die CRC in der gleichen Weise. Ein CRC-Fehler tritt auf,
wenn das berechnete Ergebnis von der empfangenen
CRC-Sequenz abweicht. Mittels Softmenütaste PARITÄT
wird auf ein Paritätsfehler getriggert. Paritätsbits sind Bit 6
undBit7desIdentier.HierbeiwirddiekorrekteÜbertragungdesIdentierüberprüft.MitderSoftmenütaste
SYNCHRONISATION: wird getriggert, wenn das Synchronisationsfeld einen Fehler meldet.
❙ ID: Dieses Softmenü setzt den Trigger zu einem be-
stimmtenIdentierbzw.zueinembestimmtenIdentierbereich.DieSoftmenütasteVERGLEICHsetztdie
Vergleichsfunktion. Wenn das Pattern mindestens ein X
(ohne Wertung) enthält, kann auf gleich oder ungleich des
angegebenen Wertes getriggert werden. Wenn das
Pattern nur 0 oder 1 enthält, kann auf einen Bereich
größer oder kleiner des angegebenen Wertes getriggert
werden. Die PATTERN-EINGABE kann binär oder
hexadezimal erfolgen. Wird die binäre Eingabe gewählt,
können die einzelnen Bits innerhalb der Daten zur
Bearbeitung mit der Softmenütaste BIT und dem Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld aus-
Serielle Busanalyse
gewählt werden. Mit ZUSTAND wird jedem Bit ein
logischer Zustand zugeordnet (High = H = 1, Low = L = 0
oder X = ohne Wertung). Der Zustand X kennzeichnet
einen beliebigen Zustand. Wird die hexadezimale Eingabe
gewählt, wird mit der Softmenütaste WERT und dem
Universaldrehgeber im CURSOR/MENU Bedienfeld der
Wert für das jeweilige Byte festgelegt. Bei der hexadezimalen Eingabe kann nur das gesamte Byte auf X gesetzt
werden. Mit der Softmenütaste BYTE kann von Byte zu
Byte geschaltet werden.
❙ ADRESSE UND DATEN: Das Softmenü ADRESS-SETUP
und DATEN-SETUP bieten die gleichen Einstellmöglichkeiten wie das Softmenü ID. Das Softmenü DATEN SETUP
erlaubt die Eingabe des Datenbitmusters bzw. der HEX
Werte für bis zu 8 Byte. Als Vergleiche für Adress- und
Datenwerte stehen jeweils wieder GLEICH und
UNGLEICH zur Verfügung.
Abb. 13.22: LIN BUS
Mehrmaliges Drücken auf die Softmenütaste MENU OFF
schließt alle Menüs und das Oszilloskop triggert auf die
eingestellte Bitfolge. Bei Messungen ohne Messobjekt
siehe Kap. 10.2.5.
13.8.3 LIN BUS Tabelle
Abb. 13.23: LIN BUS Tabellenbeispiel
59
Page 60

Serielle Busanalyse
Spalte Beschreibung
Start Time Frame Startzeit in Bezug auf den Triggerzeitpunkt
ID Frame ID
Length Anzahl der Bits innerhalb eines Frames
Data Datenbytes
Chks Prüfsumme (Checksum)
State Frame Status:
❙ OK = Frame o.k.
❙ DATA = bei Erfassungsanfang/-ende wurde nur
der Framestart oder das Frameende dekodiert
und es sind noch keine Daten vorhanden
❙ SYNC = Synchronisationsfehler
❙ CHKS = Checksum Fehler
❙ PARI = Paritätsfehler
❙ WAKEUP = WakeUp Frame
❙ INS = ein „angerissener“ Frame sitzt am Ende
der Erfassung und das eigentliche Ende wurde
nicht dekodiert
Tab. 13.6: Aufteilung LIN BUS Tabelle
14 Remote Betrieb
Die R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202 Serie verfügt standardmäßig über eine Ethernet und eine USB
Schnittstelle
Um eine Kommunikation zu ermöglichen, müssen die gewählte
Schnittstelle und die ggfs. dazugehörigen Einstellungen im Oszilloskop exakt denen im PC entsprechen.
Neben einer LAN-Schnittstelle besitzt die R&S®HMO1002
bzw. R&S®HMO1202 Serie einen USB-Device-Anschluss.
Für diese Schnittstelle kann der Anwender auswählen, ob
das Gerät über einen virtuellen COM Port (VCP) oder über
die USB-TMC-Klasse angesprochen werden soll.
14.1 USB VCP
Die verfügbaren USB-VCP-Treiber sind für Windows XP™,
VISTA™, Windows 7™ und Windows 8™ (32 + 64 Bit) voll getestet und freigegeben.
Bei der klassischen Variante des VCP (virtueller COM Port)
kann der Anwender nach Installation der entsprechenden
Windows-Treiber mit einem beliebigen Terminalprogramm
über SCPI-Kommandos mit der R&S®HMO1002 bzw.
R&S®HMO1202 Serie kommunizieren. Der aktuellste USBVCP-Treiber kann kostenlos von der ROHDE & SCHWARZ
Webseite www.rohde-schwarz.com im Downloadbereich
heruntergeladen und in ein entsprechendes Verzeichnis
entpackt werden.
Der USB-VCP-Treiber kann nur auf dem PC installiert werden,
wenn folgende Grundvoraussetzungen erfüllt sind:
1. R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202 mit aktivierter
USB-VCP-Schnittstelle.
2. Ein PC mit dem Betriebssystem Windows XP™, VISTA™, Windows 7™, Windows 8™ oder Windows 10™ (32 oder 64 Bit).
3. Administratorrechte sind für die Installation des Treibers unbedingt erforderlich. Sollte eine Fehlermeldung bzgl. Schreibfehler erscheinen, ist im Regelfall das notwendige Recht für die
Installation des Treibers nicht gegeben. In diesem Fall setzen
Sie sich bitte mit Ihrer IT-Abteilung in Verbindung, um die notwendigen Rechte zu erhalten.
60
Ist auf dem PC noch kein Treiber für die R&S®HMO1002
bzw. R&S®HMO1202 Serie vorhanden, meldet sich das
Betriebssystem mit dem Hinweis „Neue Hardware gefunden“, nachdem die Verbindung zwischen dem Messgerät und dem PC hergestellt wurde. Außerdem wird der
„Assistent für das Suchen neuer Hardware“ angezeigt.
Nur dann ist die Installation des USB-Treibers erforderlich. Weitere Informationen zur USB VCP Treiberinstalla-
tionndenSieinderInstallationsanleitunginnerhalbder
Treiberdatei.
Zusätzlich kann die kostenlose Software HMExplorer genutzt werden. Diese Windows-Anwendung bietet für die
Page 61

R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202 Serie neben einer
Terminalfunktion auch die Möglichkeit, Screenshots zu
erstellen oder den Messwertspeicher auszulesen.
14.2 USB TMC
Die moderne Alternative zum virtuellen COM Port (VCP) ist
die Ansteuerung mit Hilfe der USB-TMC-Klasse. TMC steht
dabei für die „Test & Measurement Class“ und bedeutet,
dass bei installierten VISA-Treibern das angeschlossene
Messgerät ohne spezielle Windows-Treiber erkannt wird
und in den entsprechenden Umgebungen direkt verwendet werden kann. Der Aufbau des TMC-Modells hat die
GPIB-Schnittstelle als Vorbild. Daher ist es ein großer Vorteil der USB-TMC-Klasse, dass durch die Abfrage spezieller
Register festgestellt werden kann, ob Befehle beendet und
korrekt abgearbeitet worden sind. Bei der Kommunikation
über den VCP sind an dieser Stelle dagegen Prüf- und Polling-Mechanismen in der steuernden Software notwendig,
die teilweise zu einer erheblichen Belastung der Messgeräte-Schnittstelle führen können. Durch die TMC-StatusRegister wird dieses Problem bei USB-TMC genauso
gelöst, wie das bei der GPIB-Schnittstelle hardwareseitig
über die entsprechenden Steuerleitungen geschieht.
Remote Betrieb
Abb. 14.1b: NI-VISA 5.4.1
Starten Sie die Installation mit „Weiter“ und folgen Sie den
Installationsanweisungen.
Die Kommunikation über USB TMC wird von der HMExplorer
Software nicht unterstützt.
14.2.1 USBTMCKonguration
Die die R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202 Serie setzt
einen generischen USB Gerätetreiber voraus, wenn dieser im USB-TMC Modus betrieben wird. Die USB Test
& Measurement Klasse (USB-TMC) ist ein Protokoll, das
GPIB-ähnliche Kommunikation über USB Schnittstellen
ermöglicht und eine eigene Geräteklasse der USB-Spe-
zikationdarstellt.DasUSB-TMCProtokollunterstützt
Serviceabfragen,TriggerundandereGPIB-spezische
Anweisungen. Der Treiber ist im NI-VISA Paket (Virtual Instrument Software Architecture) enthalten und kann unter
http://www.ni.com/downloads/ni-drivers/ heruntergeladen
werden.
Zuerst müssen die NI-VISA Treiber auf Ihrem Windows
System installiert werden. Hierfür laden Sie sich bitte die
aktuellste Version des NI-VISA Treiberpakets herunter. Entpacken Sie das zuvor geladene Treiberpaket und folgen Sie
nun den Installationsanweisungen.
Abb. 14.2: NI-VISA Installationsanweisung
In diesem Schritt wählen Sie bitte unter „NI-VISA xxx >
Alle Anwendungen lokal installieren“ aus.
Hier beispielhaft für NI-VISA 5.4.1:
Abb. 14.1a: NI-VISA 5.4.1
Abb. 14.3: NI-VISA Anwendung lokal installieren
Nach der erfolgreichen Installation der NI-VISA Treiber,
können Sie nun die R&S®HMO1002 bzw. R&S®HMO1202
Serie auf die USB-TMC Schnittstelle umstellen. Gehen Sie
dazu in das SETUP Menü Ihres Oszilloskops und wählen
Sie INTERFACE.
61
Page 62

Remote Betrieb
Abb. 14.4: Setup-Menü
Anschließend wechseln Sie per Softkey auf „USB“ und
gehen weiter in das „PARAMETER“ Submenü.
Nach erfoglreicher Einrichtung erscheint das Fenster „Gerätetreiberinstallation“ mit „USB Test and Measurement
Device (IVI), Verwendung jetzt möglich“.
Abb. 14.7: Gerätetreiberinstallation
Öffnen Sie nun den Windows Geräte-Manager. Das Messgerät ist nun unter „USB Test and Measurement Devices >
USB Test and Measurement Device (IVI)“ gelistet.
Abb. 14.5: Schnittstellen-Menü
Dort stellen Sie den USB-Typ auf „USB TMC“.
Abb. 14.6: Schnittstellen-Parameter-Menü
Abb. 14.8: Anzeige im Geräte-Manager
14.3 USB MTP
USB-MTP stellt eine einfache Möglichkeit dar, sich Daten
vom Oszilloskop auf den PC zu laden. Hierzu wird in der
Regel keine Treiber benötigt (laut Microsoft wird USB MTP
ab WindowsXP SP3 automatisch unterstützt). USB-MTP
hat mit SCPI oder der Geräte-Fernsteuerung nichts zu tun,
es dient lediglich dem Transfer von Daten in Form von
Dateien. Wird am Oszilloskop die USB MTP Funktion ausgewählt und das Gerät mit einem PC verbunden, so taucht
das Gerät im PC Gerätemanager als tragbares Gerät auf.
Abschließend stellen Sie die Verbindung zwischen dem
Netzgerät und Ihrem Windows PC mit einem USB-Schnittstellenkabel (Typ A – B) her. Bei der erstmaligen Verwendung meldet sich das Betriebssystem mit dem Hinweis
„Neue Hardware gefunden“.
62
Abb. 14.9: Anzeige im Geräte-Manager
Page 63

Im Gerät enthalten sind drei Laufwerke:
❙ Internal Storage:
Zugriff auf die im Gerät gespeicherten Dateien, z.B.
Geräte Settings, Referenzen, Masken und Formelsätze
(nur bei R&S®HMO1202 Serie)
❙ Live Data:
Zugriff auf mehrere Unterordner, README.TXT Datei,
SCREENSHOT und SETTINGS
❙ Upload:
Senden von Dateien an das Oszilloskop (temporäres
Laufwerk)
Abb. 14.10: Ordner Anzeige
Ist ein USB Stick am Oszilloskop angesteckt, so kann der
Inhalt des USB Sticks über USB-MTP angesehen bzw. Dateien auf den PC kopiert werden. Der USB Stick erscheint
in der Ordner Liste als USB FRONT. Im Gegensatz zu der
Bildvorschau bei LIVE DATA, welche nur mit einem Rechtklick und ÖFFNEN möglich ist, funktioniert die Bildvorschau bei USB FRONT, da die Größenangabe im Explorer
mit der tatsächlichen Dateigröße übereinstimmt. Die Dateigrößenangaben im Explorer sind teilweise überschätzt,
damit Windows die Dateien beim Empfang am PC nicht
einfach abschneidet.
Remote Betrieb
Abb. 14.12: Ordnerstruktur LIVE DATA
In den Ordnern CHANNEL, BUS und PODbendensich
zwei Unterodner und eine README.TXT. Die Unterordner enthalten Dateien für die Kurvendaten in den diversen
Formaten. Die Dateien im Ordner ACQUISITION MEMORY
liefern Daten aus dem Erfassungsspeicher, die Dateien
im Ordner DISPLAY DATA liefern nur die sichtbaren Kurvendaten. In den Ordnern MATHE und REFERENZEN sind
nur die sichtbaren Kurvendaten enthalten, daher sind hier
keine Unterordner verfügbar. Die jeweiligen INFO.TXT Dateien enthalten einige wichtige Informationen zu den Kurven, wie z.B. Name, Einheiten, Samples und dergleichen.
Die Dateiinhalte werden erst beim Senden an den PC
erzeugt. Kurvendaten sollten aus diesem Grund nur mit angehaltener Erfassung (STOP Modus) ausgelesen werden.
Das Auslesen des Erfassungsspeicher ist nur mit angehaltener Erfassung sinnvoll, das sonst nur die Bildschirmdaten
ausgelesen werden. Wird die Erfassung beim Auslesen der
Daten nicht gestoppt, kann dies zu Kurvendaten von unterschiedlichen Erfassungen führen.
Abb. 14.11: Ordner Anzeige mit USB Stick
Das Senden von Dateien an das Oszilloskop wird nur im Laufwerk
Upload unterstützt. Alle anderen Laufwerke sind schreibgeschützt. Es gibt keine Möglichkeit, den Schreibschutz aufzuheben.
14.3.1 Live Data
Im Ordner LIVE DATAbendensichmehrereUnterordner
und Dateien. Beim Öffnen eines Screenshots wird jedesmal ein aktueller Schnappschuss gemacht und an den PC
gesendet. Ein Doppelklick darauf öffnet die Bildvorschau,
die jedoch in Kombination mit der R&S®HMO1002 bzw.
R&S®HMO1202 Serie nicht funktioniert. Die Größe der
tatsächlich gesendeten Datei ist aufgrund von Kompression kleiner als die Angabe im Explorer. Dies quittiert die
Bildvorschau mit einem Fehler. Screenshots können somit
immer nur mit einem Rechtsklick und ÖFFNEN geöffnet
werden. Die Datei SETTINGS liefert die aktuellen Geräteeinstellungen im jeweiligen Format.
14.3.2 Upload
Der Ordner UPLOAD ist ein temporäres Laufwerk im RAM
des Oszilloskop, welches seinen Inhalt beim Ausschalten
oder Neustarten des Gerätes verliert. Dieser Ordner ist
dazu gedacht, bestimmte Dateien an das Oszilloskop zu
senden. Wird vom PC eine Datei in diesen Ordner kopiert,
so überprüft das Oszilloskop die Datei, ob diese direkt
geladen werden kann. Die Dateiendungen .HDS und .SCP
für Geräteeinstellungen, .HLK für Lizenzschlüssel und
.HFU für Firmware Updates werden unterstützt. Andere
Dateiendungen werden ignoriert. Geräteeinstellungen und
Lizenzschlüssel werden ohne weitere Nachfrage des PCs
geladen. Zum Ausführen eines Firmware Updates ist es
zusätzlich notwendig, dass das Update über die Softmenütaste AUSFÜHREN direkt am Oszilloskop gestartet wird.
14.4 Ethernet
Zur direkten Verbindung mit einem Host (PC) oder indirekten Verbindung über einen Switch, wird ein doppelt
geschirmtes Netzwerkkabel (z.B. CAT.5, CAT.5e, CAT.5+,
CAT.6 oder CAT.7) benötigt, das auf beiden Seiten über
einen Stecker vom Typ RJ-45 verfügt. Als Netzwerkkabel
kann ein ungekreuztes oder ein gekreuztes Kabel (CrossOver-Cable) verwendet werden.
63
Page 64

Remote Betrieb
14.4.1 IP-Netzwerke (IP – Internetprotokoll)
Damit zwei oder mehrere Netzelemente (z. B. Messgeräte,
Hosts / PC’s, …) über ein Netzwerk miteinander kommunizieren können, sind ein Reihe von grundlegenden Zusammenhängen zu beachten, damit die Datenübertragung in
Netzwerken fehlerfrei und ungestört funktioniert. Jedem
Netzelement in einem Netzwerk muss eine IP-Adresse
zugeteilt werden, damit diese untereinander Daten austauschen können. IP-Adressen werden (bei der IP-Version 4)
in einer Form von vier durch Punkte getrennte Dezimalzahlen dargestellt (z.B. 192.168.15.1). Jede Dezimalzahl repräsentiert dabei eine Binärzahl von 8 Bit. IP-Adressen werden in öffentliche und private Adressbereiche aufgeteilt.
Öffentliche IP Adressen werden durch das Internet geroutet und können von einem Internet Service Provider (ISP)
bereitgestellt werden. Netzelemente die eine öffentliche
IP-Adresse besitzen, können über das Internet direkt erreicht werden bzw. können über das Internet Daten direkt
austauschen. Private IP-Adressen werden nicht durch das
Internet geroutet und sind für private Netzwerke reserviert.
Netzelemente die eine private IP-Adresse besitzen, können
nicht direkt über das Internet erreicht werden bzw. können
keine Daten direkt über das Internet austauschen.
Damit Netzelemente mit einer privaten IP-Adresse über
das Internet Daten austauschen können, müssen diese
über einen Router, der eine IP-Adressumsetzung durchführt (engl. NAT; Network Adress Translation), mit dem
Internet verbunden werden. Über diesen Router, der eine
private IP-Adresse (LAN IP-Adresse) und auch eine öffentliche IP Adresse (WAN IP-Adresse) besitzt, sind dann die
angeschlossen Netzelemente mit dem Internet verbunden
und können darüber Daten austauschen. Wenn Netzelemente nur über ein lokales Netzwerk (ohne Verbindung
mit dem Internet) Daten austauschen, verwenden Sie am
Besten private IP Adressen. Wählen Sie dazu z.B. eine
private IP-Adresse für das Messgerät und eine private
IP-Adresse für den Host (PC), mit dem Sie das Messgerät
steuern möchten. Sollten Sie Ihr privates Netwerk später
über einen Router mit dem Internet verbinden, können
Sie die genutzten privaten IP-Adressen in Ihrem lokalen
Netzwerk beibehalten. Da in jedem IP-Adressbereich die
erste IP-Adresse das Netzwerk bezeichnet und die letzte
IP-Adresse als Broadcast-IP-Adresse genutzt wird, müssen
von der „Anzahl möglicher Hostadressen“ jeweils zwei
IP-Adressen abgezogen werden (siehe Tab. 1: Private IP
Adressbereiche). Neben der Einteilung von IP-Adressen
in öffentliche und private Adressbereiche werden IPAdressen auch nach Klassen aufgeteilt (Class: A, B, C, D,
E).InnerhalbderKlassenA,B,undCbendensichauch
die zuvor beschriebenen privaten IP Adressbereiche. Die
Klasseneinteilung von IP-Adressen ist für die Vergabe
von öffentlichen IP-Adressbereichen von Bedeutung und
richtet sich im Wesentlichen nach der Größe eines lokalen
Netzwerks (maximale Anzahl von Hosts im Netzwerk),
das mit dem Internet verbunden werden soll (siehe Tab. 2:
Klassen von IP Adressen).
IP-Adressen können fest (statisch) oder variabel (dynamisch) zugeteilt werden. Wenn IP-Adressen in einem Netzwerk fest zugeteilt werden, muss bei jedem Netzelement
eine IP-Adresse manuell eingestellt werden. Wenn IPAdressen in einem Netzwerk automatisch (dynamisch) den
angeschlossenen Netzelementen zugeteilt werden, wird
für die Zuteilung von IP-Adressen ein DHCP-Server (engl.
DHCP;DynamicHostCongurationProtocol)benötigt.
Bei einem DHCP-Server kann ein IP-Adressbereich für die
automatische Zuteilung von IP-Adressen eingestellt werden. Ein DHCP-Server ist meistens bereits in einem Router
(DSL-Router, ISDN-Router, Modem-Router, WLAN-Router,
…) integriert. Wird ein Netzelement (Messgerät) über ein
Netzwerkkabel direkt mit einem Host (PC) verbunden, können dem Messgerät und dem Host (PC) die IP-Adressen
nicht automatisch zugeteilt werden, da hier kein Netzwerk
mit DHCP-Server vorhanden ist. Sie müssen daher am
Messgerät und Host (PC) manuell eingestellt werden.
Wenn DHCP genutzt wird und das Messgerät keine IP Adresse
beziehen kann (z.B. wenn kein Ethernet Kabel eingesteckt ist
oder das Netzwerk kein DHCP unterstützt) dauert es bis zu drei
Minuten, bis ein Timeout die Schnittstelle wieder zur Konguration frei gibt.
IP-Adressen werden durch das Verwenden von Subnetzmasken in einen Netzwerkanteil und in einen Hostanteil
Adressbereich Subnetzmaske(n) CIDR-Schreibweise AnzahlmöglicherHostadressen
10.0.0.0 –10.255.255.255 255.0.0.0 10.0.0.0/8 224−2=16.777.214
172.16.0.0 –172.31.255.255 255.240.0.0 172.16.0.0/12 220−2=1.048.574
192.168.0.0 –192.168.255.255 255.255.0.0
255.255.255.0
Tab. 14.1: Private IP Adressbereiche
192.168.0.0/16
192.168.0.0/24
216−2=65.534
8
2
−2=254
Klassen Adressbereich Netzanteil Hostanteil Max. Anzahl der Netze Max. Hosts pro Netz
A 0.0.0.1 - 127.255.255.255 8 Bit 24 Bit 126 16.777.214
B 128.0.0.1 - 191.255.255.255 16 Bit 16 Bit 16.384 65.534
C 192.0.0.1 - 223.255.255.255 24 Bit 8 Bit 2.097.151 254
D 224.0.0.1 - 239.255.255.255 Reserviert für Multicast-Anwendungen
E 240.0.0.1 - 255.255.255.255 Reserviert für spezielle Anwendungen
Tab. 14.2: Klassen von IP Adressen
64
Page 65

Remote Betrieb
aufgeteilt, so ähnlich wie z.B. eine Telefonnummer in
Vorwahl (Länder- und Ortsnetzrufnummer) und Rufnummer (Teilnehmernummer) aufgeteilt wird. Subnetzmasken
haben die gleiche Form wie IP Adressen. Sie werden aus
vier durch Punkte getrennten Dezimalzahlen dargestellt
(z.B. 255.255.255.0). Wie bei den IP-Adressen repräsentiert
hier jede Dezimalzahl eine Binärzahl von 8 Bit. Durch die
Subnetzmaske wird die Trennung zwischen Netzwerkanteil
und Hostanteil innerhalb einer IP Adresse bestimmt (z.B.
wird die IP-Adresse 192.168.10.10 durch die Subnetzmaske
255.255.255.0 in einen Netzwerkanteil 192.168.10.0 und
einen Hostanteil 0.0.0.10 aufgeteilt). Die Aufteilung erfolgt
durch die Umwandlung der IP-Adresse und der Subnetzmaske in Binärform und anschließend einer Bitweisen
logischen AND- Verknüpfung zwischen IP-Adresse und
Subnetzmaske. Das Ergebnis ist der Netzwerkanteil der IPAdresse. Der Hostanteil der IP-Adresse wird durch die Bitweise logische NAND-Verknüpfung zwischen IP-Adresse
und Subnetzmaske gebildet. Durch die variable Aufteilung
von IP-Adressen in Netzwerkanteil und Hostanteil durch
Subnetzmasken, kann man IP-Adressbereiche individuell
für große und kleine Netzwerke festlegen. Dadurch kann
man große und kleine IP-Netzwerke betreiben und diese
ggf. auch über einen Router mit dem Internet verbinden.
In kleineren lokalen Netzwerken wird meistens die Subnetzmaske 255.255.255.0 verwendet. Netzwerkanteil (die ersten 3 Zahlen) und Hostanteil (die letzte Zahl) sind hier ohne
viel mathematischen Aufwand einfach zu ermitteln und es
können bei dieser Subnetzmaske bis zu 254 Netzelemente
(z.B. Messgeräte, Hosts / PC’s, …) in einem Netzwerk
gleichzeitig betrieben werden.
IP-Adressenzuteilung mit der Aktivierung der DHCP Funktion möglich. Bitte kontaktieren Sie ggfs. Ihren IT Verantwortlichen, um die korrekten Einstellungen vorzunehmen.
PC und Messgerät müssen sich im gleichen Netzwerk benden,
ansonsten ist keine Verbindung möglich.
Wenn das Gerät eine IP-Adresse hat, lässt es sich mit
einem Webbrowser unter dieser IP aufrufen, da die
Ethernet Schnittstelle über einen integrierten Webserver
verfügt. Dazu wird die IP Adresse in der Adresszeile des
Browsers eingegeben (http://xxx.xxx.xxx.xxx) und es
erscheint ein entsprechendes Fenster mit der Angabe des
Gerätetyps und der Seriennummer.
Abb. 14.13: Ethernet-Parameter-Menü
Oft ist in einem Netzwerk auch ein Standardgateway vorhanden. In den meisten lokalen Netzen ist dieses Gateway
mit dem Router zum Internet (DSL-Router, ISDN-Router
etc) identisch. Über diesen (Gateway-) Router kann eine
Verbindung mit einem anderen Netzwerk hergestellt werden. Dadurch können auch Netzelemente, die sich nicht
imgleichen(lokalen)Netzwerkbenden,erreichtwerden
bzw. Netzelemente aus dem lokalen Netzwerk können mit
Netzelementen aus anderen Netzwerken Daten austauschen. Für einen netzwerkübergreifenden Datenaustausch
muss die IP-Adresse des Standardgateways ebenfalls
eingestellt werden. In lokalen Netzwerken wird meistens
die erste IP Adresse innerhalb eines Netzwerks für diesen
(Gateway-) Router verwendet. Router die in einem lokalen
Netzwerk als Gateway verwendet werden haben meistens
eine IP-Adresse mit einer „1“ an der letzten Stelle der IPAdresse (z.B. 192.168.10.1).
14.4.2 Ethernet Einstellungen
Die Schnittstellenkarte verfügt neben der USB- auch über
eine Ethernet-Schnittstelle. Die Einstellungen der notwendigen Parameter erfolgt direkt in der R&S®HMO1002 bzw.
R&S®HMO1202 Serie, nachdem Ethernet als Schnittstelle
ausgewählt wurde und die Softmenütaste PARAMETER gedrückt wurde. Es ist möglich, eine vollständige
Parametereinstellung inklusive der Vergabe einer festen IPAdresse vorzunehmen. Alternativ ist auch die dynamische
65
Page 66

Technische Daten
Technische Daten
Technische Daten
15 Technische Daten
R&S®HMO1002 Serie
R&S®HMO1202 Serie
2-Kanal Digital Oszilloskope mit
50/70/100/200/300 MHz Bandbreite
ab Firmware Version 5.457
Anzeige
Display Größe / Typ 16,5 cm (6,5“) VGA Farbdisplay
Display Auflösung 640 (H) x 480 (V) Pixel
2
Hintergrundbeleuchtung 400 cd/m
Anzeigenbereich für Kurven in Horizontalrichtung
ohne Menü 12 Div (600 Pixel)
mit Menü 10 Div (500 Pixel)
Anzeigebereich für Kurven
in Vertikalrichtung 8 Div (400 Pixel)
mit VirtualScreen 20 Div
Farbtiefe 256 Farben
Kanalanzeige Falschfarben, inverse Helligkeit
Helligkeitsstufen
Kurvenanzeige 32
Vertikalsystem
DSO Mode CH1, CH2
MSO Mode (POD mit Logiktastkopf R&S®HO3508)
R&S®HMO1002 Seire
R&S®HMO1202 Serie
Analogkanäle
Y-Bandbreite (-3 dB)
(1 mV, 2 mV)/Div
R&S®HMO1002 Serie
R&S®HMO1202 Serie
(5 mV bis 10 V)/Div
R&S®HMO1002
R&S®HMO1072
R&S®HMO1102
R&S®HMO1212
R&S®HMO1222
R&S®HMO1232
Untere AC Bandbreite 2 Hz
Bandbreitenbegrenzung ca. 20 MHz (zuschaltbar)
Anstiegszeit (berechnet, 10% bis 90%)
R&S®HMO1002 (50 MHz)
R&S®HMO1072 (70 MHz)
R&S®HMO1102 (100 MHz)
R&S®HMO1212 (100 MHz)
R&S®HMO1222 (200 MHz)
R&S®HMO1232 (300 MHz)
DC-Verstärkungsgenauigkeit
Eingangsempfindlichkeit
alle Analogkanäle 1mV/Div bis 10V/Div
Grobskalierung 13 kalibrierte Stellungen, 1-2-5 Folge
Feinskalierung zwischen den kalibirierten Stellungen
Impedanz
R&S®HMO1002 Serie
R&S®HMO1202 Serie
CH1, POD, Ext.In oder CH1, CH2, Ext.In
CH1, CH2, POD, Ext.In
50 MHz
100 MHz
50 MHz
70 MHz
100 MHz
100 MHz
200 MHz
300 MHz
<7 ns
<5 ns
<3,5 ns
<3,5 ns
<1,75 ns
<1,15 ns
3% vom Bereichsendwert
1MΩII16pF±2pF
1MΩII16pF±2pF,50Ω(umschaltbar)
(LED)
Kopplung DC, AC, GND
Max. Eingangsspannung
1MΩ 200 V
50Ω
(R&S®HMO1202 Serie) 5 V
Positionsbereich
R&S®HMO1002 Serie
R&S®HMO1202 Serie
Kanal Isolation 35 dB von DC bis zur spezifizierten Bandbreite
XY-Modus CH1, CH2
Invertierung wahlweise alle Analogkanäle
Logikkanäle mit Logiktastkopf R&S®HO3508
Schaltpegel TTL, CMOS, ECL, benutzer-
Impedanz 100kΩ||4pF
Kopplung DC
Max. Eingangsspannung 40 V
Triggersystem
Triggermodus
Auto Triggert automatisch auch dann, wenn kein
Normal Triggert nur auf ein definiertes Triggerereignis
Single Triggert einmalig auf ein definiertes
Triggeranzeige Display und Bedienfeld (LED)
Triggerempfindlichkeit
bis 5 mV/Div 1,5 Div
ab 5 mV/Div 0,8 Div
Pegeleinstellbereich
mit Autolevel einstellbar zwischen den Scheitelwerten des
ohne Autolevel ±5 Div (von der Displaymitte)
extern -5 V bis +5 V
Triggerkopplung
AC
R&S®HMO1002 Serie <5 mV/Div: 10 Hz bis 65 MHz
R&S®HMO1202 Serie <5 mV/Div: 10 Hz bis 130 MHz
DC
R&S®HMO1002 Serie <5 mV/Div: DC bis 65 MHz
R&S®HMO1202 Serie <5 mV/Div: DC bis 130 MHz
HF
R&S®HMO1002 Serie <5 mV/Div: 30 kHz bis 65 MHz
R&S®HMO1202 Serie <5 mV/Div: 30 kHz bis 130 MHz
zuschaltbare Filter
LF DC bis 5 kHz (-3 db), zuschaltbar bei DC und
Rauschunterdrückung min. Signalhöhe: 1,5 Div (ab 5 mV/Div)
Trigger Holdoff Bereich Auto, 50 ns bis 10 s
(abfallend mit 20 db/Dekade ab 100 kHz
s
)
auf 5 V
eff
, max. 30 V
eff
±5 Div (von der Displaymitte)
±15 Div (von der Displaymitte)
(gleicher V/Div Bereich)
definiert (-2 V bis +8 V)
s
Ereignis auftritt
Triggerereignis
Signals
>5 mV/Div: 10 Hz bis 65/90/130 MHz
>5 mV/Div: 10 Hz bis 130/220/300 MHz
>5 mV/Div: DC bis 65/90/130 MHz
>5 mV/Div: DC bis 130/220/300 MHz
>5 mV/Div: 30 kHz bis 65/90/130 MHz
>5 mV/Div: 30 kHz bis 130/220/300 MHz
Autolevel
zuschaltbar bei AC, DC und HF-Kopplung
s
66
Page 67

Technische Daten
Technische Daten
Externer Eingang (BNC)
Funktion ext. Triggereingang, zusätzlicher Digitalkanal
Impedanz 1MΩ||16pF±2pF
Empfindlichkeit 300 mV
ss
Pegeleinstellbereich -5 V bis +5 V
Max. Eingangsspannung 100 V
(abfallend mit 20 db/Dekade ab 100 kHz
s
)
auf 5 V
eff
Triggerkopplung
AC
R&S®HMO1002 Serie
R&S®HMO1202 Serie
10 Hz bis 50/70/100 MHz
10 Hz bis 100/200/300 MHz
DC
R&S®HMO1002 Serie
R&S®HMO1202 Serie
DC bis 50/70/100 MHz
DC bis 100/200/300 MHz
Triggerausgang über AUX OUT (BNC)
Funktion Ausgabe der Triggerfrequenz, Fehleranzeiger
beim Maskentest
Ausgangsspannung ca. 3 V
Polarität positiv
Pulsbreite > 150 ns (Triggerereignis),
> 0,5 µs (Maskenverletzung)
Triggerarten
Flanke
Richtung steigend, fallend, beide
Triggerkopplung Autolevel, AC, DC, HF
zuschaltbare Filter LF, Noise Rejection
Quellen
R&S®HMO1002 Serie
R&S®HMO1202 Serie
alle Analog- und Logikkanäle, Netz,
extern (AC, DC)
Pulsbreite
Polarität positiv, negativ
Funktion Gleich, ungleich, kleiner, größer, innerhalb/
außerhalb eines Bereiches
Pulsdauer 16 ns bis 10 s, Auflösung min. 2 ns
Quellen alle Analogkanäle
Logik
Funktionen
logisch UND, ODER, WAHR, UNWAHR
zeitlich Gleich, ungleich, kleiner, größer, innerhalb/
außerhalb eines Zeitbereiches,
Zeitüberschreitung
Zeitdauer 16 ns bis 10 s, Auflösung min. 2 ns
Zustände H, L, X
Quellen alle Logikkanäle
Video
Sync. Pulspolarität positiv, negativ
unterstütze Standards PAL, NTSC, SECAM, PAL-M, SDTV 576i,
HDTV 720p, HDTV 1080i, HDTV 1080p
Halbbild Even/Odd, Beide
Zeile wählbare Zeilennummer, alle
Quellen alle Analogkanäle, extern (AC, DC)
Serielle Busse (optional)
Busdarstellung bis zu zwei Busse können gleichzeitig ana-
lysiert werden. Darstellung der Daten im
ASCII-, Binär-, Dezimal- oder HexadezimalFormat
Optionsbezeichnung
2
R&S®HOO10, R&S®HV110 I
C/SPI/UART/RS-232 Busanalyse auf Analog-
und Logikkanälen
R&S®HOO11, R&S®HV111 I2C/SPI/UART/RS-232 Busanalyse auf
Analogkanälen
R&S®HOO12, R&S®HV112 CAN/LIN Busanalyse auf Analog- und
Logikkanälen
Triggerarten nach Protokolltyp
2
C Start, Stop, ACK, NACK, Address/Data
I
SPI Start, End, Serial Pattern (32Bit)
UART/RS-232 Startbit, Frame Start, Symbol, Pattern
LIN Frame Start, Wake Up, Identifier, Data, Error
CAN Frame Start, Frame End, Identifier, Data, Error
Horizontalsystem
Zeitbereich (Yt) Hauptansicht, Zeitbereichs- und Zoom-Fenster
Frequenzbereich (FFT) Zeitbereichsfenster und Frequenzansicht (FFT)
XY-Modus Spannung (XY)
VirtualScreen virtuelle Anzeige von ±10 Div für alle Mathe-
matik-, Logik-, Bus- und Referenzsignale
Komponententester Spannung (X), Strom (Y)
Referenzkurven bis zu 4 Referenzkurven gleichzeitig darstellbar
Kanal Deskew ±32 ns, Schrittweite 2 ns
Memory Zoom bis zu 50.000 : 1
Zeitbasis
Genauigkeit ± 50,0 x 10
-6
Alterung ± 10,0 x 10-6 pro Jahr
Betriebsart
REFRESH
R&S®HMO1002 Serie
R&S®HMO1202 Serie
2 ns/Div bis 50 s/Div
1 ns/Div bis 50 s/Div
ROLL 50 ms/Div bis 50 s/Div
Digitale Erfassung
Abtastrate (Echtzeit)
Analogkanäle
R&S®HMO1002 Serie
R&S®HMO1202 Serie
2x 500 MSa/s oder 1x 1 GSa/s
2x 1 GSa/s oder 1x 2 GSa/s
Logikkanäle
R&S®HMO1002 Serie
R&S®HMO1202 Serie
8x 500 MSa/s
8x 1 GSa/s
Speichertiefe
Analogkanäle
R&S®HMO1002 Serie
R&S®HMO1202 Serie
2x 500 kSa oder 1x 1 MSa
2x 1 MSa oder 1x 2 MSa
Logikkanäle
R&S®HMO1002 Serie
R&S®HMO1202 Serie
500 kSa pro Kanal
1 MSa pro Kanal
Auflösung 8 Bit, (HiRes bis zu 16 Bit)
Kurvenform Arithmetik Refresh, Roll (freilaufend/getriggert), Average
(bis zu 1024), Envelope (Hüllkurve), Peak-
Detect (2 ns), Filter (Tiefpass, einstell-bar),
Hochauflösend (HiRes bis zu 16 Bit)
Aufnahmemodus Automatik, max. Abtastrate, max.
Kurvenwiederholrate
Interpolation
alle Analogkanäle Sin(x)/x, Linear, Sample-hold
Logikkanäle Puls
Verzögerung
Pretrigger
R&S®HMO1002 Serie
R&S®HMO1202 Serie
0 bis 500.000 Sa x (1/Abtastrate)
0 bis 1.000.000 Sa x (1/Abtastrate)
(2x im interlaced Betrieb)
6
Posttrigger 0 bis 8 x 10
Sa x (1/Abtastrate)
67
Page 68

Technische Daten
Technische Daten
Signalwiederholrate bis zu 10.000 Wfm/s
Darstellung Punkte, Vektoren, Nachleuchten
Nachleuchten min. 50 ms
Messfunktionen und Bedienung
Bedienung Menügeführt (mehrsprachig), Autoset,
Hilfsfunktionen (mehrsprachig)
AUTO Messfunktionen Spannung (U
), Amplitude, Phase, Frequenz, Periode,
U
max
, Us+, Us-, U
ss
, U
, U
eff
mittel
min
,
Anstiegs-/Abfallzeit (80%, 90%), Pulsebreite
(pos/neg), Burstweite, Tastverhältnis (pos/neg),
Standardabweichung, Verzögerung, Crest
Faktor, Overshoot (pos/neg), Flanken-/
Impulszähler (pos/neg), Triggerperiode,
Triggerfrequenz
CURSOR Messfunktionen Spannung(U1,U2,∆U),Zeit(t1,t2,∆t,1/∆t),
Verhältnis X, Verhältnis Y, Flanken-/
Impulszähler (pos/neg), Spitzenwerte (U
), U
, U
U
ss
, Standardabweichung,
mittel
eff
s+
, Us-,
Tastverhältnis (pos/neg), Anstieg-/Abfallzeit
(80%, 90%), V-Marker, Crest Faktor
Schnellmessung
(QUICKVIEW)
fest vorgegeben: Spannung (U
), Anstiegs-/Abfallzeit, Frequenz,
U
mittel
, Us+, Us-, U
ss
Periodendauer; 6 weitere Messfunktionen
(siehe Automessfunktionen) frei wählbar
Marker bis zu 8 frei positionierbare Marker zur
einfachen Navigation
Frequenzzähler (hardware-basiert)
Auflösung 5-stellig
Frequenzbereich
R&S®HMO1002
R&S®HMO1202
Genauigkeit ± 50,0 x 10
0,5 Hz bis 50/70/100 MHz
0,5 Hz bis 100/200/300 MHz
-6
Alterung ±10,0 x 10-6 pro Jahr
Maskentest
Funktion Pass/Fail-Vergleich eines Signals mit einer
vordefinierten Maske
Quellen Analogkanäle
Testart Maske (Schlauch) um Signal, mit einstellbarer
Toleranz
Aktionen
im Fehlerfall Stop, Beep, Screenshot, Triggerimpuls,
automatische Speicherung der Kurve
im Normalfall
Statistik der getesteten Kurven: Anzahl der
Gesamtereignisse (max. 4x10
9
Ereignisse),
Anzahl der bestandenen / fehlerhaften
Erfassungen (Absolutwert und in %), Dauer
Mathematische Funktionen
Quickmath
Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division
Quellen CH1, CH2
Mathematik (R&S®HMO1202 Serie)
Funktionen Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division,
min/max Amplitude, Quadrat, Wurzel, Betrag,
pos/neg Anteil, Reziprok, Invertiert, dek./nat.
Logarithmus, Ableitung, Integral, IIR-Tiefpass/
Hochpass
Bearbeitung Formelsatz-Editor, menügeführt
Quellen alle Analogkanäle, selbstdefinierte Konstanten
Speicherort Mathematikspeicher
Anzahl Formelsätze 5 Formelsätze
Anzahl Gleichungen 5 Gleichungen pro Formelsatz
Gleichzeitige Anzeige
1 Formelsatz und max. 4 Gleichungen
mathematischer Funktionen
Frequenzanalyse (FFT)
Parameter Frequenzspan, Mittenfrequenz, vertikale
Skalierung, vertikale Position
FFT Auflösung 2 kSa, 4 kSa, 8 kSa, 16 kSa, 32 kSa,
64 kSa, 128 kSa
Fenster Hanning, Hamming, Rectangular, Blackman
Skalierung dBm, dBV, V
eff
Kurvenform Arithmetik Refresh, Average (bis zu 512), Envelope
(Hüllkurve)
Cursor Messung 2 horizontale Marker, Peak-Suche
(vorhergehender/nächster)
Quellen alle Analogkanäle
Probe Adjust Ausgang
Bedienung manuell, Adjust-Wizzard
Frequenz 1 kHz, 1 MHz
Pegel
R&S®HMO1002 Serie
R&S®HMO1202 Serie
,
eff
ca. 2,5 V
ca. 2,5 V
(ta <4 ns)
ss
(ta <1 ns)
ss
Mustergenerator
Funktionen Rechteck Generator / Tastkopfabgleich, Bus
Signalquelle, Zähler, programmierbares Muster
Rechteck Generator Frequenzbereich: 1 mHz bis 500 kHz
Pegel: ca. 2,5 V
ss
Polarität: normal, invers
Tastverhältnis: 1% bis 99%
Bus Signal Source (4 Bit) I
2
C (100 kBit/s, 400 kBit/s, 1 MBit/s, 3,4 MBit/s),
SPI (100 kBit/s, 250 kBit/s, 1 MBit/s), UART
(9600 Bit/s, 115,2 kBit/s, 1 MBit/s), CAN (bis zu
50 MBit/s), LIN (bis zu 50 MBit/s)
Zähler (4Bit) Frequenz: 1 mHz bis 25 MHz
Richtung: vorwärts, rückwärts
Programmierbares Muster
(4Bit)
Abtastzeit: 20 ns bis 42 s;
Speichertiefe: 2048 Sa
Pattern-Totzeit: 20 ns bis 42 s
Funktionsgenerator
Signalformen DC, Sinus, Rechteck, Puls, Dreieck/Rampe
Sinus Frequenzbereich: 0,1 Hz bis 50 kHz
Flatness: ±1 dB relativ zu 1 kHz
DC Offset: max. ±3 V
Rechteck Frequenzbereich: 0,1 Hz bis 25 kHz
Anstiegszeit: <4 µs
DC Offset: max. ±3 V
Puls Frequenzbereich: 0,1 Hz bis 10 kHz
Tastverhältnis: 10% bis 90%
DC Offset: max. ±3 V
Dreieck / Rampe Frequenzbereich: 0,1 Hz bis 10 kHz
DC Offset: max. ±3 V
Abtastgeschwindigkeit 978 kSa/s
Frequenzgenauigkeit ± 50,0 x 10
-6
Alterung ±10,0 x 10-6 pro Jahr
Amplitude
DC ±3 V
DC Offsetfehler (meas.) max. ±25 mV
hochohmige Last 60 mV
50ΩLast 30 mVss bis 3 V
bis 6 V
ss
ss
ss
Genauigkeit 3%
Digitalvoltmeter
Anzeige Ein Primär und Sekundär-Messwert pro
Kanal, gleichzeitges Messen auf allen
Analogkanälen, 3-stellige Messwertanzeige
68
Page 69

Technische Daten
Technische Daten
Messfunktionen DC, AC
Quellen alle Analogkanäle
Komponententester
Darstellung Spannung (X), Strom (Y)
Testfrequenz 50 Hz, 200 Hz
Testspannung 10 V
Teststrom 10 mA (Kurzschluss)
Bezugspotential Masse (Schutzleiter)
Schnittstellen
für Massenspeicher
(FAT16/32)
für Fernsteuerung Ethernet (RJ45), USB Device (Typ B) über VCP
Allgemeine Gerätedaten
Benutzerspeicher 3 MB für Referenzen und Geräteeinstellungen
Speichern / Laden
Geräteeinstellungen intern oder auf USB Speicher, verfügbare
Referenzkurven intern oder auf USB Speicher, verfügbare
Erfasste Kurven auf USB Speicher, verfügbare Dateiformate:
Kurvenwerte Anzeige- oder Erfassungsspeicher
Quellen einzelne oder alle Analogkanäle
Screenshots auf USB Speicher, verfügbare Dateiformate:
Realtime Clock (RTC) Datum und Uhrzeit
AC Versorgung 100 V bis 240 V, 50 Hz bis 60 Hz, CAT-II
Leistungsaufnahme
R&S®HMO1002 Serie
R&S®HMO1202 Serie
Sicherheit
Temperatur
Arbeitstemperatur +5 °C bis +40 °C
Lagertemperatur –20 °C bis +70 °C“
Rel. Luftfeuchtigkeit 5% bis 80% (ohne Kondensation)
Mechanische Angaben
Abmessungen (B x H x T) 285 x 175 x 140 mm
Nettogewicht 1,7 kg
EMC
HF Abstrahlung in Übereinstimmung mit CISPR 11/EN 55011
Störfestigkeit
Alle Angaben bei 23 °C nach einer Aufwärmzeit von 30 Minuten.
, AC+DC
rms
, Upp, Up+, Up-,
rms
Crest Faktor
(Leerlauf)
s
1 x USB-Host (Typ A), max. 500mA
oder TMC
Dateiformate: SCP, HDS
Dateiformate: BIN (MSB/LSB), FLT (MSB/LSB),
CSV, TXT, HRT
BIN (MSB/LSB), FLT (MSB/LSB), CSV, TXT
BMP, GIF, PNG (farbig, invertiert, Graustufen)
max. 25 W
max. 30 W
in Übereinstimmung mit IEC 61010-1 (ed. 3),
IEC 61010-2-30 (ed. 1), EN 61010-1, EN
61010-2-030 , CAN/CSA-C22.2 No. 61010-112 , CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2-030-12, UL
Std. No. 61010-1 (3rd Edition) ,
UL61010-2-030
Klasse B
in Übereinstimmung mit IEC/EN 61326-1
Tabelle 2, Störfestigkeit nach Anforderungen
für industrielle Umgebungen. Testkriterium ist
angezeigter Rauschpegel innerhalb ±1 DIV bei
5 mV/DIV Eingangsempfindlichkeit
Bandbreiten-Upgrades R&S®HMO1002 Serie
Beschreibung Option Voucher
Bandbreiten-Upgrade
50 MHz auf 70 MHz R&S®HOO572 R&S®HV572
Bandbreiten-Upgrade
50 MHz auf 100 MHz R&S®HOO512 R&S®HV512
Bandbreiten-Upgrade
70 MHz auf 100 MHz R&S®HOO712 R&S®HV712
Bandbreiten-Upgrades R&S®HMO1202 Serie
Beschreibung Option Voucher
Bandbreiten-Upgrade
100 MHz auf 200 MHz R&S®HOO312 R&S®HV312
Bandbreiten-Upgrade
100 MHz auf 300 MHz R&S®HOO313 R&S®HV313
Bandbreiten-Upgrade
200 MHz auf 300 MHz R&S®HOO323 R&S®HV323
Busanalyse Optionen
Beschreibung Option Voucher
2
C, SPI, UART/RS-232 auf
I
Analog- und Logikkanälen R&S®HOO10 R&S®HV110
2
C, SPI, UART/RS-232 auf
I
allen Analogkanälen R&S®HOO11 R&S®HV111
CAN und LIN auf Analog und
Logikkanälen R&S®HOO12 R&S®HV112
Im Lieferumfang enthalten:
Netzkabel, gedruckte Bedienungsanleitung, 2x H
(R&S®HMO1002) oder 2x RT-ZP03 Tastköpfe (R&S®HMO1202),
HZ20 Adapter: BNC auf 4 mm Buchsen
Empfohlenes Zubehör:
HO3508 8 Kanal Logiktastkopf (350 MHz, 4 pF)
HZ115 Differenz-Tastkopf 100 : 1/1000 : 1
HZO20 Hochspannungstastkopf 1000:1 (400MHz, 1000 V
HZO30 1 GHz Aktiv-Tastkopf (0,9 pF, 1 MΩ)
HZO40 Aktiver Differenz-Tastkopf 200 MHz (10 : 1, 3,5 pF, 1 MΩ)
HZO41 Aktiver Differenz-Tastkopf 800 MHz (10 : 1, 1 pF, 200 kΩ)
HZO50 Gleich-Wechselstrom-Messzange 30 A, DC bis 100 kHz
HZO51 Gleich-Wechselstrom-Messzange 100/1000 A, DC bis 20 kHz
HZ51 150 MHz Passiv-Tastkopf 10 : 1 (12 pF, 10 MΩ)
HZ52 250 MHz Passiv-Tastkopf 10 : 1 (10 pF, 10 MΩ)
HZ53 100 MHz Passiv-Tastkopf 100 : 1 (4.5 pF, 100 MΩ)
HZO90 Tasche zum Schutz und für den Transport
HZO91 19” Einbausatz 4 HE
Z154 Tastköpfe
eff
)
Measured Value (meas.): Beschreibt eine erwartete Produkteigenschaft, die
anhand von Stichproben ermittelt wurde.
69
Page 70

Anhang
16 Anhang
16.1 Abbildungsverzeichnis
Abb. 1.1: Betriebspositionen ........................4
Abb. 1.2: Produktkennzeichnung nach EN 50419 .......6
Abb. 2.1: Frontansicht R&S®HMO1202 ................8
Abb. 2.2: Bedienfeldabschnitt A .....................8
Abb. 2.3: Die Bedienfelder B, C und D ................9
Abb. 2.4: UPGRADE Menü ........................11
Abb. 2.5: manuelle Eingabe des Lizenzschlüssels ......11
Abb. 2.6: Erfolgreicher Selbstabgleich ...............12
Abb. 2.7: Selbstabgleich Logiktastkopf ...............12
Abb. 2.8: Geräterückseite .........................12
Abb. 3.1: Bedienfeldabschnitt A ....................13
Abb. 3.2: Bildschirm nach Anschluss des Tastkopfes ...13
Abb. 3.3: Bildschirm nach Umstellen auf DC Kopplung ..13
Abb. 3.4: Bildschirm nach Autosetup ................13
Abb. 3.5: Teil D des Bedienfeldes mit Zoomtaste .......13
Abb. 3.6: Zoomfunktion ...........................14
Abb. 3.7: Quickview Parametermessung .............14
Abb. 3.8: Parameterauswahl .......................14
Abb. 3.9: Speichern und Laden Menü ...............15
Abb. 3.10: Bildschirmfoto Einstellungsmenü ...........15
Abb. 4.1: Bedienfeld B des Vertikalsystems ...........16
Abb. 4.2: Kurzmenü für vertikale Einstellung ..........16
Abb. 4.3: Tastkopf Wizard .........................17
Abb. 4.4: Namensvergabe .........................17
Abb. 5.1: Bedienfeld D des Horizontalsystems .........18
Abb. 5.2: AM moduliertes Signal mit maximaler
Wiederholrate ...........................19
Abb. 5.3: AM moduliertes Signal mit maximaler
Abtastrate ..............................20
Abb. 5.4: AM moduliertes Signal mit automatischer
Einstellung .............................20
Abb. 5.5: Zoomfunktion ...........................21
Abb. 5.6: Marker im Zoom Modus ..................22
Abb. 6.1: Bedienfeld des Triggersystems .............23
Abb. 6.2: Kopplungsarten bei Flankentrigger ..........23
Abb. 6.3: Menü zur Logiktriggereinstellung ...........24
Abb. 6.4: Einstellungen der Logikkanalanzeige ........25
Abb. 6.5: Videotriggermenü .......................26
Abb. 6.6: Externes Triggersignal ....................26
Abb. 7.1: Schema und Beispiel der Virtual Screen
Funktion ...............................27
Abb. 7.2: Nachleuchtfunktion ......................28
Abb. 8.1: Auswahlmenü zu Cursormessungen ........30
Abb. 8.2: Menü zum Einstellen der Automessfunktion ..32
Abb. 9.1: Beispiel einer Mathematikkurve ............33
Abb. 9.2: Quickmathematik Menü ..................33
Abb. 9.3: Formeleditor für Formelsatz ................34
Abb. 9.4: Eingabe von Konstanten und Einheiten ......34
Abb.9.5: DenitionderStromgleichung .............35
Abb.9.6: DenitionderEnergiegleichung ............35
Abb. 9.7: FFT ...................................36
Abb. 9.8: PASS/FAIL Maskentest ...................37
Abb. 9.9: Hameg HZ20 Adapter verbunden mit
AUX OUT ..............................38
Abb. 9.10: Komponententest-Beispiel. ................38
Abb. 9.11: Komponententester Testbilder ..............39
Abb. 9.12: Digital Voltmeter. ........................40
Abb. 10.1: Arbitrary Menü ..........................41
Abb. 10.2: Arbitrary Mustereinstellungen ..............41
Abb. 11.1: Basismenü für Geräteeinstellungen .........42
Abb. 11.2: Geräteeinstellungen speichern .............43
Abb. 11.3: Referenzen laden und speichern ............43
Abb. 11.4: Menü zum Abspeichern von Kurven .........44
Abb. 11.5: Beispiel eines unterstützten Druckers ........45
Abb. 11.6: Screenshot-Modul .......................45
Abb.11.7:DenitionderFILE/PRINT-Taste .............46
Abb. 12.1: Optionaler Logiktastkopf R&S®HO3508 ......46
Abb. 12.2: 8 Bit DAC Signalwechsel ..................47
Abb.13.1:MenüzumDenierenvonBussen ..........49
Abb. 13.2: Beispiel I2C BUS mit BUS-Tabelle ...........49
Abb. 13.3: Beispiel Parallel BUS mit BUS-Tabelle ........50
Abb. 13.4: I2C 7-Bit-Adresse ........................50
Abb. 13.5: I2C LESEN/SCHREIB Triggermenü ..........51
Abb. 13.6: I2C BUS ................................51
Abb. 13.7: I2C BUS Tabelle .........................52
Abb. 13.8: CAN BUS Tabellenbeispiel .................58
Abb.13.8:MenüzumDeniereneinesSPIBusses ......52
Abb.13.9:EinfacheKongurationeinesSPIBUS .......53
Abb. 13.10: SSPI BUS Tabellenbeispiel ................54
Abb. 13.11: UART Bitfolge ..........................54
Abb. 13.12: Triggermenü UART Daten ................55
Abb.13.13:Seite2|2UARTBUSKongurationsmenü ....55
Abb. 13.14: UART Triggermenü Seite 2 ................56
Abb. 13.15: UART BUS Tabellenbeispiel ...............56
Abb.13.16:CANBUSKonguration ..................56
Abb. 13.17: CAN BUS .............................57
Abb. 13.19: Aufbau LIN Byte-Struktur .................58
Abb. 13.20: LIN BUS Menü .........................58
Abb. 13.21: LIN Daten Triggermenü ..................59
Abb. 13.22: LIN BUS ..............................59
Abb. 13.23: LIN BUS Tabellenbeispiel .................59
Abb. 14.1a: NI-VISA 5.4.1 ..........................61
Abb. 14.1b: NI-VISA 5.4.1 ..........................61
Abb. 14.2: NI-VISA Installationsanweisung .............61
Abb. 14.3: NI-VISA Anwendung lokal installieren ........61
Abb. 14.4: Setup-Menü ............................62
Abb. 14.5: Schnittstellen-Menü ......................62
Abb. 14.6: Schnittstellen-Parameter-Menü .............62
Abb. 14.7: Gerätetreiberinstallation ...................62
Abb. 14.8: Anzeige im Geräte-Manager ...............62
Abb. 14.9: Anzeige im Geräte-Manager ...............62
Abb. 14.10: Ordner Anzeige .........................63
Abb. 14.11: Ordner Anzeige mit USB Stick .............63
Abb. 14.12: Ordnerstruktur LIVE DATA ................63
Abb. 14.13: Ethernet-Parameter-Menü ................65
70
Page 71

Anhang
16.2 Stichwortverzeichnis
A
Abfallzeit: 14, 29, 31, 37
AC-Kopplung: 16
Abtastrate: 9, 18, 19, 20, 21, 36, 44, 48
B
Bitmuster: 25
Bitrateneinstellung: 42
Blackman: 36
Blindwiderstand: 39
Busanalyse: 10, 17, 48
BUS Signalquelle: 42
C
Crest Faktor: 29, 31
CSV-Datei: 44, 49
D
Dateiformat: 43, 45
Dateimanager: 11, 42, 43, 44
Datenrate: 42, 58
Digitalvoltmeter: 39, 40
E
Education Mode: 12
Effektivwert: 29, 30, 40
Eingangswiderstand: 16
Erfassungsspeicher: 19, 20, 21, 44, 45
Ethernet: 10, 12, 63, 64
Komponententest: 8
Komponententester: 9, 38
Kongurationsmenü:47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58
Konstante: 34
Kopplung: 16
Kurvendaten: 42, 44
Kurzmenü: 33
L
Lissajous: 28
Lizenzschlüssel: 10, 11, 48
Logikbetrieb: 25
Logikpegeleinstellungen: 25
Logiktastkopf: 8, 11, 12, 24, 46, 48
Logiktrigger: 17, 21, 24, 46, 50
M
Maskenspeicher: 37
Maskentest: 37, 38
Mathematikkurven: 9, 43
Messgitter: 14, 17, 47, 49
Messinterval: 39
Messquelle: 30, 31, 32
Messwertanzeige: 39, 40
Messwertpunkte: 44
Mixed-Signal-Betrieb: 11
N
Nachleuchtfunktion: 28
Nutzerfrequenz: 41
F
FALSCHFARBEN: 27
Formeleditor: 33, 34
Fourier-Analyse: 36
Frequenzanalyse: 33, 35
Frequenzgenauigkeit: 37
Funktionsgenerator: 40
G
Graustufen: 10, 45
Grenzfrequenz: 18, 24
H
Halbleiter: 39
Hamming: 36
Hanning: 36
Helligkeitsverlauf: 27
Hold Off Zeit: 23, 26
Hüllkurve: 18, 36
I
Impedanz: 38, 39
Impulsdauer: 24, 25
Impulstrigger: 23, 24
Induktivität: 39
K
Kapazität: 39
P
Paritätslter:55
Pattern: 40, 41, 42, 57, 59
Periodendauer: 14, 19, 29, 32, 37
Phasendifferenz: 38
Polarität: 26, 40, 56
Pulsbreite: 14, 31, 37
Q
Quellkurve: 37
Quick Mathematik: 33
Quickview: 8, 14
R
Rauschpegel: 36
Rauschunterdrückung: 24, 36
Referenzen: 9, 42, 43, 44
Referenzquelle: 31, 32
Referenzsignal: 15
S
Scheinwiderstandswert: 38
Schwellwert: 17, 46
Selbstabgleich: 11, 12
Shunt: 17
Signalamplitude: 30, 31, 40
Signalform: 37, 40, 45
Signalperiode: 30, 31, 32
71
Page 72

Anhang
Signalspannung: 26
Sinusgenerator: 38
SI-Präx:35
Spannungsdifferenz: 30
Spannungspegel: 31
Spitzenwerterfassung: 19, 20, 21
Standardabweichung: 29, 31, 40
Startsignal: 51
Stromzange: 17
Subtraktion: 34
Synchronimpulses: 26
Synchronisationsfeld: 59
T
Tastkopfabgleich: 17
Tastverhältnis: 14, 29, 31, 37, 40
Teilererkennung: 17
TIEFPASS: 24
Tiefpasslter:16, 18, 24, 34
Toleranzmaske: 37
Totzeit: 53
Triggerart: 23, 24, 27, 54
Triggerereignis: 23, 27, 53, 55
Triggerfunktionen: 41
Triggerpegel: 9, 23, 24
Triggerquelle: 21, 23, 24, 32
Triggersignal: 23, 24
Triggerzeitpunkt: 18, 21, 48, 53
Triggerzustand: 25
U
UA RT: 11, 40, 42, 48, 49, 54, 55, 56, 58
Überschwingen: 29, 31
V
Vergleichszeit: 24, 25
Verlustwiderstand: 39
Videomodulation: 26
Videotrigger: 25
V-Marker: 14
W
Wabendarstellung: 49, 51
Wiederholrate: 19, 20, 21
Y
Y-Position: 9, 16, 27, 47
Z
Zeitbasis: 9, 11, 13, 14, 18, 20, 21, 36, 44
Zeitbasiseinstellung: 9, 18, 21, 35, 42
ZOOM: 13, 14, 18, 21, 22
Zweifenster-Darstellung: 13
72
Page 73

Anhang
75
Page 74

74
Page 75

Page 76

© 2017 Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
Mühldorfstr. 15, 81671 München, Germany
Phone: +49 89 41 29 - 0
Fax: +49 89 41 29 12 164
E-mail: info@rohde-schwarz.com
Internet: www.rohde-schwarz.com
Customer Support: www.customersupport.rohde-schwarz.com
Service: www.service.rohde-schwarz.com
Subject to change – Data without tolerance limits is not binding.
R&S® is a registered trademark of Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG.
Trade names are trademarks of the owners.
5800.5301.03 │ Version 04 │R&S®HMO1x02 Serie
The following abbreviations are used throughout this manual: R&S®HMO1x02 Serie is abbreviated as R&S HMO1x02 Serie.
 Loading...
Loading...