Page 1

¨
¨
1:6 GP Buggy „Carbon Fighter III“
2WD RtR 2.4 GHz
Best.-Nr. / Item No. / N° de commande / Bestelnr. 23 99 99
Bedienungsanleitung Seite 2 - 32
Operating Instructions Page 33 - 63
Notice d’emploi Page 64 - 94
Gebruiksaanwijzing Pagina 95 - 125
Version 04/13
Page 2

2
Inhaltsverzeichnis
Seite
1. Einführung .......................................................................................................................................................... 3
2. Bestimmungsgemäße Verwendung .................................................................................................................. 4
3. Symbol-Erklärung .............................................................................................................................................. 4
4. Lieferumfang ...................................................................................................................................................... 5
5. Sicherheitshinweise ........................................................................................................................................... 5
a) Allgemein ..................................................................................................................................................... 6
b) Inbetriebnahme ............................................................................................................................................ 7
c) Fahren des Fahrzeugs ................................................................................................................................ 8
6. Batterie- und Akkuhinweise ............................................................................................................................... 9
7. Akkus laden...................................................................................................................................................... 10
a) Empfängerakku laden ................................................................................................................................ 10
b) Akkus im Sender laden .............................................................................................................................. 10
8. Inbetriebnahme ................................................................................................................................................ 11
a) Karosserie abnehmen ............................................................................................................................... 11
b) Verlegen des Antennenkabels vom Empfänger ........................................................................................ 11
c) Empfängerakku in das Fahrzeug einsetzen .............................................................................................. 12
d) Sender und Empfangsanlage in Betrieb nehmen ..................................................................................... 12
e) Fail-Safe programmieren ........................................................................................................................... 12
f) Luftfilter ölen und Fahrzeug betanken....................................................................................................... 13
g) Karosserie und Heckflügel aufsetzen und befestigen ............................................................................... 13
h) Überprüfen der Reichweite der Fernsteuerung ........................................................................................ 13
i) Motor starten .............................................................................................................................................. 14
j) Steuern des Fahrzeugs ............................................................................................................................. 15
k) Fahrt beenden ........................................................................................................................................... 16
9. Einstellmöglichkeiten am Fahrzeug ................................................................................................................. 17
a) Einstellung des Radsturzes ....................................................................................................................... 17
b) Einstellung der Spur .................................................................................................................................. 19
c) Einstellung der Lenkgeometrie .................................................................................................................. 20
d) Einstellung der Stoßdämpfer ..................................................................................................................... 21
e) Einstellung des Servo-Savers ................................................................................................................... 22
10. Motoreinstellungen .......................................................................................................................................... 23
a) Einstellen des Vergasers allgemein .......................................................................................................... 23
b) Einstellen der Leerlaufgemisch-Regulierschraube (L) .............................................................................. 24
c) Einstellen der Hauptdüsennadel (H) ......................................................................................................... 24
d) Einstellen der Standgasdrehzahl (S) ......................................................................................................... 25
e) Wiederherstellen der werkseitigen Einstellungen ..................................................................................... 25
11. Reinigung und Wartung ................................................................................................................................... 26
12. Entsorgung ....................................................................................................................................................... 28
a) Allgemein ................................................................................................................................................... 28
b) Batterien und Akkus ................................................................................................................................... 28
13. Konformitätserklärung (DOC) .......................................................................................................................... 28
14. Behebung von Störungen ................................................................................................................................ 29
15. Technische Daten ............................................................................................................................................ 32
Page 3

3
1. Einführung
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir bedanken uns für den Kauf dieses Produkts.
Dieses Produkt erfüllt die gesetzlichen, nationalen und europäischen Anforderungen.
Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie als Anwender diese Bedienungsanleitung beachten!
Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Produkt. Sie enthält wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung. Achten Sie hierauf, auch wenn Sie dieses Produkt an Dritte weitergeben.
Heben Sie deshalb diese Bedienungsanleitung zum Nachlesen auf!
Alle enthaltenen Firmennamen und Produktbezeichnungen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber. Alle Rechte
vorbehalten.
Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an:
Tel.: 0180/5 31 21 11
Fax: 0180/5 31 21 10
E-Mail: Bitte verwenden Sie unser Formular im Internet: www.conrad.de, unter der Rubrik „Kontakt“.
Mo. bis Fr. 8.00-18.00 Uhr
www.conrad.at
www.business.conrad.at
Tel.: 0848/80 12 88
Fax: 0848/80 12 89
E-Mail: support@conrad.ch
Mo. bis Fr. 8.00-12.00, 13.00-17.00 Uhr
Page 4

4
2. Bestimmungsgemäße Verwendung
Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Modellfahrzeug mit Hinterradantrieb, das über die mitgelieferte Fernsteueranlage drahtlos per Funk gesteuert werden kann.
Das Chassis ist fahrfertig aufgebaut.
Das Produkt ist kein Spielzeug, es ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.
Beachten Sie alle Sicherheitshinweise dieser Bedienungsanleitung. Diese enthalten wichtige Informationen zum Umgang mit dem Produkt.
3. Symbol-Erklärung
Das Symbol mit dem Ausrufezeichen weist Sie auf besondere Gefahren bei Handhabung, Betrieb oder
Bedienung hin.
Das „Pfeil“-Symbol steht für spezielle Tipps und Bedienhinweise.
Page 5
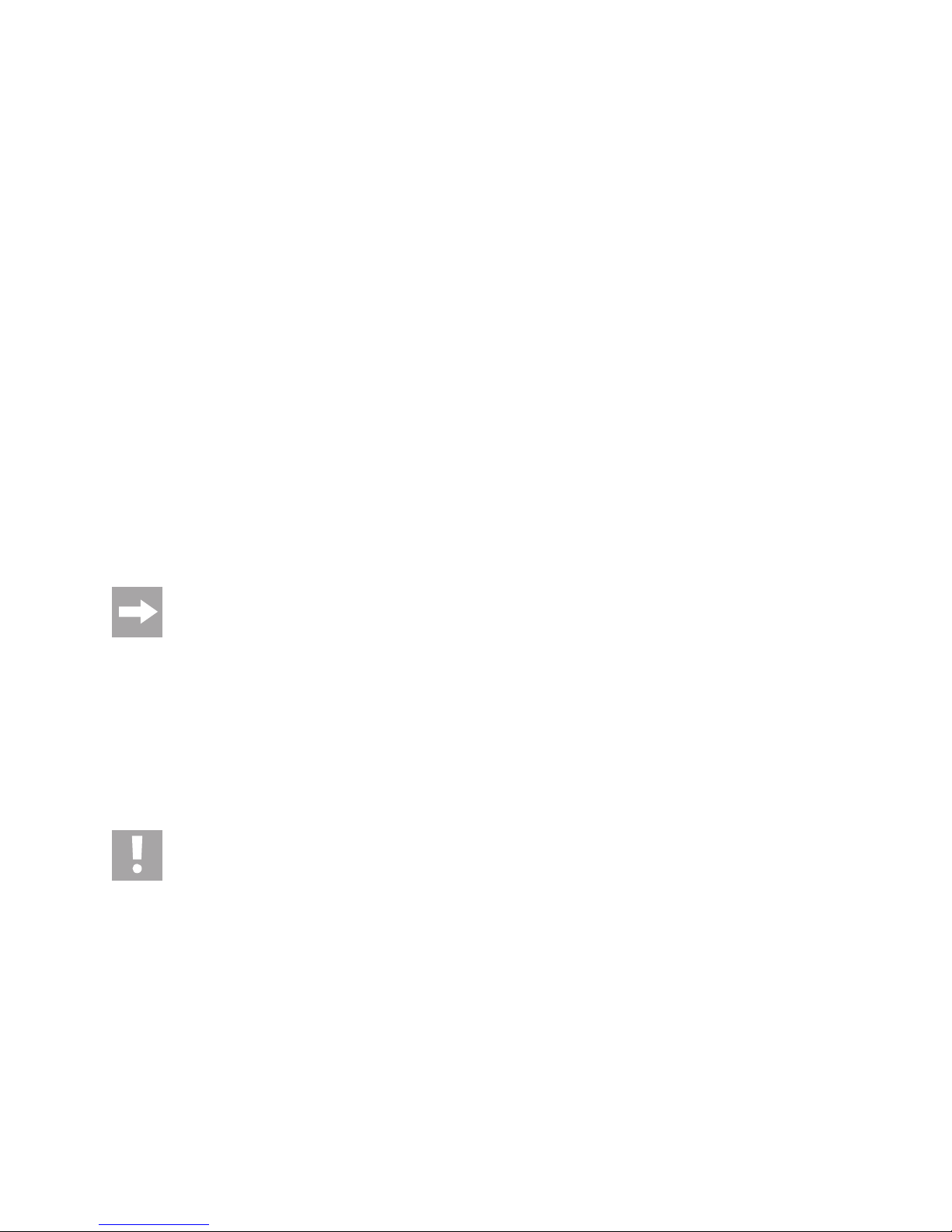
5
4. Lieferumfang
• Fahrfertig aufgebautes Fahrzeug, RtR
• Sender
• Kleinteile (z.B. Antennenröhrchen für die Empfängerantenne)
• Zündkerzenschlüssel
• Bedienungsanleitung zum Fahrzeug
• Bedienungsanleitung zur Fernsteueranlage
Benötigtes Zubehör (nicht im Lieferumfang):
• 4 Akkus oder Batterien (Typ Mignon/AA) für den Sender
• Empfängerakku (Hump-Pack 6 V, 1500 mAh empfohlen)
• Ladegerät für Sender- und Empfängerakku
• Tankflasche
• Luftfilteröl
• Zweitakt-Gemisch 1:25 Öl-/Kraftstoffgemisch (mit Super oder Super Plus Kraftstoff)
Die Ersatzteilliste zu diesem Produkt finden Sie auf unserer Website www.conrad.com im DownloadBereich zum jeweiligen Produkt.
Alternativ können Sie die Ersatzteilliste telefonisch anfordern, die Kontaktdaten finden Sie am Anfang
dieser Bedienungsanleitung im Kapitel „Einführung“.
5. Sicherheitshinweise
Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt
die Gewährleistung/Garantie. Für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!
Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten
der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen
erlischt die Gewährleistung/Garantie.
Von der Gewährleistung und Garantie ausgeschlossen sind ferner normaler Verschleiß bei Betrieb (z.B.
abgefahrene Reifen, abgenutzte Zahnräder) und Unfallschäden (z.B. gebrochene Querlenker, verbogenes Chassis usw.).
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, diese Sicherheitshinweise dienen nicht nur zum Schutz des
Produkts, sondern auch zu Ihrer eigenen Sicherheit und der anderer Personen. Lesen Sie sich deshalb
dieses Kapitel sehr aufmerksam durch, bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen!
Page 6
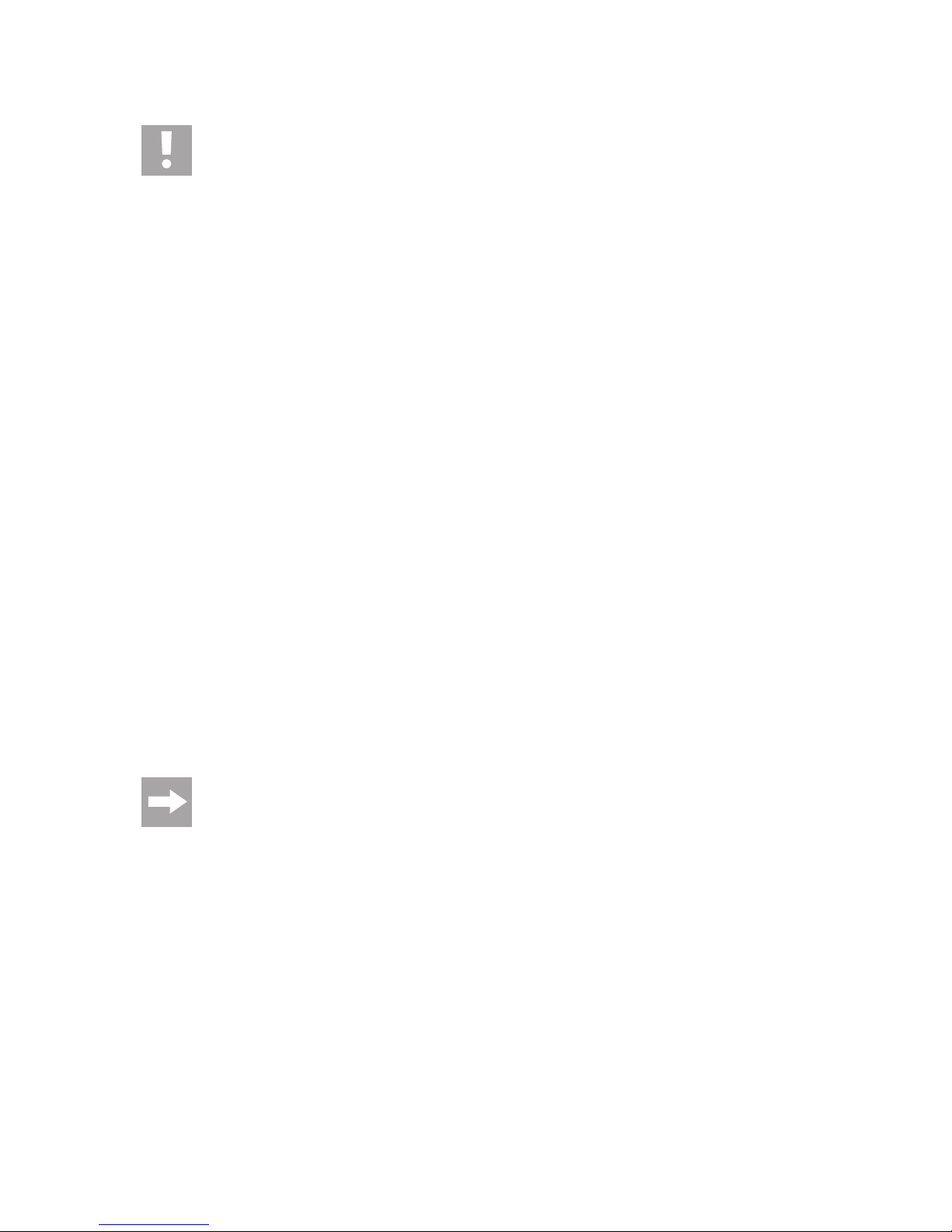
6
a) Allgemein
Achtung, wichtiger Hinweis!
Beim Betrieb des Modells kann es zu Sach- und/oder Personenschäden kommen. Achten Sie deshalb
unbedingt darauf, dass Sie für den Betrieb des Modells ausreichend versichert sind, z.B. über eine Haftpflichtversicherung. Falls Sie bereits eine Haftpflichtversicherung besitzen, so informieren Sie sich vor
Inbetriebnahme des Modells bei Ihrer Versicherung, ob der Betrieb des Modells mitversichert ist.
• Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen (CE) ist das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Produkts
nicht gestattet.
• Das Produkt ist kein Spielzeug, es ist nicht für Kinder unter 14 Jahren geeignet.
• Das Produkt darf nicht feucht oder nass werden.
• Berühren Sie während des Betriebes niemals den Motor und den Auspuff! Verbrennungs- und Verletzungsgefahr!
• Halten Sie Kraftstoff unter Verschluss; lagern Sie diesen so, dass er für Kinder unzugänglich ist.
• Vermeiden Sie Kontakt mit Augen, Schleimhaut und Haut. Bei Unwohlsein ist sofort ein Arzt zu konsultieren!
• Verschütten Sie Kraftstoffe niemals. Verwenden Sie eine spezielle Kraftstoffflasche zum Betanken.
• Probeläufe und Fahrbetrieb dürfen nur im Freien durchgeführt werden. Atmen Sie Kraftstoffdämpfe und Abgase
nicht ein, diese sind gesundheitsgefährlich!
• Der Kraftstoff ist hochentzündlich, die Kraftstoffdämpfe sind hochexplosiv! Rauchen Sie niemals beim Umgang mit
Kraftstoffen (z.B. beim Betanken). Halten Sie offenes Feuer fern! Explosions- und Brandgefahr!
• Kraftstoff darf nur in gut belüfteten Räumen, fern von Zündquellen und nur in zugelassenen Mengen gelagert wer-
den.
• Wird der Fahrbetrieb dauerhaft beendet, muss der im Tank des Modells verbliebene Kraftstoff abgepumpt werden.
• Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liegen, dieses könnte für Kinder zu einem gefährlichen Spiel-
zeug werden.
• Sollten sich Fragen ergeben, die nicht mit Hilfe der Bedienungsanleitung abgeklärt werden können, so setzen Sie
sich bitte mit uns (Kontaktinformationen siehe Kapitel 1) oder einem anderen Fachmann in Verbindung.
Die Bedienung und der Betrieb von ferngesteuerten Modellfahrzeugen muss erlernt werden! Wenn Sie
noch nie ein solches Fahrzeug gesteuert haben, so fahren Sie besonders vorsichtig und machen Sie sich
erst mit den Reaktionen des Fahrzeugs auf die Fernsteuerbefehle vertraut. Haben Sie Geduld!
Gehen Sie bei Betrieb des Produkts kein Risiko ein! Ihre eigene Sicherheit und die Ihres Umfeldes hängen alleine von Ihrem verantwortungsbewussten Umgang mit dem Modell ab.
• Der bestimmungsgemäße Betrieb des Fahrzeugs erfordert gelegentliche Wartungsarbeiten oder auch Reparatu-
ren. Beispielsweise nutzen sich Reifen bei Betrieb ab, oder es gibt bei einem Fahrfehler einen „Unfallschaden“.
Verwenden Sie für die dann von Ihnen erforderlichen Wartungs- oder Reparaturarbeiten ausschließlich OriginalErsatzteile!
Page 7
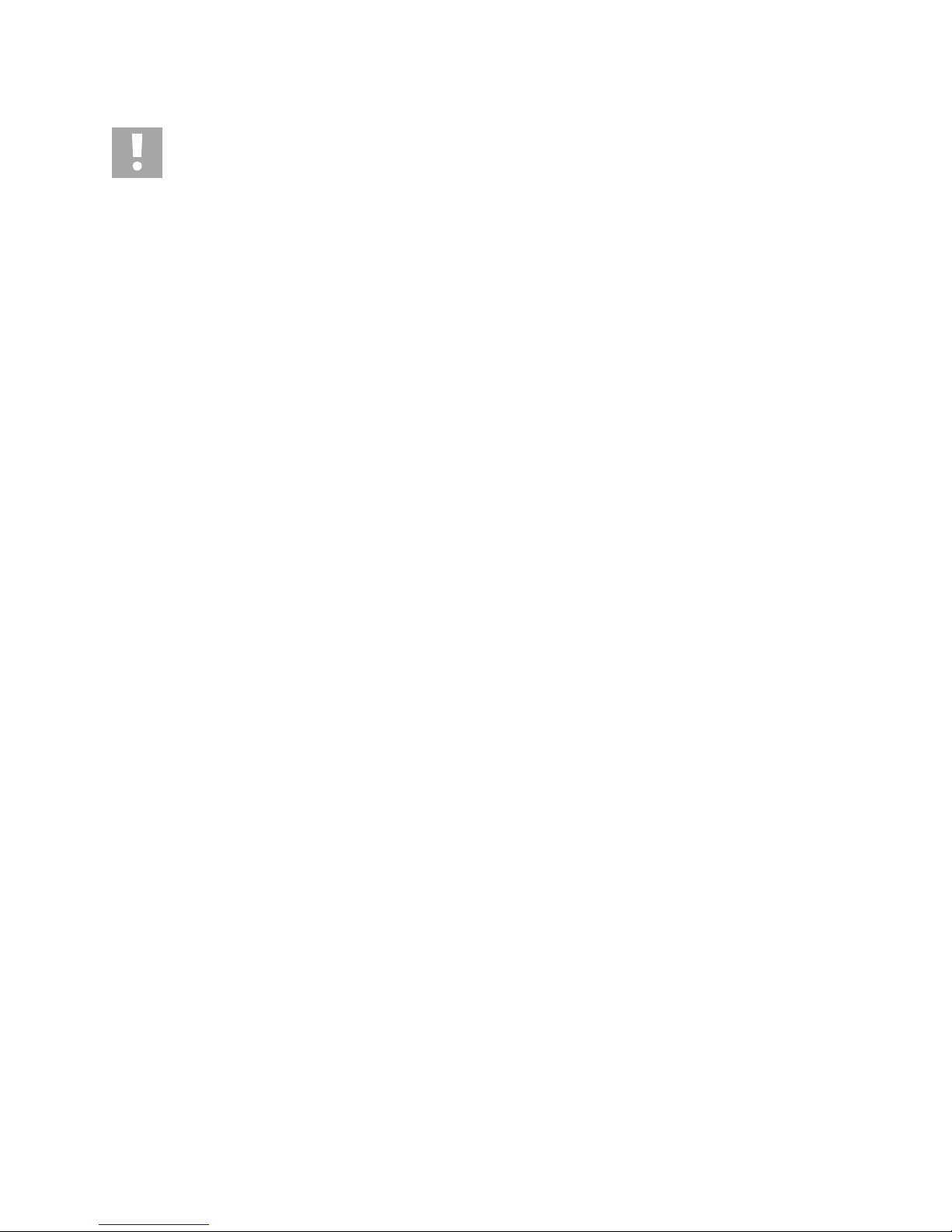
7
b) Inbetriebnahme
Die Anleitung zur Fernsteueranlage liegt getrennt bei. Beachten Sie unbedingt die dort enthaltenen
Sicherheitshinweise und alle weiteren Informationen!
Gehen Sie bei der Inbetriebnahme immer in nachfolgend beschriebener Reihenfolge vor, andernfalls kommt es zu
unvorhersehbaren Reaktionen des Fahrzeugs! Beachten Sie außerdem das Kapitel 8.
Schritt 1:
Schalten Sie den Sender ein, falls noch nicht geschehen. Kontrollieren Sie dessen Funktion (z.B. Betriebsanzeige
des Senders).
Schritt 2:
Stellen Sie das Fahrzeug auf eine geeignete Unterlage, so dass sich die Räder frei bewegen können.
Schließen Sie die Empfängerstromversorgung an und bringen Sie den Ein-/Ausschalter für die Empfängerstromversorgung in die Stellung „ON“ (= eingeschaltet).
Schritt 3:
Prüfen Sie vor dem Betrieb des Fahrzeugs am stehenden Modell, ob es wie erwartet auf die Fernsteuerbefehle
reagiert (Gas- und Lenkservo).
Schritt 4:
Stellen Sie die Trimmung des Gas-/Bremshebels am Sender so ein, dass beim vollständigen Loslassen des Hebels
(Neutralstellung des Gas-/Bremshebels am Sender) die Bremse nicht greift.
Schritt 5:
Stellen Sie die Trimmung für die Lenkung ein, so dass die Vorderräder in etwa gerade stehen. Eine genaue Einstellung für Geradeausfahrt kann später während der Fahrt erfolgen.
Schritt 6:
Prüfen Sie das Gas- und Lenkservo, ob diese im Betrieb bei jeweiligem Vollausschlag am Sender mechanisch „auf
Block“ laufen. Ist dies der Fall, muss am Sender der Servoweg begrenzt werden (siehe Bedienungsanleitung der
Fernsteuerung).
Schritt 7:
Programmieren Sie (falls in der Fernsteuerung integriert) auf das Gasservo eine Failsafe-Funktion und prüfen dessen korrekte Funktion. Ist diese Funktion nicht in der Fernsteuerung integriert, empfehlen wird dringend den Einsatz
eines externen Failsafe-Moduls (muss separat erworben werden).
Page 8

8
c) Fahren des Fahrzeugs
• Der unsachgemäße Betrieb kann schwerwiegende Personen- und Sachschäden verursachen! Fahren Sie nur,
solange Sie direkten Sichtkontakt zum Modell haben. Fahren Sie deshalb auch nicht bei Nacht.
• Fahren Sie nur, wenn Ihre Reaktionsfähigkeit uneingeschränkt gegeben ist. Müdigkeit, Alkohol- oder Medikamen-
ten-Einfluss kann, wie bei einem echten Kraftfahrzeug, zu Fehlreaktionen führen.
• Beachten Sie, dass dieses Modellfahrzeug nicht auf öffentlichen Straßen, Plätzen und Wegen gefahren werden
darf. Betreiben Sie es auch nicht auf privatem Gelände ohne der Zustimmung des Besitzers.
• Fahren Sie nicht auf Tiere oder Menschen zu!
• Fahren Sie nicht bei Regen, durch nasses Gras, Wasser, Schlamm oder Schnee. Das Modell ist nicht wasserfest
oder wasserdicht.
• Vermeiden Sie das Fahren bei sehr niedrigen Außentemperaturen. Bei Kälte kann der Kunststoff der Karosserie
und der Fahrwerksteile an Elastizität verlieren; dann führen auch kleine Unfälle zu Schäden am Modell.
• Fahren Sie nicht bei Gewitter, unter Hochspannungsleitungen oder in der Nähe von Funkmasten.
• Fassen Sie nie an das Zündkabel oder den Zündkerzenstecker, wenn der Motor läuft. Hochspannung, Lebensge-
fahr!
• Die Getriebeübersetzung ist für den Geländeeinsatz ausgelegt. Im Falle eines permanenten Straßeneinsatzes kann
nicht ausgeschlossen werden, dass der Motor überdreht wird.
• Lassen Sie immer den Sender eingeschaltet, solange das Fahrzeug in Betrieb ist. Zum Abstellen des Fahrzeugs
stellen Sie immer zuerst den Motor ab. Danach schalten Sie die Empfängerstromversorgung aus (Schalter auf
„OFF“). Erst jetzt darf der Sender ausgeschaltet werden.
• Bei schwachen Batterien (bzw. Akkus) im Sender nimmt die Reichweite ab. Schwache Batterien (oder Akkus) in der
Empfangsanlage verhindern einen kraftvollen Betrieb der Servos. Prüfen Sie vor einer Ausfahrt den Ladezustand
der Batterien bzw. Akkus im Sender und am Empfänger.
Das Fahrzeug ist aufgrund der Größe mit einem sehr starken Lenkservo ausgestattet. Dieses hat einen erhöhten
Strombedarf. Aus diesem Grund ist auch eine leistungsstarke Empfängerstromversorgung erforderlich (z.B. 5zelliger
Hump-Akkupack).
Kontrollieren Sie vor und nach jeder Fahrt die Empfängerstromversorgung. Bei zu niedriger Spannung reagieren
die Servos nur noch schwach, so dass das Fahrzeug nicht mehr auf die Steuerbefehle am Sender reagiert. Außerdem könnte es zu unvorhergesehenen Reaktionen des Empfängers kommen.
Beenden Sie den Fahrbetrieb sofort (Motor ausschalten, Empfängerstromversorgung ausschalten, Sender ausschalten), wenn die Reaktionen der Empfangsanlage nicht wie gewünscht ausfallen. Tauschen Sie danach die
Empfängerstromversorgung aus bzw. laden Sie sie wieder auf.
• Sowohl Motor und Antriebsteile (z.B. Auspuff, Kupplung) erhitzen sich bei Betrieb. Machen Sie vor jeder neuen
Ausfahrt eine Pause von mindestens 5 - 10 Minuten.
Fassen Sie den Motor und Antriebsteile (Auspuff etc.) nicht an, bis diese abgekühlt sind. Verbrennungsgefahr!
Page 9

9
6. Batterie- und Akkuhinweise
• Batterien/Akkus gehören nicht in Kinderhände.
• Lassen Sie Batterien/Akkus nicht offen herumliegen, es besteht die Gefahr, dass diese von Kindern oder Haustieren
verschluckt werden. Suchen Sie in einem solchen Fall sofort einen Arzt auf!
• Batterien/Akkus dürfen niemals kurzgeschlossen, zerlegt oder ins Feuer geworfen werden. Es besteht Explosionsgefahr!
• Ausgelaufene oder beschädigte Batterien/Akkus können bei Berührung mit der Haut Verätzungen verursachen,
benutzen Sie deshalb in diesem Fall geeignete Schutzhandschuhe.
• Herkömmliche (nicht wiederaufladbare) Batterien dürfen nicht aufgeladen werden. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr! Laden Sie ausschließlich dafür vorgesehene Akkus; verwenden Sie dazu geeignete Akkuladegeräte.
• Achten Sie beim Einlegen von Batterien/Akkus auf die richtige Polung (Plus/+ und Minus/- beachten).
• Bei längerem Nichtgebrauch (z.B. bei Lagerung) entnehmen Sie die im Sender eingelegten Batterien (bzw. Akkus),
um Schäden durch auslaufende Batterien/Akkus zu vermeiden. Trennen Sie den Empfängerakku vollständig vom
Empfänger.
Laden Sie Akkus etwa alle 3 Monate nach, da es andernfalls durch die Selbstentladung zu einer sog. Tiefentladung
kommen kann, wodurch die Akkus unbrauchbar werden.
• Wechseln Sie immer den ganzen Satz Batterien bzw. Akkus des Senders aus. Mischen Sie nicht volle mit halbvollen
Batterien/Akkus. Verwenden Sie immer Batterien bzw. Akkus des gleichen Typs und Herstellers.
• Mischen Sie niemals Batterien mit Akkus! Verwenden Sie für den Sender entweder Batterien oder Akkus.
• Beim Einsatz von LiPo-Akkus im Fahrzeug beachten Sie unbedingt die Informationen des Herstellers zum Umgang
bzw. Aufladen des LiPo-Akkus.
Der Betrieb des Senders mit Akkus anstelle von Batterien ist möglich.
Die geringere Spannung (Batterien = 1,5 V, Akkus = 1,2 V) und die geringere Kapazität von Akkus führt
jedoch zu einer Verringerung der Betriebsdauer. Dies spielt jedoch normalerweise keine Rolle, da die
Betriebsdauer des Senders weit über der des Empfängerakkus im Fahrzeug liegt.
Wenn Sie Batterien im Sender einsetzen, so empfehlen wir Ihnen die Verwendung von hochwertigen
Alkaline-Batterien.
Page 10
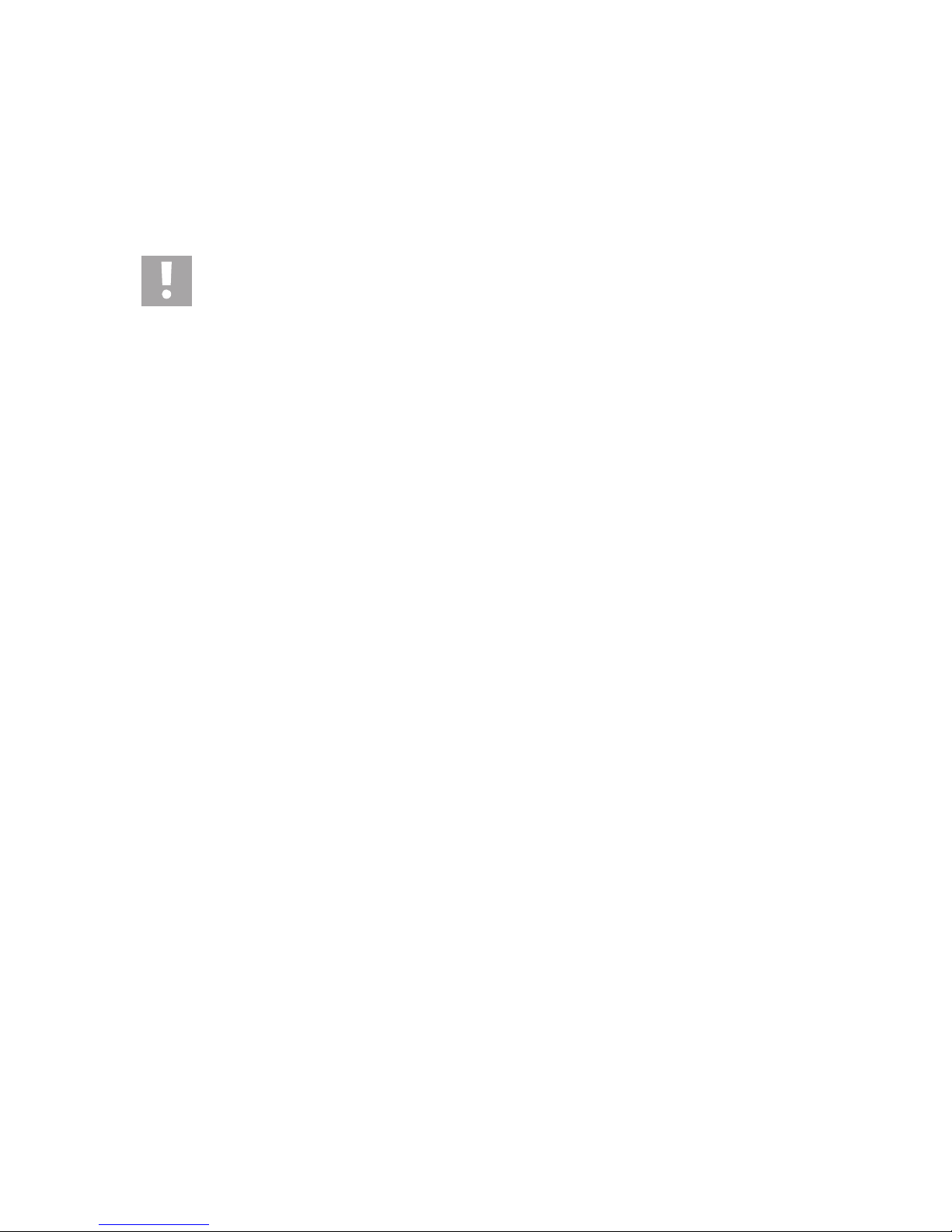
10
7. Akkus laden
a) Empfängerakku laden
• Zum Betrieb des Fahrzeugs ist eine separate, leistungsstarke Empfängerstromversorgung erforderlich, da der Strombedarf vor allem des Lenkservos sehr hoch ist.
Wir empfehlen, als Empfängerstromversorgung einen hochstromfähigen 5zelligen NiMH-Hump-Akkupack
einzusetzen.
• Trennen Sie den Empfängerakku vor einem Ladevorgang vom Empfänger und nehmen Sie ihn aus der Akkubox
des Fahrzeugs heraus.
• Beachten Sie zum Aufladen des Empfängerakkus die Bedienungsanleitung zu dem von Ihnen verwendeten Ladegerät.
• Akkus erwärmen sich beim Laden oder Entladen (beim Fahren des Fahrzeugs). Laden Sie Akkus erst dann, wenn
sich diese auf Zimmertemperatur abgekühlt haben. Gleiches gilt nach dem Ladevorgang; benutzen Sie den Akku im
Fahrzeug erst dann, wenn sich der Akku nach dem Ladevorgang vollständig abgekühlt hat.
b) Akkus im Sender laden
Beachten Sie dazu die getrennt beiliegende Bedienungsanleitung des Senders.
Page 11

11
8. Inbetriebnahme
a) Karosserie abnehmen
Entfernen Sie die vier Halteclipse des Überrollbügels
(2 x über der Vorderachse; 2x links/rechts vom Tank)
und auch die beiden Clipse seitlich bei den Hinterrädern (siehe Pfeile in Bild 1).
Ziehen Sie die Überrollbügel seitlich aus den Halterungen und stellen die Bügel senkrecht. Heben und
Verdrehen Sie die Karosserie in der Art, dass sie sich
durch die aufgestellten Überrollbügel entfernen lässt.
b) Verlegen des Antennenkabels vom Empfänger
Bringen Sie zunächst den Ein-/Ausschalter des
Empfängers (siehe Kreis in Bild 2) in die Stellung „OFF“
(ausgeschaltet).
Öffnen Sie die Empfängerbox (Bild 2, Pos. 1) durch
Abziehen der drei Clipse.
Führen Sie das Antennenkabel durch den Deckel der
Empfängerbox sowie das Antennenröhrchen (siehe
mitgeliefertes Zubehör).
Führen Sie auch das Akkuanschlusskabel des Ein-/
Aussschalters aus der Empfängerbox heraus (siehe
auch Bild 3, Pos. 4).
Stecken Sie nach dem Verschließen der Empfängerbox das Röhrchen in die Halterung an der Oberseite
der Empfängerbox (siehe Pfeil in Bild 2).
Lassen Sie überschüssiges Antennenkabel einfach oben aus dem Ende des Antennenröhrchens heraushängen.
Um eine optimale Reichweite zu erzielen, muss das Antennenkabel senkrecht aus dem Fahrzeug ragen.
Kürzen Sie das Antennenkabel niemals! Wickeln Sie das Antennenkabel niemals auf! Dies verringert die
Reichweite sehr stark.
Bild 1
Bild 2
Page 12
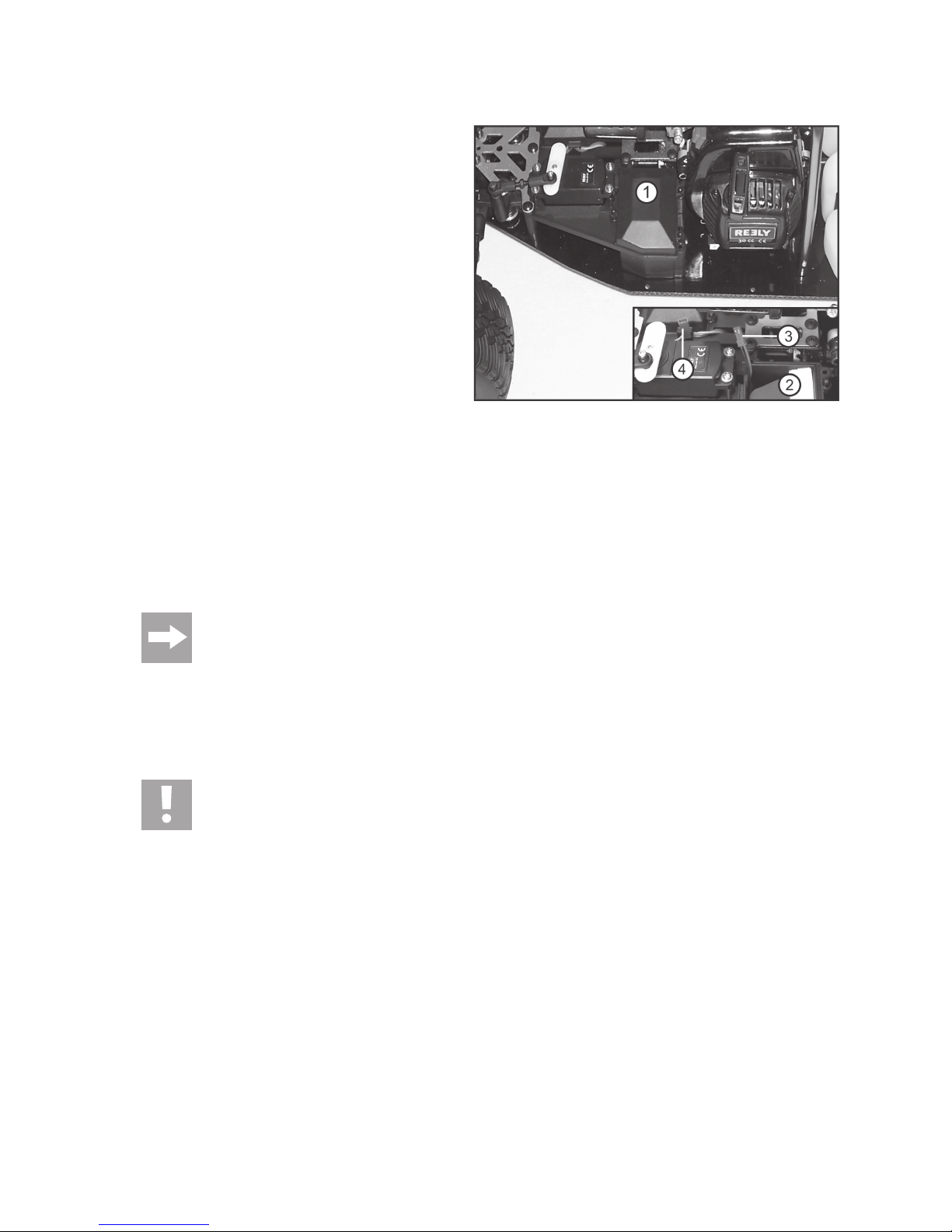
12
c) Empfängerakku in das Fahrzeug einsetzen
Aufgrund des hohen Strombedarfs der beiden Servos
ist ein leistungsstarker Empfängerakku erforderlich (wir
empfehlen einen 5zelligen NiMH-Hump-Akkupack).
Öffnen Sie die Akkubox (Bild 3, Pos. 1) durch Abziehen der drei Clipse und legen Sie den Empfängerakku
(Bild 3, Pos. 2) ein.
Das Anschlusskabel des Akkus führen Sie aus der
Akkubox heraus (Bild 3, Pos. 3) und verbinden es mit
dem zweipoligen roten BEC-Stecker, der vom EinAusschalter der Empfängerbox heraus geführt wurde
(Bild 3, Pos. 4).
Verschließen Sie die Akkubox wieder, achten Sie dabei darauf, dass die Kabel nicht geknickt oder eingequetscht werden.
d) Sender und Empfangsanlage in Betrieb nehmen
Öffnen Sie das Batteriefach am Sender und legen Sie neue Batterien oder voll geladene Akkus in das Batteriefach
ein. Achten Sie auf die richtige Polung (Plus/+ und Minus/-), siehe Beschriftung im Batteriefach. Verschließen Sie das
Batteriefach wieder.
Schalten Sie den Sender ein. Kontrollieren Sie die Funktion des Senders.
Beachten Sie die beiliegende Bedienungsanleitung zur Fernsteueranlage.
Schalten Sie die Empfangsanlage ein (Schalter auf „ON“, siehe Kreismarkierung in Bild 2).
e) Fail-Safe programmieren
Aus Sicherheitsgründen darf der Motor während der Programmierung der Fail-Safe-Funktion nicht laufen!
Für die Programmierung des Fail-Safe orientieren Sie sich in der Bedienungsanleitung der Fernsteuerung. Kommt ein externes Fail-Safe-Modul zum Einsatz (nicht im Lieferumfang; optionales Zubehör), verwenden Sie diese Bedienungsanleitung. Das Fail-Safe muss das Gas-/Bremsservo steuern.
Schalten Sie den Sender und die Empfängerstromversorgung ein und prüfen die Funktion der Servos. Schalten Sie
anschließend den Sender aus.
Durch die fehlenden Steuerimpulse beginnt das Lenkservo eventuell zu zittern, dies ist jedoch normal (falls gewünscht,
könnte durch ein als optionales Zubehör erhältliches zweites Fail-Safe auch das Lenkservo in eine definierte Position
fahren, z. B. für den Geradeauslauf).
Stellen Sie das Fail-Safe so ein, dass das Gas-/Bremsservo in der Stellung ist, in der die Bremse aktiviert wird (max.
Bremsleistung). Bei einem Ausfall des Sendersignals wird nun vom Fail-Safe automatisch das Gas auf Leerlauf geregelt und die Bremse aktiviert, so dass das Fahrzeug zum Stillstand kommt.
Bild 3
Page 13
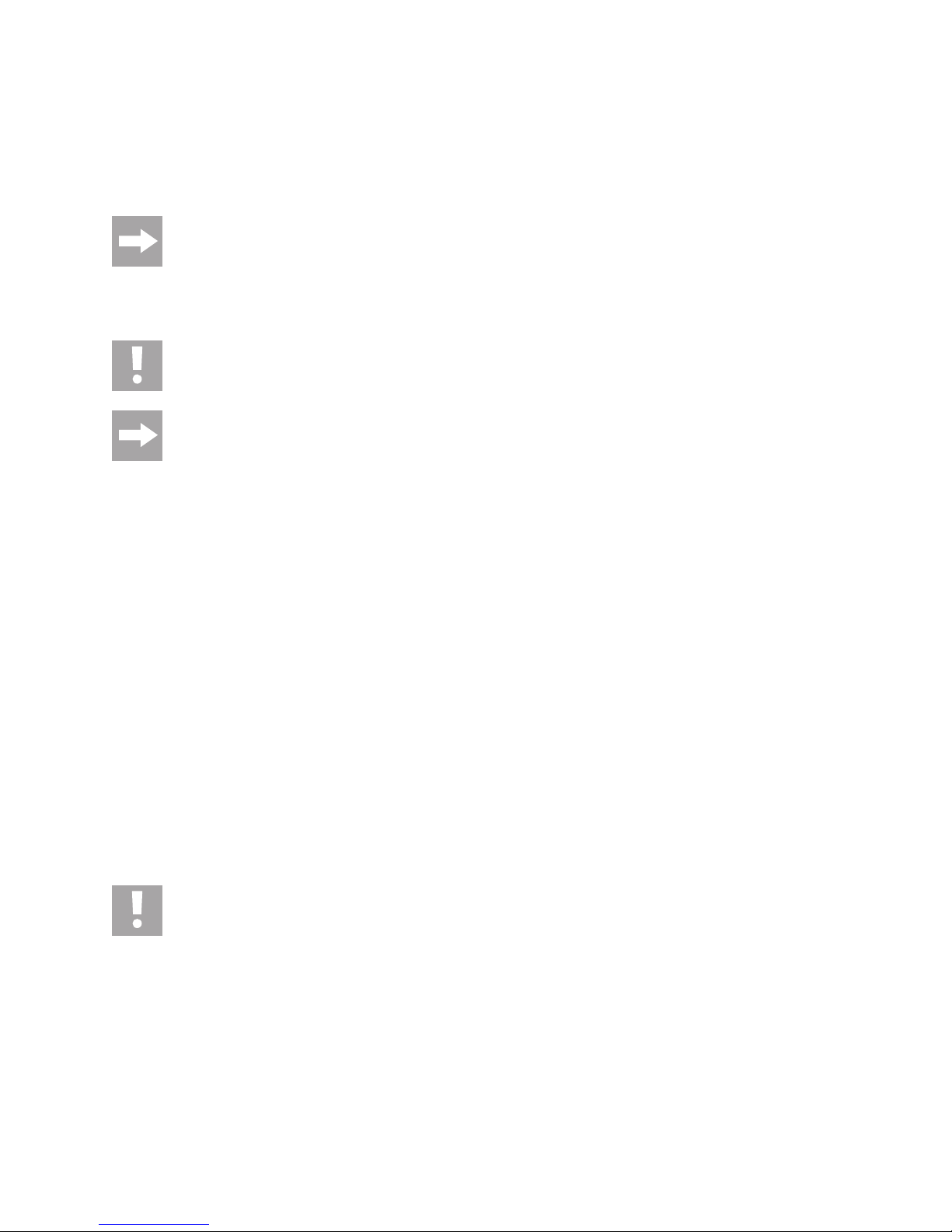
13
f) Luftfilter ölen und Fahrzeug betanken
Ölen Sie den Luftfilter leicht ein, um auch feinste Staubpartikel auszufiltern. Verwenden Sie hierzu ein spezielles
Luftfilter-Öl (nicht im Lieferumfang). Schrauben Sie das Luftfiltergehäuse mittels der zentralen Schraube auf der Vorderseite des Filters ab und nach dem Ölen wieder an. Achten Sie hierbei auf einen korrekten Sitz des Filters und
dessen Halterung.
Wird der Luftfilter nicht eingeölt, kommt es durch das Ansaugen von kleinen Staubpartikeln zu einem stark
erhöhten Verschleiß des Motors. Bei fortwährendem Betrieb des Motors ohne eingeölten Luftfilter kann es
zu einem Motorschaden kommen, Verlust von Gewährleistung/Garantie!
Öffnen Sie den Tankverschluss und befüllen den Tank mit einem Zweitaktgemisch (Mischungsverhältnis 1:25). Verwenden Sie für das Gemisch nur hochwertiges, synthetisches Zweitakt-Öl und Super-Kraftstoff (bzw. Super Plus).
Ein Zweitaktgemisch mit „E10“-Kraftstoff oder ein Gemisch mit geringerem Ölanteil darf nicht verwendet
werden. Bei Nichtbeachtung drohen kapitale Motorschäden; Verlust von Gewährleistung/Garantie!
Um für das Betanken des Fahrzeugs nicht immer die Karosserie abnehmen zu müssen, empfehlen wir
(falls noch nicht geschehen), an entsprechender Stelle der Karosserie eine passende Öffnung zu schneiden.
g) Karosserie und Heckflügel aufsetzen und befestigen
Setzen Sie die Karosserie in umgekehrter Weise wie in Kapitel 8 a) beschrieben auf die Halterungen auf und sichern
diese mit Sicherungsclipsen.
Montieren Sie den Heckflügel, in dem Sie links und rechts von der Heckflügelhalterung jeweils einen MoosgummiRing und dann den Heckflügel aufstecken. Den Heckflügel sichern Sie mit zwei Sicherungsclipsen.
Ihr Fahrzeug ist jetzt für die erste Testfahrt bereit.
h) Überprüfen der Reichweite der Fernsteuerung
Damit Sie nicht die Kontrolle über das Modell verlieren, sollten Sie vor jedem ersten Start oder nach einem Unfall die
Funktion und Reichweite der RC-Anlage überprüfen. Für den Reichweitentest genügt es, die Funktion des Lenkservos
zu testen.
Auf Grund der guten Haftung der Reifen und des Fahrzeuggewichtes würden die Räder im Stand und auf dem Boden
Ihrem Lenkausschlag nicht spontan und direkt folgen. Aus diesem Grund stützen Sie das Modell an der Vorderachse
so ab, dass die Räder frei in der Luft hängen.
Führen Sie den Reichweitentest nur dann durch, wenn der Motor nicht läuft!
• Schalten Sie (sofern noch nicht geschehen) erst den Sender, dann den Empfänger ein.
• Entfernen Sie sich etwa 50 m von dem Modell.
• Bewegen Sie das Steuerrad am Sender (Kanal 1) nach rechts. Die Räder müssen jetzt nach rechts einschlagen.
• Bewegen Sie jetzt das Steuerrad nach links. Die Räder müssen jetzt nach links einschlagen.
• Lassen Sie den Fernsteuerhebel los. Die Räder müssen jetzt in die Geradeausstellung zurückdrehen.
Page 14
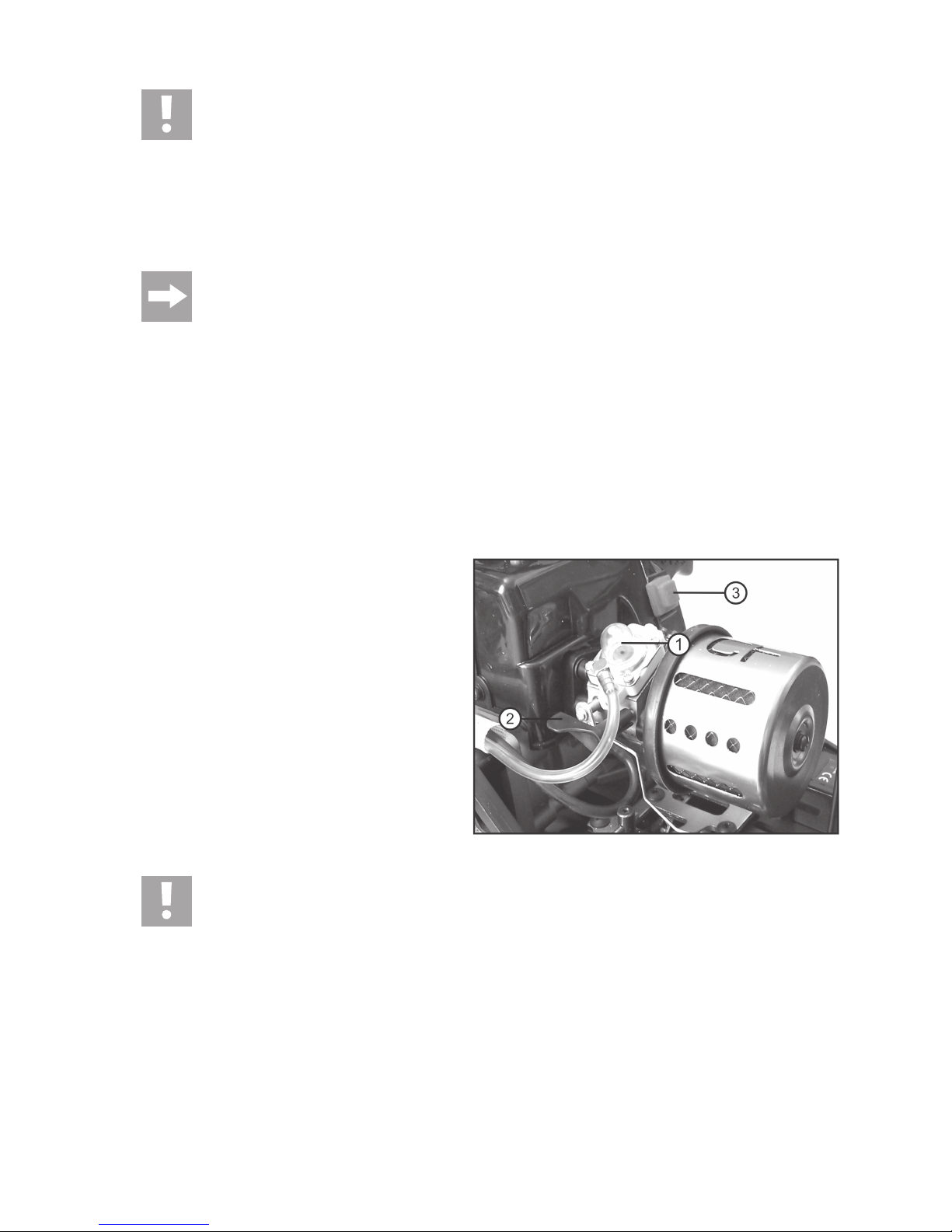
14
Bild 4
Fahren Sie das Modell niemals mit fehlerhaft arbeitender Fernsteuerung!
Suchen Sie vor einer Ausfahrt zuerst den Fehler, falls die Reaktionen der Fernsteuerung beim Reichweitentest nicht wie beschrieben ausfallen.
i) Motor starten
Allgemeines zum Verbrennungsmotor
Bei der Inbetriebnahme des neuen Motors muss eine gewisse Einlaufzeit eingehalten werden. Während
der Einlaufphase passen sich die Motorteile perfekt aneinander an, wodurch maximale Leistung erreicht
und vorzeitiger Verschleiß vermieden wird.
Der Einlaufprozess muss daher mit größter Sorgfalt vorgenommen werden!
Starten des kalten Motors
Der Vergaser besitzt eine integrierte Membranpumpe, die in Funktion tritt, sobald der Motor läuft.
Dabei wird der abwechselnde Über- und Unterdruck im Kurbelwellengehäuse genutzt, um den Kraftstoff in den Vergaser zu fördern.
Zum Starten verfügt der Vergaser über eine manuelle Pumpe, mit der der Kraftstoff in den Vergaser befördert wird.
Diese manuelle Pumpe besteht aus einer transparenten Gummi-Kalotte (Bild 4, Pos. 1), die so gleichzeitig als Schauglas zur Sichtkontrolle der Kraftstoffzufuhr zum Vergaser dient.
• Schließen Sie die Choke-Klappe (siehe Bild 4, Pos.
2), in dem Sie den Hebel nach unten schieben.
• Betätigen Sie die manuelle Pumpe (Gummi-Kalotte
mehrfach drücken), bis sich das Schauglas vollständig mit Kraftstoff gefüllt hat und der Kraftstoff in den
Vergaser gelangt ist.
• Ziehen Sie den Seilzugstarter so oft durch, bis die
erste Motorzündung hörbar wird.
• Öffnen Sie danach sofort die Choke-Klappe wieder
(Hebel waagrecht) und ziehen Sie den Seilzugstarter
mit Schwung durch, bis der Motor anspringt. Halten
Sie hierbei das Modell mit einer Hand fest.
Achtung!
Ziehen Sie den Seilzugstarter nicht bis zum Anschlag heraus, sondern immer nur etwa 3/4 der Länge!
Ermitteln Sie die Länge des Seilzuges durch langsames Herausziehen ohne Zündung! Ziehen Sie den
Seilzugstarter niemals mit Gewalt heraus!
• Wenn der Motor gleich nach dem ersten Anspringen wieder ausgeht, schließen Sie die Choke-Klappe und ziehen
Sie den Seilzugstarter erneut durch, bis der Motor wieder läuft.
• Wenn der Motor läuft, lassen Sie den Seilzugstarter los und stellen Sie den Gas/Bremshebel am Fernsteuersender
auf Leerlauf.
Page 15
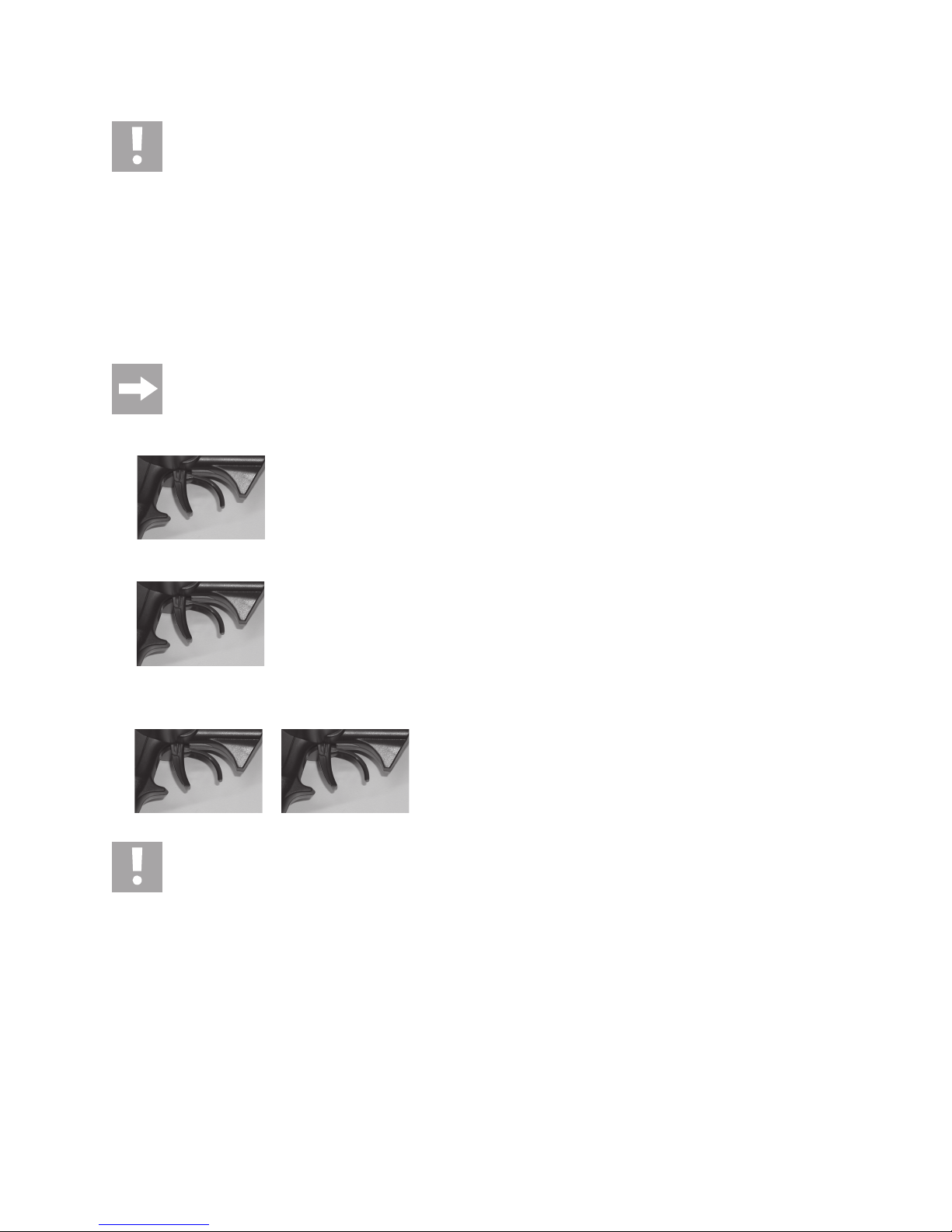
15
• Öffnen Sie die Choke-Klappe wieder (Hebel waagerecht) und lassen den Motor ca. 1 - 2 Minuten warm laufen.
Achtung!
Bleibt die Choke-Klappe zu lange geschlossen oder wurde zu viel Kraftstoff in den Verbrennungsraum
und das Kurbelgehäuse gepumpt, überfettet das Gemisch und der Motor säuft ab. Der Seilzugstarter lässt
sich dann nur mit erhöhtem Kraftaufwand betätigen. Unterlassen Sie weitere Startversuche und entfernen
Sie den überschüssigen Treibstoff (siehe Kapitel 14), um Schäden an Seilzugstarter und Motor zu vermeiden!
In Bild 4, Pos. 3 ist auch der Taster für „Motor aus“ zu sehen.
j) Steuern des Fahrzeugs
Die nachfolgenden Abbildungen dienen nur zur Illustration der Funktionen, diese müssen nicht mit dem
Design des mitgelieferten Senders übereinstimmen.
1. Gas-/Bremshebel loslassen, Fahrzeug rollt aus (bzw. bewegt sich nicht), Hebel ist in Neutralstellung
2. Vorwärts fahren, Gas-/Bremshebel in Richtung Griff ziehen
3. Vorwärts fahren und dann bremsen (Fahrzeug verzögert; rollt nicht langsam aus), Gas-/Bremshebel ohne Pause
vom Griff wegschieben
Bewegen Sie den Gas-/Bremshebel für die Fahrfunktion nur sehr vorsichtig und fahren Sie zu Beginn
nicht zu schnell, bis Sie sich mit der Reaktion des Fahrzeugs auf die Bedienung vertraut gemacht haben.
Machen Sie keine schnellen und ruckartigen Bewegungen an den Bedienelementen des Senders.
Sollte das Fahrzeug die Tendenz aufweisen, nach links oder rechts zu ziehen, so stellen Sie am Sender
die Trimmung für die Lenkung entsprechend ein (siehe auch Bedienungsanleitung der Fernsteuerung).
Wenn die Neutralstellung der Fahrfunktion nicht richtig ist (z.B. Trimmung leicht verstellt), so kann durch
erhöhte Standdrehzahl des Motors die Kupplung schleifen und vorzeitig verschleißen (Trimmung steht
Richtung Vollgas) oder die Bremse verhindert ein Rollen des Fahrzeugs (Trimmung Richtung Bremse
verstellt). Sollte eines dieser Probleme bei Ihnen auftreten, so korrigieren Sie die Einstellung der Trimmung für die Fahrfunktion.
¨
¨
¨
Bild 5
Bild 6
Bild 7
Page 16
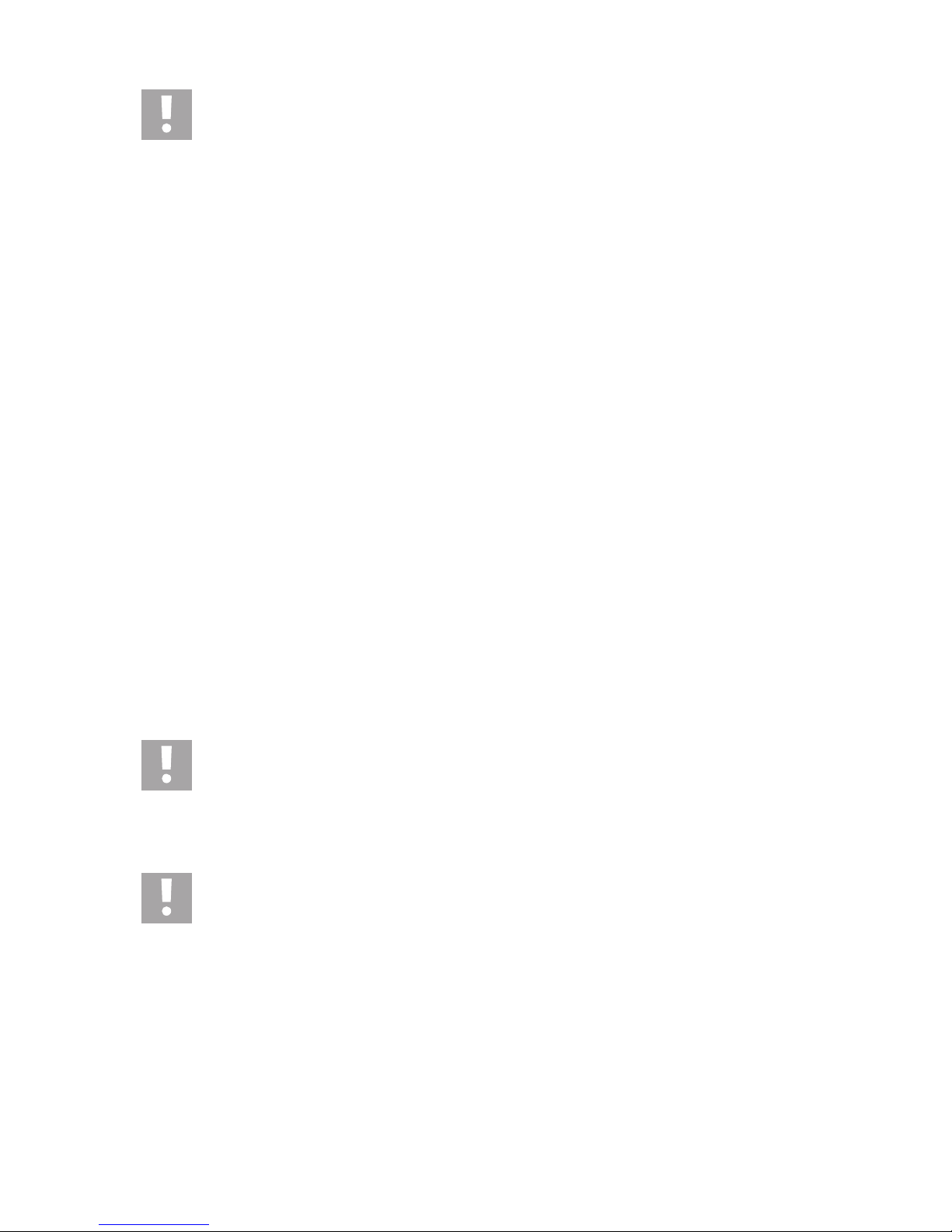
16
Der Zweitakt-Motor des Modells ist luftgekühlt. Das heißt, dass der Fahrtwind die Kühlung des Motors
übernehmen muss (Fahrtwindkühlung).
Vermeiden Sie daher nach Möglichkeit, das Fahrzeug mit häufigen, heftigen Lastwechseln (durch kurze
Gasstöße aus dem niedrigen Drehzahlbereich und anschließend ruckartiges Zurücknehmen der Drehzahl) zu beschleunigen. Die kurzzeitig hohen Drehzahlen erhitzen den Motor stark, ohne dass eine entsprechende Kühlung durch den Fahrtwind sichergestellt ist. Als Folge einer Überhitzung des Motors könnte der Kolben in der Laufbuchse steckenbleiben (Kolbenstecker) und den Antrieb schlagartig blockieren.
Dabei können Folgeschäden im gesamten Antriebsstrang auftreten.
Beenden Sie das Fahren sofort, wenn Sie ungewöhnliche Reaktionen des Fahrzeugs auf die Steuerbefehle am Sender feststellen oder wenn das Fahrzeug nicht mehr reagiert.
Dieses Verhalten könnte durch einen schwachen Empfängerakku oder Batterien/Akkus im Sender verursacht werden.
Auch eine zusammengewickelte Empfängerantenne, Störungen auf dem verwendeten Funkkanal bzw.
Frequenzband (z.B. andere Modelle, Funkübertragungen durch andere Geräte), ein zu großer Abstand
zwischen Sender und Fahrzeug oder ungünstige Sende-/Empfangsbedingungen können eine Ursache
für ungewöhnliche Reaktionen des Fahrzeugs sein.
Warten Sie nach einer Ausfahrt unbedingt mindestens 5 - 10 Minuten, bis sich der Motor und der gesamte
Antrieb (Auspuff, Kupplung etc.) ausreichend abgekühlt haben, bevor Sie mit dem Fahrzeug erneut fahren.
k) Fahrt beenden
Um das Fahren zu beenden, gehen Sie wie folgt vor:
• Lassen Sie den Gas-/Bremshebel am Sender los, so dass er in der Neutralstellung steht und lassen Sie das Fahrzeug ausrollen.
• Nachdem das Fahrzeug still steht, betätigen Sie den roten Taster am Motorblock oberhalb vom Seitzugstarter (siehe auch Bild 4, Pos. 3) und schalten hiermit den Motor ab.
Fassen Sie dabei nicht in die Räder oder den Antrieb und bewegen Sie auf keinen Fall den Gas-/Bremshebel am Sender! Halten Sie das Fahrzeug nicht an den Rädern fest!
• Schalten Sie die Empfängerstromversorgung aus.
• Zuletzt ist der Sender auszuschalten.
Achtung!
Motor und Antriebsteile (z.B. Auspuff) werden beim Betrieb sehr warm! Fassen Sie deshalb diese Teile
unmittelbar nach der Fahrt nicht an, Verbrennungsgefahr!
Page 17
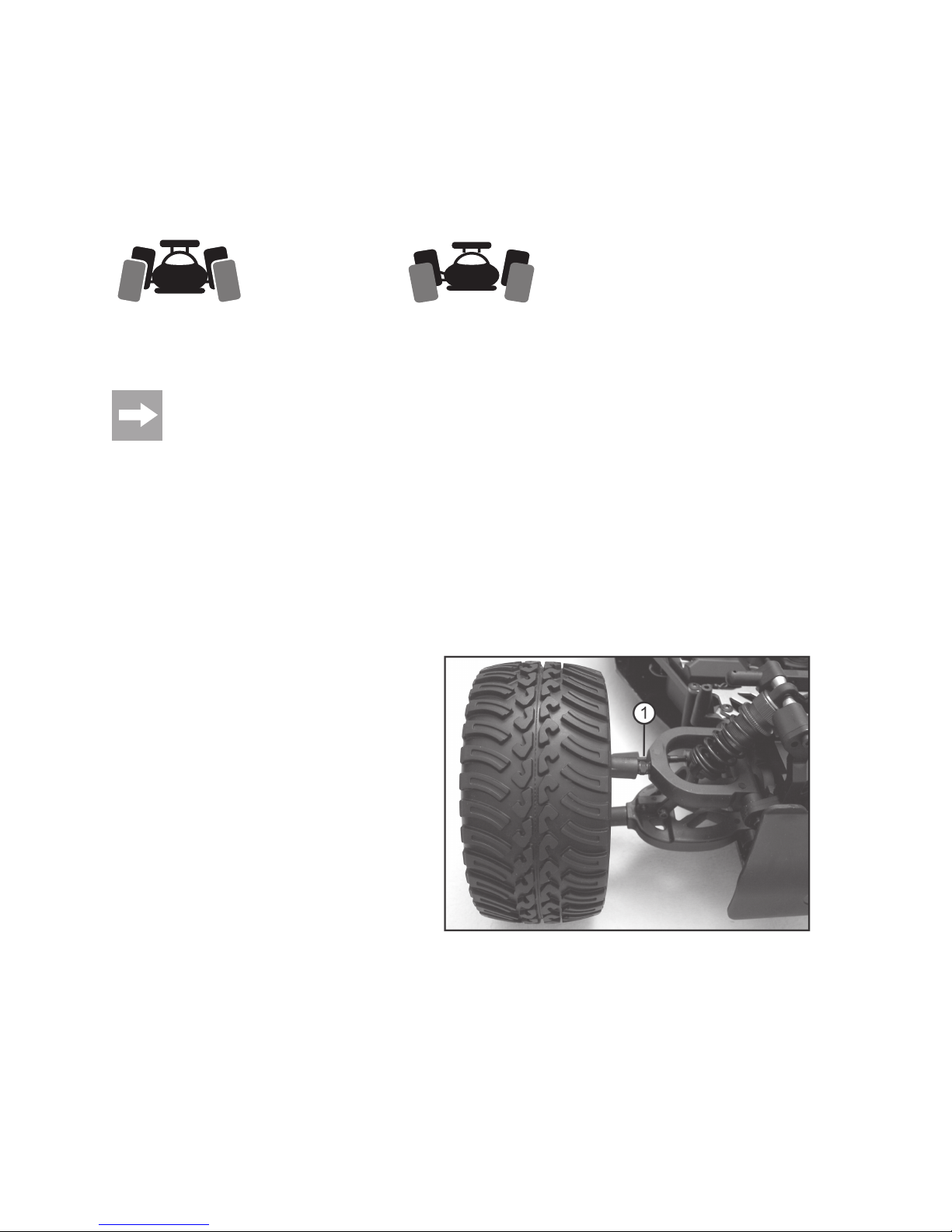
17
9. Einstellmöglichkeiten am Fahrzeug
a) Einstellung des Radsturzes
Der Radsturz bezeichnet die Neigung der Radebene gegenüber der Senkrechten.
Negativer Sturz Positiver Sturz
(Radoberkanten zeigen nach innen) (Radoberkanten zeigen nach außen)
Die Einstellung der Räder bei den beiden Abbildungen oben ist übertrieben dargestellt, um Ihnen den
Unterschied zwischen negativem und positivem Sturz zu zeigen. Für die Einstellung am Modellfahrzeug
sollte eine so extreme Einstellung natürlich nicht vorgenommen werden!
• Ein negativer Sturz an den Vorderrädern erhöht die Seitenführungskräfte der Räder bei Kurvenfahrten, die Lenkung
spricht direkter an, die Lenkkräfte werden geringer. Gleichzeitig wird das Rad in Achsrichtung auf den Achsschenkel
gedrückt. Damit wird axiales Lagerspiel ausgeglichen, das Fahrverhalten wird ruhiger.
• Ein negativer Sturz an den Hinterrädern vermindert die Neigung des Fahrzeughecks, in Kurven auszubrechen.
• Die Einstellung eines positiven Sturzes vermindert dagegen die Seitenführungskräfte der Reifen und sollte grundsätzlich nicht verwendet werden.
Radsturz an der Vorderachse einstellen:
Die Verstellung des Radsturzes erfolgt durch das Verdrehen der Schraube (1) des oberen Querlenkers.
Da diese Schraube je ein Links- und Rechtsgewinde
hat, müssen Sie den Querlenker zum Verstellen des
Radsturzes nicht ausbauen.
Bild 8a
Bild 8b
Bild 9
Page 18
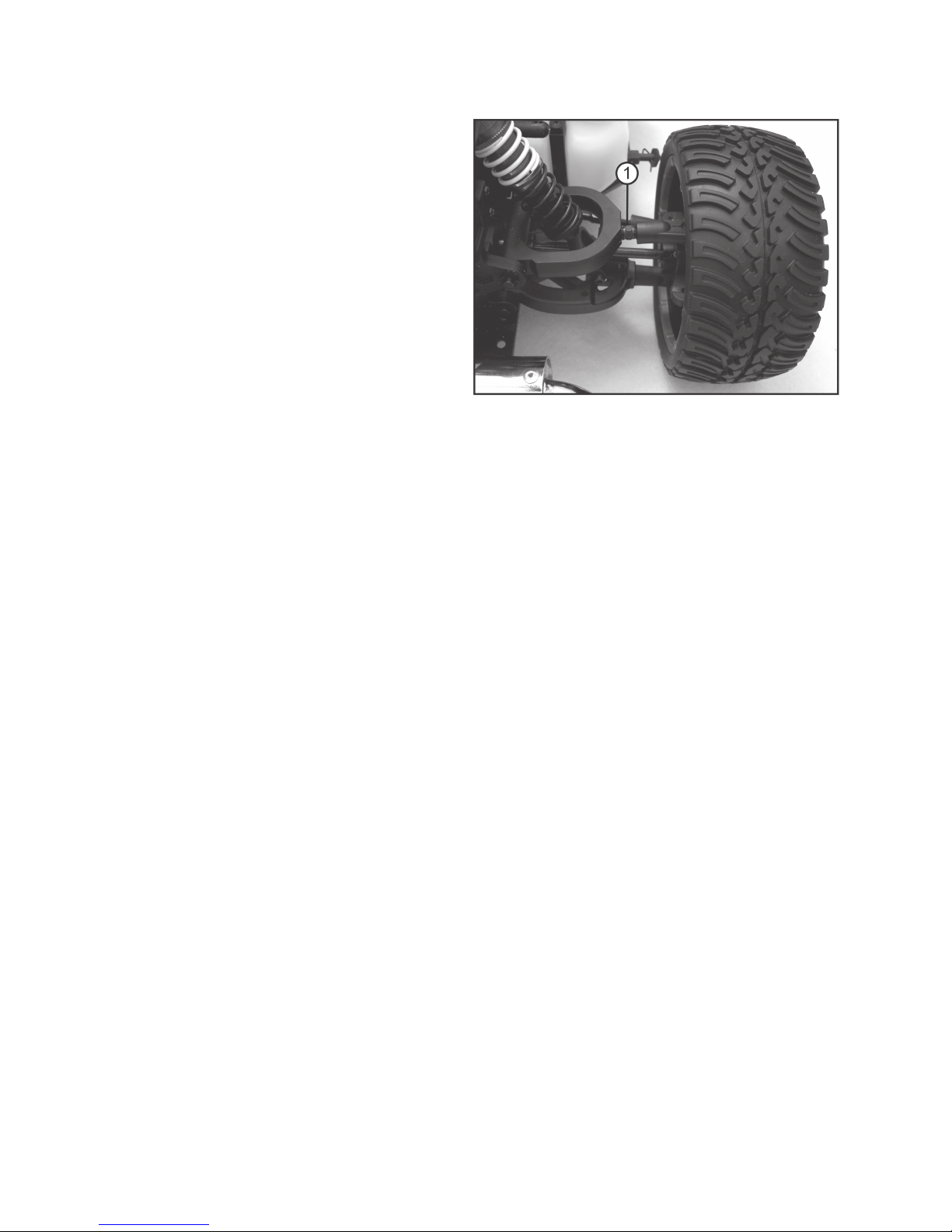
18
Radsturz an der Hinterachse einstellen:
Die Verstellung des Radsturzes erfolgt durch das Verdrehen der Schraube (1) des oberen Querlenkers.
Da diese Schraube je ein Links- und Rechtsgewinde
hat, müssen Sie den Querlenker zum Verstellen des
Radsturzes nicht ausbauen.
Bild 10
Page 19
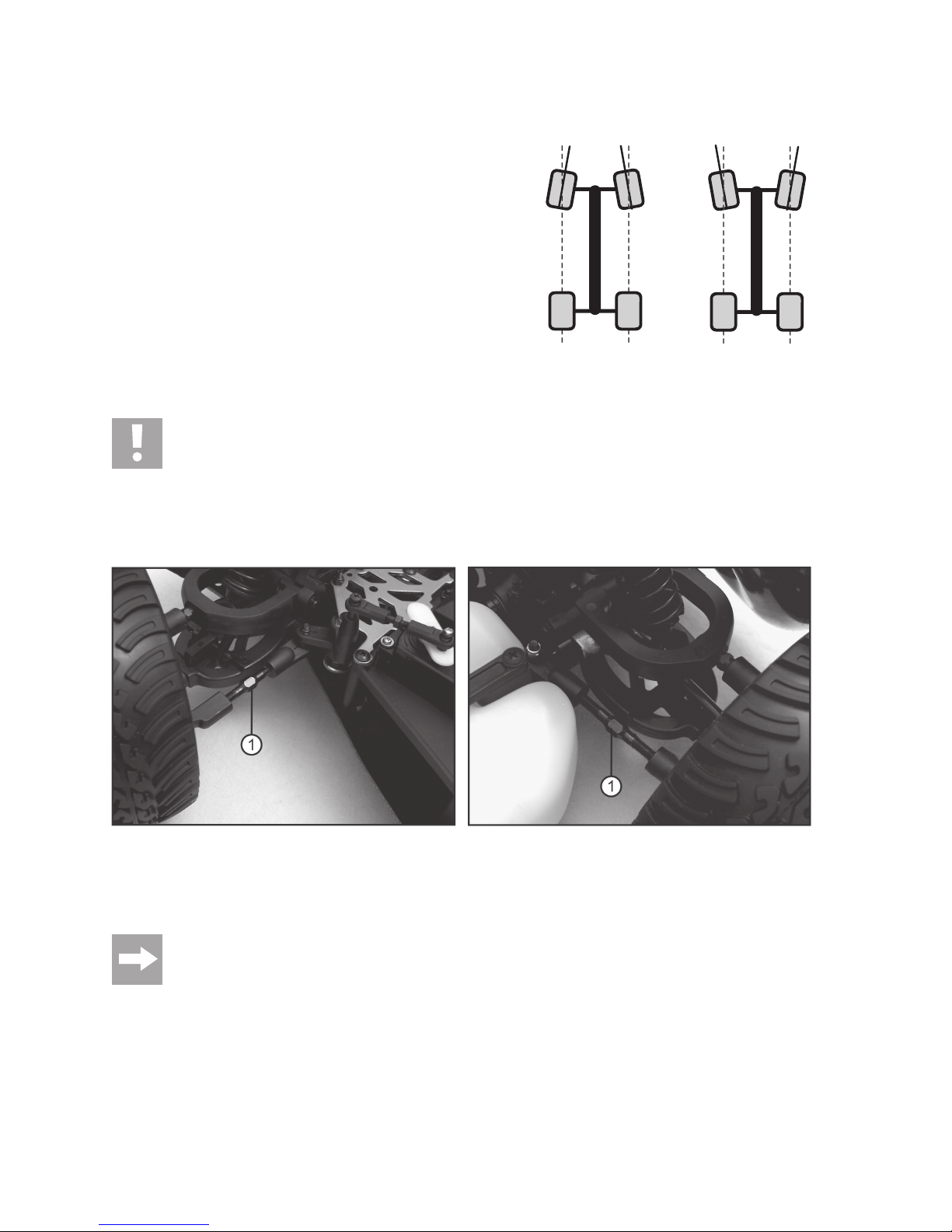
19
b) Einstellung der Spur
Die Spur (Vorspur = Bild „a“, Nachspur = Bild „b“) bezeichnet die Stellung der Radebene zur Fahrtrichtung.
Während der Fahrt werden die Räder durch den Rollwiderstand vorne
auseinandergedrückt und stehen daher nicht mehr exakt parallel zur
Fahrtrichtung. Zum Ausgleich können die Räder des stehenden Fahrzeuges so eingestellt werden, dass sie vorne leicht nach innen zeigen.
Diese Vorspur bewirkt gleichzeitig eine bessere Seitenführung des
Reifens und damit ein direkteres Ansprechen der Lenkung.
Wird ein weicheres Ansprechen der Lenkung gewünscht, kann dies
entsprechend über die Einstellung einer Nachspur erreicht werden, d.h.,
die Räder des stehenden Fahrzeugs zeigen nach außen. Ein Spurwinkel von 0° an der Vorderachse sorgt für die besten Fahrergebnisse
auf fast jedem Untergrund.
Ein Spurwinkel von mehr als 3° Vorspur (a) oder Nachspur (b) führt zu Problemen im Handling und verminderter Geschwindigkeit, außerdem erhöht sich der Reifenverschleiß.
Das obige Bild zeigt eine stark übertriebene Einstellung, die nur zur Verdeutlichung des Unterschieds
zwischen Vor- und Nachspur dient. Wird eine solche Einstellung beim Fahrzeug gewählt, so ist es nur
noch sehr schlecht steuerbar!
Spur einstellen:
Bild 12: Vorderachse Bild 13: Hinterachse
¦¦
a
b
Die Vor-/Nachspur an der Vorderachse lässt sich durch Verdrehen der Verstellschraube (1) einstellen. Da die Verstellschraube je ein Links- und Rechtsgewinde hat, muss sie zum Verstellen nicht ausgebaut werden.
Verdrehen Sie immer beide Verstellschrauben (1) gleichmäßig (linkes und rechtes Vorderrad), da Sie
sonst entweder die Trimmung am Sender verstellen müssen oder sogar die Ansteuerung durch das Lenkservo korrigiert werden muss (z.B. Servostange verstellen oder Servoarm anders auf das Servo aufstekken).
Bild 11
Page 20

20
c) Einstellung der Lenkgeometrie
Defekte bei Servos werden durch schwergängige Anlenkungen bzw. Mechaniken (z.B. durch Verschmutzung oder
Rost) genauso wie durch unsymmetrische, und damit nicht lineare geometrische Lenkeinstellungen verursacht. Deshalb müssen Sie vor dem Fahrbetrieb bei Ihrem Modell nachfolgende Punkte überprüfen und eventuell entsprechende Korrekturen durchführen.
Durch diese Maßnahmen gewährleisten Sie eine stärkere, unter Last schnellere und vor allem nach links und rechts
gleichmäßige Ansteuerung der Lenkung. Achten Sie bei den Einstellungen auf jeden Fall darauf, dass das Servo nicht
auf Block läuft.
Die rechtwinkeligen Lenkhebel A und A‘ müssen exakt
parallel und somit 90° zur Linie B ausgerichtet werden. Die Linie B ist genau 180° (also quer) zur Fahrtrichtung.
Sollten die vorderen Räder nach der Korrektur der
Lenkhebelposition nicht exakt auf neutral (gerade) stehen, so müssen Sie mit den Spurstangen C und C‘ die
Neutraleinstellung der Räder (Spur) einstellen.
Beachten Sie hierzu auch die Hinweise im Kapitel 9.
b).
Der Servoabtriebshebel vom Lenkservo D muss bei
Neutralstellung des Senders (Trimmung auch auf 0)
exakt 90° zum Servogehäuse ausgerichtet sein.
Wenn notwendig, so demontieren Sie den Servohebel
und setzen ihn versetzt wieder auf. Geringfügige Abweichungen können mit der Trimmung am Sender eingestellt werden.
Sind die Lenkhebel und der Servoabtriebshebel wie oben beschrieben exakt eingestellt, muss eventuell noch die
Steuerstange E abgelängt werden, damit die Räder wieder auf Geradeausfahrt stehen.
Bild 14
Page 21
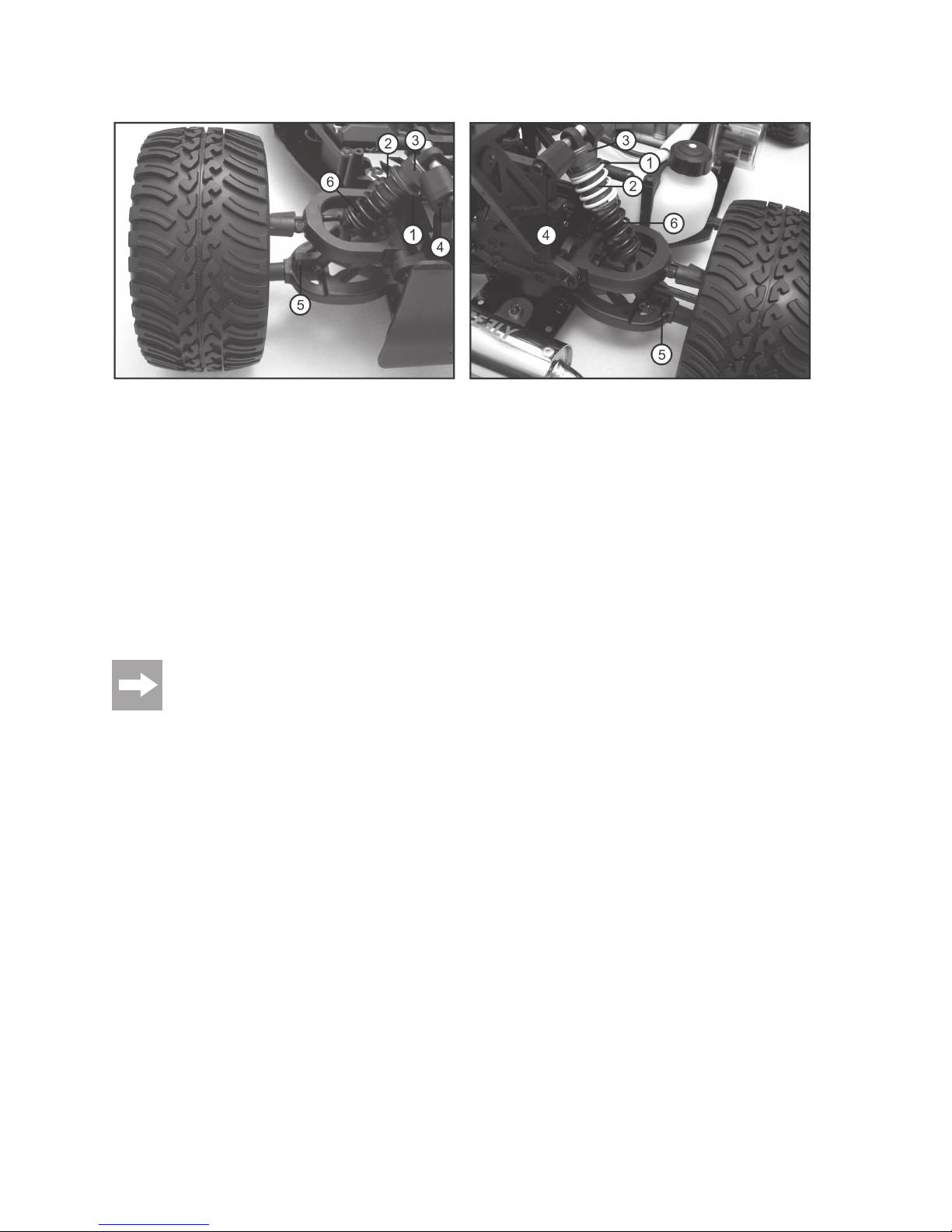
21
d) Einstellung der Stoßdämpfer
Bild 15: Vorderachse Bild 16: Hinterachse
Am oberen Ende des Stoßdämpfers kann die Einstellung der Feder-Vorspannung durch das Verdrehen einer Rändelmutter (1) vorgenommen werden. Achten Sie darauf, dass sich hierbei der Stoßdämpferkörper (2) nicht mitdreht und
sich dadurch von der Stoßdämpferkappe (3) herausdreht (es droht dann Ölverlust).
Die Stoßdämpfer an Vorderachse und Hinterachse des Fahrzeugs können an der Dämpferbrücke (4) und am unteren
Querlenker (5) in verschiedenen Positionen montiert werden. Der Hersteller hat hier jedoch bereits eine optimale
Position gewählt, deshalb sollte eine Veränderung nur von professionellen Fahrern durchgeführt werden.
Stellen Sie die Stoßdämpfer einer Achse immer gleich ein (am linken und rechten Rad der Vorderachse bzw. der
Hinterachse), da andernfalls das Fahrverhalten negativ beeinflusst wird.
Achten Sie auch immer auf den korrekten Sitz der Staubschutzgummis im Inneren der Federn (6).
Als optionales Zubehör (nicht im Lieferumfang, getrennt bestellbar) können Sie z.B. Federn mit einem
anderen Härtegrad verwenden oder Sie befüllen die Stoßdämpfer mit einem Dämpferöl mit anderer Viskosität.
Page 22
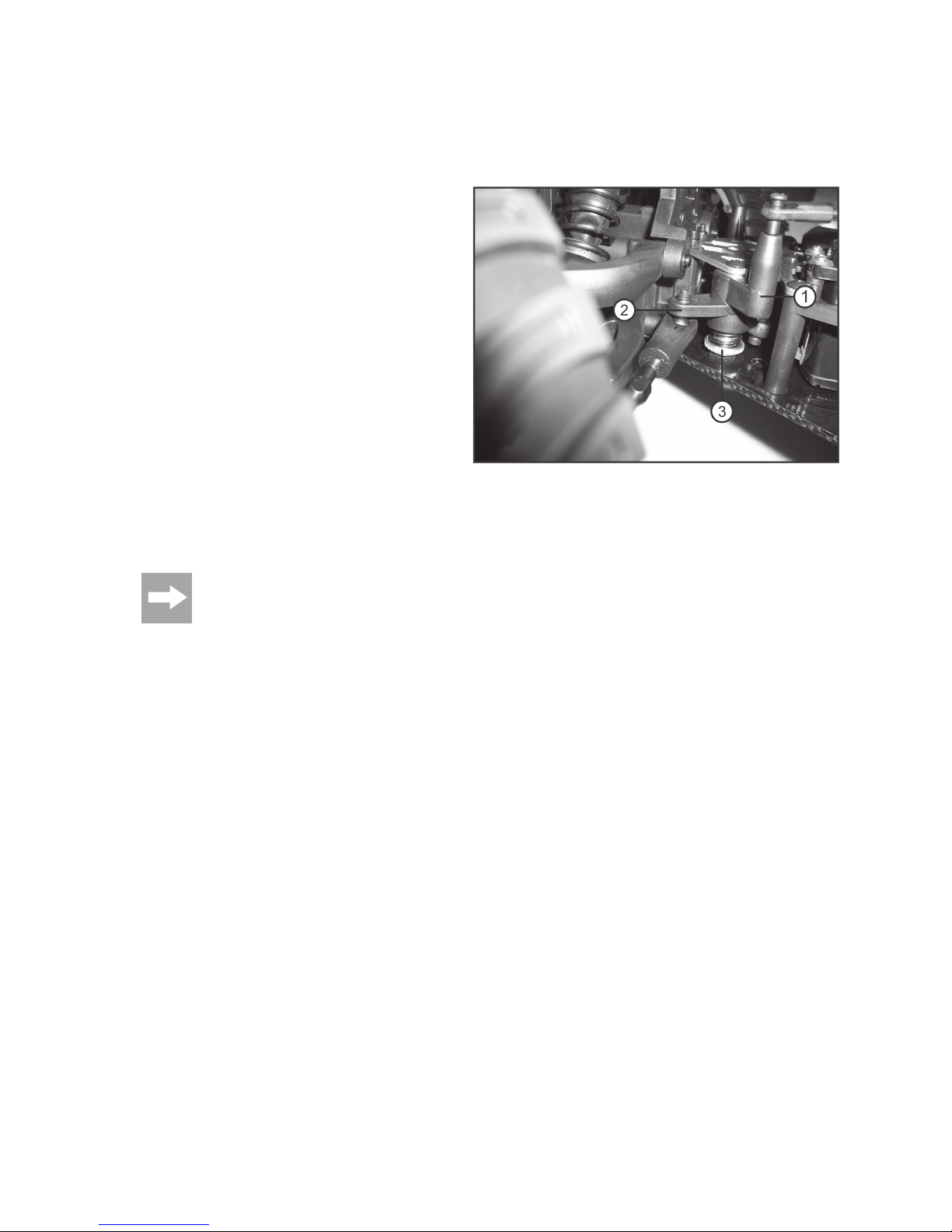
22
e) Einstellung des Servo-Savers
Die Lenkung des Fahrzeuges ist als Achsschenkellenkung ausgelegt.
Die Schwenkbewegung des Servosteuerhebels wirkt über das Lenkgestänge auf den Arm des Servo-Savers.
Der Servo-Saver besteht aus zwei rechtwinklig zueinander angeordneten Hebeln (1 und 2), die nicht starr
miteinander verbunden sind, sondern sich über eine
Feder in einer Ebene mit dem Lenkgestänge gegeneinander bewegen lassen.
Der zweite Hebelarm des Servo-Savers bewegt die
Lenkungsplatte, die wiederum über die beiden Spurstangenhebel den Lenkeinschlag der beiden Vorderräder bewirkt.
Wenn im Fahrbetrieb harte Schläge über die Räder in
die Lenkmechanik eingeleitet werden, werden diese
nicht unmittelbar auf das Lenkservo übertragen, sondern über die federnde Verbindung der beiden Hebelarme des Servosavers gedämpft.
Die Wirkung des Servosavers kann mit einer Rändelmutter (3) über eine Änderung des Anpressdrucks der
Feder auf die beiden Hebelarme eingestellt werden.
Bei zu weicher Einstellung bewirken bereits leichte Stöße gegen das Rad eine Verdrehung der beiden
Arme des Servosavers, was die Lenkgenauigkeit und Spurtreue beim Fahren negativ beeinflusst.
Eine zu strenge Einstellung dagegen kann dagegen dazu führen, dass das Servogetriebe beschädigt
wird, da Stöße gegen die Räder ungefiltert an das Servo weitergeleitet werden.
Bild 17
Page 23

23
10. Motoreinstellungen
Der Vergaser ist ab Werk für die ersten Fahrten optimal vorjustiert. Hierbei wird eine fette Vergasereinstellung verwendet, um den Motor in der Einlaufphase ausreichend mit Schmierung zu versorgen. Dies zeigt sich an kräftiger weißer
Rauchentwicklung aus dem Auspuff.
Für die ersten 2 - 3 Tankfüllungen sollte die fette Vergasereinstellung beibehalten werden. Zudem sollten Sie auf zu
lange Vollgasphasen verzichten und den Motor schonend mit unterschiedlichen Drehzahlen einfahren.
a) Einstellen des Vergasers allgemein
Je nach verwendetem Gemisch, Zündkerze, Schalldämpfer und Umgebungsbedingungen wie Luftdruck und Luftfeuchtigkeit können geringfügige Änderungen in der Vergasereinstellung nötig werden. Die Feineinstellung von Leerlauf und Vollgas kann erst bei gut eingelaufenem Motor vorgenommen werden.
L Leerlaufgemisch-Regulierschraube
H Hauptdüsennadel
S Einstellschraube für Standgas
Bild 18
Page 24
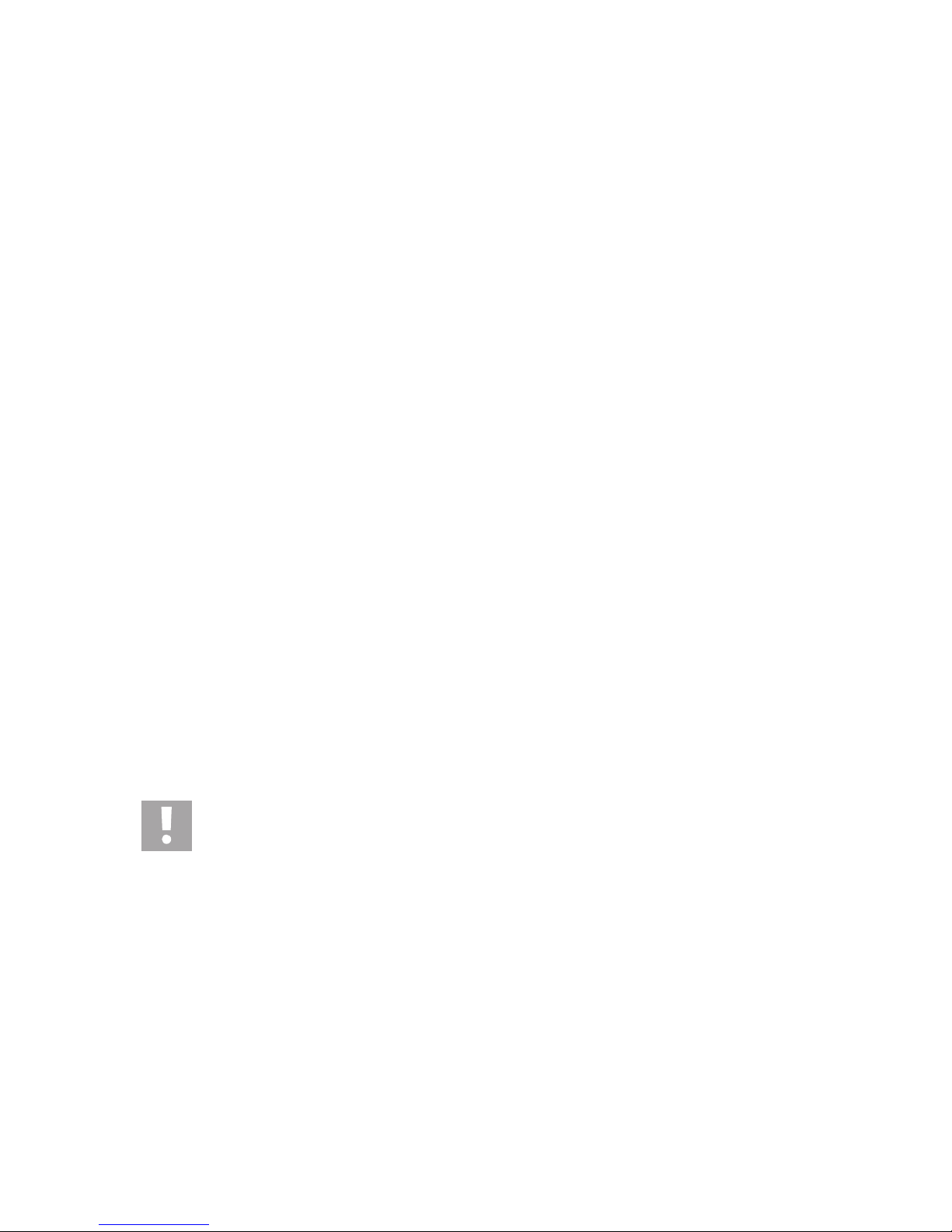
24
b) Einstellen der Leerlaufgemisch-Regulierschraube (L)
• Bringen Sie den Motor durch Fahren auf Betriebstemperatur.
• Nimmt der Motor dabei nur schlecht Gas an, ist das Leerlaufgemisch zu mager. Das Verdrehen der Leerlauf-Gemischregulierschraube gegen den Uhrzeigersinn (nach links) lässt das Gemisch fetter werden.
Korrigieren Sie die Einstellung schrittweise, indem Sie die Leerlauf-Gemischregulierschraube jeweils ca. eine 1/8Umdrehung nach links drehen.
• Nimmt der Motor nur stotternd und unter heftiger Rauchentwicklung Gas an, ist das Gemisch zu fett. Das Verdrehen
im Uhrzeigersinn (nach rechts) magert das Gemisch ab (der Kraftstoffanteil wird verringert).
Korrigieren Sie die Einstellung der Leerlauf-Gemischregulierschraube schrittweise um jeweils ca. eine 1/8-Umdrehung nach rechts.
c) Einstellen der Hauptdüsennadel (H)
• Heben Sie die angetriebene Achse vom Boden ab und lassen Sie den betriebswarmen Motor kurzfristig auf Vollgas
laufen.
• Jetzt können Sie die Einstellung des Vollgasgemisches an der Hauptdüsennadel in Schritten von 1/8-Umdrehung
korrigieren.
Drehen Sie die Hauptdüsennadel im Uhrzeigersinn, wenn das Gemisch magerer werden soll.
Drehen Sie die Hauptdüsennadel gegen den Uhrzeigersinn, um das Gemisch anzureichern (den Kraftstoffanteil zu
erhöhen).
• Für eine lange Motorlebensdauer sollten Sie für die Einstellung der Hauptdüsennadel eine leicht fette Vergasereinstellung bevorzugen.
Verdrehen Sie hierzu in kleinen Schritten die Hauptdüsennadel (H) so lange, dass der Motor kurz nach dem Steuersignal „Vollgas“ seine Höchstdrehzahl erreicht und ohne stottern rund läuft.
Anschließend drehen Sie die Hauptdüsennadel eine 1/8-Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn, um den Kraftstoffanteil zu erhöhen (= fette Vergasereinstellung).
• Nach jedem Motorlauf (Tankfüllung) ist eine ausreichende Abkühlphase (ca. 10 min) einzulegen.
Achtung!
Es ist von höchster Wichtigkeit, dass das Gemisch niemals zu sehr abgemagert wird! Bedenken Sie, dass
die Motorschmierung über das im Treibstoff enthaltene Öl erfolgt.
Zu wenig Kraftstoff im Gemisch (= magere Vergasereinstellung) führt zu einer Überhitzung des Motors
und einem Festgehen des Kolbens wegen mangelhafter Schmierung. Während des Betriebes sollte immer eine leichte weiße Rauchfahne aus dem Auspuff sichtbar sein. Falls nicht, stoppen Sie sofort den
Motor und reichern Sie das Gemisch an. Achten Sie weiterhin darauf, dass der Zylinderkopf ausreichend
von Luft umströmt wird, um ein Überhitzen zu vermeiden. Die optimale Betriebstemperatur des Motors
beträgt ca. 100 - 120 °C. Überprüfen Sie die Temperatur mit einem Infrarot-Thermometer.
Sie erkennen, dass der Motor eingelaufen ist, wenn er sich im kalten Zustand und ohne Zündkerze ohne
spürbaren Widerstand durchdrehen lässt. Erst jetzt dürfen Sie den Motor mit voller Leistung betreiben.
Page 25
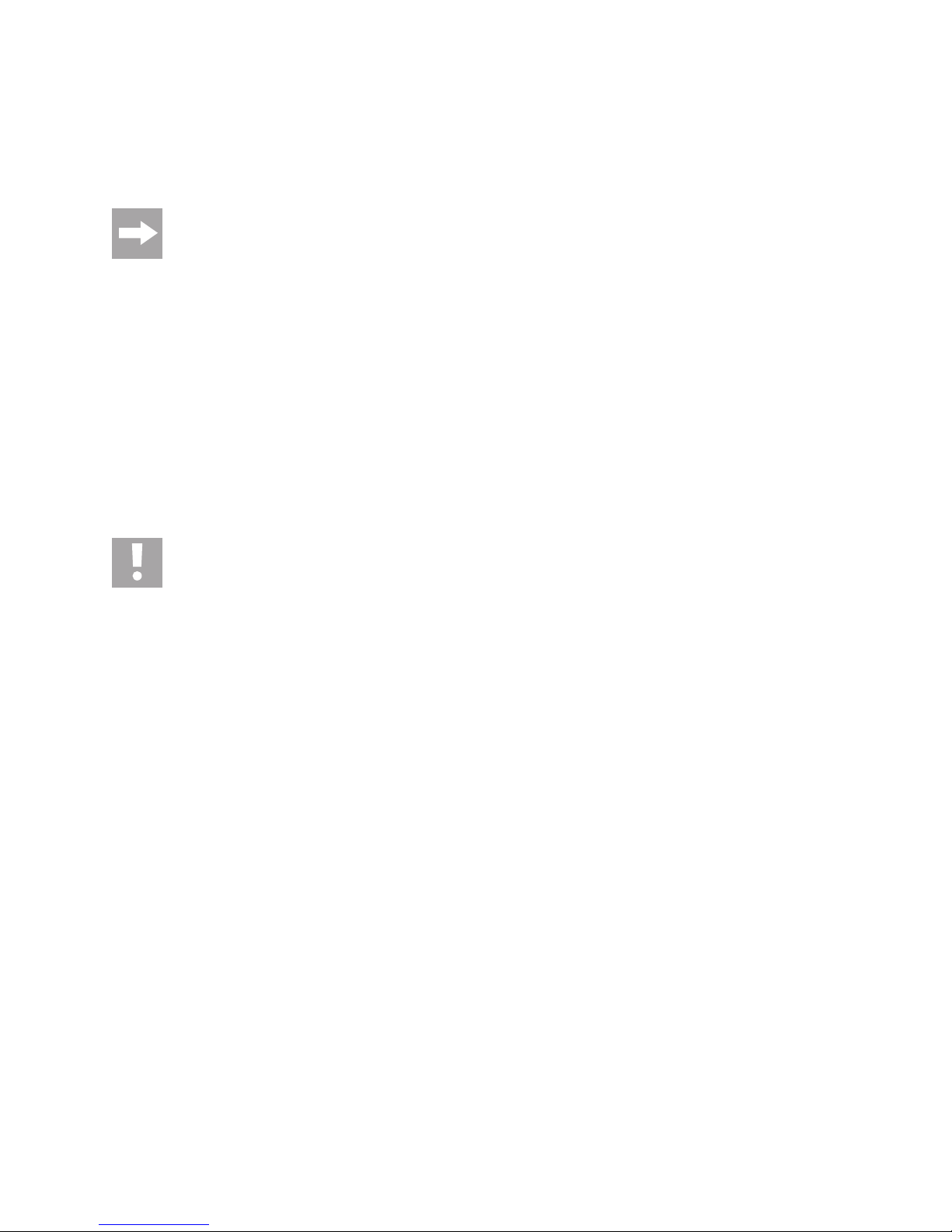
25
d) Einstellen der Standgasdrehzahl (S)
• Drehen Sie die Einstellschraube für das Standgas (S) im Uhrzeigersinn, wenn die Standgasdrehzahl höher werden
soll.
• Das Drehen der Einstellschraube gegen den Uhrzeigersinn verringert die Standgasdrehzahl.
Stellen Sie bei betriebswarmen Motor die Standgasdrehzahl so ein, dass der Motor noch sicher läuft.
Vermeiden Sie ein zu hohes Standgas, da in diesem Fall die Kupplung permanent schleift und schneller
verschleißt.
e) Wiederherstellen der werkseitigen Einstellungen
Leerlaufgemisch-Regulierschraube (L):
Als Grundeinstellung sollte die Leerlauf-Gemischregulierschraube 1,25 Umdrehungen herausgedreht sein.
• Drehen Sie die Schraube vorsichtig und ohne Kraftaufwand ganz hinein, bis sie gerade anliegt.
• Drehen Sie jetzt die Nadel wieder um 1,25 Umdrehungen heraus.
Hauptdüsennadel (H):
Die Grundeinstellung der Hauptdüsennadel beträgt 1,75 Umdrehungen.
Wird die Hauptdüsennadel zu fest hineingedreht, kann sowohl die Nadel als auch der Sitz der Nadel im
Vergaser zerstört werden! Verlust von Gewährleistung/Garantie!
Page 26
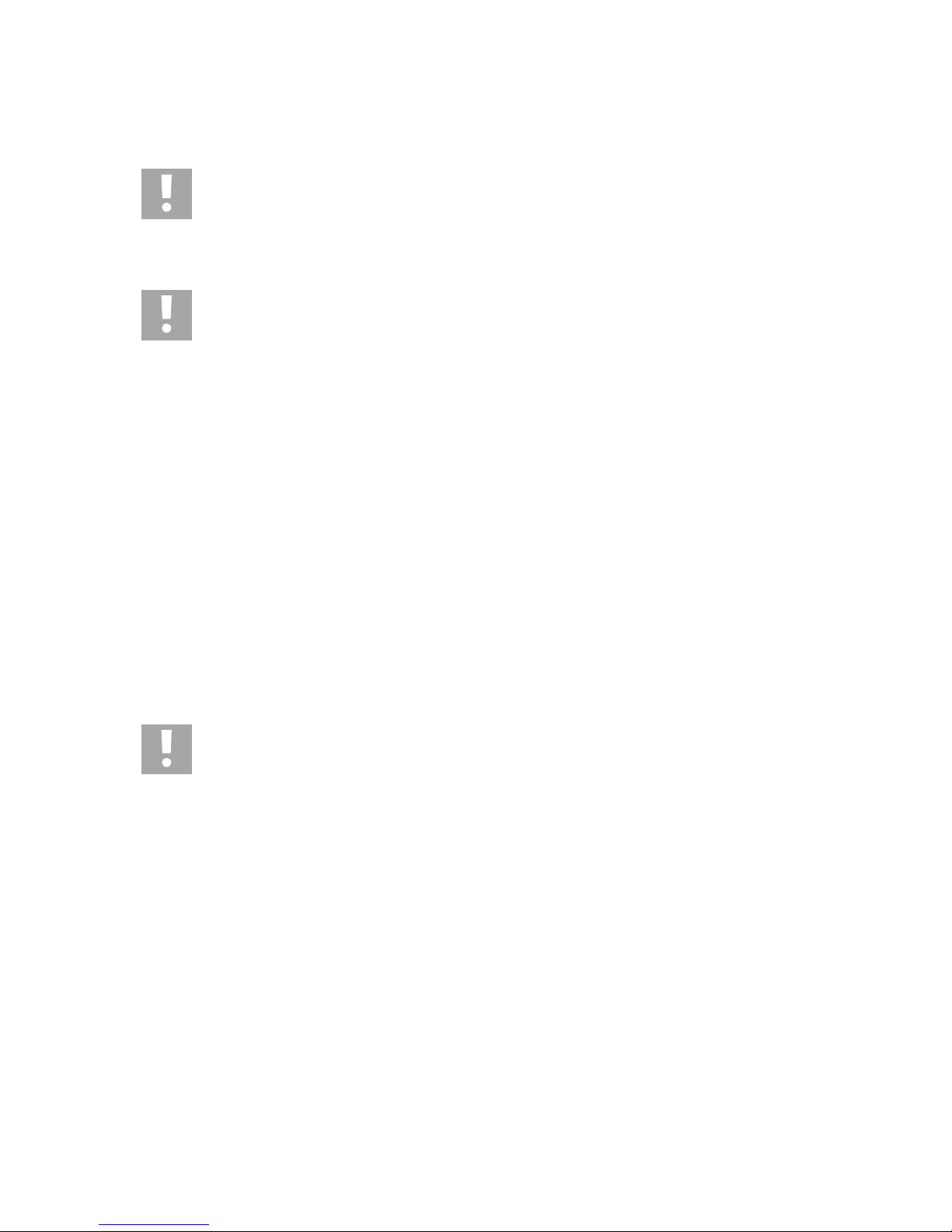
26
11. Reinigung und Wartung
Falls Sie vorher mit dem Fahrzeug gefahren sind, lassen Sie alle Teile (z.B. Motor, Auspuff usw.) zuerst
vollständig abkühlen.
Reinigen Sie das ganze Fahrzeug nach dem Fahren von Staub und Schmutz, verwenden Sie z.B. einen langhaarigen
sauberen Pinsel und einen Staubsauger. Druckluft-Sprays können ebenfalls eine Hilfe sein.
Verwenden Sie keine Reinigungssprays oder herkömmliche Haushaltsreiniger. Dadurch könnte die Elektronik beschädigt werden, außerdem führen solche Mittel zu Verfärbungen an den Kunststoffteilen oder
der Karosserie.
Waschen Sie das Fahrzeug niemals mit Wasser ab, z.B. mit einem Hochdruckreiniger. Dadurch wird der
Motor und auch der Empfänger sowie die Servos zerstört. Das Fahrzeug darf nicht feucht oder nass
werden!
Zum Abwischen der Karosserie kann ein weiches, leicht angefeuchtetes Tuch verwendet werden. Reiben Sie nicht zu
fest, sonst gibt es Kratzspuren.
In gewissen Abständen sind am Fahrzeug Wartungsarbeiten und Funktionskontrollen durchzuführen, die einen störungsfreien Betrieb und eine lange Fahrtüchtigkeit gewährleisten.
Durch die Motorvibrationen und Erschütterungen beim Fahren können sich Teile und Schraubverbindungen lösen.
Kontrollieren Sie deshalb vor und nach jeder Fahrt folgende Positionen:
• Fester Sitz der Radmuttern und aller Schraubverbindungen des Fahrzeugs
• Befestigung der Servos
• Verklebung der Reifen auf den Felgen bzw. den Zustand der Reifen
• Befestigung aller Kabel (diese dürfen nicht in bewegliche Teile des Fahrzeugs gelangen)
Überprüfen Sie außerdem vor jedem Gebrauch das Modell auf Beschädigungen. Falls Sie Beschädigungen feststellen, so darf das Fahrzeug nicht verwendet bzw. in Betrieb genommen werden.
Sollten abgenutzte Fahrzeugteile (z.B. Reifen) oder defekte Fahrzeugteile (z.B. ein gebrochener Querlenker) ausgetauscht werden müssen, so verwenden Sie nur Originalersatzteile.
Kontrollieren Sie nach mehreren Fahrten regelmäßig folgende Positionen:
• Der Luftfilter muss eingeölt, sauber und ohne Beschädigungen sein, um z.B. in staubiger Umgebung auch feinsten
Staub auszufiltern.
• Alle beweglichen und gelagerten Teile sind nach der Reinigung des Modell bzw. nach mehreren Ausfahrten mit
einem dünnflüssigen Maschinenöl oder Sprühfett zu schmieren.
• Prüfen Sie Aussehen und Kontaktabstand der Zündkerze.
Zündkerzen verschleißen, besonders in der Einlaufphase. Wir empfehlen daher, stets einige Zündkerzen zum Auswechseln bereitzuhalten.
Page 27

27
Verwenden Sie nur Zündkerzen vom Typ „CMR 7H“! Eine falsche bzw. verschlissene Zündkerze lässt den Motor
fehlerhaft laufen und erschwert die Abstimmung. Für den Einbau bzw. Austausch der Zündkerze benötigen Sie
einen Zündkerzenschlüssel (Kreuzschlüssel SW10). Der ideale Elektrodenabstand einer intakten Zündkerze beträgt 0,7 mm.
• Überprüfen Sie die Anlenkung des Vergasers und
der Bremse.
Bei neutral stehendem Gas-/Bremsservo (1) muss
das Vergaseranlenkgestänge (2) durch die Federkraft der Vergaserdrosselklappe leicht auf den mechanischen Anschlag des Ruderhorns drücken.
• Das Bremsgestänge (3) darf hierbei noch nicht auf
die Bremshebel (4) und somit auf die Bremse einwirken.
• Wird am Sender die Bremsfunktion betätigt, bewegt
sich das Ruderhorn in Richtung der Pfeile. Das Gasgestänge wird durch die eingebaute Feder noch stärker Richtung mechanischen Anschlag am Vergaser
(siehe auch Bild 18) gezogen. Hierbei darf sich die
Drehzahl des Motors nicht verringern. Ist dies der
Fall, muss der vordere Stellring justiert werden (Richtung Vergaser schieben).
• Gleichzeitig wird der Bremshebel (4) bewegt und hierdurch die Bremse betätigt. Bremsbeläge unterliegen einem
Verschleiß. Nach einer gewissen Betriebsdauer lässt je nach Fahrweise die Bremswirkung nach. Mit der Einstellschraube (5) können Sie das Gestänge entsprechend so verstellen, dass sich wieder die gewohnte Bremswirkung
einstellt.
Bild 19
Page 28

28
12. Entsorgung
a) Allgemein
Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht in den Hausmüll!
Entsorgen Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer gemäß den geltenden gesetzlichen Vorschriften.
b) Batterien und Akkus
Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batterieverordnung) zur Rückgabe aller gebrauchten Batterien und Akkus
verpflichtet; eine Entsorgung über den Hausmüll ist untersagt!
Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit nebenstehendem Symbol gekennzeichnet, das auf das Verbot
der Entsorgung über den Hausmüll hinweist. Die Bezeichnungen für das ausschlaggebende Schwermetall sind: Cd=Cadmium, Hg=Quecksilber, Pb=Blei (Bezeichnung steht auf der Batterie/Akku z.B. unter
dem links abgebildeten Mülltonnen-Symbol).
Ihre verbrauchten Batterien/Akkus können Sie unentgeltlich bei den Sammelstellen Ihrer Gemeinde, unseren Filialen
oder überall dort abgeben, wo Batterien/Akkus verkauft werden.
Sie erfüllen damit die gesetzlichen Verpflichtungen und leisten Ihren Beitrag zum Umweltschutz.
13. Konformitätserklärung (DOC)
Hiermit erklären wir, Conrad Electronic, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, dass sich dieses Produkt in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie
1999/5/EG befindet.
Die Konformitätserklärung zu diesem Produkt finden Sie unter www.conrad.com.
Page 29

29
14. Behebung von Störungen
Auch wenn das Modell nach dem heutigen Stand der Technik gebaut wurde, kann es dennoch zu Fehlfunktionen oder
Störungen kommen. Aus diesem Grund möchten wir Ihnen aufzeigen, wie Sie eventuelle Störungen beseitigen können.
Das Modell reagiert nicht
• Bei 2,4 GHz-Fernsteueranlagen muss der Empfänger am Sender angelernt werden. Dieser Vorgang wird z.B. mit
den englischen Begriffen „Binding“ oder „Pairing“ bezeichnet. Den Anlernvorgang hat normalerweise der Hersteller
bereits durchgeführt, kann jedoch selbstverständlich auch von Ihnen durchgeführt werden. Beachten Sie dazu die
getrennt beiliegende Bedienungsanleitung der Fernsteueranlage.
• Ist der Empfängerakku oder die Batterien/Akkus im Sender leer?
• Haben Sie zuerst den Sender und anschließend die Empfängerstromversorgung eingeschaltet? Halten Sie immer
diese Reihenfolge ein!
• Ist der Empfängerakku richtig mit dem entsprechenden Anschlussstecker verbunden?
• Ist das Fahrzeug zu weit weg? Bei vollem Empfängerakku und vollen Batterien/Akkus im Sender sollte eine Reichweite von 100 m und mehr möglich sein. Dies kann jedoch verringert werden durch Umgebungseinflüsse, z.B.
Sender auf der gleichen oder benachbarten Frequenz, die Nähe zu Metallteilen, Bäumen usw.
Auch die Position von Sender- und Empfängerantenne zueinander hat sehr starken Einfluss auf die Reichweite.
Optimal ist es, wenn sowohl die Sender- als auch die Empfängerantenne senkrecht steht. Wenn Sie dagegen mit
der Senderantenne auf das Fahrzeug zielen, ergibt sich eine sehr kurze Reichweite!
• Prüfen Sie die richtige Position der Stecker der Servos im Empfänger. Sind die Stecker um 180° verdreht eingesteckt, so funktionieren die Servos nicht.
• Sind die Stecker von Servo und Fahrtregler am Empfänger in der richtigen Orientierung angeschlossen? Wenn die
Stecker von Gasservo und Lenkservo gegeneinander vertauscht wurden, steuert der Gas-/Bremshebel das Lenkservo und das Drehrad das Gasservo.
Der Motor springt nicht an
• Das Standgas ist zu niedrig eingestellt.
Stellen Sie am Sender mit Hilfe der Trimmung für die Fahrfunktion die Neutralstellung richtig ein bzw. trimmen in
Richtung Standgas-Erhöhung. Überprüfen Sie die Stellringe am Gasgestänge auf korrekten und festen Sitz.
• Wurde zum Start der Choke gesetzt?
• Wurde der Choke zu lange gesetzt? Möglicherweise ist der Motor abgesoffen.
Entfernen Sie die Zündkerze. Trocknen Sie die Zündkerze mit Druckluft. Halten Sie ein Tuch über den Zylinder des
Motors und ziehen mehrfach am Seilzugstarter, um den überschüssigen Kraftstoff aus dem Brennraum zu entfernen. Setzen Sie die Zündkerze wieder ein und starten ohne Choke erneut. Springt der Motor nach dem zehnten
Versuch immer noch nicht an, nochmals mit gesetztem Choke versuchen.
Page 30

30
• Ist der Elektrodenabstand der Zündkerze korrekt (soll: 0,7 mm)?
• Ist die Zündkerze schon länger in Gebrauch und eventuell verschlissen? Im Zweifelsfall ist der Startversuch mit
neuer Zündkerze zu testen.
• Sind alle Kraftstoffleitungen in Ordnung? Wird mit der manuellen Pumpe Kraftstoff angesaugt?
Fahrzeug bleibt beim Loslassen des Gas-/Bremshebels nicht stehen
• Standgas ist zu hoch eingestellt. Stellen Sie am Sender mit Hilfe der Trimmung für die Fahrfunktion die Neutralstellung richtig ein.
• Wenn der Trimmweg nicht reicht, muss die Standgasschaube am Vergaser justiert werden.
Fahrzeug wird langsamer
• Der Antrieb ist durch Blätter, Äste o.ä. blockiert.
• Die Vergasereinstellung ist zu mager eingestellt (Motor ist kraftlos und möglicherweise überhitzt). Stellen Sie den
Vergaser fetter ein.
• Der Luftfiltereinsatz ist verschmutzt. Dadurch ist die Vergasereinstellung zu fett (Motor stottert und kommt nicht oder
nur sehr langsam auf Touren). Reinigen oder wechseln Sie den Luftfilter.
Das Lenkservo zeigt nur noch geringe oder überhaupt keine Reaktion; die Reichweite zwischen Sender
und Fahrzeug ist nur sehr kurz
• Der Empfängerakku ist schwach oder leer.
• Überprüfen Sie die Batterien/Akkus im Sender.
Der Geradeauslauf stimmt nicht
• Stellen Sie am Sender die Trimmung für die Lenkfunktion richtig ein.
• Überprüfen Sie das Lenkgestänge bzw. die Einstellung für die Spur.
• Hatte das Fahrzeug einen Unfall? Dann prüfen Sie das Fahrzeug auf defekte oder gebrochene Teile und tauschen
Sie diese aus.
Lenkung gegenläufig zur Bewegung des Drehrads am Sender
• Aktivieren Sie am Sender die Reverse-Einstellung für die Lenkfunktion.
Fahrfunktion gegenläufig zur Bewegung des Gas-/Bremshebels am Senders
Normalerweise muss das Fahrzeug fahren, wenn der Gas-/Bremshebel am Sender zum Griff hin gezogen wird. Aktivieren Sie am Sender die Reverse-Einstellung für die Fahrfunktion.
Page 31

31
Die Lenkung funktioniert nicht oder nicht richtig, Lenkausschlag am Fahrzeug zu gering
• Falls der Sender eine Dualrate-Einstellung bietet, kontrollieren Sie diese (Bedienungsanleitung zum Sender beachten). Bei zu geringer Dualrate-Einstellung reagiert das Lenkservo nicht mehr.
Gleiches gilt für die sog. EPA-Einstellung (= „End-Point-Adjustment“, Einstellung der Endpositionen für den Servoweg
zum Schutz der Servomechanik), sofern am Sender vorhanden.
• Prüfen Sie die Lenkmechanik auf lose Teile; prüfen Sie z.B., ob der Servoarm richtig auf dem Servo befestigt ist.
• Die Lenkmechanik ist durch Schmutz oder Rost schwergängig. Reinigen und schmieren Sie die komplette Lenkmechanik.
• Der Servosaver ist zu schwach eingestellt.
Page 32

32
15. Technische Daten
Maßstab: ................................................... 1:6
Empfängerakku: ....................................... Ein 5zelliger NiMH-Akkupack (Nennspannung 6,0 V); nicht im Lieferum-
fang enthalten, muss getrennt bestellt werden
Antrieb: ..................................................... 2-Takt Verbrennungsmotor, 26 ccm, 1,18 kW / 1,6 PS
Hinterradantrieb
Kugelgelagerter Antrieb
Differenzial in der Hinterachse
Radsturz der Vorder- und Hinterachse einstellbar
Spur der Vorder- und Hinterachse einstellbar
Federung: ................................................. Einzelradaufhängung, mit Spiralfedern/Stoßdämpfer, verstellbar
Abmessungen (L x B x H): .......................750 x 445 x 270 mm
Reifen-Abmessungen (B x Ø): ................. 78 x 170 mm
Radstand: ................................................. 525 mm
Bodenfreiheit: ........................................... 55 mm
Gewicht (ohne Akkus): ............................. 10490 g
Geringe Abweichungen in Abmessungen und Gewicht sind produktionstechnisch bedingt.
Page 33

33
Table of Contents
Page
1. Introduction ...................................................................................................................................................... 34
2. Intended Use .................................................................................................................................................... 35
3. Explanation of Symbols ................................................................................................................................... 35
4. Scope of Delivery ............................................................................................................................................. 36
5. Safety Information ............................................................................................................................................ 36
a) General Information ................................................................................................................................... 37
b) Commissioning .......................................................................................................................................... 38
c) Driving the Vehicle ..................................................................................................................................... 39
6. Notes on Batteries and Rechargeable Batteries ............................................................................................. 40
7. Charging the batteries ..................................................................................................................................... 41
a) Charging Receiver Battery ........................................................................................................................ 41
b) Charging Rechargeable Batteries in the Transmitter ................................................................................ 41
8. Commissioning ................................................................................................................................................ 42
a) Removing the Car Body ............................................................................................................................ 42
b) Installing the Receiver Aerial Cable ........................................................................................................... 42
c) Inserting Receiver Battery into the Vehicle ............................................................................................... 43
d) Taking the Transmitter and Receiver System into Operation ................................................................... 43
e) Programme Fail-Safe ................................................................................................................................ 43
f) Oil Air Filter and Fuel Vehicle .................................................................................................................... 44
g) Attaching and Fastening the Car Body and Rear Wing ............................................................................44
h) Checking the Range of the Remote Control ............................................................................................. 44
i) Starting the Engine .................................................................................................................................... 45
j) Controlling the Vehicle ............................................................................................................................... 46
k) Stopping the Vehicle .................................................................................................................................. 47
9. Vehicle Settings ............................................................................................................................................... 48
a) Setting the Camber .................................................................................................................................... 48
b) Setting the Alignment................................................................................................................................. 50
c) Setting the Steering Geometry .................................................................................................................. 51
d) Setting the Shock Absorbers ..................................................................................................................... 52
e) Setting the Servo Saver ............................................................................................................................. 53
10. Motor Settings .................................................................................................................................................. 54
a) General Setting of the Carburettor ............................................................................................................ 54
b) Setting the Idle Mixture Adjustment Screw (L) .......................................................................................... 55
c) Setting the Main Nozzle Needle (H) .......................................................................................................... 55
d) Setting the Idling Mixture Speed (S) ......................................................................................................... 56
e) Recovering the Factory Settings ............................................................................................................... 56
11. Cleaning and Maintenance .............................................................................................................................. 57
12. Disposal ........................................................................................................................................................... 59
a) General Information ................................................................................................................................... 59
b) Batteries and Rechargeable Batteries ...................................................................................................... 59
13. Declaration of Conformity (DOC) ..................................................................................................................... 59
14. Troubleshooting ............................................................................................................................................... 60
15. Technical Data ................................................................................................................................................. 63
Page 34

34
1. Introduction
Dear Customer,
Thank you for purchasing this product.
This product complies with the statutory national and European requirements.
To maintain this status and to ensure safe operation, you as the user must observe these operating instructions!
These operating instructions are part of this product. They contain important notes on
commissioning and handling. Also consider this if you pass on the product to any third party.
Therefore, retain these operating instructions for reference!
All company names and product names are trademarks of their respective owners. All rights reserved.
If there are any technical questions, contact:
Tel. no.: +49 9604 / 40 88 80
Fax. no.: +49 9604 / 40 88 48
E-mail: tkb@conrad.de
Mon. to Thur. 8.00am to 4.30pm, Fri. 8.00am to 2.00pm
Page 35

35
2. Intended Use
The product is a model car with rear-wheel drive which can be radio-controlled with the enclosed wireless remote
control.
The chassis is constructed ready to drive.
This product is not a toy and not suitable for children under 14 years of age.
Observe all safety information in these operating instructions. They contain important information
on handling of the product.
3. Explanation of Symbols
The symbol with the exclamation mark points out particular dangers associated with handling, function or
operation.
The „arrow“ symbol indicates special advice and operating information.
Page 36

36
4. Scope of Delivery
• Ready-to-run vehicle, RtR
• Transmitter
• Small parts (e.g. aerial tubes for receiver aerial)
• Spark plug wrench
• Operating instructions for the vehicle
• Operating instructions for the remote control system
Required Accessories (not part of the delivery):
• 4 rechargeable or normal batteries (type mignon AA) for the transmitter
• Receiver battery (Hump pack 6 V, 1500 mAh recommended)
• Charger for transmitter and receiver battery
• Tank bottle
• Air filter oil
• Two-stroke mixture 1:25 oil/fuel mixture (with Super or Super Plus fuel)
The spare part list can be found on our website www.conrad.com in the download section for the respective
product.
Alternatively, you may also call to request the list of spare parts. For contact information, see the chapter
„Introduction“ at the beginning of these operating instructions.
5. Safety Information
In case of damage caused by non-compliance with these operating instructions, the warranty/
guarantee will expire. We do not assume any liability for consequential damage!
We do not assume any liability for damage to property or personal injury caused by improper use
or the failure to observe the safety instructions! In such cases the warranty/guarantee will expire.
Normal wear and tear during operation (e.g. worn tyres, worn gears) and damage from accidents (e.g.
broken transverse links, twisted chassis, etc.) are excluded from the guarantee and warranty.
Dear customer, these safety instructions are not only for the protection of the product but also for your own
safety and that of other people. Therefore, read this chapter very carefully before taking the product into
operation!
Page 37

37
a) General Information
Caution, important note!
Operating the model may cause damage to property and/or individuals. Therefore, make sure that you are
sufficiently insured when using the model, e.g. by taking out private liability insurance. If you already have
private liability insurance, verify whether or not operation of the model is covered by your insurance before
commissioning your model.
• For safety and licensing (CE) reasons, unauthorised conversion and/or modifications to the product are not permitted.
• This product is not a toy and not suitable for children under 14 years of age.
• The product must not become damp or wet.
• Never touch the motor and exhaust during operation! Danger of burns and injury!
• Keep the fuel locked away, store it inaccessible for children.
• Avoid contact with eyes, mucous membranes and skin. Consult a doctor immediately if you feel unwell!
• Never spill the fuel. Use a special fuel bottle to fuel the car.
• Test-runs or drives must only take place outdoors. Do not inhale the fuel and exhaust fumes; they are hazardous to
health!
• The fuel is highly combustible; the fuel vapours are highly explosive! Never smoke when handling fuels (e.g. when
fuelling up). Keep away naked flame! Danger of explosion and fire!
• Fuel must be kept in well-ventilated rooms only, away from ignition sources and in approved quantities only.
• If driving operation is permanently terminated, the fuel remaining in the model tank must be pumped out.
• Do not leave the packaging material lying around carelessly as it can become a dangerous toy for children.
• Should questions arise that are not answered by the operating manual, contact us (for contact information, see
chapter 1) or another expert.
The operation and handling of remote controlled model cars must be learned! If you have never driven
such a vehicle before, drive particularly carefully and get used to the reactions of the car to the remote
control commands first. Do be patient!
Do not take any risks when operating the product! Your own safety and that of your environment depends
completely on your responsible use of the model.
• The intended operation of the vehicle requires maintenance work or repairs from time to time. The tyres, for example,
will wear during operation, and there may be „accident damage“ due to driving errors.
Only use genuine spare parts for the maintenance and repair work you then have to perform!
Page 38

38
b) Commissioning
The manual for the remote control system is included separately. Always observe all safety information
included in it as well as any other information!
Always commission the vehicle according to the following sequence. Otherwise, unpredictable reactions of the vehicle
may result! Also observe chapter 8.
Step 1:
Switch on the transmitter if you haven’t done so already. Check its function (e.g. operation display of the transmitter).
Step 2:
Place the vehicle on an appropriate surface so that the wheels can move freely.
Connect the receiver power supply and put the on/off switch for the receiver power supply in the „ON“ position (=
switched on).
Step 3:
Before operating the vehicle, check whether the stationary model reacts as expected to the commands of the remote
control (throttle and steering servo).
Step 4:
Set the trimming for throttle/brake at the transmitter so that the brake will not catch when the lever (neutral position
of the throttle/brake lever at the transmitter) is released entirely.
Step 5:
Set the trim for steering so that the front wheels are about straight. The exact setting for straight driving can be
performed during a drive.
Step 6:
Check the throttle and steering servo for whether they run „to block“ in operation mechanically at the corresponding
full deflection at the transmitter. In this case, the servo path at the transmitter must be adjusted accordingly (see
operating instructions of the remote control).
Step 7:
Programme a failsafe function on the throttle servo (if integrated in the remote control) and check it for correct
function. If this function is not integrated into the remote control, we urgently recommend using a failsafe module
(must be purchased separately.
Page 39

39
c) Driving the Vehicle
• Improper operation may cause serious injury and property damage! Only drive with the model directly in view. This
is why you shouldn’t drive at night.
• Only drive when your ability to react is unrestricted. Exhaustion or the influence of alcohol or medication can cause
incorrect responses, just as with real vehicles.
• Please note that this model vehicle must not be driven on public roads, places or streets. Also do not operate it on
private grounds without the owner’s permission.
• Don’t drive towards animals or people!
• Do not drive in rain, through wet grass, water, mud or snow. The model is not waterproof or watertight.
• Avoid driving at very low outdoor temperatures. In the cold, the plastic of the car body and the chassis parts can
loose its elasticity; in this case, small accidents can already lead to damage to the model.
• Do not drive in the case of a thunderstorm, under high-voltage power lines or in the proximity of radio masts.
• Never touch the ignition cable or spark plug connector when the motor runs. High voltage, danger to life!
• Gear transmission is designed for off-road use. In case of permanent driving on roads, the engine may overrev.
• Leave the transmitter on while the vehicle is in operation. Always switch off the motor first to park the vehicle. Then
switch off the receiver power supply (switch to „OFF“). Now you may turn off the transmitter.
• The range of the transmitter decreases when the batteries (or rechargeable batteries) are weak. Weak batteries (or
rechargeable batteries) in the receiver system prevent powerful operation of the sensor. Before going on a drive,
check the charge condition of the batteries or rechargeable batteries in the transmitter and receiver.
Due to its size, the vehicle is equipped with a very strong steering servo. It has an increased power demand. For this
reason, a high-performance receiver current supply is required (e.g. 5-cell Hump battery pack).
Check the receiver power supply before and after each drive. If the voltage is too low, the servos will only show weak
reactions, so that the vehicle will no longer react to the control commands from the transmitter. The receiver may
also show unpredictable responses.
Terminate driving operation at once (switch off motor, switch off receiver power supply, switch off transmitter) if the
reaction of the receiver system is not as desired. Then replace the receiver power supply or recharge it.
• The motor and drive parts (e.g. exhaust, clutch) heat in operation. Wait at least 5 to 10 minutes before each new
drive.
Do not touch the motor and drive parts (exhaust, etc.) until they have cooled down. Danger of burns!
Page 40

40
6. Notes on Batteries and Rechargeable Batteries
• Keep batteries/rechargeable batteries out of the reach of children.
• Do not leave any batteries/rechargeable batteries lying around openly. There is a risk of batteries being swallowed
by children or pets. In this case, see a doctor immediately!
• Batteries/rechargeable batteries must never be short-circuited, disassembled or thrown into fire. There is a danger
of explosion!
• Leaking or damaged batteries/rechargeable batteries can cause chemical burns to skin. Wear suitable protective
gloves when handling them.
• Never recharge normal (non-rechargeable) batteries. There is a risk of fire and explosion! Only charge rechargeable
batteries intended for this purpose. Use suitable battery chargers.
• Always observe correct polarity (positive/+ and negative/-) when inserting the batteries/rechargeable batteries.
• To avoid damage during damage from leaking batteries/rechargeable batteries, remove the batteries (or rechargeable
batteries) from the transmitter when the device is not used over an extended period of time (e.g. when stored).
Disconnect the receiver battery from the receiver completely.
Recharge the rechargeable batteries about every 3 months. Otherwise, so-called deep discharge may result, rendering
the rechargeable batteries useless.
• Always replace the entire set of batteries or rechargeable batteries in the transmitter. Never mix fully charged batteries/
rechargeable batteries with partially discharged ones. Always use batteries or rechargeable batteries of the same
type and manufacturer.
• Never mix batteries and rechargeable batteries! Use batteries or rechargeable batteries for the transmitter.
• When using LiPo batteries in the vehicle, always observe the manufacturer’s information on handling or charging
LiPo batteries.
The transmitter can be operated with rechargeable instead of regular batteries.
However, the low voltage (batteries = 1.5 V, rechargeable batteries = 1.2 V) and the lower capacity of
rechargeable batteries does lead to a decrease of the operating time. Usually this does not matter, as the
operating time of the transmitter by far exceeds the operating time of the receiver batteries in the vehicle.
When using batteries in the transmitter, we recommend the use of high-quality alkaline batteries.
Page 41

41
7. Charging the Batteries
a) Charging the Receiver Battery
• For operation of the vehicle, a separate, high-performance receiver current supply is required because the power
demand is very high, particularly for the steering servo.
We recommend using a high-current-capable 5-cell NiMH hump battery pack as receiver power supply.
• Disconnect the receiver battery from the receiver before charging and remove it from the vehicle’s battery box.
• Observe the operating instructions for the charger used when charging the receiver batteries.
• Rechargeable batteries heat up when charged or discharged (driving the vehicle). Wait until the rechargeable batteries
have reached room temperature before charging them. The same applies after the charging procedure. Do not use
the rechargeable battery in the vehicle until it has cooled down completely after the charge process.
b) Charging Rechargeable Batteries in the Transmitter
Also observe the separately enclosed operating instructions for the transmitter.
Page 42

42
8. Commissioning
a) Remove Car Body
Remove the four holding clips of the over-roll bar (2 x
above the front axle; 2x left/right of the tank) and the
two clips at the sides of the rear wheels (see arrows in
figure 1).
Pull the over-roll bars from the side of the holders and
put them vertically. Lift and twist the car body so that it
can be removed from the folded-up over-roll bar.
b) Installing the Receiver Aerial Cable
First put the on/off switch for the receiver (see circle in
figure 2) in the „OFF“ position (off).
Open the receiver box (figure 2, item 1) by pulling off
the three clips.
Guide the aerial cable through the receiver box lid and
the aerial tube (see included accessories).
Route the battery connection cable of the on/off switch
out of the receiver box (also see figure 3, item 4).
After closing the receiver box, push the tube into the
holder at the top of the receiver box (see arrow in
figure 2).
Simply let excess cable protrude loosely from the tip
of the aerial tube.
For best range, the aerial cable must protrude from the vehicle vertically.
Never shorten the aerial cable! Never coil the aerial cable! This greatly reduces the range.
Figure 1
Figure 2
Page 43

43
c) Inserting Receiver Battery into the Vehicle
Due to the high current demand of the two servos, highperformance a receiver battery is required (as with a
combustion-engine model vehicle) (we recommend a
5-cell NiMH hump battery pack).
Open the battery box (figure 3, item 1) by pulling off
the three clips and insert the receiver battery (figure 3,
item 2).
Route the connection cable of the battery out of the
battery box (figure 3, item 3) and connect it to the red
two-pin BEC plug that was routed out of the receiver
box from the on/off switch (figure 3, item 4).
Close the battery box again; make sure that no cables
are bent or squeezed.
d) Taking the Transmitter and Receiver System into Operation
Open the battery compartment on the transmitter and insert new batteries or fully charged rechargeable batteries.
Observe correct polarity (plus/+ and minus/-), see label on the battery compartment. Close the battery compartment
again.
Switch on the transmitter. Check the functions at the transmitter.
Observe the enclosed operating instructions for the remote control system.
Switch on the receiver system (set switch to „ON“, see circle in figure 2).
e) Programme Fail-Safe
For reasons of safety, the motor must not run while programming the fail-safe function! Work according to
the operating instructions of the remote control to programme the fail-safe. If an external fail-safe module
is used (not included in the delivery; operational accessories), use these operating instructions. The failsafe must control the throttle/brake servo.
Switch on the transmitter and the receiver power supply and check the function of the servo. Then switch on the
transmitter.
Due to the missing control impulses, the steering servo starts to vibrate; this is normal however. (If desired, a second
failsafe (optionally available) can also move the steering servo to a defined position, e.g. for straight forward run).
Set the fail-safe so that the throttle/brake servo is in the position in which the brake is activated (max. brake output).
When the transmitter signal fails, the fail-safe now automatically sets throttle to idle and activates the brake so that the
vehicle stops.
Figure 3
Page 44

44
f) Oil Air Filter and Fuel Vehicle
Oil the air filter slightly in order to filter out dust particles. Use special air filter oil for this (not included in the delivery).
Screw on the air filter housing off of the front of the filter with the central screw and on again after oiling. Observe
correct fit of the filter and its holder.
If the air filter is not oiled, small dust particles are sucked in and lead to a strongly increased wear of the
motor. At continuous motor operation without oiled air filter, motor damage may occur; loss of warranty/
guarantee!
Open the tank lid and fill the tank with a two-stroke mixture (mixing ratio 1:25). Use only high-quality synthetic twostroke oil and Super fuel (Super Plus) for the mixture.
Two-stroke mixture with „E10“ fuel or a mixture with a lower oil share must not be used. Motor damage
threatens at non-observance; loss of guarantee/warranty!
To avoid having to remove the car body each time you fuel up the car, we recommend that you cut a
matching opening into the car body at the right position (if you have not done so yet).
g) Attaching and Fastening the Car Body and Rear Wing
Put the car body onto the supports reversed as described in chapter 8 a) and secure them each with safety clips.
Install the tail wings by pushing a sponge rubber ring and then the tail wing each at the left and right of the tail wing
holder. Secure the tail wing with two safety clips.
Your car is now ready for its first test run.
h) Checking the Range of the Remote Control
In order not to lose control over your model you should, before each first start or after a crash, check the function and
range of the RC system. For the range test, it is sufficient to check the steering servo function.
Due to the good traction of the wheels and the weight of the vehicle, the wheels would not follow your steering
commands spontaneously and directly while still on the floor. Therefore, support the model at the front axle in a way
that allows the wheels to hang freely.
Only perform the range test without the engine running!
• First switch on the transmitter (if you have not done so yet), then the receiver.
• Move approx. 50 m away from the model.
• Move the steering wheel at the transmitter (channel 1) to the right. Now the wheels must turn towards the right!.
• Move the steering wheel to the left. Now the wheels must turn towards the left.
• Release the lever of the remote control. The wheels must return to the straight position.
Never drive the model with a defective remote control!
Before driving, find the error if the reactions to the remote control during the range test are not as described.
Page 45

45
Figure 4
i) Starting the Engine
General information on combustion engines
At commissioning of the new engine, a certain run-in time must be complied with. During this time, engine
parts are tuned to one another, whereby maximal capacity is reached and premature wear is prevented.
Running in therefore needs to be performed very carefully!
Starting the engine cold
The carburettor has an integrated diaphragm pump that activates when the engine is running.
It uses the alternating over- and underpressure in the crankshaft housing to transport fuel into the carburettor.
For starting, the carburettor has a manual pump that is used to transport fuel into the carburettor. This manual pump
comprises a transparent rubber sphere (figure 4, item 1), which serves as sight glass for visual inspection of fuel
supply to the carburettor at the same time.
• Connect the choke flap (see figure 4, item 2) by
pushing the lever down.
• Actuate the manual pump (push rubber sphere
several times) until the „gauge glass“ is completely
filled up with fuel and the latter reaches the
carburettor.
• Now pull the cable pull starter through repeatedly
until you can hear the first ignition of the engine.
• Then open the choke flap again at once (lever horizontal) and pull the rope pull starter quickly until the
engine starts up. Hold the model with one hand.
Attention!
Do not pull out the cable starter all the way but only to a maximum of 3/4 of its length! Determine the rope
length by slow extension without ignition! Never pull out the cable pull starter with force!
• When the motor goes out again right after the first start-up, close the chock flap and pull the cable pull starter through
again until the motor runs again.
• Once the motor is running, release the cable pull starter and set the throttle/brake lever at the remote control transmitter
to idle.
• Open the choke valve again (lever horizontal) and let the engine warm up for about 1 to 2 minutes.
Attention!
If the choke flap remains closed for too long or too much fuel was pumped into the combustion chamber
and the crank housing, the mixture will over-fatten and the motor will flood. The cable pull starter can be
operated only with increased force. Refrain from further start attempts and remove the excess fuel (see
chapter 14) in order to prevent damaging the cable pull starter and the engine!
Figure 4, item 3 also shows the button for „Motor off“.
Page 46

46
j) Controlling the Vehicle
The following figures are only to illustrate the functions and do not necessarily correspond to the design of
the transmitter provided.
1. Release throttle/braking lever, vehicle rolls to a halt (or does not move), lever is in neutral position
2. Drive forwards, pull the throttle/brake lever towards the handle
3. Drive forwards and then brake (vehicle slows down; does not roll to a halt slowly); push throttle/brake lever away
from the handle without stopping
Move the throttle/braking lever for the drive function very cautiously and do not drive too fast at the beginning
until you get used to the reactions of the car.
Do not make any quick and jerky movements with the operating elements of the remote control.
If the vehicle tends to pull towards the left or the right, set the steering trim on the transmitter accordingly
(also see operating instructions of the remote control).
If the neutral position of the driving function is not correct (e.g. trimming slightly misadjusted), increased
idle speed of the engine may cause the clutch to drag and wear prematurely (trimming is set to the full
throttle direction) or the brake prevents rolling of the vehicle (trimming misadjusted towards brake). If you
have one of these problems, correct the trimming settings for the driving function.
The model’s two-stroke engine is air cooled. This means that the airstream has to cool down the engine
(air cooling).
This is why you should try to avoid accelerating the vehicle with frequent, strong load changes (short
throttle bursts from low rev range and jerkily lowering the revs). The short-term high speeds will strongly
heat the engine without the corresponding cooling from airstream being ensured. As a result of overheating
the engine, the piston may get stuck in the cylinder liner (piston gets stuck) and suddenly block the drive.
This could cause consequential damage to the entire drive train.
Stop driving immediately if the vehicle shows any unusual responses to the remote commands or if the
vehicle does not respond at all.
¨
¨
¨
Figure 5
Figure 6
Figure 7
Page 47

47
This conduct may be caused by a weak receiver battery or batteries/rechargeable batteries in the transmitter.
A coiled telescopic aerial, disturbances on the radio channel or frequency band used (e.g. other models,
radio transmissions from other devices), too large or a distance between the transmitter and vehicle or
adverse transmission/reception conditions could also be a cause for unusual responses of the vehicle.
After a drive, wait for at least 5 - 10 minutes until motor and the entire drive (exhaust, clutch, etc.) have
cooled down sufficiently before driving the vehicle again.
k) Stopping the Vehicle
To stop driving, proceed as follows:
• Let go of the throttle/brake lever on the transmitter so that it goes into neutral position, and let the vehicle run out.
• After the vehicle stands still, push the red button at the motor block above the cable pull starter (also see figure 4,
item 3) and switch off the motor by this.
Never touch the wheels or the drive mechanism, and make sure you do not move the throttle/brake lever
at the transmitter! Do not hold the vehicle at its wheels!
• Switch off the receiver power supply.
• Switch off the transmitter last.
Attention!
The motor and drive parts (e.g. exhaust) grow very hot in operation! Do not touch these parts immediately
after operation. Danger of burns!
Page 48

48
9. Vehicle Settings
a) Setting the Camber
The camber is the inclination of the wheel level as compared to the vertical.
Negative inclination Positive inclination
(Top wheel edge points inwards) (Top wheel edge points outwards)
The setting of the wheel is exaggerated in the two figures in order to make the difference between negative and positive cambers more obvious. The setting on the model vehicle should of course not be as
extreme as shown!
• A negative inclination of the front wheels increases the lateral cornering powers of the wheel when driving through
bends, the steering reacts more directly and steering forces are reduced. At the same time, the wheel is pushed onto
the axle leg in the direction of the axle. This balances out axial bearing clearance, the driving behaviour is calmer.
• A negative inclination of the rear wheels reduces the tendency of the rear of the vehicle to swerve in bends.
• Setting a positive camber on the other hand reduces the cornering force of the wheels and should not be used.
Setting Front Axle Camber:
For setting the camber, turn the screw (1) of the upper
transverse link.
Because this screw has a left and right hand thread at
either end, the transverse link does not need to be
dismantled for the camber to be adjusted.
Figure 8a
Figure 8b
Figure 9
Page 49

49
Setting Rear Axle Camber:
For setting the camber, turn the screw (1) of the upper
transverse link.
Because this screw has a left and right hand thread at
either end, the transverse link does not need to be
dismantled for the camber to be adjusted.
Figure 10
Page 50

50
b) Setting the Alignment
Wheel alignment (toe-in = figure „a“, toe-out = figure „b“) describes the
relation of the wheel level to the driving direction.
The tyres are pushed apart in the front by rolling friction when driving.
Therefore, they are no longer precisely parallel to the driving direction.
To compensate, the tyres of the stationary vehicle can be adjusted so
that they point slightly inwards. This toe-in improves lateral cornering of
the tyres and leads to a more direct response to steering.
If a milder response to steering is desired, this can be achieved
accordingly by adjusting a toe-out, i.e. the wheels of the stationary
vehicle point outward. An alignment angle of 0° on the front axle ensures
the best driveability on almost any ground.
An alignment angle of more than 3° toe-in (a) or toe-out (b) will lead to handling problems and decreased
speed. It will also increase tyre wear.
The figure above shows a strongly over-emphasised setting. It is only used for showing the difference
between toe-in and toe-out. If such a setting is used for the vehicle, it will be very difficult to control!
Setting the alignment:
Figure 12: Front axle Figure 13: Rear axle
¦¦
a
b
For the front axle, alignment can be set by turning the adjustment screw (1). Because the adjustment screw has a left
and right hand thread at either end, it does not need to be dismantled to be adjusted.
Turn both adjustment screws (1) evenly (left and right front wheel). Otherwise, you need to adjust the trim
of the transmitter or even correct the steering servo control (e.g. adjust servo rod or attach servo arm to the
servo differently).
Figure 11
Page 51

51
c) Adjusting the Steering Geometry
Servo defects are caused by stiff linkage or mechanical parts (e.g. by contamination or rust) as well as by asymmetrical
and therefore non-linear geometric steering settings. Therefore, you need to check the following items in your model
during driving and perform any required corrections.
These measures warrant stronger control operation that is faster under load and in particular even to the left and right.
When making settings, always observe that the servo does not run to block.
The right-angle steering levers A and A‘ must be
precisely parallel and therefore aligned at 90° to line
B. Line B is precisely at 180° (vertical) to the driving
direction.
If the front wheels are not set precisely to neutral
(straight) after correction of the steering lever position,
use track rods C and C‘ to set the neutral position of
the wheels (track).
Also observe the notes in chapter 9. b).
The servo output lever of steering servo D must be
aligned at precisely 90° of the servo housing when
the transmitter is set to the neutral position (trimming
also to 0).
If necessary, disassemble the servo lever and attach it
again offset. Light deviations can be set by trimming
the transmitter.
When the steering levers and servo output levers are set precisely as described above, the track rod E may have to be
shortened for the wheels to be set to straight driving again.
Figure 14
Page 52

52
d) Setting the Shock Absorbers
Figure 15: Front axle Figure 16: Rear axle
The spring-pre-tension at the upper end of the shock absorber can be adjusted by turning a knurled nut (1). Ensure
that the shock absorber body (2) does not turn along and is turned from the shock absorber cap (3) by this (oil loss
threatens).
The shock absorbers at the vehicle’s front and rear vehicle axles can be mounted in different positions at the lower
transverse link (5) and at the damper bridge (4). The manufacturer has, however, already chosen the best position;
therefore, only professional drivers should change these.
Always set the shock absorbers for one axle evenly (at the left and right wheels of the front or rear axle). Otherwise,
driving behaviour will be influenced negatively.
Always ensure correct attachment of the dust protection rubbers inside the springs (6).
Optional accessories (not included in the delivery; can be ordered separately) that can be used include
springs with a different stiffness or damper oil of a different viscosity for filling the shock absorbers.
Page 53

53
e) Setting the Servo Saver
The steering of the vehicle is designed as an axle leg steering.
The pivoting movement of the servo control lever affects one arm of the servo saver via the steering linkage.
The servo saver consists of two right-angled levers (1
and 2), which are not rigidly coupled but can be moved
against each other via a spring in one level with the
steering linkage.
The second lever arm of the servo saver moves the
steering plate which in turn causes the steering
deflection of both front wheels via the two track rods.
When hard shocks are transmitted from the wheels
into the steering mechanics during operation, they are
not immediately transmitted to the steering servo, but
absorbed by the resilient connection of the two lever
arms of the servo saver.
The effect of the servo saver can be adjusted with a
knurled nut (3) by modifying the spring contact pressure
on the two lever arms.
When this is set too soft, even light impacts against the wheel will cause the two servo saver arms to twist,
which will negatively influence steering accuracy and track during driving.
However, if it is set too tightly, the servo drive may be damaged because impacts against the wheels are
passed on to the wheels unfiltered.
Figure 17
Page 54

54
10. Motor Settings
The carburettor is perfectly pre-adjusted for the first runs ex works. A rich carburettor setting is used to supply the
motor sufficiently with lubrication in the run-in phase. This is shown by strong white smoke development from the
exhaust.
The rich carburettor setting should be maintained for the first 2 - 3 tank fillings. Additionally, do not use any long fullthrottle phases and run in the motor carefully with different speeds.
a) General Setting of the Carburettor
Depending on mixture used, spark plug, muffler and ambient conditions like barometric pressure and humidity, small
changes in the carburettor setting may be required. The fine settings of idle and full throttle are only possible with the
engine well run in.
L Idle mixture regulating screw
H Main nozzle needle
S Setting screw for idling speed
Figure 18
Page 55

55
b) Setting the Idle Mixture Adjustment Screw (L)
• Put the motor to operating temperature by driving.
• If the motor does not accept throttle well, the idling mixture is too lean. Turn the idle mix adjusting screw anticlockwise
(towards the left) to make the mix richer.
Adjust the setting gradually by about 1/8 turns of the idle mix adjusting screw anti-clockwise.
• If the motor only accepts throttle stuttering and under strong development of smoke, the mixture is too rich. Twisting
clockwise (to the right) makes the mixture leaner (the fuel share is reduced).
Adjust the setting gradually by about 1/8 turns of the idle mix adjusting screw clockwise.
c) Setting the Main Nozzle Needle (H)
• Lift the actuated axis from the bottom and drive the engine at operating state temperature at full throttle for a short
time.
• The full throttle mixture at the main nozzle needle can now be set in steps of 1/8 turn.
Turn the main nozzle needle clockwise if the mix should be leaner.
Anticlockwise to make the mix richer (to increase the proportion of fuel).
• For a long motor service life, prefer a slightly rich carburettor setting to set the main nozzle needle.
For this, twist the main nozzle needle (H) slowly in small steps so that the engine reaches its maximum speed briefly
after the control signal „full throttle“ and runs smoothly without stuttering.
Then turn the main nozzle needle counter-clockwise by about 1/8 turn to increase the fuel share (= rich carburettor
setting).
• After each engine running (tank filling), allow for a sufficient cooling stage (approx. 10 min).
Attention!
It is always extremely important not to make the mix too lean! Observe that the engine is lubricated by the
oil in the fuel.
Too little oil in the mix (= lean carburettor settings) will cause the engine to overheat and the piston to seize
due to defective lubrication. During operation, a slight white smoke vane should be visible from the exhaust
at all times. If not, stop the engine at once and enrich the mix. Also make sure that sufficient air circulates
around the cylinder head in order to avoid overheating. The best engine operating temperature is approx.
100 - 120°. Check the temperature with an infrared thermometer.
You can tell that the engine is run in when it can be cranked up in cold state without spark plug and without
noticeable resistance. Only now must the engine be operated at full output.
Page 56

56
d) Setting the Idling Mixture Speed (S)
• Turn the setting screw for idling speed (S) clockwise to increase the idling speed.
• Turning the setting screw counter-clockwise decreases the idling speed.
Set the idling speed with the engine still warm from operation so that the engine still runs securely. Avoid
too-high idling speed because this will cause the clutch to drag continually and speeds up wear.
e) Recovering the Factory Settings
Idle Mixture Adjustment Screw (L):
As basic setting, unscrew the idle mix adjusting screw by 1.25 rotations.
• Carefully turn the screw in without applying force until it is flush.
• Now unscrew the needle again by 1.25 rotations.
Main nozzle needle (H):
The basic setting of the main nozzle needle is 1.75 rotations.
If the main nozzle needle is turned in too firmly, both the needle and the needle seat in the carburettor may
be destroyed! Loss of guarantee/warranty!
Page 57

57
11. Cleaning and Maintenance
If you have driven the vehicle before, let all parts (e.g. motor, exhaust, etc.) cool down completely first.
Clean the whole vehicle of dust and dirt after driving, e.g. with a long-haired clean brush and a vacuum cleaner.
Compressed air aerosols can also be helpful.
Do not use cleaning aerosols or conventional household cleaners. This may damage the electronics and
lead to discolouration of the plastic parts or the body.
Never wash the vehicle with water, e.g. using a high-pressure cleaner. This will destroy the engine and the
receiver as well as the servos. The vehicle must not become damp or wet!
A soft cloth, slightly dampened, can be used to wipe the car body. Do not rub too hard to avoid scratch marks.
At appropriate intervals, you should perform maintenance work and function checks on the vehicle. This ensures
trouble-free operation and road-worthiness for a long time.
Motor vibrations and shocks during driving can loosen parts and screw fittings.
Therefore, check the following items before and after driving:
• Tight fit of wheel nuts and of all vehicle screw fittings
• Servo attachment
• Glue-connections of tyres and rims or tyre condition
• Attachment of all cables (they must not get into movable parts of the vehicle)
Also check the model for damage before each use. If you find any damage, the car may not be used
anymore and has to be taken out of operation.
Only original spare parts must be used to replace worn vehicle parts (e.g. tyres) or defective vehicle parts
(e.g. a broken transverse link).
Check, the following positions regularly after several drives:
• The air filter must be oiled, clean and undamaged to filter out even the finest dust, e.g. in a dusty environment.
• All moveable parts and parts with bearings must be lubricated with a low viscosity machine oil or spray grease after
cleaning of the model or several drives.
• Check looks and contact distance of the spark plug.
Spark plugs wear, especially in the running-in phase. Therefore, we recommend that you always keep some spark
plugs at hand for replacement.
Only use spark plugs of type „CMR 7H“! Wrong or worn spark plugs will cause the engine to run incorrectly and
impairs reconciliation. Installation and replacement of the spark plug requires a spark plug wrench (lug wrench
SW10). The ideal electrode distance of intact spark plugs is 0.7 mm.
Page 58

58
• Check the carburettor and brake linkage.
With the throttle/brake servo (1) set to neutral, the
carburettor linkage rod (2) must push slightly onto
the mechanical stop of the rudder horn via the
carburettor throttle flap.
• The brake linkage (3) must not affect the brake lever
(4) and therefore the brake yet.
• If the brake function is operated at the transmitter,
the rudder horn moves towards the arrows. The
throttle linkages are pulled even more strongly
towards the mechanical stop at the carburettor (also
see figure 18) by the installed spring. The motor
speed must not decrease. If this is the case, the front
adjustment ring must be adjusted (push towards the
carburettor).
• At the same time, the throttle lever (4) is moved and operates the brake. Brake linings are subject to wear. After a
certain operating duration, the brake effect will reduce depending on driving manner. The adjustment screw (5) can
be used to adjust the linkage until the usual brake effect is achieved again.
Figure 19
Page 59

59
12. Disposal
a) General Information
Electronic devices must not be disposed of in the domestic waste!
At the end of its service life, dispose of the product according to the relevant statutory regulations.
b) Batteries and Rechargeable Batteries
You as the end user are required by law (Battery Ordinance) to return all used batteries/rechargeable batteries. Disposing
of them in the household waste is prohibited!
Batteries and rechargeable batteries containing hazardous substances are marked with adjacent symbol
to indicate that disposal in the household waste is prohibited. The descriptions for the respective heavy
metal are: Cd=cadmium, Hg=mercury, Pb=lead (the designation is written on the battery/rechargeable
battery, e.g. under the dust bin symbol depicted at the left).
You may return used batteries/rechargeable batteries free of charge at the official collection points of your community,
in our stores, or wherever batteries/rechargeable batteries are sold.
You thus fulfil your statutory obligations and contribute to the protection of the environment.
13. Declaration of Conformity (DOC)
We, Conrad Electronic, Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau, hereby declare that this product adheres to the
fundamental requirements and other relevant regulations of the directive 1999/5/EC.
The compliance statement for this product is available at www.conrad.com.
Page 60

60
14. Troubleshooting
Even though the model and the remote control system were built according to the state of the art, there may still be
malfunctions or errors. For this reason, we would like to give you some information on how to deal with possible
problems.
The model does not respond
• For 2.4 GHz remote control systems, the receiver must be taught to the transmitter. This process may be referred to
by the terms of „Binding“ or „Pairing“. The teaching process usually was performed by the manufacturer already;
however, it can, of course, also be done by you. Also observe the separately enclosed operating instructions for the
remote control system.
• Is the receiver battery or are the batteries/rechargeable batteries in the transmitter discharged?
• Did you switch on the transmitter first and then the receiver power supply? Always observe this order!
• Is the receiver battery connected to the corresponding connection plug correctly?
• Is the vehicle too far away? With a fully charged receiver battery and fully charged batteries/rechargeable batteries
in the transmitter, the range should be 100 m and more. The range can be decreased by outside influences, such as
transmitters working on the same or an adjacent frequency, proximity to metal parts, trees, etc.
The position of transmitter and receiver aerial to each other very strongly influences range. It is best when both the
transmitter and receiver aerial are vertical. If you point the transmitter aerial at the vehicle, the range will be very
short!
• Check the correct position of the servo plugs in the receiver. If the plugs are inserted rotated by 180°, the servos will
not work.
• Are the servo and speed controller plugs connected in the right orientation? If, however, the throttle controller and
steering servo plugs are swapped, the throttle/brake lever controls the steering servo, and the wheel of the throttle
servo controls driving.
The motor does not start.
• Idling speed is set too low.
Set the neutral position on the transmitter correctly by using the trimmer for the driving function or trim towards idling
speed increase. Check the adjustment rings at the throttle linkages for correct and tight fit.
• Was the choke set for starting?
• Was the choke set too long? The engine may have been flooded.
Remove the spark plug. Carefully dry the spark plug with compressed air. Hold a cloth above the engine cylinder and
pull the cable pull starter several times to remove excessive fuel from the combustion chamber. Insert the spark plug
again and start again without choke. If the motor does not start up again after the tenth attempt, try with the choke set
again.
• Is the electrode distance of the spark plug correct (target: 0.7 mm)?
Page 61

61
• Has the spark plug been in use for a longer time or may it be worn? In doubt, check the starting attempt with a new
spark plug.
• Are all fuel lines OK? Is the manual pump used to suck off fuel?
The vehicle does not stop when the throttle/brake lever is released
• Idling speed is set too high. Set the neutral position on the transmitter correctly by using the trimmer for the driving
function arm.
• When the trimming path isn’t sufficient, adjust the idling speed screw at the carburettor.
Vehicle slows down
• The drive is blocked by leaves, branches, etc.
• The carburettor setting is too lean (engine is weak and possible overheated). Set the carburettor richer.
• The air filter insert is contaminated. This makes the carburettor setting too rich (motor stutters and does not or only
very slowly pick up speed). Clean or replace the air filter.
The steering servo shows only slight or no reaction; the range between transmitter and vehicle is very
short
• The receiver battery is weak or discharged.
• Check the batteries/rechargeable batteries in the transmitter.
The vehicle doesn’t drive in a straight line correctly
• Adjust the steering trimmer at the transmitter.
• Check the steering rods or wheel alignment setting.
• Did your car have an accident? If so, check the vehicle for any defective or broken parts and replace them.
Steering works opposite to the way the turning wheel is turned at the transmitter
• Activate the steering reverse setting at the transmitter.
Driving works opposite to the movement of the throttle/brake lever at the transmitter
Usually, the vehicle should drive forwards if you pull the throttle/brake lever at the transmitter towards the handle.
Activate the driving reverse setting at the transmitter.
Page 62

62
The steering is not functioning or is functioning incorrectly, steering lock too slight on the vehicle
• If the transmitter offers dual rate settings, check these settings (observe transmitter’s operating instructions). If the
dual rate setting is too low, the steering servo will no longer react.
The same applies for the so-called EPA setting (= „End-Point-Adjustment“, setting of the end positions for the servo
path to protect the servo mechanics) if present at the transmitter.
• Check the steering mechanics for loose parts; e.g. check if the servo arm is properly attached to the servo.
• The steering mechanics are stiff because of dirt or rust. Clean and lubricate the complete steering mechanics.
• The servo saver is set too weak.
Page 63

63
15. Technical Data
Scale: ........................................................1:6
Receiver battery: ...................................... a 5-cell NiMH battery pack (rated voltage 6.0 V); not included, must be
ordered separately
Drive: ........................................................ 2-stroke combustion engine, 26 ccm, 1.18 kW / 1.6 PS
Rear-wheel drive
ball-bearing drive
Differential in rear axle
front and rear axle camber can be set
front and rear axle track can be set
Suspension: ..............................................independent wheel suspension with spiral spring/shock-absorber, adjustable
Dimensions (L x W x H): ...........................750 x 445 x 270 mm
Tyre dimensions (W x Ø):......................... 78 x 170 mm
Wheel base:..............................................525 mm
Ground clearance: .................................... 55 mm
Weight (without rechargeable batteries): .10,490 g
Low deviations in dimensions and weight are due to production technical reasons.
Page 64

64
Table des matières
Page
1. Introduction ...................................................................................................................................................... 65
2. Utilisation conforme ......................................................................................................................................... 66
3. Explication des symboles ................................................................................................................................ 66
4. Étendue de la livraison .................................................................................................................................... 67
5. Consignes de sécurité ..................................................................................................................................... 67
a) Généralités ................................................................................................................................................. 68
b) Mise en service .......................................................................................................................................... 69
c) Conduite du véhicule ................................................................................................................................. 70
6. Remarques spécifiques aux piles et batteries ................................................................................................. 71
7. Recharge des batteries .................................................................................................................................... 72
a) Recharge de la batterie du récepteur ........................................................................................................ 72
b) Recharge des batteries dans l’émetteur ................................................................................................... 72
8. Mise en service ................................................................................................................................................ 73
a) Démontage de la carrosserie .................................................................................................................... 73
b) Pose du câble d’antenne du récepteur ..................................................................................................... 73
c) Mise en place de la batterie du récepteur dans le véhicule ...................................................................... 74
d) Mise en service de l’émetteur et de l’installation de réception .................................................................. 74
e) Programmation Failsafe ............................................................................................................................ 74
f) Graissage du filtre à air et ravitaillement en carburant du véhicule ..........................................................75
g) Mise en place de la carrosserie et de l’aile arrière .................................................................................... 75
h) Contrôle de la portée de la télécommande ............................................................................................... 75
i) Démarrage du moteur ............................................................................................................................... 76
j) Pilotage du véhicule .................................................................................................................................. 77
k) Fin de la conduite ...................................................................................................................................... 78
9. Possibilités de réglage sur le véhicule ............................................................................................................ 79
a) Réglage du déport de roue ........................................................................................................................ 79
b) Réglage de l’alignement des roues ........................................................................................................... 81
c) Réglage de la géométrie de guidage ........................................................................................................ 82
d) Réglage des amortisseurs ......................................................................................................................... 83
e) Réglage du protecteur de servo ................................................................................................................ 84
10. Réglages du moteur ........................................................................................................................................ 85
a) Réglage général du carburateur ............................................................................................................... 85
b) Réglage de la vis de régulation du mélange du ralenti (L) ....................................................................... 86
c) Réglage de l’aiguille d’injecteur principale (H) .......................................................................................... 86
d) Réglage de la vitesse de rotation du ralenti (S) ........................................................................................ 87
e) Restauration des réglages d’usine ............................................................................................................ 87
11. Nettoyage et entretien ..................................................................................................................................... 88
12. Élimination........................................................................................................................................................ 90
a) Généralités ................................................................................................................................................. 90
b) Piles et batteries ........................................................................................................................................ 90
13. Déclaration de conformité (DOC) .................................................................................................................... 90
14. Dépannage ...................................................................................................................................................... 91
15. Caractéristiques techniques ............................................................................................................................ 94
Page 65

65
1. Introduction
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour l’achat du présent produit.
Ce produit est conforme aux exigences légales, nationales et européennes.
Afin de maintenir l’appareil en bon état et d’en assurer un fonctionnement sans danger, l’utilisateur doit impérativement
respecter le présent mode d’emploi !
Le présent mode d’emploi fait partie intégrante du produit. Il contient des remarques importantes
pour la mise en service et la manipulation du produit. Tenez compte de ces remarques, même en
cas de cession de ce produit à un tiers.
Conservez le présent mode d’emploi afin de pouvoir le consulter à tout moment !
Tous les noms d’entreprises et appellations de produits contenus dans ce mode d’emploi sont des marques déposées
des propriétaires respectifs. Tous droits réservés.
Pour toute question technique, veuillez vous adresser à :
Tél. : 0892 897 777
Fax : 0892 896 002
e-mail : support@conrad.fr
Du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00
le samedi de 8h00 à 12h00
Tél. : 0848/80 12 88
Fax : 0848/80 12 89
e-mail : support@conrad.ch
Du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 17h00
Page 66

66
2. Utilisation conforme
Ce produit est un modèle réduit de voiture à traction arrière qui se pilote sans fil par liaison radio à l’aide de la
télécommande fournie.
Le châssis est assemblé et prêt à être mis en service.
Ce produit n’est pas un jouet et ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
Observez toutes les consignes de sécurité stipulées dans le présent mode d’emploi. Celles-ci
contiennent des informations importantes relatives à l’utilisation du produit.
3. Explication des symboles
Un point d’exclamation placé dans un triangle attire l’attention sur des dangers particuliers lors du
maniement, du fonctionnement et de l’utilisation.
Le symbole de la « flèche » renvoie à des conseils et consignes d’utilisation particuliers.
Page 67

67
4. Étendue de la livraison
• Véhicule assemblé prêt à être mis en service, RtR
• Émetteur
• Petits accessoires (par ex. tube d’antenne pour l’antenne du récepteur)
• Clé à bougie
• Mode d’emploi du véhicule
• Mode d’emploi de la télécommande
Accessoires requis (non fournis) :
• 4 batteries ou piles (type Mignon / AA) pour l’émetteur
• Batterie du récepteur (pack Hump 6 V, recommandation : 1 500 mAh)
• Chargeur pour la batterie de l’émetteur et du récepteur
• Flacon de remplissage de carburant
• Huile pour filtres à air
• Mélange deux temps 1:25, mélange huile / carburant (avec Super ou Super Plus)
La liste des pièces de rechange de ce produit est disponible sur notre site web www.conrad.com dans la
rubrique Téléchargement du produit correspondant.
Vous pouvez également demander cette liste par téléphone, nos coordonnées sont indiquées au début du
mode d’emploi, dans le chapitre « Introduction ».
5. Consignes de sécurité
Tout dommage résultant du non-respect du présent mode d’emploi entraîne l’annulation de la garantie légale / du fabricant. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages consécutifs !
De même, nous n’assumons aucune responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels
résultant d’une utilisation de l’appareil non conforme aux spécifications ou du non-respect des
présentes consignes de sécurité ! De tels cas entraînent l’annulation de la garantie ou garantie
légale.
La garantie ou garantie légale ne couvre pas non plus l’usure normale due au fonctionnement (par ex.
pneus ou roues dentées usés) ni les dommages causés lors d’un accident (par ex. rupture du bras transversal, voilage du châssis, etc.).
Chère cliente, cher client, ces mesures de sécurité servent non seulement à la protection du produit, mais
également à assurer votre propre sécurité et celle d’autres personnes. Veuillez donc très attentivement
lire ce chapitre avant la mise en service du produit !
Page 68

68
a) Généralités
Attention, remarque importante !
L’utilisation du modèle réduit peut occasionner des dommages matériels et / ou corporels. Veillez donc
impérativement à ce que l’utilisation du modèle réduit soit couverte par votre assurance, par ex. par une
assurance responsabilité civile. Si vous avez déjà souscrit une assurance responsabilité civile, veuillez
vous renseigner auprès de votre compagnie d’assurance si l’utilisation du modèle réduit est bien couverte
par cette assurance avant la mise en service du modèle réduit.
• Pour des raisons de sécurité et d’homologation (CE), il est interdit de transformer et / ou de modifier soi-même le
produit.
• Ce produit n’est pas un jouet et ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans.
• Le produit ne doit ni prendre l’humidité ni être mouillé.
• Pendant le fonctionnement, ne touchez jamais le moteur ou le tuyau d’échappement ! Danger de brûlures et de
blessures !
• Conservez l’essence sous clé ; stockez-la hors de portée des enfants.
• Évitez tout contact avec les yeux, les muqueuses et la peau. En cas de malaise, immédiatement consulter un
médecin !
• Ne renversez jamais de carburant. Employez un flacon spécial pour remplir le réservoir.
• Il est interdit d’effectuer des essais et de conduire en intérieur. N’inhalez pas les vapeurs de carburant ni les gaz
d’échappement, ils sont dangereux pour la santé !
• Le carburant est extrêmement inflammable, les vapeurs de carburant sont extrêmement explosives ! Ne fumez
jamais durant la manipulation de carburants (par ex. durant le ravitaillement en carburant). Ne faites pas de feu à
proximité ! Danger d’explosion et d’incendie !
• Le carburant doit uniquement être stocké en quantités autorisées dans les locaux bien aérés et loin de toute source
d’allumage.
• Lorsque le modèle réduit n’est plus utilisé durant une période prolongée, le carburant restant doit être pompé hors
du réservoir.
• Ne laissez pas traîner le matériel d’emballage. Il pourrait devenir un jouet dangereux pour les enfants.
• Au cas où vous auriez des questions auxquelles le mode d’emploi n’a pu répondre, veuillez nous contacter
(coordonnées, voir chapitre 1) ou demandez l’avis d’un autre spécialiste.
Vous devez apprendre à utiliser et à piloter les modèles réduits de voiture télécommandés ! Si vous n’avez
encore jamais piloté un tel véhicule, veuillez alors être particulièrement prudent et prenez le temps de
vous familiariser aux réactions du véhicule aux commandes de la télécommande. Soyez patient !
Ne prenez aucun risque lors de l’utilisation du produit ! Votre sécurité personnelle et celle de votre entourage
dépendent exclusivement de votre comportement responsable durant l’utilisation du modèle réduit.
• L’utilisation conforme du véhicule nécessite des travaux d’entretien occasionnels ainsi que des réparations. Les
pneus par ex. peuvent s’user pendant le fonctionnement ou un « accident » peut se produire en cas d’erreur de
conduite.
Pour les travaux d’entretien et de réparation, n’utilisez que des pièces de rechange d’origine !
Page 69

69
b) Mise en service
Le mode d’emploi de la télécommande est fourni séparément. Veuillez impérativement observer les
consignes de sécurité ainsi que toutes les autres informations qui y sont contenues !
Lors de la mise en service, procédez toujours dans l’ordre décrit ; le véhicule risquerait sinon de réagir de manière
imprévisible ! Observez également le chapitre 8.
Étape 1 :
Si cela n’est pas déjà fait, allumez l’émetteur. Assurez-vous de son fonctionnement correct (par ex. voyant de
fonctionnement de l’émetteur).
Étape 2 :
Placez le véhicule sur une surface appropriée en veillant à ce que les roues puissent tourner librement.
Raccordez l’alimentation électrique du récepteur puis commutez l’interrupteur marche / arrêt de cette dernière en
position « ON » (= connecté).
Étape 3 :
Avant d’utiliser le véhicule, assurez-vous que le modèle réduit réagisse correctement aux commandes de la
télécommande (servo d’accélération et de direction).
Étape 4 :
Réglez la compensation du levier d’accélération / de freinage sur l’émetteur en veillant à ce que le frein ne s’enclenche
pas lorsque vous relâchez complètement le levier (position neutre du levier d’accélération / de freinage sur l’émetteur).
Étape 5 :
Réglez la compensation de la direction de sorte que les roues avant soient à peu près droites. Un réglage précis
pour la conduite en ligne droite pourra être effectué plus tard, durant la conduite.
Étape 6 :
Contrôlez si le mécanisme du servo d’accélération et de direction touche la butée lorsque les leviers correspondants
sont actionnés à fond sur l’émetteur durant le fonctionnement. Le cas échéant, la course du servo doit être limitée
sur l’émetteur (voir mode d’emploi de la télécommande).
Étape 7 :
Programmez (à condition que celle-ci soit prévue sur la télécommande) une fonction Failsafe sur le servo d’accélération
puis assurez-vous de son fonctionnement correct. Si cette fonction n’est pas prévue sur la télécommande, nous
recommandons instamment l’utilisation d’un module Failsafe externe (à acheter séparément).
Page 70

70
c) Conduite du véhicule
• Une utilisation incorrecte peut provoquer de graves dommages matériels et corporels ! Veillez à toujours maintenir
un contact visuel direct de votre modèle réduit lors du pilotage. C’est pourquoi vous ne devez pas non plus piloter de
nuit.
• Utilisez uniquement le modèle réduit lorsque votre capacité de réaction n’est pas restreinte. La fatigue et la conduite
sous l’emprise d’alcool ou de médicaments peuvent fausser vos réactions, exactement comme lors de la conduite
d’une vraie voiture.
• Veuillez tenir compte du fait qu’il est interdit d’utiliser ce modèle réduit dans les rues, lieux et voies publics. Ne
l’utilisez pas non plus dans les propriétés privées sans l’autorisation du propriétaire.
• Ne le dirigez pas vers des animaux ou des personnes !
• Ne l’utilisez pas par temps de pluie, sur une pelouse mouillée, dans l’eau, la boue ou la neige. Le modèle réduit n’est
pas résistant à l’eau et n’est pas étanche.
• Évitez de conduire le modèle réduit lorsque les températures extérieures sont très basses. Par temps froid, le
plastique de la carrosserie et les éléments du châssis pourraient perdre leur élasticité et même de petits accidents
pourraient endommager le modèle réduit.
• Ne roulez pas par temps d’orage, sous des lignes haute tension ou à proximité de pylônes d’antennes.
• Pendant que le moteur tourne, ne touchez jamais le câble d’allumage ni la fiche pour bougie d’allumage. Haute
tension, danger de mort !
• Le ratio de la transmission est adapté à la conduite hors-route. En cas d’utilisation permanente sur route, il est
possible que le moteur s’emballe.
• Laissez toujours l’émetteur allumé tant que le véhicule est en marche. Pour arrêter le véhicule, éteignez toujours
d’abord le moteur. Éteignez ensuite l’alimentation électrique du récepteur (interrupteur en position « OFF »). Vous
pouvez maintenant éteindre l’émetteur.
• Si les piles (ou batteries) de l’émetteur sont faibles, sa portée diminue. Les piles (ou batteries) faibles dans l’installation
de réception empêchent un fonctionnement à pleine puissance des servos. Avant chaque trajet, contrôlez l’état de
charge des piles ou batteries dans l’émetteur et le récepteur.
En raison de sa taille, le véhicule est équipé d’un servo de direction très puissant. Sa consommation électrique est
élevée. Il est donc également indispensable d’utiliser une alimentation électrique puissante pour le récepteur (par ex.
pack de batteries Hump à 5 cellules).
Avant et après chaque trajet, contrôlez donc l’alimentation électrique du récepteur. Si la tension est trop faible, les
servos ne réagissent plus suffisamment, le véhicule ne réagit donc plus aux commandes de l’émetteur. Le récepteur
risquerait sinon de réagir de manière imprévisible.
Lorsque l’installation de réception ne fonctionne pas de la manière souhaitée, arrêtez immédiatement la conduite
(éteindre le moteur, éteindre l’alimentation électrique du récepteur, éteindre l’émetteur). Remplacez ensuite
l’alimentation électrique du récepteur ou rechargez-la.
• Le moteur tout comme les pièces de l’entraînement (par ex. pot d’échappement, embrayage) chauffent durant le
fonctionnement. Avant chaque nouveau trajet, faites une pause d’au moins 5 à 10 minutes.
Ne touchez jamais le moteur et les pièces d’entraînement (pot d’échappement, etc.) avant qu’ils aient
refroidi. Danger de brûlure !
Page 71

71
6. Remarques spécifiques aux piles et batteries
• Maintenez les piles et batteries hors de la portée des enfants.
• Ne laissez pas traîner les piles et batteries, les enfants ou les animaux domestiques risqueraient de les avaler. En tel
cas, consultez immédiatement un médecin !
• Ne court-circuitez ni ne démontez jamais les piles et batteries et ne les jetez jamais dans le feu. Il y a danger
d’explosion !
• En cas de contact avec la peau, les piles / batteries qui fuient ou sont endommagées peuvent entraîner des brûlures
à l’acide. En tel cas, veuillez donc utiliser des gants de protection appropriés.
• Les piles traditionnelles (non rechargeables) ne doivent jamais être rechargées. Il y a danger d’incendie et d’explosion !
Ne rechargez que les batteries prévues à cet effet ; n’utilisez que des chargeurs de batteries appropriés.
• Lors de l’insertion des piles ou batteries, respectez la polarité (ne pas inverser plus / + et moins / -).
• Si vous n’utilisez pas l’appareil pendant une période prolongée (par ex. en cas de stockage), retirez les piles (ou
batteries) de l’émetteur. Elles risqueraient sinon d’endommager l’appareil en cas de fuite. Débranchez complètement
la batterie du récepteur.
Rechargez les batteries environ tous les 3 mois. Le cas contraire, l’autodécharge risquerait de provoquer une décharge
dite totale et les batteries deviendraient inutilisables.
• Remplacez toujours le jeu entier de piles ou batteries de l’émetteur. Ne mélangez pas les piles / batteries pleines
avec des piles / batteries à moitié pleines. N’utilisez que des piles ou batteries du même type et du même fabricant.
• Ne mélangez jamais piles et batteries ! Pour l’émetteur, utilisez soit des piles soit des batteries.
• Si vous utilisez des batteries LiPo dans le véhicule, observez absolument les informations du fabricant concernant
la manipulation et la recharge des batteries LiPo.
L’émetteur fonctionne aussi bien avec des batteries qu’avec des piles.
La tension (piles = 1,5 V, batteries = 1,2 V) et la capacité inférieures des batteries réduisent la durée de
fonctionnement du modèle réduit. En temps normal, cela ne joue toutefois aucun rôle puisque l’autonomie
de l’émetteur est nettement supérieure à celle de la batterie du récepteur installée dans le véhicule.
Si vous souhaitez insérer des piles dans l’émetteur, nous vous recommandons d’utiliser des piles alcalines
de haute qualité.
Page 72

72
7. Recharge des batteries
a) Recharge de la batterie du récepteur
• Comme la consommation électrique, notamment du servo de direction, est très élevée, le véhicule nécessite une
puissante alimentation électrique externe pour le récepteur.
Nous recommandons d’utiliser un pack Hump de batteries NiMH à 5 cellules à courant fort pour l’alimentation
électrique du récepteur.
• Avant le cycle de charge, débranchez la batterie du récepteur du récepteur et retirez-la du logement des batteries du
véhicule.
• Pour recharger la batterie du récepteur, observez les informations contenues dans le mode d’emploi de votre chargeur.
• Les batteries chauffent pendant la charge et la décharge (durant la conduite du véhicule). Avant de recharger les
batteries, attendez toujours qu’elles aient refroidi à température ambiante. Il en va de même après le cycle de
charge ; attendez que la batterie ait complètement refroidi avant de l’insérer dans le véhicule.
b) Recharge des batteries dans l’émetteur
À ce propos, observez le mode d’emploi fourni avec l’émetteur.
Page 73

73
8. Mise en service
a) Démontage de la carrosserie
Retirez les quatre clips de retenue de l’arceau de
sécurité (2 clips au-dessus de l’essieu avant ; 2 clips
à gauche et à droite du réservoir) ainsi que les deux
clips sur le côté près des roues arrière (voir flèches
sur la figure 1).
Tirez les arceaux de sécurité latéralement hors des
supports puis positionnez les arceaux à la verticale.
Tournez et orientez la carrosserie de manière à pouvoir
la retirer à travers les arceaux de sécurité relevés.
b) Pose du câble d’antenne du récepteur
Commutez d’abord l’interrupteur marche / arrêt du
récepteur (voir cercle sur la figure 2) en position
« OFF » (déconnecté).
Ouvrez le compartiment du récepteur (figure 2, n° 1)
en retirant les trois clips.
Faites passer le câble d’antenne à travers le couvercle
du compartiment du récepteur et à travers le tube
d’antenne (voir accessoires fournis).
Faites également passer le câble de raccordement de
la batterie de l’interrupteur marche / arrêt hors du
compartiment du récepteur (voir également figure 3,
n° 4).
Après avoir fermé le compartiment du récepteur,
enfichez le tube dans le support sur le haut du
compartiment du récepteur (voir flèche sur la figure 2).
Laissez simplement pendre l’excédent de câble d’antenne de l’extrémité supérieure du tube d’antenne.
Afin de garantir une portée optimale, le câble d’antenne doit dépasser à la verticale du véhicule.
Ne raccourcissez jamais le câble d’antenne ! N’enroulez jamais le câble d’antenne ! Cela réduirait
considérablement sa portée.
Figure 1
Figure 2
Page 74

74
c) Mise en place de la batterie du récepteur dans le véhicule
En raison de la consommation électrique élevée des
deux servos, une batterie puissante est requise pour
le récepteur (nous recommandons un pack Hump de
batteries NiMH à 5 cellules).
Ouvrez le boîtier des batteries (figure 3, n° 1) en retirant
les trois clips puis insérez la batterie du récepteur
(figure 3, n° 2).
Faites passer le câble de raccordement de la batterie
hors du boîtier des batteries (figure 3, n° 3) puis
raccordez-le à la fiche bipolaire BEC rouge, qui sort
de l’interrupteur marche / arrêt du boîtier des batteries
(figure 3, n° 4).
Refermez le boîtier des batteries en veillant à ne pas
couder ni écraser les câbles.
d) Mise en service de l’émetteur et de l’installation de réception
Ouvrez le logement des piles de l’émetteur puis insérez-y les batteries neuves ou des batteries complètement
rechargées. Respectez la polarité (ne pas inverser plus / + et moins / -), voir inscription dans le logement des piles.
Refermez le logement des piles.
Allumez l’émetteur. Assurez-vous du fonctionnement correct de l’émetteur.
Observez le mode d’emploi fourni avec la télécommande.
Allumez l’installation de réception (interrupteur en position « ON », voir cercle sur la figure 2).
e) Programmation Failsafe
Pour des raisons de sécurité, le moteur ne doit pas tourner pendant la programmation de la fonction
Failsafe ! Pour la programmation du Failsafe, observez le mode d’emploi de la télécommande. En cas
d’utilisation d’un module Failsafe externe (non fourni ; accessoire en option), employez ce mode d’emploi.
Le Failsafe doit piloter le servo d’accélération / de freinage.
Allumez l’émetteur et l’alimentation électrique du récepteur puis contrôlez le fonctionnement des servos. Éteignez
ensuite l’émetteur.
L’absence d’impulsions de commande peut provoquer des vibrations au niveau du servo de direction, cela est toutefois
normal (si vous le souhaitez, le servo de direction pourrait également se déplacer dans une position définie, par ex.
pour la conduite en ligne droite, en utilisant un second module Failsafe disponible en option).
Réglez le Failsafe de manière à placer le servo de gaz / de frein dans la position dans laquelle le frein sera activé
(puissance de freinage maximale). En cas de défaillance du signal de l’émetteur, le Failsafe régule automatiquement
l’accélération au ralenti et active le frein de manière à arrêter le véhicule.
Figure 3
Page 75

75
f) Graissage du filtre à air et ravitaillement en carburant du véhicule
Lubrifiez légèrement le filtre à air afin de filtrer également les plus petites particules de poussière. Pour ce faire,
employez une huile spéciale pour filtre à air (non fournie). Dévissez le boîtier du filtre à air en retirant la vis centrale à
l’avant du filtre puis revissez-le après le graissage. Assurez-vous ici que le filtre et son support soient correctement
fixés.
Si le filtre à air n’est pas graissé, l’aspiration des petites particules de poussière accélère l’usure du moteur.
Une utilisation prolongée du moteur sans graissage du filtre à air peut endommager le moteur, perte de la
garantie ou garantie légale !
Ouvrez le bouchon du réservoir puis remplissez le réservoir avec un mélange à deux temps (rapport de mélange
1:25). Pour le mélange, employez uniquement une huile synthétique à deux temps haut de gamme et du carburant
Super (ou Super Plus).
Il est interdit d’employer un mélange à deux temps avec carburant « E10 » ou un mélange avec une
teneur en huile réduite. En cas de non-respect, il y a danger de grave détérioration du moteur ; perte de la
garantie ou garantie légale !
Pour ne pas devoir toujours démonter la carrosserie avant de faire le plein du véhicule, nous recommandons
(si cela n’est pas déjà fait) de découper un orifice adéquat dans la carrosserie.
g) Mise en place de la carrosserie et de l’aile arrière
Installez la carrosserie sur les supports en effectuant les étapes décrites dans le chapitre 8 a) dans l’ordre inverse puis
fixez-la à l’aide des clips de sécurité.
Montez puis emboîtez l’aile arrière en insérant respectivement une bague en caoutchouc à gauche et à droite du
support de l’aile arrière. Fixez l’aile arrière à l’aide de deux clips de sécurité.
Votre véhicule est maintenant opérationnel pour la première marche d’essai.
h) Contrôle de la portée de la télécommande
Pour ne pas perdre le contrôle du modèle réduit, vous devez vérifier le fonctionnement et la portée de l’installation RC
avant tout premier démarrage et après un accident. Pour vérifier la portée, il suffit de tester le fonctionnement du servo
de direction.
Grâce à la bonne adhérence à la route des pneus et grâce au poids du modèle, les roues à l’arrêt et en contact avec
le sol ne réagiraient pas immédiatement à un actionnement de la direction. Pour cette raison, soutenez l’essieu avant
du modèle réduit de manière à ce que les roues ne touchent plus le sol et puissent tourner librement.
Réalisez uniquement le test de la portée lorsque le moteur ne tourne pas !
• Allumez (s’il n’est pas déjà allumé) d’abord l’émetteur, puis le récepteur.
• Éloignez-vous env. 50 m du modèle réduit.
• Tournez le volant (canal 1) sur l’émetteur vers la droite. Les roues doivent maintenant être braquées vers la droite.
• Tournez maintenant le volant vers la gauche. Les roues doivent maintenant être braquées vers la gauche.
Page 76

76
Figure 4
• Relâchez le levier de la télécommande. Les roues doivent maintenant se remettre en alignement droit.
Ne conduisez jamais le modèle réduit avec une télécommande défectueuse !
Avant chaque trajet, recherchez d’abord l’erreur si la télécommande ne réagit pas comme prévu durant el
test de la portée.
i) Démarrage du moteur
Généralités à propos du moteur à combustion
Lors de la mise en service du nouveau moteur, il convient d’observer une phase de rodage. Pendant la
phase de rodage, les pièces du moteur s’ajustent parfaitement, permettant d’atteindre la puissance maximale et d’éviter une usure prématurée.
La phase de rodage est donc très importante !
Démarrer le moteur à froid
Le carburateur est équipé d’une pompe à membrane intégrée qui démarre dès que le moteur tourne.
Cette pompe exploite l’alternance des surpressions et dépressions à l’intérieur du carter du vilebrequin afin de refouler
le carburant dans le carburateur.
Pour le démarrage, le carburateur dispose d’une pompe manuelle à l’aide de laquelle le carburant est refoulé dans le
carburateur. Cette pompe manuelle se compose d’une calotte en caoutchouc transparente (figure 4, n° 1), qui sert en
même temps de verre de regard pour le contrôle visuel de l’alimentation en carburant vers le carburateur.
• Fermez l’étrangleur (voir figure 4, n° 2) en déplaçant
le levier vers le bas.
• Actionnez la pompe manuelle (appuyez plusieurs fois
sur la calotte en caoutchouc) jusqu’à ce que le verre
de regard soit entièrement rempli de carburant et
que le carburant arrive dans le carburateur.
• Tirez plusieurs fois sur le démarreur par câble jusqu’à
ce que le premier allumage du moteur soit audible.
• Ouvrez ensuite à nouveau l’étrangleur (levier en
position horizontale) puis tirez vigoureusement le
démarreur par câble jusqu’à ce que le moteur
démarre. Tenez ici fermement le modèle à une main.
Attention !
Ne tirez pas à fond le démarreur par câble, mais seulement aux 3/4 de sa longueur ! Déterminez la
longueur du démarreur par câble en le tirant lentement, sans allumage ! Ne forcez jamais le démarreur
par câble !
• Si le moteur s’arrête immédiatement après le premier allumage, fermez l’étrangleur puis tirez encore une fois le
démarreur à câble jusqu’à ce que le moteur redémarre.
• Lorsque le moteur tourne, relâchez le démarreur par câble puis réglez le levier d’accélération / de freinage en
position Ralenti sur l’émetteur de la télécommande.
Page 77

77
• Ouvrez à nouveau l’étrangleur (levier en position horizontale) et laissez tourner le moteur pendant env. 1 à 2 minutes.
Attention !
Si l’étrangleur reste fermé trop longtemps ou si trop de carburant est refoulé dans la chambre de combustion
et le carter de vilebrequin, le mélange est trop riche et le moteur s’étouffe. Le démarreur par câble ne peut
alors être actionné qu’au moyen d’une grande dépense d’énergie physique. N’effectuez pas de nouvelle
tentative de démarrage et évacuez l’excédent de carburant (voir chapitre 14) afin d’éviter toute détérioration
du démarreur par câble et du moteur !
La figure 4, n° 3, montre également le bouton-poussoir « Arrêt moteur ».
j) Pilotage du véhicule
Les figures ci-après ne sont destinées qu’à l’illustration des fonctions, elles ne correspondent pas forcément
au modèle de l’émetteur fourni.
1. Levier d’accélération / de freinage relâché, le véhicule ralentit (ou ne se déplace plus), le levier est en position
neutre
2. Rouler en marche avant, pousser lentement le levier d’accélération / de freinage en direction de la poignée
3. Rouler en marche avant puis freiner (le véhicule freine, il ne ralentit pas), repousser le levier d’accélération / de
freinage de la poignée sans pause
Déplacez le levier d’accélération / de freinage pour la fonction de conduite avec beaucoup de précaution
et ne conduisez pas trop vite au début jusqu’à ce que vous soyez familiarisé avec les réactions du véhicule
aux commandes.
Ne déplacez pas les éléments de commande de l’émetteur avec des mouvements rapides et saccadés.
Si le véhicule se déporte vers la gauche ou vers la droite, réglez le compensateur de la direction sur
l’émetteur en conséquence (voir également mode d’emploi de la télécommande).
Si la position neutre de la fonction de conduite est incorrecte (par ex. léger déréglage du compensateur),
l’embrayage peut patiner et subir une usure prématurée en raison de la vitesse de rotation accrue au
ralenti (le compensateur se trouve en position Plein gaz) ou le frein empêche le roulement du véhicule
(compensateur déréglé vers le frein). Si vous rencontrez l’un de ces problèmes, corrigez le réglage du
compensateur pour la fonction de conduite.
¨
¨
¨
Figure 5
Figure 6
Figure 7
Page 78

78
Le moteur à deux temps du modèle réduit est refroidi par air. Cela signifie que le vent relatif doit prendre
en charge le refroidissement du moteur (refroidissement par vent relatif).
Pour cette raison, évitez, dans la mesure du possible, d’accélérer le véhicule par une alternance fréquente
et forte de l’effort (brèves accélérations à bas régime puis réduction brusque de la vitesse de rotation).
L’augmentation brève du régime provoque une surchauffe du moteur sans que ce dernier ne puisse
suffisamment être refroidi par le vent relatif. Une surchauffe du moteur pourrait provoquer le grippage des
pistons dans la chemise de piston (bielle coulée) et un blocage brusque de l’entraînement. Cela peut
endommager toute la chaîne de transmission.
Interrompez immédiatement la conduite si vous observez des réactions inhabituelles du véhicule quant
aux commandes sur l’émetteur ou si le véhicule ne réagit plus.
Ce phénomène peut s’expliquer par une faible capacité de la batterie du récepteur ou des piles / batteries
dans l’émetteur.
De même, une antenne du récepteur enroulée, des perturbations sur le canal radio ou la gamme de
fréquences employée (par ex. autres modèles réduits, transmissions radio d’autres appareils), une distance
trop élevée entre l’émetteur et le véhicule ou des conditions défavorables d’émission / de réception peuvent
être à l’origine de réactions inhabituelles du véhicule.
Après chaque trajet, attendez impérativement au moins 5 à 10 minutes jusqu’à ce que le moteur et toutes
les pièces de l’entraînement (pot d’échappement, embrayage, etc.) aient suffisamment refroidi avant de
remettre le véhicule en marche.
k) Fin de la conduite
Pour arrêter la conduite, procédez de la manière suivante :
• Relâchez le levier d’accélération / de freinage sur l’émetteur de sorte qu’il soit en position neutre et laissez le véhicule
rouler par inertie.
• Lorsque le véhicule est immobile, actionnez le bouton-poussoir rouge sur le bloc-moteur au-dessus du démarreur
par câble (voir également figure 4, n° 3) et éteignez ainsi le moteur.
Ne touchez pas les roues ni l’entraînement et ne bougez en aucun cas le levier d’accélération / de freinage de l’émetteur ! Ne retenez pas le véhicule par les roues !
• Éteignez l’alimentation électrique du récepteur.
• Éteignez l’émetteur en dernier.
Attention !
Le moteur et les pièces de l’entraînement (par ex. pot d’échappement) chauffent énormément durant le
fonctionnement ! Ne touchez donc jamais ces pièces immédiatement après la conduite, il y a danger de
brûlure !
Page 79

79
9. Possibilités de réglage sur le véhicule
a) Réglage du déport de roue
Le déport de roue désigne l’inclinaison du niveau de la roue par rapport à la perpendiculaire.
Déport négatif Déport positif
(les bords supérieurs de la roue (les bords supérieurs de la roue
sont tournés vers l’intérieur) sont tournés vers l’extérieur)
Le réglage des roues est exagéré sur les deux figures ci-dessus pour mieux vous montrer la différence
entre le déport négatif et le déport positif. Pour le réglage du modèle réduit, il ne faut naturellement pas
effectuer de réglage aussi extrême !
• Un déport de roue négatif des roues avant augmente les efforts de guidage latéraux des roues dans les virages, la
direction réagit plus directement, les efforts de direction sont moindres. En même temps, la roue est pressée en
direction de l’essieu sur la fusée d’essieu. Cela permet de compenser le jeu de palier axial, la conduite est plus
douce.
• Un déport négatif des roues arrière réduit l’inclinaison de l’arrière du véhicule et le risque de dérapage dans les
virages.
• Le réglage d’un déport positif réduit en revanche les efforts de guidage latéraux des pneus et ne doit donc pas être
utilisé.
Réglage du déport de roue sur l’essieu avant :
Le déport de roue se règle en tournant la vis (1) du
bras transversal supérieur.
Comme la vis a un filetage à gauche et à droite, vous
ne devez pas démonter le bras transversal pour régler
le déport de roue.
Figure 8a
Figure 8b
Figure 9
Page 80

80
Réglage du déport de roue sur l’essieu arrière :
Le déport de roue se règle en tournant la vis (1) du
bras transversal supérieur.
Comme la vis a un filetage à gauche et à droite, vous
ne devez pas démonter le bras transversal pour régler
le déport de roue.
Figure 10
Page 81

81
b) Réglage de l’alignement des roues
L’alignement des roues (pincement = figure « a », ouverture = figure
« b ») désigne la position du plan de roue par rapport au sens de la
marche.
Pendant la conduite, les roues sont écartées à l’avant par la résistance
au roulement et ne sont donc plus exactement parallèles au sens de
marche. Pour la compensation, les roues du véhicule immobilisé
peuvent être ajustées de sorte à être, à l’avant, légèrement dirigées
vers l’intérieur. Ce pincement entraîne en même temps une amélioration
du guidage latéral du pneu et, par conséquent, une réaction plus directe
de la direction.
Si vous désirez une réaction plus douce de la direction, vous pouvez
l’obtenir en réglant l’ouverture des roues, cela signifie que les roues du
véhicule à l’arrêt sont tournées vers l’extérieur. Un angle d’alignement
de 0° sur l’essieu avant garantit une conduite optimale sur la quasitotalité des terrains.
Un angle de plus de 3° de pincement (a) ou d’ouverture (b) entraîne des problèmes de manipulation du
véhicule, réduit la vitesse et augmente alors l’usure des pneus.
La figure ci-dessus illustre un réglage fortement surentraîné, qui sert uniquement à souligner la différence
entre pincement et ouverture. Si un tel réglage est sélectionné pour le véhicule, celui-ci est alors très
difficile à diriger !
Réglage de l’alignement des roues :
Figure 12 : essieu avant Figure 13 : essieu arrière
¦¦
a
b
Le pincement ou l’ouverture sur l’essieu avant se règlent en tournant la vis de réglage (1). Comme la vis de réglage a
un filetage à gauche et à droite, elle ne doit pas être démontée pour le réglage.
Tournez toujours de la même manière les deux vis de réglage (1) (roues avant gauche et droite), car vous
devez, le cas échéant, régler la compensation sur l’émetteur ou modifier la commande via le servo de
direction (par ex. régler la tige de servo ou installer différemment le bras sur le servo).
Figure 11
Page 82

82
c) Réglage de la géométrie de guidage
Les dysfonctionnements des servos sont provoqués par des articulations ou mécanismes grippés (par ex. en présence
de saleté ou de rouille) tout comme par des réglages géométriques asymétriques, et donc non linéaires, de la direction.
Il est donc indispensable de contrôler les points suivants avant chaque utilisation de votre modèle réduit et, le cas
échéant, de réaliser les corrections nécessaires.
Ces mesures garantissent une activation de la direction plus puissante, plus rapide à charge, mais surtout homogène
à gauche et à droite. Lors du réglage, veillez impérativement à ce que le servo ne soit pas actionné à fond.
Les leviers de direction perpendiculaires A et A’ doivent
être parfaitement parallèles et ainsi former un angle
droit par rapport à la ligne B. L’angle de la ligne B par
rapport au sens de marche s’élève exactement à 180°
(sens transversal).
Si les roues avant ne se trouvent pas exactement en
position neutre (droite) après la correction de la position
du levier de direction, vous devez régler la position
neutre des roues (alignement des roues) à l’aide des
barres d’accouplement C et C’.
À ce propos, observez également les remarques dans
le chapitre 9. b).
En position neutre sur l’émetteur (compensateur
également sur 0), le palonnier du servo de direction D
doit exactement former un angle droit par rapport au
boîtier du servo.
Le cas échéant, démontez le levier du servo puis remontez-le en le décalant. Les écarts mineurs peuvent être ajustés
à l’aide du compensateur sur l’émetteur.
Si les leviers de direction et le palonnier de servo sont réglés avec précision de la manière décrite plus haut, la bielle
de commande E doit éventuellement encore être raccourcie afin que les roues soient à nouveau droites.
Figure 14
Page 83

83
d) Réglage des amortisseurs
Figure 15 : essieu avant Figure 16 : essieu arrière
La précontrainte des ressorts se règle en tournant un écrou moleté (1) sur l’extrémité supérieure de l’amortisseur.
Veillez alors à ce que le corps de l’amortisseur (2) ne soit pas entraîné et se dévisse ainsi du capuchon de l’amortisseur
(3) (en tel cas, risque de fuite d’huile).
Les amortisseurs sur l’essieu avant et sur l’essieu arrière du véhicule peuvent être montés dans différentes positions
sur le pont amortisseur (4) et sur le bras transversal inférieur (5). Le fabricant a déjà choisi une position optimale, les
modifications sont uniquement réservées aux modélistes professionnels.
Réglez toujours les amortisseurs d’un essieu de la même manière (sur la roue gauche et droite de l’essieu avant ou de
l’essieu arrière) ou le comportement de conduite sera alors influencé négativement.
Assurez-vous également toujours de la fixation correcte des caoutchoucs de protection contre la poussière à l’intérieur
des ressorts (6).
Vous pouvez utiliser comme accessoire en option (non fourni, à acheter séparément) des ressorts avec un
degré de dureté différent ou remplir les amortisseurs d’une huile de viscosité différente.
Page 84

84
e) Réglage du protecteur de servo
La direction du véhicule est conçue sous forme d’une direction à fusée.
Le pivotement du levier de servocommande agit sur le bras du protecteur de servo gauche via la timonerie de direction.
Le protecteur du servo se compose de deux leviers (1
et 2) disposés perpendiculairement l’un par rapport à
l’autre, qui ne sont pas rigidement reliés entre eux. Un
ressort leur permet de se déplacer l’un vers l’autre au
même niveau que la timonerie de direction.
Le deuxième bras de levier du protecteur de servo
déplace la plaque de direction et influence ainsi l’angle
de braquage des deux roues avant via les deux leviers
de la barre d’accouplement.
En cas de transmission de chocs importants sur le
mécanisme de direction via les roues durant la
conduite, ces chocs ne sont pas directement retransmis
au servo de direction, mais sont amortis par
l’articulation à ressort des deux leviers du protecteur
de servo.
L’effet du protecteur de servo se règle au moyen d’un écrou moleté (3) en modifiant la force de compression des
ressorts exercée sur les deux bras de levier.
Si le réglage est trop souple, les chocs légers contre la roue peuvent tordre les deux bras de la protection
de servo, influençant ainsi la précision de la direction et l’alignement durant la conduite de manière négative.
Un réglage trop rigide peut, en revanche, endommager l’engrenage servo étant donné que les chocs
contre les roues sont transmis sans filtre au servo.
Figure 17
Page 85

85
10. Réglages du moteur
Le carburateur est préréglé en usine de manière optimale pour les premiers trajets. Un réglage riche est employé pour
le carburateur afin de garantir un graissage suffisant du moteur durant la phase de rodage. Cela est indiqué par un
dégagement important de fumée blanche par le pot d’échappement.
Conserver le réglage riche du carburateur pour les 2 ou 3 premiers pleins. Évitez également de trop longues phases
à plein régime et rodez le moteur en douceur à différentes vitesses de rotation.
a) Réglage général du carburateur
En fonction du mélange, de la bougie d’allumage, des amortisseurs utilisés et des conditions ambiantes, comme la
pression atmosphérique et l’humidité de l’air, il peut s’avérer nécessaire de légèrement modifier le réglage du carburateur.
Le réglage précis du ralenti et du plein régime ne peut être entrepris qu’après la phase de rodage du moteur.
L Vis de régulation du mélange du ralenti
H Aiguille d’injecteur principale
S Vis de réglage pour le ralenti
Figure 18
Page 86

86
b) Réglage de la vis de régulation du mélange du ralenti (L)
• Faites tourner le moteur jusqu’à ce qu’il atteigne sa température de service.
• Si le moteur ne réagit pas correctement lorsque vous accélérez, le mélange du ralenti est trop maigre. Une rotation
de la vis de régulation du mélange du ralenti dans le sens antihoraire (vers la gauche) permet d’enrichir le mélange.
Corrigez progressivement le réglage en tournant la vis de régulation du mélange du ralenti respectivement d’env.
1/8 de tour vers la gauche.
• Si le moteur n’admet les gaz qu’en hoquetant et en dégageant beaucoup de fumée, le mélange est trop gras. Une
rotation de la vis de régulation du mélange du ralenti dans le sens horaire (vers la droite) amaigrit le mélange (la
teneur en carburant est réduite).
Corrigez le réglage de la vis de régulation du mélange du ralenti en la tournant progressivement d’env. 1/8 de tour
vers la droite.
c) Réglage de l’aiguille d’injecteur principale (H)
• Soulevez l’essieu arrière entraîné du sol et faites brièvement tourner à plein régime le moteur lorsqu’il a atteint sa
température de service.
• Vous pouvez maintenant progressivement corriger le réglage du mélange à plein régime sur l’aiguille d’injecteur
principale par 1/8 de tour.
Tournez l’aiguille d’injecteur principale dans le sens horaire pour amaigrir le mélange.
Tournez l’aiguille d’injecteur principale dans le sens antihoraire pour enrichir le mélange (augmenter la teneur en
carburant).
• Afin de garantir une longue durée de vie du moteur, choisissez, de préférence, un réglage légèrement riche du
carburateur pour le réglage de l’aiguille d’injecteur principale.
Pour ce faire, tournez lentement l’aiguille d’injecteur principale (H) jusqu’à ce que le moteur atteigne sa vitesse de
rotation maximale juste après le signal de commande « Plein régime » et qu’il tourne correctement, sans à-coups.
Tournez ensuite l’aiguille d’injecteur principale d’1/8 de tour dans le sens antihoraire pour augmenter la teneur en
carburant (= réglage riche du carburateur).
• Après chaque utilisation du moteur (plein de carburant), une phase de refroidissement suffisamment longue est
nécessaire (env. 10 min).
Attention !
Il est essentiel que le mélange ne soit jamais trop maigre ! Prenez en considération le fait que le moteur
est lubrifié par l’huile contenue dans le carburant.
Une teneur trop faible en carburant dans le mélange (= réglage maigre du carburateur) provoque une
surchauffe du moteur et un grippage du piston en raison du graissage insuffisant. Pendant le fonctionnement,
il doit toujours y avoir un faible dégagement de fumée blanche par le pot d’échappement. Si ce n’est pas
le cas, arrêtez immédiatement le moteur et enrichissez le mélange. Veillez également à ce que la culasse
de cylindre soit suffisamment ventilée pour éviter sa surchauffe. La température de service optimale du
moteur est d’env. 100 - 120 °C. Contrôlez la température avec un thermomètre à infrarouge.
Le moteur est rodé si vous parvenez à le faire rouler à froid et sans bougie d’allumage et sans résistance
sensible. C’est seulement à partir de maintenant que le moteur peut être exploité à pleine puissance.
Page 87

87
d) Réglage de la vitesse de rotation du ralenti (S)
• Tournez la vis de réglage pour le ralenti (S) dans le sens horaire afin d’augmenter la vitesse de rotation au ralenti.
• La rotation de la vis de réglage dans le sens antihoraire réduit la vitesse de rotation au ralenti.
Lorsque le moteur a atteint sa température de service, ajustez la vitesse de rotation au ralenti en veillant
à ce que le moteur tourne encore correctement. Évitez un ralenti trop élevé, l’embrayage patinerait sinon
en permanence et serait ainsi soumis à une usure prématurée.
e) Restauration des réglages d’usine
Vis de régulation du mélange du ralenti (L) :
Comme réglage de base, il est conseillé de dévisser la vis de réglage du mélange de ralenti de 1,25 tours.
• Vissez avec précaution complètement la vis sans forcer jusqu’à ce qu’elle affleure.
• Dévissez maintenant l’aiguille de 1,25 tours.
Aiguille d’injecteur principale (H) :
Le réglage de base de l’aiguille d’injecteur principale correspond à 1,75 tours.
Si vous vissez trop fermement l’aiguille d’injecteur principale, vous risquez de détruire l’aiguille ainsi que
son logement à l’intérieur du carburateur ! Perte de la garantie ou garantie légale !
Page 88

88
11. Nettoyage et entretien
Si vous avez utilisé le véhicule auparavant, attendez d’abord que toutes les pièces aient complètement
refroidi (par ex. moteur, pot d’échappement, etc.).
Après chaque trajet, éliminez complètement la poussière et la saleté de tout le véhicule. Employez par ex. un pinceau
propre à poils longs et un aspirateur. Les bombes d’air comprimé peuvent également s’avérer utiles.
N’utilisez pas de sprays de nettoyage ou de détergents ménagers traditionnels. Ceux-ci risqueraient
d’endommager l’électronique et pourraient décolorer les pièces en plastique ou les pièces de la carrosserie.
Ne lavez jamais le véhicule à l’eau, par ex. avec un nettoyeur haute pression. Cela détruirait le moteur
ainsi que le récepteur et les servos. Le véhicule ne doit ni prendre l’humidité ni être mouillé !
Pour nettoyer la carrosserie, utiliser un chiffon doux, légèrement humide. Ne frottez pas trop fort afin de ne pas rayer
la carrosserie.
Des travaux d’entretien et des contrôles du fonctionnement doivent être effectués sur le modèle réduit à intervalles
réguliers afin de garantir une mise en service et un fonctionnement irréprochables.
Les vibrations du moteur et les chocs pendant la conduite peuvent provoquer le dévissage des pièces et des raccords
à vis.
Contrôlez les points suivants avant et après chaque conduite :
• Position fixe des écrous de roue et de tous les raccords vissés du véhicule
• Fixation des servos
• Adhérence des pneus sur les jantes et état des pneus
• Fixation de tous les câbles (ceux-ci ne doivent pas toucher les pièces mobiles du véhicule)
Contrôlez le modèle réduit avant chaque mise en marche afin de vous assurer qu’il ne soit pas endommagé.
En présence de dommages, n’utilisez plus le véhicule et ne le mettez pas en service.
Si des pièces usées (par ex. pneus) ou défectueuses du véhicule (par ex. bras transversal cassé) doivent
être remplacées, employez alors uniquement des pièces de rechange d’origine.
Tous les quelques trajets, contrôlez régulièrement les points suivants :
• Le filtre à air doit être graissé, propre et dans un état irréprochable afin de par ex. pouvoir filtrer les fines particules
de poussière dans les atmosphères poussiéreuses.
• Après le nettoyage du modèle réduit et tous les quelques trajets, toutes les pièces mobiles et toutes les pièces sur
palier doivent être lubrifiées à l’aide d’une huile machine fluide ou de graisse à pulvériser.
• Contrôler l’apparence et l’écart entre les contacts de la bougie d’allumage.
Les bougies d’allumage sont des pièces d’usure, surtout pendant la phase de rodage. Nous vous conseillons donc
de toujours entretenir un stock avec quelques bougies d’allumage afin de pouvoir les remplacer le cas échéant.
Page 89

89
Employez uniquement des bougies d’allumage du type « CMR 7H » ! Une bougie d’allumage incorrecte ou usée
provoque un dysfonctionnement du moteur et rend l’ajustage plus difficile. Pour le montage ou le remplacement de
la bougie d’allumage, vous devez utiliser une clé pour bougie d’allumage (clé en croix de 10). L’écart idéal entre les
électrodes d’une bougie d’allumage intacte s’élève à 0,7 mm.
• Contrôlez l’articulation du carburateur et du frein.
Lorsque le servo d’accélération / de freinage (1) se
trouve en position neutre, la timonerie de direction
du carburateur (2) doit légèrement appuyer sur la
butée mécanique du guignol de gouverne sous l’effet
du ressort de l’étrangleur du carburateur.
• La timonerie de freinage (3) ne doit alors pas agir
sur les leviers de freinage (4) et ainsi sur le frein.
• Lorsque la fonction de freinage est activée sur
l’émetteur, le guignol de gouverne se déplace dans
le sens des flèches. Le ressort intégré tire la timonerie
d’accélération encore plus fortement en direction de
la butée mécanique du carburateur (voir également
figure 18). La vitesse de rotation du moteur ne doit
alors pas diminuer. Le cas échéant, ajuster la bague
de réglage avant (la pousser en direction du
carburateur).
• Le levier de freinage (4) se déplace simultanément et actionne le frein. Les garnitures de frein sont des pièces
d’usure. L’effet de freinage diminue après une certaine durée de fonctionnement. La vis de réglage (5) permet de
régler la timonerie afin de rétablir l’effet de freinage habituel.
Figure 19
Page 90

90
12. Élimination
a) Généralités
Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères !
En fin de vie, éliminez le produit conformément aux consignes légales en vigueur.
b) Piles et batteries
Le consommateur final est légalement tenu (ordonnance relative à l’élimination des piles usagées) de rapporter toutes
les piles et batteries usagées, il est interdit de les jeter dans les ordures ménagères !
Les piles et batteries qui contiennent des substances toxiques sont identifiées à l’aide des symboles cicontre qui indiquent l’interdiction de les jeter dans les ordures ménagères. Les désignations pour le métal
lourd prépondérant sont : Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb (vous trouverez la désignation sur la
pile ou batterie, par ex. au-dessous des symboles de poubelles représentés à gauche).
Vous pouvez rapporter gratuitement vos piles et batteries usagées aux centres de récupération de votre commune, à
nos succursales ou à tous les points de vente de piles et de batteries.
Vous répondez ainsi aux exigences légales et contribuez à la protection de l’environnement.
13. Déclaration de conformité (DOC)
Par la présente, Conrad Electronic, Klaus-Conrad-Straße 1, 92240 Hirschau (Allemagne), déclare que le présent
produit est conforme aux exigences fondamentales et aux autres consignes pertinentes de la directive 1999/5/CE.
La déclaration de conformité de ce produit est disponible sur le site web www.conrad.com.
Page 91

91
14. Dépannage
Bien que ce modèle réduit ait été construit selon l’état actuel de la technique, d’éventuels problèmes ou
dysfonctionnements peuvent toutefois survenir. C’est la raison pour laquelle nous vous indiquons ci-après comment
procéder afin d’éliminer vous-même d’éventuels défauts.
Le modèle réduit ne réagit pas
• Avec les télécommandes 2,4 GHz, une procédure d’apprentissage doit être effectuée pour le récepteur sur l’émetteur.
Pour cette procédure, on emploie par ex. les termes anglais « Binding » ou « Pairing ». La procédure d’apprentissage
a normalement déjà été effectuée par le fabricant, mais vous pouvez bien sûr également l’effectuer vous-même. À
cet effet, observez le mode d’emploi de la télécommande.
• La batterie du récepteur ou les batteries / piles dans l’émetteur sont-elles vides ?
• Avez-vous effectivement allumé l’émetteur avant l’alimentation électrique du récepteur ? Respectez toujours cet
ordre !
• La batterie du récepteur est-elle correctement raccordée au connecteur de raccordement correspondant ?
• Le véhicule est-il trop éloigné ? Une batterie du récepteur et des piles ou batteries pleines dans l’émetteur doivent
permettre d’atteindre une portée de 100 m et plus. Cette portée peut cependant être réduite en fonction des conditions
ambiantes, par ex. émetteur sur la même fréquence ou sur une fréquence voisine, la proximité de pièces métalliques
ou d’arbres, etc.
La position de l’antenne de l’émetteur par rapport à celle du récepteur a également une forte influence sur la portée.
Pour une portée optimale, les deux antennes doivent se trouver à la verticale. Lorsque vous dirigez l’antenne de
l’émetteur vers le véhicule, la portée est considérablement réduite !
• Contrôlez la position correcte des fiches des servos sur le récepteur. Si les fiches sont enfoncées à l’envers de 180°,
les servos ne fonctionnent pas.
• Les connecteurs du servo et du régulateur de vitesse du récepteur ont-ils été raccordés dans le bon sens ? Si les
fiches du servo d’accélération et de direction sont permutées, le levier d’accélération / de freinage commande le
levier de direction et le volant le servo d’accélération.
Le moteur ne démarre pas
• Le réglage du ralenti est trop faible.
À l’aide du compensateur pour la fonction de conduite, réglez correctement la position neutre sur l’émetteur ou
compensez en direction de l’accélération du ralenti. Contrôlez la fixation correcte des bagues de réglage sur la
timonerie d’accélération.
• L’étrangleur a-t-il été défini pour le démarrage ?
• L’étrangleur est-il activé trop longtemps ? Il est possible que le moteur soit noyé.
Retirez la bougie d’allumage. Séchez la bougie d’allumage à l’air comprimé. Tenez un chiffon au-dessus du cylindre
du moteur et tirez plusieurs fois sur le démarreur par câble pour éliminer l’excédent de carburant de la chambre de
combustion. Remettez la bougie d’allumage en place puis redémarrez sans étrangleur. Si le moteur ne démarre
toujours pas après la dixième tentative, effectuez une nouvelle tentative avec l’étrangleur.
Page 92

92
• L’écart entre les électrodes est-il correct (valeur de consigne : 0,7 mm) ?
• La bougie d’allumage est-elle utilisée depuis longtemps et est-elle éventuellement usée ? En cas de doute, effectuer
une nouvelle tentative de démarrage avec une bougie d’allumage neuve.
• Les conduites de carburant sont-elles dans un état irréprochable ? Le carburant est-il aspiré par la pompe manuelle ?
Le véhicule ne s’arrête pas lorsque vous relâchez le levier d’accélération / de freinage
• Le réglage du ralenti est trop élevé. Réglez, sur l’émetteur, à l’aide du régulateur de compensation, la position
neutre pour la fonction de conduite.
• Si la course de compensation est insuffisante, la vis du ralenti doit être ajustée sur le carburateur.
Le véhicule ralentit
• L’entraînement est bloqué par des feuilles, branches ou autres.
• Le réglage du carburateur est trop maigre (le moteur n’a pas de puissance et est éventuellement soumis à une
surchauffe). Réglez le carburateur de manière plus riche.
• La cartouche du filtre à air est encrassée. Le réglage du carburateur est ainsi trop riche (le moteur a des ratés et
n’atteint pas, ou que très lentement, sa vitesse de rotation). Nettoyez ou remplacez le filtre à air.
Le servo de direction ne réagit que faiblement ou plus du tout ; la portée entre l’émetteur et le véhicule est
très courte
• La batterie du récepteur est faible ou vide.
• Contrôlez les batteries ou piles dans l’émetteur.
La conduite en ligne droite n’est pas correcte
• Réglez correctement la compensation pour la fonction de direction sur l’émetteur.
• Vérifiez la tringlerie de direction ou le réglage de l’alignement des roues.
• Le véhicule a-t-il eu un accident ? Vérifiez alors si le véhicule comporte des pièces défectueuses ou cassées et
remplacez-les.
Direction contraire au mouvement du volant sur l’émetteur
• Activez le réglage Reverse pour la fonction de direction sur l’émetteur.
Fonction de conduite contraire au mouvement du levier d’accélération / de freinage sur l’émetteur
Normalement, le véhicule doit se déplacer lorsque le levier d’accélération / de freinage sur l’émetteur est tiré vers la
poignée. Activez le réglage Reverse pour la fonction de conduite sur l’émetteur.
Page 93

93
La direction ne fonctionne pas ou ne fonctionne pas correctement, le débattement de la direction est trop
faible sur le véhicule
• Si l’émetteur dispose d’un réglage Dualrate, contrôlez-le (observez le mode d’emploi de l’émetteur). Si le réglage
Dualrate est trop faible, le servo de direction ne réagit plus.
Cela vaut également pour le réglage EPA (= « End Point Adjustment », réglage des positions finales pour la course
de servo pour la protection du mécanisme servo) à condition qu’il soit disponible sur l’émetteur.
• Assurez-vous de l’absence de pièces desserrées au niveau du mécanisme de la direction. Contrôlez par ex. si le
bras de servo est correctement fixé sur le servo.
• Le mécanisme de direction est grippé par de la saleté ou de la rouille. Nettoyez puis graissez le mécanisme de
direction complet.
• Le réglage du protecteur de servo est trop faible.
Page 94

94
15. Caractéristiques techniques
Échelle : .................................................... 1:6
Batterie du récepteur : .............................. un pack de batteries NiMH à 5 cellules (tension nominale 6,0 V) ; non fourni,
à commander séparément
Entraînement : ..........................................moteur à combustion à 2 temps, 26 cm³, 1,18 kW / 1,6 CV
traction arrière
entraînement avec roulement à billes
différentiel dans l’essieu arrière
déport de roue réglable pour l’essieu avant et l’essieu arrière
alignement réglable de l’essieu avant et de l’essieu arrière
Suspension : .............................................suspension individuelle des roues, avec ressorts en spirale / amortisseurs,
réglables
Dimensions (L x l x h) : ............................. 750 x 445 x 270 mm
Dimensions des pneus (l x Ø) : ................78 x 170 mm
Empattement : .......................................... 525 mm
Garde au sol : ...........................................55 mm
Poids (sans batteries) : .............................10 490 g
Les procédés de fabrication employés peuvent être à l’origine de faibles écarts de dimensions et de poids.
Page 95

95
Inhoudsopgave
Pagina
1. Inleiding ............................................................................................................................................................ 96
2. Voorgeschreven gebruik .................................................................................................................................. 97
3. Verklaring van de symbolen ............................................................................................................................ 97
4. Leveringsomvang............................................................................................................................................. 98
5. Veiligheidsvoorschriften ................................................................................................................................... 98
a) Algemeen ................................................................................................................................................... 99
b) Ingebruikname ......................................................................................................................................... 100
c) Rijden van het voertuig ............................................................................................................................ 101
6. Tips voor batterijen en accu´s........................................................................................................................ 102
7. Accu’s laden ................................................................................................................................................... 103
a) Ontvangeraccu opladen .......................................................................................................................... 103
b) Accu’s in de zender laden ....................................................................................................................... 103
8. Ingebruikname ............................................................................................................................................... 104
a) Carrosserie verwijderen ........................................................................................................................... 104
b) Leggen van de antennekabel van de ontvanger ..................................................................................... 104
c) Ontvangeraccu in het voertuig plaatsen .................................................................................................. 105
d) Zender en ontvangtoestel in gebruik nemen ........................................................................................... 105
e) Fail-safe programmeren .......................................................................................................................... 105
f) Luchtfilter smeren en voertuig tanken ..................................................................................................... 106
g) Carrosserie en staartvleugel monteren en bevestigen ........................................................................... 106
h) Reikwijdte van de afstandsbediening controleren .................................................................................. 106
i) Motor starten ............................................................................................................................................ 107
j) Voertuig besturen ..................................................................................................................................... 108
k) Rijden stoppen ......................................................................................................................................... 109
9. Instelmogelijkheden op het voertuig .............................................................................................................. 110
a) Wielvlucht instellen .................................................................................................................................. 110
b) Spoor instellen ......................................................................................................................................... 112
c) Stuurgeometrie instellen .......................................................................................................................... 113
d) Schokdempers instellen .......................................................................................................................... 114
e) Servo-saver instellen ............................................................................................................................... 115
10. Motorinstellingen ............................................................................................................................................ 116
a) Carburateur afstellen - algemeen ............................................................................................................ 116
b) Stationair mengselregelschroef (L) instellen ........................................................................................... 117
c) Hoofdsproeiernaald (H) instellen ............................................................................................................. 117
d) Stationair toerental (S) instellen .............................................................................................................. 118
e) Fabrieksinstellingen opnieuw instellen .................................................................................................... 118
11. Onderhoud en reiniging ................................................................................................................................. 119
12. Afvalverwijdering ............................................................................................................................................ 121
a) Algemeen ................................................................................................................................................. 121
b) Batterijen en accu´s ................................................................................................................................. 121
13. Conformiteitsverklaring (DOC) ....................................................................................................................... 121
14. Verhelpen van storingen ................................................................................................................................ 122
15. Technische gegevens .................................................................................................................................... 125
Page 96

96
1. Inleiding
Geachte klant,
Hartelijk dank voor de aanschaf van dit product.
Dit product voldoet aan de wettelijke nationale en Europese normen.
Volg de instructies van de gebruiksaanwijzing op om deze status van het apparaat te handhaven en een ongevaarlijke
werking te garanderen!
Deze gebruiksaanwijzing hoort bij dit product. Deze bevat belangrijke instructies voor de
ingebruikname en bediening. Let hierop, ook wanneer u dit product aan derden doorgeeft.
Bewaar deze handleiding om haar achteraf te raadplegen!
Alle vermelde bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren. Alle rechten
voorbehouden.
Bij technische vragen kunt u zich wenden tot onze helpdesk.
Voor meer informatie kunt u kijken op www.conrad.nl of www.conrad.be.
Page 97

97
2. Voorgeschreven gebruik
Dit product is een modelvoertuig met achterwielaandrijving, dat via de meegeleverde afstandsbediening draadloos
bestuurd kan worden.
Het chassis is rijklaar gemonteerd.
Het product is geen speelgoed. Het is niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar.
Volg alle veiligheidsinstructies in deze gebruiksaanwijzing op. Deze bevat belangrijke informatie
voor het gebruik van het product.
3. Verklaring van de symbolen
Een uitroepteken in een driehoek wijst op speciale gevaren bij gebruik, ingebruikneming of bediening.
Het „pijl“-symbool wijst op speciale tips en bedieningsvoorschriften.
Page 98

98
4. Leveringsomvang
• Rijklaar gemonteerd voertuig, RtR
• Zender
• Kleine onderdelen (vb. antennebuisjes voor de ontvangerantenne)
• Bougiesleutel
• Gebruiksaanwijzing voor voertuig
• Gebruiksaanwijzing voor afstandsbediening
Benodigde accessoires (niet meegeleverd):
• 4 accu’s of batterijen (type mignon/AA) voor de zender
• Ontvangeraccu (Hump-pack 6 V, 1500 mAh aanbevolen)
• Laadapparaat voor zender- en ontvangeraccu
• Tankfles
• Luchtfilterolie
• Tweetakt mengsel 1:25 olie/benzinemengsel (met super of superplus benzine)
De reserveonderdelenlijst vindt u op onze internetpagina www.conrad.com in het downloadbereik van het
betrokken product.
U kunt de lijst met reserveonderdelen ook telefonisch aanvragen; de contactgegevens vindt u in de bijlage
bij deze gebruiksaanwijzing in het hoofdstuk „Inleiding“.
5. Veiligheidsaanwijzingen
Bij beschadigingen veroorzaakt door het niet opvolgen van deze gebruiksaanwijzing vervalt ieder
recht op garantie. Voor vervolgschade die hieruit ontstaat, zijn wij niet aansprakelijk!
Voor materiële schade of persoonlijk letsel, veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet
opvolgen van de veiligheidsaanwijzingen, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid! In zulke gevallen
vervalt de garantie.
Gewone slijtage bij het gebruik (bv. versleten banden, versleten tandwielen) en schade door ongevallen
(bv. gebroken wieldraagarmen, kromme carrosserie, enz.) vallen niet onder de garantie.
Geachte klant: deze veiligheidsvoorschriften hebben niet enkel de bescherming van het product, maar
ook de bescherming van uw gezondheid en die van andere personen tot doel. Lees daarom dit hoofdstuk
zeer aandachtig door voordat u het product gebruikt!
Page 99

99
a) Algemeen
Let op, belangrijk!
Bij gebruik van het model kan het tot materiële schade of lichamelijke letsels komen. Houd rekening met
het feit dat u voor het gebruik van het model voldoende verzekerd bent, bijv. via een aansprakelijkheidsverzekering. Informeer indien u reeds beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering voor u het model
in bedrijf neemt bij uw verzekering of het gebruik van het model mee verzekerd is.
• Om veiligheids- en toelatingsredenen (CE) is het eigenhandig ombouwen en/of wijzigen van het product niet
toegestaan.
• Het product is geen speelgoed. Het is niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar.
• Het product mag niet vochtig of nat worden.
• U mag de motor en de uitlaat nooit tijdens en na het gebruik aanraken! Verbrandings- en verwondingsgevaar!
• Bewaar de benzine achter slot en grendel zodat het niet toegankelijk is voor kinderen.
• Vermijd contact met de ogen, de slijmvliezen en de huid. Als u zich onwel voelt, dient u onmiddellijk een arts te
raadplegen!
• Mors nooit brandstof. Gebruik een speciale brandstoffles om het voertuig te tanken.
• Testritten en het rijden zelf zijn alleen toegestaan in openlucht. Adem de brandstofgassen en de uitlaatdampen niet
in; ze zijn schadelijk voor de gezondheid!
• De benzine is licht ontvlambaar; de benzinedampen zijn uiterst explosief! Rook nooit tijdens de omgang met
brandstoffen (vb. tijdens het tanken). Houd open vuren op afstand! Explosie- en brandgevaar!
• Benzine mag uitsluitend in goed geventileerde ruimten, ver van ontstekingbronnen en uitsluitend in de toegelaten
hoeveelheden worden bewaard.
• Als het rijden permanent wordt gestopt, moet de in de tank van het model overblijvende benzine worden weggepompt.
• U mag het verpakkingsmateriaal niet zomaar laten rondslingeren. Dit is gevaarlijk speelgoed voor kinderen.
• Wendt u zich tot ons (zie hoofdstuk 1 voor de contactgegevens) of een andere vakman indien u vragen heeft die niet
met behulp van deze gebruiksaanwijzing opgehelderd kunnen worden.
De bediening en het gebruik van op afstand bediende modelvoertuigen moet geleerd worden! Als u nog
nooit een dergelijk voertuig bestuurd heeft, moet u heel voorzichtig rijden en u eerst vertrouwd maken met
de reacties van het voertuig op de commando´s van de afstandsbediening. Wees geduldig!
Neem geen risico bij het gebruik van het model! Uw eigen veiligheid en die van uw omgeving is afhankelijk
van uw verantwoord gebruik van het model.
• Het voorgeschreven gebruik van het voertuig verondersteld regelmatige onderhoudswerken en reparaties.
Bijvoorbeeld is het zo dat de banden verslijten bij gebruik of er is „ongevalsschade“ bij een rijfout.
Gebruik voor de door u gewenste onderhouds- of reparatiewerken uitsluitend originele vervangonderdelen!
Page 100

100
b) Ingebruikname
De gebruiksaanwijzing voor de afstandsbediening werd afzonderlijk geleverd. Neem in elk geval de daar
vermelde veiligheidsvoorschriften en alle verdere informatie in acht!
Ga bij de ingebruikname altijd op de hieronder beschreven volgorde te werk, anders komt het tot onvoorzienbare
reacties van het voertuig! Houd bovendien rekening met hoofdstuk 8.
Stap 1:
Schakel de zender in indien dit nog niet is gebeurd. Controleer zijn werking (vb. bedrijfsweergave van de zender).
Stap 2:
Plaats het voertuig op een geschikte ondergrond, zodat de wielen vrij kunnen bewegen.
Sluit de stroomtoevoer van de ontvanger aan en zet de aan-/uitschakelaar voor de ontvangervoedingsspanning in
de stand „ON“ (= aan).
Stap 3:
Controleer vóór het gebruik van het voertuig en terwijl het model stilstaat of het zoals verwacht op de commando´s
van de afstandsbediening reageert (gas- en stuurservo).
Stap 4:
Stel de trimming van de gas-/remhendel op de zender zodanig in, dat bij volledig loslaten van de hendel (neutrale
stand van de gas-/remhendel van de zender) de rem niet meer actief is.
Stap 5:
Stel tenslotte de trimming voor de besturing in zodat de voorwielen ongeveer recht staan. Een precieze instelling
voor rechtdoor rijden kan later tijdens het rijden gebeuren.
Step 6:
Controleer of de gas- en stuurservo tijdens het gebruik bij volledige uitslag op de zender mechanisch „op blok“
lopen. Als dit niet het geval is, moet de servoweg op de zender worden begrensd (zie gebruiksaanwijzing van de
afstandsbediening).
Step 7:
Programmeer (indien geïntegreerd in de afstandsbediening) op de gasservo een fail-safefunctie en controleer de
correcte werking. Als deze functie niet in de afstandsbediening is geïntegreerd, raden wij u sterk aan om een externe fail-safemodule (moet afzonderlijk worden aangekocht) te gebruiken.
 Loading...
Loading...