Page 1
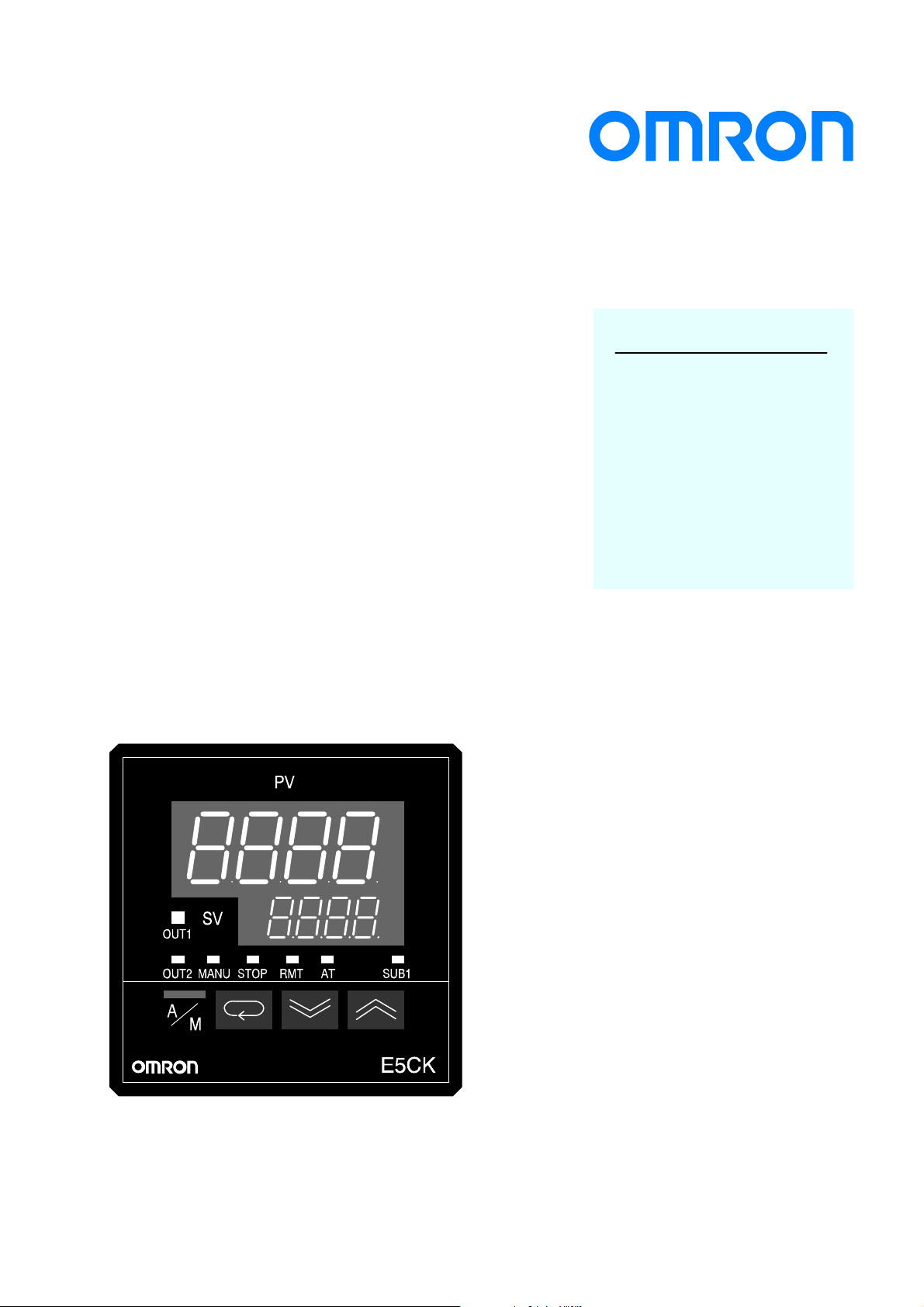
Digitaler Temperaturregler
E5CK
Kurzübersicht
Vor dem Betrieb 9. . . . . . . . . . .
Basiseinstellungen 17. . . . . . . . .
Betriebseinstellungen 33. . . . . .
Parameter 53. . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunikationsfunktion 87. . . .
Fehlersuche 101. . . . . . . . . . . . . .
Technisches Handbuch
H078–D1–1A, Technisches Handbuch: E5CK, 08.99
Page 2

E5CK
Digitaler Temperaturregler
Technisches Handbuch
August 1999
I
Page 3

E Copyright by OMRON, Langenfeld, August 1999
Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Veröffentlichung darf in irgendeiner
Form, wie z. B. Druck, Fotokopie oder einem anderen Verfahren, ohne schriftliche
Genehmigung der Firma OMRON, Langenfeld, reproduziert, vervielfältigt oder
veröffentlicht werden.
Änderungen vorbehalten.
II
Page 4

Vorwort
In diesem Technischen Handbuch des Temperaturreglers E5CK wird die Installation und Bedienung beschrieben.
Der Temperaturregler E5CK verfügt über eine Reihe verschiedener Temperatur–
und Analogeingänge. Über die Funktion der Ausgangszuweisung können Ausgänge Alarmfunktionen übernehmen, bspw. wenn eine Unterbrechung des Regelkreises auftritt. Eine individuelle Kalibrierung der Ein–/Ausgänge gewährleistet eine
Anpassung an Ihren Regelungsprozeß. Innerhalb des Regelungs–Prozesses können mehrere Sollwerte definiert werden. Durch die Schutzklasse IP 66 (Nema4)
kann der Temperaturregler auch in rauher Industrieumgebung eingesetzt werden.
Sollten Sie das englischsprachige Handbuch zu dem Temperaturregler benötigen,
verweisen wir auf das englische Manual H078–E1–1.
Um die Arbeit mit diesem Handbuch für Sie besonders effizient zu gestalten, beachten Sie bitte folgenden:
– Das Handbuch ist in einzelne Kapitel eingeteilt, denen jeweils ein detailliertes
Inhaltsverzeichnis vorangestellt ist. Das Gesamt–Inhaltsverzeichnis finden Sie
im direkten Anschluß an das Vorwort.
– Sind mehrere Hinweise zusammengefaßt, kennzeichnet der Bindestrich ”–” die
einzelnen Hinweise. Wird innerhalb eines Textes oder einer Abbildung bezug
auf einen Hinweis genommen, wird der Bindestrich ”–” durch H1:, H2:, etc. ersetzt.
– Die eingesetzten Symbole und deren Bedeutungen sind nachfolgend darge-
stellt.
Hinweis
Vorsicht
Achtung
1.
2. 3. ...
Wichtige Informationen über das Produkt, auf die besonders aufmerksam gemacht
werden soll.
Ein Nichtbeachten kann leichte Körperverletzung oder einen Sachschaden zur
Folge haben.
Ein Nichtbeachten kann Tod, schwere Körperverletzung oder erheblichen Sachschaden zur Folge haben.
Aktive Handlungsschritte des Anwenders, bei der die Numerierung die Reihenfolge
des Vorgehens festlegt.
Eine Bitte in eigener Sache
Sollten Ihnen Fehler oder mißverständliche Darstellungen in diesem Handbuch
auffallen, würden wir uns über Ihre Verbesserungsvorschläge freuen.
Ein entsprechendes Formblatt finden Sie am Ende dieses Handbuches.
III
Page 5

Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1 – Allgemeines 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Gehäuse und Anzeigen 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Ein– und Ausgänge 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Parameter und Menüs 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Die Kommunikationsfunktion 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Kalibrierung 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gesamtansicht 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Frontseite 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anzeigen 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tastenfunktionen 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eingänge 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgänge 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgangszuweisung 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Datenübertragungsausgang 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Betriebsarten 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manuelle Einstellung 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parameter umschalten 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parameter speichern 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RS–232C 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RS–485 7. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kalibrierung des Eingangs 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kalibrierung des Ausgangs 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Speicherung der Kalibrierungsdaten 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitel 2 – Vor dem Betrieb 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Einstellung und Einbau 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gehäuse entfernen 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einstellen der Eingangsart 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation der Ausgangs–Baugruppe 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation der Kommunikations–Baugruppe 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Installation 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Abmessungen (in mm) 11. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schalttafel–Ausschnitt 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Installation 12. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klemmenabdeckung installieren 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Klemmenverdrahtung 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Klemmenanordnung 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sicherheitsmaßnahmen bei der Verdrahtung 13. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verdrahtung 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitel 3 – Basiseinstellungen 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Regelkreis–Beispiel 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Einstellen der Eingangsspezifikationen 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eingangsart 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skalierung 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Änderung eingeben 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beispiel 19. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Einstellen der Ausgangsspezifikationen 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgangs–Zuweisungen 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direkt–/Reverse–Betrieb 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regelzyklus 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beispiel 21. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
V
Page 6

Inhaltsverzeichnis
4. Randbedingungen des Alarmausgangs einstellen 22. . . . . . . . . . . . . . . .
Alarmbetrieb 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alarmwert 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alarmhysterese 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bereitschaft 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bei Alarm schließen / Bei Alarm öffnen 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zusammenfassung des Alarmbetriebes 24. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Verriegelungs–Betriebsart 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verriegelung 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A/M–Taste verriegeln 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beispiel 26. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Betrieb starten und unterbrechen 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgangs–Stellwert während einer Unterbrechung einstellen 27. . . . . . .
Beispiel 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Einstellung des Regelbetriebes 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Änderung des Sollwertes 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beispiel 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manueller Betrieb 28. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auto–Tuning (AT) 29. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beispiel 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitel 4 – Betriebseinstellungen 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Einstellen der Regelart 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Heiz– und Kühlregelung 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EIN/AUS–Regelung 34. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Parameter–Limitierungen 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgangs–Stellgröße 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sollwert–Limitierung 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sollwert (SP)–Rampenverhalten 37. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Optionale Funktionen einsetzen 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ereigniseingang 38. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Übertragungs–Ausgang 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. BA–Funktion 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LBA–Erkennungszeit 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LBA–Erkennungsbreite 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LBA–Erkennungsbeispiel 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LBA–Erkennungszeit aktivieren 40. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LBA–Erkennungszeit berechnen 41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Kalibrierung 42. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kalibrierung Thermoelement 1 45. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kalibrierung Thermoelement 2 46. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kalibrierung des Platin–Widerstandsthermometers 47. . . . . . . . . . . . . . . .
Kalibrierung des Stromeingangs 49. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kalibrierung des Spannungseingangs 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Überprüfung der Anzeigegenauigkeit 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Thermoelement 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Platin–Widerstandsthermometer 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Strom– und Spannungseingang 52. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VI
Page 7

Inhaltsverzeichnis
Kapitel 5 – Parameter 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Verriegelungs–Betriebsart 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verriegelung 53. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[A/M]–Taste verriegelt 54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Manuelle Betriebsart 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handbuch MV 55. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Betriebsart Ebene 0 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PV/SP (Istwert/Sollwert) 56. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sollwert während SP–Rampe 57. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Überwachung des Ausgangsstellwertes (Heizen) 57. . . . . . . . . . . . . . . . .
Überwachung des Ausgangsstellwertes (Kühlen) 57. . . . . . . . . . . . . . . . .
Run/Stop 58. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Betriebsart Ebene 1 59. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AT ausführen/abbrechen 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sollwert 0 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sollwert 1 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alarmwert 1 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alarmwert 2 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alarmwert 3 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proportionalband (P) 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nachstellzeit (I) 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vorhaltezeit (D) 61. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kühlkoeffizient 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Totband 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manueller Reset–Wert 62. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hysterese (Heizen) 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hysterese (Kühlen) 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schaltzykluszeit (Heizen) 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schaltzykluszeit (Kühlen) 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artverwandte Parameter 63. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Betriebsart Ebene 2 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dezentraler/lokaler Betrieb 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SP–Rampen–Zeiteinheit 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SP–Rampenwert 65. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Erkennungszeit bei einer Regelkreisunterbrechung (LBA) 66. . . . . . . . . .
Ausgangsstellgröße (MV) bei Stop 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgangsstellgröße (MV) bei Istwert–Fehler 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgangsstellgrößen (MV)–Obergrenze 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgangsstellgrößen (MV)–Untergrenze 67. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Änderungsgrenzwerte der Ausgangsstellgröße (MV) 67. . . . . . . . . . . . . .
Digitaler Eingangsfilter 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alarm 1 Hysterese 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alarm 2 Hysterese 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alarm 3 Hysterese 68. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oberer Grenzwert der Eingangsverschiebung 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unterer Grenzwert der Eingangsverschiebung 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Setupbetriebsart 70. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eingangstyp 71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skalierungs–Obergrenze 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skalierungs–Untergrenze 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dezimalkomma 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parameter initialisiert 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
_C/_F–Auswahl 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zuweisung Regelausgang 1 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zuweisung Regelausgang 2 73. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zuweisung Hilfsausgang 1 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alarmtyp 1 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alarmtyp 2 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alarmtyp 3 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alarm 1 (bei Alarm geöffnet) 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VII
Page 8

Inhaltsverzeichnis
Alarm 2 (bei Alarm geöffnet) 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alarm 3 (bei Alarm geöffnet) 75. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Direkt–/Reverse–Betrieb (Kühlen/Heizen) 76. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7. Betriebsart Erweiterte Funktion 77. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Oberer Grenzwert des Sollwertes 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Unterer Grenzwert des Sollwertes 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PID / EIN/AUS 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artverwandte Parameter 78. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ST (Selbstoptimierung) 79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stabiler ST–Bereich (Selbstoptimierung) 79. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AT Verstärkungs–Faktor 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bereitschafts–Rücksetzmethode 80. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Automatische Rückkehr zum Anzeigebetrieb 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
AT–Hysterese 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
LBA–Erkennungsbreite 81. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Multi–SP–Funktion (Mehrfach–Sollwert) 83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zuweisung Ereigniseingangs 1 83. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Der Kommunikations–Stopbit 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunikations–Datenlänge 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunikations–Parität 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunikations–Baudrate 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kommunikations–Baugruppen–Nr. 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artverwandte Parameter 84. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Übertragungsausgangs–Typ 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Übertragungsausgangs–Obergrenze 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Übertragungsausgangs–Untergrenze 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9. Kalibrierungs–Betriebsart 86. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitel 6 – Die Kommunikationsfunktion 87. . . . . . . . . . . . . .
1. Beschreibung der Kommunikationsfunktion 87. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Beschreibung 87. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Übertragungsverfahren 87. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schnittstelle 87. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Kommunikationsvorbereitungen 88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RS–232C 88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RS–485 88. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Einstellen der Kommunikationsparameter 89. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Befehlskonfiguration 90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Befehle und Antworten 91. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parameter lesen / speichern 91. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spezielle Befehle 94. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5. Lesen der Kommunikations–Fehlermeldung 95. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Undefinierterer Fehler 96. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6. Programmbeispiel 97. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programmliste 98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anwendungsbeispiele 99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapitel 7 – Fehlersuche 101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1. Überprüfung der Grundeinstellungen 101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2. Fehleranzeige 102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3. Fehlerausgänge 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Regelkreisunterbrechungsfehler (LBA) 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eingangsfehler 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A/D–Konvertierungsfehler 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4. Überprüfung der Betriebsbeschränkungen 104. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII
Page 9

Inhaltsverzeichnis
Anhang 105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Spezifikation 105. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nenndaten und Charakteristika der Ausgangsbaugruppe 107. . . . . . . . . .
Nenndaten und Charakteristika der optionalen Baugruppe 107. . . . . . . . .
Blockschaltbild 108. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Parameter–Liste 112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUZZY–Selbstoptimierung (ST) 114. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zubehör 117. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
X–Format 118. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lesen der X–Format–Liste 119. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RX–Befehlsstatus (Istwert lesen) 120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ASCII–Code 121. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IX
Page 10
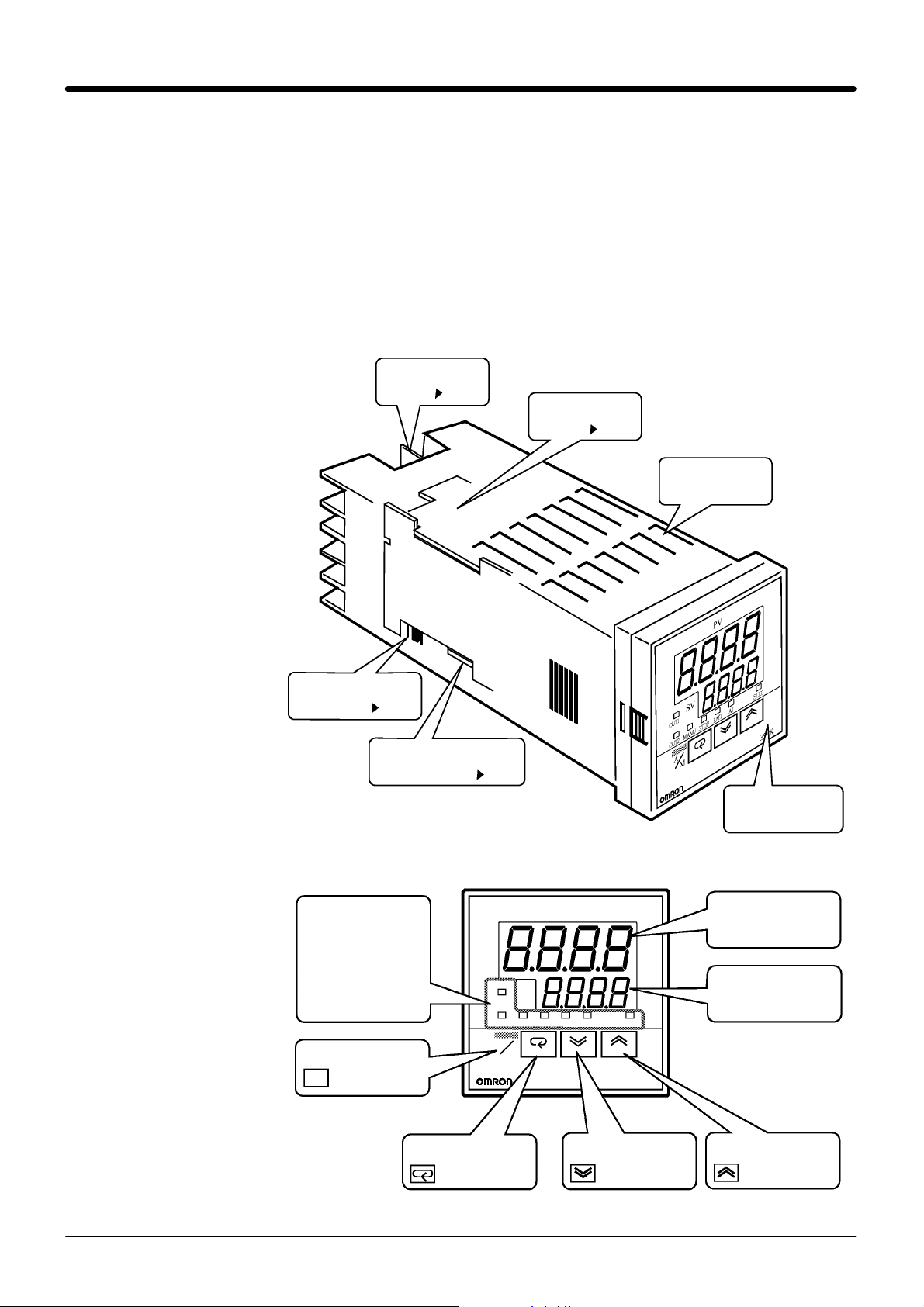
Kapitel 1 – Allgemeines
Dieses Kapitel gibt einen Überblick über den gesamten Funktionsumfang des
E5CK. Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte den nachfolgenden
Kapiteln.
1. Gehäuse und Anzeigen
Gesamtansicht
Klemmen
P 2–6
Ausgangsbaugr.
P 2–3
Rückseite
Frontseite
Jumper für
Eingangstyp
P 2–2
Optionale
Baugruppe
Betriebsanzeigen
OUT1
OUT2
SUB1
MANU
STOP
RMT
AT
A/M–Taste
A/M
P 2–3
PV
SV
OUT1
OUT2 MANUHALT RMT AT SUB1
A
M
E5CK
Frontseite
Istwert–Anzeige
(Anzeige 1)
Sollwert–Anzeige
(Anzeige 2)
Aufwärts–TasteAbwärts–TasteAnzeige–Taste
1
Page 11
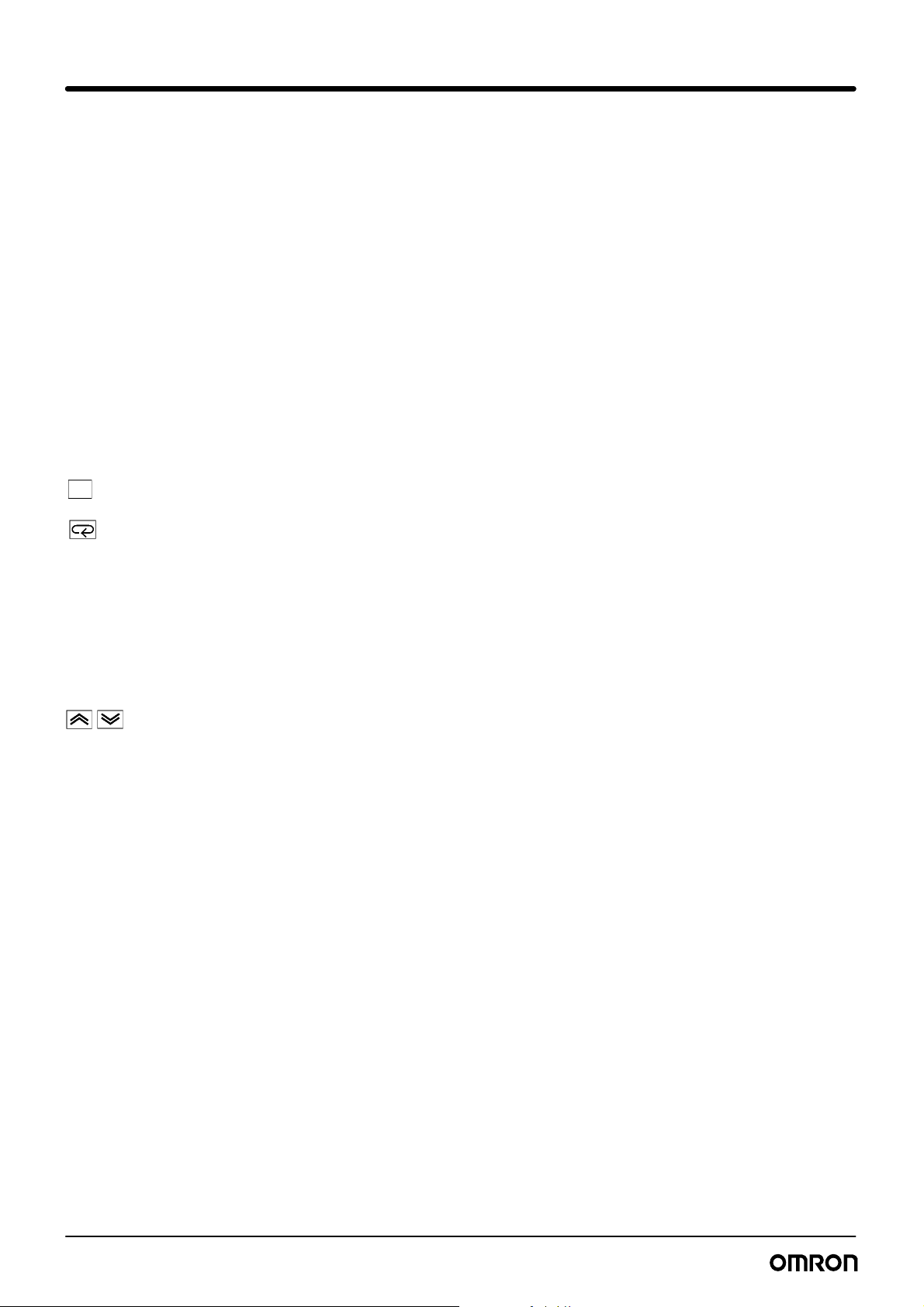
Kapitel 1 – Allgemeines
Anzeigen
Anzeige 1 Anzeige des Betriebswertes oder des Parametersymbols.
Anzeige 2 Anzeige des Istwertes, Bedienervariable oder Parametereinstellung
Betriebs–Anzeige OUT1: Leuchtet, wenn der Pulsausgang 1 aktiv ist.
OUT2: Leuchtet, wenn der Pulsausgang 2 aktiv ist.
SUB1: Leuchtet, wenn der Hilfsausgang 1 aktiv ist.
MANU: Leuchtet, wenn die manuelle Betriebsart aktiviert ist.
STOP: Leuchtet, wenn der Betrieb gestoppt wird.
RMT: Leuchtet während des dezentralen Betriebes.
AT: Leuchtet während der Selbstoptimierung (Auto–Tuning).
Tastenfunktionen
A/M
Umschalten zwischen den Betriebsarten ”Auto” und ”Manuell”.
Diese Taste verfügt über mehrere Funktionen. In Abhängigkeit von dem Zeitraum,
die diese Taste gedrückt wird, können die verschiedenen Funktionen aktiviert werden. Wird die Taste weniger als 1 Sekunde gedrückt, kann zwischen den einzelnen
Parametereinstellungen umgeschaltet werden. Wird die Taste 1 Sekunde oder länger gedrückt gehalten, wird die Menü–Anzeige aufgerufen. Um zwischen den einzelnen Funktionen umschalten zu können, darf die Taste nicht länger als 1
Sekunde gedrückt werden.
Weitere Informationen zur Parameterumschaltung und zur Menü–Anzeige siehe
Seite 6.
Durch Drücken der ”Aufwärts–Taste” wird der Wert bzw. die Einstellung der SV–
Anzeige 2 hinaufgezählt. Über die ”Abwärts–Taste” kann dieser Wert bzw. dieser
Einstellung wieder verringert werden.
Weitere Variationsmöglichkeiten sind gegeben, wenn gleichzeitig die ”A/M–Taste”
gedrückt wird. Weitere Informationen zu den möglichen Tastenkombinationen
siehe Seite 6, 17 und 33.
2
Page 12
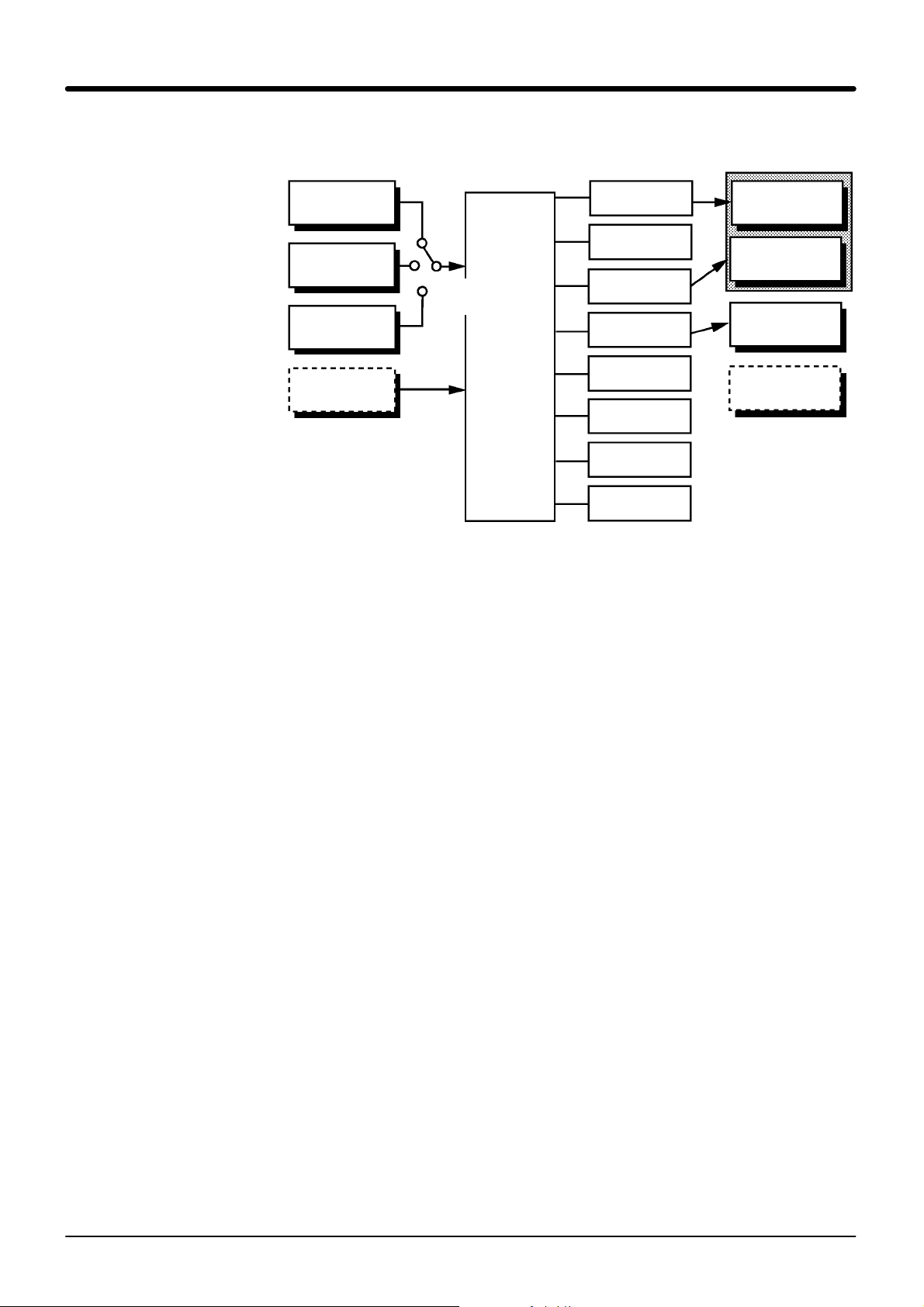
Kapitel 1 – Allgemeines
2. Ein– und Ausgänge
Temperatur–
eingang
Regler
Spannungs–
eingang
Jumper zur Ein–
stellung des
Eingangstyps
Stromeingang
Ereignis–
eingang
Abb. 1: Blockschaltbild Ein–/Ausgänge
Eingänge Der E5CK unterstützt vier Eingänge.
Temperatureingang / Spannungseingang / Stromeingang
– Nur eine Eingangsbeschaltung (Temperatureingang, Spannungseingang oder
Stromeingang) kann ausgewählt und mit dem Regler verbunden werden. In der
obenstehenden Abbildung ist dem Regler der Temperatureingang zugewiesen
worden. Die Einstellung erfolgt über den Jumper an der linken Seite des E5CK.
– Folgende Thermofühler können an den Temperatureingang angelegt werden:
Thermoelement: K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W, PLII
Platin–Widerstandsthermometer: JPt100, Pt100
– Die folgenden Ströme können an den Stromeingang angelegt werden:
4...20 mA, 0...20 mA
– Die folgenden Spannungen können an den Spannungseingang angelegt wer-
den: 1...5 VDC, 0...5 VDC, 0...10 VDC
Regelausgang
(Heizen)
Regelausgang
(Kühlen)
Alarm 1
Alarm 2
Alarm 3
LBA
Fehler 1
Fehler 2
Regelausgang 1
Regelausgang 2
Hilfsausgang 1
Schreiber–
ausgang 1
Ereigniseingänge
Um den Ereigniseingang einzusetzen, muß die Eingangsbaugruppe E53–CKB eingesetzt werden. Wählen Sie zwischen den folgenden 5 Ereigniseingängen:
– Multi–SP (Mehrfach–Sollwert)
– RUN / STOP
– Auto / Manual
3
Page 13
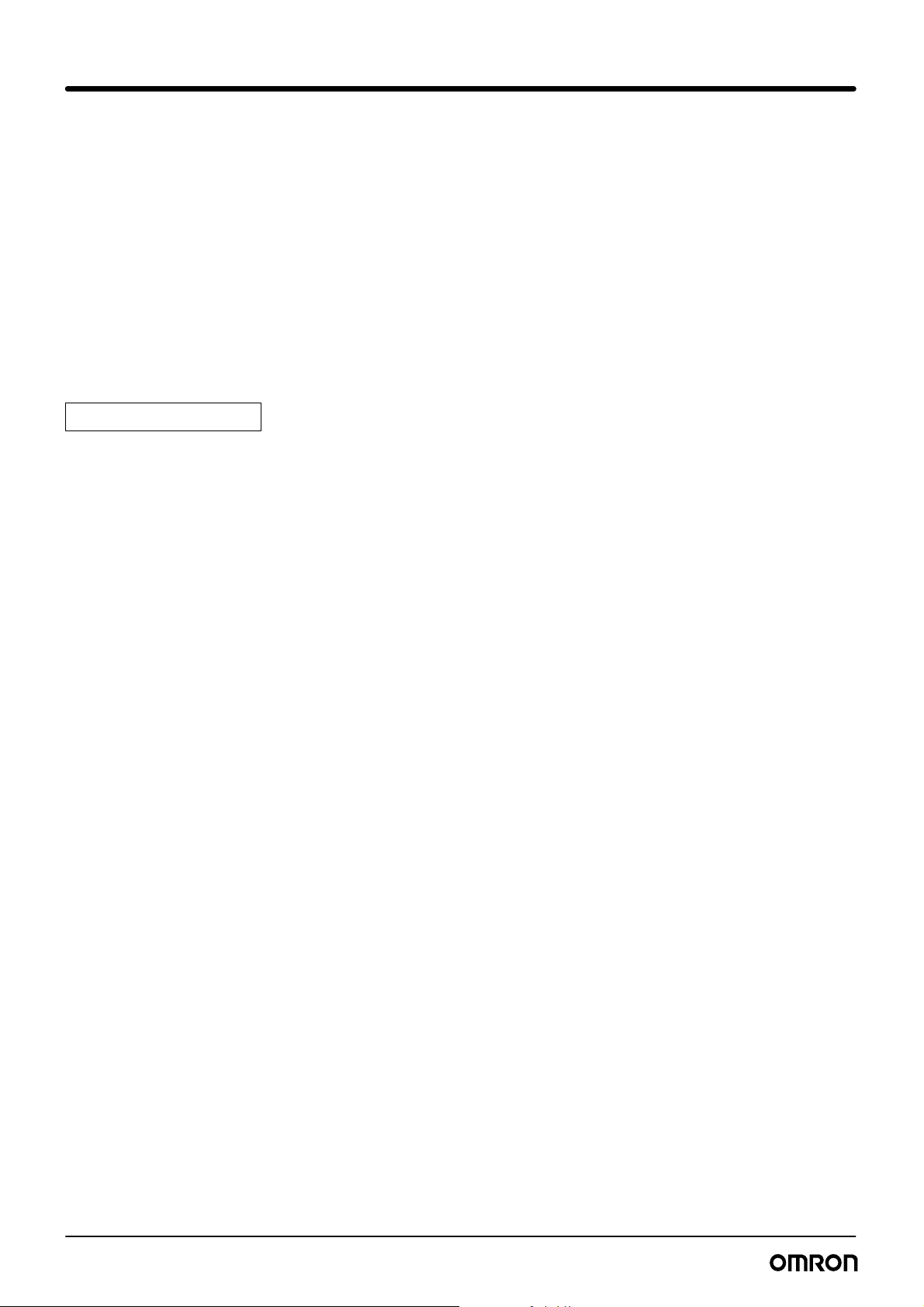
Kapitel 1 – Allgemeines
Ausgänge Der E5CK bietet die folgenden vier Ausgänge:
– Regelausgang 1
– Regelausgang 2
– Hilfsausgang 1
– Datenübertragungsausgang 1
Für den Betrieb der Regelausgänge 1 und 2 muß eine zusätzliche Ausgangsbaugruppe eingesetzt werden. Zwischen 8 verschieden beschalteten Ausgangsbaugruppen kann gewählt werden. Die Ausgangsbaugruppe muß separat bestellt
werden.
Für den Betrieb des Datenübertragungsausgangs wird die Kommunikationsbaugruppe E53–CKF benötigt.
Hinweis
Ausgangszuweisung
Die Ausgänge des E5CK arbeiten mit einer netzabhängigen Einschaltverzögerung.
Fünf Sekunden nach dem Einschalten sind die Ausgänge aktiv.
Der E5CK bietet die folgenden acht Ausgangsfunktionen:
– Regelausgang (Heizen)
– Regelausgang (Kühlen)
– Alarme 1...3
– LBA (Regelkreisunterbrechung)
– Fehler 1 (Eingangsfehler)
– Fehler 2 (A/D–Konvertierungsfehler)
Weisen Sie den Regelausgängen 1 und 2 und dem Hilfsausgang 1 diese Ausgangsfunktionen zu.
Den Regelausgängen 1 und 2 können die folgenden Funktionen zugewiesen werden: Regelausgang (Heizen), Regelausgang (Kühlen), Alarme 1...3 und LBA. Dem
Hilfsausgang 1 können auch die Alarme 1...3 und LBA zugewiesen werden, zusätzlich aber auch die Fehlerfunktion 1 und 2.
Im Beispiel auf der vorhergehenden Seite wird die Funktion ”Heizen” dem
Regelausgang 1, die Funktion ”Alarm 1” dem Regelausgang 2 und die Funktion
”Alarm 2” dem Hilfsausgang 1 zugewiesen.
In einer Heiz– und Kühlregelung weisen Sie den Regelausgängen 1 oder 2 die
Funktion Kühlen zu.
Datenübertragungs–
ausgang
4
Der E5CK liefert mit dem E53–CKF einen der folgenden 5 Analogwerte:
– Sollwert
– Sollwert während der SP–Rampe (Sollwert–Rampe)
– Istwert
– Von der Heizseite geregelte Variable
– Von der Kühlseite geregelte Variable
Diese Daten können skaliert ausgegeben werden. Bei Grenzwertdefinitionen kann
der obere Grenzwert kleiner als der untere Grenzwert gewählt werden.
Page 14

Kapitel 1 – Allgemeines
3. Parameter und Menüs
Betriebsarten
Verriegelung
Manuelle Einstellung
E5CK Parameter werden mit den folgenden neun Betriebsarten eingeteilt:
– Betriebsart Verriegelung
– Betriebsart manuelle Einstellung
– Betriebsart Ebene 0
– Betriebsart Ebene 1
– Betriebsart Ebene 2
– Betriebsart Setup
– Betriebsart Erweiterte Funktionen
– Betriebsart Kommunikation
– Betriebsart Ein–/Ausgangskalibrierung
Die Parameter–Einstellungen bei sieben Betriebsarten (nicht möglich bei der Betriebsart ”Verriegelung” und ”Manuelle Einstellung”) können über das Menü überprüft und modifiziert werden.
Diese Betriebsart dient der Verriegelung des Menüs und der A/M–Taste. Dadurch
wird einer unerlaubten Änderung von Parametern und das Umschalten zwischen
dem manuellen / automatischen Betrieb (A/M–Taste) vorgebeugt.
In dieser Betriebsart kann der Regler manuell bedient werden. Variable Prozeßparameter können nur in dieser Betriebsart geändert werden.
Ebene 0
Ebene 1
Ebene 2
Setup
Erweiterte Funktionen
In dieser Betriebart kann der Regler während des normalen Betriebes umgeschaltet werden. Während des Betriebes können Sie den Sollwert ändern und den Betrieb starten und stoppen. Der Prozeßwert, die SP–Rampe und die variablen
Prozeßwerte können überwacht, jedoch nicht geändert werden.
Dies ist die Hauptbetriebsart zur Einstellung der Regelparameter. Einstellungen
wie Auto–Tuning (AT), Alarmwerte, Regelzeiträume und PID–Parameter lassen
sich in dieser Betriebsart definieren.
Dies ist die Hilfsbetriebsart zur Einstellung der Hilfsparameter. In dieser Betriebsart
können Sie Parameter–Grenzwerte für den Sollwert und die variablen Prozeßwerte
vornehmen, zwischen der lokalen und dezentralen Betriebsart umschalten, den
Alarm für eine Regelkreisunterbrechung (LBA = Loop Break Alarm) aktivieren, die
Alarm–Hysterese und die Werte der digitalen Eingangsfilter einstellen.
In dieser Betriebsart werden die Basisspezifikationen, die vor dem Betrieb definiert
werden müssen, vorgenommen. Dazu zählen: Eingangsart, Skalierung, Ausgangs–Zuweisungen und Kühlen–/Heizen–Betrieb.
Dies ist die Betriebsart zur Einstellung der erweiterten Funktionen. Dazu zählen:
ST (self–tuning), SP–Rampen–Grenzwerte, Auswahl der erweiterten PID oder
EIN/AUS–Regelung, Alarmbereitschafts–Rücksetzverfahren, Initialisierung der Parameter und Einstellung der Zeitspanne bis zur automatischen Anzeige der Überwachungs–Anzeige (Display).
5
Page 15
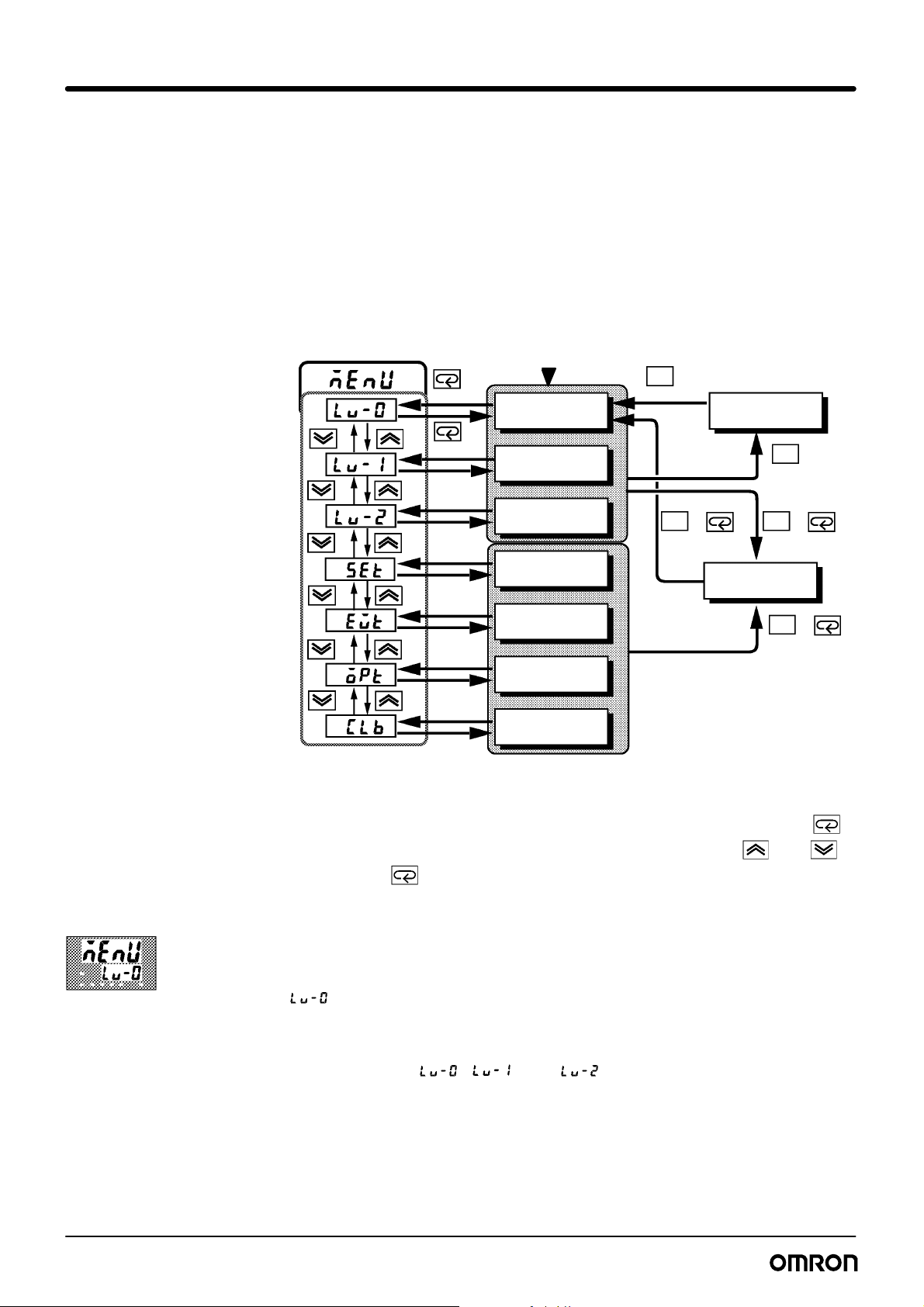
Kapitel 1 – Allgemeines
Kommunikation
Ein–/Ausgangskalibrierung
Auswählen der Betriebsart
Diese Betriebsart dient der Parametrierung zusätzlicher Funktionen. Voraus–
setzung dafür ist die Installation der Kommunikationsbaugruppe. Folgende Funktionen können dann parametriert werden: Kommunikationsbedingungen, Datenübertragungs–Ausgang und Ereignis–Eingangs–Parameter.
Diese Betriebsart dient der Kalibrierung der Eingänge und des Datenübertragungsausgangs. Die Kalibrierung der Eingänge ergibt sich über die Auswahl der Eingangsart. Die Kalibrierung des Ausgangs kann nur dann vorgenommen werden,
wenn die Kommunikationsbaugruppe E53–CKF in der Steuereinheit installiert ist.
Die folgende Abbildung stellt die Vorgehensweise bei der Auswahl der Betriebsart
dar.
POWER ON (Netz Ein)
A/M
Min. 1 s
Min. 1 s
Betriebsart
”Ebene 0”
Betriebsart
”Ebene 1”
Betriebsart
”Ebene 2”
Betriebsart
”Setup”
Min. 1 s
A/M
Min. 1 s
Betriebsart ”Manuelle Einstellung”
A/M
Min. 1 s
++
Betriebsart
”Verriegelung”
A/M
Min. 1 s
Menüanzeige
Betriebsart ”Erweiterte Funktionen”
Betriebsart
”Kommunikation”
Betriebsart
”E/A–Kalibrierung”
+
A/M
Min. 1 s
Abb. 2: Blockschaltbild MENÜ–Betriebsarten
Um das Menü aufzurrufen, drücken Sie für mindestens 1 Sekunde die Taste .
Das Aufrufen der gewünschten Betriebsart erfolgt über die Tasten oder .
Über die Taste wird der erste Parameterwert der jeweiligen Betriebsart angezeigt. Die Betriebsart ”Verriegelung” und ”manuelle Einstellung” kann nicht aufgerufen werden.
Wird die Menüanzeige aufgerufen, wird die vorhergehende Betriebsart angezeigt.
Wird zum Bespiel, während sich der E5CK sich in der Betriebsebene 0 befindet,
das Menü aufgerufen, erscheint auf der unteren Anzeige (Anzeige 2) die Meldung
[ ]. Die Betriebsebene 0 ist aktiv.
Die Betriebsart ”Verriegelung” kann nicht aufgerufen werden. Sind die Betriebsarten bis zur Ebene 1 verriegelt, kann das Menü nicht aufgerufen werden.
Betriebsart Ebene 0...2
6
Sind die Anzeigen [ ] [ ] oder [ ] ausgewählt, sind die entsprechenden Betriebsebenen 0...2 aktiviert. Diese Funktionen werden während des laufenden Regelvorgangs ausgewählt.
Page 16
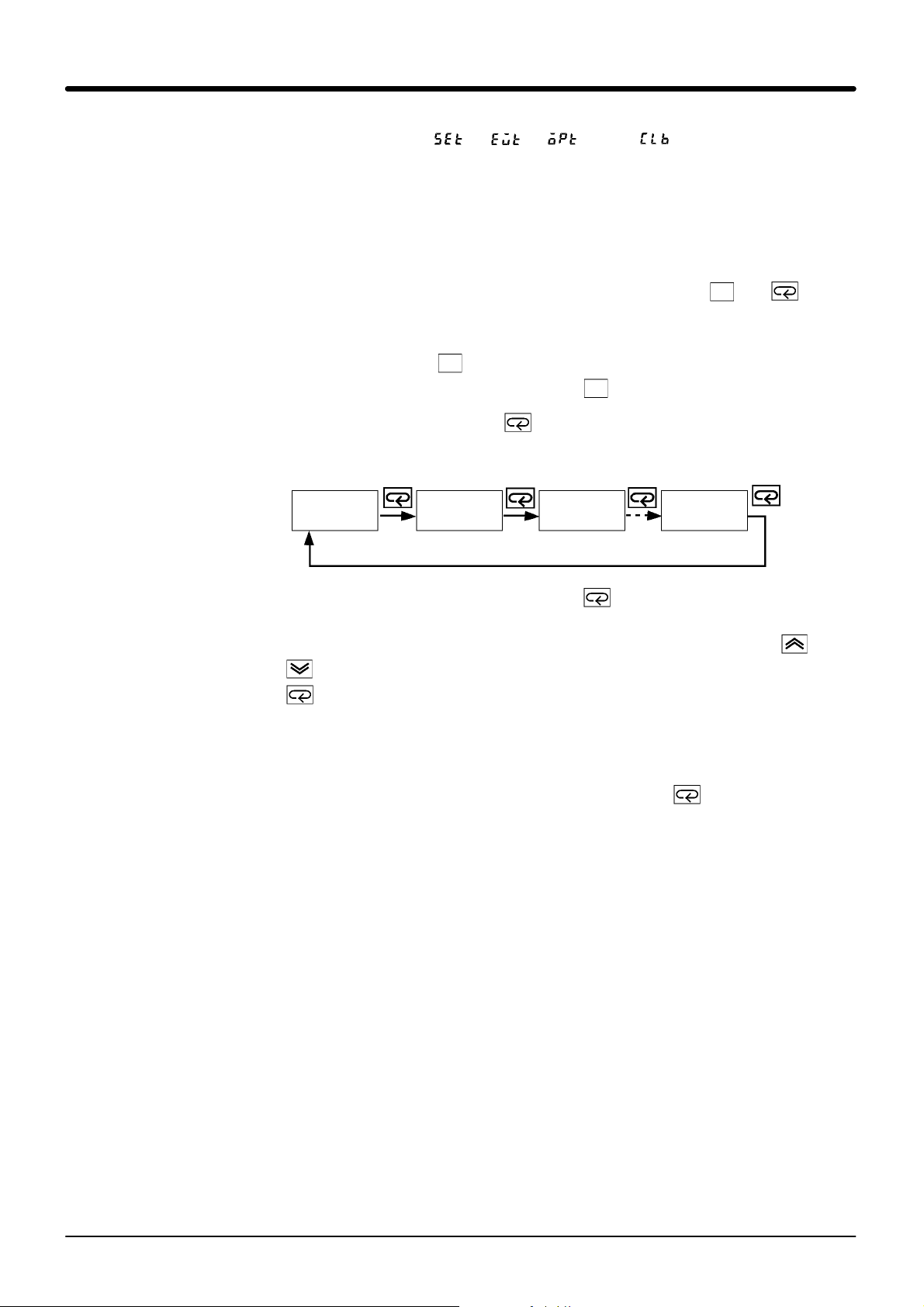
Kapitel 1 – Allgemeines
Setup
Erweiterte Funktionen
Kommunikation
E/A–Kalibrierung
Verriegelung
Manuelle Einstellung
Parameter umschalten
Sind die Anzeigen [ ] [ ] [ ] oder [ ] ausgewählt, dann sind
die Betriebsarten Setup, erweiterte Funktionen, Kommunikation und E/A–Kalibrierung aktiv.
Werden diese Betriebsarten aufgerufen, wird die Regelung zurückgesetzt. In diesem Fall werden die Regel– und Hilfsausgänge auf AUS gesetzt. Wird eine andere
Betriebsart aktiviert, wird der Reset aufgehoben.
Um den Regler in die Betriebsart ”Verriegelung” umzuschalten oder zur Betriebsebene 0 zurückzuschalten, drücken Sie gleichzeitig die Tasten A/M und für mindestens 1 Sekunde.
Um den Regler in die manuelle Betriebsart umzuschalten, drücken Sie auf der
Ebene 0...2 die Taste A/M für mindestens 1 Sekunde. Um auf die Ebene 0 zurück-
zukehren, drücken Sie wiederum die Taste A/M für mindestens 1 Sekunde.
Durch jedes Drücken der Taste wird der nächste Parameter angezeigt (gilt
nicht für die Betriebsart ”Manuelle Einstellung”). Nach der Anzeige des letzten Parameters wird wieder der erste Parameter angezeigt.
Parameter
1
Parameter
2
Parameter
3
Parameter
n
Abb. 3: Parameter–Umschaltung über die Taste
Parameter speichern
Wurde eine Parametereinstellung geändert, wählen Sie über die Tasten und
den gewünschten Parameter an und bestätigen die Einstellung mit der
–Taste.
Wurde eine weitere Betriebsart aufgerufen, wird der Inhalt des Parameters vor der
Auswahl der Betriebsart gespeichert.
Vor dem Ausschalten der Spannung müssen zuerst die Einstellungen und Parameterinhalte gespeichert werden (durch Drücken der Taste oder durch Aufrufen
einer anderen Betriebsart).
4. Die Kommunikationsfunktion
Voraussetzung für die Benutzung der Kommunikationfunktion ist die Installation
der Kommunikations–Baugruppen E53–CK01/–CK03. Diese Kommunikationsfunktion ermöglicht die Überprüfung und Einstellung von Regelparametern. Weitere
Informationen über die Kommunikationsfunktion siehe Kapitel 6.
RS–232C
Wird die Schnittstelle RS–232C eingesetzt, installieren Sie die Kommunikations–
Baugruppe E53–CK01.
RS–485
Wird die Schnittstelle RS–485 eingesetzt, installieren Sie die Kommunikations–
Baugruppe E53–CK03.
7
Page 17
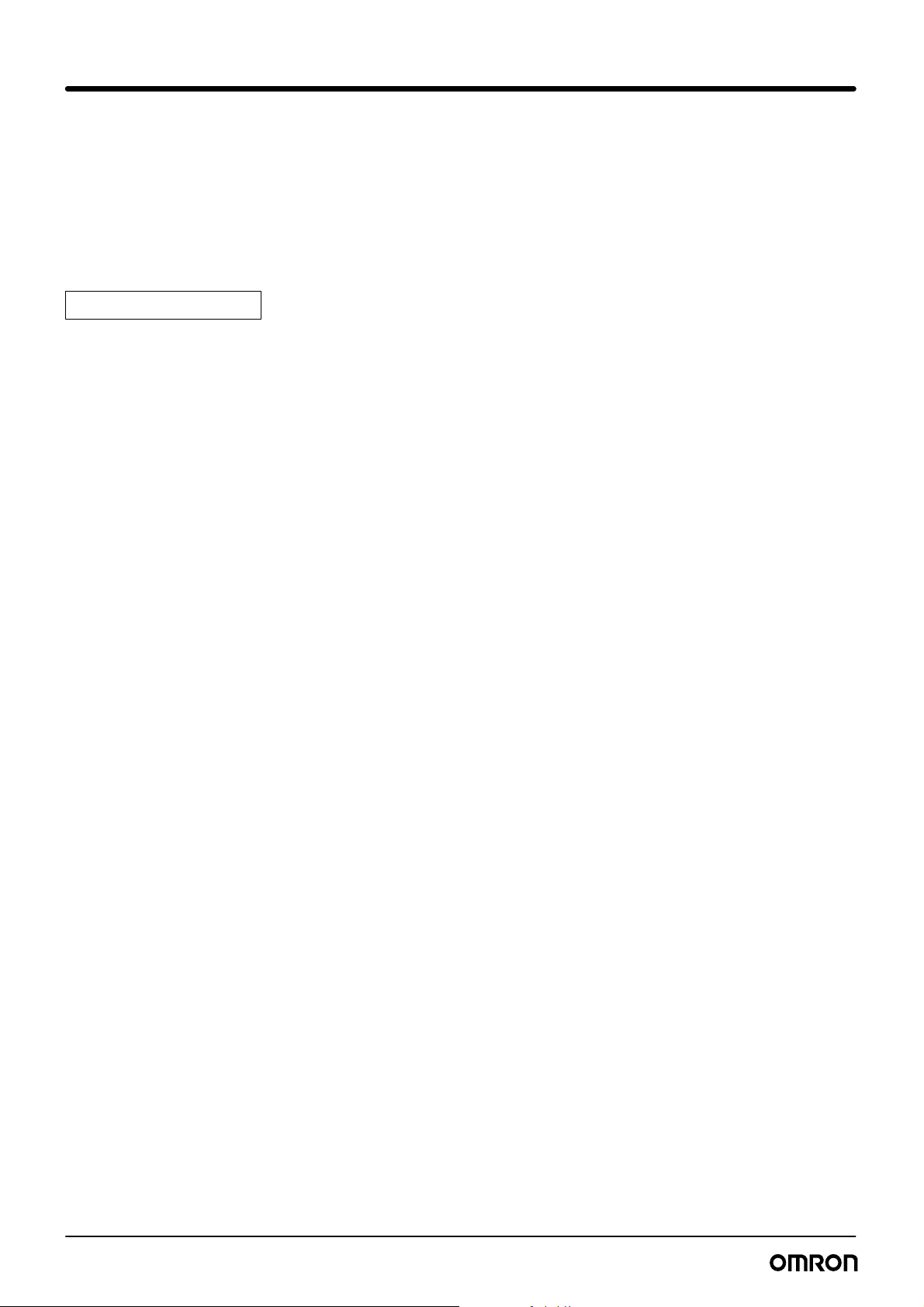
Kapitel 1 – Allgemeines
5. Kalibrierung
Der Temperaturregler E5CK wurde werkseitig kalibriert. Individuelle Anpassungen
des Temperatureingangs, des analogen Eingangs (Spannung, Strom) und des
Ausgangs können über die Parameter vorgenommen werden.
Beachten Sie, daß sich die Auffrischung der Kalibrierungsdaten auf den letzten
Wert vor der Kalibrierung der E5CK Temperaturreglers bezieht.
Hinweis
Kalibrierung des Eingangs
Kalibrierung des
Ausgangs
Speicherung der
Kalibrierungsdaten
Die werkseitige Einstellung der Kalibrierungsdaten kann nach der Änderung dieser
Daten vom Anwender nicht wieder hergestellt werden. Es gilt immer die zuletzt
gespeicherte Kalibrierung.
Für die Kalibrierung des Eingangs stehen vier Kalibrierungsparameter zur
Verfügung:
– Thermoelement
– Platin–Widerstandsthermometer
– Stromeingang
– Spannungseingang
Jeweils zwei Parametereinstellungen stehen für die Eingangsbeschaltung durch
die Thermoelemente bzw. das Anliegen eines analogen Spannungssignals zur Verfügung.
Der Datenübertragungsausgang kann nur dann kalibriert werden, wenn die Kommunikations–Baugruppe E53–CKF installiert ist.
Nach der Kalibrierung der Parameter werden die Kalibrierungsdaten vorläufig gespeichert. Diese Daten können nur dann als endgültige Kalibrierungsdaten gespeichert werden, wenn alle Parameter neu kalibriert worden sind. So sind alle
Parameter erst einmal vorläufig gespeichert.
Bei der Speicherung von Daten werden auch Informationen bezüglich der durchgeführten bzw. nicht durchgeführten Kalibrierung gespeichert.
Zur Durchführung der Kalibrierung ist eine Reihe von Meßgeräten erforderlich. Die
für die Durchführung erforderlichen Informationen entnehmen Sie bitte den entsprechenden Handbüchern.
Weitere Information über die Kalibrierung siehe Kapitel 4 – 5. Kalibrierung auf
Seite 42.
8
Page 18
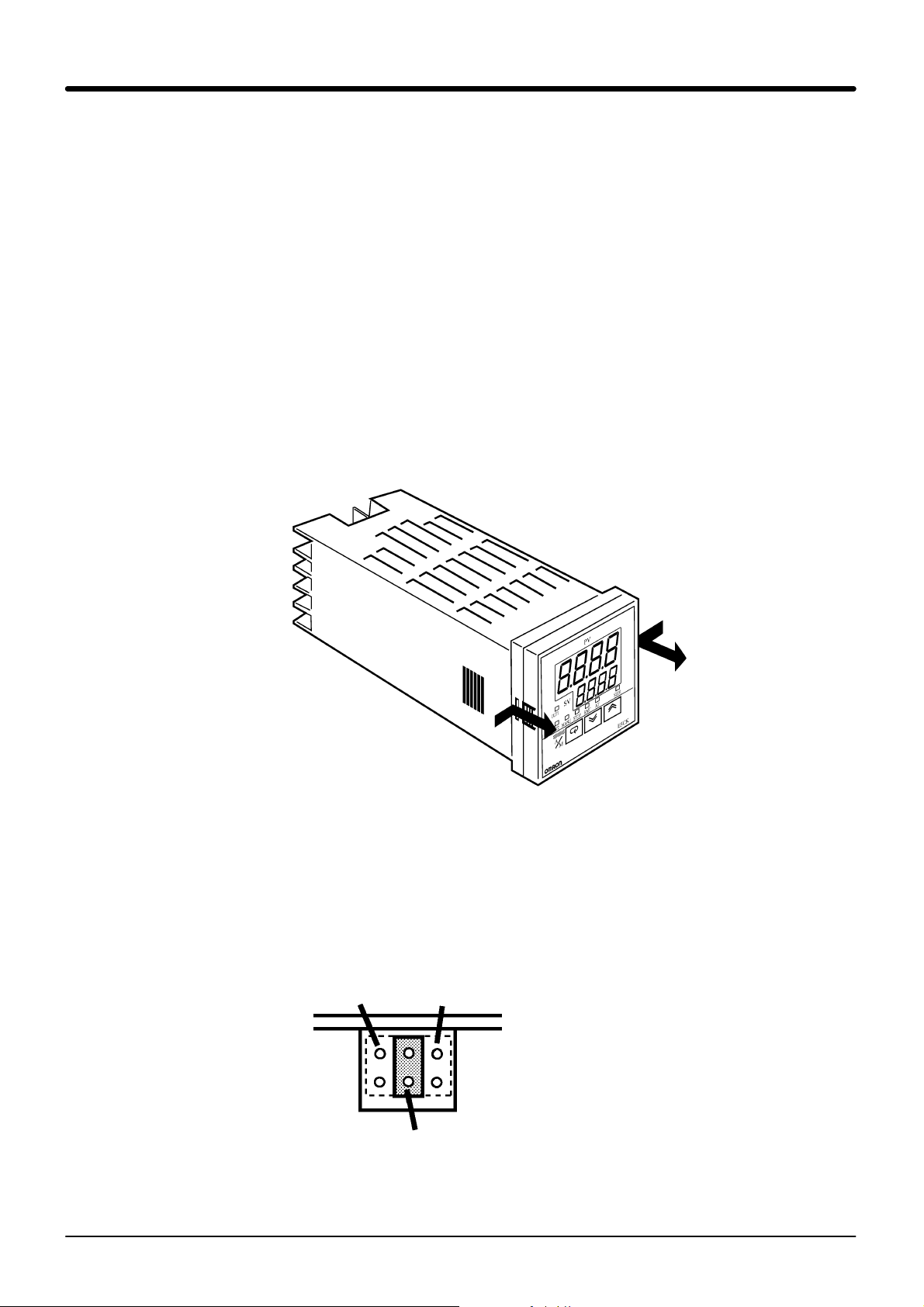
Kapitel 2 – Vor dem Betrieb
Dieses Kapitel beschreibt die Maßnahmen, die vor dem Einschalten des E5CK
durchzuführen sind.
1. Einstellung und Einbau
Nachfolgend wird die Einstellung des Eingangs–Wahlschalters und die Installation
der Ausgangs– und Kommunikations–Baugruppen beschrieben.
Gehäuse entfernen
Das Gehäuse muß zur Einstellung des Eingangs–Wahlschalters und für die Installation der Ausgangs– und Kommunikations–Baugruppen entfernt werden. Gehen
Sie dabei wie folgt vor:
– Drücken Sie die Haken auf der linken und rechten Seite der Frontseite zusam-
men und ziehen das Gehäuse nach hinten ab.
Abb. 4: Gehäuse nach hinten abziehen
Einstellen der Eingangsart
Weitere Information über den Eingangs–Wahlschalter siehe Seite 1.
Schalten Sie den Eingangs–Wahlschalter auf den gewünschten Eingang um. Fol-
gende Eingangsarten stehen zur Verfügung: Temperatureingang, Spannungs– und
Stromeingang. Die werkseitige Einstellung ist Temperatureingang.
I: Stromeingang V: Spannungseingang
TC.PT: Temperatureingang
Abb. 5: Eingangsarten
9
Page 19
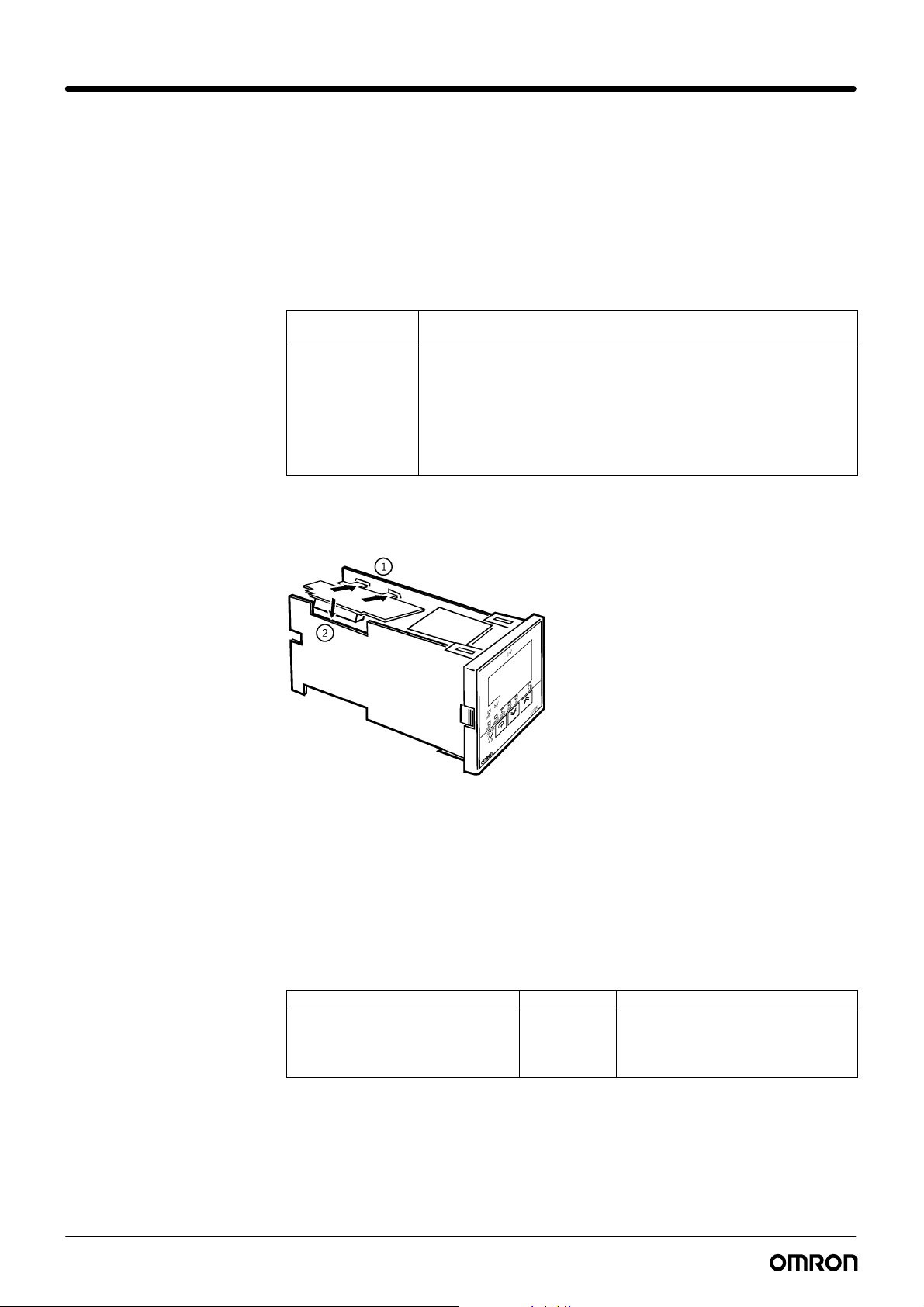
Kapitel 2 – Vor dem Betrieb
Installation der
Ausgangs–Baugruppe
Achten Sie bei der Installation des Jumpers zur Einstellung der Eingangsart darauf, daß Sie die Anschlußpunkte nicht berühren.
Haben Sie die Einstellung der Eingangsart abgeschlossen, installieren Sie das Gehäuse wieder. Achten Sie dabei darauf, daß die Verriegelungen wieder einrasten.
Folgende Ausgangs–Baugruppen stehen für den E5CK zur Verfügung:
Einbau
Modell
E53–R4R4
E53–Q4R4
E53–Q4HR4
E53–C4R4
E53–C4DR4
E53–V44R4
E53–Q4Q4
E53–Q4HQ4H
Relais / Relais
Spannung (NPN) / Relais
Spannung (PNP) / Relais
4...20 mA / Relais
0...20 mA / Relais
0...10 V/Relais
Spannung (NPN) / Spannung (NPN)
Spannung (PNP) / Spannung (PNP)
Abb. 6: Ausgangs–Baugruppen
(Regel–Ausgang 1/ Regel–Ausgang 2)
Spezifikationen
Installation der
Kommunikations–Baugruppe
Abb. 7: Einbau der Ausgangs–Baugruppe
– Auf der rechten Seite des E5CK befinden sich zwei rechteckige Aussparungen.
Hängen Sie die Ausgangs–Baugruppe in diese Aussparungen ein.
– Drücken Sie die Ausgangs–Baugruppe dann in die Anschlußleiste auf der lin-
ken Seite des E5CK.
Folgende Kommunikations–Baugruppen stehen für den E5CK zur Verfügung:
Baugruppe Modell Spezifikationen
Kommunikations–Baugruppe
Kommunikations–Baugruppe
Eingangs–Baugruppe
Kommunikations–Baugruppe
Abb. 8: Kommunikations–Baugruppen
E53–CK01
E53–CK03
E53–CKB
E53–CKF
Schnittstelle RS–232C
Schnittstelle RS–485
Ereigniseingang: 1 Eingang
Ausgang: 4...20 mA
10
Page 20
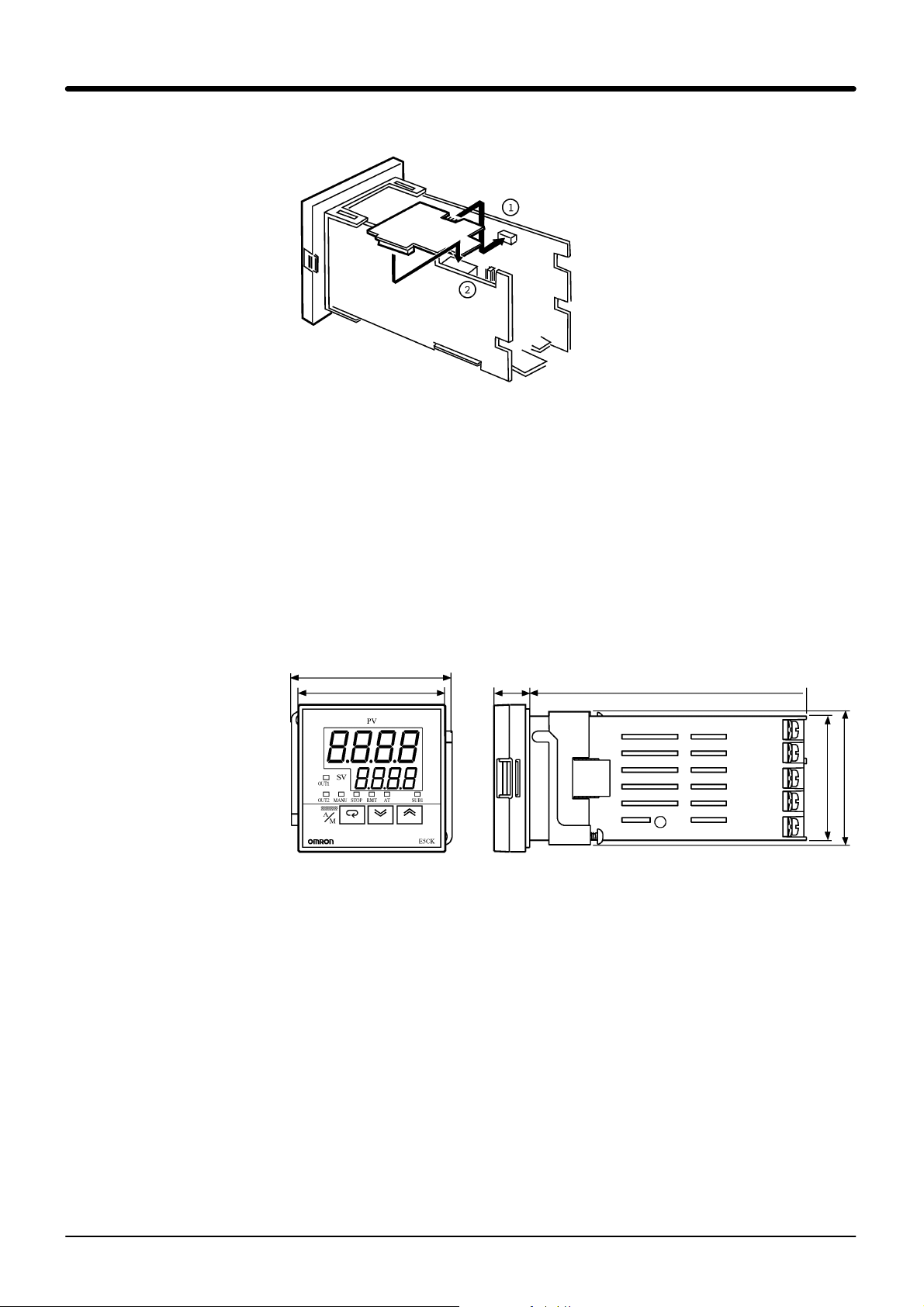
Kapitel 2 – Vor dem Betrieb
Einbau
Abb. 9: Einbau der Kommunikations–Baugruppe
– Drehen Sie den E5CK um und installieren die Baugruppe horizontal (rechte
Seite des Temperaturreglers).
– Drücken Sie dann die Kommunikations–Baugruppe in die Anschlußleiste auf
der linken Seite des E5CK.
2. Installation
Abmessungen (in mm)
58
53j 13 100
Abb. 10: Front– und Seitenansicht des E5CK
j
44.8
48
11
Page 21
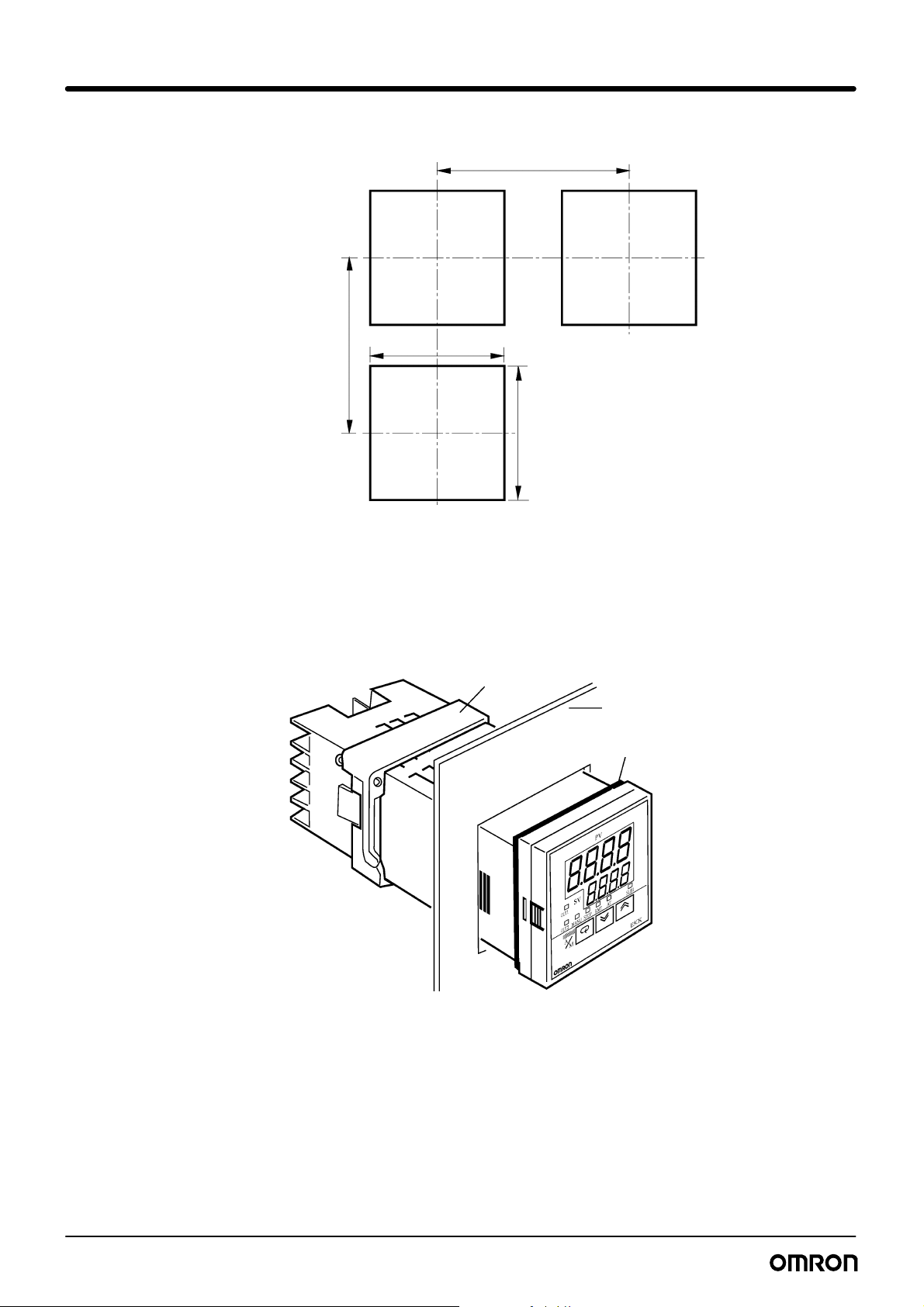
Kapitel 2 – Vor dem Betrieb
Schalttafel–Ausschnitt
Einheiten in mm.
min. 65 mm
Installation
min. 60 mm
Abb. 11: Ausschnitt und Abstand der Temperaturregler
45
+0.6
0
45
+0.6
0
– Die empfohlene Schalttafelstärke sollte 1...5 mm betragen.
– Halten Sie den Abstand zwischen den Temperaturreglern (vertikal und horizon-
tal) ein.
Befestigungs–Adapter
Schalttafel
Abdichtung
(gegen Spritzwassser)
12
Abb. 12: Installation des E5CK in der Schalttafel
– Führen Sie den Temperaturregler, entsprechend der obenstehenden Abbildung,
in die Schalttafel ein.
– Schieben Sie den Befestigungs–Adapter von hinten auf den E5CK und befesti-
gen ihn an der Schalttafel.
– Ziehen Sie die beiden Schrauben des Befestigungs–Adapters mit einem max.
Drehmoment von 0,29...0,39 Nm an.
Page 22
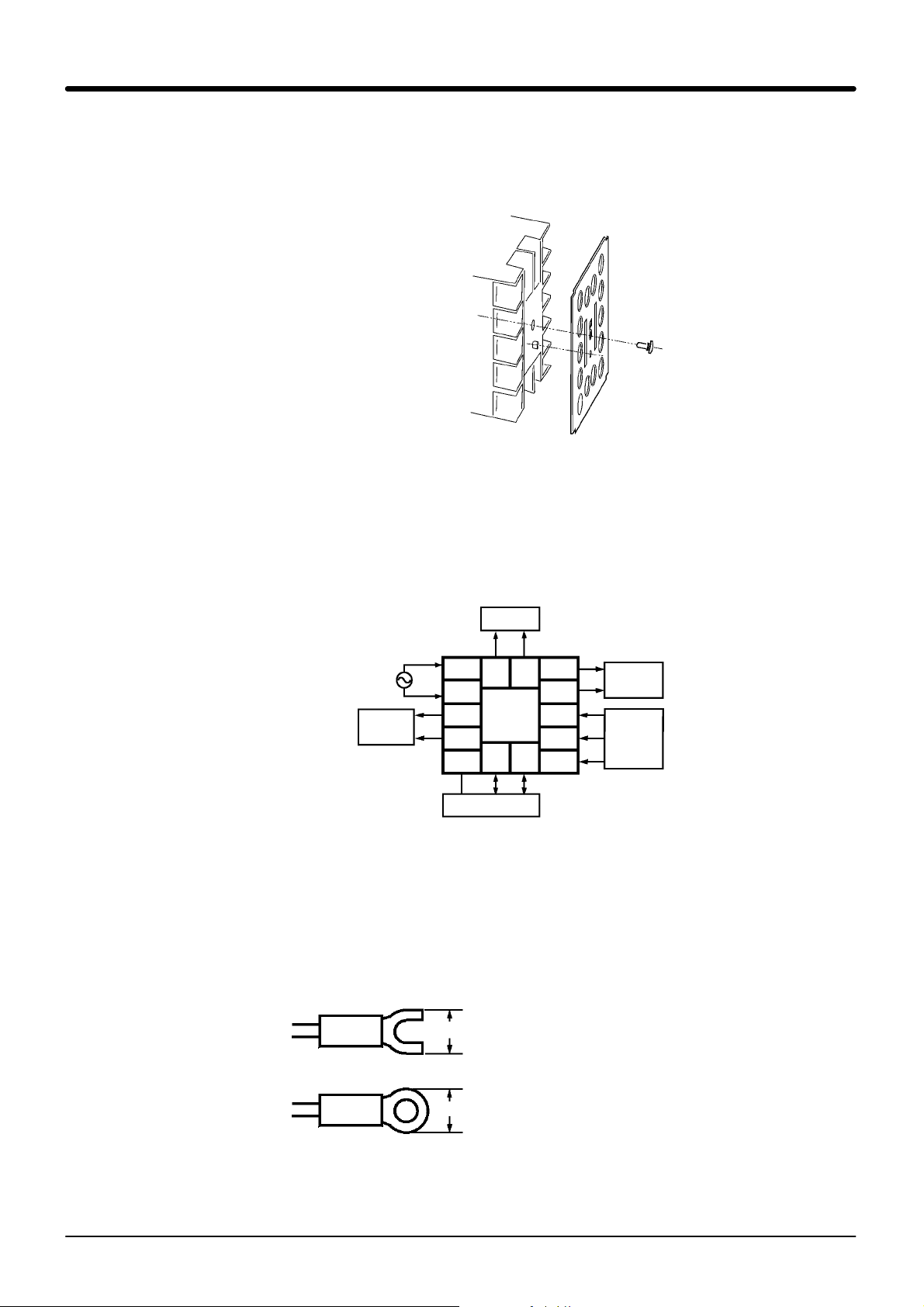
Kapitel 2 – Vor dem Betrieb
Klemmenabdeckung
installieren
Im Lieferumfang des Temperaturreglers E5CK–AA1–500 ist die Klemmenabdekkung E53–COV07 enthalten. Die Befestigung der Klemmenabdeckung ist nachfolgend dargestellt.
Abb. 13: Klemmenabdeckung für die Rückseite des E5CK
3. Klemmenverdrahtung
Klemmenanordnung
Sicherheitsmaßnahmen
bei der Verdrahtung
OUT1
5
100...240 VAC
(24 VAC/VDC)
SUB1
Abb. 14: Gesamte Klemmenanordnung
11 12
4
3
2
13 14
1
Kommunikation
10
9
8
7
6
OUT2
IN
Benutzen Sie separate Kabelkanäle für die Verlegung der Eingangs– und
Netzleitungen, um Störungen des Temperaturreglers auszuschließen.
Arbeiten Sie bei der Verdrahtung des E5CK mit Klemmenschuhen. Ziehen Sie die
Klemmen mit einem max. Drehmoment von 0,78 Nm an.
Benutzen Sie die folgenden Klemmenschuhtypen:
7.2mm max.
Abb. 15: Klemmenschuhe
7.2mm max.
13
Page 23
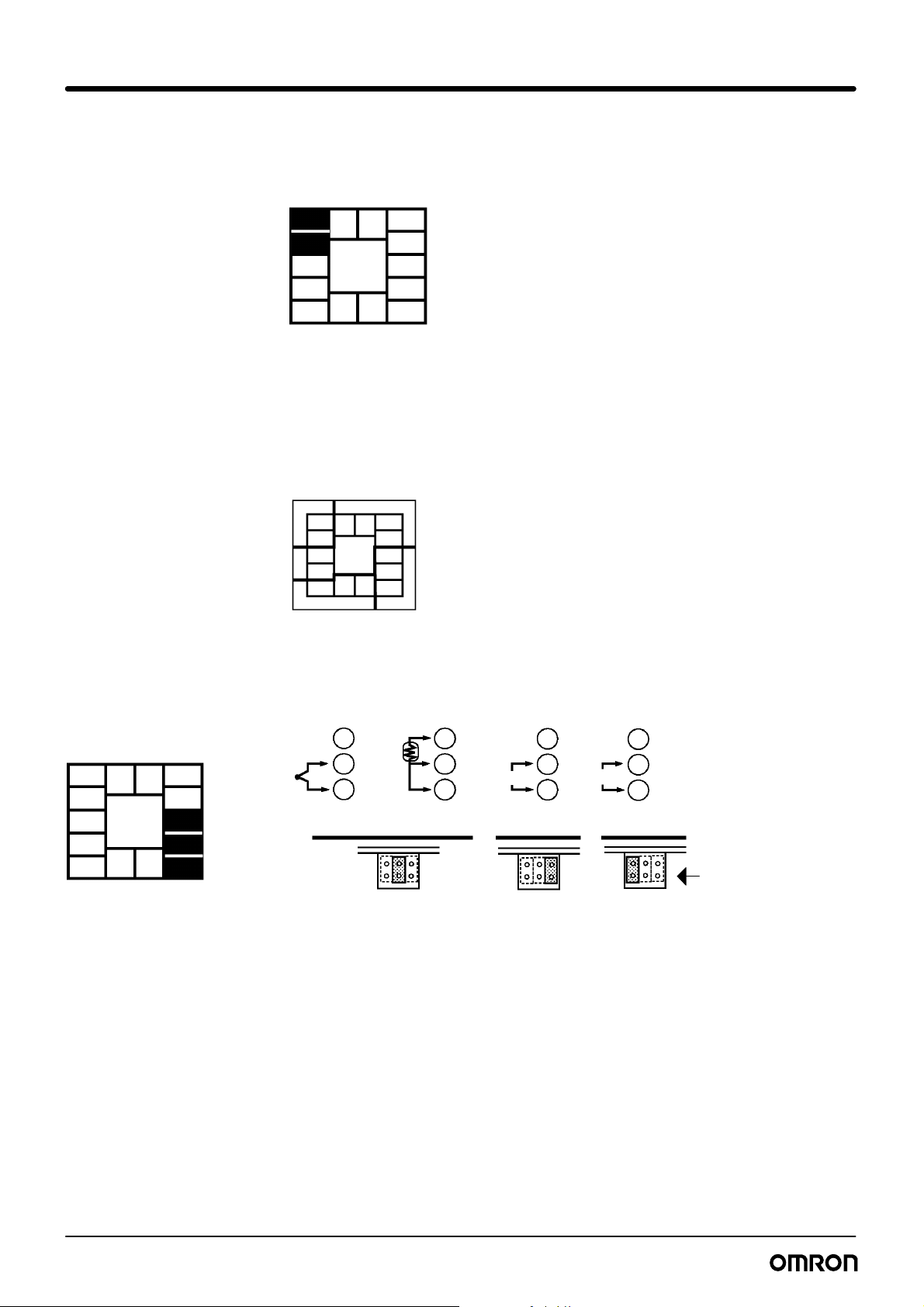
Kapitel 2 – Vor dem Betrieb
Verdrahtung
Spannungsversorgung
Spannungsblöcke
Legen Sie an die Klemmen 4 und 5 max. eine Spannung von 100...240 VAC,
50/60 Hz und ca. 15 VA (24 VAC/DC, 50/60 Hz, 6 VA, 3,5 W).
5
5
11 12
4
4
3
2
13 14
1
Abb. 16: Belegung der Spannungsversorgungs–Klemmen
10
9
8
7
6
Der E5CK verfügt über unabhängige Spannungsversorgungen für jeden Klemmenblock (A, B, C und D). Beachten Sie jedoch, daß die Spannungsversorgung für
Block C und D gleichzeitig von der Kommunikations–Baugruppe (E53–CKB oder
E53–CKF) genutzt wird.
AC
5
4
3
C
2
1
D
11 12
13 14
10
9
8
7
6
B
Eingang
5
4
3
2
1
11 12
13 14
10
Abb. 17: Einteilung in Spannungsblöcke
Belegen Sie die Eingangsklemmen 6...8 entsprechend der Eingangsbeschaltung.
8
–
7
9
8
8
7
7
6
6
Thermoelement
6
+
Platin–Widerstandsthermometer
TC ⋅PT V I
Abb. 18: Eingangsbeschaltung
8
7
6
8
–
7
V
6
+
Spannungseingang
8
–
7
mA
6
+
Stromeingang
Einstellungen des
Eingangs–Wahlschalters
(Jumper).
Passen Sie die Eingangsbeschaltung über den Eingangs–Wahlschalter an. Für die
Beschaltung mit einem Thermoelement oder Plantin–Widerstandsthermometer
wird die gleiche Einstellung (TC/PT) des Eingangs–Wahlschalters gewählt. Weitere
Informationen über den Eingangs–Wahlschalter siehe Seite 9.
14
Page 24
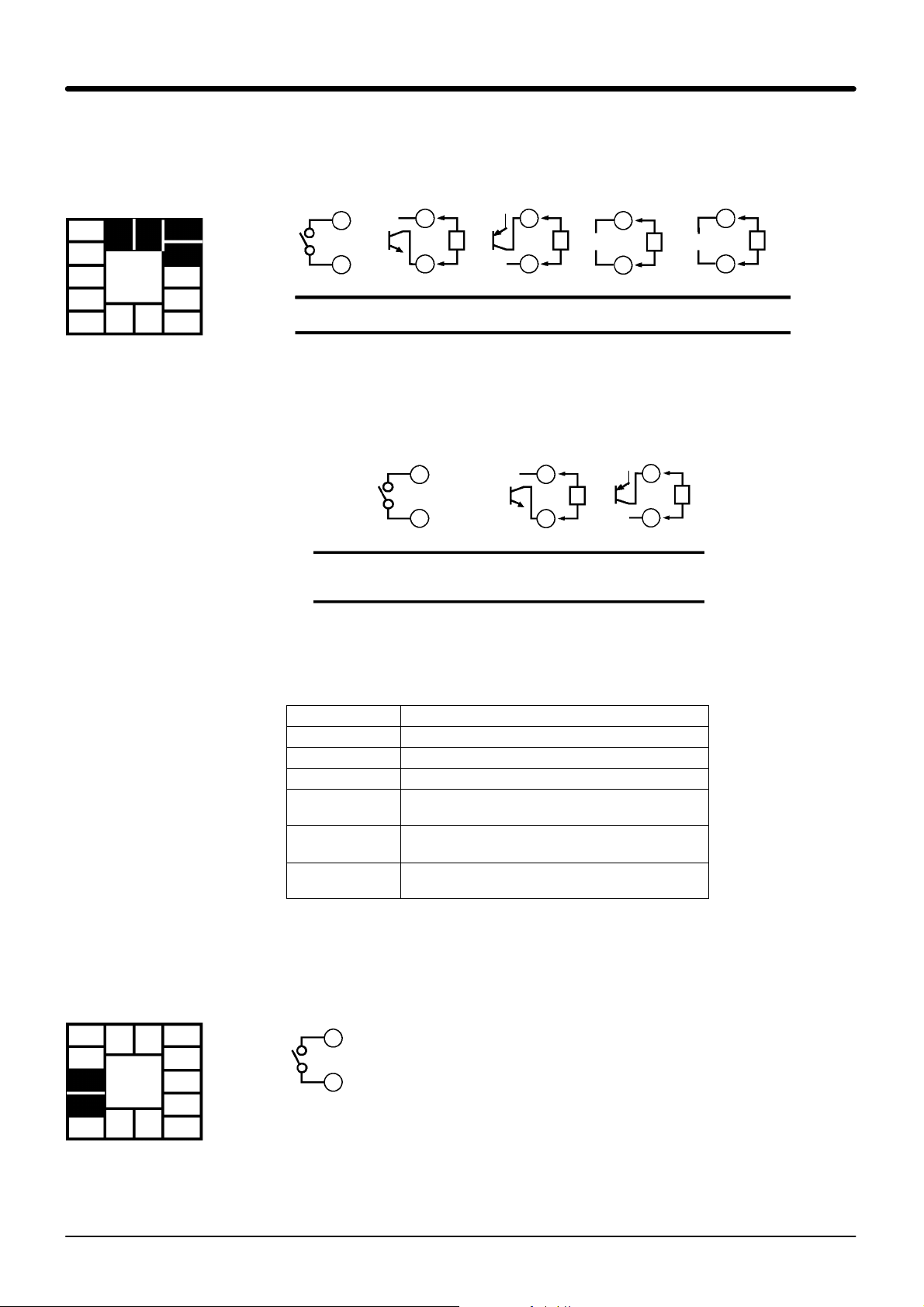
Kapitel 2 – Vor dem Betrieb
0
mA
0
zulässige Lastim edanz: max. 500 Ω
Regelausgang
5
11 12
4
3
2
13 14
1
10
Die Klemmen 11 und 12 sind für den Regelausgang 1 (OUT1) belegt. Fünf Ausgangsbeschaltungen stehen zur Verfügung:
+V
11
9
8
7
6
12
Relais
E53–R4R4 E53–Q4R4
+
11
12
–
NPN PNP 0...10V 4...20 mA/0...20 mA
E53–Q4Q4
+V
L
GND
E53–Q4HR4
E53–Q4HQ4H
Abb. 19: Beschaltungsmöglichkeiten des Regelausgangs 1
11
12
+
L
–
+
11
12
L
–
V
E53–V44R4 E53–C4R4
+
11
mA
12
–
E53–C4DR4
L
Die Klemmen 9 und 10 sind für den Regelausgang 2 (OUT2) belegt. Drei Ausgangsbeschaltungen stehen zur Verfügung:
10
9
Relais
E53–R4R4 / E53–V44R4
E53–Q4R4 / E53–C4R4
E53–Q4HR4 / E53–C4DR4
+V
+
10
9
NPN PNP
E53–Q4Q4 E53–Q4HQ4H
+V
L
GND
–
10
+
L
9
–
Hilfsausgang 1
5
11 12
4
3
2
13 14
1
10
Abb. 20: Beschaltungsmöglichkeiten des Regelausgangs 2
Die folgende Tabelle zeigt die Spezifikationen für jeden Ausgangstyp an.
Ausgangstyp Spezifikationen
Relais 250 VAC, 3 A
Spannung (NPN) 12 VDC, 20 mA (mit Kurzschluß–Schutz)
p
Spannung (PNP) 12 VDC, 20 mA (mit Kurzschluß–Schutz)
0...10 V 0...10 VDC, zulässige Lastimpedanz: min. 1 kΩ;
Auflösung: Ca. 2600
4...20 mA 4...20 mA, zulässige Lastimpedanz: max. 500 Ω;
Auflösung: Ca. 2600
0...20 mA 0...20 mA, zulässige Lastimpedanz: max. 500 Ω;
...20
...20 mA,
Auflösung: Ca. 2600
Abb. 21: Ausgangsspezifikationen
Die Klemmen 2 und 3 werden von dem Hilfsausgang 1 (SUB1) belegt. Folgende
Ausgangsbeschaltung steht zur Verfügung.
3
9
8
7
6
2
Relais–Spezifikation:
SPST–NO, 250 VAC, 1 A
Abb. 22: Beschaltung des Hilfsausgangs 1
15
Page 25
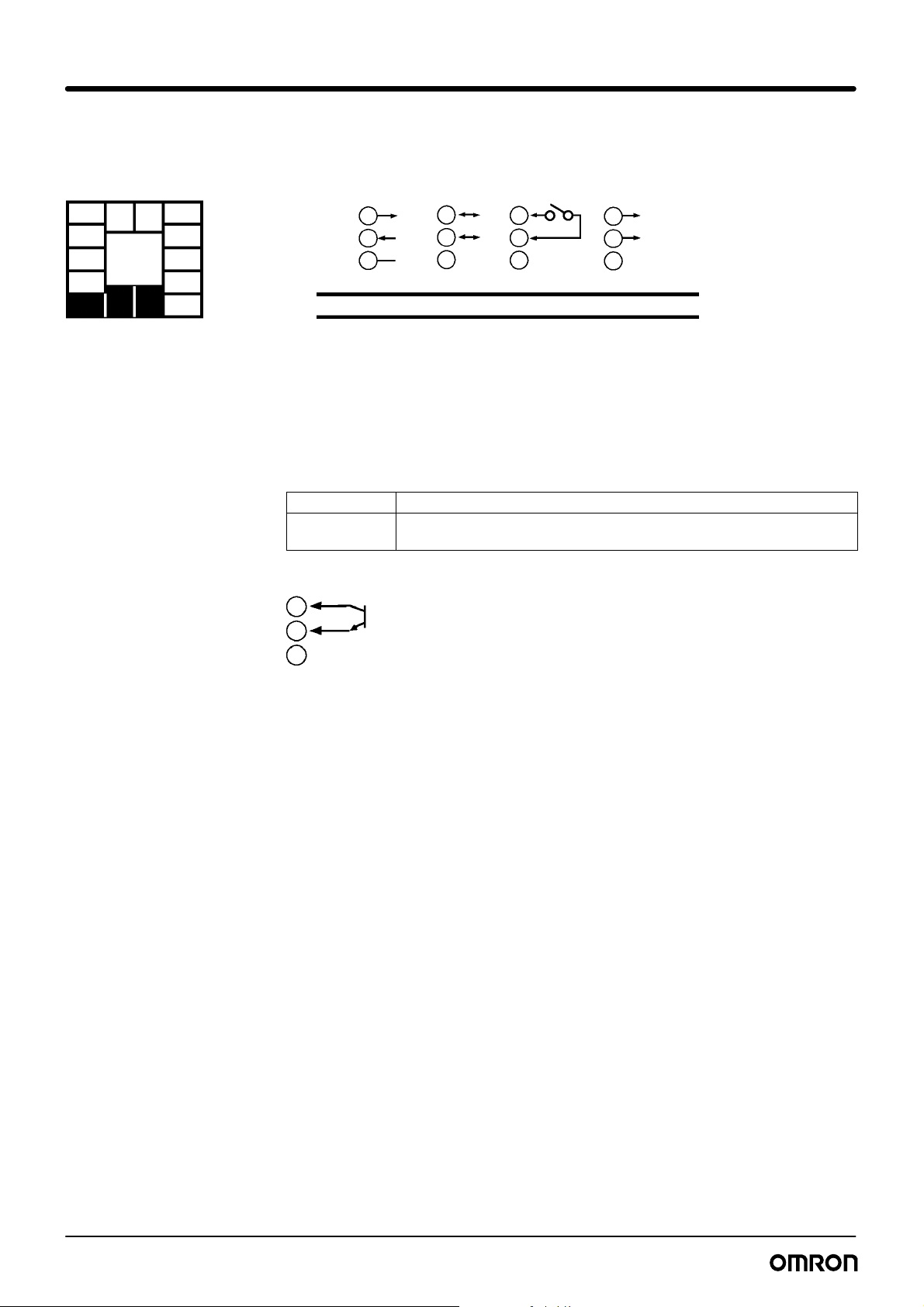
Kapitel 2 – Vor dem Betrieb
Kommunikations–
Baugruppe
5
4
3
2
1
11 12
13 14
10
Die Klemmen 1, 13 und 14 können nur von der Kommunikations–Baugruppe belegt werden. Folgende Beschaltung steht zur Verfügung.
SD A +
13
9
8
7
6
RD
14
SG
1
RS–232C
E53–CK01
13
B
14
1
RS–485
E53–CK03
13
14
1
Ereigniseingang
E53–CKB E53–CKF
13
4...20 m A
14
–
1
Übertragungsausgang
Abb. 23: Beschaltung des Kommunikationsausgangs
Weitere Informationen zu der RS–232C / RS–485 Kommunikation siehe Kaptel 6 –
Einsatz der Kommunikationsfunktion.
Benutzen Sie den Ereigniseingang unter den folgenden Bedingungen:
Kontakteingang EIN: max. 1 KΩ; AUS: min. 100 KΩ;
Kontaktloser Ein-
gang
EIN: max. 1,5 V Restspannung; AUS: max. 0,1 mA Leckstrom
Polarität des kontaktlosen Eingangs
+
13
14
–
1
Abb. 24: Eingangsbeschaltung
Übertragungsausgangs–Spezifikation:
4...20 mA, max. Lastimpedanz max. 500 Ω; Auflösung: ca. 2600
16
Page 26
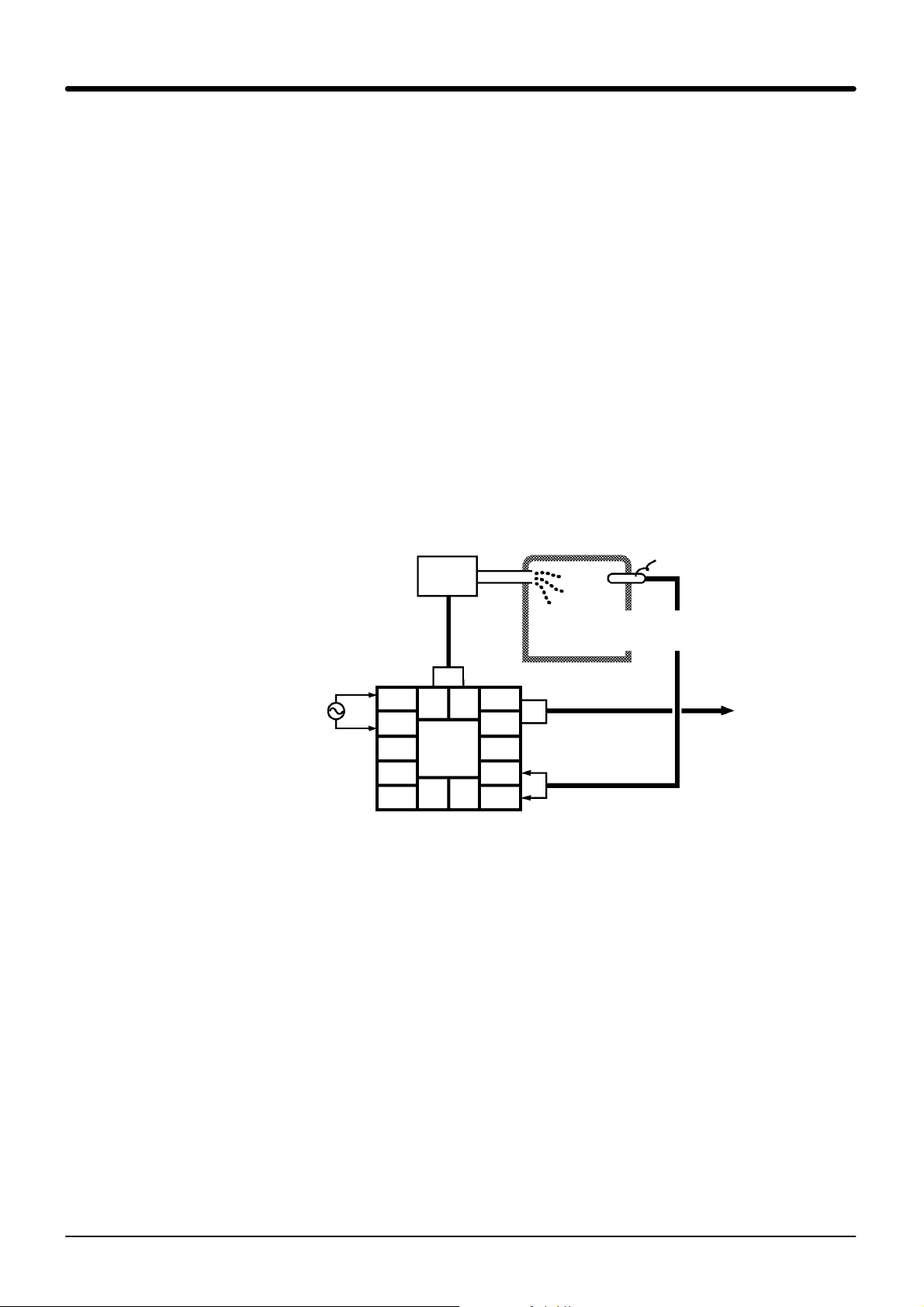
Kapitel 3 – Basiseinstellungen
1. Regelkreis–Beispiel
Nachfolgend ist ein Beispiel für einen einfachen Regelkreis dargestellt, um die
Funktionen des Temperaturreglers E5CK vorzustellen.
Folgende Randbedingungen sind gegeben:
Ein Luftfeuchtigkeitsensor mit einem Ausgang von 4...20 mA wird mit dem E5CK
verbunden. Der Messbereich des Luftfeuchtigkeitsensors liegt bei 10...95 %.
Um die Luftfeuchtigkeit auf einem konstanten Wert von 60 % zu halten, wird die
Regelung der Flüssigkeitzufuhr über den Puls–Ausgang OUT1 vorgenommen.
Ein Alarm wird ausgegeben, wenn die Luftfeuchtigkeit den oberen Grenzwert von
70% oder unteren Grenzwert von 50% über– bzw. unterschreitet.
Ein–/Ausgangs–
spezifikation
Ausgangs–Baugruppe: Relais/Relais–Typ (E53–R4R4)
Einstellung der Eingangart: I (Stromeingang)
Regelung
der Flüssigkeitzufuhr
OUT1
100...240VAC
(24 VAC/DC)
5
4
3
2
1
E5CK
11 12
13 14
Abb. 25: Regelung der Luftfeuchtigkeit über den E5CK
Bereich, in dem die Luftfeuchtigkeit konstant gehalten werden
soll.
10
9
8
7
6
OUT2
4...20mA
Sensor zur Messung
der Luftfeuchtigkeit
Alarm 1
(Abweichung vom
oberen und unteren
Grenzwert der Luftfeuchtigkeit werden
gemeldet)
17
Page 27
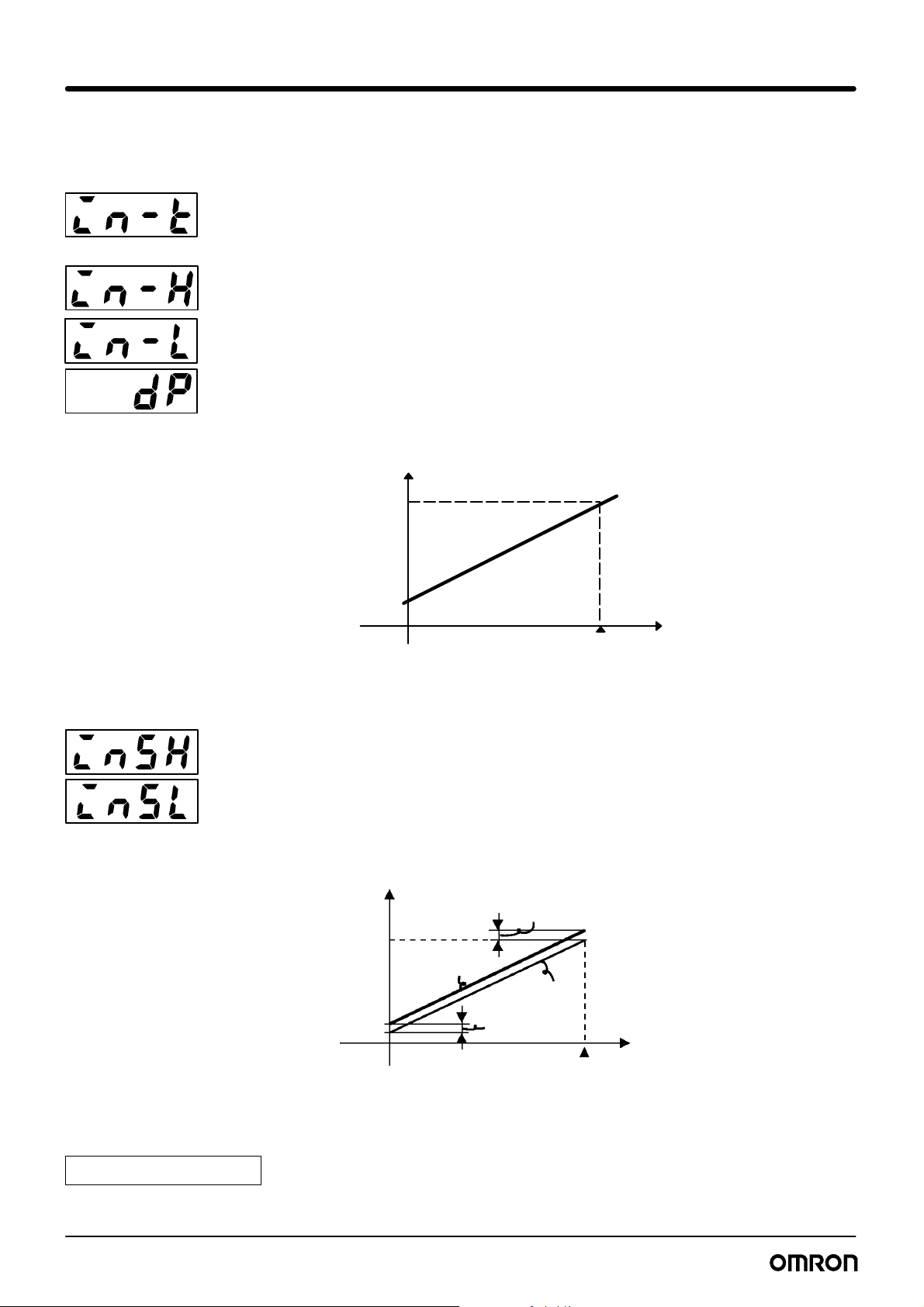
Kapitel 3 – Basisbetrieb
2. Einstellen der Eingangsspezifikationen
Eingangsart
Skalierung
Einstellen der Typ–Nr. (0...21) über Parameter ”Eingangs–Typ”. Die werkseitige
Einstellung ist ”2: K1 (Thermoelement)”.
Weitere Informationen über Eingangsarten und Einstellbereiche siehe Seite 70.
Wurde ein Spannungseingang und ein Stromeingang ausgewählt, ist eine Skalie-
rung (Anpassung) der Regelung erforderlich.
Folgende Parameter werden in der Setup–Betriebsart skaliert: ”Oberer Grenzwert”,
”Unterer Grenzwert” und ”Dezimalpunkt”.
Parameter ”Oberer Grenzwert” definert den oberen Eingangs–Grenzwert und Pa-
rameter ”Unterer Grenzwert” den unteren Eingangs–Grenzwert. Parameter ”Dezimalpunkt” definiert die Anzahl der Nachkommastellen.
Das folgende Beispiel zeigt die Skalierung eines 4...20 mA–Eingangs. Nach der
Skalierung kann die Luftfeuchtigkeit direkt abgelesen werden. In diesem Fall kann
Parameter ”Dezimalpunkt” auf 1 gesetzt werden.
Ausgang (Luftfeuchtigkeit)
Skalierung oberer
Grenzwert (95 %)
Skalierung unterer
Grenzwert (10 %)
0
100 % FS
Eingang (4...20 mA)
Änderung eingeben
Abb. 26: Skalierung eines 4...20 mA–Eingangs
Wurde der Eingang als Temperatureingang definiert, ist eine Skalierung nicht erforderlich. Beachten Sie jedoch, daß die oberen und unteren Grenzwerte verändert
(verschoben) werden können. Wird bspw. eine Änderung um 1,2 _C für den oberen und unteren Grenzwert vorgegeben, ändert sich in diesem Beispiel der obere
Grenzwert von 200 _C auf 201,2 _C. Auch der untere Grenzwert muß um diesen
Betrag verschoben werden.
Die Änderungs–Eingabe erfolgt in der Betriebsart Ebene 2 über die Parameter ”input shift upper limit” und ”input shift lower limit”.
Temperatur
Input shift upper limit: Eingangsverschiebung oberer Grenzwert
berer Grenzwert
Nach Änderung
nterer Grenzwert
0
Input shift lower limit: Eingangsverschiebung unterer Grenzwert
Abb. 27: Verschiebung der oberen und unteren Grenzwerte
Vor Änderung
Eingang (%FS)
100
Hinweis
18
Die Umschaltung des Temperaturreglers von ”_C” auf ”_F” kann über Parameter
_C/_F–Selection vorgenommen werden.
Page 28
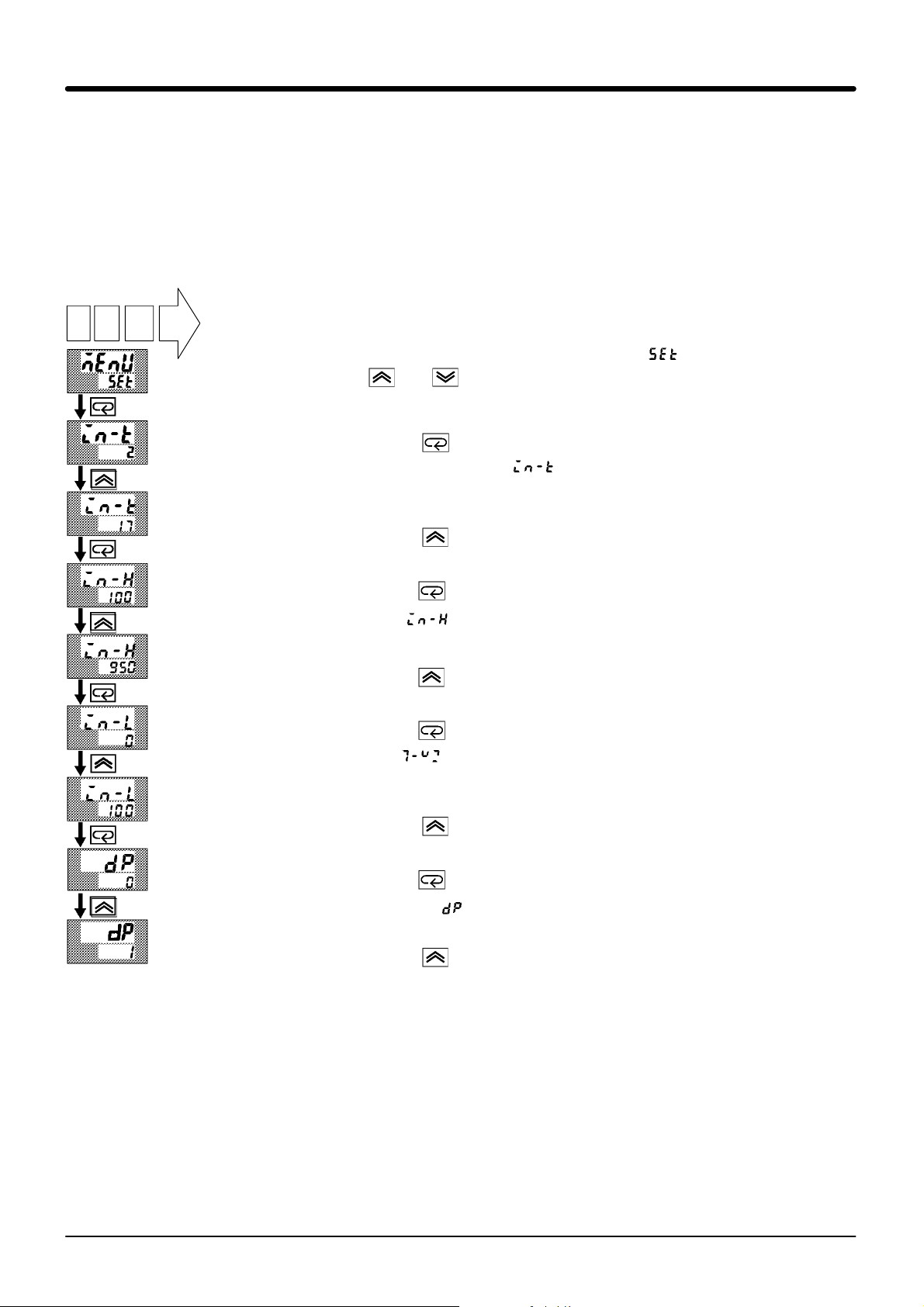
Kapitel 3 – Basisbetrieb
Beispiel
1.
2. 3. ...
Definieren Sie folgende Parameter:
– Eingangsart: 17 (4...20 mA)
– Skalierung oberer Grenzwert: 950
– Skalierung unterer Grenzwert: 100
– Dezimalpunkt: 1
Parameter–Eingabe
1. Rufen Sie die Menüanzeige auf. Wählen Sie [ ] (Setup–Betriebsart)
über die oder Tasten. Weitere Informationen über das Aufrufen der
Menüanzeige siehe Seite 6.
2. Drücken Sie die Taste, um die Setup–Betriebsart aktivieren. Als Startparameter der Setup–Betriebsart [ ] wird “Eingangsart” angezeigt. Die
Werkseinstellung ist ”2”.
3. Drücken Sie die Taste, bis die Anzeige ”17” anzeigt.
4. Drücken Sie die Taste, um den Sollwert einzugeben. Auf der Anzeige wird
die Meldung [ ] angezeigt (Oberer Grenzwert). Die Werkseinstellung ist
”100”.
5. Drücken Sie die Taste, bis die Anzeige ”950” anzeigt.
6. Drücken Sie die Taste, um den Sollwert einzugeben. Auf der Anzeige wird
die Meldung [ ] angezeigt (Unterer Grenzwert). Die Werkseinstellung ist
”0”.
7. Drücken Sie die Taste, bis die Anzeige ”100” anzeigt.
8. Drücken Sie die Taste, um den Sollwert einzugeben. Auf der Anzeige wird
die Meldung [ ] angezeigt (Dezimalpunkt). Die Werkseinstellung ist ”0”.
9. Drücken Sie die Taste, bis die Anzeige ”1” anzeigt.
19
Page 29
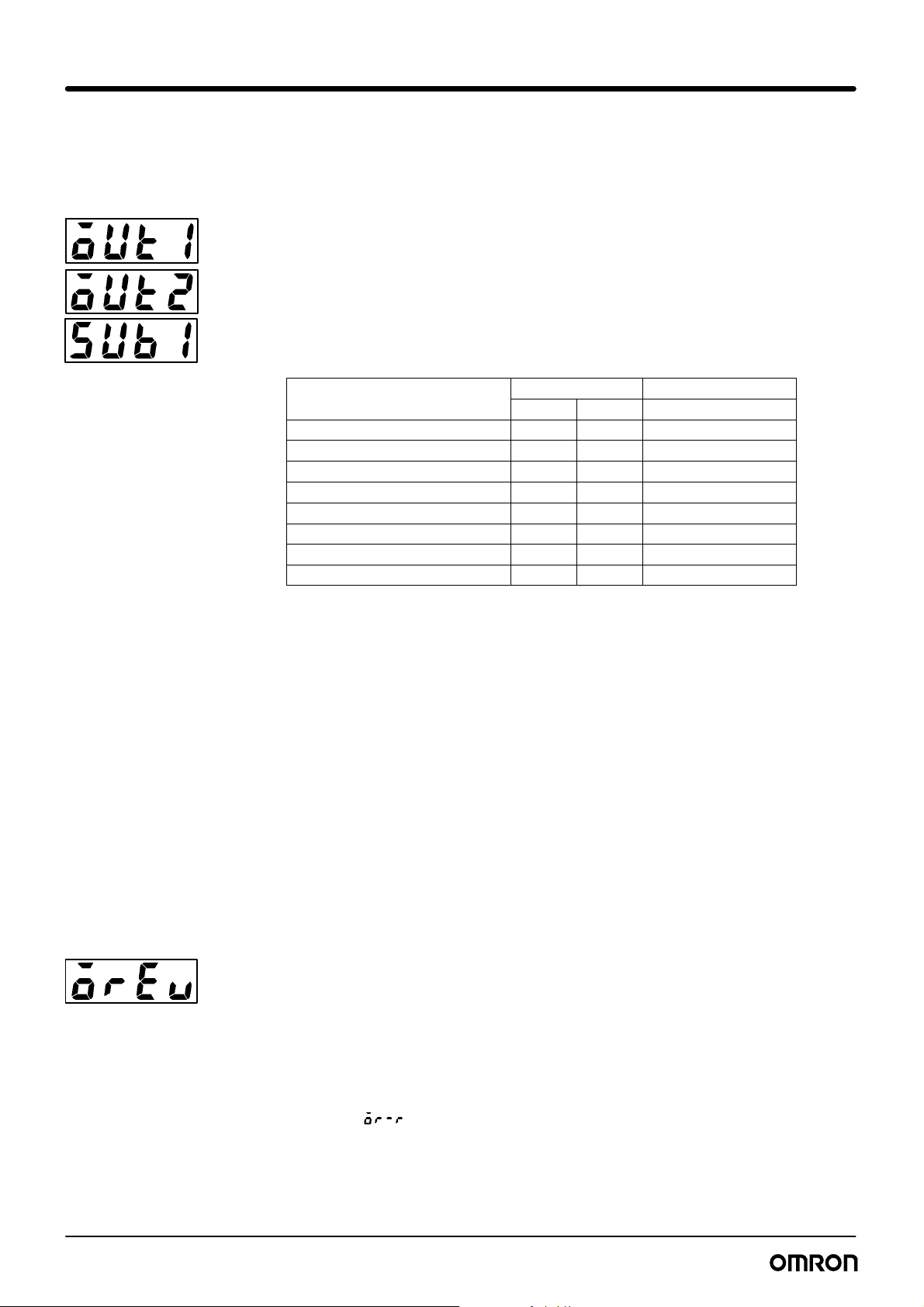
Kapitel 3 – Basisbetrieb
Zuweisung
3. Einstellen der Ausgangsspezifikationen
Ausgangs–Zuweisungen
Acht Ausgänge werden angeboten:
– Regelausgang (Heizen)
– Regelausgang (Kühlen)
– Alarmausgänge 1...3
– LBA
– Fehler 1 (Eingangsfehler)
– Fehler 2 (A/D– Konvertierungsfehler).
In der folgenden Tabelle ist die Zuweisung der 8 Ausgänge dargestellt.
Ausgangs–Funktion
Zuweisung
Regelausgang (Heizen) F F
Regelausgang (Kühlen) F F
Alarm 1 F F F
Alarm 2 F F F
Alarm 3 F F F
LBA (Regelkreisunterbrechung) F F F
Fehler 1; Eingangsfehler F
Fehler 2; A/D–Konvertierfehler F
Abb. 28: Zuweisung der Ausgänge
Regelausgang Hilfsausgang
1 2 1
Direkt–/Reverse–Betrieb
Die Heiz– und Kühlregelung wird durchgeführt , wenn die Funktion ”Kühlen” dem
Regelausgang zugewiesen wird. Die Standard–Regelung wird durchgeführt, wenn
keine Funktion dem Regelausgang zugewiesen wird. Weitere Informationen zur
Heiz– und Kühlregelung siehe ”Kapitel 4 – 1. Auswahl der Regelungsart” auf Seite
33.
Werkseitige Einstellungen:
– Regelausgang (Heizen) = Regelausgang 1
– Alarm 1 = Regelausgang 2
– Alarm 2 = Hilfsausgang 1
Ausgangszuweisungen für die Einstellung der Parameter “Zuweisung des Regel–
ausgangs 1”, ”Zuweisung des Regelausgangs 2” und ”Zuweisung des Hilfsausgangs 1” werden in der Betriebsart SETUP vorgenommen.
Der Direkt– oder Normal–Betrieb entspricht einer Regelung, bei der der Ausgangs–Stellwert (MV) proportional zu der Zunahme des Istwert ansteigt. Bei dem
Reverse–Betrieb wird der Ausgangs–Stellwert (MV) proportional zu der Abnahme
des Istwertes verringert.
Ist zum Beispiel in einem Heizkreissystem der Istwert (PV) niedriger als der Sollwert (SP), erfolgt eine Nachregelung um den Differenzbetrag der beiden Werte. In
diesem Heizkreissystem handelt es sich um eine Abnahme des Ausgangs–Stellwertes, also um den Reverse–Betrieb. In einem Kühlkreissystem würde es sich
(Istwert höher als Sollwert) dann um den Normal– oder Direkt–Betrieb handeln.
20
Der Direkt(Norm al) – oder Reverse–Bet rieb wird in der Set up–B et riebs art über den
Parameter [ ] ”Direk t/ Rever se–Bet rieb” eingest ellt.
Page 30
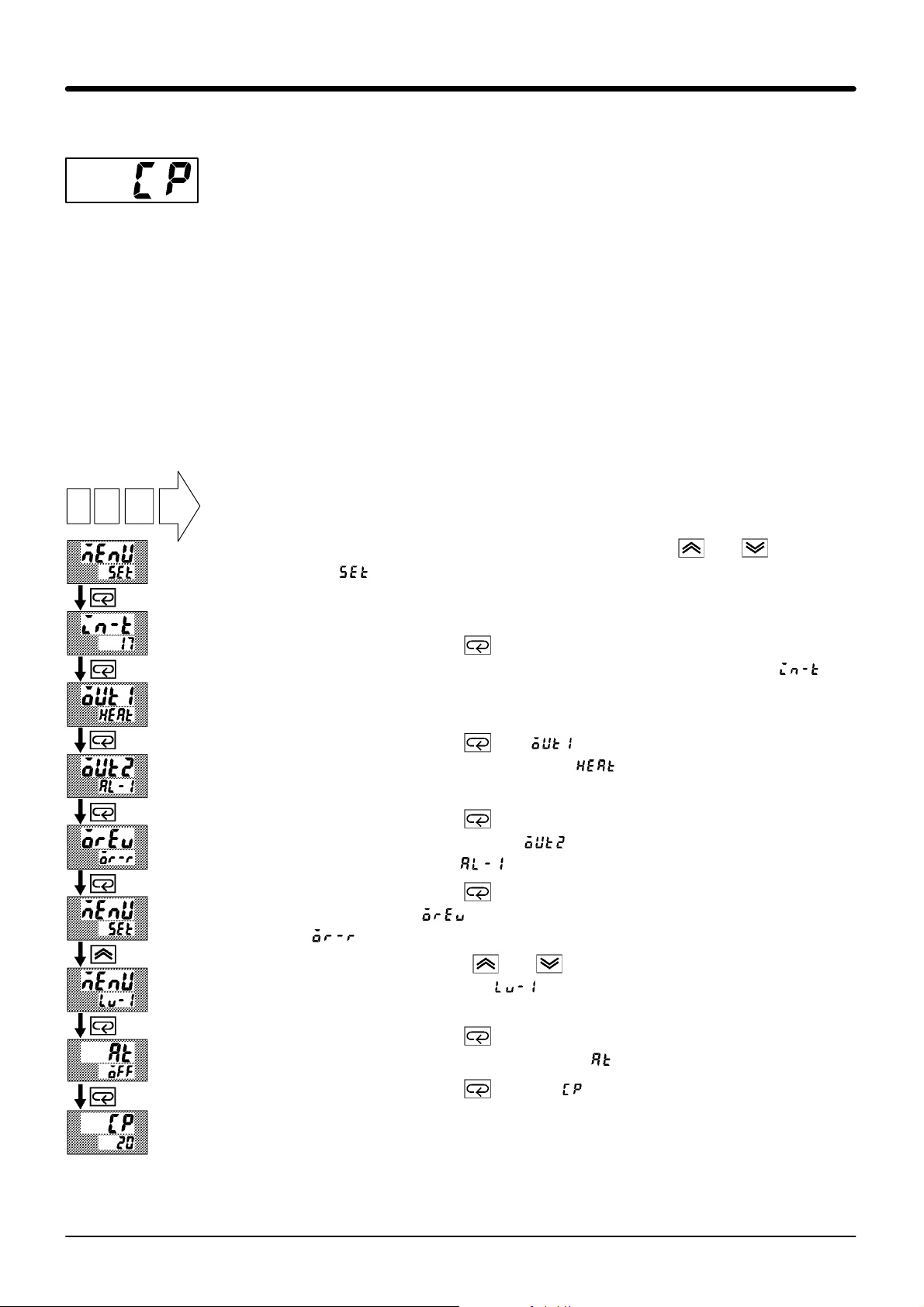
Kapitel 3 – Basisbetrieb
Regelzyklus
Beispiel
1.
2. 3. ...
Wird der Ausgang mit einer Puls–Baugruppe (z.B. Relais) beschaltet, muß der
Puls–Ausgabezyklus (Regelzyklus) definiert werden. Je kürzer der Puls–Ausgabezyklus eingestellt wird, um so genauer und schneller arbeitet die Regelung. Bedenken Sie jedoch, daß die Lebenserwartung einer Relais–Baugruppe dadurch
reduziert wird.
Der Regelzyklus wird in der Betriebsart Ebene 1 über Parameter ”Regelzyklus
(Heizen)” eingestellt. Die werkseitige Einstellung ist ”20:20 Sekunden”.
Definieren Sie die folgenden Parameter:
– Zuweisung Regelausgang1: Regelausgang (Kühlen)
– Zuweisung Regelausgang 2: Alarmausgang 1
– Direkt–/Reverse–Betrieb: Reverse–Betrieb
– Regelzyklus: 20 Sekunden
Bei allen Einstellungen handelt es sich um werkseitige Einstellungen. Alle Einstellungen werden in dem nachfolgenden Beispiel vorgenommen.
Parameter–Eingabe
1. Rufen Sie die Menüanzeige auf. Wählen Sie über die oder Tasten die
[ ] Setup–Betriebsart an. Weitere Informationen über das Aufrufen der
Menüanzeige siehe Seite 6.
1 second min.
2. Drücken Sie die Taste , um die Setup–Betriebsart zu aktivieren. Der erste
angezeigte Parameter in der Setup–Betriebsart ist die Eingangsart [ ]. In
diesem Beispiel wird die Einstellung 17 (4...20 mA) angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste , bis [ ] (Zuweisung des Regelausgang 1) angezeigt wird. Der Werkseinstellung ist [ ].
4. Drücken Sie die Taste , um die Zuweisung des Regelausgangs 2 einzustellen. Auf der Anzeige erscheint [ ] (Zuweisung des Regelausgangs 2). Die
Werkseinstellung ist [ ].
5. Drücken Sie die Taste , um den Reverse–Betrieb einzustellen. Auf der Anzeige erscheint [ ] (Direkt–/Reverse–Betrieb). Die Werkseinstellung ist
[ ].
6. Drücken Sie die Tasten oder , um die Betriebsart Ebene 1 einzustellen.
Auf der Anzeige erscheint [ ] (Betriebsart Ebene 1). Weitere Informationen
über das Aufrufen der Menüanzeige siehe Seite 1–7.
7. Drücken Sie die Taste , um die Betriebsart Ebene 1 zu aktivieren. Start–Parameter der Betriebsart Ebene 1 ist [ ] (AT ausführen/abbrechen).
8. Drücken Sie die Taste , bis [ ] (Regelzyklus) angezeigt wird. Die
Werkseinstellung ist 20. Die Einstellung ist korrekt. Verlassen Sie anschließend
den Tasten–Betrieb.
21
Page 31

Kapitel 3 – Basisbetrieb
4. Randbedingungen des Alarmausgangs einstellen
Drei Alarmausgänge werden angeboten: Alarme 1..3. Sie müssen einem Ausgang
zugewiesen werden.
Jedem Alarmausgang wird über folgende Alarm–Randbedingungen definiert:
Alarmbetrieb, Alarmwert und Alarmhysterese. Die Definition kann aus einer oder
mehreren Randbedingungen bestehen.
Die Schaltbedingungen des Alarmausgang (für den Fall das der Alarmausgang auf
EIN gesetzt wird) können auf ÖFFNEN oder SCHLIEßEN über Parameter ”Bei
Alarm öffnen / Bei Alarm schließen” eingestellt werden.
Alarmbetrieb
Folgende Alarmbetriebe werden unterstützt:
Alarmbetrieb Alarmausgang
X: positiver Wert X: negativer Wert
1 Oberer und unterer Grenzwert–
Alarm
(Regelabweichung)
2 Oberer Grenzwert–Alarm (Rege-
labweichung)
3 Unter Grenzwert–Alarm (Regelab-
weichung)
4 Oberer und unterer Grenzwert–Be-
reichsalarm
(Regelabweichung)
5 Oberer und unterer Grenzwert–
Alarm mit Bereitschaft
(Regelabweichung)
6 Oberer Grenzwert–Alarm mit
Bereitschaft (Regelabweichung)
7 Unterer Grenzwert–Alarm mit
Bereitschaft (Regelabweichung)
8 Oberer Grenzwert–Alarm (Absolut-
wert)
9 Unterer Grenzwert–Alarm (Abso-
lutwert)
10 Oberer Grenzwert–Alarm mit Be-
reitschaft
(Absolutwert)
11 Unterer Grenzwert–Alarm mit Be-
reitschaft
(Absolutwert)
EIN
AUS
EIN
AUS
EIN
AUS
EIN
AUS
EIN
AUS
EIN
AUS
EIN
AUS
EIN
AUS
EIN
AUS
EIN
AUS
EIN
AUS
XX
SP
SP
X
XX
SP
XX
SP
SP
X
SP
X
0
X
0
X
0
X
0
SP
X
X
Immer EIN
EIN
AUS
EIN
AUS
Immer AUS
Immer AUS
EIN
AUS
EIN
AUS
EIN
AUS
EIN
AUS
EIN
AUS
EIN
AUS
X
SP
X
SP
X
SP
X
SP
X
0
X
0
X
0
X
0
22
Der Alarmbetrieb wird unabhängig für jeden Alarm in der Setup–Betriebsart über
Parameter ”Alarm 1...3” eingestellt. Die werkseitige Einstellung ist 2 (Oberer
Grenzwert–Alarm – Regelabweichung).
Page 32

Kapitel 3 – Basisbetrieb
Alarmwert
Alarmhysterese
Die Alarmwerte werden durch ein “X” in der obenstehenden Tabelle angezeigt.
Der Alarmausgangs–Betrieb ist bei einem positiven oder negativen Alarmwert unterschiedlich.
Die Alarmwerte werden unabhängig für jeden Alarm in der Betriebsart Ebene 1
über Parameter ”Alarmwerte 1...3” eingestellt. Die werkseitige Einstellung ist 0.
Die Alarmhysterese kann beim Schalten der Alarmausgänge (EIN/AUS) wie folgt
definiert werden:
Oberer Grenzwertalarm Unterer Grenzwertalarm
Alarmhysterese
EIN
AUS
Alarmwert Alarmwert
Abb. 29: EIN–/AUS–Schaltverhalten der Alarmhysterese
EIN
AUS
Alarmhysterese
Die Alarmhysterese wird unabhängig für jeden Alarm in der Betriebsart Ebene 2
über Parameter ”Alarmhysterese 1...3” eingestellt. Die werkseitige Einstellung ist
”0,02: 0,02 % FS”.
Bereitschaft
Die Funktion ”Bereitschaft” setzt den Alarmausgang sofort auf AUS, erst wenn der
Istwert den Alarmbereich einmal überschritten hat und sich anschließend wieder im
Alarmbereich befindet. Erst dann wird der Alarm eingeschaltet.
Beispiel:
Wird bei dem Alarmbetrieb ”Regelabweichung unterer Grenzwert” eingestellt, be-
wegt sich der Istwert gewöhnlich innerhalb des Alarmbereiches. Der Alarmausgang
ist dann auf EIN gesetzt, da der Istwert beim Einschalten der Spannungsversorgung unter dem Sollwert liegt. Wird jedoch beim Alarmbetrieb ”Regelabweichung
unterer Grenzwert mit Bereitschaft” eingestellt, erfolgt ein Setzen des Alarmausgangs erst dann, wenn der Istwert den Bereich überschreitet und anschließend
wieder unter den Alarmwert abfällt.
Bei Alarm schließen / Bei Alarm öffnen
Wird die Funktion ”Bei Alarm schließen” eingestellt, wird bei einem auftretenden
Alarm der Ausgang auf EIN gesetzt. Wird die Funktion ”Bei Alarm öffnen” eingestellt, wird bei einem auftretenden Alarm der Ausgang auf AUS gesetzt.
Bei Alarm schließen
Bei Alarm öffnen
Alarm Ausgang Ausgangs–LED
EIN EIN Leuchtet
AUS AUS Leuchtet nicht
EIN AUS Leuchtet
AUS EIN Leuchtet nicht
Abb. 30: Auswirkungen der Funktion ”Bei Alarm schließen / Bei Alarm öffnen”
Alarmtyp und die Funktion ”Bei Alarm schließen” (normalerweise geöffnet) / ”Bei
Alarm öffnen” (normalerweise geschlossen) können unabhängig für jeden Alarm
eingestellt werden.
23
Page 33

Kapitel 3 – Basisbetrieb
Zusammenfassung des
Alarmbetriebes
Die Einstellung der Funktion ”Bei Alarm schließen / Bei Alarm öffnen” wird in der
Setup–Betriebsart ” vorgenommen. Die werkseitige Einstellung ist ”Bei Alarm
schließen” [ ].
Nachfolgend sind die Alarmfunktionen grafisch dargestellt. Die gewählte Einstellung ist ”Unterer Grenzwertalarm (Regelabweichung)”.
Alarmbetrieb: Unterer Grenzwertalarm mit
Bereitschaft (Regelabweichung)
Istwert
Alarmwert
Alarmhysterese
Zeit
Bereitschaft abgebrochen
Geschlossen (EIN)
Alarmausgang
(Bei Alarm geschlossen)
Geöffnet (AUS)
Beispiel
Abb. 31: Alarmbetrieb
Wird der Temperatur–Istwert um " 10 % Über– bzw. unterschreiten, wird der
Alarmausgang 1 gesetzt. Folgende Parameter müssen definiert werden:
– Alarmbetrieb 1: 1 (Regelabweichung der oberen
und unteren Grenzwerte)
– Alarmwert 1: 10
– Alarmhysterese: 0,20
– Bei Alarm schließen / Bei Alarm öffnen: (Bei Alarm schließen)
Bei allen Einstellungen handelt es sich um werkseitige Einstellungen. Alle Einstellungen werden in dem nachfolgenden Beispiel überprüft.
24
Page 34

Kapitel 3 – Basisbetrieb
1.
2. 3. ...
Min. von 1 Sekunde.
Parameter–Eingabe
Die Einstellungen ”Alarmhysterese” und ”Bei Alarm öffnen / Bei Alarm schließen”
entsprechen den werkseitigen Einstellungen und werden bei der Parameter–Eingabe nicht berücksichtigt.
1. Rufen Sie die Menüanzeige auf und über die oder Tasten die Setup–
Betriebsart [ ] auf. Weitere Informationen zu der Menüanzeige siehe
Seite 6.
2. Drücken Sie die Taste , um die Setup–Betriebsart zu aktivieren. Der erste
angezeigte Parameter in der Setup–Betriebsart ist die Eingangsart [ ]. In
diesem Beispiel wird die Einstellung 17 (4...20 mA) angezeigt.
3. Drücken Sie die Taste , bis [ ] (Alarmbetrieb) angezeigt wird. Die
Werkseinstellung ist 2 (Regelabweichung oberer Grenzwert).
4. Drücken Sie die Taste , um die Werkseinstellung von 2 auf 1 zu ändern
(Regelabweichung unterer Grenzwert).
Hinweis
5., Drücken Sie die Tasten oder , um die Betriebsart Ebene 1 einzustellen.
Auf der Anzeige erscheint [ ] (Betriebsart Ebene 1). Weitere Informationen
über das Aufrufen der Menüanzeige siehe Seite 1–7.
6. Drücken Sie die Taste , um die Betriebsart Ebene 1 zu aktivieren. Start–Pa-
rameter der Betriebsart Ebene 1 ist [ ] (AT ausführen/abbrechen).
7. Drücken Sie die Taste , bis [ ] (Alarmwert 1) angezeigt wird.
8. Drücken Sie die Taste , bis die Einstellung 10 angezeigt wird. Die Werksein-
stellung ist 0.
Der Dezimalpunkt des Alarmwertes entspricht der Einstellung des Parameters ”Dezimalpunkt” der Setup–Betriebsart. In diesem Beispiel wird der “Dezimalpunkt” Parameter in “1” umgeschaltet. (Hingegen bei der Temperatureingabe entspricht der
Dezimalpunkt des Alarmwertes dem eingesetzten Sensor.)
25
Page 35

Kapitel 3 – Basisbetrieb
5. Verriegelungs–Betriebsart
Verriegelung
Hinweis
A/M–Taste verriegeln
Die Verriegelungs–Betriebsart ermöglicht es, daß Parameteränderungen während
des Betriebes unterbunden werden. Die Aktivierung erfolgt durch gleichzeitiges
Betätigen der
A/M
und Taste.
Der eingestellte Wert der ”Verriegelung” gibt den Bereich der geschützten Parameter an. Einstellungen von 0...6 sind möglich.
0: Keine Verriegelung
1: Betriebsarten Ebene 0...2, Setup–Betriebsart erweiterte Funktionen und Kom-
munikations–Betriebsart sind verreigelt.
2: Betriebarten Ebene 0...2 sind verriegelt.
3: Betriebsart Ebene 0 und 1 sind verriegelt.
4: Nur Betriebsart Ebene 0 ist verriegelt und wird in der Menüanzeige nicht ange-
zeigt.
5: Nur Parameter PV/SV (Sollwert/Istwert) kann benutzt werden.
6: Nur Parameter PV/SV (Sollwert/Istwert) kann angezeigt werden. Der Sollwert
kann nicht verändert werden.
Die Werkseinstellung der Verriegelungs–Betriebsart ist 1.
Wird die A/M–Taste verriegelt, kann während des automatischen Betriebes nicht in
die manuelle Betriebsart umgeschaltet werden.
Beispiel
1.
2. 3. ...
A/M
A/M
Folgende Betriebsarten sollen verriegelt werden: Setup, erweiterte Funktion, Kommunikation und E/A–Kalibrierung. Folgende Parameter müssen definiert werden:
– Verriegelung: 2 (nur Betriebsart Ebene 0...2)
Parameter–Eingabe
1. Drücken Sie für min. 1 Sekunde gleichzeitig die
A/M
und Tasten, um die
Verriegelungs–Betriebsart zu aktivieren.
2. Auf der Anzeige wird ”SEC” (Verriegelung) angezeigt. Die Werkseinstellung der
Verriegelungs–Betriebsart ist 1. Um diesen Wert auf 2 zu ändern, drücken Sie
die Taste .
3. Drücken Sie für min. 1 Sekunde gleichzeitig die
A/M
und Tasten. Auf der
Anzeige wird der Parameter ”PV/SP–Monitor” der Betriebsart Ebene 0 ange-
zeigt.
26
Page 36

Kapitel 3 – Basisbetrieb
6. Betrieb starten und unterbrechen
Sie können den Betrieb starten und unterbrechen, indem Sie die Einstellung des
Parameters ”RUN/STOP” der Betriebsart Ebene 0 ändern.
Die RUN/STOP–Funktion kann bis zu 100.000 mal umgeschaltet werden.
Um den Betrieb zu unterbrechen, setzen Sie die Einstellung des Parameters RUN/
STOP auf STOP. In der Anzeige erscheint [ ]. Wird der Betrieb unterbrochen,
leuchtet die STOP–LED.
Ausgangs–Stellwert während einer Unterbrechung
einstellen
Beispiel
1.
2. 3. ...
Um den Ausgang während einer Betriebsunterbrechung zu parametrieren, verändern Sie den Ausgangs–Stellwert im Bereich von – 5,0...105,0 % der Betriebsart
Ebene 2. Die werkseitige Einstellung ist ”0,0: 0,0 %.
Das folgende Beispiel beschreibt das Verfahren zur Unterbrechung des Reglers
während des Regler–Betriebes.
Parameter–Eingabe
1. Rufen Sie die Menüanzeige auf und wählen über die Tasten oder
[ ] (Betriebsart Ebene 0) aus. Weitere Informationen zur Menüanzeige
siehe Seite 6.
2. Drücken Sie Taste , um die Betriebsart Ebene 0 zu aktivieren. Der Soll–
und Istwert (PV/SP) wird angezeigt.
3. Drücken Sie Taste , bis der Parameter RUN/STOP [ ] angezeigt
wird.
4. Drücken Sie die Taste , bis [ ] in der Anzeige erscheint. Die STOP–
LED leuchtet und der Betrieb wird unterbrochen.
Um Betrieb wieder fortzusetzen, wählen Sie nach oben beschriebenen Verfahren
[ ] ”RUN” an. Die STOP–LED erlicht und der Betrieb wird fortgesetzt.
27
Page 37

Kapitel 3 – Basisbetrieb
7. Einstellung des Regelbetriebes
Änderung des Sollwertes
Beispiel
1.
2. 3. ...
Manueller Betrieb
Sie können den Sollwert in der Betriebsart Ebene 0 über Parameter ”Sollwert” ändern.
Beachten Sie, daß Sie den Sollwert nicht ändern können, wenn dem Parameter
”Verriegelung” der Wert 6 zugewiesen wurde.
Um den Sollwert zu ändern, drücken Sie die oder Tasten. Wird der neu
eingestellte Wert für 2 Sekunden nicht geändert, wird er abgespeichert.
Das folgende Beispiel beschreibt die Änderung des Temperatur–Sollwertes von
60 auf 50 _C.
Parameter–Eingabe
1. Rufen Sie die PV/SP–Anzeige (Soll–/Istwert) auf.
2. Drücken Sie die Taste, um den Wert von 60 auf 50 _C zu ändern.
Zur Einstellung des manuellen Betriebes und zur manuellen Einstellung des Ausgangs–Stellwertes muß die Taste A/M für mindestens 1 Sekunde gedrückt werden.
Der Temperaturregler gibt dann die manuelle Betriebsart frei.
Hinweis
Der Ausgangs–Stellwert wird auf der Anzeige 2 angezeigt. Der Ausgangs–Stellwert kann über die Tasten oder geändert werden. Nach 2 Sekunden wird
der neue Wert übernommen.
Ist der manuelle Betrieb aktitiviert, können keine Eingaben in anderen Betriebsar-
ten vorgenommen werden. Dazu muß der manuelle Betrieb verlassen werden.
Drücken Sie dazu für mindestens 1 Sekunde die A/M–Taste.
Die automatische Rückstellung der Anzeigefunktion arbeitet während des manuellen Betriebes nicht.
Die Umschaltung des Betriebes von ”automatisch” auf ”manuell” bewirkt eine rückführungs– und pumpfreie Arbeitsweise. Der eingestellte Betrag ist der jeweilige fest
eingestellte Ausgangsstellwert.
Wird die Spannung während des manuellen Betriebes unterbrochen, wird der manuelle Betrieb mit dem vor der Spannungsunterbrechung aktuellen Ausgangs–
Stellwert fortgesetzt.
Die Umschaltung zwischen dem manuellen und automatischen Betrieb kann bis zu
100.000 mal erfolgen.
Um den Ausgangsstellwert vor plötzlichen Änderungen beim Umschalten zwischen
dem manuellen und automatischen Betrieb zu schützen, wird der Betrieb mit dem
vor der Umschaltung aktuellen Ausgangs–Stellwertes fortgesetzt. Nachdem der
Betrieb umgeschaltet wurde, erfolgt sofort eine Annäherung an diesen Wert.
28
Page 38

Kapitel 3 – Basisbetrieb
Das folgende Diagramm stellt die Umschaltung zwischen dem manuellen und automatischen Betrieb dar.
Ausgangs–Stellwert (%)
Rückführungsfrei
Pumpfrei
Auto–Tuning (AT)
0
Manuell
A/M
Auto
Abb. 32: Manueller Betrieb
Ausgangs–Stellwert verändern
EINAUS
Spannungsunterbrechung
Zeit
AT (Auto–Tuning) kann nicht ausgeführt werden, wenn der Betrieb abgebrochen
wird oder während der EIN/AUS–Regelung.
Wird das Auto–Tuning ausgeführt, werden die optimalen PID Parameter automatisch gesetzt, indem der Ausgangs–Stellwert geändert wird, um die Kennwerte
(wird auch als ”Grenzzyklusmethode” bezeichnet) des Regelungsziels zu errechnen. Während des Auto–Tunings leuchtet die AT–LED.
40 % oder 100 % AT kann über die ”Begrenzte Stellgrößen–Änderung” eingestellt
werden. Spezifizieren Sie [ ] oder [ ] in der Betriebsart Ebene 1 über
Parameter ”AT ausführen / abbrechen”.
Während der Heiz– und Kühlregelung kann der AT–Wert nur auf100 % eingestellt
werden. (So wird [ ] (40 % AT) nicht angezeigt.)
Um die Auto–Tuning–Funktion abzubrechen, spezifizieren Sie ”AT abbrechen”
[ ].
Zusätzlich zu der Auto–Tunining–Funktion verfügt der Temperaturregler über die
Fuzzy–Selbstoptimierung (ST). Diese Funktion nimmt eine automatische Anpassung der PID–Konstanten an das zu regelnde Gerät vor, wodurch eine optimale
Temperaturregelung sichergestellt wird. Beachten Sie jedoch, daß die ST–Funktion
nur für die Standard–Regelung des Temperatureinganges arbeitet. Weitere Informationen zu dieser Funktion siehe Seite 79.
29
Page 39

Kapitel 3 – Basisbetrieb
40 % AT
Nehmen Sie die Einstellung der ”Begrenzten Stellgrößen–Änderung (40 % der AT–
Zeit)” vor. Während der Ausführung der Auto–Tuning–Funktion werden
Schwankungen des Sollwertes über die Einstellung der begrenzten Stellgrößen–
Änderung auf ein Minimum begrenzt. Im Verhältnis zu der Einstellung AT = 100 %
benötigt diese Einstellung einen längere Regelzeit.
Der Zeitpunkt der Generierung der begrenzten Stellgrößen–Änderung ist davon
abhängig, ob die Regelabweichung des Sollwertes beim Start der AT–Funktion
größer oder kleiner 10 % ist.
Regelabweichung
beim Start AT > 10 %
Begrenzte Stellgrößen–
Änderung (40 % AT–Zeit)
Soll-
wert
Start
Auto–Tuning
Regelabweichung 10 %
des Sollwertes
AT–Zeit AT–Zeit
Ende
Auto–Tuning
Soll-
wert
Zeit
Abb. 33: Einstellung der begrenzten Stellgrößen–Änderung 40 % AT
Regelabweichung
beim Start AT < 10 %
Begrenzte Stellgrößen–
Änderung (40 % AT–Zeit)
Regelabweichung 10 %
des Sollwertes
Start
Auto–Tuning
Ende
Auto–Tuning
Zeit
100 % AT
Bei der Einstellung der begrenzten Stellgrößen–Änderung auf 100 % AT wird sichergestellt, daß Schwankungen des Sollwertes vom Start bis zum Ende der Auto–Tuning–Funktion ausgeglichen werden. Zusätzlich wird auch die
AT–Ausführungszeit verkürzt.
Begrenzte Stellgrößen–Änderung (100 % AT–Zeit)
Sollwert
Start
Auto–Tuning
AT–Zeit
Ende
Auto–Tuning
Abb. 34: Einstellung der begrenzten Stellgrößen–Änderung 100 % AT
Zeit
30
Page 40

Kapitel 3 – Basisbetrieb
Beispiel
1.
2. 3. ...
AT execute
Hinweis
Das folgende Beispiel beschreibt die Einstellung der begrenzten Stellgrößen–Änderung auf 40 % AT.
Parameter–Eingabe
– Rufen Sie über die Tasten oder die Betriebsart Ebene 1 [ ] auf.
Weiter Informatione zur Menüanzeige siehe Seite 6.
– Drücken Sie zur Aktivierung der Betriebsart Ebene 1 die Taste . Das erste
Parameter der Setup–Betriebsart ”AT ausführen / abbrechen” [ ] wird an-
gezeigt. In diesem Beispiel ist die aktuelle Paramter–Einstellung ”AT abbre-
chen” [ ].
– Drücken Sie zur Einstellung [ ] (40 % AT) die Taste .
– Die AT–LED leuchtet und die AT–Ausführung wird gestartet. Erlischt die AT–
LED (Ende des AT–Betriebes), wird automatisch auf die Parameter–Einstellung
”AT abbrechen” [ ] umgeschaltet.
Sind die Regel–Kenngrößen bekannt, können die PID–Konstanten direkt über Regelbetrieb eingestellt werden. Folgende PID–Konstanten können über die Betriebsart Ebene 1 definiert werden: Proportionalband (P), Nachstellzeit (I) und
Nachhaltezeit (D). Diese PID–Konstanten werden ausführlich in Kapitel 5 behandelt.
31
Page 41

Kapitel 4 – Betriebseinstellungen
Parameter
Anzeige Parameter–bezeichnung: Betriebsart Beschreibung
Zuweisung Regelausgang 1: Setup Spezifizierung der Regelart
Zuweisung Regelausgang 2: Setup Spezifizierung der Reglart
Direkt/Reverse–Betrieb: Setup Spezifizierung der Rgelsart
Totband: Ebene 1 Heiz– und Kühlregelung
Kühl–Koeffizient: Ebene 1 Heiz– und Kühlregelung
Ausgangs–Stellwert: Ebene 2 Regelstellwert, wenn Regelbetrieb un-
Hysterese (Heizen): Ebene 1 EIN/AUS–Regelung
Hysterese (Kühlen): Ebene 1 EIN/AUS–Regelung
PID EIN/AUS: Erweiterung EIN/AUS–Regelung
Abb. 35: Parameter–Zuordnung und –Beschreibung
1. Einstellen der Regelart
Beim Einstellen der Regelart müssen die Parameter entsprechend der nachfolgenden Tabelle eingestellt werden. Die werkseitige Einstellung der Parameter ist Heizregelung.
terbrochen wird
Hinweis
Heiz– und Kühlregelung
Totband
Parameter
Regelart
Heizregelung
(Standard)
Kühlregelung
(Standard)
Heiz– und Kühlregelung Regelausgang (Heizen) Regelausgang (Kühlen) Reverse–Betrieb
Zuweisung
Regelausgang 1
Regelausgang (Heizen) – Reverse–Betrieb
Regelausgang (Kühlen) – Direkt–Betrieb
Zuweisung
Regelausgang 2
Direkt–/Reverse–
Betrieb
Abb. 36: Regelarten
Weitere Informationen über die Ausgangszuweisung siehe Kapitel 3 – 3. Ausgangsspezifikationen auf Seite 20.
Bei der Heiz– und Kühlregelung können das Totband und der Kühlkoeffizient eingestellt werden.
Der Mittelwert desTotbandes stellt den Sollwert dar. Die Totbandbreite wird in der
Betriebsart Ebene 1 über Parameter ”Totband” eingestellt. Die Definition eines positiven und negativen Totbandwertes ist in Abb. 37 dargestellt. Die Definition eines
negativen Totbandwertes erzeugt eine Überlappung der Kennlinien Heizen/Kühlen.
Ausgang
Totband
Ausgang
Totband
Heizen
0
Sollwert
Positiver Totbandwert
Kühlen
Istwert
Heizen Kühlen
0
Negativer T otbandwert
Abb. 37: Positiver und negativer Wert des Totbandes
Sollwert
Istwert
33
Page 42

Kapitel 4 – Betriebseinstellungen
Kühl–Koeffizient
Ausgangs–Stellwert bei
Unterbrechung
Hinweis
EIN/AUS–Regelung
Bei der Heiz– und Kühlregelung wird das Proportionalband der Kühlseite durch
folgende Formel berechnet:
P (Kühlseite) = Kühlkoeffizient x P (Heizseite)
Bei der Heiz– und Kühlregelung hängt der Ausgangs–Stellwert, der bei einer Unterbrechung des Regelbetriebes ausgegeben wird, in der gleichen Weise von dem
eingestellten Wert in Betriebsart Ebene 2 über Parameter ”Ausgangs–Stellwert bei
Unterbechung” ab wie für die Standard–Regelung.
Beachten Sie, daß bei der Heiz– und Kühlregelung der Ausgangs–Stellwert auf der
Kühlseite aus praktischen Gründen als negativer Wert behandelt wird. Ist der Ausgangs–Stellwert bei einer Unterbrechung ein negativer Wert, wird der negative
Wert nur auf der Kühlseite zugeordnet. Handelt es sich um einen positiven Wert,
wird dieser Wert nur der Heizseite zugeordnet. Die werkseitige Einstellung ist 0.
Arbeitet der Temperaturregler mit der Werkseinstellung, wird der Ausgangs–Stellwert weder der Heizseite noch der Kühlseite zugeordnet.
Wurde für das Totband ein negativer Wert (Überlappung) eingestellt, wird der Betrieb bei einer Umschaltung (zwischen manuellen und automatischen Betrieb) nicht
mit dem gleichen Betrag der Ausgangs–Stellgröße fortgeführt.
Die Umschaltung zwischen der erweiterten PID–Regelung und der
EIN/AUS–Regelung erfolgt in der erweiterten Betriebsart über Parameter
”PID EIN/AUS”.
Erweiterte PID–Regelung: [ ]
EIN/AUS Regelung: [ ]
Werkseinstellung: [ ]
Hysterese
Bei der EIN/AUS–Regelung stabilisiert die Hysterese zwischen der Umschaltung
von EIN/AUS den Betrieb. Der Hysteresen–Bereich wird bei der EIN/AUS–Regelung nur einfach als Hysterese bezeichnet. Die Funktionen Regelausgang (Heizen)
bzw. Regelausgang (Kühlen) werden über die Parameter Hysterese (Heizen) bzw.
Hysterese (Kühlen) eingestellt.
Bei der Standard–Regelung (Heiz– oder Kühlregelung) kann die Hysterese nur für
die Heizseite eingestellt werden.
Hysterese (Heizen)
EIN
AUS Istwert
Sollwert
Abb. 38: Standard–Regelung (Heiz– oder Kühlregelung)
Bei der Heiz– und Kühlregelung kann ein Totband eingestellt werden. Somit ist
eine 3–Punkt–Regelung möglich.
Totband
Hysterese (Heizen)
EIN
Heizen
AUS
Sollwert
Hysterese (Kühlen)
Kühlen
Istwert
34
Abb. 40: Heiz– und Kühlregelung (3–Punkt–Regelung)
Page 43

Kapitel 4 – Betriebseinstellungen
2. Parameter–Limitierungen
Parameter
Anzeige Parameter Betriebsart Beschreibung
Stellgröße oberer Grenzwert: Ebene 2 Ausgangs–Begrenzung
Stellgröße unterer Grenzwert: Ebene 2 Ausgangs–Begrenzung
Stellgrößen–Sprung: Ebene 2 Stellgrößensprung
Oberer Grenzwert des
Sollwertes: Erweiterung
Unterer Grenzwert des
Sollwertes: Erweiterung
SP–Rampen–Sollwert: Ebene 2 Sollwert–Änderungs–Limitierung
SP–Rampen–Zeiteinheit: Ebene 2 Sollwert–Änderungs–Limitierung
Abb. 41: Parameter–Zuordnung und –Beschreibung
Sollwert–Begrenzung
Sollwert–Begrenzung
Ausgangs–Stellgröße
Stellgrößen–Begrenzung
Die oberen und unteren Grenzwerte der Ausgangs–Stellgröße werden über Parameter ”Stellgrößen–Begrenzung” und die zeitabhängige Änderung (pro Sekunde)
des Ausgangs–Stellgrößen–Betrages wird über Parameter ”Stellgrößen–Sprung”
eingestellt.
Der obere und untere Grenzwert der Ausgangs–Stellgröße wird in der Betriebsart
Ebene 2 über die Parameter ”Stellgrößen–Obergrenze” und ”Stellgrößen–Untergrenze” definiert. Liegt die Ausgangs–Stellgröße, die vom E5CK berechnet wird,
außerhalb der Stellgrößen–Grenzwerte, wird der Ausgang von diesen Para–
metereinstellungen begrenzt.
Ausgang ( % )
100
0
Abb. 42: Stellgrößen–Begrenzung
Oberer Grenzwert
der Ausgangs–Stellgröße
Unterer Grenzwert
der Ausgangs–Stellgröße
Istwert
Beachten Sie, daß bei der Heiz– und Kühlregelung der Ausgangs–Stellwert auf der
Kühlseite aus praktischen Gründen als negativer Wert behandelt wird.
Der obere Grenzwert wird der Heizseite (positiver Wert) und der untere Grenzwert
der Kühlseite (negativer Wert) zugewiesen. Dies ist grafisch in der nachfolgenden
Abbildung dargestellt.
Ausgang (%)
Unterer Grenzwert der
Ausgangs–Stellgröße
Oberer Grenzwert der
Ausgangs–Stellgröße
Abb. 43: Stellgrößen–Begrenzung
100
Heizen
Sollwert
Kühlen
Istwert
100
35
Page 44

Kapitel 4 – Betriebseinstellungen
Stellgrößen–Sprung–
Limitierung
Parameter–Limitierungs–
Bedingungen
In der Betriebsart Ebene 2 wird Über Paramerter ”Stellgrößen–Sprung” die auf
eine Sekunde bezogene größtmögliche Änderung des Betrages des Ausgangs–
Stellwertes festgelegt. Überschreitet eine Änderung der Ausgangs–Stellgröße diesen Parameterwert, regelt der E5CK die Stellgröße mit diesem
”pro–Sekunden–Wert” nach
Ausgang (%)
100
0
Schaltpunkt
Abb. 44: Stellgrößen–Sprung–Limitierung
Max. Änderung
der Ausgangs–
Stellgröße pro
Sekunde
Zeit
Die Parameter–Limtierungs–Bedingungen sind bei folgenden Randbedingungen
ungültig:
– Während der EIN/AUS–Regelung.
– Während der ST–Ausführung (Selbstoptimierung).
– Während des Auto–Tuning–Betriebes (nur bei Stellgrößen–Limitierung).
– Während des manuellen Betriebes.
– Wenn der Betrieb unterbrochen wird.
– Wenn ein Fehler aufgetreten ist.
Sollwert–Limitierung
Der Einstell–Bereich des Sollwertes wird von der Sollwertbegrenzung festgelegt. In
der Erweiterungs–Betriebsart wird über die Parameter ”Sollwert–Obergrenze” und
Sollwert–Untergrenze” der Einstellbereich des Sollwertes festgelegt. Beachten Sie
jedoch, daß bei einer zurückgesetzten Sollwert–Limitierung die eingestellten oberen und unteren Sollwertgrenzen wieder automatisch bei Überschreiten der Sollwert–Limitierung aktiviert werden. Wenn die Eingangsart, die Temperatur–Einheit
und der Skalierungsbereich (Sensor) geändert werden, wird die Sollwert–Limitierung automatisch auf die Einstellung für den Skalierungsbereich (Sensor) zurückgesetzt.
Skalierungsbereich (Sensor)
Sollwertbegrenzung
Einstellbereich
Auf neuen oberen
Grenzwert geändert
Änderung auf oberen Grenzwert
Änderung der Eingangsart
Sollwert
Oberer und unterer Grenzwert der Sollwert–Limitierung
Obere und untere Skalierungs–Grenzwerte (Sensor)
A
B
CB
Sollwert
Sollwert
36
Abb. 45: Sollwert–Limitierung
Page 45

Kapitel 4 – Betriebseinstellungen
Sollwert
(SP)–Rampenverhalten
Mit der SP–Rampenfunktion arbeitet der E5CK auf der Basis der Stellgrößen–
Sprung–Limitierung (Sollwertänderung pro Sekunde während SP–Rampe). Das
Intervall, in dem eine beschränke Sollwert–Änderung ausgeführt wird, wird als SP–
Rampe bezeichnet.
Sollwert
Sollwert
Schaltpunkt
Abb. 46: SP–Rampenverhalten
SP–Rampe
SP–Rampen–
Sollwert
SP–Rampen–Zeiteinheit
Zeit
Das SP–Rampenverhalten definiert sich über die Parameter ”SP–Rampen–Sollwert” und ”SP–Zeiteinheit”. Das SP–Rampenverhalten ist deaktiviert, wenn der
Parameterwert für den SP–Rampen–Sollwert auf 0 gesetzt ist. Dies entspricht der
werkseitigen Einstellung.
Die Sollwert–Änderung der SP–Rampe kann in der Betriebsart Ebene 0 über Parameter ”Sollwert während SP–Rampe” überwacht werden.
Startbetrieb
Die Beschränkungen sind ungültig bzw. können nicht eingestellt werden, wenn eine
der folgenden Bedingungen auftritt:
Wird die SP–Rampenfunktion beim Einschalten der Spannung aktiviert oder der
E5CK aus dem STOP– in den RUN–Betrieb umgeschaltet, wird der Istwert über
die SP–Rampe dem Sollwert angenähert; auf die gleiche Art, wie bei der Änderung
des Sollwertes. In diesem Fall wird der Betrieb mit dem vor der Änderung aktuellen
Istwert (wird dabei als Sollwert betrachtet) ausgeführt.
Die Richtung der SP–Rampe wird durch das Verhältnis des Istwertes zum Sollwert
bestimmt.
Istwert < Sollwert Istwert > Sollwert
Sollwert Sollwert
Sollwert
SP–Rampe
Istwert
Spannung EIN
Abb. 47: Rampenverhalten bei Start
Istwert
Sollwert
Zeit Zeit
SP–Rampe
Kontinuierliche
Änderung
Spannung EIN
Beschränkungen des
SP–Rampenverhaltens
– Die Ausführung des Auto–Tunings beginnt nach der SP–Rampe.
– Wird der E5CK in den manuellen Betrieb umgeschaltet, ändert sich der Sollwert
entsprechend der SP–Rampenfunktion (bis zum Ende der SP–Rampe).
– Die SP–Rampenfunktion wird beim Auftreten eines Fehlers zurückgesetzt.
37
Page 46

Kapitel 4 – Betriebseinstellungen
3. Optionale Funktionen einsetzen
Anzeige Parameter Betriebsart Anwendung
Multi–SP–Funktion Optional Ereigniseingangs–Funktionen
Zuweisung Ereigniseingang 1 Optional Ereigniseingangs–Funktionen
Sollwert 0 Ebene 1 Multi–SP
Sollwert 1 Ebene 1 Multi–SP
Übertragungs–Ausgang–Art Optional
Oberer Grenzwert des
Übertragungs–Ausgangs Optional
Unterer Grenzwert des
Übertragungs–Ausgangs Optional
Abb. 48: Parameter–Zuordnung und –Beschreibung
Weitere Informationen über die Kommunikationsfunktion siehe Kapitel 6 – Einsatz
der Kommunikationsfunktion.
Zuweisung Übertragungs–Ausgang
Skalierung
Übertragungs–Ausgang
Skalierung
Übertragungs–Ausgang
Ereigniseingang
Eingangs–Zuweisung
Multi–SP–Funktion
01
RUN/STOP
Auto/Manual
Multi–SP
Voraussetzung für die Benutzung des Ereigniseinganges ist die Installation der
Eingangs–Baugruppe E53–CKB.
Sie können folgende Zuweisungen für den Ereigniseingang vornehmen:
– RUN/STOP
– Auto/Manual
– Multi–SP
Treffen Sie zuerst die Entscheidung, ob die Multi–SP–Funktion benötigt wird oder
nicht. Die beiden verbleibenden Funktion (RUN/STOP und Auto/Manual) können
nur dann in Betrieb genommen werden, wenn die Multi–SP–Funktion deaktiviert
wurde.
Beim Einsatz der Multi–SP–Funktion setzen Sie in der Betriebsart ”Optional” Parameter ”Multi–SP–Funktion” auf 1 (EIN). Wollen Sie andere Funktionen benutzen,
setzen Sie diesen Parameter auf 0 (AUS).
Soll dem Ereigniseingang eine andere als die Multi–SP–Funktion zugewiesen werden, weisen Sie dem Ereigniseingang in der Betriebsart ”Optional” Parameter
Ereigniseingangs–Zuweisung 1 zu. Die folgende Tabelle zeigt das Verhältnis zwischen Parametereinstellung und Ereigniseingangs–Funktion auf.
Anzeige Funktion
EIN: STOP /AUS: RUN
EIN: Manual /AUS: Auto
RUN/STOP
Auto/Manual
38
Abb. 49: Ereigniseingang
Wird der Ereigniseingang auf EIN gesetzt, wird der Betrieb des Temperaturreglers
unterbrochen und die STOP–LED leuchtet. Der Inhalt des Ereigniseingangs wird in
der Betriebsart Ebene 0 dem Parameter RUN/STOP zugewiesen.
Wird der Ereigniseingang auf EIN gesetzt, wird der Temperaturregler in den manuellen Betrieb umgeschaltet und die MANU–LED leuchtet.
Schalten Sie den Ereigniseingang auf EIN/AUS, während der Temperaturregler
EIN ist.
Page 47

Kapitel 4 – Betriebseinstellungen
Multi–SP
Übertragungs–Ausgang
Die Sollwerte, die in der Betriebsart Ebene 1 über die Parameter Sollwert 1 und
Sollwert 2 definiert sind, können je nach Anwendung umgeschaltet werden. Beachten Sie jedoch, daß diese Parameter nicht eingestellt werden können, wenn die
Multi–SP–Funktion nicht aktiviert wurde.
Der Sollwert kann bis auf 100.000 mal umgeschaltet werden.
Wurde der Ereigniseingang auf AUS gesetzt, wird Sollwert 0 benutzt. Wurde der
Ereigniseingang auf EIN gesetzt, wird der Sollwert 1 benutzt.
Soll der Sollwert geändert werden, wird der aktuell angezeigte Sollwert geändert.
Die aktivierte SP–Rampenfunktion arbeitet bei der Umschaltung zwischen Sollwert
0 und 1. In der nachfolgenden Abbildung ist dies grafisch dargestellt.
Sollwert
Sollwert 1
Sollwert 0
Ereigniseingang
Abb. 50: Umschalten zwischen Sollwert 0 und 1
AUS
SP–Rampe
Zeit
EIN
Voraussetzung für die Benutzung der Übertragungsfunktion ist die Installation der
Ausgangs–Baugruppe E53–CKF
Sie können die zu übertragenden Größen in der Betriebsart ”Optional” über die
Parameter ”Übertragungs–Ausgangsart” auswählen:
Sollwert
Sollwert während SP–Rampe
Istwert
Ausgangsstellwert (Heizen) und
Ausgangsstellwert (Kühlen).
Dieser Übertragungsausgang kann entsprechend den Einstellungen der Parameter
”Oberer Grenzwert des Übertragungsausgangs” und ”Unterer Grenzwert des Übertragungsausgangs” vor der Ausgabe skaliert werden. Der Wert, der dem oberen
Grenzwert zugewiesen wird, kann kleiner sein als der Wert, der dem unteren
Grenzwert zugewiesen wird. In diesem Fall wird über den Übertragungsausgang
der Ausgangsstellwert für das Heizen geregelt. Im umgekehrten Fall (unterer
Grenzwert niedriger als oberer Grenzwert) wird über den Übertragungsausgang
der Ausgangsstellwert für das Kühlen geregelt. Über den Sollwert der SP–Rampe
kann die Differenz zwischen dem oberen und unteren Grenzwert definiert werden.
In der folgenden Abbildung ist die Heiz– und Kühlskalierung dargestellt.
Übertragungs–Ausgang Übertragungs–Ausgang
(mA)
20
Heiz–Skalierung Kühl–Skalierung
(fallende Skalierung)
(mA)
20
(steigende Skalierung)
4
Obere Grenzwert
des Übertragungs–
Ausgangs: 0 %
Abb. 51: Heiz– und Kühlskalierung
Untere Grenzwert
des Übertragungs–
Ausgangs: 100 %
Stellgröße
(%)
4
0
Untere Grenzwert
des Übertragungs–
Ausgangs: 10 %
Stellgröße (%)
100
Obere Grenzwert
des Übertragungs–
Ausgangs: 80 %
39
Page 48

Kapitel 4 – Betriebseinstellungen
4. LBA–Funktion
Die LBA–Funktion (Loop Break Alarm = Regelkreisunterbrechungsalarm) kann nur
dann verwendet werden, wenn sie einem Ausgang zugewiesen wird. Tritt ein Speicher– oder A/D–Konvertierungsfehler auf, arbeitet die LBA–Funktion nicht.
Die LBA–Funktion dient der Erkennung einer Regelkreisunterbrechung oder eines
Regelkreisfehlers. Zusätzlich wird ein Alarm ausgegeben, wenn der Istwert nicht
auf die Ausgangsstellgröße in definierten Bereichen reagiert.
LBA–Erkennungszeit
LBA–Erkennungsbreite
LBA–Erkennungsbeispiel
Normalerweise, wenn der Ausgang auf einen minimalen oder maximalen Wert eingestellt ist, steigt oder fällt die Ist–Temperatur nach dem Verstreichen der Totzeit.
Ein Loop–Break–Alarm wird dann ausgegeben, wenn der Sollwert sich nicht in einer bestimmten Richtung (vergrößert / verkleinert) und nicht in einer definierten
Zeitspanne verändert. Diese definierte Zeitspanne ist die LBA–Erkennungszeit.
Die LBA–Erkennungsbreite definiert die Abweichungen des Istwertes vom Sollwert.
Änderungen innerhalb dieses fest definierten Bereiches werden nicht als
Sollwertabweichungen erkannt bzw. behandelt.
In dem folgenden Beispiel ist der Funktionsverlauf des Istwertes auf Grund eines
durchgebrannten Heizelementes dargestellt (max. Ausgang).
LBA–Erkennungszeit
PV
LBA–Erkennungszeit
LBA Erkennungsbreite
Ausgang
LBA–Erkennungszeit
aktivieren
Zeit
Heizelement
durchgebrannt
Abb. 52: Beispiel für LBA–Funktion
LBA= EIN
Die LBA–Erkennung wird ausgeführt, wenn der Istwert den Sollwert erreicht bzw.
überschreitet (max. Ausgang). Bei der ersten Erkennungszeit verändert sich dieser
Wert steigend. Die LBA–Funktion bleibt im Zustand AUS.
Bei der zweiten Erkennungszeit erfolgt eine Zunahme des Istwertes (dargestellt
durch die unterbrochene Linie). Die Änderung überschreitet zwar die LBA–Erkennungsbreite, die LBA–Funktion bleibt aber im Zustand AUS.
Brennt das Heizelement durch, nimmt der Istwert ab. Der LBA–Ausgang wird auf
EIN gesetzt.
Die LBA–Erkennungszeit wird über das Auto–Tuning automatisch festgelegt
(außer bei der Heiz– und Kühlregelung).
Kann die optimale Erkennungszeit nicht über die Auto–Tuning–Funktion eingestellt
werden, kann die LBA–Erkennungszeit auch über die Betriebsart Ebene 2 eingestellt werden.
40
Page 49

Kapitel 4 – Betriebseinstellungen
LBA–Erkennungszeit
berechnen
Die LBA–Erkennungszeit kann wie folgt berechnet werden:
1. Schalten Sie den Ausgang auf Maximum.
2. Messen Sie die Zeit bis zum Erreichen der LBA–Erkennungsbreite (Standardwert 0,2 % des Skalenwertes).
3. Multiplizieren Sie den gemessenen Wert mit 2.
Gemessene Zeit TM
Istwert
0.2%FS
Ausgang
Zeit
LBA–Erkennungszeit = TM x 2
Abb. 53: Erkennungszeit–Berechnung
4. Beim EIN/AUS–Regel–Betrieb sollten Sie einen Wert (LBA–Erkennungszeit)
einstellen, der größer ist als der Regelzyklus.
Parameter
Anzeige Parameter Betriebsart Anwendung
AT ausführen / abbrechen: Ebene 1 Automatische Einstellung der LBA–
Erkennungszeit
LBA–Erkennungszeit: Ebene 2 Einstellen der LBA–Erkennungszeit
LBA Erkennungsbreite. Erweitere
Funktion
Änderung von LBA Erfassungsbreite
Abb. 54: Parameter–Zuordnung und –Beschreibung
41
Page 50

Kapitel 4 – Betriebseinstellungen
5. Kalibrierung
Um den E5CK Temperaturegler zu kalibrieren, wählen Sie in der Menü–Anzeige
( ) im Menüdisplay, um die Kalibrierungs–Betriebsart zu wählen. [ ] wird
angezeigt.
Beachten Sie jedoch, daß ( ]) bei der ersten Kalibrierung des E5CK nicht im
Menü angezeigt wird. In diesem Fall muß zuerst der Verriegelungs–Parameter in
der Betriebsart ”Verriegelung” auf 0 gesetzt werden.
Die Parameter in der Kalibrierungs–Betriebsart werden wie folgt konfiguriert.
Thermoelement 1
Übertragungs–Ausgang
Datenspeicherung
Thermoelement
Thermoelement 2
Nur wenn Übertragungs–Ausgang–
Funktion angeboten wird
Platin–Widerstands–
thermometer
Thermoelement 1: K1/J1/L1/E/N/W/PLII
Thermoelement 2: K2/J2/L2/R/S/B/T/U
Platin–Widerstands–
thermometer: JPT100 / PT100
Stromeingang
Spannungseingang
0...10 V0...5 V 1...5 V
42
Abb. 55: Parameter–Einstellungen in der Kalibrierungs–Betriebsart
Um den gewünschten Parameter zu wählen, drücken Sie die Taste . Die Parameter werden in folgender Reihenfolge angezeigt:
1. Kalibrierung der Eingänge
2. Kalibrierung des Übertragungs–Ausgänges
3. Speicherung der Kalibrierungsdaten
Wenn der E5CK Temperaturregler die Übertragungs–Ausgangsfunktion nicht anbietet, wird die Kalibrierung des Übertragungs–Ausgangs automatisch aus dem
Kalibrierungsverfahren gelöscht:
1. Kalibrierung der Eingänge
2. Speicherung der Kalibrierungsdaten
Nur Eingaben, die in der Setup–Betriebsart über Parameter ”Eingangsart” vorgenommen wurden, können kalibriert werden. Um vorläufig Daten für jeden der Kali-
brierungsparameter zu speichern, drücken Sie die Taste für 1 Sekunde.
Page 51

Kapitel 4 – Betriebseinstellungen
Der Übertragungsausgang kann nur dann kalibriert werden, wenn die Kommunikationsbaugruppe E53–CKF installiert ist. Die Einstellung der Daten erfolgt über die
Tasten oder .
Das Daten–Speicherungs–Menü wird nur dann angezeigt, wenn alle Kalibrierungs-
eingaben zwischengespeichert worden sind.
Nach der Kalibrierung des Eingänge sollten alle Eingaben auf Genauigkeit über-
prüft werden. Weiter Informationen siehe Seite 52.
Kalibrierungs–Menü
Kalibrierungs–
Parameter
Istwert
Kennzeichen für Kalibrierungs–Speicherung
Kennzeichen
Kalibrierung der
Thermoelemente
Vorbereitungen
Parameter werden auf der Anzeige 1 und Istwerte auf der Anzeige 2 angezeigt.
Normalerweise ändert sich der Istwert in meheren Stellen. Der Istwert blinkt bspw.
bei einem aufgetretenen Sensorfehler, wenn der Istwert den Kalibrierungsbereich
über– bzw. unterschreitet.
Blinkt die Istwert–Anzeige, kann dieser Wert nicht gespeichert werden, auch nicht
durch Drücken der Taste .
Befindet sich der E5CK in der Betriebsart ”Kalibrierung” [ ], wird die Speicherung der Parameter–Werte durch ein Kennzeichen (.) vor dem Kalibrierungs–
Parameter angezeigt.
Die Kalibrierung der Thermoelemente erfolgt nach der Einteilung in Thermoelemente Gruppe 1 (K1, J1, L1, E, N, W, PLII) und Thermoelemente Gruppe 2 (K2,
J2, L2, R, S, B, T, U).
Decken Sie bei der Kalibrierung nicht die Ober– und Unterseite des Temperaturreglers ab. Berühren Sie nicht die Eingangsklemmen (Klemme 6 und 7) und die
Kompensationsklemmen.
100...240 VAC
(24 VAC/DC)
5
4
3
2
1
11 12
13 14
10
9
8
7
6
STV
Klemmenkompensation
0 °C/32 °F
STV= Spannungs–
Stromquelle
DMM
Abb. 56: Thermoelemente kalibrieren
DMM =Multimeter
Stellen Sie die Klemmenkompensation auf 0_C ein. Achten Sie darauf, daß die
internen Thermoelemente der Klemmenkompensation deaktiviert sind (Spitzen
sind offen).
In der obenstehenden Abbildung bezeichnet STV eine Standard–DC Spannungs–
Stromquelle und DMM den Anschluß für ein digitales Mulitimeter.
Benutzen Sie die entsprechende Klemmenkompensation für das ausgewählte
Thermoelement. Werden die Thermoelemente R, S E, B, W oder PLII verwendet,
kann die Klemmenkompensation durch eine Klemmenkompensation für K–Thermoelemente ersetzt werden.
43
Page 52

Kapitel 4 – Betriebseinstellungen
Hinweis
Bei der Kalibrierung darf die Klemmenkompensation nicht berührt werden, da dies
zu Verfälschung der Meßergebnisse führt. Schließen Sie die Klemmenkompensation kurz (Kontakte geschlossen) oder öffnen Sie die Klemmenkompensation, um
einen Kontaktzustand oder einen kontaklosen Zustand zu erzeugen.
Klemmenkompensation
E5CK
Geschlossen
Leiter
Abb. 57: Klemmenkompensation
Kaltstellen–Kompensation
E5CK
05C/325F
Leiter
Geöffnet
44
Page 53

Kapitel 4 – Betriebseinstellungen
Kalibrierung Thermoelement 1
Nachfolgend ist die Kalibrierung eines Thermoelementes beschrieben, bei der die
Übertragungs–Ausgangsfunktion angeboten wird. Wird die Übertragungs–Ausgangsfunktion nicht angeboten, überspringen Sie die Schritte 7...10.
1. Wird in Anzeige 1[ ] angezeigt, zeigt Anzeige 2 den Zeitgeber (30 Minuten) an. Dieser Wert wird bei der Kalibrierung heruntergezählt.
2. Zuerst kalibrieren Sie den Haupteingang. Drücken Sie Taste , bis auf der
Anzeige [ ] (50 mV Kalibrierungs–Anzeige) erscheint. Setzen Sie STV–
Ausgang auf 50 mV. Hat sich der Wert in Anzeige 2 stabilisiert, drücken Sie die
Taste .
3. Drücken Sie Taste , bis auf der Anzeige [ ] (0 mV Kalibrierungs–Anzeige) erscheint. Setzen Sie STV–Ausgang auf 0 mV. Hat sich der Wert in Anzeige 2 stabilisiert, drücken Sie die Taste .
4. Als nächstes kalibrieren Sie die Klemmenkompensation. Drücken Sie Taste
Setzen Sie STV–Ausgang auf 0 mV. Hat sich der Wert in Anzeige 2 stabilisiert,
drücken Sie die Taste .
, bis auf der Anzeige [ ] (310 mV Kalibrierungs–Anzeige)erscheint.
5. Drücken Sie Taste , bis auf der Anzeige [ ] (0 mV Kalibrierungs–Anzeige) erscheint. Setzen Sie STV–Ausgang auf 0 mV. Hat sich der Wert in Anzeige 2 stabilisiert, drücken Sie die Taste .
6. Kalibrieren Sie schließlich den Kompensations–Wert. Entfernen Sie die Spannungsversorgung und verbinden das Thermoelement mit der Klemmenkompensation.
Achten Sie darauf, daß die Zuweisung für Klemmenkompensation eingestellt
wird. Drücken Sie dann die Taste . Auf der Anzeige wird die Meldung
[ ] ausgegeben (Anzeige für den Kompensationswert). Hat sich der Wert in
Anzeige 2 stabilisiert, drücken Sie die Taste .
7. Als nächstes kalibrieren Sie die Übertragungs–Ausgangsfunktion. Wird die
Übertragungs–Ausgangsfunktion nicht angeboten, gehen Sie zu Punkt 11.
Drücken Sie die Taste . Auf der Anzeige wird [ ] (20 mA ) angezeigt.
8. Stellen Sie den Ausgang über die Tasten oder auf 20mA ein. Überwachen Sie die Anzeige mit dem Multimeter. Im Beispiel auf der linken Seite ist die
Anzeige dargestellt. Der angezeigte Wert ist um zwei Stellen kleiner als vor der
Kalibrierung.
9. Drücken Sie Taste . Auf der Anzeige wird [ ] (4 mA Kalibrierung) dargestellt.
10.Stellen Sie den Ausgang über die Tasten oder auf 4 mA ein. Überwachen Sie die Anzeige mit dem Multimeter. Im Beispiel auf der linken Seite ist die
Anzeige dargestellt. Der angezeigte Wert ist um zwei Stellen kleiner als vor der
Kalibrierung.
11.Drücken Sie die Taste , bis die Anzeige ”Daten speichern” angezeigt wird.
Drücken Sie dann die Taste und die Anzeige 2 wechselt zu [ ]. Zwei
Sekunden später sind die Daten im internen Speicher abgelegt. Wird die Meldung [ ] angezeigt und anschließend die Taste gedrückt, werden die
Daten gelöscht.
12.Die Kalibrierung der Thermoelement Gruppe 1 ist beendet. Drücken Sie die Taste und kehren zu der Anzeige [ ] zurück.
45
Page 54

Kapitel 4 – Betriebseinstellungen
Kalibrierung Thermoelement 2
Nachfolgend ist die Kalibrierung eines Thermoelementes beschrieben, bei der die
Übertragungs–Ausgangsfunktion angeboten wird. Wird die Übertragungs–Ausgangsfunktion nicht angeboten, überspringen Sie die Schritte 7...10.
1. Wird in Anzeige 1[ ] angezeigt, zeigt Anzeige 2 den Zeitgeber (30 Minuten) an. Dieser Wert wird bei der Kalibrierung heruntergezählt.
2. Zuerst kalibrieren Sie den Haupteingang. Drücken Sie Taste , bis auf der
Anzeige [ ] (20 mV Kalibr.–Anzeige) erscheint. Setzen Sie STV–Ausgang
auf 20 mV. Hat sich der Wert in Anz. 2 stabilisiert, drücken Sie die Taste .
3. Drücken Sie Taste , bis auf der Anzeige [ ] (0 mV Kalibrierungs–Anzeige). Setzen Sie STV–Ausgang auf 0 mV. Hat sich der Wert in Anzeige 2 stabilisiert, drücken Sie die Taste .
4. Als nächstes kalibrieren Sie die Klemmenkompensation. Drücken Sie Taste
Setzen Sie STV–Ausgang auf 0 mV. Hat sich der Wert in Anzeige 2 stabilisiert,
drücken Sie die Taste .
, bis auf der Anzeige [ ] (310 mV Kalibrierungs–Anzeige) erscheint.
5. Drücken Sie Taste , bis auf der Anzeige [ ] (0 mV Kalibrierungs–Anzeige) dargestellt wird. Setzen Sie STV–Ausgang auf 0 mV. Hat sich der Wert
in Anzeige 2 stabilisiert, drücken Sie die Taste .
6. Kalibrieren Sie schließlich den Kompensations–Wert. Lösen Sie den STV–Ausgang und verbinden das Thermoelement mit der Klemmenkompensation.
Achten Sie darauf, daß die Zuweisung für Klemmenkompensation eingestellt
wird. Drücken Sie dann die Taste . Auf der Anzeige wird die Meldung
[ ] ausgegeben (Anzeige für den Kompensationswert). Hat sich der Wert in
Anzeige 2 stabilisiert, drücken Sie die Taste .
7. Als nächstes kalibrieren Sie die Übertragungs–Ausgangsfunktion. Wird die
Übertragungs–Ausgangsfunktion nicht angeboten, gehen Sie zu Punkt 11.
Drücken Sie die Taste . Auf der Anzeige wird [ ] (20 mA ) angezeigt.
8. Stellen Sie den Ausgang über die Tasten oder auf 20mA ein. Überwachen Sie die Anzeige mit dem Multimeter. Im Beispiel auf der linken Seite ist die
Anzeige dargestellt. Der angezeigte Wert ist um zwei Stellen kleiner als vor der
Kalibrierung.
9. Drücken Sie Taste . Auf der Anzeige wird [ ] (4 mA Kalibrierung) dargestellt.
10.Stellen Sie den Ausgang über die Tasten oder auf 4 mA ein. Überwachen Sie die Anzeige mit dem Multimeter. Im Beispiel auf der linken Seite ist die
Anzeige dargestellt. Der angezeigte Wert ist um zwei Stellen kleiner als vor der
Kalibrierung.
11.Drücken Sie die Taste , bis die Anzeige ”Daten speichern” angezeigt wird.
Drücken Sie dann die Taste und die Anzeige 2 wechselt zu [ ]. Zwei
Sekunden später sind die Daten im internen Speicher abgelegt. Wird die Meldung [ ] angezeigt und anschließend die Taste gedrückt, werden die
Daten gelöscht.
12.Die Kalibrierung der Thermoelement Gruppe 1 ist beendet. Drücken Sie die Taste und kehren zu der Anzeige [ ] zurück.
46
Page 55

Kapitel 4 – Betriebseinstellungen
Kalibrierung des Platin–Widerstandsthermometers
Vorbereitung
100...240VAC
(24 VAC/DC)
Abb. 58: Klemmenbelegung
Benutzen Sie beim Anschluß des Platin–Widerstandsthermometers Leitungen gleicher Dicke. Das Multimeter ist nur erforderlich, wenn die Übertragungs–Ausgangsfunktion eingesetzt wird. Schließen Sie die Klemmen 6 und 7 kurz.
5
4
3
2
1
11 12
13 14
Multimeter
10
9
8
7
6
6-stellige Widerstands–Kalibrierbox
Kalibrierung
Klemmen 6 und 8
kurzschließen
Verdrahtung ändern.
Klemmen 6 und 8
kurzschließen
Nachfolgend ist die Kalibrierung eines Platin–Widerstandsthermometers beschrieben, bei der die Übertragungs–Ausgangsfunktion eingesetzt wird. Wird die Übertragungs–Ausgangsfunktion nicht eingesetzt, überspringen Sie die Schritte 7...10.
1. Wird in Anzeige 1[ ] angezeigt, zeigt Anzeige 2 den Zeitgeber (30 Minuten) an. Dieser Wert wird bei der Kalibrierung heruntergezählt.
2. Zuerst kalibrieren Sie den Haupteingang. Drücken Sie Taste , bis auf der
Anzeige[ ] (300 Ω Kalibrierungs–Anzeige) erscheint. Stellen Sie die 6–stellige Widerstands–Kalibrierbox auf 300 Ω ein.Hat sich der Wert in Anzeige 2
stabilisiert, drücken Sie die Taste .
3. Drücken Sie Taste , bis auf der Anzeige [ ] (0 Ω Kalibrierungs–Anzeige) erscheint. Schließen Sie die Klemmen 6 und 8 kurz. Hat sich der Wert in
Anzeige 2 stabilisiert, drücken Sie die Taste .
4. Kalibrieren Sie als nächstes den B–B–Eingang. Ändern Sie dazu die Klemmenverdrahtung. Schließen Sie an die Klemmen 6 und 7 die 6–stellige Widerstands–Kalibrierbox an. Schließen Sie die Klemmen 6 und 8 kurz. Halten Sie
die Verbindungen so kurz wie möglich.
10
9
8
7
6
6-stellige Widerstands–Kalibrierbox
Siehe nächste Seite
Abb. 59: Klemmenverdrahtung
5. Drücken Sie Taste , bis auf der Anzeige [ ] (10 Ω Kalibrierungs–Anzeige) dargestellt wird. Stellen Sie die Kalibrierungsbox auf 10 Ω. Hat sich der
Wert in Anzeige 2 stabilisiert, drücken Sie die Taste .
6. Drücken Sie Taste , bis auf der Anzeige [ ] (0 Ω Kalibrierungs–Anzeige) dargestellt wird. Stellen Sie die Kalibrierungsbox auf 10 Ω. Hat sich der
Wert in Anzeige 2 stabilisiert, drücken Sie die Taste .
47
Page 56

Kapitel 4 – Betriebseinstellungen
Siehe vorherige Seite
7. Als nächstes kalibrieren Sie die Übertragungs–Ausgangsfunktion. Wird die
Übertragungs–Ausgangsfunktion nicht angeboten, gehen Sie zu Punkt 11.
Drücken Sie die Taste . Auf der Anzeige wird [ ] (20 mA ) angezeigt.
8. Stellen Sie den Ausgang über die Tasten oder auf 20mA ein. Überwachen Sie die Anzeige mit dem Multimeter. Im Beispiel auf der linken Seite ist die
Anzeige dargestellt. Der angezeigte Wert ist um zwei Stellen kleiner als vor der
Kalibrierung.
9. Drücken Sie Taste . Auf der Anzeige wird [ ] (4 mA Kalibrierung) dargestellt.
10.Stellen Sie den Ausgang über die Tasten oder auf 4 mA ein. Überwachen Sie die Anzeige mit dem Multimeter. Im Beispiel auf der linken Seite ist die
Anzeige dargestellt. Der angezeigte Wert ist um zwei Stellen kleiner als vor der
Kalibrierung.
11.Drücken Sie die Taste , bis die Anzeige ”Daten speichern” angezeigt wird.
Drücken Sie dann die Taste und die Anzeige 2 wechselt zu [ ]. Zwei
Sekunden später sich die Daten im internen Speicher abgelegt. Wird die Meldung [ ] angezeigt und anschließend die Taste gedrückt, werden die
Daten gelöscht.
12.Die Kalibrierung des Platin–Widerstandsthermometers ist beendet. Drücken Sie
die Taste und kehren zu der Anzeige [ ] zurück.
48
Page 57

Kapitel 4 – Betriebseinstellungen
m
Kalibrierung des Stromeingangs
Vorbereitung
100...240 VAC
(24 VAC/DC)
5
4
3
11 12
10
9
8
Kalibrierung
2
13 14
1
DMM
Abb. 60: Klemmenbelegung bei der Kalibrierung des Stromeingangs
7
6
DMM= Multimeter
STV
STV= Spannungs–/Stro
quelle
DMM ist nur erforderlich, wenn die Übertragungs–Ausgangsfunktion angeboten
wird.
Nachfolgend ist die Kalibrierung des Stromeingangs beschrieben, bei der die Übertragungs–Ausgangsfunktion angeboten wird. Wird die Übertragungs–Ausgangsfunktion nicht angeboten, überspringen Sie die Schritte 4...7.
1. Wird in Anzeige 1[ ] angezeigt, zeigt Anzeige 2 den Zeitgeber (30 Minuten) an. Dieser Wert wird bei der Kalibrierung heruntergezählt.
2. Zuerst kalibrieren Sie den Haupteingang. Drücken Sie Taste , bis auf der
Anzeige [ ] (20 mV Kalibrierungs–Anzeige) erscheint. Setzen Sie STV–
Ausgang auf 20 mV. Hat sich der Wert in Anzeige 2 stabilisiert, drücken Sie die
Taste .
3. Drücken Sie Taste , bis auf der Anzeige [ ] (0 mV Kalibrierungs–Anzeige) erscheint. Setzen Sie STV–Ausgang auf 0 mV. Hat sich der Wert in Anzeige 2 stabilisiert, drücken Sie die Taste .
4. Als nächstes kalibrieren Sie die Übertragungs–Ausgangsfunktion. Wird die
Übertragungs–Ausgangsfunktion nicht angeboten, gehen Sie zu Punkt 8. Drük-
ken Sie die Taste . Auf der Anzeige wird [ ] (20 mA ) angezeigt.
5. Stellen Sie den Ausgang über die Tasten oder auf 20mA ein. Überwachen Sie die Anzeige mit dem Multimeter. Im Beispiel auf der linken Seite ist die
Anzeige dargestellt. Der angezeigte Wert ist um zwei Stellen kleiner als vor der
Kalibrierung.
6. Drücken Sie Taste . Auf der Anzeige wird [ ] (4 mA Kalibrierung) dargestellt.
7. Stellen Sie den Ausgang über die Tasten oder auf 4 mA ein. Überwachen Sie die Anzeige mit dem Multimeter. Im Beispiel auf der linken Seite ist die
Anzeige dargestellt. Der angezeigte Wert ist um zwei Stellen kleiner als vor der
Kalibrierung.
8. Drücken Sie die Taste , bis die Anzeige ”Daten speichern” angezeigt wird.
Drücken Sie dann die Taste und die Anzeige 2 wechselt zu [ ]. Zwei
Sekunden später sind die Daten im internen Speicher abgelegt. Wird die Meldung [ ] angezeigt und anschließend die Taste gedrückt, werden die
Daten gelöscht.
9. Die Kalibrierung des Stromeingangs ist beendet. Drücken Sie die Taste
und kehren zu der Anzeige [ ] zurück.
49
Page 58

Kapitel 4 – Betriebseinstellungen
Kalibrierung des Spannungseingangs
Vorbereitung
100...240 VAC
(24 VAC/DC)
5
4
3
11 12
10
9
8
Kalibrierung
0...5 V, 1...5 V
2
13 14
1
DMM DMM= Multimeter
Abb. 61: Klemmenbelegung bei der Kalibrierung des Spannungseingangs
7
6
STV
STV= Spannungs–/Stromquelle
DMM ist nur erforderlich, wenn die Übertragungs–Ausgangsfunktion angeboten
wird.
Nachfolgend ist die Kalibrierung des Spannungseingangs beschrieben, bei der die
Übertragungs–Ausgangsfunktion angeboten wird. Wird die Übertragungs–Ausgangsfunktion nicht angeboten, überspringen Sie die Schritte 4...7.
1. Wird in Anzeige 1[ ] angezeigt, zeigt Anzeige 2 den Zeitgeber (30 Minuten) an. Dieser Wert wird bei der Kalibrierung heruntergezählt.
2. Zuerst kalibrieren Sie den Haupteingang. Drücken Sie Taste , bis auf der
Anzeige [ ] (5 V Kalibrierungs–Anzeige) erscheint. Setzen Sie STV–Ausgang auf 5 V. Hat sich der Wert in Anzeige 2 stabilisiert, drücken Sie die Taste
.
3. Drücken Sie Taste , bis auf der Anzeige [ ] (0 V Kalibrierungs–Anzeige) erscheint. Setzen Sie STV–Ausgang auf 0 V. Hat sich der Wert in Anzeige 2 stabilisiert, drücken Sie die Taste .
4. Als nächstes kalibrieren Sie die Übertragungs–Ausgangsfunktion. Wird die
Übertragungs–Ausgangsfunktion nicht angeboten, gehen Sie zu Punkt 8. Drük-
ken Sie die Taste . Auf der Anzeige wird [ ] (20 mA ) angezeigt.
5. Stellen Sie den Ausgang über die Tasten oder auf 20 mA ein. Überwachen Sie die Anzeige mit dem Multimeter. Im Beispiel auf der linken Seite ist die
Anzeige dargestellt. Der angezeigte Wert ist um zwei Stellen kleiner als vor der
Kalibrierung.
6. Drücken Sie Taste . Auf der Anzeige wird [ ] (4 mA Kalibrierung) dargestellt.
7. Stellen Sie den Ausgang über die Tasten oder auf 4 mA ein. Überwachen Sie die Anzeige mit dem Multimeter. Im Beispiel auf der linken Seite ist die
Anzeige dargestellt. Der angezeigte Wert ist um zwei Stellen kleiner als vor der
Kalibrierung.
8. Drücken Sie die Taste , bis die Anzeige ”Daten speichern” angezeigt wird.
Drücken Sie dann die Taste und die Anzeige 2 wechselt zu [ ]. Zwei
Sekunden später sind die Daten im internen Speicher abgelegt. Wird die Meldung [ ] angezeigt und anschließend die Taste gedrückt, werden die
Daten gelöscht.
9. Die Kalibrierung des Spannungseingangs (0...5 V, 1...5 V) ist beendet. Drücken
Sie die Taste und kehren zu der Anzeige [ ] zurück.
50
Page 59

Kapitel 4 – Betriebseinstellungen
Kalibrierung
0...10 V
Nachfolgend ist die Kalibrierung des Spannungseingangs beschrieben, bei der die
Übertragungs–Ausgangsfunktion angeboten wird. Wird die Übertragungs–Ausgangsfunktion nicht angeboten, überspringen Sie die Schritte 4...7.
1. Wird in Anzeige 1[ ] angezeigt, zeigt Anzeige 2 den Zeitgeber (30 Minuten) an. Dieser Wert wird bei der Kalibrierung heruntergezählt.
2. Zuerst kalibrieren Sie den Haupteingang. Drücken Sie Taste , bis auf der
Anzeige [ ] (10 V Kalibrierungs–Anzeige) erscheint. Setzen Sie STV–Ausgang auf 10 V. Hat sich der Wert in Anzeige 2 stabilisiert, drücken Sie die
Taste .
3. Drücken Sie Taste , bis auf der Anzeige [ ] (0 V Kalibrierungs–Anzeige) erscheint. Setzen Sie STV–Ausgang auf 0 V. Hat sich der Wert in Anzeige 2 stabilisiert, drücken Sie die Taste .
4. Als nächstes kalibrieren Sie die Übertragungs–Ausgangsfunktion. Wird die
Übertragungs–Ausgangsfunktion nicht angeboten, gehen Sie zu Punkt 8. Drük-
ken Sie die Taste . Auf der Anzeige wird [ ] (20 mA ) angezeigt.
5. Stellen Sie den Ausgang über die Tasten oder auf 20 mA ein. Überwachen Sie die Anzeige mit dem Multimeter. Im Beispiel auf der linken Seite ist die
Anzeige dargestellt. Der angezeigte Wert ist um zwei Stellen kleiner als vor der
Kalibrierung.
6. Drücken Sie Taste . Auf der Anzeige wird [ ] (4 mA Kalibrierung) dargestellt.
7. Stellen Sie den Ausgang über die Tasten oder auf 4 mA ein. Überwachen Sie die Anzeige mit dem Multimeter. Im Beispiel auf der linken Seite ist die
Anzeige dargestellt. Der angezeigte Wert ist um zwei Stellen kleiner als vor der
Kalibrierung.
8. Drücken Sie die Taste , bis die Anzeige ”Daten speichern” angezeigt wird.
Drücken Sie dann die Taste und die Anzeige 2 wechselt zu [ ]. Zwei
Sekunden später sind die Daten im internen Speicher abgelegt. Wird die Meldung [ ] angezeigt und anschließend die Taste gedrückt, werden die
Daten gelöscht.
9. Die Kalibrierung des Spannungseingangs (0...10 V) ist beendet. Drücken Sie
die Taste und kehren zu der Anzeige [ ] zurück.
51
Page 60

Kapitel 4 – Betriebseinstellungen
/
Überprüfung der
Anzeigegenauigkeit
Thermoelement
Nach der Kalibrierung der Eingänge führen Sie eine Überprüfung der Anzeigegenauigkeit durch. Damit soll sichergestellt werden, daß die Kalibrierung des E5CK
korrekt vorgenommen wurde. Betreiben Sie den E5CK in der Betriebsart Ebene 0
über PV/SP–Überwachung (Istwert/Sollwert–Überwachung). Überprüfen Sie die
Anzeigegenauigkeit der oberen / unteren Grenzwerte.
Nachfolgend ist die erforderliche Schaltungskonfiguration dargestellt. Stellen Sie
sicher, daß der E5CK mit der Klemmenkompensation über eine Kompensationsleitung verbunden ist. Dieser Eingangsanschluß wird für den Betrieb benötigt.
5
11 12
4
100...240 VAC
(24 VAC/DC)
3
2
1
13 14
Abb. 62: Konfiguration für Thermoelemente
10
9
8
7
6
Komensations–
leitung
Klemmen–
Kompensation
STV=
Spannungs–
Stromquelle
Stellen Sie beim Betrieb sicher, daß die Einstellung der Klemmenkompensation
0 _C beträgt. Gleichen Sie den STV–Ausgang der Startspannung des Über–
prüfungswertes ein.
Platin–Widerstandsthermometer
Strom– und
Spannungseingang
Nachfolgend ist die erforderliche Schaltungskonfiguration dargestellt.
5
11 12
4
100...240 VAC
(24 VAC/DC)
3
2
1
13 14
Abb. 63: Konfiguration für Platin–Widerstandsthermometer
10
9
8
7
6
6-stellige Widerstands–Kalibrierbox
Stellen Sie beim Betrieb sicher, daß die Einstellung der 6–stelligen Widerstandskalibrierbox dem zu überprüften Wert entspricht.
Nachfolgend ist die erforderliche Schaltungskonfiguration dargestellt.
100...240 VAC
(24 VAC/DC)
5
4
3
2
1
11 12
13 14
10
9
8
7
6
STV= Spannungs–/Stromquelle
STV
52
Abb. 64: Konfiguration für Strom– und Spannungseingang
Stellen Sie beim Betrieb sicher, daß der über STV eingestellte Spannungs– oder
Stromwert dem Prüfwert entspricht.
Page 61

Kapitel 5 – Parameter
Auf der Anzeige des E5CK werden nur Parameter angezeigt, die beim Betrieb verwendet werden. Diese Parameter werden dann angezeigt, wenn die ”Randbedingungen” (rechts) erfüllt sind. Beachten Sie, daß die Einstellungen geschützter
Parameter noch gültig sind und nicht ohne Berücksichtigung der Randbedingungen
angezeigt werden.
1. Verriegelungs–Betriebsart
Die Verriegelungs–Betriebsart deaktiviert (verriegelt) die Menü– oder
Bevor Parameter in dieser Betriebsart geändert werden, stellen Sie sicher, daß die
Verriegelung der Menü– oder
Um in diese Betriebsart umzuschalten, drücken Sie gleichzeitig für mehr als eine
Sekunde die
mindestens 1 Sekunde kann die Betriebsart wieder deaktiviert bzw. verlassen werden.
Die folgende Tabelle zeigt die Parameter an, die von dieser Betriebsart angeboten
werden. Auf der angegebenen Seite finden Sie weitere Informationen zu diesem
Parameter.
Symbol Parametername Seite
A/M
AT ausführen / abbrechen
A/M
–Taste den Betrieb nicht stören.
Randbedingung:
Der E5CK muß in
Betrieb sein.
A/M
–Taste.
– und –Taste. Durch nochmaliges Drücken dieser Tasten für
Verriegelung 53
[A/M]–Taste verriegelt 54
Verriegelung
Dieser Parameter gibt an, welche Parameter geschützt werden. Jedoch beachten
Sie, daß die Verriegelungs–Betriebsart und die manuelle Betriebsart nicht geschützt werden können.
Wenn diesem Parameter in “0...3” umgeschaltet wird, können nur die durch das
Zeichen ”f” gekennzeichneten Betriebsarten aktiviert werden. Wird bspw. diesem
Parameter der Wert 2 zugewiesen, können nur die Betriebsarten Ebene 0...2 aktiviert werden.
53
Page 62

Kapitel 5 – Parameter
Betriebsart
Zugewiesener Para-
Betriebsart
E/A–Kalibrierung f
Kommunikation f f
Erweiterte Funk-
tion
Setup f f
Ebene 2 f f f
Ebene 1 f f f f
Ebene 0 f f f f
meterwert
0 1 2 3
f f
Werden diesem Parameter die Werte 4...6 zugewiesen, können nur Operationen
auf der Betriebsart Ebene 0 durchgeführt werden. Die Betriebsart wird nicht in der
Menü–Anzeige angezeigt.
Wird der Wert 5 zugewiesen, kann nur der Parameter ”ISTWERT/SOLLWERT”
verwendet werden.
Wird der Wert 6 zugewiesen, kann nur der Parameter ”ISTWERT/SOLLWERT”
angezeigt werden. (Der Sollwert kann nicht verändert werden.)
Hinweis
Hinweis
Der Werkseitige Einstellung ist 1. (Nur die Kalibrierungsbetriebsart wird geschützt.)
Weitere Informationen siehe Kapitel 3 – 5. Verriegelungs–Betriebsart (Seite 26).
[A/M]–Taste verriegelt
Die Funktion der Taste ist ungültig. Sie können dann nicht mehr zwischen
dem manuellen und automatischen Betrieb umschalten.
[ ]:
[ ]:
Werkseitige Einstellung = [ ]
Weitere Informationen siehe Kapitel 3 – 5. Verriegelungs–Betriebsart (Seite 26).
A/M
–Taste ist verriegelt
A/M
–Tasten–Verriegelung ist aufgehoben
54
Page 63

Kapitel 5 – Parameter
2. Manuelle Betriebsart
In dieser Betriebsart sind manuelle Operationen möglich und die MANU–LED
leuchtet.
Wird diese Betriebsart aktiviert, wird der Ausgangsstellwert, der sofort nach der
Änderung der Betriebsart aktiv ist, ausgegeben. Der Ausgangsstellwert wird über
die Tasten oder geändert.
Um diese Betriebsart zu aktivieren, drücken Sie die Taste
A/M
für mindestens 1
Sekunde, wenn Sie sich in der Betriebsart Ebene 0...2 befinden. Um die Betriebsart zu verlassen, drücken Sie die Taste
A/M
wiederum mindestens für 1 Sekunde. Sie befinden sich dann in der Betriebsart Ebene 0.
Der manuelle Ausgangsstellwert ist der einzige Parameter, der in diese Betriebsart
verfügbar ist.
Handbuch MV
Einstellen des Ausgangsstellwertes für den manuellen Betrieb.
Der Istwert wird auf der Anzeige 1 und der Ausgangsstellwert wird auf Anzeige 2
angezeigt. Ändern Sie den Ausgangsstellwert mit den Tasten oder .
Istwert
Ausgangsstellwert
[MANU]–LED
Der manuelle Ausgangsstellwert bleibt bei einer Spannungsunterbrechung erhalten.
Regelart Einstellbereich Einheit
Standard –5,0...105,0 % 0
Heizen und Kühlen –105,0...105,0 % 0
Werkseitige
Einstellung
Hinweis
Weitere Informationen siehe Kapitel 3 – 7. Einstellung des Regelbetriebes
(Seite 28).
55
Page 64

Kapitel 5 – Parameter
3. Betriebsart Ebene 0
Die Parameter in dieser Betriebsart können nur dann eingestellt werden, wenn der
Verriegelungs–Betriebsart die Werte 0...4 zugewiesen werden.
Diese Betriebsart wird zur Überwachung des Istwertes, des Sollwertes und des
Ausgangsstellwertes während des Betriebes benutzt. Zusätzlich kann eine Überprüfung und Einstellung des Sollwertes vorgenommen werden. Der Betrieb des
E5CK kann in dieser Betriebsart gestartet und gestoppt werden.
Um diese Betriebsart zu aktivieren bzw. in diese Betriebsart umzuschalten, drükken Sie für mindestens 1 Sekunde die Taste . Dies ist möglich, wenn Sie sich
in der Betriebart Ebene 1 oder 2, in der Betriebsart Setup, Erweiterte Funktionen,
Kommunikation oder E/A–Kalibrierung befinden. Es wird dann das Menü ange-
zeigt. Wählen Sie dann [ ] und drücken anschließend wird die Taste für
mindenstens 1 Sekunde. Sie befinden sich dann in der Betriebsart Ebene 0.
Zur Auswahl der Parametern drücken Sie die Taste . Um Parametereinstellungen zu ändern, benutzen Sie die Tasten oder . Die zur Verfügung stehenden Parameter sind nachfolgend aufgeführt.
Istwert
Symbol Parametername Seite
PV/SP 56
Sollwert während SP–Rampe 57
Überwachung Ausgangsstellwert (Heizen) 57
Überwachung Ausgangsstellwert (Kühlen) 57
Run/Stop 58
PV/SP (Istwert/Sollwert)
Istwert
Sollwert
Der Istwert wird über Anzeige Nr.1 und der Sollwert über Anzeige Nr. 2 angezeigt.
Der Sollwert kann eingestellt werden.
Ist die Multi–SP–Funktion (Mehrfach–Sollwert) in Betrieb, wird in Abhängigkeit der
Einstellung Sollwert 0 oder 1 aktiviert.
Die Dezimalpunkt–Position hängt vom ausgewählten Temperatursensor im Eingang und von den Skalierungsergebnissen des Analogeingangs ab.
Überwachungsbereich Baugruppe
Skalierungs–Untergrenze – 10 % FS bis Skalierungs–Obergrenze +10 % FS EU
Sollwert
Hinweis
56
Wähernd der Temperaturmessung wird über den ausgewählten Sensor der zu
überwachende Bereich definiert.
Einstellbereich Baugruppe
Sollwert–Untergrenze bis Sollwert–Obergrenze EU 0
Werkseitige
Einstellung
Weitere Informationen siehe Kapitel 3 – 7. Einstellung des Regelbetriebes
(Seite 28).
Page 65

Kapitel 5 – Parameter
Artverwandte Parameter
Eingangstyp, Sk alierungs–O bergr enze, Sk alierungs–Unt ergrenz e, Dezimalpunk t (Se tup–Betriebsart) , Sollwert–O bergr enze und Sollwert–Unt ergrenze (Betriebsart Er wei terte Funk tionen) .
Sollwert während SP–Rampe
Die SP–Rampenfunktion muß zuerst aktiviert werden. Stellen Sie dann den entsprechenden Sollwert ein.
Hinweis
Artverwandte Parameter
Artverwandte Parameter
Überwachungsbereich
Unterer SP–Grenzwert bis Oberer SP–Grenzwert EU 0
Baugruppe
Werkseitige Einstellung
Weitere Informationen siehe Kapitel 3 – 7. Einstellung des Regelbetriebes
(Seite 28).
PV/SP (Betriebsart Ebene 0)
Zeiteinheit und Sollwert der SP–Rampe (Betriebsart Ebene 2)
Sollwert–Ober– und Untergrenzwert (Betriebsart Erweiterte Funktionen)
Oberer SP–Grenzwert, Unterer SP–Grenzwert (Betriebsart Erweiterte Funktion)
Multi–SP–Funktion (Mehrfach Sollwert) (Kommunikations–Betriebsart)
Sollwert 0, Sollwert 1 (Betriebsart Ebene 1)
Überwachung des Ausgangsstellwertes (Heizen)
Überwachung des Ausgangsstellwertes (Kühlen)
Dieser Parameter kann nicht gesetzt werden.
Überwacht den Ausgangsstellwert der Heiz– oder Kühlseite.
Der Ausgangsstellwert wird in einem Standard–Regelungsystem über Parameter
”Überwachung des Ausgangsstellwertes Heizen” überwacht.
Parameter ”Überwachung des Ausgangsstellwertes Kühlen” kann nur während der
Heiz– und Kühlregelung verwendet werden.
57
Page 66

Kapitel 5 – Parameter
Überwachung des Ausgangsstellwertes (Heizen)
Regelung
Standard –5,0...105,0 %
Heizen und Kühlen 0,0...105,0 %
Überwachungsbereich
Einheit
Überwachung des Ausgangsstellwertes (Kühlen)
Regelung
Heizen und Kühlen 0,0...105,0 %
Überwachungs–
bereich
Einheit
Run/Stop
Dieser Parameter wird zur Überprüfung des Betriebszustandes des E5CK und zur
Spezifizierung des Start/Stop–Betriebes benutzt.
Wird die ”Run/Stop–Funktion” dem Ereigniseingang zugewiesen, wird der Betrieb
unterbrochen, wenn der Ereigniseingang auf EIN gesetzt wird. Befindet sich der
Ereigniseingang im Status AUS, wird der Betrieb fortgesetzt. Es können keine
Prioritätszuordnungen gemacht werden.
Um den Betrieb zu starten, weisen Sie diesem Parameter über die Tasten
oder die Einstellung [ ] zu. Um den Betrieb zu unterbrechen, weisen
Sie diesem Parameter die Einstellung [ ] zu. Wird der Betrieb unterbrochen,
leuchtet die Stop–LED.
Der werkseitige Einstellung ist [ ]
Hinweis
Weitere Informationen siehe Kapitel 3 – 6. Betrieb starten und unterbrechen
(Seite 27).
58
Page 67

Kapitel 5 – Parameter
4. Betriebsart Ebene 1
Die Parameter in dieser Betriebsart können nur dann eingestellt werden, wenn der
Verriegelungsbetriebsart die Werte 0...3 zugewiesen werden.
Diese Betriebsart enthält die Hauptparameter zur Einstellung der Regelung. Folgende Parameter sind verfügbar: AT (Auto–Tuning), Einstellung der Alarmwerte,
Einstellung der Schaltzykluszeit und der PID–Konstanten.
Um diese Betriebsart zu aktivieren bzw. in diese Betriebsart umzuschalten, drükken Sie für mindestens 1 Sekunde die Taste . Dies ist möglich, wenn Sie sich
in der Betriebart Ebene 0 oder 2, in der Betriebsart Setup, Erweiterte Funktionen,
Kommunikation oder E/A–Kalibrierung befinden. Es wird dann das Menü angezeigt. Wenn Sie [ ] wählen, drücken Sie die Taste für mindenstens 1 Sekunde. Sie befinden sich dann in der Betriebsart Ebene 1.
Zur Auswahl der Parametern drücken Sie die Taste . Um Parametereinstellungen zu ändern, benutzen Sie die Tasten oder . Die zur Verfügung stehenden Parameter sind nachfolgend aufgeführt.
Symbol Parametername Seite
AT ausführen/abbrechen 60
Sollwert 0
Sollwert 1
Alarmwert 1
Alarmwert 2
Alarmwert 3
Proportionalband (P)
Nachstellzeit (I)
Vorhaltezeit (D)
Kühlkoeffizienten
Totband
Manueller Resetwert
Hysterese (Heizen)
Hysterese (Kühlen)
Schaltzykluszeit (Heizen)
60
60
61
61
61
61
61
61
62
62
62
63
63
63
Schaltzykluszeit (Kühlen)
63
59
Page 68

Kapitel 5 – Parameter
AT ausführen/abbrechen
Voraussetzung: Der E5CK muß in Betrieb sein, die erweiterte PID–Regelung eingestellt und ST deaktiviert (AUS) sein.
Für die Ausführung wird der Grenzzyklus der Ausgangsstellgrößen–Änderungsbreite (40 oder 100 %) festgelegt. Nach der AT–Ausführung werden die Parameter
für PID und LBA–Erkennungszeit (Regelkreisunterbrechung) automatisch eingestellt.
Während der Heiz– und Kühlregelung kann nur 100 % AT ausgeführt werden.
Wird dieser Parameter ausgewählt, ist die Einstellung [ ].
Um 40 % AT auszuführen, wählen Sie [ ]. Um 100 % AT auszuführen, wäh-
len Sie [ ]. Während des Auto–Tuning–Betriebes leuchtet die AT–LED. Beachten Sie, daß während der Heiz– und Kühlregelung [ ] nicht angezeigt
wird.
Nach der AT–Ausführung werden die Parameter automatisch zurückgesetzt
[ ].
Hinweis
Artverwandte Parameter
Weitere Informationen siehe Kapitel 3 – 7. Einstellung des Regelbetriebes
(Seite 28).
Run/Stop (Betriebsart Ebene 0)
Proportionalband, Nachstell– und Vorhaltezeit (Betriebsart Ebene 1)
LBA Erkennungszeit (Betriebsart Ebene 2)
Sollwert 0
Sollwert 1
Die Multi–SP–Funktion (Mehrfach–Sollwert) muß aktiviert sein.
Befindet sich der Ereigniseingang im Status AUS, wird Parameter ”Sollwert 0” ver-
wendet. Status EIN: Parameter ”Sollwert 1” wird verwendet.
Wird der Sollwert–Parameter geändert, wird die Einstellung, die über den Ereigni-
seingang (Sollwert 0 oder Sollwert 1) ausgewählt wurde, verbunden und geändert.
Die Dezimalpunkt–Position hängt vom ausgewählten Temperatursensor im Ein-
gang und von den Skalierungsergebnissen des Analogeingangs ab.
Einstellbereich Baugruppe
Skalierungs–Untergrenze bis Skalierungs–Obergrenze EU 0
Werkseitige
Einstellung
Hinweis
Artverwandte Parameter
60
Weitere Informationen siehe Kapitel 4 – 3. Kommunikationsfunktion benutzen
(Seite 38).
Multi–SP–Funktion (Betriebsart Kommunikation)
Sollwert (Betriebsart Ebene 0)
Eingangstyp, Skalierungs–Obergrenze, Skalierungs–Untergrenze und Dezimalpunkt (Setup Betriebsart)
Page 69

Kapitel 5 – Parameter
Alarmwert 1
Alarmwert 2
Alarmwert 3
Alarme müssen den Ausgängen zugewiesen werden. Werden die Alarme 1 und 2
bspw. den Ausgängen 1 und 2 zugewiesen, kann der Alarm 3 nicht mehr verwendet werden.
Dieser Parameter wird für die Überwachung oder Änderung der Alarm wert e der
Alarm–Ausgänge 1 bis 3 verwendet.
Die Dezimalpunkt–Position hängt vom ausgewählten Temperatursensor im Eingang und von den Skalierungsergebnissen des Analogeingangs ab.
Hinweis
Artverwandte Parameter
Einstellbereich Baugruppe
–1999 bis 9999 EU 0
Werkseitige
Einstellung
Weitere Informationen siehe Kapitel 3 – 7. Einstellung des Regelbetriebes
(Seite 28).
Eingangs–Typ, Skalierungs–Obergrenze, Skalierungs–Untergrenze, Dezimalpunkt,
Zuweisung Regelausgang 1, Zuweisung Regelausgang 2, Zuweisung
Hilfsaugang 1, Alarmtyp 1, Alarmtyp 2, Alarmtyp 3, Alarm 1 (geöffnet bei Alarm),
Alarm 2 (geöffnet bei Alarm), Alarm 3 (geöffnet bei Alarm), Setup–Betriebsart
Alarm–Hysterese 1, Alarm–Hysterese 2, Alarmhysterese 3 (Betriebsart Ebene 2)
Standby–Bereitschaftsmodus (Betriebsart Erweiterte Funktionen)
Proportionalband (P)
Nachstellzeit (I)
Vorhaltezeit (D)
Voraussetzung: Der E5CK muß in Betrieb sein, die erweiterte PID–Regelung eingestellt und ST deaktiviert (AUS) sein.
Es erfolgt hierüber die Einstellung der PID–Konstanten. Beachten Sie, daß die Einstellung der PID–Konstanten über Auto–Tuning mit der aktivierten Selbstoptimierung nachgeregelt wird.
Artverwandte Parameter
Parameter Einstellbereich Einheit
Proportionalband (P) 0,1...999,9 % FS 10.0
Nachstellzeit (I) 0...3999 Sek. 233
Vorhaltezeit (D) 0...3999 Sek. 40
AT ausführen/abbrechen (Betriebsart Ebene 1)
Werkseitige
Einstellung
61
Page 70

Kapitel 5 – Parameter
Kühlkoeffizient
Voraussetzung: Heiz–/Kühlregelung oder erweiterter PID–Regelung des E5CK.
In der Heiz– und Kühlregelung wird P auf der Kühlseite mit der folgenden Formel
errechnet: Kühlseite P = Kühlkoeffizient P
Hinweis
Artverwandte Parameter
Hinweis
Einstellbereich Einheit
0,01...99,99 Keine 1.00
Werkseitige
Einstellung
Weitere Informationen siehe Kapitel 4 – 1. Auswahl der Regelart (Seite 33).
Proportionalband (Betriebsart Ebene 1)
Totband
Voraussetzung: Heiz– und Kühlregelung des E5CK.
Einstellung des Totbandes der Heiz– und Kühl–Regelung. Ein negativer Wert führt
zu einem überlappenden Band.
Einstellbereich Einheit
–19,99...99,99 % FS 0,00
Werkseitige
Einstellung
Weitere Informationen siehe Kapitel 4 – 1. Auswahl der Regelart (Seite 33).
Manueller Reset–Wert
Voraussetzung: Standard–Regelung oder erweiterte PID–Regeleung des E5CK;
ST: OFF (AUS) und Parameter der Nachstellzeit (I) auf 0.
Einstellung des erforderlichen Ausgangsstellwertes, um während der Stabilisierung
der P– oder PD–Regelung einen Offset auszuschließen.
Einstellbereich Einheit
0.0 zu 100,0 % 50.0
Werkseitige
Einstellung
62
Page 71

Kapitel 5 – Parameter
Hysterese (Heizen)
Hysterese (Kühlen)
Voraussetzung: Einstellung des E5CK auf EIN/AUS–Regelung.
Die Einstellung der Hysterese sichert einen stabilen EIN/AUS–Betrieb.
Benutzen Sie bei der Standardregelung den Parameter Hysterese (Heizen). Der
Parameter Hysterese (Kühlen) kann nicht verwendet werden.
Bei der Heiz– und Kühlregelung kann die Hysterese getrennt für das Heizen und
Kühlen eingestellt werden. Benutzen Sie den Parameter Hysterese (Heizen), um
für die Heizseite die Hysterese einzustellen und den Parameter Hysterese (Kühlen), um für die Kühlseite die Hysterese einzustellen.
Hinweis
Artverwandte Parameter
Parameter Einstellbereich Einheit
Hysterese (Heizen) 0,01...99,99 % FS 0,10
Hysterese (Kühlen) 0,01...99,99 % FS 0,10
Werkseitige
Einstellung
Weitere Informationen siehe Kapitel 4 – 1. Auswahl der Regelart (Seite 33).
Zuweisung Regelausgang 1, Zuweisung Regelausgang 2 (Setup–Betriebsart)
PID–/EIN/AUS–Regelung (Betriebsart Erweiterte Funktionen)
Schaltzykluszeit (Heizen)
Schaltzykluszeit (Kühlen)
Voraussetzung: Der Ralais– oder Spannungsausgang muß als Ausgang definiert
werden und die erweiterte PID–Regelung aktiviert werden.
Über die Schaltzykluszeit wird der Puls–/Pause–Zeitraum definiert. Berücksichtigen Sie bei der Einstellung der Schaltzykluszeit die Regelungscharakteristik des
E5CK.
Benutzen Sie bei der Standard–Regelung den Parameter Schaltzykluszeit (Heizen). Der Parameter Schaltzykluszeit (Kühlen) kann nicht verwendet werden.
Hinweis
Artverwandte Parameter
Bei der Heiz– und Kühlregelung kann die Schaltzykluszeit getrennt für das Heizen
und Kühlen eingestellt werden. Benutzen Sie den Parameter Schaltzykluszeit (Heizen), um für die Heizseite die Schaltzykluszeit einzustellen und die Schaltzykluszeit (Kühlen), um für die Kühlseite die Schaltzykluszeit einzustellen.
Parameter Einstellbereich Einheit
Schaltzykluszeit (Heizen) 1...99 Sek. 20
Schaltzykluszeit (Kühlen) 1...99 Sek. 20
Werkseitige
Einstellung
Weitere Informationen siehe Kapitel 3 – 3. Einstellen der Ausgangsspezifikation
(Seite 19).
Zuweisung Regelausgang 1, Zuweisung Regelausgang 2 (Setup–Betriebsart)
63
Page 72

Kapitel 5 – Parameter
5. Betriebsart Ebene 2
Die Parameter in dieser Betriebsart können nur dann eingestellt werden, wenn der
Verriegelungs–Betriebsart die Werte 0...2 zugewiesen werden.
Diese Betriebsart enthält die Hilfsparameter zur Einstellung der Regelparameter.
Diese Betriebsart beinhaltet Parameter zur Beschränkung des Ausgangsstellwertes und des Sollwertes, Parameter zum Umschalten zwischen lokalem und dezentralem Betrieb, Parametern zur Einstellung eines Alarms bei Regelkreisunter–
brechung (LBA) und zur Einstellung digitaler Eingangsfilterwerte.
Um diese Betriebsart zu aktivieren bzw. in diese Betriebsart umzuschalten, drükken Sie für mindestens 1 Sekunde die Taste . Dies ist möglich, wenn Sie sich
in der Betriebart Ebene 0 oder 1, in der Betriebsart Setup, Erweiterte Funktionen,
Kommunikation oder E/A–Kalibrierung befinden. Es wird dann das Menü angezeigt. Wenn Sie [ ] wählen, drücken Sie / . Anschließend wird die Ta-
ste für mindenstens 1 Sekunde gedrückt. Sie befinden sich dann in der
Betriebsart Ebene 2.
Zur Auswahl der Parametern drücken Sie die Taste . Um Parametereinstellungen zu ändern, benutzen Sie die Tasten oder . Die zur Verfügung stehenden Parameter sind nachfolgend aufgeführt.
Symbol Parameter Seite
Dezentraler/lokaler Betrieb 65
SP–Rampen–Zeiteinheit
SP–Rampenwert
LBA–Erkennungszeit
Ausgangsstellgröße bei Stop
Ausgangsstellgröße bei Istwert–Fehler
Obergrenze Ausgangsstellwert
Untergenze Ausgangsstellwert
Grenzwert Ausgangsstellwert
Digitaler Eingangs–Filter
Alarm–Hysterese 1
Alarm–Hysterese 2
Alarm–Hysterese 3
Obere Grenzwertverschiebung (Temperatur)
65
65
66
66
66
67
67
67
68
68
68
69
69
64
Untere Grenzwertverschiebung (Temperatur)
69
Page 73

Kapitel 5 – Parameter
Dezentraler/lokaler Betrieb
Voraussetzung: Die Kommunikationsfunktion des E5CK muß aktiviert werden. Anschließend kann zwischen lokalem und dezentralem Betrieb umgeschaltet werden.
Die Parametereinstellung während des dezentralen Betriebes kann über die Kommunikationsfunktion geändert werden. Die Parametereinstellung während des lokalen Betriebes kann direkt über den E5CK geändert werden.
Sie können die Parametereinstellung der beiden Kommunikationverfahren überprüfen, unabhängig davon, ob sich der E5CK im dezentralen oder lokalen Betrieb befindet.
Einstellbereich
[ ]: dezentral
[ ]: lokal
Werkseitige
Einstellung
[ ]
SP–Rampen–Zeiteinheit
SP–Rampenwert
Voraussetzung: Parameter ST muss deaktiviert sein.
Spezifiziert die Änderungsrate während des SP–Rampenbetriebes. Der SP–Ram-
penwert definiert die maximal zulässige Änderung pro Zeiteinheit (Minute oder
Stunde). Wird dem Parameter SP–Rampenwert der Wert Null zugewiesen, ist die
SP–Rampenfunktion deaktiviert.
Die Zeiteinheit und der SP–Rampenwert sind voneinander unabhängig. Soll die
Rampenfunktion bspw. auf 30 pro Minute eingestellt werden, muß dem Parameter
SP–Rampenwert der Wert 30 und dem Parameter SP–Rampen–Zeiteinheit die
Einheit Minute [ ] zugewiesen werden. Soll die Einstellung auf 30 pro Stunde
geändert werden, muß nur die Parameter–Einstellung der SP–Rampen–Zeiteinheit
auf Stunde [ ] abgeändert werden.
Die Dezimalpunkt–Position des SP–Rampenwertes hängt vom ausgewählten Temperatursensor im Eingang und von den Skalierungsergebnissen des Analogeingangs ab.
Hinweis
Artverwandte Parameter
Parameter Einstellbereich Einheit
SP–Rampen–Zeiteinheit [ ] : Minute / [ ]: Stunde
SP–Rampenwert 0 bis 9999 EU 0
Keine
Werkseitige
Einstellung
Während des Temperatureingangs wirkte der Bereich des zur Zeit auswählten
Sensors er, während der Einstellbereich für die “SOLLWERTRAMPE Wert” Parameter “setzte.”
Weitere Informationen siehe Kapitel 4 – 2. Betriebsbeschränkungen (Seite 35).
Einganstyp, Skalierungs–Obergrenze, Skalierungs–Untergrenze, Dezimalpunkt
(Setup–Betriebsart)
65
Page 74

Kapitel 5 – Parameter
Erkennungszeit bei einer Regelkreisunterbrechung (LBA)
Voraussetzung: Die LBA–Funktion (Alarm bei Regelkreisunterbrechung) muß einem Ausgang des E5CK zugewiesen werden.
Dieser Parameter wird bei der AT–Ausführung automatisch eingestellt (außer bei
der EIN/AUS–Regelung).
Ein Alarm bei einer Regelkreisunterbrechung wird gemeldet, wenn die Änderungen
eines Parameter–Istwertes 0,2 % des Parameter–Absolutwertes (FS) ausmachen
und somit die oberen oder unteren Grenzwerte der Ausgangsstellgröße über– bzw.
unterschreiten werden.
Die LBA–Funktion wird deaktiviert, wenn diesem Parameter der Wert Null zugewiesen wird.
Hinweis
Artverwandte Parameter
Einstellbereich Einheit
0...9999 Sek. 0
Werkseitige
Einstellung
Weitere Informationen siehe Kapitel 4 – 4. LBA–Funktion (Seite 40) und
Kapitel 7 – 3. Fehlerausgänge (Seite 103)
AT ausführen/abbrechen (Betriebsart Ebene 1)
Zuweisung Regelausgang 1, Zuweisung Regelausgang 2, Zuweisung
Hilsausgang 1 (Setup–Betriebsart)
Ausgangsstellgröße (MV) bei Stop
Ausgangsstellgröße (MV) bei Istwert–Fehler
Der Parameter MV bei Stop stellt den Ausgangsstellwert bei einer Unterbrechung
des Betriebes ein.
Der Parameter MV bei Istwertfehler stellt den Ausgangsstellwert bei einem Eingangsfehler ein.
Die Einstellbereiche während der Standard– und Heiz–/Kühlregelung sind unterschiedlich.
Artverwandte Parameter
66
Der Ausgangsstellwert während der Heiz– und Kühlregelung wird auf der Kühlseite
als negativer Wert dargestellt.
Regelart Einstellbereich Einheit
Standard –5,0...105,0 % 0
Heizen und Kühlen –105,0...105,0 % 0
Werkseitige
Einstellung
MV bei Stop: Kapitel 3 – 6. Betrieb starten und unterbrechen
(Seite 27)
MV bei Istwert–Fehler: Kapitel 7 – 2. Fehleranzeige (Seite 102)
Page 75

Kapitel 5 – Parameter
Ausgangsstellgrößen (MV)–Obergrenze
Ausgangsstellgrößen (MV)–Untergrenze
Änderungsgrenzwerte der Ausgangsstellgröße (MV)
Voraussetzung: Der E5CK muß in Betrieb sein, die erweiterte PID–Regelung eingestellt und ST deaktiviert (AUS) sein.
Die Parameter MV Obergrenze und MV–Untergrenze definieren die oberen und
unteren Grenzwerte der Ausgangsstellgröße. Liegt die vom E5CK berechnete Ausgangsstellgröße außerhalb der oberen und unteren Grenzwerte, wird entweder der
obere bzw. untere Grenzwert diesem Parameter zugewiesen.
Über Parameter Änderungsgrenzwerte MV werden Änderungen der Ausgangsstellgröße pro Zeiteinheit (Sekunde) festgelegt. Tritt eine Änderung der Ausgangsstellgröße ein, die den Wert der max. Änderungsgrenzwerte MV überschreitet, wird die
Ausgangsstellgrößen–Änderung über diesen Parameter begrenzt.
Oberer Grenzwert der Ausgangsstellgröße
Die Einstellbereiche während der Standard– und Heiz–/Kühlregelung sind unterschied-
lich. Der Ausgangsstellwert während der Heiz– und Kühlregelung wird auf der
Kühlseite als negativer Wert dargestellt.
Regelart Einstellbereich Einheit
Standard MV Untergrenze +0,1...105,0 % 105.0
Heizen und Kühlen 0,0...105,0 % 105.0
Werkseitige
Einstellung
Unterer Grenzwert der Ausgangsstellgröße
Die Einstellbereiche während der Standard– und Heiz–/Kühlregelung sind unterschied-
lich. Der Ausgangsstellwert während der Heiz– und Kühlregelung wird auf der
Kühlseite als negativer Wert dargestellt.
Regelart Einstellbereich Einheit
Standard –5,0...MV...Obergrenze –0,1 % –5.0
Heizen und Kühlen –105,0...0,0 % –105.0
Werkseitige
Einstellung
Änderungsgrenzwerte der Ausgangsstellgröße
Einstellbereich Baugruppe
0,0...100,0 % 0,0 : AUS
Werkseitige
Einstellung
Hinweis
Weitere Informationen siehe Kapitel 4 – 2. Betriebsbeschränkungen (Seite 35)
67
Page 76

Kapitel 5 – Parameter
Digitaler Eingangsfilter
Über diesen Parameter wird die Zeitkonstante des digitalen Eingangsfilters festgelegt. Die nachfolgende Abbildung stellt den Kurvenverlauf von Daten hinter dem
digitalen Eingangsfilter dar.
Istwert vor dem digitalen Eingangsfilter
A
Istwert hinter dem digitalen Eingangsfilter
0,63 A
Zeitkonstante Zeit
Digitaler Eingansgfilter
Hinweis
Einstellbereich Einheit
0...9999 Sek. 0
Werkseitige
Einstellung
Alarm 1 Hysterese
Alarm 2 Hysterese
Alarm 3 Hysterese
Voraussetzung: Die Alarme müssen den Ausgängen zugewiesen werden. Werden
bspw. die Ausgänge 1 und 2 von Alarmen belegt, kann Alarmhysterese 3 nicht benutzt werden.
Dieser Parameter dient zur Überprüfung der Hysterese der Alarm–Ausgänge 1...3.
Einstellbereich Einheit
0,01...99,99 % FS 0,02
Weitere Informationen siehe Kapitel 3 – 4. Randbedingungen des Alarmausgangs
einstellen (Seite 22).
Werkseitige
Einstellung
Artverwandte Parameter
68
Alarmtyp 1, Alarmtyp 2, Alarmtyp 3, Alarm 1 (geöffnet bei Alarm), Alarm 2 (geöffnet bei Alarm), Alarm 3 (geöffnet bei Alarm), Setup–Betriebsart
Alarmwert 1, Alarmwert 2, Alarm–Wert 3 (Betriebsart Ebene 1)
Page 77

Kapitel 5 – Parameter
Oberer Grenzwert der Eingangsverschiebung
Unterer Grenzwert der Eingangsverschiebung
Voraussetzung: Als Eingangstyp muß zwischen den Einstellungen Thermoelement
oder Platin–Widerstandsthermometer gewählt werden
Sowohl für den oberen als auch für den unteren Grenzwert der Eingangsverschiebung müssen die Einstellungen definiert werden.
Hinweis
Artverwandte Parameter
Einstellbereich Einheit
–199,9...999,9 _C oder _F 0,0
Werkseitige
Einstellung
Weitere Informationen siehe Kapitel 3 – 2. Einstellen der Eingangsspezifikationen
(Seite 18)
Eingangstyp (Setup–Betriebsart)
69
Page 78

Kapitel 5 – Parameter
6. Setupbetriebsart
Die Parameter in dieser Betriebsart können nur dann eingestellt werden, wenn der
Verriegelungs–Betriebsart die Werte 0 und1 zugewiesen werden.
Diese Betriebsart enthält die Parameter zur Einstellung der Basisspezifikationen
des E5CK. Über diese Parameter kann der Eingangstyps, die Skalierung, die Ausgangszuweisungen und der Direkt–/Reverse–Betrieb definiert werden.
Um diese Betriebsart zu aktivieren bzw. in diese Betriebsart umzuschalten, drükken Sie für mindestens 1 Sekunde die Taste . Dies ist möglich, wenn Sie sich
in der Betriebart Ebene 0...2, in der Betriebsart Setup, Erweiterte Funktionen,
Kommunikation oder E/A–Kalibrierung befinden. Es wird dann das Menü angezeigt. Wählen Sie dann [ ] über die Tasten oder und drücken an-
schließend wird die Taste für mindenstens 1 Sekunde. Sie befinden sich dann
in der Setup–Betriebsart.
Zur Auswahl der Parametern drücken Sie die Taste . Um Parametereinstellungen zu ändern, benutzen Sie die Tasten oder . Die zur Verfügung stehenden Parameter sind nachfolgend aufgeführt.
Symbol Parametername Seite
Eingangstyp 71
Skalierungs–Obergrenze
Skalierungs–Untergrenze
Dezimalkomma
_C/_F–Auswahl
Parameter–Initialisierung
Zuweisung Regelausgang 1
Zuweisung Regelausgang 2
Zuweisung Hilfsausgang 1
Alarmtyp 1
Alarm 1 (bei Alarm geöffnet)
Alarmtyp 2
Alarm 2 (bei Alarm geöffnet)
Alarmtyp 3
Alarm 3 (bei Alarm geöffnet)
72
72
72
73
73
73
73
74
74
75
74
75
74
75
70
Kühlen–/Heizen–Betrieb
76
Page 79

Kapitel 5 – Parameter
TC@PT
V
Eingangstyp
Gleichen Sie die Parametereinstellungen (Software) mit den Parametereinstellungen (Hardware) ab.
Weisen Sie den Klemmen 6...8 einen in der nachfolgenden Tabelle aufgelisteten
Eingangscode zu. Der werkseitige Einstellung ist 2 (K1 Thermoelement).
Eingangscode
0 JPt –199,9...650,0 (_C) / –199,9...999,9 (_F) Platin–Wider1 Pt –199,9...650,0 (_C) / –199,9...999,9 (_F)
2 K1 –200...1300 (_C) / –300...2300 (_F)
3 K2 0,0...500,0 (_C) / 0,0...900,0 (_F)
4 J1 –100...850 (_C) / –100...1500 (_F)
5 J2 0,0...400,0 (_C) / 0,0...750,0 (_F)
6 T –199,9...400,0 (_C) / –199,9...700,0 (_F)
7 E 0...600 (_C) / 0...1100 (_F)
8 L1 –100...850 (_C) / –100...1500 (_F)
9 L2 0,0...400,0 (_C) / 0,0...750,0 (_F) Thermoelement
10 U –199,9...400,0 (_C) / –199,9...700,0 (_F)
11 N –200...1300 (_C) / –300...2300 (_F)
12 R 0...1700 (_C) / 0...3000 (_F)
13 S 0...1700 (_C) / 0...3000 (_F)
14 B 100...1800 (_C) / 300...3200 (_F)
15 W 0...2300 (_C) / 0...4100 (_F)
16 PLII 0...1300 (_C) / 0...2300 (_F)
17 4...20 mA
18 0...20 mA
19 1...5 V
20 0...5 V
21 0...10 V
Eingangtyp
standthermometer
Stromeingang
Spannungseingang
Position d e s
Jumpers
TC@PT
TC@PT
I
V
Hinweis
Artverwandte Parameter
Weitere Informationen siehe Kapitel 3 – 2. Einstellen der Eingangsspezifikationen
(Seite 18).
Wenn der Eingang als Temperatureingang definiert wird:
_C / _F–Auswahl ”(Setup–Betriebsart)
Wenn der Eingangtyp als Spannungs– oder Stromeingang definiert wird:
Skalierungs–Obergrenze, Skalierungs–Untergrenze (Setup–Betriebsart)
71
Page 80

Kapitel 5 – Parameter
Skalierungs–Obergrenze
Skalierungs–Untergrenze
Dezimalkomma
Voraussetzung: Der Eingang muß als Analogeingang (Spannungs– oder Stromeingang) definiert werden.
Wird der Eingang als Spannungs– oder Stromeingang definiert, wird eine Skalierung durchgeführt. Die Werte für die Skalierungs–Ober– bzw. Untergrenze werden
über die Parameter Skalierungs–Obergrenze bzw. Skalierungs–Untergrenze definiert.
Der Parameter Dezimalpunkt gibt die Anzahl der Nachkommastellen der Werte
(z.B. Sollwert) an.
Skalierungs–Obergrenze, Skalierungs–Untergrenze
Hinweis
Artverwandte Parameter
Parameter Einstellbereich Einheit
Skalierungs–Obergrenze
Skalierungs–Untergrenze
Skalierungs–Untergrenze +1...9999 EU 100
–1999...Skalierungs–Obergrenze –1 EU 0
Werkseitige
Einstellung
Dezimalkomma: Werkseitige Einstellung: 0
Parameter–
Wert
0
1
2
3
Einstellung Beispiel
0: keine Nachkommastelle
1: 1 Nachkommastelle
2: 2 Nachkommastellen
3: 3 Nachkommastellen
1234
123,4
12,34
1,234
Weitere Informationen siehe Kapitel 3 – 2. Einstellen der Eingangsspezifikationen
(Seite 18)
Eingangstyp (Setup–Betriebsart)
72
Page 81

Kapitel 5 – Parameter
Parameter initialisiert
Setzt die Parametereinstellungen auf die werkseitigen Einstellungen (Standardeinstellungen) zurück. Beachten Sie, daß die folgenden Parameter nicht zurückgesetzt werden:
Eingangstyp, Skalierungs–Obergrenze, Skalierungs–UNtergrenze, Dezimalkomma
und _C/_F Auswahl.
Wird dieser Parameter aufgerufen, wird im Display zuerst [ ] angezeigt. Über
die Taste kann [ ] ausgewählt werden.
_C/_F–Auswahl
Voraussetzungen: Definieren Sie den Eingang als Temperatureingang (Thermoelement oder Platin–Widerstandsthermometer).
Wählen Sie zwischen der Einstellung _C und _F aus.
Hinweis
Artverwandte Parameter
Einstellbereich
: _C / : _F
Werkseitige
Einstellung
Weitere Informationen siehe Kapitel 3 – 2. Einstellen der Eingangsspezifikationen
(Seite 18)
Eingangstyp (Setup–Betriebsart)
Zuweisung Regelausgang 1
Zuweisung Regelausgang 2
Über diese beiden Parameter erfolgt eine Zuweisung der Ausgangsfunktionen an
Regelausgang 1 oder Regelausgang 2.
Die folgenden sechs Ausgangsfunktionen können den Ausgängen zugewiesen
werden: Regelausgang (Heizen), Regelausgang (Kühlen), Alarm 1...3 und LBA.
Fehler 1 und 2 können nicht den Ausgängen zugewiesen werden.
Wenn eine Ausgangs funktion Regelausgang 1 zugewiesen wir d, leuchtet die LED
OUT1. Beachten Sie, daß die OUT1 LED nicht leuchtet, wenn Regelausgang (Heizen) oder Regelaus gang (Kühlen) den linearen Ausgängen (Str om und Spannung)
zugewiesen wird.
Hinweis
Wenn eine Ausgangs funktion Regelausgang 2 zugewiesen wir d, leuchtet die LED
OUT2.
Symbol
Funktion Regelausgang
(Heizen)
Regelausgang (Kühlen)
Alarm 1 Alarm 2 Alarm 3 LBA
Werkseitige Einstellungen:
Regelausgang 1 = [ ], Regelausgang 2 = [ ]
Weitere Informationen siehe Kapitel 3 – 3. Einstellen der Ausgangsspezifikationen
(Seite 19).
73
Page 82

Kapitel 5 – Parameter
Artverwandte Parameter
LBA Erkennungszeit (Betriebsart Ebene 2)
Zuweisung Hilfsausgang 1
Dem Hilfsausgang 1 können die folgenden sechs Ausgangsfunktionen zugewiesen
werden: :
Alarme 1 bis 3, LBA, Fehler 1 (Eingangsfehler) und Fehler 2 (A/D–Konvertierungsfehler).
Regelausgang (Heizen) und Regelausgang (Kühlen) können den Ausgängen nicht
zugewiesen werden.
Wenn eine Ausgabenfunktion, die Hilfsausgang 1 zugewiesen wird, aktiviert ist,
leuchtet die SUB1 LED.
Symbol
Funktion
Werkseitige Einstellungen: [ ]
Alarm 1 Alarm 2
Alarm 3 LBA Fehler 1 Fehler 2
Hinweis
Artverwandte Parameter
Weitere Informationen siehe Kapitel 3 – 3. Einstellen der Ausgangsspezifikationen
(Seite 19).
LBA Erkennungszeit (Betriebsart Ebene 2)
Alarmtyp 1
Alarmtyp 2
Alarmtyp 3
Voraussetzung: Die Alarme müssen den Ausgängen zugewiesen werden. Wird
bspw. Alarm 1 und 2 den Ausgängen 1 und 2 zugewiesen, kann Alarmtyp 3 nicht
verwendet werden.
Über die nachfolgend aufgeführten Einstellungen wird der Alarmbetrieb von Parameter Alarmtyp 1...3 spezifiziert. Weitere Informationen siehe Seite 22.
74
Page 83

Kapitel 5 – Parameter
Hinweis
Artverwandte Parameter
Parameter–
Werte
1
2
3
4
5
6
Einstellungen Parameter–
Oberer und unterer Grenzwert–
Alarm (Regelabweichung)
Oberer Grenzwert–Alarm
(Regelabweichung)
Unterer Grenzwert–Alarm
(Regelabweichung)
Oberer und unterer Grenzwert–Bereichsalarm (Regelabweichung)
Oberer und unterer Grenzwert–
Alarm mit Bereitschaft (Regelabweichung)
Oberer Grenzwert–Alarm mit Bereitschaft (Regelabweichung)
Werte
7 Unterer Grenzwert–Alarm mit Be-
8
9
10
11
Einstellungen
reitschaft (Regelabweichung)
Oberer Grenzwert–Alarm (Absolut-
wert)
Unterer Grenzwert–Alarm (Absolut-
wert)
Oberer Grenzwert–Alarm mit Ber-
eitschaft (Absolutwert)
Unterer Grenzwert–Alarm mit Ber-
eitschaft (Absolutwert)
Werkseitige Einstellung: Regelabweichung Obere Grenzewert
Weitere Informationen siehe Kapitel 3 – 4. Alarmtyp einstellen (Seite 22).
Alarmwert 1, Alarmwert 2, Alarmwert 3 (Betriebsart Ebene 1)
Alarmhysterese 1, Alarmhysterese 2, Alarmhysterese 3 (Betriebsart Ebene 2)
Alarm 1 (bei Alarm geöffnet), Alarm 2 (bei Alarm geöffnet), Alarm 3 (bei Alarm geöffnet), Zuweisung Regelausgang 1, Zuweisung Regelausgang 2 (Setup–Betriebsart)
Alarm 1 (bei Alarm geöffnet)
Alarm 2 (bei Alarm geöffnet)
Alarm 3 (bei Alarm geöffnet)
Voraussetzung: Die Alarme müssen den Ausgängen zugewiesen werden. Wird
bspw. Alarm 1 und 2 den Ausgängen 1 und 2 zugewiesen, kann Alarm 3 (bei
Alarm geöffnet) nicht verwendet werden.
Der Ausgangsstatus der Alarme 1...3 kann definiert werden.
Wird die Einstellung ”Geschlossen bei Alarm” gewählt, wird der Status der Alarm–
Ausgangsfunktion ausgegeben. Wird die Einstellung ”Geöffnet bei Alarm” gewählt,
wird der Status der Alarm–Ausgangsfunktion invertiert ausgegeben. In der nachfolgenden Tabelle ist die Beziehung zwischen Alarm–Ausgangsfunktion, Alarm, Ausgang und Ausgangs–LED dargestellt.
Alarm Ausgang Ausgangs–LED
Geschlossen bei Alarm
Geöffnet bei Alarm
EIN EIN Leuchtet
AUS AUS Leuchtet nicht
EIN AUS Leuchtet
AUS EIN Leuchtet nicht
75
Page 84

Kapitel 5 – Parameter
Hinweis
Artverwandte Parameter
Einstellbereich
: Geschlossen bei Alarm/ : Geöffnet
bei Alarm
Werkseitige
Einstellung
Weitere Informationen siehe Kapitel 3 – 4. Randbedingungen für den Alarmausgang einstellen (Seite 22).
Alarmwert 1, Alarmwert 2, Alarmwert 3 (Betriebsart Ebene 1)
Alarmhysterese 1, Alarmhysterese 2, Alarmhysterese 3 (Betriebsart Ebene 2)
Alarm 1 (bei Alarm geöffnet), Alarm 2 (bei Alarm geöffnet), Alarm 3 (bei Alarm geöffnet), Zuweisung Regelausgang 1, Zuweisung Regelausgang 2 (Setup–Betriebsart)
Direkt–/Reverse–Betrieb (Kühlen/Heizen)
Der Direkt–Betrieb oder normaler Betrieb bezieht sich auf die Istwert–Regelung,
bei der die Ausgangsstellgröße analog der Zunahme des Istwertes steigt. Beim
Reverse–Betrieb steigt dagegen die Ausgangsstellgröße bei der Abnahme des Istwertes an.
Einstellbereich
: Reverse–Betrieb/ Direkt–Betrieb
Werkseitige
Einstellung
Hinweis
Weitere Informationen siehe Kapitel 3 – 3. Einstellen der Ausgangsspezifikationen
(Seite 19).
76
Page 85

Kapitel 5 – Parameter
7. Betriebsart Erweiterte Funktion
Die Parameter in dieser Betriebsart können nur dann eingestellt werden, wenn der
Verriegelungs–Betriebsart die Werte 0 und1 zugewiesen werden.
Diese Betriebsart enthält die Parameter zur Einstellung der Erweiterten Funktionen
des E5CK. Über diese Parameter kann die Einstellungen für ST (Selbstoptimierung), Sollwert–Grenzwerte, erweiterte PID oder EIN/AUS–Regelung, Bereitschafts–Reset–Mehtode, Rücksetzen der Parameter und Automatische Rückkehr
zur Anzeige–Betriebsart definiert werden.
Um diese Betriebsart zu aktivieren bzw. in diese Betriebsart umzuschalten, drükken Sie für mindestens 1 Sekunde die Taste . Dies ist möglich, wenn Sie sich
in der Betriebart Ebene 0...2, in der Betriebsart Setup, Erweiterte Funktionen,
Kommunikation oder E/A–Kalibrierung befinden. Es wird dann das Menü angezeigt. Wählen Sie dann [ ] über die Tasten oder und drücken an-
schließend wird die Taste für mindenstens 1 Sekunde. Sie befinden sich dann
in der Betriebsart Erweiterte Funktionen.
Zur Auswahl der Parametern drücken Sie die Taste . Um Parametereinstellungen zu ändern, benutzen Sie die Tasten oder . Die zur Verfügung stehenden Parameter sind nachfolgend aufgeführt.
Symbol Parametername Seite
Oberer Grenzwert der Sollwerteinstelung 78
Unterer Grenzwert der Sollwerteinstelung 78
PID / EIN/AUS 78
ST (Selbstoptimierung) 79
Stabiler ST–Bereich (Selbstoptimierung) 79
α 79
AT b e r e c h n e t e Verstärkung 80
Bereitschafts–Reset–Methode 80
Automatische Rückkehr zur Anzeige–Betriebsart 81
AT–Hysterese 81
LBA Erkennungsbreite 81
77
Page 86

Kapitel 5 – Parameter
Oberer Grenzwert des Sollwertes
Unterer Grenzwert des Sollwertes
Über diese Parameter werden die oberen und unteren Grenzwerte des Sollwertes
festgeschrieben. Werden diese beiden Einstellungen während des Regelungsprozesses überschritten, regelt der E5CK die oberen und unteren Grenzwerte auf die
Parametereinstellungen zurück.
Wird der Eingangstyp auf die Einstellung Temperatureingang umgeschaltet, gelten
die Einstellungen der für diesen Sensor definierten oberen und unteren Grenzwerte. Wird der Eingangstyp auf Analogeingang umgeschaltet, gelten für die Sollwert–Ober/Untergenze die Skalierungseinstellungen der oberen und unteren
Grenzwerte.
Während des Temperatureingangs hängt die Dezimalkomma–Stellung vom ausgewählten Sensortyp ab und während des Analogeingangs von den Skalierungsergebnissen.
Hinweis
Artverwandte Parameter
Werkseitige Einstellung
Parameter Einstellbereich
Oberer Grenzwert des
Sollwertes
Unterer Grenzwert des
Sollwertes
Sollwert–Untergrenze +1...Skalierungs–Obergrenze EU 1300
Skalierungs–Untergrenze...Sollwert–Obergenze + 1 EU –200
Einheit
Während des Temperatureingangs wird der Bereich vom Sensortyp und nicht von
den oberen und unteren Grenzwerten bestimmt.
Weitere Informationen siehe Kapitel 4 – 2. Parameterlimitierungen (Seite 35).
Eingangstyp, Skalierung oberer Grenzwert, Skalierung unterer Grenzwert, Dezimalkomma (Setup–Betriebsart)
PID / EIN/AUS
Erweitere PID–Regelung oder EIN/AUS–Regelung.
Einstellbereich
: Erweiterte PID/ EIN/AUS
Werkseitige
Einstellung
Hinweis
Artverwandte Parameter
78
Weitere Informationen siehe Kapitel 4 – 1. Einstellen der Regelart (Seite 33).
Hysterese (Heizen), Hysterese (Kühlen), (Betriebsart Ebene 1)
Page 87

Kapitel 5 – Parameter
ST (Selbstoptimierung)
Stabiler ST–Bereich (Selbstoptimierung)
Voraussetzungen: Auf Temperatureingang umschalten und die Regelart einstellen
(Standard–Regelung oder erweiterte PID–Regelung).
Wird Parameter ST auf EIN gesetzt, wird die Selbstoptimierung aktiviert. Während
des Betriebes der ST–Funktion muß die Spannung, die auf der Lastseite mit dem
Regelungsausgang verbunden ist, zum gleichen Zeitpunkt oder vor dem Start des
E5CK eingeschaltet werden.
Über Parameter Stabiler ST–Bereich wird der stabile Bereich während der Selbstoptimierung festgelegt. Beachten Sie jedoch, daß dieser Parameter nur dann genutzt werden kann, wenn Parameter ST eingeschaltet bzw. aktiviert wurde.
Werksei-
Parameter Einstellbereich Einheit
ST
Stabiler ST–Be-
reich
0,1...999,9
: ST–Funktion AUS/ : ST–Funktion EIN
Keine
_C oder
_F
tige Einstellung
15,0
Artverwandte Parameter
Artverwandte Parameter
Eingangstyp (Setup–Betriebsart)
PID / EIN/AUS (Betriebsart Erweiterte Funktionen)
α
Voraussetzungen: Einstellen der erweiterten PID–Regelung und ST muß aktiviert
werden.
Einstellen des erweiterten PID–Regelungs–Parameters α.
Einstellbereich Einheit
0,00...1,00 Keine 0,65
PID / EIN/AUS (Erweiterte Funktionen)
Werkseitige
Einstellung
79
Page 88

Kapitel 5 – Parameter
AT Verstärkungs–Faktor
Voraussetzungen: Die Regelart ist erweiterte PID−Regelung und ST muß deakti
viert werden.
Über diesen Parameter wird der Verstärkungsfaktor für die PID–Konstante während des Auto–Tunings eingestellt. Soll innerhalb des Regelungsprozesses ”Response” die Priorität gegeben werden, muß der eingestellte Wert verringert
werden. Steht die Stabilität im Vordergrund, muß der eingestellte Wert vergrößert
werden.
Artverwandte Parameter
Artverwandte Parameter
Einstellbereich Einheit
0,1...10,0 Keine 1,0
Werkseitige
Einstellung
AT ausführen/abbrechen (Betriebsart Ebene 1)
PID– / EIN/AUS–Regelung (Betriebsart Erweiterte Funktionen)
Bereitschafts–Rücksetzmethode
Wählt die Bedingungen für einen möglichen Reset aus, nachdem die Alarmbereitschaft abgebrochen wurde.
Bedingung A: Regelstart (incl. Spannung EIN) und der Parameter Sollwert, Alarmwert oder Verschiebungswert ändert sich.
Bedingung B: Spannung EIN
Einstellbereich
0: Bedingung A / 1: Bedingung B 0
Alarmtyp 1, Alarmtyp 2, Alarmtyp 3 (Setup–Betriebsart)
Werkseitige
Einstellung
80
Page 89

Kapitel 5 – Parameter
Automatische Rückkehr zum Anzeigebetrieb
Wenn Sie mit keinem der Regelschlüssel für die Zeiteinstellung in diesem Parameter arbeiten (sie befinden sich in Betriebsart Ebene 0...2), wird auf der Anzeige automatische der Soll– und Istwert angezeigt.
Wenn dieser Parameter in “0” umgeschaltet wird, wird diese Funktion deaktiviert.
Dieser Parameter ist ungültig, während das Menü angezeigt wird.
Einstellbereich Einheit
0...99 Sekunde 0
Werkseitige
Einstellung
AT–Hysterese
Voraussetzungen: Die Regelart ist erweiterte PID−Regelung und ST muß deakti
viert werden.
Die Ebenen des Grenzzyklus–Betriebes während der AT–Ausführung werden als
Hysteresen bei Ereignisumschaltung EIN/AUS dargestellt. Dieser Parameter definiert die Hysteresenbreite.
Einstellbereich Einheit
0,1...9,9 % FS 0,2
Werkseitige
Einstellung
LBA–Erkennungsbreite
Voraussetzungen: Die LBA–(Regelkreis–Unterbrechungs–Alarm)–Funktion muß
einem Ausgang zugewiesen werden.
Ist die Änderung der Ausgangs–Stellgröße unterhalb des in diesem Parameter eingestellten Wertes, betrachtet der E5CK dies als eine Regelkreisunterbrechung.
Einstellbereich Einheit
0,0...999,9 % FS 0,2
Werkseitige
Einstellung
81
Page 90

Kapitel 5 – Parameter
8. Kommunikations–Betriebsart
Die Parameter in dieser Betriebsart können nur dann eingestellt werden, wenn der
Verriegelungs–Betriebsart die Werte 0 und1 zugewiesen werden.
Sie können diese Betriebsart nur dann aktivieren, wenn Sie die Kommunikations–
Baugruppe installiert haben. Sie können dann in dieser Betriebsart die Kommunikationsbedingungen, die Übertragungs– und Ereignisausgangs–Parameter
entsprechend der im E5CK installierten Kommunikations–Baugruppe abgleichen.
Um diese Betriebsart zu aktivieren bzw. in diese Betriebsart umzuschalten, drükken Sie für mindestens 1 Sekunde die Taste . Dies ist möglich, wenn Sie sich
in der Betriebart Ebene 0...2, in der Betriebsart Setup, Erweiterte Funktionen,
Kommunikation oder E/A–Kalibrierung befinden. Es wird dann das Menü angezeigt. Wählen Sie dann [ ] über die Tasten oder und drücken an-
schließend wird die Taste für mindenstens 1 Sekunde. Sie befinden sich dann
in der Betriebsart Erweiterte Funktionen.
Zur Auswahl der Parametern drücken Sie die Taste . Um Parametereinstellungen zu ändern, benutzen Sie die Tasten oder . Die zur Verfügung stehenden Parameter sind nachfolgend aufgeführt.
Symbol Parametername Seite
Multi–SP–Funktion (Mehrfach–Sollwert) 83
Zuweisung Ereigniseingang 1 83
Kommunikations–Stopbit 84
Kommunikations–Datenlänge 84
Kommunikationsparität 84
Kommunikations–Baudrate 84
Kommunikationsbaugruppen–Nr. 84
Übertragungsausgangs–Typ 85
Übertragungsausgangs–Obergrenze 85
Übertragungsausgangs–Untergrenze 85
82
Page 91

Kapitel 5 – Parameter
Multi–SP–Funktion (Mehrfach–Sollwert)
Voraussetzungen: Die Ereigniseingangs–Funktion muß aktiviert werden.
Dieser Parameter gibt die Anzahl von der Sollwerte (SP) an, wenn die Multi–SP–
Funktion verwendet wird. Wenn Sie diesem Parameter den Wert 0 zuweisen, kann
die Multi–SP–Funktion nicht verwendet werden.
Hinweis
Artverwandte Parameter
Kommunikations–Baugruppe
Einstellbereich Einheit
0...1 Kein 0
Werkseitige
Einstellung
Weitere Informationen siehe Kapitel 4 – 3. Optionale Funktionen einsetzen
(Seite 38).
Zuweisung Ereigniseingang 1 (Kommunikations–Betriebsart)
Ereigniseingangs–Baugruppe E53–CKB
Zuweisung Ereigniseingangs 1
Voraussetzungen: Der Ereigniseingang muß während des Betriebes der Ereigniseingangsfunktion spezifiziert werden.
Über diesen Parameter wird der Ereigniseingang ohne Multi–SP–Funktion spezifiziert. Die folgenden beiden Funktionen können eingestellt werden:
– RUN / Stop
– Auto / Manuell
Hinweis
Artverwandte Parameter
Kommunikations–Baugruppe
Während das Menü angezeigt wird, ist der Ereigniseingang deaktiviert. Er ist ebenfalls in den Betriebsarten Erweiterte Funktionen, Kommunikation und Kalibrierung
deaktiviert.
Symbol Funktion Ereigniseingangs–Betrieb
RUN / Stop EIN: Stop AUS: RUN
Auto / Manuell EIN: Manuell AUS: Auto
Weitere Informationen siehe Kapitel 4 – 3. Optionale Funktionen einsetzen
(Seite 38).
Zuweisung Ereigniseingang 1 (Kommunikations–Betriebsart)
Ereigniseingangs–Baugruppe E53–CKB
83
Page 92

Kapitel 5 – Parameter
Der Kommunikations–Stopbit
Kommunikations–Datenlänge
Kommunikations–Parität
Kommunikations–Baudrate
Kommunikations–Baugruppen–Nr.
Voraussetzung: Die Kommunikationsfunktion muß aktiviert werden.
Über diese Parameter werden die Kommunikationsbedingungen eingestellt. Achten
Sie darauf, daß das Stopbit, die Datenlänge, die Parität und die Baudrate des Host
mit den Einstellungen des E5CK übereinstimmen. Diese Einstellungen werden aktiviert, wenn der E5CK wieder eingeschaltet oder die Betriebsart Ebene 0...2 umgeschaltet wird.
Werden zwei oder mehr E5CK an einen Host angeschlossen, müssen den einzelnen E5CK Baugruppennummern zugewiesen werden. Achten Sie darauf, daß es
zu keinen Überschneidungen kommt.
Kommunikations–Stopbit
Einstellbereich Einheit
1, 2 Bits 2
Werkseitige
Einstellung
Kommunikations–Datenlänge
Einstellbereich Einheit
7, 8 Bits 7
Werkseitige
Einstellung
Kommunikations–Parität
Einstellung
keine Gerade Ungerade
Werkseitige
Einstellung
Kommunikations–Baudrate
Einstellbereich Einheit
1,2, 2,4, 4,8, 9,6, 19,2 kBaud 9,6
Werkseitige
Einstellung
Hinweis
Artverwandte Parameter
84
Kommunikations–Baugruppen–Nr.
”Einstellbereich” Einheit
0...99 Keine 0
Werkseitige
Einstellung
Weitere Informationen siehe Kapitel 4 – 3. Optionale Funktionen einsetzen
(Seite 38).
Dezentral / lokal (Betriebsart Ebene 2)
Page 93

Kapitel 5 – Parameter
Kommunikations–Baugruppe
RS–232C–Baugruppe: E53–CK01)
RS–485–Baugruppe: E53–CK03
Übertragungsausgangs–Typ
Übertragungsausgangs–Obergrenze
Übertragungsausgangs–Untergrenze
Voraussetzung: Die Übertragungsausgangsfunktion muß aktiviert werden.
Über diese Parameter werden die Übertragungsausgangs–Bedingungen definiert.
Über Parameter Übertragungsausgangs–Typ erfolgt eine Selektion und Zuweisung
einer Funktion zu dem Übertragungsausgang: Sollwert, Sollwert während SP
Rampe, Istwert, Ausgangsstellwert (Heizen) und Ausgangsstellwert (Kühlen).
Beachten Sie, daß der Ausgangsstellwert (Kühlen) nur während der Heiz– und
Kühlregelung auswählt werden kann.
Die Paramerter Übertragungsausgangs–Obergrenze und Übertragungsausgangs–
Untergrenze werden für die Skalierung der Übertragungsausgänge eingesetzt. Der
eingestellte Bereich wird durch die Ausgangsdaten festgelegt. Es ist auch möglich,
einen unteren Grenzwert zu definieren, dessen Wert größer ist als der Wert für den
oberen Grenzwert.
Während des Temperatureingangs hängt die Dezimalkommaposition des Sollwertes, des Sollwert während der SP Rampe oder des Istwertes vom zur Zeit ausgewählten Sensortyps und während des Analogeingangs von den Skalierungs–
ergebnissen ab.
Übertragungs–Typ
Sollwert Unterer Sollgrenzwert...Oberer Sollgrenzwert
Sollwert während SP Rampe Unterer Sollgrenzwert...Oberer Sollgrenzwert
Istwert
Ausgangs–Stellwert Heizen
Ausgangs–Stellwert Kühlen
Übertragungsausgangs–Untergrenze ...
Übertragungsausgangs–Obergrenze
Skalierungsuntergrenze...Skalierungsobergrenze
–5,0...105,0 %
0,0...105,0 %
Die Ausgangsbereiche des Sollwertes, des Sollwertes während der SP Rampe
oder des Istwertes, wenn der Temperatureingang ausgewählt wurde, sind die Bereiche, die von dem ausgewählten Sensortyp unterstützt werden.
Wenn Sie Parameter Ausgangs–Stellwert (Heizen) ausgewählt haben, wird die
Übertragungsausgangsuntergrenze während der Heiz– und Kühlregelung auf
0, 0 gesetzt.
Hinweis
Kommunikations–Baugruppe
Weitere Informationen siehe Kapitel 4 – 3. Optionale Funktionen einsetzen
(Seite 38).
Übertragungs–Ausgangs–Baugruppe E53–CKF
85
Page 94

Kapitel 5 – Parameter
9. Kalibrierungs–Betriebsart
Die Parameter in dieser Betriebsart können nur dann eingestellt werden, wenn der
Verriegelungs–Betriebsart der Werte 0 zugewiesen wird. Wenn diese Betriebsart
zum ersten Mal eingesetzt wird, weisen Sie dieser Betriebsart den Wert 0 zu.
Diese Betriebsart erlaubt die Kalibrierung der Ein– und Ausgänge. Nur die Parameter, die sich auf die Eingangseinstellungen der Setup–Betriebsart beziehen,
können eingesetzt werden. Die entsprechenden Ausgangsparameter können eingestellt werden, wenn die Kommunikationsbaugruppe E53–CKF installiert wurde.
Um diese Betriebsart zu aktivieren bzw. in diese Betriebsart umzuschalten, drükken Sie für mindestens 1 Sekunde die Taste . Dies ist möglich, wenn Sie sich
in der Betriebart Ebene 0...2, in der Betriebsart Setup, Erweiterte Funktionen oder
Kommunikation befinden. Es wird dann das Menü angezeigt. Wählen Sie dann
[ ] über die Tasten oder und drücken anschließend wird die Taste
für mindenstens 1 Sekunde. Sie befinden sich dann in der Betriebsart E/A–
Kalibrierung.
Weitere Informationen zu den Parametern der E/A–Kalibreirungs–Betriebsart siehe
Kapitel 4 – 5. E/A–Kalibierung (Seite 42).
86
Page 95

Kapitel 6 – Die Kommunikationsfunktion
Dieses Kapitel beschreibt die Kommunikationsfunktion, die den Datentransfer zwischen einem Host und dem E5CK regelt.
1. Beschreibung der Kommunikationsfunktion
Beschreibung
Die Kommunikationsfunktion ermöglicht die Überwachung und Einstellung der
E5CK–Parameter. Der Host ist mit dem E5CK Temperaturregler verbunden.
Voraussetzung dafür ist die Installation einer der Kommunikationsbaugruppen
E53–CK01 oder E53–CK03, die die Kommunikationsfunktion für die Schnittstellen
RS–232C und RS–485 unterstützten. Folgende Funktionen werden angeboten:
– Lesen und Speichern der Parameter;
– Betriebsbefehle;
– Einstellen der Betriebsartebenen.
Die Kommunikationsfunktion setzt die folgenden Bedingungen voraus:
– Das Speichern der Parameter ist während des dezentralen Betriebes möglich,
jedoch nicht während des Auto–Tunings.
– Das Speichern der Parameter wird von den Einstellebenen unterstützt. Die
Speicherbedingungen sind von den Einstellebenen abhängig:
Einstellebene 1: Keine Einschränkungen
Einstellebene 0: Das Speichern der Parameter ist in der Setup– und Erweiterungsbetriebsart nicht möglich.
– Weitere Informationen über das Umschalten zwischen den Einstellebenen siehe
Seite 6–9.
– Die Parameter ”Run/Stop”, ”Dezentral/lokal” und “AT ausführen/abbrechen”
werden als übergeordnete Befehle behandelt.
Übertragungsverfahren
Schnittstelle
Der Host schickt einen “Befehlsrahmen” zum E5CK und der E5CK sendet einen
“Antwortrahmen” entsprechend dem Inhalt des Befehls zurück, der vom Host gesendet wird. Mit anderen Worten wird ein Antwortsrahmen für jeden gesendeten
Befehlsrahmen zurückgesendet.
Das folgende Diagramm stellt den Befehls–/Antwort–Rahmenbetrieb dar.
Befehlsrahmen Befehlsrahmen
Host
E5CK
Antwortrahmen
Abb. 65: Übertragungsverfahren zwischen E5CK und Host
Für die Kommunikation zwischen dem Host und dem E5CK über die Schnittstellen
RS–232C/RS–485 benötigen Sie die folgenden Kommunikationsbaugruppen:
– E53–CK01 (RS–232C)
– E53–CK03 (RS–485)
87
Page 96

Kapitel 6 – Die Kommunikationsfunktion
2. Kommunikationsvorbereitungen
Weitere Informationen über die erforderliche Verdrahtung siehe Kapitel 2.
Schnittstellenbelegung
RS–232C
RS–485
– Nur ein E5CK kann an den Host angeschlossen werden.
– Die Kabellänge sollte15 Meter nicht überschreiten.
– Benutzen Sie eine abgeschirmte 2–Drahtleitung.
E5CK
RS–232C
Nr.
13 SD
RD
14
SG
1
25–polig
(SD) TXD
(RD) RXD
(RS) RTS
(CS) CTS
(DR) DSR
(SG) COMMON
(ER) DTR
2
3
4
5
6
7
20
1FG
Abb. 66: PIN–Belegung RS–232C
E5CK
RS–232C
Nr.
13 SD
RD
14
SG
1
(RD) RXD
(SD) TXD
(ER) DTR
(SG) COMMON
(DR) DSR
(RS) RTS
(CS) CTS
9–polig
2
3
4
5
6
7
8
1FG
– Bis zu 32 Temperaturregler E5CK, einschließlich eines Computers, können an
den Host angeschlossen werden.
– Die Gesamtkabellänge sollte 500 m nicht überschreiten.
– Benutzen Sie eine abgeschirmte 2–Drahtleitung.
– Installieren Sie den Abschlußwiderstand entsprechend der nachfolgenden Ab-
bildung.
– Benutzen Sie einen Abschlußwiderstand mit einer Impedanz von 120 Ω (0,5
W). Der Gesamtwiderstand sollte mindestens 54 Ω betragen.
Host
RS–485
–
+
FG
Abgeschirmtes Kabel
A< B: Kennzeichen
A > B: Zwischenraum
Abb. 67: PIN–Belegung RS–485
E5CK (Nr. 0)
RS–485
Nr.
13
A
B
14
E5CK (Nr.30)
RS–485
Nr.
A
13
B
14
Abschlußwiderstand (120 Ω / 0,5 W)
88
Page 97

Kapitel 6 – Die Kommunikationsfunktion
Einstellen der Kommunikationsparameter
Kommunikationparameter
Passen Sie die Einstellung der Kommunkiationsparameter des Hosts an den E5CK
an. Werden mehr als zwei E5CK an den Host angeschlossen, müssen die Einstellungen der Kommunikationsparameter auf allen E5CK gleich sein. Diese Einstellungen sind nachfolgend beschrieben. Weitere Information über die
Hostspezifikation entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Technischen Handbuch.
Die Einstellung der Kommunikationsparameter erfolgt über die Front des E5CK.
Folgende Einstellungen können vorgenommen werden:
Parameter/Symbol
Baugruppen–Nr. 0...99 0 ...99
Baudrate
(in kBaud)
Bitlänge (in Bit) 7 / 8
Parität Keine / gerade / ungerade
Haltbit 1/2
Abb. 68: Parameter–Einstellungen (Werkseinstellungen sind invers dargestellt)
1,2 / 2,4 /4,8 / 9,6 / 19,2
Bereich Sollwert
9,61,2 / 2,4/ 4,8 / 19,2
7 /8
/ /
1 / 2
89
Page 98

Kapitel 6 – Die Kommunikationsfunktion
3. Befehlskonfiguration
Die Befehlskonfiguration ist nachfolgend dargestellt und besteht aus Befehl und
Antwort.
Befehl
2b 1b 2b 4b 2b 2b
Baugrup-
pen–Nr.
@
Antwort
2b 1b 2b 4b 2b 2b2b
Baugrup-
pen–Nr.
@
“@”
Das Startzeichen. Dieses Zeichen muß vor dem führenden Byte eingefügt werden.
Befehls–
Code
Befehlstyp
Befehls–
Code
Befehlstyp
Endcode
Daten
Daten
FCS
*
FCS
CR
CR
*
Baugruppen–Nr.
Gibt die Baugruppennummer des E5CK an. Gibt es zwei oder mehr Übertragungsziele, muß das gewünschte Ziel über die Baugruppen–Nr. spezifiziert werden.
Befehlstyp
Definiert den Befehlstyp über die Codes 1...3: Parameter lesen, Parameter speichern und besondere Befehle.
Befehlscode
Definiert für jeden Befehl den Befehlstyp. Beim Befehl Parameter lesen /
Parameter speichern muß die Parameternummer angegeben werden.
Daten
Definiert den Sollwert oder die Einstellung. Der Befehl Parameter lesen erhält die
fiktiven Daten 0000. In der Antwort wird dies eingefügt, nur wenn der Endcode 00
ist.
Endcode
Beinhaltet die Kommunikationsergebnisse. Weitere Informationen über den Endcode siehe Kapitel 6 – 5. Lesen der Kommunikationsfehlerinformation.
FCS (Rahmenprüfsumme)
Überträgt die Rahmenprüfsummenergebnisse vom Startzeichen in den Datenbereich. Weitere Informationen über die Rahmenprüfung siehe Kapitel 6 – 6. Programmbeispiel.
”*” CR
Zeigt das Ende des Befehls– und Antwortblocks an.
90
Page 99

Kapitel 6 – Die Kommunikationsfunktion
4. Befehle und Antworten
Nachfolgend ist die Struktur der Befehle und Antworten dargestellt. Diese Befehle
unterliegen den folgenden Bedingungen:
– Die Daten in 1 Byte–Einheiten oder im ASCII–Code dargestellt.
– Das Lesen und Speichern numerischer Werte unterliegt wiederum den folgen-
den Bedingungen:
1. Der Dezimalpunkt wird nicht angezeigt.
Beispiel: 10,0 = [0100]
2. Das äußerst linke Bit bei negativen numerischen Daten wird wie folgt aus–
gedrückt.
Beispiel: -150,0 = [A500]; -15 = [F015]
Parameter lesen / speichern
Parameter lesen
2b 2b 4b 2b 2b
Befehl
@
Baugruppen–Nr.
1
Parameter–Nr.
XXXX
FCS
*
X: Jeder Wert akzeptiert
CR
Antwort
Parameter speichern
Befehl
Antwort
2b 2b 4b 2b 2b2b
Baugruppen–Nr.
@
2b 2b 4b 2b 2b
Baugruppen–Nr.
@
2b 2b 4b 2b 2b2b
Baugruppen–Nr.
@
1
2
2
Parameter–Nr.
Parameter–Nr.
Parameter–Nr.
Endcode
Daten speichern
Endcode
Daten lesen FCS
FCS
Daten speichern
*
FCS
CR
CR
*
CR
*
Das Lesen oder Speichern der Parameter erfolgt in dem spezifizierten E5CK.
– Das Lesen ist nur während des dezentralen Betriebes möglich.
– Das Speichern ist während Auto–Tuning–Betriebes nicht möglich.
– Bei den nachfolgend aufgeführten Befehlen handelt es sich um Spezialbefehle.
Weitere Informationen auf Seite 94.
Run / Stop; Dezentral / Lokal; AT ausführen / abbrechen
– Weiter Information über die Parametereinstellung sind auf den nachfolgenden
Seiten dargestellt.
Hinweis
Über die Befehle MA und ME des X–Formates kann der Sollwert entweder in den
nichtflüchtigen RAM–Speicher oder den RAM–Speicher geschrieben werden. Der
nichtflüchtige RAM–Speicher erlaubt maximal 100.000 Speichervorgänge. Wird
diese Zahl überschritten, nehmen Sie die Zuweisung RAM–Speicher vor.
91
Page 100

Kapitel 6 – Die Kommunikationsfunktion
Parameter–Nr. Parameter Dateneinstellung und Überwachungsbereich Betriebsart
00 Istwert–Überwachung
86 Istwert während SP–Rampe
04 MV–Überwachung (Heizen)
42 MV–Überwachung (Kühlen)
01 Sollwert Sollwert–Untergrenze bis Sollwert–Obergrenze
02 Alarmwert 1 –1999...9999
03 Alarmwert 2 –1999...9999
41 Alarmwert 3 –1999...9999
19 Proportionalband (P) 0,1...999,9
20 Vorhaltezeit (I) 0...3999
21 Nachhaltezeit (D) 0...3999
22 Kühlkoeffizient 0,01...99,99 Ebene 1
09 Totband –19,99...99,99
23 Manueller RESET–Wert 0,0...100,0
06 Hysterese (Heizen) 0,01....99,99
43 Hysterese (Kühlen) 0,01...99,99
07 Zykluszeit (Heizen) 1...99
08 Zykluszeit (Kühlen) 1...99
44 SP–Rampen–Zeiteinheit 0: Minuten; 1: Stunden
45 SP–Rampen–Sollwert 0...9999
46 LBA Erkennungszeit 0...9999
47 Stellgröße bei Stop –5,0...105,0
48 Stellgröße bei Istwertfehler –5,0...105,0
50 Stellgröße Obergrenze Die MV untere Grenze +0,1 bis 105,0
49 Stellgröße Untergrenze – 5,0 bis MV–Obergrenze – 0,1
51 Stellgröße Änderungsbegren-
zung
56 Digitaler Eingangsfilter 0...9999
25 Alarmhysterese 1 0,01...99,99
26 Alarmhysterese 2 0,01...99,99
52 Alarmhysterese 3 0,01...99,99
53 Verschiebung oberer Eingangs-
grenzwert
54 Verschiebung unterer Ein-
gangsgrenzwert
*1
Skalierungs–Untergrenze –10% bis Skalierungs–Obergrenze
+10%
*1
*1
*1
Sollwert–Untergrenze bis Sollwert–Obergrenze
–5,0...105,0
0,0...105,0
0,0...100,0
–999,9...999,9
–999,9...999,9
*2
*3
*4
*4
*5
Ebene 0
Ebene 2
Hinweis
92
*1: Nur beim Lesen möglich.
*2: Der Bereich des Temperatureingangs wird durch den eingesetzten Sensor
bestimmt.
*3: Während Heiz– und Kühlregelung im Bereich von 0,0...105, 0.
*4: Während Heiz– und Kühlregelung im Bereich von –105,0...105,0.
*5: Während Heiz– und Kühlregelung im Bereich von –105,0 bis zur
MV–Obergrenze von –0,1.
Ein nicht definierter Fehler (End–Code: 1C) wird erzeugt, wenn Befehle für nicht
gültige Parameter benutzt werden.
 Loading...
Loading...