Page 1

Oszilloskop
HM303-6
Handbuch
Deutsch
Page 2
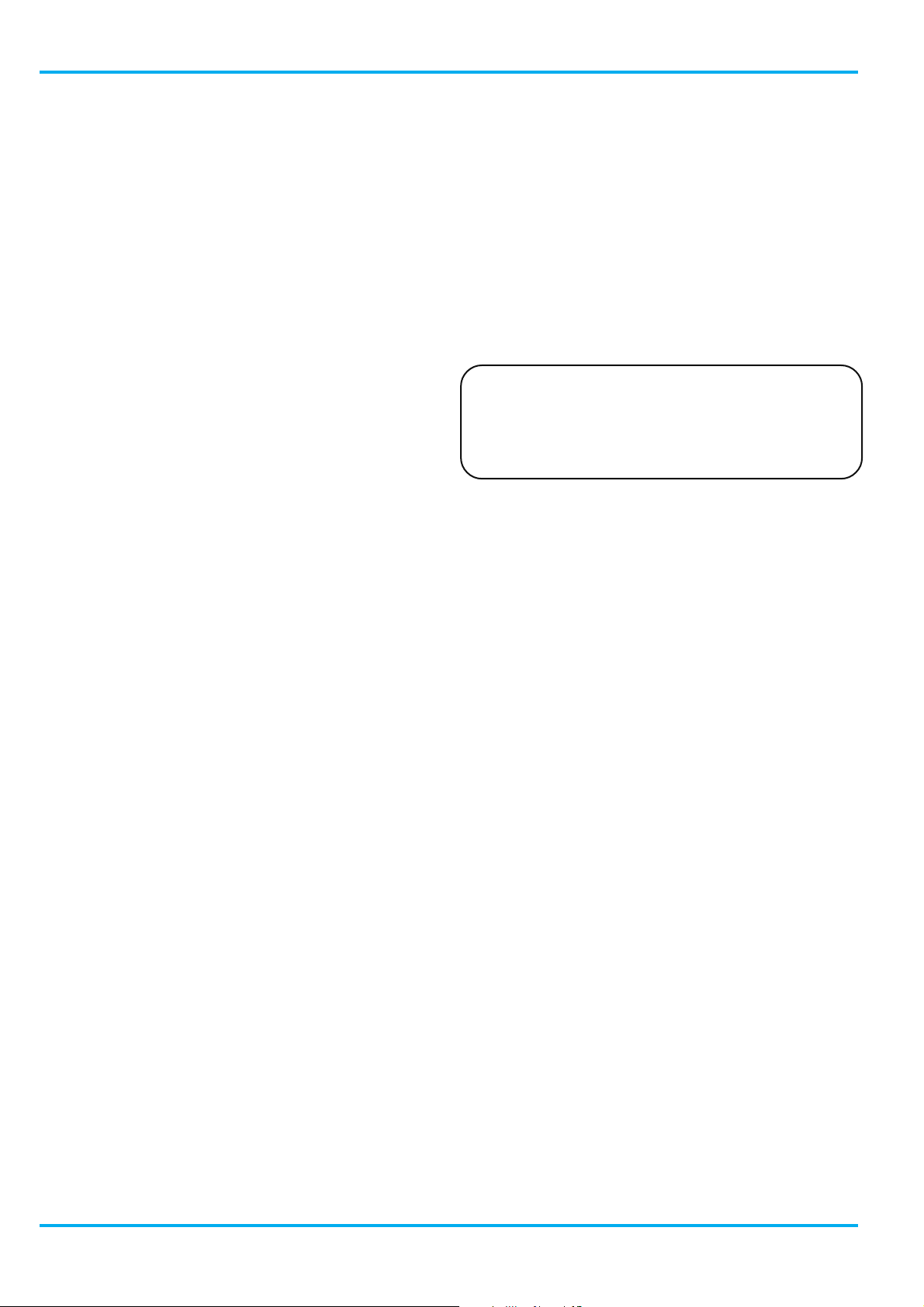
g
g
Inhaltsverzeichnis
Oszilloskop
HM 303-6
CE-Konformität ...................................................................4
Technische Daten ............................................................... 5
Allgemeines .........................................................................6
Aufstellung des Gerätes ................................................6
Sicherheit ........................................................................ 6
Bestimmungsgemäßer Betrieb .....................................6
Gewährleistung und Reparatur.......................................7
Wartung ..........................................................................7
Schutzschaltung ..............................................................7
Netzspannung ................................................................ 7
Art der Signalspannung..................................................... 8
Größe der Signalspannung ............................................. 8
Spannungswerte an einer Sinuskurve ............................ 8
Gesamtwert der Eingangsspannung .............................. 9
Zeitwerte der Signalspannung ........................................ 9
Anlegen der Signalspannung ........................................10
Bedienelemente ................................................................11
Inbetriebnahme und Voreinstellungen .......................... 12
Strahldrehung TR .......................................................... 12
Tastkopf-Abgleich und Anwendung .............................. 12
Ab
leich 1kHz ............................................................... 13
3
Betriebsarten der Vertikalverstärker............................. 13
XY-Betrieb...................................................................... 14
Phasenvergleich mit Lissajous-Figur ........................... 14
Phasendifferenz-Messung
im Zweikanal-Betrieb .................................................... 14
Phasendifferenzmessung im Zweikanalbetrieb ........... 15
Messung einer Amplitudenmodulation ........................ 15
Triggerung und Zeitablenkung ....................................... 15
Automatische Spitzenwert-Triggerung .........................16
Normaltriggerung ..........................................................16
Flankenrichtung............................................................. 16
Triggerkopplung............................................................. 16
TV (Videosignal-Triggerung) .......................................... 16
Bildsynchronimpuls-Triggerung.....................................17
Zeilensynchronimpuls-Triggerung ................................. 17
Netztriggerung .............................................................. 17
Alternierende Triggerung .............................................. 17
Externe Triggerung ........................................................ 18
Triggeranzeige ...............................................................18
Holdoff-Zeiteinstellung.................................................. 18
Komponenten-Test ........................................................18
Kurzanleitung HM303-6 .................................................. 21
Bedienun
selemente HM303-6
2
Änderungen vorbehalten
Page 3
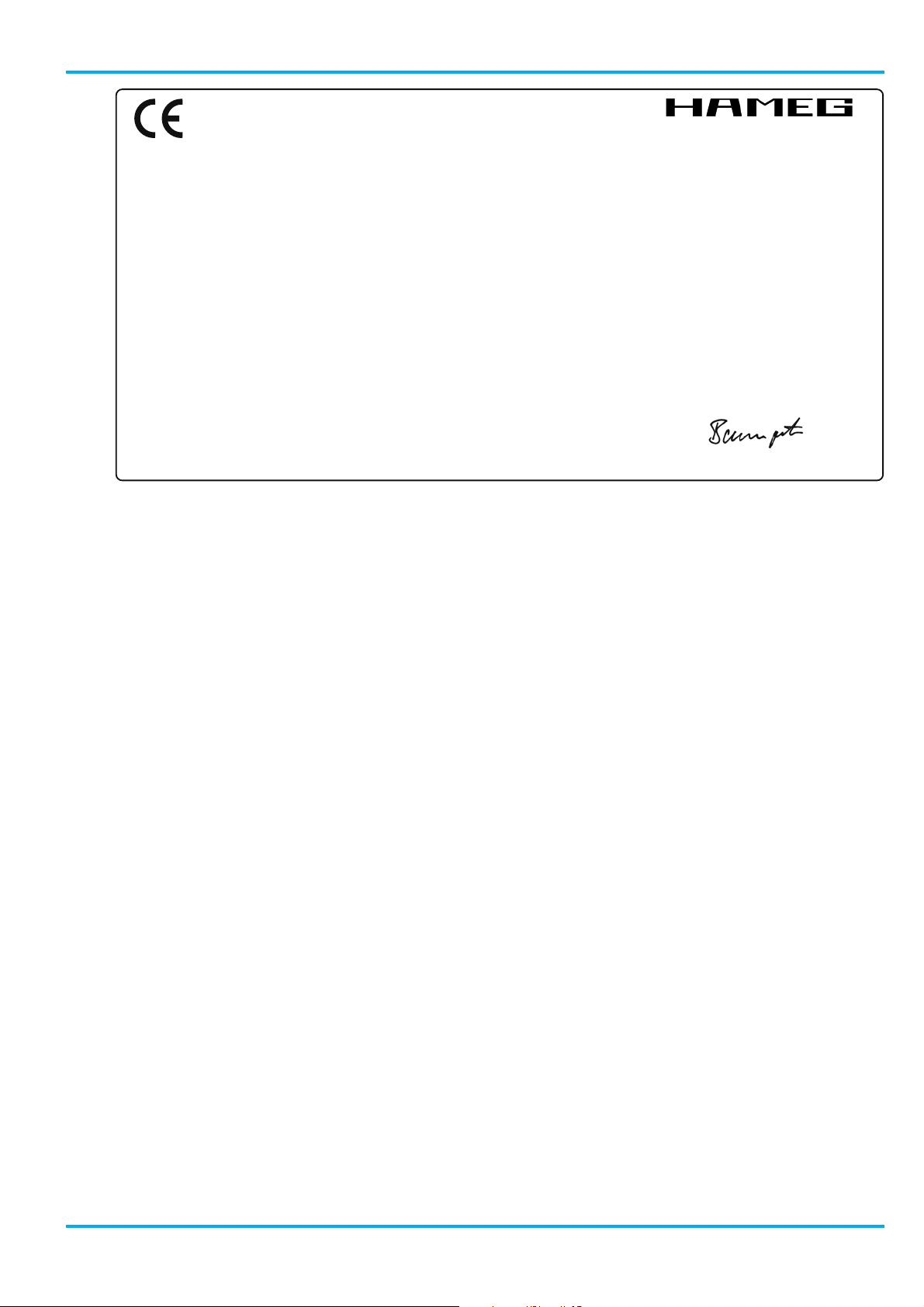
Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE
Herstellers HAMEG Instruments GmbH
Manufacturer Industriestraße 6
Fabricant D - 63533 Mainausen
Bezeichnung / Product name / Designation:
Oszilloskop/Oscilloscope/Oscilloscope
Ty p / Ty p e / Typ e : HM303-6
mit / with / avec: -
Optionen / Options / Options: -
mit den folgenden Bestimmungen / with applicable regulations / avec les
directives suivantes
EMV Richtlinie 89/336/EWG ergänzt durch 91/263/EWG, 92/31/EWG
EMC Directive 89/336/EEC amended by 91/263/EWG, 92/31/EEC
Directive EMC 89/336/CEE amendée par 91/263/EWG, 92/31/CEE
Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG ergänzt durch 93/68/EWG
Low-Voltage Equipment Directive 73/23/EEC amended by 93/68/EEC
Directive des equipements basse tension 73/23/CEE amendée par 93/68/CEE
Instruments
Angewendete harmonisierte Normen / Harmonized standards applied / Normes
harmonisées utilisées
Sicherheit / Safety / Sécurité
EN 61010-1: 1993 / IEC (CEI) 1010-1: 1990 A 1: 1992 / VDE 0411: 1994
EN 61010-1/A2: 1995 / IEC 1010-1/A2: 1995 / VDE 0411 Teil 1/A1: 1996-05
Überspannungskategorie / Overvoltage category / Catégorie de surtension: II
Verschmutzungsgrad / Degree of pollution / Degré de pollution: 2
Elektromagnetische Verträglichkeit / Electromagnetic compatibility
Compatibilité électromagnétique
EN 61326-1/A1
Störaussendung / Radiation / Emission: Tabelle / table / tableau 4, Klasse / Class /
Classe B.
Störfestigkeit / Immunity / Imunitee: Tabelle / table / tableau A1.
EN 61000-3-2/A14
Oberschwingungsströme / Harmonic current emissions / Émissions de courant
harmonique:
Klasse / Class / Classe D.
EN 61000-3-3
Spannungsschwankungen u. Flicker / Voltage fluctuations and flicker / Fluctuations
de tension et du flicker.
Datum /Date /Date Unterschrift / Signature /Signatur
15.01.2001
E. Baumgartner
Technical Manager/Directeur Technique
®
Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung
HAMEG Meßgeräte erfüllen die Bestimmungen der EMV Richtlinie. Bei der Konformitätsprüfung werden von HAMEG die gültigen Fachgrundbzw. Produktnormen zu Grunde gelegt. In Fällen wo unterschiedliche Grenzwerte möglich sind, werden von HAMEG die härteren
Prüfbedingungen angewendet. Für die Störaussendung werden die Grenzwerte für den Geschäfts- und Gewerbebereich sowie für
Kleinbetriebe angewandt (Klasse 1B). Bezüglich der Störfestigkeit finden die für den Industriebereich geltenden Grenzwerte Anwendung.
Die am Meßgerät notwendigerweise angeschlossenen Meß- und Datenleitungen beeinflußen die Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte
in erheblicher Weise. Die verwendeten Leitungen sind jedoch je nach Anwendungsbereich unterschiedlich. Im praktischen Meßbetrieb sind
daher in Bezug auf Störaussendung bzw. Störfestigkeit folgende Hinweise und Randbedingungen unbedingt zu beachten:
1. Datenleitungen
Die Verbindung von Meßgeräten bzw. ihren Schnittstellen mit externen Geräten (Druckern, Rechnern, etc.) darf nur mit ausreichend
abgeschirmten Leitungen erfolgen. Sofern die Bedienungsanleitung nicht eine geringere maximale Leitungslänge vorschreibt, dürfen
Datenleitungen (Eingang/Ausgang, Signal/Steuerung) eine Länge von 3 Metern nicht erreichen und sich nicht außerhalb von Gebäuden
befinden. Ist an einem Geräteinterface der Anschluß mehrerer Schnittstellenkabel möglich, so darf jeweils nur eines angeschlossen sein.
Bei Datenleitungen ist generell auf doppelt abgeschirmtes Verbindungskabel zu achten. Als IEEE-Bus Kabel sind die von HAMEG beziehbaren
doppelt geschirmten Kabel HZ72S bzw. HZ72L geeignet.
2. Signalleitungen
Meßleitungen zur Signalübertragung zwischen Meßstelle und Meßgerät sollten generell so kurz wie möglich gehalten werden. Falls keine
geringere Länge vorgeschrieben ist, dürfen Signalleitungen (Eingang/Ausgang, Signal/Steuerung) eine Länge von 3 Metern nicht erreichen
und sich nicht außerhalb von Gebäuden befinden.
Alle Signalleitungen sind grundsätzlich als abgeschirmte Leitungen (Koaxialkabel - RG58/U) zu verwenden. Für eine korrekte Masseverbindung
muß Sorge getragen werden. Bei Signalgeneratoren müssen doppelt abgeschirmte Koaxialkabel (RG223/U, RG214/U) verwendet werden.
3. Auswirkungen auf die Meßgeräte
Beim Vorliegen starker hochfrequenter elektrischer oder magnetischer Felder kann es trotz sorgfältigen Meßaufbaues über die
angeschlossenen Meßkabel zu Einspeisung unerwünschter Signalteile in das Meßgerät kommen. Dies führt bei HAMEG Meßgeräten nicht
zu einer Zerstörung oder Außerbetriebsetzung des Meßgerätes.
Geringfügige Abweichungen des Meßwertes über die vorgegebenen Spezifikationen hinaus können durch die äußeren Umstände in
Einzelfällen jedoch auftreten.
4. Störfestigkeit von Oszilloskopen
4.1 Elektromagnetisches HF-Feld
Beim Vorliegen starker hochfrequenter elektrischer oder magnetischer Felder, können durch diese Felder bedingte Überlagerungen des
Meßsignals sichtbar werden. Die Einkopplung dieser Felder kann über das Versorgungsnetz, Meß- und Steuerleitungen und/oder durch
direkte Einstrahlung erfolgen. Sowohl das Meßobjekt, als auch das Oszilloskop können hiervon betroffen sein.
Die direkte Einstrahlung in das Oszilloskop kann, trotz der Abschirmung durch das Metallgehäuse, durch die Bildschirmöffnung erfolgen.
Da die Bandbreite jeder Meßverstärkerstufe größer als die Gesamtbandbreite des Oszilloskops ist, können Überlagerungen sichtbar
werden, deren Frequenz wesentlich höher als die –3 dB Meßbandbreite ist.
4.2 Schnelle Transienten / Entladung statischer Elektrizität
Beim Auftreten von schnellen Transienten (Burst) und ihrer direkten Einkopplung über das Versorgungsnetz bzw. indirekt (kapazitiv) über
Meß- und Steuerleitungen, ist es möglich, daß dadurch die Triggerung ausgelöst wird.
Das Auslösen der Triggerung kann auch durch eine direkte bzw. indirekte statische Entladung (ESD) erfolgen.
Da die Signaldarstellung und Triggerung durch das Oszilloskop auch mit geringen Signalamplituden (<500µV) erfolgen soll, läßt sich das
Auslösen der Triggerung durch derartige Signale (> 1kV) und ihre gleichzeitige Darstellung nicht vermeiden.
Änderungen vorbehalten
HAMEG Instruments GmbH
3
Page 4
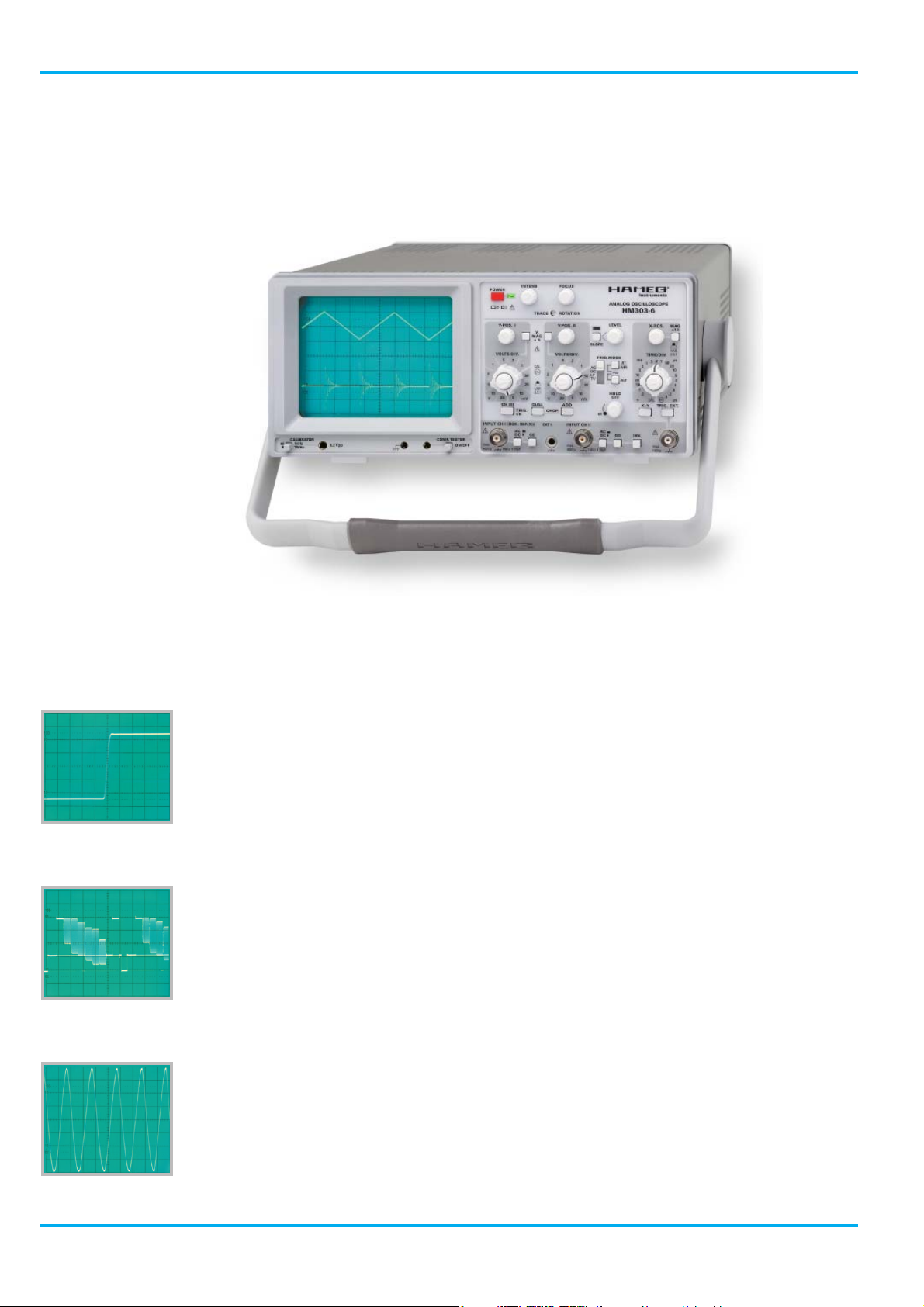
HM303-6
35 MHz Analog-Oszilloskop
HM303-6
Höchste Signalwiedergabequalität mit minimalem
Überschwingen
2 Kanäle mit Ablenkkoeffizienten 1 mV - 20 V/cm,
niedriges Rauschen
Zeitbasis 0,2 s – 100 ns/cm, mit X-Dehnung bis 10 ns/cm
Triggerung 0 bis 50MHz ab 5 mm Signalhöhe
(100 MHz › 8 mm)
Analogbetrieb bietet unübertroffene Signaldarstellung mit
hoher Auflösung und bis zu 500.000 Signaldarstellungen/sek
Yt-, XY- und Komponententest-Betrieb
TV Videosignal auf Zeile
getriggert
Keine Signalverfälschung
durch Überschwingen ...
Vollaussteuerung
mit 35 MHz Sinus
4
Änderungen vorbehalten
Page 5
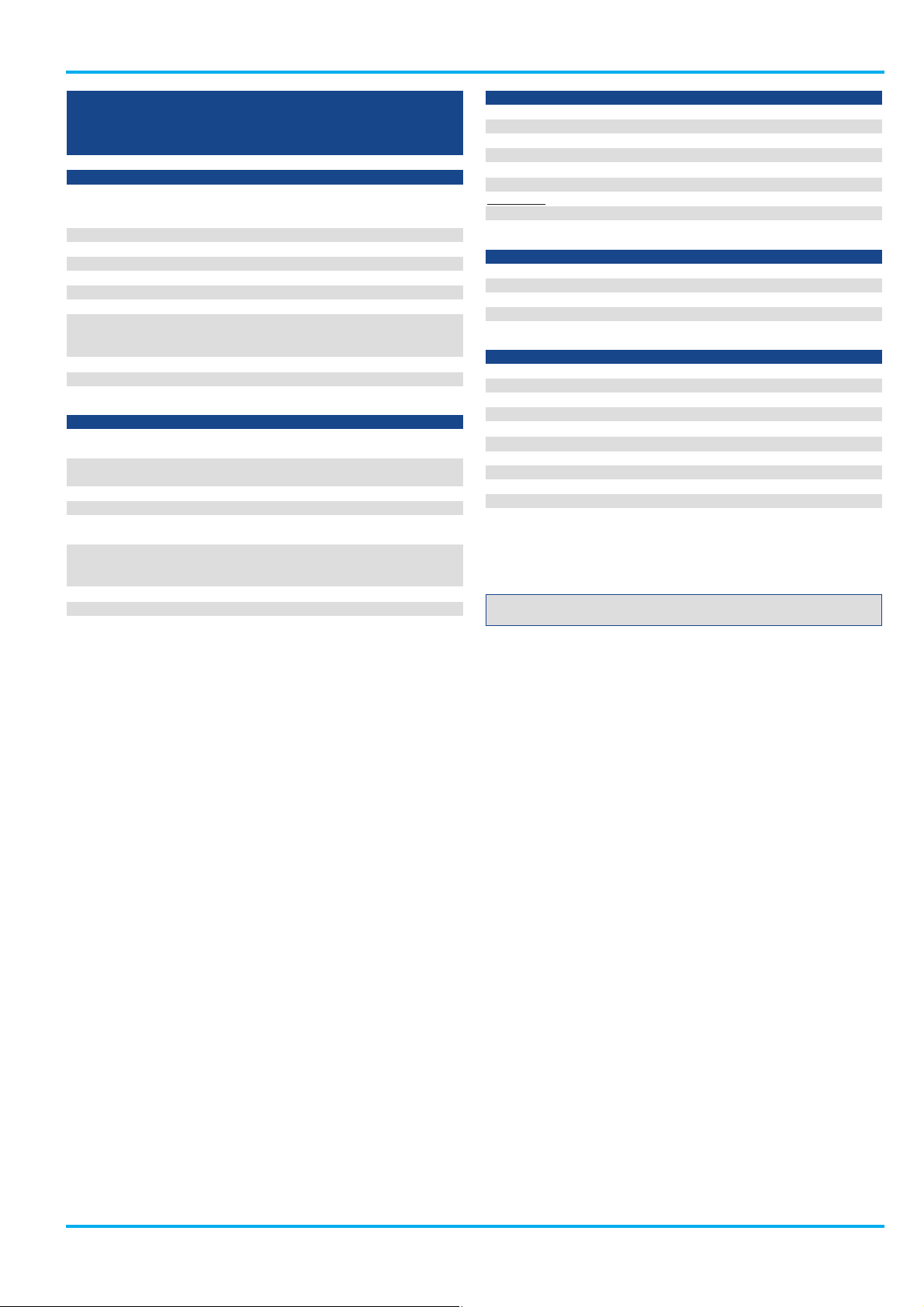
Technis che Dat en
Horizontalablenkung
Zeitbasis: 0,2 s/cm – 0,1 μs/cm (Schaltfolge 1-2-5)
Genauigkeit: ±3%
Variabel (unkal.): › 2,5:1 bis › 0,5 s/cm
X-Dehnung x10: bis 10 ns/cm
Genauigkeit: ± 5 %
Hold-off Zeit: variabel bis ca. 10 : 1
XY-Betrieb
Bandbreite X-Verstärker: 0 – 2,5 MHz (-3 dB)
XY-Phasendifferenz ‹3°: ‹ 120 kHz
Komponententester
Testspannung: ca. 7 V
eff
(Leerlauf)
Teststrom: ca. 7 mA
eff
(Kurzschluss)
Testfrequenz: ca. 50 Hz
Testkabelanschluss: 2 Steckbuchsen 4 mm Ø
Prüfkreis liegt einpolig an Masse (Schutzleiter)
Verschiedenes
CRT: D14-363GY, 8 x 10 cm mit Innenraster
Beschleunigungsspannung: ca. 2 kV
Strahldrehung: auf Frontseite einstellbar
Rechteck-Kal.-Signal: 0,2V ± 1 %, ≈ 1 kHz/1 MHz (ta ‹ 4 ns)
Netzanschluss: 105 – 253 V, 50/60 Hz ± 10 %, CAT II
Leistungsaufnahme: ca. 36 Watt bei 230 V/50 Hz
Umgebungstemperatur: 0° C...+40° C
Schutzart: Schutzklasse I (EN 61010-1)
Gewicht: ca. 5,4 kg
Gehäuse (B x H x T): 285 x 125 x 380 mm
35 MHz Analog-Oszilloskop HM303-6
bei 23 °C nach einer Aufwärmzeit von 30 Minuten
Vertikalablenkung
Betriebsarten: Kanal I oder II einzeln
Kanal I und II (alternierend oder chop.)
Summe oder Differenz von CH I und CH II
Invertierung: CH II
XY-Betrieb: CH I (X) und CH II (Y)
Bandbreite: 2 x 0 bis 35 MHz (-3 dB)
Anstiegszeit: ‹10ns
Überschwingen: max. 1%
Ablenkkoeffizienten: Schaltfolge 1-2-5
1 mV/cm – 2 mV/cm: ± 5 % (0 – 10 MHz (-3 dB))
5 mV/cm – 20 V/cm: ± 3 % (0 – 35 MHz (-3 dB))
Variabel (unkal.): › 2,5 : 1 bis › 50 V/cm
Eingangsimpedanz: 1 MΩ II 20 pF
Eingangskopplung: DC, AC, GND (Ground)
Max. Eingangsspannung: 400 V (DC + Spitze AC)
Triggerung
Automatik (Spitzenwert): 20Hz – 50 MHz (≥ 5mm)
50 MHz - 100 MHz (≥ 8 mm)
Normal mit Level-Einst.: 0 - 50MHz (≥ 5 mm)
50 MHz – 100 MHz (≥ 8 mm)
Triggeranzeige: LED
Flankenrichtung: positiv oder negativ
Quellen: Kanal I oder II, CH I alternierend CH II,
(≥ 8 mm) Netz und extern
Kopplung: AC: 10 Hz – 100MHz
DC: 0 – 100 MHz
LF: 0 – 1,5 kHz
Triggeranzeige: LED
Triggerung extern: ≥ 0,3 V
ss
(30 Hz – 50 MHz)
Aktiver TV-Sync-Separator: positiv und negativ
Im Lieferumfang enthalten: Netzkabel, Bedienungsanleitung, 2 Tastköpfe
1:1 /10:1 (HZ154)
Änderungen vorbehalten
5
Page 6
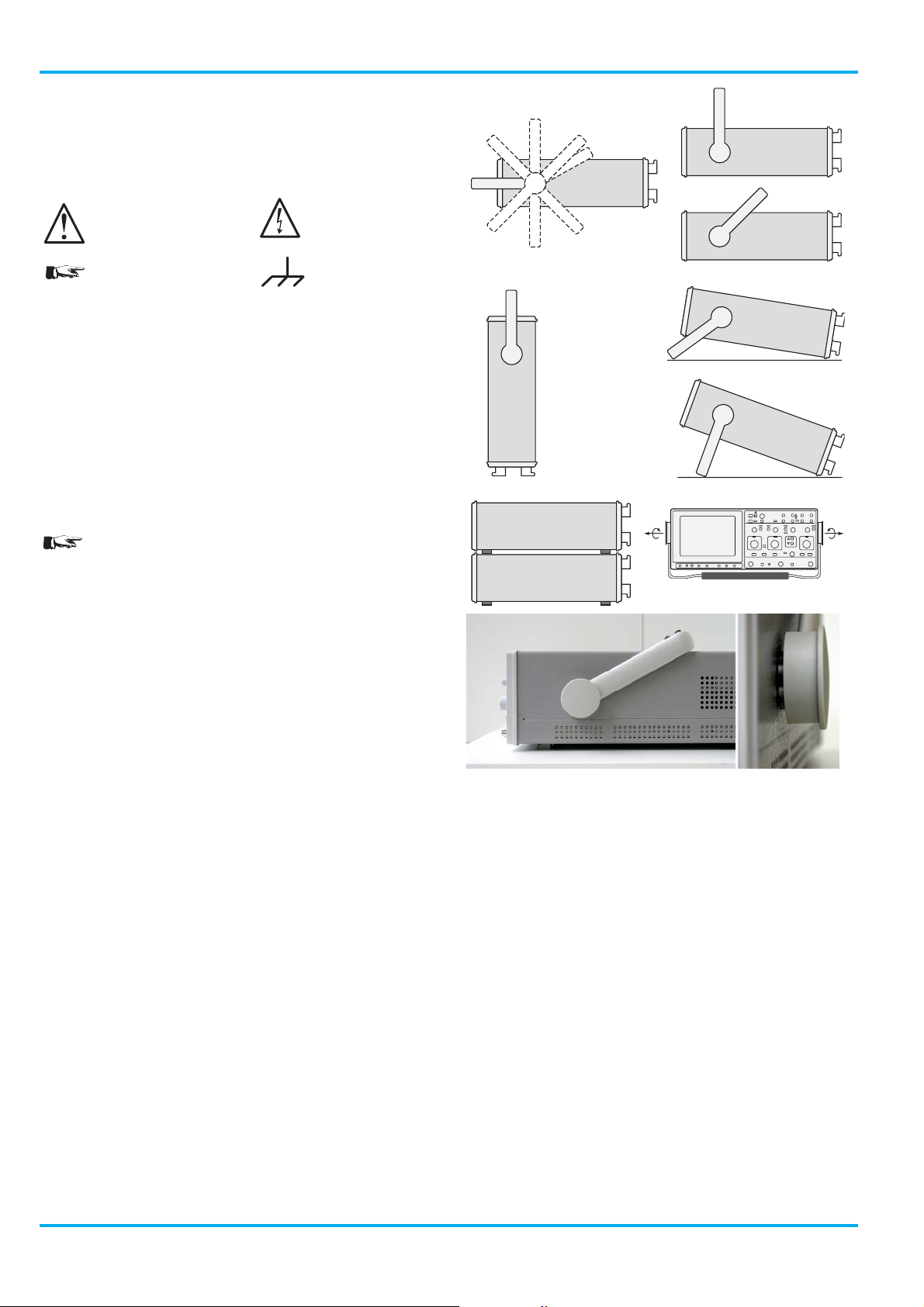
Allgemeines
Sofort nach dem Auspacken sollte das Gerät auf mechanische Beschädigungen und lose Teile im Inneren überprüft werden. Falls ein
Transportschaden vorliegt, ist sofort der Lieferant zu informieren.
Das Gerät darf dann nicht in Betrieb gesetzt werden.
Symbole
Bedienungsanleitung Hochspannung
beachten
Hinweis Erde
unbedingt beachten!
Aufstellung des Gerätes
Wie den Abbildungen zu entnehmen, lässt sich der Griff in verschiedene Positionen schwenken:
A = Trageposition
B = Position in der der Griff entfernt werden kann, aber auch für
waagerechtes Tragen
C = Waagerechte Betriebsstellung
D und E = Betriebsstellungen mit unterschiedlichem Winkel
F = Position zum Entfernen des Griffes
T = Stellung für Versand im Karton (Griffknöpfe nicht gerastet)
Achtung!
Um eine Änderung der Griffposition vorzunehmen,
muss das Oszilloskop so aufgestellt sein, dass es
nicht herunterfallen kann, also z.B. auf einem Tisch
stehen. Dann müssen die Griffknöpfe zunächst
auf beiden Seiten gleichzeitig nach Außen gezogen und in Richtung der gewünschten Position
geschwenkt werden. Wenn die Griffknöpfe wäh-
rend des Schwenkens nicht nach Außen gezogen
werden, können sie in die nächste Raststellung
einrasten.
B
C
B
T
A
C
D
F
E
D
E
A
PUOPFGkT
PUOPFGkT PUOPFGkT
PUOPFGkT
PUOGkT
PUOPFGkT
PUOPFGkT
HM507
PUOPFGkT
PUOPFGkT
PUOPFGkT PUOPFGkT PUOPFGkT PUOPFGkT
PUOPFGkT
PUOPFGkT PUOPFGkT
PUk PUk PUk PUk PUk PUk
PUkT
HGOPFFD
PUOPFGkT
B
PUOPFGkT
PUkT
PUkT
PUkT
INPUT CHI
OPK
HJ
PUkT
VBN
PUOPFGkT
HJKL
PUOPFGkT
PUkT
PUOPFGkT
HGOFFD
PUkT
PUkT
PUkT
INPUT CHI
INPUT CHI
HAMEG
OPK
OPK
HJ
HJ
VBN
VBN
PUOPFGkT
HJKL
HJKL
T
T
Entfernen/Anbringen des Griffs
Abhängig vom Gerätetyp kann der Grif f in Stellung B oder F entfernt
werden, in dem man ihn weiter herauszieht. Das Anbringen des
Griffs erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Sicherheit
Dieses Gerät ist gemäß VD E 0411 Teil 1, Sicherheitsbestimmungen
für elektrische Mess-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte, gebaut,
geprüft und hat das Werk in sicherheitstechnisch
einwandfreiem Zustand verlassen. Es entspricht damit auch den
Bestimmungen der europäischen Norm EN 61010-1 bzw. der internationalen Norm IEC 1010-1. Um diesen Zustand zu erhalten und
einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die
Hinweise und Warnvermerke beachten, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind. Gehäuse, Chassis und alle Messanschlüsse
sind mit dem Netzschut zleiter verbunden. Das Gerät entspricht den
Bestimmungen der Schutzklasse I. D ie berührbaren Metallteile sind
gegen die Netzpole mit 2200 V Gleichspannung geprüft.
Das Oszilloskop darf aus S icherheitsgründen nur an vorschriftsmäßigen
Schutzkontaktsteckdosen betrieben werden. Der Netzstecker muss
eingeführt sein, bevor Signalstromkreise angesc hlossen werden. Die
Auftrennung der Schutzkontaktverbindung ist unzulässig.
Die meisten Elektronenröhren generieren Gammastrahlen. Bei die sem Gerät bleibt die Ionendosisleistung weit unter dem gesetzlich
zulässigen Wert von 36 pA/kg.
Wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr
möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen
unabsichtlichen Betrieb zu sichern.
Diese Annahme ist berechtigt,
– wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen hat,
– wenn das Gerät lose Teile enthält,
– wenn das Gerät nicht mehr arbeitet,
– nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen (z.B.
im Freien oder in feuchten Räumen),
– nach schweren Transportbeanspruchungen (z.B. mit einer
Verpackung, die nicht den Mindestbedingungen von Post,
Bahn oder Spedition entsprach).
Bestimmungsgemäßer Betrieb
ACHTUNG! Das Messgerät ist nur zum Gebrauch durch Personen
bestimmt, die mit den beim Messen elektrischer Größen verbundenen Gefahren vertraut sind.
Aus Sicherheitsgründen darf das Oszilloskop nur an vorschriftsmä-
ßigen Schutzkontak tsteckdosen betrieben werden. Die Auf trennung
der Schutzkontakt verbindung ist unzulässig. Der Netzstecker muss
eingeführt sein, bevor Signalstromkreise angeschlossen werden.
6
Änderungen vorbehalten
Page 7
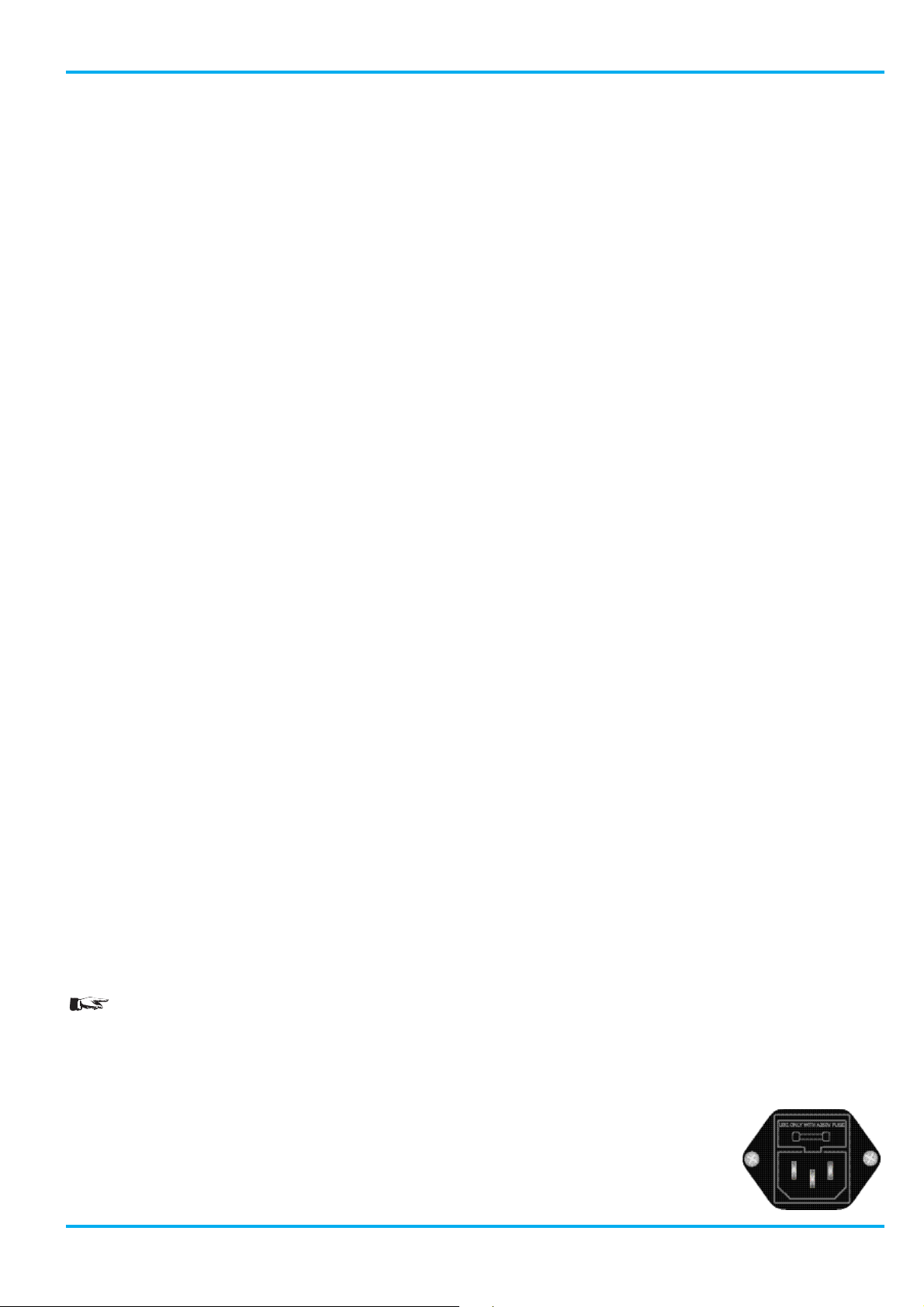
Allgemeines
CAT I
Dieses Oszilloskop ist für Messungen an Stromkreisen bestimmt,
die entweder gar nicht oder nicht direkt mit dem Netz verbunden sind. Direkte Messungen (ohne galvanische Trennung) an
Messstromkreisen der Messkategorie II, III oder IV sind unzuläs-
sig! Die Stromkreise eines Messobjekts sind dann nicht direkt
mit dem Netz verbunden, wenn das Messobjekt über einen
Schutz-Trenntransformator der Schutzklasse II betrieben wird.
Es ist auch möglich mit Hilfe geeigneter Wandler (z.B. Stromzangen), welche die Anforderungen der Schutzklasse II erfüllen,
quasi indirekt am Netz zu messen. Bei der Messung muss die
Messkategorie – für die der Hersteller den Wandler spezifi ziert
hat – beachtet werden.
Messkategorien
Die Messkategorien beziehen sich auf Transienten auf dem Netz.
Transienten sind kurze, sehr schnelle (steile) Spannungs- und
Stromänderungen, die periodisch und nicht periodisch auftreten
können. Die Höhe möglicher Transienten nimmt zu, je kürzer die
Entfernung zur Quelle der Niederspannungs-installation ist.
Messkategorie IV: Messungen an der Quelle der Niederspannungsinstallation (z.B. an Zählern).
Messkategorie III: Messungen in der Gebäudeinstallation (z.B.
Ver teiler, Leistungsschalter, fest installierte Steckdosen, fest installierte Motoren etc.).
Messkategorie II: Messungen an Stromkreisen, die elektrisch
direkt mit dem Niederspannungsnetz verbunden sind (z.B. Haushaltsgeräte, tragbare Werkzeuge etc.)
Räumlicher Anwendungsbereich
Das Oszilloskop ist für den Betrieb in folgenden Be reichen bestimmt:
Industrie-, Wohn-, Geschäfts- und Gewerbebereich
sowie Kleinbetriebe.
Umgebungsbedingungen
Die zulässige Umgebungstemperatur während des Betriebs reicht
von 0 °C bis +40 °C. Während der Lagerung oder des Transports
darf die Temperatur zwischen –20 °C und +55 °C betragen. Hat
sich während des Transports oder der Lagerung Kondenswasser
gebildet, muss das Gerät ca. 2 Stunden akklimatisiert werden,
bevor es in Betrieb genommen wird. Das Oszilloskop ist zum Gebrauch in sauberen, trockenen Räumen bestimmt. Es darf nicht bei
besonders großem Staub bzw. Feuchtigkeitsgehalt der Luft, bei
Explosionsgefahr sowie bei aggressiver chemischer Einwirkung
betrieben werden.
Die Betriebslage ist belie big. Eine ausreichende Luftzirkulation ( Konvektionskühlung) ist jedoch zu gewährleisten. Bei Dauerbetrieb ist
folglich eine horizontale oder schräge Betriebslage (Aufstellbügel)
zu bevorzugen.
Die Lüftungslöcher dürfen nicht abgedeckt
werden!
Nenndaten mit Toleranzangaben gelten nach einer A nwärmzeit von
mind. 20 Minuten und bei einer Umgebungstemperatur zwischen
15 °C und 30 °C. Wer te ohne Toleranzangabe sind Richtwerte eines
durchschnittlichen Gerätes.
jeder Frühausfall erkannt. Anschließend erfolgt ein umfangreicher
Funktions- und Qualitätstest, bei dem alle Betriebsarten und die
Einhaltung der technischen Daten geprüft werden. Die Prüfung
erfolgt mit Prüfmitteln, die auf nationale Normale rückführbar
kalibriert sind.
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen des
Landes, in dem das HAMEG-Produkt erworben wurde. Bei Beanstandungen wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie
das HAMEG-Produkt erworben haben.
Nur für die Bundesrepublik Deutschland:
Um den Ablauf zu beschleunigen, können Kunden innerhalb der Bundesrepublik Deutschland die Reparaturen auch direkt mit HAMEG
abwickeln. Auch nach Ablauf der Gewährleistungsfrist steht Ihnen
der HAMEG Kundenservice für Reparaturen zur Verfügung.
Return Material Authorization (RMA):
Bevor Sie ein Gerät an uns zurücksenden, fordern Sie bitte in
jedem Fall per Internet : http: //w ww.hameg.de oder Fax eine
RMA-Nummer an. Sollte Ihnen keine geeignete Verpackung
zur Verfügung stehen, so können Sie einen leeren Originalkarton über den HAMEG-Vertrieb (Tel: +49 (0) 6182 800 300,
E-Mail: vertrieb@hameg.de) bestellen.
Wartung
Die Außenseite des Oszilloskops sollte regelmäßig mit einem
Staubpinsel gereinigt werden. Hartnäckiger Schmutz an Gehäuse
und Griff, den Kunststoff- und A luminiumteilen lässt sich mit einem
angefeuchteten Tuch ( Wasser +1% Entspannungsmittel) entfernen.
Bei fettigem Schmut z kann Brennspiritus oder Waschbenzin ( Petroleumäther) benutzt werden. Die Sichtscheibe darf nur mit Wasser
oder Waschbenzin (aber nicht mit Alkohol oder Lösungsmitteln)
gereinigt werden, sie ist dann noch mit einem tro ckenen, sauberen,
fusselfreien Tuch nachzureiben. Nach der Reinigung sollte sie mit
einer handelsüblichen antistatischen Lösung, geeignet für Kunststoffe, behandelt werden. Keinesfalls dar f die Reinigungsfl üssigkeit
in das Gerät gelangen. Die Anwendung anderer Reinigungsmittel
kann die Kunststoff- und Lackoberfl ächen angreifen.
Netzspannung
Das Gerät arbeitet mit 50 und 60 Hz Netzwechselspannungen im
Bereich von 105 V bis 253 V. Eine Netzspannungsumschaltung ist
daher nicht vorgesehen.
Die Netzeingangssicherung ist von außen zugänglich. Netz steckerBuchse und Sicherungshalter bilden eine Einheit. Ein Auswechseln
der Siche r u n g d a r f u n d k a n n ( b e i u n b e s c h ädigtem Sicherungshalter)
nur erfolgen, wenn zuvor das Netzkabel aus der Buchse entfernt
wurde. Dann muss der Sicher ungshalter mit einem Schraubenzieher
herausgehebelt werden. Der Ansatzpunkt ist ein Schlitz, der sich
auf der Seite der Anschlusskontakte befi ndet. Die Sicherung kann
dann aus einer Halterung ge drückt und ersetzt werden.
Der Sicherungshalter wird gegen den Federdruck einge scho ben, bis er eingerastet ist. Die Verwendung ,,geflickter“
Sicherungen oder das Kurzschließen des Sicherungshalters ist
unzulässig. Dadurch entstehende Schäden fallen nicht un ter die
Gewährleistung.
Gewährleistung und Reparatur
HAMEG Geräte unterliegen e iner streng en Qualit ätskontrolle. Jedes
Gerät durchläuft vor dem Verlassen der Produktion einen 10-stündigen „Burn in-Test“. Im intermittierenden Betrieb wird dabei fast
Änderungen vorbehalten
Sicherungstype:
Größe 5 x 20 mm; 250V~, C;
IEC 127, Bl. III; DIN 41 662
(evtl. DIN 41 571, Bl. 3).
Abschaltung: träge (T) 0,8A.
7
Page 8
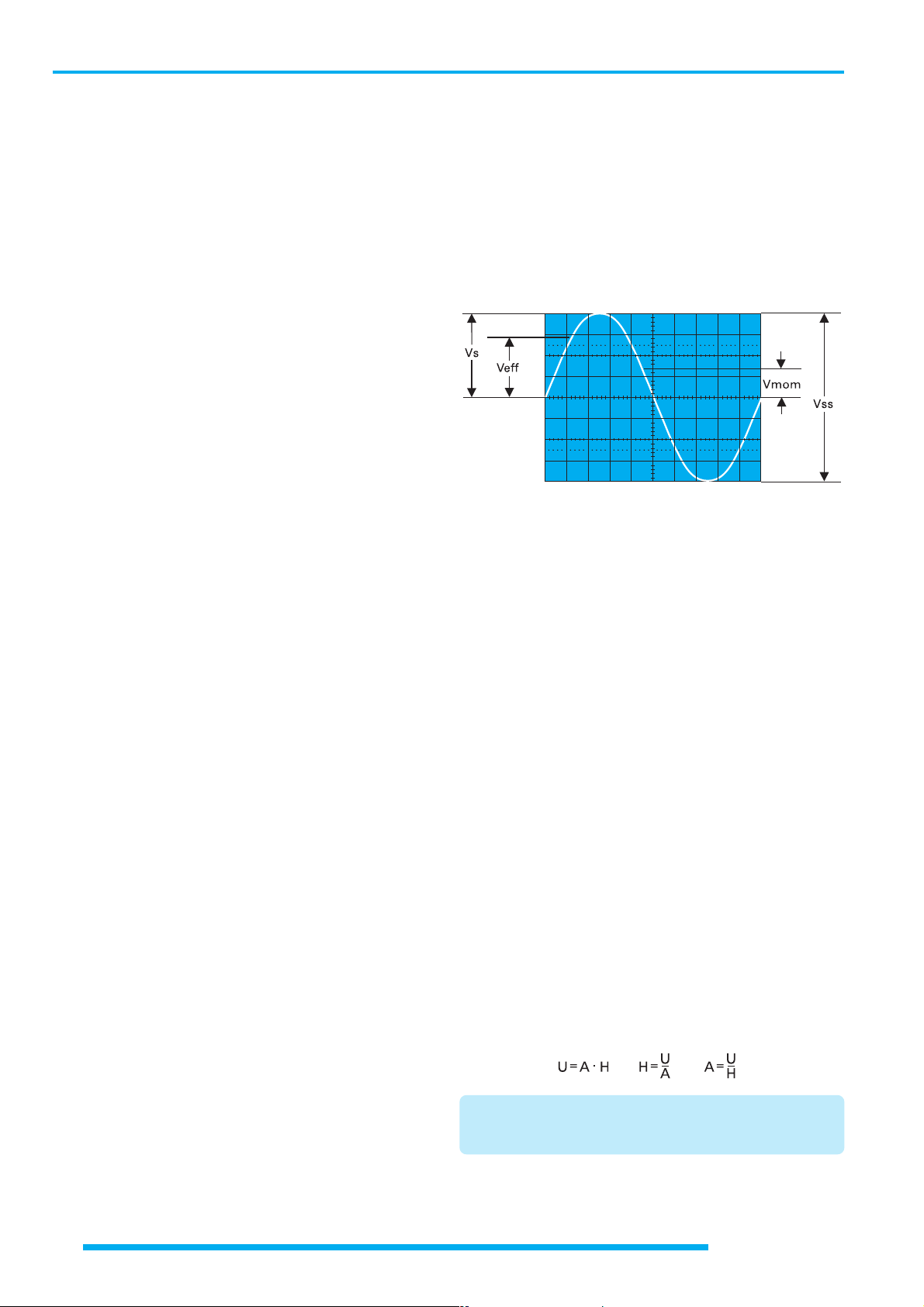
Die Grundlagen der Signalaufzeichnung
Art der Signalspannung
Der HM303-6 erfaßt praktisch alle sich periodisch wiederholenden Signalarten, von Gleichspannung bis Wechselspannungen mit einer Frequenz von mindestens 35MHz
(-3dB).
Der Vertikalverstärker ist so ausgelegt, daß die Übertragungsgüte nicht durch eigenes Überschwingen beeinflußt wird.
Die Darstellung einfacher elektrischer Vorgänge, wie
sinusförmige HF- und NF-Signale oder netzfrequente Brummspannungen, ist in jeder Hinsicht problemlos. Beim Messen ist
ein ab ca. 14MHz zunehmender Meßfehler zu berücksichtigen,
der durch Verstärkungsabfall bedingt ist. Bei ca. 18MHz beträgt
der Abfall etwa 10%, der tatsächliche Spannungswert ist dann
ca. 11% größer als der angezeigte Wert. Wegen der differierenden Bandbreiten der Vertikalverstärker (-3dB zwischen
35MHz und 38MHz), ist der Meßfehler nicht so exakt definierbar.
Bei der Aufzeichnung rechteck- oder impulsartiger Signalspannungen ist zu beachten, daß auch deren Oberwellenanteile
übertragen werden müssen. Die Folgefrequenz des Signals
muß deshalb wesentlich kleiner sein als die obere Grenzfrequenz
des Vertikalverstärkers. Bei der Auswertung solcher Signale ist
dieser Sachverhalt zu berücksichtigen.
Schwieriger ist das Oszilloskopieren von Signalgemischen,
besonders dann, wenn darin keine mit der Folgefrequenz
ständig wiederkehrenden höheren Pegelwerte enthalten sind,
auf die getriggert werden kann. Dies ist z.B. bei Burst-Signalen
der Fall. Um auch dann ein gut getriggertes Bild zu erhalten, ist
u.U. eine Veränderung der HOLD OFF- und/oder der Zeitbasis-
Feineinstellung erforderlich.
Fernseh-Video-Signale (FBAS-Signale) sind mit Hilfe des aktiven TV-Sync-Separator leicht triggerbar.
Die zeitliche Auflösung ist unproblematisch. Beispielsweise
wird bei ca. 35MHz und der kürzesten einstellbaren Ablenkzeit
(10ns/cm) alle 2,8cm ein Kurvenzug geschrieben.
Für den wahlweisen Betrieb als Wechsel- oder Gleichspannungsverstärker hat der Vertikalverstärker-Eingang einen DC/
AC-Schalter (DC = direct current; AC = alternating current). Mit
Gleichstromkopplung DC sollte nur bei vorgeschaltetem
Tastteiler oder bei sehr niedrigen Frequenzen gearbeitet werden, bzw. wenn die Erfassung des Gleichspannungsanteils der
Signalspannung unbedingt erforderlich ist.
Bei der Aufzeichnung sehr niederfrequenter Impulse können
bei AC-Kopplung (Wechselstrom) des Vertikalverstärkers störende Dachschrägen auftreten (AC-Grenzfrequenz ca. 1,6Hz
für 3dB). In diesem Falle ist, wenn die Signalspannung nicht mit
einem hohen Gleichspannungspegel überlagert ist, die DC-
Kopplung vorzuziehen. Andernfalls muß vor den Eingang des
auf DC-Kopplung geschalteten Meßverstärkers ein entsprechend großer Kondensator geschaltet werden. Dieser muß
eine genügend große Spannungsfestigkeit besitzen. DC-Kopp-
lung ist auch für die Darstellung von Logik- und Impulssignalen
zu empfehlen, besonders dann, wenn sich dabei das
Tastverhältnis ständig ändert. Andernfalls wird sich das Bild bei
jeder Änderung auf- oder abwärts bewegen. Reine Gleichspannungen können nur mit DC-Kopplung gemessen werden.
Größe der Signalspannung
größen und Spannungsbezeichnungen in der Oszilloskopie wird
jedoch der Vss-Wert (Volt-Spitze-Spitze) verwendet. Letzterer
entspricht den wirklichen Potentialverhältnissen zwischen dem
positivsten und negativsten Punkt einer Spannung.
Will man eine auf dem Oszilloskopschirm aufgezeichnete
sinusförmige Größe auf ihren Effektivwert umrechnen, muß
der sich in Vss ergebende Wert durch 2 x √‘2 = 2,83 dividiert
werden. Umgekehrt ist zu beachten, daß in Veff angegebene
sinusförmige Spannungen den 2,83fachen Potentialunterschied
in Vss haben. Die Beziehungen der verschiedenen Spannungsgrößen sind aus der nachfolgenden Abbildung ersichtlich.
Spannungswerte an einer Sinuskurve
Veff = Effektivwert; Vs = einfacher Spitzenwert;
Vss = Spitze-Spitze-Wert;
Vmom = Momentanwert (zeitabhängig)
Die minimal erforderliche Signalspannung am Y-Eingang für
ein 1 cm hohes Bild beträgt 1mVss (±5%), wenn die Drucktaste Y-MAG. x5 gedrückt ist und der Feinstell-Knopf des auf
5mV/cm eingestellten Eingangsteilerschalters sich in seiner
kalibrierten Stellung CAL. (Rechtsanschlag) befindet. Es können jedoch auch noch kleinere Signale aufgezeichnet werden.
Die Ablenkkoeffizienten am Eingangsteiler sind in mVss/cm
oder Vss/cm angegeben. Die Größe der angelegten Span-
nung ermittelt man durch Multiplikation des eingestellten
Ablenkkoeffizienten mit der abgelesenen vertikalen Bildhöhe in cm. Wird mit Tastteiler 10:1 gearbeitet, ist nochmals
mit 10 zu multipilizieren. Für Amplitudenmessungen muß
der Feinsteller am Eingangsteilerschalter in seiner kalibrierten Stellung CAL. stehen (Pfeil waagerecht nach rechts
zeigend). Wird der Feinstellknopf nach links gedreht, verringert sich die Empfindlichkeit in jeder Teilerschalterstellung
mindestens um den Faktor 2,5. So kann jeder Zwischenwert
innerhalb der 1-2-5 Abstufung eingestellt werden. Bei direktem Anschluß an den Y-Eingang sind Signale bis 400Vss
darstellbar (Teilerschalter auf 20V/cm, Feinsteller auf Linksanschlag).
Mit den Bezeichnungen
H = Höhe in cm des Schirmbildes,
U = Spannung in Vss des Signals am Y-Eingang,
A = Ablenkkoeffizient in V/cm am Teilerschalter
läßt sich aus gegebenen zwei Werten die dritte Größe errechnen:
Alle drei Werte sind jedoch nicht frei wählbar. Sie müssen beim HM303-6 innerhalb folgender Grenzen liegen
(Triggerschwelle, Ablesegenauigkeit):
In der allgemeinen Elektrotechnik bezieht man sich bei Wechselspannungsangaben in der Regel auf den Effektivwert. Für Signal-
8
H zwischen 0,5cm und 8cm, möglichst 3,2cm und 8cm,
U zwischen 0,5mVss und 160Vss,
A zwischen 1mV/cm und 20V/cm in 1-2-5 Teilung.
Änderungen vorbehalten
Page 9

Beispiele:
Eingest. Ablenkkoeffizient A = 50mV/cm 0,05V/cm,
abgelesene Bildhöhe H = 4,6cm,
gesuchte Spannung U = 0,05x4,6 = 0,23Vss
Eingangsspannung U = 5Vss,
eingestellter Ablenkkoeffizient A = 1V/cm,
gesuchte Bildhöhe H = 5:1 = 5cm
Signalspannung U = 230Veff x 2x√2 = 651Vss
(Spannung >160Vss, mit Tastteiler 10:1 U = 65,1Vss),
gewünschte Bildhöhe H = mind. 3,2cm, max. 8cm,
maximaler Ablenkkoeffizient A = 65,1:3,2 = 20,3V/cm,
minimaler Ablenkkoeffizient A = 65,1:8 = 8,1V/cm,
einzustellender Ablenkkoeffizient A = 10V/cm
Die Spannung am Y-Eingang darf 400V (unabhängig von
der Polarität) nicht überschreiten. Ist das zu messende
Signal eine Wechselspannung die einer Gleichspannung überlagert ist (Mischspannung), beträgt der höchstzulässige Gesamtwert beider Spannungen (Gleichspannung und einfacher
Spitzenwert der Wechselspannung) ebenfalls + bzw. -400V
(siehe Abbildung. Wechselspannungen, deren Mittelwert Null
ist, dürfen maximal 800Vss betragen.
Beim Messen mit Tastteilern sind deren höhere Grenzwerte
nur dann maßgebend, wenn DC-Eingangskopplung am
Oszilloskop vorliegt. Für Gleichspannungsmessungen bei AC-
Eingangskopplung gilt der niedrigere Grenzwert des
Oszilloskopeingangs (400V). Der aus dem Widerstand im Tastkopf
und dem 1MΩ Eingangswiderstand des Oszilloskops bestehende Spannungsteiler ist, durch den bei AC-Kopplung dazwischen
geschalteten Eingangs-Kopplungskondensator, für Gleichspannungen unwirksam. Gleichzeitig wird dann der Kondensator mit der ungeteilten Gleichspannung belastet. Bei Mischspannungen ist zu berücksichtigen, daß bei AC-Kopplung deren
Gleichspannungsanteil ebenfalls nicht geteilt wird, während der
Wechselspannungsanteil einer frequenzabhängigen Teilung
unterliegt, die durch den kapazitiven Widerstand des
Koppelkondensators bedingt ist. Bei Frequenzen ≥40Hz kann
vom Teilungsverhältnis des Tastteilers ausgegangen werden.
In Stellung GD wird der Signalweg direkt hinter dem Y-Eingang
aufgetrennt; dadurch ist der Spannungsteiler auch in diesem
Falle unwirksam. Dies gilt selbstverständlich für Gleich- und
Wechselspannungen.
Unter Berücksichtigung der zuvor erläuterten Bedingungen
können mit HAMEG-Tastteilern 10:1 Gleichspannungen bis
600V bzw. Wechselspannungen (mit Mittelwert Null) bis
1200Vss gemessen werden. Mit Spezialtastteilern 100:1 (z.B.
HZ53) lassen sich Gleichspannungen bis 1200V bzw. Wechselspannungen (mit Mittelwert Null) bis 2400Vss messen.
Die Grundlagen der Signalaufzeichnung
Gesamtwert der Eingangsspannung
Die gestrichelte Kurve zeigt eine Wechselspannung, die um 0
Volt schwankt. Ist diese Spannung einer Gleichspannung überlagert (DC), so ergibt die Addition der positiven Spitze zur
Gleichspannung die maximal auftretende Spannung (DC + AC
Spitze).
Zeitwerte der Signalspannung
In der Regel handelt es sich in der Oszilloskopie um zeitlich
wiederkehrende Spannungsverläufe, im folgenden Perioden
genannt. Die Zahl der Perioden pro Sekunde ist die Folgefrequenz. Abhängig von der Zeitbasis-Einstellung des TIME/
DIV.-Schalters können eine oder mehrere Signalperioden oder
auch nur ein Teil einer Periode dargestellt werden. Die Zeitkoeffizienten sind am TIME/DIV.-Schalter in s/cm, ms/cm
und µs/cm angegeben. Die Skala ist dementsprechend in drei
Felder aufgeteilt. Die Dauer einer Signalperiode, bzw. eines
Teils davon, ermittelt man durch Multiplikation des betreffenden Zeitabschnitts (Horizontalabstand in cm) mit dem
am TIME/DIV.-Schalter eingestellten Zeitkoeffizienten.
Dabei muß der mit einer roten Pfeil-Knopfkappe gekennzeichnete Zeit-Feinsteller in seiner kalibrierten Stellung
CAL. stehen (Pfeil waagerecht nach rechts zeigend).
Mit den Bezeichnungen
L = Länge in cm einer Periode (Welle) auf dem Schirmbild,
T = Zeit in s für eine Periode,
F = Folgefrequenz in Hz,
Z = Zeitkoeffizient in s/cm am Zeitbasisschalter
und der Beziehung F = 1/T lassen sich folgende Gleichungen
aufstellen:
Allerdings verringert sich dieser Wert bei höheren Frequenzen
(siehe technische Daten HZ53). Mit einem normalen Tastteiler
10:1 riskiert man bei so hohen Spannungen, daß der den TeilerLängswiderstand überbrückende C-Trimmer durchschlägt,
wodurch der Y-Eingang des Oszilloskops beschädigt werden
kann. Soll jedoch z.B. nur die Restwelligkeit einer Hochspannung oszilloskopiert werden, genügt auch der 10:1-Tastteiler.
Diesem ist dann noch ein entsprechend hochspannungsfester
Kondensator (etwa 22-68nF) vorzuschalten.
Mit der auf GD geschalteten Eingangskopplung und dem Y-
POS.-Einsteller kann vor der Messung eine horizontale Rasterlinie als Referenzlinie für Massepotential eingestellt werden.
Sie kann beliebig zur horizontalen Mittellinie eingestellt werden,
je nachdem, ob positive und/oder negative Abweichungen vom
Massepotential zahlenmäßig erfaßt werden sollen.
Änderungen vorbehalten
Bei gedrückter Taste X-MAG. (x10) ist Z durch 10 zu
teilen.
Alle vier Werte sind jedoch nicht frei wählbar. Sie sollten beim
HM303-6 innerhalb folgender Grenzen liegen:
L zwischen 0,2 und 10cm, möglichst 4 bis 10cm,
T zwischen 0,01µs und 2s,
F zwischen 0,5Hz und 30MHz,
Z zwischen 0,1µs/cm und 0,2s/cm in 1-2-5 Teilung
(bei ungedrückter Taste X-MAG. (x10)), und
Z zwischen 10ns/cm und 20ms/cm in 1-2-5 Teilung
(bei gedrückter Taste X-MAG. (x10)).
9
Page 10

Die Grundlagen der Signalaufzeichnung
Beispiele:
Länge eines Wellenzugs (einer Periode) L = 7cm,
eingestellter Zeitkoeffizient Z = 0,1µs/cm,
gesuchte Periodenzeit T = 7x0,1x10
-6
= 0,7µs
gesuchte Folgefrequenz F = 1:(0,7x10-6) = 1,428MHz.
Zeit einer Signalperiode T = 1s,
eingestellter Zeitkoeffizient Z = 0,2s/cm,
gesuchte Länge L = 1:0,2 = 5cm.
Länge eines Brummspannung-Wellenzugs L = 1cm,
eingestellter Zeitkoeffizient Z = 10 ms/cm,
gesuchte Brummfrequenz F = 1:(1x10x10
-3
) = 100Hz.
TV-Zeilenfrequenz F = 15 625 Hz,
eingestellter Zeitkoeffizient Z = 10µs/cm,
gesuchte Länge L = 1:(15 625x10
-5
) = 6,4cm.
Länge einer Sinuswelle L = min. 4cm, max. 10cm,
Frequenz F = 1kHz,
max. Zeitkoeffizient Z = 1:(4x10
min. Zeitkoeffizient Z = 1:(10x10
einzustellender Zeitkoeffizient Z = 0,2ms/cm,
dargestellte Länge L = 1:(10
3
) = 0,25ms/cm,
3
) = 0,1ms/cm,
3
x 0,2x10–3) = 5cm.
Länge eines HF-Wellenzugs L = 1cm,
eingestellter Zeitkoeffizient Z = 0,5µs/cm,
gedrückte Dehnungstaste X-MAG. (x 10) : Z = 50ns/cm,
gesuchte Signalfreq. F = 1:(1x50x10
-9
) = 20MHz,
gesuchte Periodenzeit T = 1:(20x106) = 50ns.
Ist der zu messende Zeitabschnitt im Verhältnis zur vollen
Signalperiode relativ klein, sollte man mit gedehntem Zeitmaßstab (X-MAG. (x10)) arbeiten. Die ermittelten Zeitwerte sind
dann durch 10 zu dividieren. Durch Drehen des X-POS.-Knop-
fes kann der interessierende Zeitabschnitt in die Mitte des
Bildschirms geschoben werden.
Das Systemverhalten einer Impulsspannung wird durch deren
Anstiegszeit bestimmt. Impuls-Anstiegs-/Abfallzeiten werden
zwischen dem 10%- und 90%-Wert ihrer vollen Amplitude
gemessen.
Bei einem am TIME/DIV.-Schalter eingestellten Zeitkoeffizienten von 0,2µs/cm und gedrückter Dehnungstaste (XMAG. (x10)) ergäbe das Bildbeispiel eine gemessene Gesamtanstiegszeit von
= 1,6cm x 0,2µs/cm : 10 = 32ns
t
ges
Bei sehr kurzen Zeiten ist die Anstiegszeit des OszilloskopVertikalverstärkers und des evtl. benutzten Tastteilers geometrisch vom gemessenen Zeitwert abzuziehen. Die Anstiegszeit
des Signals ist dann
2
2
= √t
ges
- t
t
a
Dabei ist tges die gemessene Gesamtanstiegszeit, t
vom Oszilloskop (beim HM303-6 ca. 10ns) und t
Tastteilers, z.B. = 2ns. Ist t
Anstiegszeit des Vertikalverstärkers vernachlässigt werden
osc
- t
2
t
die
osz
die des
größer als 100ns, kann die
ges
t
(Fehler <1%).
Obiges Bildbeispiel ergibt damit eine Signal-Anstiegszeit von
= √322 - 102 - 22 = 30,3ns
t
a
Die Messung der Anstiegs- oder Abfallzeit ist natürlich nicht auf
die oben im Bild gezeigte Bild-Einstellung begrenzt. Sie ist so
nur besonders einfach. Prinzipiell kann in jeder Bildlage und bei
beliebiger Signalamplitude gemessen werden. Wichtig ist nur,
daß die interessierende Signalflanke in voller Länge, bei nicht
zu großer Steilheit, sichtbar ist und daß der Horizontalabstand
bei 10% und 90% der Amplitude gemessen wird. Zeigt die
Flanke Vor- oder Überschwingen, darf man die 100% nicht auf
die Spitzenwerte beziehen, sondern auf die mittleren Dachhöhen. Ebenso werden Einbrüche oder Spitzen (glitches) neben der Flanke nicht berücksichtigt. Bei sehr starken Einschwingverzerrungen verliert die Anstiegs- oder Abfallzeitmessung allerdings ihren Sinn. Für Verstärker mit annähernd konstanter Gruppenlaufzeit (also gutem Impulsverhalten)
gilt folgende Zahlenwert-Gleichung zwischen Anstiegszeit t
(in ns) und Bandbreite B (in MHz):
a
Messung:
Die Flanke des betr. Impulses wird exakt auf 5cm Schreibhöhe
eingestellt (durch Y-Teiler und dessen Feineinstellung.)
Die Flanke wird symmetrisch zur X- und Y-Mittellinie positioniert (mit X- und Y-Pos. Einsteller).
Die Schnittpunkte der Signalflanke mit den 10%- bzw. 90%Linien jeweils auf die horizontale Mittellinie loten und deren
zeitlichen Abstand auswerten (T=LxZ).
Die optimale vertikale Bildlage und der Meßbereich für die
Anstiegszeit sind in der folgenden Abbildung dargestellt.
Anlegen der Signalspannung
Vorsicht beim Anlegen unbekannter Signale an den
Vertikaleingang!
Ohne vorgeschalteten Tastteiler sollte der Schalter für die
Signalkopplung zunächst immer auf AC und der Eingangsteilerschalter auf 20V/cm stehen. Ist die Strahllinie nach dem
Anlegen der Signalspannung plötzlich nicht mehr sichtbar,
kann es sein, daß die Signalamplitude viel zu groß ist und den
Vertikalverstärker total übersteuert. Der Eingangsteilerschalter
muß dann nach links zurückgedreht werden, bis die vertikale
Auslenkung nur noch 3-8 cm hoch ist. Bei mehr als 160 Vss
großer Signalamplitude ist unbedingt ein Tastteiler vorzuschalten. Verdunkelt sich die Strahllinie beim Anlegen des Signals
sehr stark, ist wahrscheinlich die Periodendauer des Meßsignals
wesentlich länger als der eingestellte Wert am TIME/DIV.-
Schalter. Letzterer ist dann auf einen entsprechend größeren
Zeitkoeffizienten nach links zu drehen.
Die Zuführung des aufzuzeichnenden Signals an den Y-Eingang
des Oszilloskops ist mit einem abgeschirmten Meßkabel wie
z.B. HZ32 und HZ34 direkt oder über einen Tastteiler 10:1
geteilt möglich. Die Verwendung der genannten Meßkabel an
hochohmigen Meßobjekten ist jedoch nur dann empfehlenswert, wenn mit relativ niedrigen, sinusförmigen Frequenzen
(bis etwa 50kHz) gearbeitet wird. Für höhere Frequenzen muß
10
Änderungen vorbehalten
Page 11

Die Grundlagen der Signalaufzeichnung Bedienelemente
die Meß-Spannungsquelle niederohmig, d.h. an den KabelWellenwiderstand (in der Regel 50Ω) angepaßt sein. Besonders bei der Übertragung von Rechteck- und Impulssignalen ist
das Kabel unmittelbar am Y-Eingang des Oszilloskops mit
einem Widerstand gleich dem Kabel-Wellenwiderstand abzuschließen. Bei Benutzung eines 50Ω-Kabels wie z.B. HZ34 ist
hierfür von HAMEG der 50Ω-Durchgangsabschluß HZ22 erhältlich. Vor allem bei der Übertragung von Rechtecksignalen
mit kurzer Anstiegszeit werden ohne Abschluß an den Flanken
und Dächern störende Einschwingverzerrungen sichtbar. Auch
höherfrequente (>100kHz) Sinussignale dürfen generell nur
impedanzrichtig abgeschlossen gemessen werden. Im allgemeinen halten Verstärker, Generatoren oder ihre Abschwächer
die Nenn-Ausgangsspannung nur dann frequenzunabhängig
ein, wenn ihre Anschlußkabel mit dem vorgeschriebenen Widerstand abgeschlossen wurden. Dabei ist zu beachten, daß
man den Abschlußwiderstand HZ22 nur mit max. 2 Watt
belasten darf. Diese Leistung wird mit 10Veff oder - bei Sinussignal - mit 28,3Vss erreicht.
Wird ein Tastteiler 10:1 oder 100:1 verwendet, ist kein Abschluß erforderlich. In diesem Fall ist das Anschlußkabel direkt
an den hochohmigen Eingang des Oszilloskops angepaßt. Mit
Tastteiler werden auch hochohmige Spannungsquellen nur
geringfügig belastet (ca. 10MΩ II 16 pF bzw. 100MΩ II 7pF bei
HZ53). Deshalb sollte, wenn der durch den Tastteiler auftretende Spannungsverlust durch eine höhere Empfindlichkeitseinstellung wieder ausgeglichen werden kann, nie ohne diesen
gearbeitet werden. Außer dem stellt die Längsimpedanz des
Teilers auch einen gewissen Schutz für den Eingang des
Vertikalverstärkers dar. Infolge der getrennten Fertigung sind
alle Tastteiler nur vorabgeglichen; daher muß ein genauer
Abgleich am Oszilloskop vorgenommen werden (
,,Tastkopf-Abgleich”
Standard-Tastteiler am Oszilloskop verringern mehr oder weniger dessen Bandbreite; sie erhöhen die Anstiegszeit. In
allen Fällen, bei denen die Oszilloskop-Bandbreite voll genutzt
werden muß (z.B. für Impulse mit steilen Flanken), raten wir
dringend dazu, die Tastköpfe HZ51 (10:1), HZ52 (10:1 HF)
und HZ54 (1:1 und 10:1) zu benutzen. Das erspart u.U. die
Anschaffung eines Oszilloskops mit größerer Bandbreite und
hat den Vorteil, daß defekte Einzelteile bei HAMEG bestellt
und selbst ausgewechselt werden können. Die genannten
Tastköpfe haben zusätzlich zur niederfrequenten Kompensationseinstellung einen HF-Abgleich. Damit ist mit Hilfe
eines auf 1MHz umschaltbaren Kalibrators, z.B. HZ60, eine
Gruppenlaufzeitkorrektur an der oberen Grenzfrequenz des
Oszilloskops möglich. Tatsächlich werden mit diesen TastkopfTypen Bandbreite und Anstiegszeit des HM303-6 kaum merklich geändert und die Wiedergabe-Treue der Signalform u.U.
sogar noch verbessert. Auf diese Weise könnten spezifische
Mängel im Impuls-Übertragungsverhalten nachträglich korrigiert werden.
).
siehe
Wenn ein Tastteiler 10:1 oder 100:1 verwendet wird,
muß bei Spannungen über 400V immer DC-Eingangskopplung benutzt werden.
Bei AC-Kopplung tieffrequenter Signale ist die Teilung nicht
mehr frequenzunabhängig. Impulse können Dachschräge zeigen, Gleichspannungen werden unterdrückt - belasten aber
den betreffenden Oszilloskop-Eingangskopplungskondensator.
Dessen Spannungsfestigkeit ist max. 400V (DC + Spitze AC).
Ganz besonders wichtig ist deshalb die DC-Eingangskopplung
bei einem Tastteiler 100:1, der meist eine zulässige Spannungsfestigkeit von max. 1200V (DC + Spitze AC) hat. Zur Unterdrükkung störender Gleichspannung darf aber ein Kondensator
entsprechender Kapazität und Spannungsfestigkeit vor den
Tastteiler geschaltet werden (z.B. zur Brummspannungsmessung).
Bei allen Tastteilern ist die zulässige Eingangswechsels-
pannung oberhalb von 20kHz frequenzabhängig begrenzt.
Deshalb muß die ,,Derating Curve” des betreffenden
Tastteilertyps beachtet werden.
Wichtig für die Aufzeichnung kleiner Signalspannungen ist die
Wahl des Massepunktes am Prüfobjekt. Er soll möglichst
immer nahe dem Meßpunkt liegen. Andernfalls können evtl.
vorhandene Ströme durch Masseleitungen oder Chassisteile
das Meßergebnis stark verfälschen. Besonders kritisch sind
auch die Massekabel von Tastteilern. Sie sollen so kurz und dick
wie möglich sein. Beim Anschluß des Tastteiler-Kopfes an eine
BNC-Buchse sollte ein BNC-Adapter benutzt werden, der oft
als Tastteiler-Zubehör mitgeliefert wird. Damit werden Masseund Anpassungsprobleme eliminiert.
Das Auftreten merklicher Brumm- oder Störspannungen im
Meßkreis (speziell bei einem kleinen Ablenkkoeffizienten) wird
möglicherweise durch Mehrfach-Erdung verursacht, weil dadurch Ausgleichströme in den Abschirmungen der Meßkabel
fließen können (Spannungsabfall zwischen den Schutzleiterverbindungen, verursacht von angeschlossenen fremden Netzgeräten, z.B. Signalgeneratoren mit Störschutzkondensatoren).
Bedienelemente
Zur besseren Verfolgung der Bedienungshinweise ist das am
Ende der Anleitung befindliche Frontbild zu beachten.
Die Frontplatte ist, wie bei allen HAMEG-Oszilloskopen üblich,
entsprechend den verschiedenen Funktionen in Felder aufgeteilt. Oben rechts neben dem Bildschirm befindet sich der NetzTastenschalter (POWER) mit Symbolen für die Ein- (I) und AusStellung (O) und die Netz-Anzeige (LED). Daneben sind die
beiden Drehknöpfe für Helligkeit (INTENS.) und Schärfe (FOCUS)
angebracht. Die mit TRACE ROTATION (Strahldrehung) bezeichnete Öffnung (für Schraubendreher) dient zur Strahldrehung.
Im mittleren und unteren Feld befinden sich:
Die Vertikalverstärkereingänge für Kanal I (CHI = Channel I) und
Kanal II (CHII = Channel II) mit den zugehörigen Eingangskopplungsschaltern DC-AC sowie GD und den Stellknöpfen
für die Y-Position (Y-POS. = vertikale Strahllage) beider Kanäle.
Ferner kann Kanal II mit seiner INV.-Taste invertiert (umgepolt)
werden. Zur Empfindlichkeitseinstellung der beiden Vertikalverstärker dienen die in VOLTS/DIV. kalibrierten Teilerschalter.
Die dort aufgesetzten kleinen Pfeilknöpfe rasten am Rechtsanschlag in Kalibrationsstellung CAL. ein und verringern die
Empfindlichkeit bei maximaler Linksdrehung mehr als 2,5fach.
So ist jede Empfindlichkeits-Zwischenstellung wählbar. Jedem
Teilerschalter ist eine Drucktaste (Y-MAG. x5) zugeordnet.
Wird die Taste eingerastet, erhöht sich die Empfindlichkeit in
jeder Teilerschalterstellung um den Faktor 5. Unterhalb der
Teilerschalter befinden sich drei Tasten für die BetriebsartUmschaltung der Vertikalverstärker. Sie werden nachstehend
noch näher beschrieben.
Rechts davon sind die Einstellelemente für Zeitablenkung
(TIME/DIV.) und Triggerung angeordnet. Sie werden nachstehend im einzelnen erläutert. Mit dem TIME/DIV.-Zeitbasis-
schalter werden die Zeitkoeffizienten in der Folge 1-2-5 gewählt. Zwischenwerte sind mit dem dort aufgesetzten kleinen
Pfeilknopf einstellbar. Er rastet am Rechtsanschlag in der
Kalibrationsstellung ein. Linksdrehung vergrößert den Zeitkoeffizienten 2,5fach. Wird die Taste X-MAG. x10 eingerastet,
wird der Zeitkoeffizient um den Faktor 10 verringert.
Zur Triggerung gehören:
- AT/NM-Taste zur Umschaltung von automatischer auf
Normaltriggerung,
Änderungen vorbehalten
11
Page 12

Inbetriebnahme und Voreinstellungen
- LEVEL-Knopf zur Triggerpegeleinstellung,
- SLOPE-Taste (/ \) zur Wahl der Triggerflankenrichtung,
- TRIG. MODE- (Trigger) Kopplungsschalter
AC-DC-LF und TV,
- ALT-Taste zur Wahl der alternierenden Triggerung von Kanal
I und Kanal II im alternierenden DUAL-Betrieb (immer in
Verbindung mit automatischer Triggerung).
- ~ (Netztriggerung) wenn die AT/NM- und die ALT-Taste
gedrückt sind (Netztriggerung immer mit Normaltriggerung
kombiniert),
- TR-LED (leuchtet bei einsetzender Triggerung).
- TRIG. EXT.-Taste zur Umschaltung von interner auf externe
Triggerung und die zugehörige BNC-Buchse für das Anlegen
einer Spannung zur externen Triggerung.
Ferner finden sich hier die Stellknöpfe für die X-Position (X-
POS. = horizontale Strahllage) und die Holdoff-Zeit (HOLD OFF
= Sperrzeit der Triggerung zwischen zwei aufeinanderfolgenden Sägezahn-Starts). Mit der XY-Taste kann vom Zeitbasisbetrieb (Yt) auf den X-Y-Betrieb des HM303-6 umgeschaltet
werden.
Direkt unter dem Bildschirm befindet sich links die
Kalibratorfrequenz-Taste CAL., mit der die Frequenz des
Kalibratorsignals von ca. 1kHz auf ca. 1MHz umgeschaltet
werden kann. Daneben liegt die Ausgangsbuchse für den
Kalibrator 0.2Vpp zum Abgleich von Tastteilern 10:1. Rechts
sind die Buchsen für den COMPONENT TESTER mit der
zugehörigen Drucktaste ON (Ein)/ OFF (Aus) angeordnet.
Pfeilen in ihre kalibrierte Stellung CAL. einzurasten. Die
auf den Knopfkappen angebrachten Striche sollen etwa
senkrecht nach oben zeigen (Mitte des Einstellbereiches).
Der TRIG. MODE-Schalter sollte in der obersten Stellung
(AC) stehen.
Mit der roten Netztaste POWER wird das Gerät in Betrieb
gesetzt. Der Betriebszustand wird durch Aufleuchten einer
LED angezeigt. Wird nach ca. 20 Sekunden Anheizzeit kein
Strahl sichtbar, ist möglicherweise der INTENS.-Einsteller nicht
genügend aufgedreht, bzw. der Zeitbasis-Generator wird nicht
ausgelöst. Außerdem können auch die POS.-Einsteller verstellt sein. Es ist dann nochmals zu kontrollieren, ob entsprechend den Hinweisen alle Knöpfe und Tasten in den richtigen
Positionen stehen. Dabei ist besonders auf die Taste AT/NM
zu achten. Ohne angelegte Meßspannung wird die Zeitlinie nur
dann sichtbar, wenn sich diese Taste ungedrückt in der AT-
Stellung (Automatische Triggerung) befindet. Erscheint nur ein
Punkt (Vorsicht, Einbrenngefahr!), ist wahrscheinlich die Taste
XY gedrückt. Sie ist dann auszulösen. Ist die Zeitlinie sichtbar,
wird am INTENS-Knopf eine mittlere Helligkeit und am Knopf
FOCUS die maximale Schärfe eingestellt. Dabei sollte sich die
Eingangskopplungs-Drucktaste GD (CH.I) in Raststellung GD
(ground = Masse) befinden. Der Eingang ist dann aufgetrennt,
damit eventuell am Eingang anliegende Signalspannungen
unbelastet bleiben; denn der sonst mit dem Eingang verbundene Vertikalverstärker wird kurzgeschlossen. Damit ist sichergestellt, daß keine Störspannungen von außen die Fokussierung
beeinflussen können.
Alle Details sind so ausgelegt, daß auch bei Fehlbedienung kein
größerer Schaden entstehen kann. Die Drucktasten besitzen
im wesentlichen nur Nebenfunktionen. Man sollte daher bei
Beginn der Arbeiten darauf achten, daß keine der Tasten
eingedrückt ist. Die Anwendung richtet sich nach dem jeweiligen Bedarfsfall.
Der HM303-6 erfaßt alle Signale von Gleichspannung bis zu
einer Frequenz von mindestens 35MHz (-3dB). Bei
sinusförmigen Vorgängen liegt die -6dB Grenze sogar bei
50MHz. Die zeitliche Auflösung ist unproblematisch.
Beispielsweise wird bei ca. 50MHz und der kürzesten einstellbaren Ablenkzeit (10ns/cm) alle 2cm ein Kurvenzug geschrieben. Die Toleranz der angezeigten Werte beträgt in beiden
Ablenkrichtungen nur ±3%. Alle zu messenden Größen sind
daher relativ genau zu bestimmen. Jedoch ist zu berücksichtigen, daß sich in vertikaler Richtung ab ca. 10MHz der Meßfehler in Y-Richtung mit steigender Frequenz ständig vergrößert.
Dies ist durch den Verstärkungsabfall des Meßverstärkers
bedingt. Bei 18MHz beträgt der Abfall etwa 10%. Man muß
daher bei dieser Frequenz zum gemessenen Spannungswert
ca. 11% addieren. Da jedoch die Bandbreiten der Vertikalverstärker differieren (normalerweise zwischen 35 und 38MHz),
sind die Meßwerte in den oberen Grenzbereichen nicht so
exakt definierbar. Hinzu kommt, daß oberhalb 35MHz mit
steigender Frequenz auch die Aussteuerbarkeit der Y-Endstufe
stetig abnimmt. Der Vertikalverstärker ist so ausgelegt, daß die
Übertragungsgüte nicht durch eigenes Überschwingen beeinflußt wird.
Inbetriebnahme und Voreinstellungen
Vor der ersten Inbetriebnahme muß die Verbindung
zwischen Schutzleiteranschluß und dem Netz-Schutzleiter vor jeglichen anderen Verbindungen hergestellt
sein (Netzstecker also vorher anschließen).
Es wird empfohlen, bei Beginn der Arbeiten keine der
Tasten zu drücken und die 3 Bedienungsknöpfe mit
Zur Schonung der Strahlröhre sollte immer nur mit jener Strahlintensität gearbeitet werden, die Meßaufgabe und Umgebungsbeleuchtung gerade erfordern. Besondere Vorsicht ist bei
stehendem, punktförmigen Strahl geboten. Zu hell eingestellt, kann dieser die Leuchtschicht der Röhre beschädigen.
Ferner schadet es der Kathode der Strahlröhre, wenn das
Oszilloskop oft kurz hintereinander aus- und eingeschaltet
wird.
Strahldrehung TRACE ROTATION
Trotz Mumetall-Abschirmung der Bildröhre lassen sich
erdmagnetische Einwirkungen auf die horizontale Strahllage nicht ganz vermeiden. Das ist abhängig von der
Aufstellrichtung des Oszilloskops am Arbeitsplatz. Dann
verläuft die horizontale Strahllinie in Schirmmitte nicht
exakt parallel zu den Rasterlinien. Die Korrektur weniger Winkelgrade ist an einem Potentiometer hinter der
mit TRACE ROTATION bezeichneten Öffnung mit einem
kleinen Schraubendreher möglich.
Tastkopf-Abgleich und Anwendung
Damit der verwendete Tastteiler die Form des Signals unverfälscht wiedergibt, muß er genau an die Eingangsimpedanz des
Vertikalverstärkers angepaßt werden. Ein im HM303-6 eingebauter Generator liefert hierzu ein Rechtecksignal mit sehr
kurzer Anstiegszeit (<4ns am 0,2Vpp Ausgang) und Frequenzen von ca. 1kHz oder 1MHz. Das Rechtecksignal kann der
konzentrischen Buchsen unterhalb des Bildschirms entnommen werden. Die Buchse liefert 0.2Vss ±1% für Tastteiler
10:1. Diese Spannung entspricht einer Bildschirmamplitude
von 4cm Höhe, wenn der Eingangsteilerschalter auf den Ablenkkoeffizienten 5mV/cm eingestellt ist. Der Innendurchmesser der Buchsen beträgt 4,9mm und entspricht dem (an
Bezugspotential liegenden) Außendurchmesser des Abschirmrohres von modernen Tastköpfen der Serie F (international
vereinheitlicht). Nur hierdurch ist eine extrem kurze Masseverbindung möglich, die für hohe Signalfrequenzen und eine
unverfälschte Kurvenform-Wiedergabe von nicht-sinusförmigen
Signalen Voraussetzung ist.
12
Änderungen vorbehalten
Page 13

Betriebsarten der Vertikalverstärker
Abgleich 1kHz
Dieser C-Trimmerabgleich (NF-Kompensation) kompensiert die
kapazitive Belastung des Oszilloskop-Eingangs. Durch den
Abgleich bekommt die kapazitive Teilung dasselbe Teilerverhältnis wie die ohmsche Spannungsteilung. Dann ergibt
sich bei hohen und niedrigen Frequenzen dieselbe Spannungsteilung wie für Gleichspannung. Für Tastköpfe 1:1 oder auf 1:1
umgeschaltete Tastköpfe ist dieser Abgleich weder nötig noch
möglich. Voraussetzung für den Abgleich ist die Parallelität der
Strahllinie mit den horizontalen Rasterlinien (
drehung TRACE ROTATION“
Tastteiler 10:1 an den INPUT CH I-Eingang anschließen, keine
Taste drücken, Eingangskopplung auf DC stellen, Eingangsteiler auf 5mV/cm und TIME/DIV.-Schalter auf 0.2ms/cm
schalten (beide Feinregler in Kalibrationsstellung CAL.), Tastkopf
in die CALIBRATOR-Buchse einstecken
Auf dem Bildschirm sind 2 Wellenzüge zu sehen. Nun ist der
NF-Kompensationstrimmer abzugleichen, dessen Lage der
Tastkopfinformation zu entnehmen ist. Mit dem beigegebenen
Isolierschraubendreher ist der Trimmer so abzugleichen, bis
die oberen Dächer des Rechtecksignals exakt parallel zu den
horizontalen Rasterlinien stehen (siehe Bild 1kHz). Dann sollte
die Signalhöhe 4cm ±1,2mm (= 3%) sein. Die Signalflanken
sind in dieser Einstellung unsichtbar.
).
siehe ,,Strahl-
Abgleich 1MHz
Ein HF-Abgleich ist bei den Tastköpfen HZ51, 52 und 54
möglich. Diese besitzen Entzerrungsglieder (R-Trimmer in Kombination mit Kondensatoren), mit denen es möglich ist, den
Tastkopf auf einfachste Weise im Bereich der oberen
Grenzfrequenz des Vertikalverstärkers optimal abzugleichen.
Nach diesem Abgleich erhält man nicht nur die maximal mögliche Bandbreite im Tastteilerbetrieb, sondern auch eine weitgehend konstante Gruppenlaufzeit am Bereichsende. Dadurch
werden Einschwingverzerrungen (wie Überschwingen, Abrundung, Nachschwingen, Löcher oder Höcker im Dach) in der
Nähe der Anstiegsflanke auf ein Minimum begrenzt. Die Bandbreite des Oszilloskops wird also bei Benutzung der Tastköpfe
HZ51, 52 und 54 ohne Inkaufnahme von Kurvenformverzerrungen voll genutzt. Voraussetzung für diesen HF-Abgleich ist ein Rechteckgenerator mit kleiner Anstiegszeit (typisch 4ns) und niederohmigem Ausgang (ca. 50Ω), der bei einer
Frequenz von 1MHz eine Spannung von 0,2Vss abgibt. Der
Kalibratorausgang des HM303-6 erfüllt diese Bedingungen,
wenn die CAL.-Taste gedrückt ist (1MHz).
Tastköpfe des Typs HZ51, 52 oder 54 an den INPUT CH IEingang anschließen, nur Kalibrator-Taste 1MHz drücken,
Eingangskopplung auf DC, Eingangsteiler auf 5mV/cm und
TIME/DIV.-Schalter auf 0.1µs/cm stellen (beide Feinregler in
Kalibrationsstellung CAL.). Tastkopf in Buchse 0.2Vpp einstek-
ken. Auf dem Bildschirm ist ein Wellenzug zu sehen, dessen
Rechteckflanken jetzt auch sichtbar sind. Nun wird der HFAbgleich durchgeführt. Dabei sollte man die Anstiegsflanke
und die obere linke Impuls-Dachecke beachten.
Auch die Lage der Abgleichelemente für die HF-Kompensation
ist der Tastkopfinformation zu entnehmen.
Die Kriterien für den HF-Abgleich sind:
– Kurze Anstiegszeit, also eine steile Anstiegsflanke.
– Minimales Überschwingen mit möglichst geradlinigem Dach,
somit ein linearer Frequenzgang.
Die HF-Kompensation sollte so vorgenommen werden, daß
der Übergang von der Anstiegsflanke auf das Rechteckdach
weder zu stark verrundet noch mit Überschwingen erfolgt.
Tastköpfe mit einem HF-Abgleichpunkt sind, im Gegensatz zu
Tastköpfen mit mehreren Abgleichpunkten, naturgemäß einfacher abzugleichen. Dafür bieten mehrere HF-Abgleichpunkte
den Vorteil, daß sie eine optimalere Anpassung zulassen.
Nach beendetem HF-Abgleich ist auch bei 1MHz die Signalhöhe am Bildschirm zu kontrollieren. Sie soll denselben Wert
haben wie oben beim 1kHz-Abgleich angegeben.
Es wird darauf hingewiesen, daß die Reihenfolge erst 1kHz-,
dann 1MHz-Abgleich einzuhalten ist, aber nicht wiederholt
werden muß, und daß die Kalibrator-Frequenzen 1kHz und
1MHz nicht zur Zeit-Eichung verwendet werden können. Ferner weicht das Tastverhältnis vom Wert 1:1 ab. Voraussetzung
für einen einfachen und exakten Tastteilerabgleich (oder eine
Ablenkkoeffizientenkontrolle) sind horizontale Impulsdächer,
kalibrierte Impulshöhe und Nullpotential am negativen Impulsdach. Frequenz und Tastverhältnis sind dabei nicht kritisch.
Betriebsarten der Vertikalverstärker
Die gewünschte Betriebsart der Vertikalverstärker wird mit
den 3 unterhalb der Teilerschalter befindlichen Tasten gewählt.
Für Mono-Betrieb werden alle Tasten ausgerastet. Dann ist nur
Kanal I betriebsbereit.
Bei Mono-Betrieb mit Kanal II ist die Taste CH I/II zu drücken.
Diese Taste trägt zusätzlich die Bezeichnung TRIG. I/II, weil
damit gleichzeitig die Kanalumschaltung der Triggerung erfolgt.
Wird die Taste DUAL gedrückt, arbeiten beide Kanäle. Bei
dieser Tastenstellung erfolgt die Aufzeichnung zweier Vorgänge nacheinander (alternate mode). Die Signalbilder aus
beiden Kanälen werden zwar nur abwechselnd einzeln dargestellt, sind aber bei schneller Zeitablenkung scheinbar beide gleichzeitig sichtbar. Für das Oszilloskopieren langsam
verlaufender Vorgänge mit Zeitkoeffizienten ³1ms/cm ist diese Betriebsart nicht geeignet. Das Schirmbild flimmert dann
zu stark, oder es scheint zu springen. Drückt man noch die
Taste CHOP., werden beide Kanäle innerhalb einer Ablenkperiode mit einer hohen Frequenz ständig umgeschaltet (chop
mode). Auch langsam verlaufende Vorgänge werden dann
flimmerfrei aufgezeichnet. Für Oszillogramme mit höherer
Folgefrequenz ist diese Art der Kanalumschaltung nicht sinnvoll.
Ist nur die Taste ADD gedrückt, werden die Signale beider
Kanäle algebraisch addiert (I ±II). Ob sich hierbei die Summe
oder die Differenz der Signalspannungen ergibt, hängt von der
Phasenlage bzw. Polung der Signale selbst und von der Stellung der INV. (invertieren) -Taste ab.
Änderungen vorbehalten
13
Page 14

Betriebsarten der Vertikalverstärker
Gleichphasige Eingangsspannungen:
INV.-Taste ungedrückt = Summe.
INV.-Taste gedrückt = Differenz.
Gegenphasige Eingangsspannungen:
INV.-Taste ungedrückt = Differenz.
INV.-Taste gedrückt = Summe.
In der ADD-Betriebsart ist die vertikale Strahllage von der YPOS.-Einstellung beider Kanäle abhängig. Das heißt die Y.POS.-
Einstellung wird addiert, kann aber nicht mit INV. (invertieren)
beeinflußt werden.
Signalspannungen zwischen zwei hochliegenden Schaltungspunkten werden oft im Differenzbetrieb beider Kanäle gemessen. Als Spannungsabfall an einem bekannten Widerstand
lassen sich so auch Ströme zwischen zwei hochliegenden
Schaltungsteilen bestimmen. Allgemein gilt, daß bei der Darstellung von Differenzsignalen die Entnahme der beiden Signalspannungen nur mit Tastteilern absolut gleicher Impedanz und
Teilung erfolgen darf. Für manche Differenzmessungen ist es
vorteilhaft, die galvanisch mit dem Schutzleiter verbundenen
Massekabel beider Tastteiler nicht mit dem Meßobjekt zu
verbinden. Hierdurch können eventuelle Brumm- oder
Gleichtaktstörungen verringert werden.
XY-Betrieb
Für XY-Betrieb wird die Taste XY betätigt. Das X-Signal wird
über den Eingang von Kanal I zugeführt. Eingangsteiler und
Feinregler von Kanal I werden im XY-Betrieb für die
Amplitudeneinstellung in X-Richtung benutzt. Zur horizon-
talen Positionseinstellung ist aber der X-POS.-Regler zu benutzen. Der Y-Positionsregler von Kanal I ist im XY-Betrieb abgeschaltet. Max. Empfindlichkeit und Eingangsimpedanz sind
nun in beiden Ablenkrichtungen gleich. Die X-MAG. (x10)
Funktion ist im XY-Betrieb abgeschaltet. Die Grenzfrequenz in
X-Richtung ist ≥2,5 MHz (-3dB). Jedoch ist zu beachten, daß
schon ab 50 kHz zwischen X und Y eine merkliche, nach
höheren Frequenzen ständig zunehmende Phasendifferenz
auftritt. Eine Umpolung des Y-Signals mit der INV.-Taste von
Kanal II ist möglich!
Der XY-Betrieb mit Lissajous-Figuren erleichtert oder er-
möglicht gewisse Meßaufgaben:
- Vergleich zweier Signale unterschiedlicher Frequenz oder
Nachziehen der einen Frequenz auf die Frequenz des anderen Signals bis zur Synchronisation. Das gilt auch noch für
ganzzahlige Vielfache oder Teile der einen Signalfrequenz.
- Phasenvergleich zwischen zwei Signalen gleicher Frequenz.
Phasenvergleich mit Lissajous-Figur
Die folgenden Bilder zeigen zwei Sinus-Signale gleicher Frequenz und Amplitude mit unterschiedlichen Phasenwinkeln.
Die Berechnung des Phasenwinkels oder der Phasenverschiebung zwischen den X- und Y-Eingangsspannungen
(nach Messung der Strecken a und b am Bildschirm) ist mit den
folgenden Formeln und einem Taschenrechner mit Winkelfunktionen ganz einfach, und übrigens unabhängig von den
Ablenkamplituden auf dem Bildschirm, durchzuführen.
Hierbei muß beachtet werden:
- Wegen der Periodizität der Winkelfunktionen sollte die
rechnerische Auswertung auf Winkel ≤90° begrenzt werden. Gerade hier liegen die Vorteile der Methode.
- Keine zu hohe Meßfrequenz benutzen. Oberhalb 220kHz
kann die gegenseitige Phasenverschiebung der beiden
Oszilloskop-Verstärker des HM303-6 im XY-Betrieb einen
Winkel von 3° überschreiten.
- Aus dem Schirmbild ist nicht ohne weiteres ersichtlich, ob
die Testspannung gegenüber der Bezugsspannung voroder nacheilt. Hier kann ein CR-Glied vor dem Testspannungseingang des Oszilloskops helfen. Als R kann gleich der
1MΩ-Eingangswiderstand dienen, so daß nur ein passender Kondensator C vorzuschalten ist. Vergrößert sich die
Öffnungsweite der Ellipse (gegenüber kurzgeschlossenem
C), dann eilt die Testspannung vor und umgekehrt. Das gilt
aber nur im Bereich bis 90° Phasenverschiebung. Deshalb
sollte C genügend groß sein und nur eine relativ kleine,
gerade gut beobachtbare Phasenverschiebung bewirken.
Falls im XY-Betrieb beide Eingangsspannungen fehlen oder
ausfallen, wird ein sehr heller Leuchtpunkt auf dem Bildschirm abgebildet. Bei zu hoher Helligkeitseinstellung (INTENSKnopf) kann dieser Punkt in die Leuchtschicht einbrennen,
was entweder einen bleibenden Helligkeitsverlust oder, im
Extremfall, eine vollständige Zerstörung der Leuchtschicht an
diesem Punkt verursacht.
Phasendifferenz-Messung
im Zweikanal-Betrieb
Eine größere Phasendifferenz zwischen zwei Eingangssignalen gleicher Frequenz und Form läßt sich sehr einfach
im Zweikanalbetrieb (Taste DUAL gedrückt) am Bildschirm
messen. Die Zeitablenkung wird dabei von dem Signal
getriggert, das als Bezug (Phasenlage 0) dient. Das andere
Signal kann dann einen vor- oder nacheilenden Phasenwinkel haben. Für Frequenzen ≥1kHz wird alternierende
Kanalumschaltung gewählt; für Frequenzen <1kHz ist der
Chopper-Betrieb geeigneter (weniger Flackern). Die Ablesegenauigkeit wird hoch, wenn auf dem Schirm nicht viel mehr
als eine Periode und etwa gleiche Bildhöhe beider Signale
eingestellt wird. Zu dieser Einstellung können ohne Einfluß
auf das Ergebnis auch die Feinregler für Amplitude und
Zeitablenkung und der LEVEL-Knopf benutzt werden. Beide
Zeitlinien werden vor der Messung mit den Y-POS.-Knöpfen
auf die horizontale Raster-Mittellinie eingestellt. Bei
sinusförmigen Signalen beobachtet man die Nulldurchgänge;
die Sinuskuppen sind weniger geeignet. Ist ein Sinussignal
durch geradzahlige Harmonische merklich verzerrt (Halbwellen nicht spiegelbildlich zur X-Achse) oder wenn eine
Offset-Gleichspannung vorhanden ist, empfiehlt sich AC-
Kopplung für beide Kanäle. Handelt es sich um Impulssignale
gleicher Form, liest man an steilen Flanken ab.
14
Änderungen vorbehalten
Page 15

Triggerung und Zeitablenkung
Phasendifferenzmessung im Zweikanalbetrieb
t = Horizontalabstand der Nulldurchgänge in cm.
T = Horizontalabstand für eine Periode in cm.
Im Bildbeispiel ist t = 3cm und T = 10cm. Daraus errechnet sich
eine Phasendifferenz in Winkelgraden von
oder in Bogengrad ausgedrückt
tor oder einem Demodulator) extern getriggert werden). Interne Triggerung ist unter Zuhilfenahme des Zeit-Feinstellers oft
möglich.
Figur 2
Amplitudenmodulierte Schwingung: F = 1MHz; f = 1kHz;
m = 50%; UT = 28,3mVeff.
Oszilloskop-Einstellung für ein Signal entsprechend Figur 2:
Keine Taste drücken. Y: CH I; 20mV/cm; AC.
TIME/DIV.: 0.2ms/cm.
Triggerung: NM (NORMAL); AC; int. mit Zeit-Feinsteller (oder
externe Triggerung).
Liest man die beiden Werte a und b vom Bildschirm ab, so
errechnet sich der Modulationsgrad aus
Relativ kleine Phasenwinkel bei nicht zu hohen Frequenzen
lassen sich genauer im XY-Betrieb mit Lissajous-Figur messen.
Messung einer Amplitudenmodulation
Die momentane Amplitude u im Zeitpunkt t einer HF-Trägerspannung, die durch eine sinusförmige NF-Spannung unverzerrt
amplitudenmoduliert ist, folgt der Gleichung
Hierin ist
UT = unmodulierte Trägeramplitude,
ΩΩ
ππ
Ω = 2
πF = Träger-Kreisfrequenz,
ΩΩ
ππ
ωω
ππ
ω = 2
πf = Modulationskreisfrequenz,
ωω
ππ
m = Modulationsgrad (i.a. ≤ 1 100%).
Neben der Trägerfrequenz F entstehen durch die Modulation
die untere Seitenfrequenz F-f und die obere Seitenfrequenz
F+f.
Figur 1
Spektrumsamplituden und -frequenzen bei AM (m = 50%)
Das Bild der amplitudenmodulierten HF-Schwingung kann mit
dem Oszilloskop sichtbar gemacht und ausgewertet werden,
wenn das Frequenzspektrum innerhalb der Oszilloskop-Bandbreite liegt. Die Zeitbasis wird so eingestellt, daß mehrere
Wellenzüge der Modulationsfrequenz sichtbar sind. Genau
genommen sollte mit Modulationsfrequenz (vom NF-Genera-
Hierin ist a = UT (1+m) und b = UT (1-m).
Bei der Modulationsgradmessung können die Feinstellknöpfe
für Amplitude und Zeit beliebig verstellt sein. Ihre Stellung geht
nicht in das Ergebnis ein.
Triggerung und Zeitablenkung
Die zeitliche Änderung einer zu messenden Spannung (Wechselspannung) ist im Yt-Betrieb darstellbar. Hierbei lenkt das
Meßsignal den Elektronenstrahl in Y-Richtung ab, während der
Zeitablenkgenerator den Elektronenstrahl mit einer konstanten, aber wählbaren Geschwindigkeit von links nach rechts
über den Bildschirm bewegt (Zeitablenkung).
Im allgemeinen werden sich periodisch wiederholende
Spannungsverläufe mit sich periodisch wiederholender Zeitablenkung dargestellt. Um eine „stehende“ auswertbare Darstellung zu erhalten, darf der jeweils nächste Start der Zeitablenkung nur dann erfolgen, wenn die gleiche Position (Spannungshöhe und Flankenrichtung) des Signalverlaufes vorliegt,
an dem die Zeitablenkung auch zuvor ausgelöst (getriggert)
wurde. Eine Gleichspannung kann folglich nicht getriggert
werden, was aber auch nicht erforderlich ist, da eine zeitliche
Änderung nicht erfolgt.
Die Triggerung kann durch das Meßsignal selbst (interne
Triggerung) oder durch eine extern zugeführte, mit dem
Meßsignal synchrone, Spannung erfolgen (externe Triggerung).
Die Triggerspannung muß eine gewisse Mindestamplitude
haben, damit die Triggerung überhaupt einsetzt. Diesen Wert
nennt man Triggerschwelle. Sie wird mit einem Sinussignal
bestimmt. Wird die Triggerspannung intern dem Meßsignal
entnommen, kann als Triggerschwelle die vertikale Bildschirm-
höhe in mm angegeben werden, bei der die Triggerung gerade
einsetzt, das Signalbild stabil steht und die TR-LED zu leuchten
beginnt. Die interne Triggerschwelle beim HM303-6 ist mit
≤5mm spezifiziert. Wird die Triggerspannung extern zugeführt,
Änderungen vorbehalten
15
Page 16

Triggerung und Zeitablenkung
ist sie an der TRIG. EXT.-Buchse in Vss zu messen. In gewissen
Grenzen kann die Triggerspannung viel höher sein als an der
Triggerschwelle. Im allgemeinen sollte der 20fache Wert
nicht überschritten werden.
Der HM303-6 hat zwei Trigger-Betriebsarten, die nachstehend
beschrieben werden.
Automatische Spitzenwert-Triggerung
Steht die Taste AT/NM ungedrückt in Stellung AT (Automatic
Triggering), wird die Zeitablenkung auch dann periodisch ausgelöst, wenn keine Meßwechselspannung oder externe
Triggerwechselspannung anliegt. Ohne Meßwechselspannung
sieht man dann eine Zeitlinie (von der ungetriggerten, also
freilaufenden Zeitablenkung), die auch eine Gleichspannung
anzeigen kann.
Bei anliegender Meßspannung beschränkt sich die Bedienung
im wesentlichen auf die richtige Amplituden- und ZeitbasisEinstellung bei immer sichtbarem Strahl. Der LEVEL-Einsteller
ist bei automatischer Spitzenwert-Triggerung wirksam. Der
LEVEL-Einstellbereich stellt sich automatisch auf die SpitzeSpitze-Amplitude des gerade angelegten Signals ein und wird
damit unabhängiger von der Signal-Amplitude und -Form. Beispielsweise darf sich das Tastverhältnis von rechteckförmigen
Spannungen zwischen 1 : 1 und 100 : 1 ändern, ohne daß die
Triggerung ausfällt.
Signale sind der Zeit-Feinstellknopf und die HOLDOFF-Zeit-
einstellung, die weiter unten besprochen wird.
Flankenrichtung
Die Triggerung kann bei automatischer und bei Normaltriggerung durch eine steigende oder eine fallende
Triggerspannungsflanke ausgelöst werden. Die Flankenrichtung ist mit der Taste SLOPE wählbar. Das / -Symbol
(ungedrückte Taste) bedeutet eine Flanke, die vom negativen
Potential kommend zum positiven Potential ansteigt. Das hat
mit Null- oder Massepotential und absoluten Spannungswerten nichts zu tun. Die positive Flankenrichtung kann auch
im negativen Teil einer Signalkurve liegen. Eine fallende
Flanke ( \ -Symbol) löst die Triggerung sinngemäß aus, wenn
die Taste SLOPE gedrückt ist. Dies gilt bei automatischer und
bei Normaltriggerung.
Triggerkopplung
Die Ankopplungsart und der Durchlaß-Frequenzbereich des
Triggersignals kann am TRIG. MODE-Umschalter gewählt
werden.
AC: Triggerbereich <20Hz bis 100MHz.
Dies ist die am häufigsten zum Triggern benutzte Kopplungsart. Unterhalb 20Hz und oberhalb 100MHz steigt die
Triggerschwelle zunehmend an.
Es ist dabei unter Umständen erforderlich, daß der LEVEL-
Einsteller fast an den Anschlag zu stellen ist. Bei der nächsten
Messung kann es erforderlich werden, den LEVEL-Einsteller
auf die Bereichsmitte zu stellen.
Diese Einfachheit der Bedienung empfiehlt die automatische
Spitzenwert-Triggerung für alle unkomplizierten Meßaufgaben.
Sie ist aber auch die geeignete Betriebsart für den „Einstieg“
bei diffizilen Meßproblemen, nämlich dann, wenn das Meßsignal
selbst in Bezug auf Amplitude, Frequenz oder Form noch
weitgehend unbekannt ist.
Mit automatischer Spitzenwert-Triggerung werden alle Parameter voreingestellt, dann kann der Übergang auf Normaltriggerung erfolgen.
Die automatische Spitzenwert-Triggerung ist unabhängig von
der Triggerquelle und ist sowohl bei interner wie auch externer
Triggerung anwendbar. Sie arbeitet oberhalb 20Hz.
In Kombination mit alternierender Triggerung (Taste ALT. gedrückt) wird die Spitzenwerterfassung abgeschaltet, während
die Triggerautomatik erhalten bleibt. Der LEVEL-Einsteller ist
dann unwirksam (Triggerpunkt 0 Volt).
Normaltriggerung
Mit Normaltriggerung (gedrückte Taste AT/NM) und passender LEVEL-Einstellung kann die Auslösung, bzw. Triggerung
der Zeitablenkung an jeder Stelle einer Signalflanke erfolgen.
Der mit dem LEVEL-Knopf erfaßbare Triggerbereich ist stark
abhängig von der Amplitude des Triggersignals. Ist bei interner
Triggerung die Bildhöhe kleiner als 1cm, erfordert die Einstellung wegen des kleinen Fangbereichs etwas Feingefühl.
Bei falscher LEVEL-Einstellung ist der Bildschirm dunkel.
Mit Normaltriggerung sind auch komplizierte Signale triggerbar.
Bei Signalgemischen ist die Triggermöglichkeit abhängig von
gewissen periodisch wiederkehrenden Pegelwerten, die u.U.
erst bei gefühlvollem Drehen des LEVEL-Knopfes gefunden
werden. Weitere Hilfsmittel zur Triggerung sehr schwieriger
DC: Triggerbereich 0 bis 100MHz.
DC-Triggerung ist dann zu empfehlen, wenn bei ganz langsamen Vorgängen auf einen bestimmten Pegelwert des
Meßsignals getriggert werden soll oder wenn impulsartige
Signale mit sich während der Beobachtung ständig ändernden Tastverhältnissen dargestellt werden müssen.
Bei interner DC- oder LF-Triggerkopplung sollte immer
mit Normaltriggerung und LEVEL-Einstellung gearbeitet werden.
LF: Triggerbereich 0 bis 1,5kHz (Tiefpaß).
Die LF-Stellung ist häufig für niederfrequente Signale besser geeignet als die DC-Stellung, weil Rauschgrößen innerhalb der Triggerspannung stark unterdrückt werden. Das
vermeidet oder verringert im Grenzfall Jittern oder Doppelschreiben, insbesondere bei sehr kleinen Eingangsspannungen. Oberhalb 1,5kHz steigt die Triggerschwelle
zunehmend an.
TV (Videosignal-Triggerung)
Steht der TRIG. MODE-Umschalter in Stellung TV, wird der
TV-Synchronimpuls-Separator wirksam. Er trennt die
Synchronimpulse vom Bildinhalt und ermöglicht eine von
Bildinhaltänderungen unabhängige Triggerung von Videosignalen.
Abhängig vom Meßpunkt, sind Videosignale (FBAS- bzw. BASSignale = Farb-Bild-Austast-Synchron-Signale) als positiv oder
negativ gerichtetes Signal zu messen. Nur bei richtiger Einstellung der SLOPE-Taste (
Bildinhalt getrennt. Die Flankenrichtung der Vorderflanke
der Synchronimpulse ist für die Einstellung der SLOPE-Taste
maßgebend; dabei darf die Invertierungs-Taste (INV.) nicht
gedrückt sein. Ist die Spannung der Synchronimpulse am
Meßpunkt positiver als der Bildinhalt, muß sich die SLOPE-
Taste in Stellung / (ungedrückt) befinden. Befinden sich die
Synchronimpulse unterhalb des Bildinhalts, ist deren Vorderflanke fallend (negativ). Dann muß sich die SLOPE-Taste in
Stellung \ (gedrückt) befinden. Bei falscher Flankenrichtungswahl erfolgt die Darstellung unstabil bzw. ungetriggert, da dann
der Bildinhalt die Triggerung auslöst.
) werden die Synchronimpulse vom
16
Änderungen vorbehalten
Page 17

Triggerung und Zeitablenkung
Die Videosignaltriggerung muß im Automatikbetrieb erfolgen. Bei interner Triggerung muß die Signalhöhe der Synchronimpulse mindestens 5mm betragen. Bei gedrückter AT/NM-
Taste kann die Videotriggerung nicht korrekt arbeiten.
Das Synchronsignal besteht aus Zeilen- und Bildsynchronimpulsen, die sich unter anderem auch durch ihre Pulsdauer
unterscheiden. Sie beträgt bei Zeilensynchronimpulsen ca. 5µs
von 64µs für eine Zeile. Bildsynchronimpulse bestehen aus
mehreren Pulsen, die jeweils ca. 28µs lang sind und mit jedem
Halbbildwechsel im Abstand von 20ms vorkommen. Beide
Synchronimpulsarten unterscheiden sich somit durch ihre Zeitdauer und durch ihre Wiederholfrequenz. Es kann sowohl mit
Zeilen- als auch mit Bildsynchronimpulsen getriggert werden.
Die Umschaltung zwischen Bild- und Zeilen-SynchronimpulsTriggerung erfolgt bei TV-Triggerung automatisch durch den
TIME/DIV.-Schalter.
In den Stellungen von .2s/div. bis 1ms/div. erfolgt die
Triggerung auf Bildsynchronimpulse.
Im Bereich von .5ms/div. bis .1µs/div wird mit den Zeilen-
synchronimpulsen getriggert.
Bildsynchronimpuls-Triggerung
Es ist ein dem Meßzweck entsprechender Zeitkoeffizient am
TIME/DIV.-Schalter zu wählen. In der 2ms/div.-Stellung wird
ein vollständiges Halbbild dargestellt. Am linken Bildrand ist
der auslösende Bildsynchronimpuls und am rechten Bildschirmrand der, aus mehreren Pulsen bestehende, Bildsynchronimpuls für das nächste Halbbild zu sehen. Das nächste Halbbild wird unter diesen Bedingungen nicht dargestellt.
Der diesem Halbbild folgende Bildsynchronimpuls löst erneut
die Triggerung und die Darstellung aus. Bei Linksanschlag des
HOLD OFF-Einstellers wird unter diesen Bedingungen jedes 2.
Halbbild angezeigt. Auf welches Halbbild getriggert wird, unterliegt dem Zufall. Durch kurzzeitiges Unterbrechen der
Triggerung (z.B. TRIG. EXT. ein- und ausrasten) kann auch
zufällig auf das andere Halbbild getriggert werden. Eine XDehnung der Darstellung kann durch Drücken der X-MAG. x10
-Taste erreicht werden; damit werden einzelne Zeilen erkennbar. Vom Bildsynchronimpuls ausgehend kann eine XDehnung auch mit dem TIME/DIV.-Knopf vorgenommen werden, in dem dieser bis zur 1ms/div.-Stellung nach rechts
gedreht wird. Allerdings ergibt sich dadurch eine scheinbar
ungetriggerte Darstellung, weil dann jedes Halbbild zu sehen
ist. Dies ist durch den Versatz der Zeilensynchronimpulse
bedingt, der zwischen den beiden Halbbildern eine halbe Zeilenlänge beträgt.
Zeilensynchronimpuls-Triggerung
Zur Zeilentriggerung muß sich der TIME/DIV.-Schalter im
Bereich von .5ms/div. bis .1µs/div. befinden. Um einzelne
Zeilen darstellen zu können, ist die TIME/DIV.-Schalterstellung
von 10µs/div. empfehlenswert. Es werden dann ca. 1½
Zeilen sichtbar.
Im allgemeinen hat das komplette Videosignal einen starken
Gleichspannungsanteil. Bei konstantem Bildinhalt (z.B. Testbild oder Farbbalkengenerator) kann der Gleichspannungsanteil ohne weiteres durch AC-Eingangskopplung des Oszilloskop-Verstärkers unterdrückt werden. Bei wechselndem
Bildinhalt (z.B. normales Programm) empfiehlt sich aber DC-
Eingangskopplung, weil das Signalbild sonst mit jeder Bildinhaltänderung die vertikale Lage auf dem Bildschirm ändert.
Mit dem Y-POS.-Knopf kann der Gleichspannungsanteil immer so kompensiert werden, daß das Signalbild in der
Bildschirmrasterfläche liegt. Das komplette Videosignal sollte bei DC-Kopplung eine vertikale Höhe von 6cm nicht überschreiten.
Die Sync-Separator-Schaltung wirkt ebenso bei externer
Triggerung. Selbstverständlich muß der Spannungsbereich
(0,3Vss bis 3Vss) für die externe Triggerung eingehalten
werden. Ferner ist auf die richtige Flankenrichtung zu achten,
die ja bei externer Triggerung nicht mit der Richtung des
Signal-Synchronimpulses übereinstimmen muß. Beides kann
leicht kontrolliert werden, wenn die externe Triggerspannung
selbst erst einmal (bei interner Triggerung) dargestellt wird.
Netztriggerung
Zur Triggerung mit Netzfrequenz müssen die Tasten AT/NM
und ALT eingerastet (gedrückt) sein (~ -Symbol). Dann wird eine
Spannung aus dem Netzteil als netzfrequentes Triggersignal (50/
60Hz) genutzt und es liegt Normaltriggerung vor.
Diese Triggerart ist unabhängig von Amplitude und Frequenz
des Y-Signals und empfiehlt sich für alle Signale, die netzsynchron sind. Dies gilt ebenfalls in gewissen Grenzen für
ganzzahlige Vielfache oder Teile der Netzfrequenz. Die
Netztriggerung erlaubt eine Signaldarstellung auch unterhalb
der Triggerschwelle. Sie ist deshalb u.a. besonders geeignet
zur Messung kleiner Brummspannungen von Netzgleichrichtern oder netzfrequenten Einstreuungen in eine Schaltung.
Mit der SLOPE-Taste wird bei Netztriggerung nicht zwischen
steigender oder fallender Flanke, sondern zwischen der positiven und der negativen Halbwelle gewählt (evtl. Netzstecker
umpolen). Die automatisch vorgegebene Normaltriggerung
ermöglicht es, den Triggerpunkt mit dem LEVEL-Einsteller über
einen gewissen Bereich der gewählten Halbwelle zu verschieben.
Netzfrequente magnetische Einstreuungen in eine Schaltung
können mit einer Spulensonde nach Richtung (Ort) und Amplitude untersucht werden. Die Spule sollte zweckmäßig mit
möglichst vielen Windungen dünnen Lackdrahtes auf einen
kleinen Spulenkörper gewickelt und über ein geschirmtes
Kabel an einen BNC-Stecker (für den Oszilloskop-Eingang)
angeschlossen werden. Zwischen Stecker- und Kabel-Innenleiter ist ein kleiner Widerstand von mindestens 100Ω einzubauen (Hochfrequenz-Entkopplung). Es kann zweckmäßig sein,
auch die Spule außen statisch abzuschirmen, wobei keine
Kurzschlußwindungen auftreten dürfen. Durch Drehen der
Spule in zwei Achsrichtungen lassen sich Maximum und Minimum am Meßort feststellen.
Alternierende Triggerung
Mit alternierender Triggerung (Taste ALT gedrückt) kann nur
bei alternierendem DUAL-Betrieb auch von beiden Kanälen
gleichzeitig intern getriggert werden. Die beiden Signalfrequenzen können dabei zueinander asynchron sein; allerdings kann die Phasendifferenz nicht mehr ermittelt werden.
Zur Vermeidung von Triggerproblemen, bedingt durch Gleichspannungsanteile, ist AC-Eingangskopplung für beide Kanäle
empfehlenswert.
Die interne Triggerquelle wird bei alternierender Triggerung
entsprechend der alternierenden Kanalumschaltung nach jedem Zeitablenkvorgang umgeschaltet. Daher muß die Amplitude beider Signale für die Triggerung ausreichen.
Mit der Umschaltung auf alternierende Triggerung wird die
Spitzenwerterfassung bei automatischer Triggerung (AT) abgeschaltet. Der Triggerpunkt beträgt dann 0 Volt und der
LEVEL-Einsteller ist wirkungslos. Normaltriggerung wird in
Änderungen vorbehalten
17
Page 18

Triggerung und Zeitablenkung Komponenten-Test
Verbindung mit alternierender Triggerung nicht ermöglicht. Bei gedrückter AT/NM - und ALT- Taste liegt
Netztriggerung (~) vor.
Externe Triggerung
Durch Drücken der Taste EXT. wird die interne Triggerung
abgeschaltet. Über die BNC-Buchse TRIG. EXT. kann jetzt
extern getriggert werden, wenn dafür eine Spannung von
0,3Vss bis 3Vss zur Verfügung steht, die synchron zum
Meßsignal ist. Diese Triggerspannung darf durchaus eine völlig
andere Kurvenform als das Meßsignal haben. Die Triggerung
ist in gewissen Grenzen sogar mit ganzzahligen Vielfachen
oder Teilen der Meßfrequenz möglich; Phasenstarrheit ist
allerdings Bedingung. Es ist aber zu beachten, daß Meßsignal
und Triggerspannung trotzdem einen Phasenwinkel aufweisen
können. Ein Phasenwinkel von z.B. 180° wirkt sich dann so aus,
daß trotz ungedrückter SLOPE-Taste (steigende Flanke löst die
Triggerung aus) die Darstellung des Meßsignals mit einer
negativen Flanke beginnt.
Auch bei externer Triggerung wird die Triggerspannung über die
Triggerkopplung geführt. Der einzige Unterschied zur internen
Triggerung besteht darin, daß die Ankopplung der Triggerspannung über einen Kondensator erfolgt. Damit beträgt bei
allen Triggerkopplungsarten die untere Grenzfrequenz ca. 20Hz.
Die Eingangsimpedanz der Buchse TRIG. EXT. liegt bei etwa
100kΩ II 10pF. Die maximale Eingangsspannung ist 100V
(DC+Spitze AC).
auslösen. Besonders bei Burst-Signalen oder aperiodischen
Impulsfolgen gleicher Amplitude kann der Beginn der
Triggerphase dann auf den jeweils günstigsten oder erforderlichen Zeitpunkt eingestellt werden.
Ein stark verrauschtes oder ein durch eine höhere Frequenz gestörtes Signal wird manchmal doppelt dargestellt. Unter Umständen läßt sich mit der LEVEL-Einstellung nur die gegenseitige Phasenverschiebung beeinflussen, aber nicht die Doppeldarstellung. Die zur Auswertung erforderliche stabile Einzeldarstellung des Signals ist aber durch die Vergrößerung der HOLD OFFZeit leicht zu erreichen. Hierzu ist der HOLD OFF-Knopf
langsam nach rechts zu drehen, bis nur noch ein Signal
abgebildet wird.
Eine Doppeldarstellung ist bei gewissen Impulssignalen möglich, bei denen die Impulse abwechselnd eine kleine Differenz
der Spitzenamplituden aufweisen. Nur eine ganz genaue LEVEL-
Einstellung ermöglicht die Einzeldarstellung. Der Gebrauch des
HOLD OFF-Knopfes vereinfacht auch hier die richtige Einstellung.
Nach Beendigung dieser Arbeit sollte der HOLD OFF-Knopf
unbedingt wieder auf Linksanschlag zurückgedreht werden,
weil sonst u.U. die Bildhelligkeit drastisch reduziert ist. Die
Arbeitsweise ist aus folgenden Abbildungen ersichtlich.
Triggeranzeige
Die der SLOPE-Taste zugeordnete mit TR bezeichnete LED
leuchtet sowohl bei automatischer als auch bei Normaltriggerung
auf, wenn folgende Bedingungen erfüllt werden:
1. Das interne bzw. externe Triggersignal muß in ausreichender Amplitude am Triggerkomparator anliegen.
2. Die Referenzspannung am Komparator (Triggerpunkt) muß
auf einen Wert eingestellt sein, der es erlaubt, daß Signalflanken den Triggerpunkt unter- und überschreiten.
Dann stehen Triggerimpulse am Komparatorausgang für den
Start der Zeitbasis und für die Triggeranzeige zur Verfügung.
Die Triggeranzeige erleichtert die Einstellung und Kontrolle der
Triggerbedingungen, insbesondere bei sehr niederfrequenten
(Normaltriggerung verwenden) oder sehr kurzen impulsförmigen Signalen.
Die triggerauslösenden Impulse werden durch die Triggeranzeige ca. 100ms lang gespeichert und angezeigt. Bei Signalen mit extrem langsamer Wiederholrate ist daher das Aufleuchten der LED mehr oder weniger impulsartig. Außerdem
blitzt dann die Anzeige nicht nur beim Start der Zeitablenkung
am linken Bildschirmrand auf, sondern - bei Darstellung mehrerer Kurvenzüge auf dem Schirm - bei jedem Kurvenzug.
Holdoff-Zeiteinstellung
Wenn bei äußerst komplizierten Signalgemischen auch nach
mehrmaligem gefühlvollen Durchdrehen des LEVEL-Knopfes
bei Normaltriggerung kein stabiler Triggerpunkt gefunden
wird, kann in vielen Fällen der Bildstand durch Betätigung des
HOLD OFF-Knopfes erreicht werden.
Mit dieser Einrichtung kann die Sperrzeit der Triggerung
zwischen zwei Zeit-Ablenkperioden im Verhältnis von ca. 10:1
kontinuierlich vergrößert werden. Triggerimpulse die innerhalb
dieser Sperrzeit auftreten, können den Start der Zeitbasis nicht
Abb. 1 zeigt das Schirmbild bei Linksanschlag des HOLD-OFF-Ein-
stellknopfes (Grundstellung). Da verschiedene Teile des Kurvenzuges angezeigt werden, wird kein stehendes Bild dargestellt
(Doppelschreiben).
Abb. 2 Hier ist die Hold-off-Zeit so eingestellt, daß immer die gleichen
Teile des Kurvenzuges angezeigt werden. Es wird ein stehendes Bild dargestellt.
Komponenten-Test
Der HM303-6 hat einen eingebauten Komponenten-Tester, der
durch Drücken der COMP. TESTER-Taste sofort betriebsbereit
ist. Der zweipolige Anschluß des zu prüfenden Bauelementes
erfolgt über die zugeordneten Buchsen (rechts unter dem Bildschirm). Bei gedrückter COMP. TESTER-Taste (ON) sind sowohl
die Y-Vorverstärker wie auch der Zeitbasisgenerator abgeschaltet.
Jedoch dürfen Signalspannungen an den drei Front-BNC-Buchsen weiter anliegen, wenn einzelne nicht in Schaltungen befindliche Bauteile (Einzelbauteile) getestet werden. Nur in diesem
Fall müssen die Zuleitungen zu den BNC-Buchsen nicht gelöst
werden (siehe ,,Tests direkt in der Schaltung”). Außer den
18
Änderungen vorbehalten
Page 19

Komponententest
INTENS.-, FOCUS- und X-POS.-Einstellern sowie der X-MAG.-
Taste (darf nicht eingerastet sein) haben die übrigen
Oszilloskop-Einstellungen keinen Einfluß auf diesen Testbetrieb. Für die Verbindung des Testobjekts mit den COMP.
TESTER-Buchsen sind zwei einfache Meßschnüre mit 4mmBananensteckern erforderlich. Nach beendetem Test kann
durch Auslösen der COMP. TESTER-Taste der Oszilloskop-
Betrieb übergangslos fortgesetzt werden.
Wie im Abschnitt SICHERHEIT beschrieben, sind alle
Meßanschlüsse (bei einwandfreiem Betrieb) mit dem
Netzschutzleiter verbunden, also auch die COMP. TESTER-Buchsen. Für den Test von Einzelbauteilen (nicht
in Geräten bzw. Schaltungen befindlich) ist dies ohne
Belang, da diese Bauteile nicht mit dem Netzschutzleiter verbunden sein können.
Sollen Bauteile getestet werden die sich in Testschaltungen bzw. Geräten befinden, müssen die Schaltungen bzw. Geräte unter allen Umständen vorher stromlos gemacht werden. Soweit Netzbetrieb vorliegt ist
auch der Netzstecker des Testobjektes zu ziehen. Damit
wird sichergestellt, daß eine Verbindung zwischen
Oszilloskop und Testobjekt über den Schutzleiter vermieden wird. Sie hätte falsche Testergebnisse zur Folge.
Nur entladene Kondensatoren dürfen getestet werden!
eine Zweipol-Prüfung; deshalb kann z.B. die Verstärkung eines
Transistors nicht getestet werden, wohl aber die einzelnen
Übergänge B-C, B-E, C-E. Da der Teststrom nur einige mA
beträgt, können die einzelnen Zonen fast aller Halbleiter
zerstörungsfrei geprüft werden. Eine Bestimmung von Halbleiter-Durchbruch- und Sperrspannung > ca. 9V ist nicht möglich.
Das ist im allgemeinen kein Nachteil, da im Fehlerfall in der
Schaltung sowieso grobe Abweichungen auftreten, die eindeutige Hinweise auf das fehlerhafte Bauelement geben.
Recht genaue Ergebnisse erhält man beim Vergleich mit
sicher funktionsfähigen Bauelementen des gleichen Typs
und Wertes. Dies gilt insbesondere für Halbleiter. Man kann
damit z.B. den kathodenseitigen Anschluß einer Diode oder ZDiode mit unkenntlicher Bedruckung, die Unterscheidung eines p-n-p-Transistors vom komplementären n-p-n-Typ oder die
richtige Gehäuseanschlußfolge B-C-E eines unbekannten
Transistortyps schnell ermitteln.
Das Testprinzip ist von bestechender Einfachheit. Ein im
HM303-6 befindlicher Sinusgenerator erzeugt eine Sinusspannung, deren Frequenz 50Hz (±10%) beträgt. Sie speist
eine Reihenschaltung aus Prüfobjekt und eingebauten Widerstand. Die Sinusspannung wird zur Horizontalablenkung und
der Spannungsabfall am Widerstand zur Vertikalablenkung
benutzt.
Ist das Prüfobjekt eine reelle Größe (z.B. ein Widerstand), sind beide Ablenkspannungen phasengleich. Auf
dem Bildschirm wird ein mehr oder weniger schräger
Strich dargestellt. Ist das Prüfobjekt kurzgeschlossen,
steht der Strich senkrecht. Bei Unterbrechung oder
ohne Prüfobjekt zeigt sich eine waagerechte Linie. Die
Schrägstellung des Striches ist ein Maß für den
Widerstandswert.
Damit lassen sich ohmische Widerstände zwischen 20
ΩΩ
4,7k
Ω testen.
ΩΩ
Kondensatoren und Induktivitäten (Spulen, Drosseln, Trafowicklungen) bewirken eine Phasendifferenz zwischen Strom
und Spannung, also auch zwischen den Ablenkspannungen.
Das ergibt ellipsenförmige Bilder. Lage und Öffnungsweite
der Ellipse sind kennzeichnend für den Scheinwiderstandswert bei einer Frequenz von 50Hz. Kondensatoren werden
im Bereich 0,1µF bis 1000µF angezeigt.
Eine Ellipse mit horizontaler Längsachse bedeutet eine
hohe Impedanz (kleine Kapazität oder große Induktivität).
Eine Ellipse mit vertikaler Längsachse bedeutet niedrige
Impedanz (große Kapazität oder kleine Induktivität).
Eine Ellipse in Schräglage bedeutet einen relativ großen
Verlustwiderstand in Reihe mit dem Blindwiderstand.
ΩΩ
Ω und
ΩΩ
Zu beachten ist hier der Hinweis, daß die Anschlußumpolung
eines Halbleiters (Vertauschen von COMP. TESTER-Buchse
mit Masse-Buchse) eine Drehung des Testbilds um 180° um
den Rastermittelpunkt der Bildröhre bewirkt.
Wichtiger noch ist die einfache Gut-/Schlecht-Aussage über
Bauteile mit Unterbrechung oder Kurzschluß, die im ServiceBetrieb erfahrungsgemäß am häufigsten benötigt wird.
Die übliche Vorsicht gegenüber einzelnen MOS-Bauelementen in Bezug auf statische Aufladung oder Reibungselektrizität wird dringend angeraten. Brumm kann
auf dem Bildschirm sichtbar werden, wenn der Basisoder Gate-Anschluß eines einzelnen Transistors offen
ist, also gerade nicht getestet wird (Handempfindlichkeit).
Bei Halbleitern erkennt man die spannungsabhängigen
Kennlinienknicke beim Übergang vom leitenden in den nichtlei-
tenden Zustand. Soweit das spannungsmäßig möglich ist, werden Vorwärts- und Rückwärts-Charakteristik dargestellt
(z.B. bei einer Z-Diode unter ca. 9V). Es handelt sich immer um
Änderungen vorbehalten
Tests direkt in der Schaltung sind in vielen Fällen möglich,
aber nicht so eindeutig. Durch Parallelschaltung reeller und/
oder komplexer Größen - besonders wenn diese bei einer
Frequenz von 50Hz relativ niederohmig sind - ergeben sich
meistens große Unterschiede gegenüber Einzelbauteilen. Hat
19
Page 20

Komponententest
man oft mit Schaltungen gleicher Art zu arbeiten (Service),
dann hilft auch hier ein Vergleich mit einer funktionsfähigen
Schaltung. Dies geht sogar besonders schnell, weil die
Vergleichsschaltung gar nicht unter Strom gesetzt werden
muß (und darf!). Mit den Testkabeln sind einfach die identischen Meßpunktpaare nacheinander abzutasten und die Schirmbilder zu vergleichen. Unter Umständen enthält die Testschaltung selbst schon die Vergleichsschaltung, z.B. bei Stereo-Kanälen, Gegentaktbetrieb, symmetrischen Brückenschaltungen. In Zweifelsfällen kann ein Bauteilanschluß einseitig
abgelötet werden. Genau dieser Anschluß sollte dann mit der
COMP. TESTER-Prüfbuchse ohne Massezeichen verbunden
werden, weil sich damit die Brummeinstreuung verringert. Die
Prüfbuchse mit Massezeichen liegt an Oszilloskop-Masse und
ist deshalb brumm-unempfindlich.
Die Testbilder zeigen einige praktische Beispiele für die Anwendung des Komponenten-Testers.
20
Änderungen vorbehalten
Page 21

Inbetriebnahme und Voreinstellungen
Gerät an Netz anschließen, Netztaste (oben rechts neben Bildschirm) drücken.
Leuchtdiode zeigt Betriebszustand an.
Gehäuse, Chassis und Meßbuchsen-Massen sind mit dem Netzschutzleiter verbunden (Schutzklasse I).
Keine weitere Taste drücken. TRIG. MODE-Wahlschalter auf AC.
AT/NM-Taste nicht gedrückt. Eingangskopplungsschalter CHI auf GD.
Am Knopf INTENS mittlere Helligkeit einstellen.
Mit den Knöpfen Y-POS.I und X-POS. Zeitlinie auf Bildschirmmitte bringen.
Anschließend mit FOCUS-Knopf Zeitlinie scharf einstellen.
Betriebsart Vertikalverstärker
Kanal I: Tasten CHI/II, DUAL und ADD herausstehend.
Kanal II: Taste CHI/II gedrückt.
Kanal I und II: Taste DUAL gedrückt. Alternierende Kanalumschaltung: Taste ADD (CHOP.) nicht drücken.
Chopper-Kanalumschaltung: Taste ADD (CHOP.) drücken.
(Nur bei Signalen <1kHz oder Zeitkoeffizienten ≥1ms/cm mit gedrückter Taste ADD (CHOP.) arbeiten)
Kanäle I+II (Summe): Nur Taste ADD drücken.
Kanäle +I−II (Differenz): Taste ADD und die Taste INV. drücken.
Betriebsart Triggerung
Kurzanleitung HM303-6
Messung
Triggerart mit Taste AT/NM wählen:
AT = Automatische Spitzenwert-Triggerung >20Hz-100MHz (ungedrückt).
NM = Normaltriggerung (gedrückt).
Trigger-Flankenrichtung: mit Taste SLOPE wählen.
Interne Triggerung: Kanal wird mit Taste TRIG.I/II (CHI/II) gewählt.
Interne alternierende Triggerung: DUAL und Taste ALT. drücken. ADD (CHOP.) darf nicht gedrückt sein.
Externe Triggerung (autom. Triggerung): Taste TRIG. EXT. drücken; Synchron-Signal (0,3Vss - 3Vss) an
Buchse TRIG. EXT. legen.
Netztriggerung (Normaltriggerung): TRIG. MODE-Drucktasten AT/NM und ALT drücken ( ~ ).
Triggerkopplung mit TRIG. MODE-Wahlschalter AC - DC - LF - TV wählen. Frequenzbereiche der
Triggerkopplung:
AC: >10Hz bis 100MHz; DC: 0 bis 100MHz; LF: 0 bis 1,5kHz.
TV für Synchronimpulsabtrennung von Videosignalen
TIME/DIV.-Schalter von 0,5ms/div. bis 0,1µs/div. = Zeilensynchronimpulse
TIME/DIV.-Schalter von 0,2s/div. bis 1ms/div. = Bildsynchronimpulse
Dabei richtige Flankenrichtung mit Taste SLOPE wählen
(Synchronimpuls oben entspricht /, unten entspricht \).
Triggeranzeige beachten: TR LED oberhalb SLOPE-Taste.
Meßsignal den Vertikal-Eingangsbuchsen von CHI und/oder CHII zuführen.
Tastteiler vorher mit eingebautem CALIBRATOR -Signal abgleichen.
Meßsignal-Ankopplung auf AC oder DC schalten.
Mit Teilerschalter (VOLTS/DIV.) Signal auf gewünschte Bildhöhe einstellen.
Am TIME/DIV.-Schalter Zeitkoeffizienten wählen.
Triggerpunkt mit LEVEL-Knopf einstellen (bei Normaltriggerung).
Bei hoher Vertikalempfindlichkeit (1mV/div.), entspr. Meß-Freq./-Aufgabe, LF-Triggerfilter wählen.
Komplexe oder aperiodische Signale evtl. mit vergrößerter HOLD OFF-Zeit triggern.
Amplitudenmessung mit Y-Feinsteller auf Rechtsanschlag CAL.
Zeitmessung mit Zeit-Feinsteller auf Rechtsanschlag CAL.
X-Dehnung x10: Taste X-MAG. x10 drücken (bei XY unwirksam).
Externe Horizontalablenkung (
XY-Betrieb
) mit gedrückter Taste XY (X-Eingang: CHI).
Komponenten-Test
COMP. TESTER-Taste drücken. Bauteil zweipolig an COMP. TESTER-Buchsen anschließen.
Test in der Schaltung:
testenden Schaltung ziehen, Verbindungen mit HM303-6 lösen (Kabel, Tastteiler), X-MAG.-Taste ausrasten
(X1), dann erst testen.
Änderungen vorbehalten
Schaltung spannungsfrei und massefrei (erdfrei) machen. Netzstecker der zu
21
Page 22

Bedienungselemente HM303-6 (Kurzbeschreibung - Frontbild)
Element Funktion Element Funktion
POWER Netz Ein/Aus; Leuchtdiode zeigt
(Taste + LED-Anzeige) Betriebszustand an.
INTENS Helligkeitseinstellung
(Drehknopf) für den Kathodenstrahl
TRACE ROTATION Trace Rotation (Strahldrehung). Dient
Trimmpotentiometer zur Kompensation des Erdmagnet(Einstellung mit feldes. Der horizontale Strahl wird
Schraubenzieher) damit parallel zum Raster gestellt
FOCUS Schärfeeinstellung für den
(Drehknopf) Kathodenstrahl.
Y-POS. I Einstellung der vertikalen Position des
(Drehknopf) Strahles für Kanal I.
Y-MAG.x5 Erhöht die Y-Verstärkung von
(Drucktaste) Kanal I um den Faktor 5.
Y-MAG.x5 Erhöht die Y-Verstärkung von
(Drucktaste) Kanal II um den Faktor 5.
Y-POS. II Einstellung der vertikalen Position des
(Drehknopf) Strahles für Kanal II.
SLOPE
(Drucktaste) Taste nicht gedrückt: ansteigend,
Im XY-Betrieb außer Funktion.
(Maximal 1mV/cm).
(Maximal 1mV/cm).
Wahl der Triggerflanke.
Taste gedrückt: fallend.
DUAL Taste nicht gedrückt: Einkanalbetrieb.
(Drucktaste) Taste DUAL gedrückt: Zweikanalbetrieb
mit alternierender Umschaltung.
CHOP. DUAL und ADD gedrückt: Zweikanal-
betrieb mit Chopper-Umschaltung.
ADD ADD allein gedrückt: Algebr. Addition.
(Drucktaste) In Kombination mit INV. Taste:
Differenzbetrieb.
VOLTS/DIV. Eingangsteiler für Kanal II. Bestimmt
(12stufig. Drehschalter)die Y-Ablenkkoeffizienten in 1-2-5
Schritten und gibt den Umrechnungsfaktor an (V/div, mV/div).
VAR. Feineinstellung der Y-Amplitude
(Drehknopf) (Kanal II). Vermindert die Verstärkung
max. um den Faktor 2,5.
Kalibrierung am Rechtsanschlag
(Pfeil nach rechts zeigend).
TRIG. MODE Wahl der Triggerankopplung:
(Schiebeschalter) AC: 10Hz−100MHz.
AC-DC-LF-TV DC: 0−100MHz.
LF: 0−1,5kHz.
TV: Triggerung für Bild und Zeile.
AT/NM Taste nicht gedrückt: Zeitlinie auch
(Drucktaste) ohne Signal sichtbar, Triggerung autom.
Taste gedrückt: Zeitlinie nur mit Signal,
Normaltriggerung mit LEVEL
TR Anzeige leuchtet, wenn Zeitbasis
(LED-Anzeige) getriggert wird.
LEVEL Triggerpegel-Einstellung
(Drehknopf)
X-POS. Strahlverschiebung in
(Drehknopf) horizontaler Richtung
X-MAG. x10 Dehnung der X-Achse um den
(Drucktaste) Faktor 10. Max. Auflösung 10ns/div.
Im XY-Betrieb außer Funktion.
VOLTS/DIV. Eingangsteiler für Kanal I. Bestimmt
(12stufig. Drehschalter)die Y-Ablenkkoeffizienten in 1-2-5
Schritten und gibt den Umrechnungsfaktor an (V/div, mV/div).
VAR. Feineinstellung der Y-Amplitude
(Drehknopf) (Kanal I). Vermindert die Verstärkung
max. um den Faktor 2,5.
Kalibrierung am Rechtsanschlag
(Pfeil nach rechts zeigend).
CH I/II-TRIG. I/II Keine Taste gedrückt: Kanal I-Betrieb
(Drucktaste) und Triggerung von Kanal I.
Taste gedrückt: Kanal II-Betrieb
und Triggerung von Kanal II.
(Triggerumschaltung bei DUAL-Betr.).
~ AT/NM und ALT gedrückt:
Triggerung mit Netzfrequenz,
dabei Normaltriggerung.
ALT Die Triggerung wird im alternierenden
(Drucktaste) DUAL-Betrieb abwechselnd von
Kanal I und II ausgelöst.
HOLD OFF Verlängerung der Holdoff-Zeit
(Drehknopf) zwischen den Ablenkperioden.
Grundstellung = Linksanschlag.
TIME/DIV. Bestimmt Zeitkoeffizienten
(20stufiger (Zeitablenkgeschwindigkeit) der
Drehschalter) Zeitbasis von 0.2s/cm bis 0.1µs/cm.
Variable Feineinstellung der Zeitbasis.
Zeitbasiseinstellung Vermindert Zeitablenkgeschwindigkeit
(Drehknopf) max. 2,5fach (Linksanschlag).
Cal.-Stellung am Rechtsanschlag
(Pfeil nach rechts).
XY (Drucktaste) Umschaltung auf XY-Betrieb.
Zuführung der horiz. Ablenkspannung
über den Eingang von Kanal I.
Achtung! Bei fehlender Ablenkung Einbrenngefahr.
TRIG. EXT. Umschaltung auf externe Triggerung.
(Drucktaste) Signalzuführung über BNC-Buchse
TRIG. EXT.
22
Änderungen vorbehalten
Page 23

Element Funktion Element Funktion
INPUT CH I Signaleingang Kanal I und Eingang
(BNC-Buchse) für Horizontalablenkung im XY-Betrieb.
Eingangsimpedanz 1M II20pF.
AC
DC Taste für die Eingangssignalankopplung
(Drucktaste) von Kanal I.
Taste gedrückt: direkte Ankopplung;
Taste nicht gedrückt:
Ankopplung über einen Kondensator.
GD (Drucktaste) GD-Taste gedrückt:
Eingang vom Signal getrennt,
Verstärker an Masse geschaltet.
(4mm Buchse) Meßbezugspotentialanschluß,
galvanisch mit Netzschutzleiter verbunden.
INPUT CH II Signaleingang Kanal II.
(BNC-Buchse) Eingangsimpedanz 1M II20pF.
AC
DC (Drucktasten) Tasten für die Eingangssignal-
ankopplung von Kanal II.
Taste gedrückt: direkte Ankopplung;
Taste nicht gedrückt:
Ankopplung über einen Kondensator.
GD (Drucktaste) GD-Taste gedrückt:
Eingang vom Signal getrennt,
Verstärker an Masse geschaltet.
INV. Invertierung von Kanal II.
(Drucktaste) In Verbindung mit gedrückter ADD-
Taste = Differenzdarstellung.
TRIG. EXT. Eingang für externes Triggersignal.
(BNC-Buchse) Taste TRIG. EXT. gedrückt.
COMP. TESTER Einschaltung des Componenten(Drucktaste) Testers; ON = ein, OFF = aus.
X-MAG.-Taste ausgerastet
COMP. TESTER Anschluß der Testkabel
(4mm Buchsen) für den Componenten-Tester.
Linke Buchse galvanisch mit
Netzschutzleiter verbunden.
0.2Vpp Ausgang des Rechteck-Kalibrators
(Buchse) 0,2Vss.
CALIBRATOR Frequenz des Kalibrator-Ausgangs.
1kHz / 1MHz Taste nicht gedrückt: ca. 1kHz,
(Drucktaste) Taste gedrückt: ca. 1MHz.
Änderungen vorbehalten
23
Page 24

Oszilloskope
Spektrumanalysatoren
Netzgeräte
Modularsystem
Serie 8000
Steuerbare Messgeräte
Serie 8100
Händler
41-0303-06D0
www.hameg.com
Änderungen vorbehalten
41-0303-06D0 / 20012007-gw HAMEG Instruments GmbH
© HAMEG Instruments GmbH Industriestraße 6
A Rohde & Schwarz Company D-63533 Mainhausen
® registrierte Marke Tel +49 (0) 61 82 800-0
DQS-Zertifi kation: DIN EN ISO 9001:2000 Fax +49 (0) 61 82 800-100
Reg.-Nr.: 071040 QM sales@hameg.de
 Loading...
Loading...