Fisher STELLVENTIL-HANDBUCH (Control Valve Handbook) (German), STELLVENTIL-HANDBUCH(Control Valve Handbook) Manuals & Guides
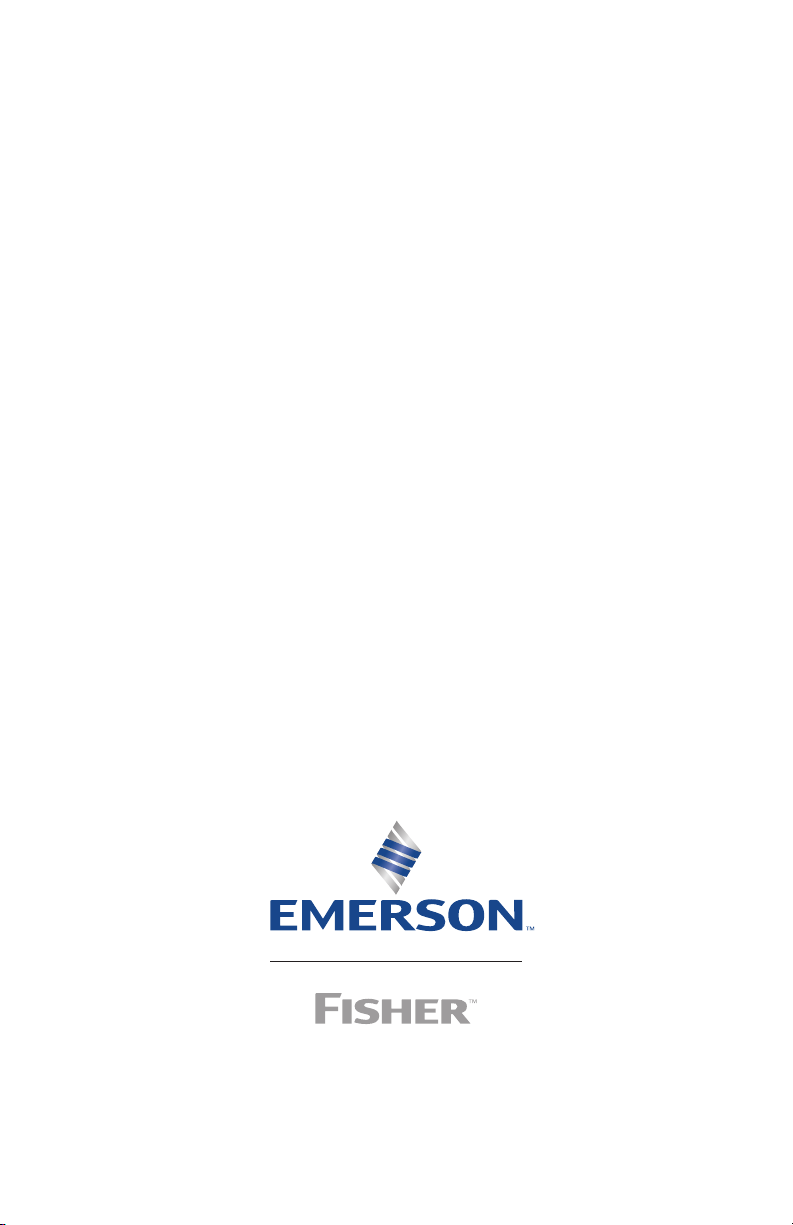
STELLVENTIL-
HANDBUCH
Fünfte Auage

Emerson Automation Solutions
Flow Controls
Marshalltown, Iowa 50158 USA
Sorocaba, 18087 Brasilien
Cernay, 68700 Frankreich
Dubai, Vereinigte Arabische Emirate
Singapur 128461 Singapur
Weder Emerson, Emerson Automation Solutions noch eines der angeschlossenen
Unternehmen übernehmen die Verantwortung für die Auswahl, Verwendung oder Wartung
eines der Produkte. Die Verantwortung für die richtige Auswahl, Verwendung und Wartung
eines Produktes oder die Nutzung eines Dienstes liegt ausschließlich beim Käufer und
Endbenutzer.
Die Inhalte dieser Veröffentlichung dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Obwohl alle
Anstrengungen unternommen wurden, um deren Richtigkeit sicherzustellen, dürfen sie weder
als ausdrückliche oder stillschweigende Garantien hinsichtlich der beschriebenen Produkte oder
Dienstleistungen oder deren Nutzung oder Anwendbarkeit angesehen werden. Alle Verkäufe
unterliegen unseren Gewährleistungsbedingungen und Konditionen, die auf Anfrage zur Verfügung
gestellt werden. Wie behalten uns das Recht vor, das Design und die Spezikationen solcher
Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, weiterzuentwickeln oder zu verbessern.
Fisher ist eine Marke im Eigentum eines der Unternehmen in der Geschäftseinheit Emerson
Automation Solutions von Emerson Electric Co. Emerson und das Emerson-Logo sind
Warenzeichen und Dienstleistungsmarken von Emerson Electric Co. Alle anderen Marken sind
das Eigentum der jeweiligen Besitzer.
© 2017, 2019 Fisher Controls International LLC. Alle Rechte vorbehalten.
D101881X012

Vorbemerkung
Stellventile werden in den modernen Fertigungsanlagen weltweit immer wichtiger. Sorgfältig
ausgewählte und gewartete Stellventile erhöhen nicht nur die Efzienz, sondern auch die
Wirtschaftlichkeit und verbessern die Sicherung und den Umweltschutz.
Dieses Stellventil-Handbuch ist seit seiner ersten Auage im Jahr 1965 eine wichtige Referenz.
Diese fünfte Ausgabe enthält wichtige Informationen über die Leistung von Stellventilen und
die neuesten Technologien.
Kapitel 1 bietet eine Einführung in Stellventile, einschließlich Denitionen für gängige
Stellventile und eine Übersicht der für die Instrumentierung verwendeten Terminologie.
Kapitel 2 enthält Informationen zum entscheidenden Thema der Leistung von Stellventilen.
Kapitel 3 behandelt die Bauformen von Stellventilen und Stellantrieben.
Kapitel 4 beschreibt digitale Stellungsregler, analoge Stellungsregler, Verstärker und anderes
Zubehör für Stellventile.
Kapitel 5 enthält eine umfassende Anleitung zur Auswahl des am besten für eine bestimmte
Anwendung geeigneten Stellventils.
Kapitel 6 behandelt die Auswahl und Verwendung von Stellventil-Sonderheiten.
Kapitel 7 erklärt Dampfkühler, Dampfaufbereitungsventile und Turbinen-Bypasssysteme.
Kapitel 8 beschreibt die typischen Installations- und Wartungsverfahren für Stellventile.
Kapitel 9 enthält Informationen zu den Stellventil-Normen und -Zulassungsstellen auf der
ganzen Welt.
Kapitel 10 beschreibt die verschiedenen Absperrventile und Stellantriebe.
Kapitel 11 behandelt die diskrete Automatisierung.
Kapitel 12 beschreibt die verschiedenen sicherheitsgerichteten Systeminstrumentierungen
(SIS).
Kapitel 13 enthält nützliche Tabellen mit technischen Referenzdaten.
Kapitel 14 enthält die Referenzdaten zu Rohrleitungen.
Kapitel 15 ist eine praktische Ressource für häug benutzte Umrechnungen.
Zusätzliche Ressourcen; hier wurden für Quellen zusammengestellt, die sich als nützlich
erweisen können, um über die Produkte von Fisher oder über die Prozessregelungsindustrie im
Allgemeinen informiert zu bleiben. Einen Link zu diesem Abschnitt nden Sie am Ende jedes
Kapitels.
Das Stellventil-Handbuch ist zugleich Lehrbuch und auch Referenz für das stärkste Glied
im Regelkreis: das Stellventil und sein Zubehör. Dieses Buch enthält umfangreiches Wissen
und bewährte Verfahren von führenden Experten auf dem Gebiet der Prozessregelung,
einschließlich Beiträgen der ISA.

Inhalt

Stellventil-Handbuch | Inhalt
Einführung in Stellventile ...................................................................... 14
1.1 Was ist ein Stellventil? .................................................................................15
1.2 Hubstellventil – Terminologie ...................................................................... 15
1.3 Drehstellventil – Terminologie ....................................................................21
1.4 Stellventil-Funktionen und -Eigenschaften – Terminologie ..........................23
1.5 Prozesssteuerung – Terminologie ................................................................25
Stellventile – Leistung ........................................................................... 32
2.1 Prozessvariabilität ....................................................................................... 33
2.1.1 Totzone ................................................................................................................... 35
2.1.1.1 Ursachen der Totzone .......................................................................................................35
2.1.1.2 Auswirkungen der Totzone ...............................................................................................36
2.1.1.3 Leistungsprüfungen .........................................................................................................36
2.1.1.4 Reibung ...........................................................................................................................36
2.1.2 Auslegung von Antrieb und Stellungsregler ............................................................... 37
2.1.3 Ansprechzeit der Armatur ......................................................................................... 38
2.1.3.1 Totzeit ..............................................................................................................................38
2.1.3.2 Dynamische Zeit ..............................................................................................................38
2.1.3.3 Lösungen .........................................................................................................................39
2.1.3.4 Versorgungsdruck ............................................................................................................40
2.1.3.5 Minimieren der Totzeit ......................................................................................................40
2.1.3.6 Ansprechzeit der Armatur .................................................................................................41
2.1.4 Armaturentyp und Kennlinien .................................................................................. 41
2.1.4.1 Durchusszunahme nach Installation ..............................................................................43
2.1.4.2 Regelkreisverstärkung ......................................................................................................43
2.1.4.3 Prozessoptimierung..........................................................................................................44
2.1.5 Nennweiten ............................................................................................................. 45
2.2 Wirtschaftliche Ergebnisse ..........................................................................46
2.3 Zusammenfassung ...................................................................................... 48
Armaturen und Stellantriebe – Bauformen ............................................ 50
3.1 Bauformen von Stellventilen ........................................................................ 51
3.1.1 Durchgangsventile ................................................................................................... 51
3.1.1.1 Einsitz-Ventilkörper...........................................................................................................51
3.1.1.2 Stangen- und sitzgeführte Ventilkörper .............................................................................52
3.1.1.3 Ventilkörper in Kägbauform ...........................................................................................52
3.1.1.4 Zweisitz-Ventilkörper ........................................................................................................53
3.1.1.5 Dreisitz-Ventilkörper .........................................................................................................53
3.1.2 Hygieneventil ........................................................................................................... 54
3.1.3 Drehventile .............................................................................................................. 54
3.1.3.1 Absperrklappen ................................................................................................................54
3.1.3.2 Kugelsegmentventile ........................................................................................................55
5

Stellventil-Handbuch | Inhalt
3.1.3.3 Hochleistungs-Absperrklappen .........................................................................................55
3.1.3.4 Kegelventil mit exzentrischem Kegel..................................................................................56
3.1.3.5 Kugelhahn mit vollem Durchgang ....................................................................................57
3.1.3.6 Mehrsitz-Durchusswahlarmatur .....................................................................................57
3.2 Stellventil-Endanschlüsse ............................................................................57
3.2.1 Rohrverschraubungen .............................................................................................. 57
3.2.2 Verschraubte Dichtungsansche .............................................................................. 58
3.2.3 Schweißenden ......................................................................................................... 58
3.2.4 Sonstige Endanschlüsse ........................................................................................... 59
3.3 Ventiloberteile ............................................................................................59
3.3.1 Verlängertes Oberteil ............................................................................................... 60
3.3.2 Faltenbalg-Oberteil .................................................................................................. 61
3.4 Stellventil-Packung .....................................................................................61
3.4.1 PTFE V-Ring .............................................................................................................. 62
3.4.2 Laminierte und Kohlefaden-Graphit-Ringe ................................................................ 62
3.4.3 U.S. Regulatorische Anforderungen für üchtige Emissionen .................................... 62
3.4.4 Globale Standards für üchtige Emissionen .............................................................. 63
3.4.5 Einzel-PTFE V-Ring-Packung ..................................................................................... 65
3.4.6 ENVIRO-SEAL PTFE-Packung ..................................................................................... 65
3.4.7 ENVIRO-SEAL Duplex-Packung ................................................................................. 67
3.4.8 ISO-Dichtung PTFE-PTFE-Packung............................................................................. 67
3.4.9 ENVIRO-SEAL Graphit-ULF ........................................................................................ 67
3.4.10 HIGH-SEAL Graphit-ULF .......................................................................................... 67
3.4.11 ISO-Dichtung Graphit-Packung .............................................................................. 67
3.4.12 ENVIRO-SEAL Graphit für Drehventile ..................................................................... 67
3.4.13 Graphitband für Drehventile................................................................................... 67
3.4.14 Auswahl eines Hubventil-Packungssystems in umweltbezogenen
Einsatzbereichen ............................................................................................................... 67
3.4.15 Auswahl eines Drehventil-Packungssystems in umweltbezogenen
Einsatzbereichen ............................................................................................................... 69
3.5 Kennlinien von käggeführten Ventilkörpern ..............................................69
3.6 Führung des Ventilkegels ............................................................................70
3.7 Stellventil-Innengarnitur mit eingeschränktem Durchuss ..........................70
3.8 Stellantriebe ................................................................................................ 71
3.8.1 Membranstellantriebe .............................................................................................. 71
3.8.2 Kolbenstellantriebe .................................................................................................. 72
3.8.4 Zahnstangen-Stellantriebe ....................................................................................... 73
3.8.5 Elektrische Stellantriebe............................................................................................ 73
Stellventile – Zubehör ........................................................................... 74
4.1 Umgebungs- und anwendungsbezogene Überlegungen ............................. 75
4.2 Stellungsregler ............................................................................................ 75
6

Stellventil-Handbuch | Inhalt
4.2.1 Pneumatische Stellungsregler................................................................................... 75
4.2.2 Analoge I/P-Stellungsregler ...................................................................................... 76
4.2.3 Digitale Stellungsregler ............................................................................................ 77
4.2.3.1 Diagnose ..........................................................................................................................77
4.2.3.2 Digitale Zwei-Wege-Kommunikation ................................................................................78
4.3 I/P-Wandler .................................................................................................78
4.4 Volumenverstärker ......................................................................................78
4.5 Sicherheitsgerichtete Systeminstrumentierungen (SIS) ...............................80
4.5.1 Teilstellwegtests ....................................................................................................... 80
4.6 Regler .........................................................................................................81
4.7 Stellungsrückmelder ...................................................................................83
4.8 Endlagenschalter ......................................................................................... 83
4.9 Magnetventil...............................................................................................83
4.10 Auslösesysteme ........................................................................................84
4.11 Handräder .................................................................................................84
Stellventile – Nennweiten ..................................................................... 86
5.1 Stellventil-Abmessungen ............................................................................88
5.1.1 Baulängen von Durchgangsventilen mit Flanschenden ............................................. 88
5.1.2 Einbaulängen für Durchgangsventile mit Schweißenden ........................................... 90
5.1.3 Einbaulängen für Durchgangsventile mit Einsteckschweißende ................................. 91
5.1.4 Einbaulängen für Durchgangsventile mit Schraubenden ........................................... 92
5.1.5 Länge Flanschäche bis Mittellinie für Durchgangs-Eckventile mit glatter
Dichtleiste ........................................................................................................................ 92
5.1.6 Einbaulängen für Durchgangsventile mit losem Flansch ........................................... 93
5.1.7 Einbaulängen für Drehventile mit Flanschenden und Flanschlos
(außer Absperrklappen)..................................................................................................... 93
5.1.8 Einbaulängen für Absperrklappen mit Monoansch (Flanschaugen) and Flanschlos
(Zwischenansch) ............................................................................................................. 94
5.1.9 Einbaulängen für Hochdruck-Absperrklappen mit exzentrischer Konstruktion ................................. 94
5.2 Sitzleckage-Einstufungen für Stellventile .....................................................95
5.3 Class VI Max. zulässige Sitzleckage ..............................................................96
5.4 Durchusskennlinien eines Stellventils ........................................................96
5.4.1 Durchusskennlinien ................................................................................................ 96
5.4.2 Auswahl der Durchusskennlinien ............................................................................ 97
5.5 Nennweiten ................................................................................................97
5.7 Gleichungskonstanten ................................................................................99
5.8 Auslegung von Ventilen für Flüssigkeiten ...................................................100
5.8.1 Bestimmen des Geometriefaktors der Rohrleitung (FP) und des Flüssigkeitsdruck-
Rückgewinnungsfaktors (FLP), angepasst an die Fittings ................................................... 100
5.8.2 Bestimmen des Differenzdrucks für die Auslegung (∆P
5.8.3 Berechnen des erforderlichen Durchusskoefzienten (Cv) ...................................... 101
) ................................. 101
Auslegung
7

Stellventil-Handbuch | Inhalt
5.8.4 Auslegung für Flüssigkeiten – Problembeispiel ........................................................ 102
5.9 Auslegung von Armaturen für kompressible Flüssigkeiten .........................104
5.9.1 Bestimmen des Geometriefaktors der Rohrleitungen (FP) und des Differenzdruck-
Verhältnisfaktors (xTP) bei gedrosseltem Durchuss mit angebrachten Fittings ................. 105
5.9.2 Bestimmen des Differenzdruckverhältnisses für die Auslegung (x
Expansionsfaktor (Y) ....................................................................................................... 105
5.9.3 Berechnen des Durchusskoefzienten (Cv)............................................................. 105
5.9.4 Auslegung für kompressible Flüssigkeiten – Problembeispiel 1 ................................. 106
5.9.5 Auslegung für kompressible Flüssigkeiten – Problembeispiel 2 ................................. 107
) und den
Auslegung
5.10 Repräsentative Auslegungskoefzienten .................................................109
5.10.1 Repräsentative Auslegungskoefzienten für einsitzige Durchgangsventile ......................... 109
5.10.2 Repräsentative Auslegungskoefzienten für Drehventile ....................................... 110
5.11 Auslegung von Stellantrieben ..................................................................111
5.11.1 Durchgangsventile ............................................................................................... 111
5.11.1.1 Nicht druckentlastete Kraft (A) .....................................................................................111
5.11.1.2 Kraft zur Bereitstellung einer Sitzanpresskraft (B)..........................................................112
5.11.1.3 Packungsreibung (C) ....................................................................................................112
5.11.1.4 Zusätzliche Kräfte (D) ..................................................................................................112
5.11.2 Berechnungen der Stellantriebskraft ..................................................................... 114
5.12 Auslegung von Stellantrieben für Drehventile ..........................................114
5.12.1 Drehmomentgleichungen .................................................................................... 114
5.12.2 Losbrechmoment ................................................................................................. 114
5.12.3 Dynamisches Moment ......................................................................................... 114
5.13 Typische Drehmomentfaktoren für Drehventile .......................................115
5.13.1 Drehmomentfaktoren für V-Schlitz-Kugelventil mit
Verbundmaterialdichtring ............................................................................................... 115
5.13.2
Drehmomentfaktoren für Hochleistungs-Absperrklappen mit Verbundmaterialdichtring
5.13.2.1 Maximaler Drehwinkel .................................................................................................115
5.14 Kavitation und Flashverdampfung ...........................................................116
5.14.1 Gedrosselter Durchuss verursacht Flashverdampfung und Kavitation .................. 116
5.14.2 Auswahl einer Armatur für einen Einsatzbereich mit Flashverdampfung ................ 117
5.14.3 Auswahl einer Armatur für einen Einsatzbereich mit Kavitation............................. 118
5.15 Vorhersage von aerodynamischen Geräuschen .......................................118
5.15.1 Aerodynamik ....................................................................................................... 118
5.15.2 Hydrodynamik ..................................................................................................... 120
5.16 Geräuschminderung ...............................................................................120
5.17 Geräuschminderung – Zusammenfassung ..............................................123
5.18 Packungsauswahl ....................................................................................124
5.18.1 Richtlinien zur Packungsauswahl für Hubventile ................................................... 125
5.18.2 Richtlinien zur Packungsauswahl für Drehventile .................................................. 126
5.19 Gehäusewerkstoffe .................................................................................127
5.19.1 Bezeichnungen für gängige Gehäusewerkstoffe .................................................... 129
. 115
8

Stellventil-Handbuch | Inhalt
5.20 Druck-/Temperaturstufen .......................................................................130
5.20.1 Druck-/Temperaturstufen für standardmäßige Class ASTM A216 Grade WCC
Gussventile ..................................................................................................................... 130
5.20.2 Druck-/Temperaturstufen für standardmäßige Class ASTM A217 Grade WC9
Gussventile ..................................................................................................................... 131
5.20.3 Druck-/Temperaturstufen für standardmäßige Class ASTM A351 Grade CF3
Gussventile ..................................................................................................................... 132
5.20.4 Druck-/Temperaturstufen für standardmäßige Class ASTM A351 Grades CF8M
und CG8M
(1)
Ventile ........................................................................................................ 133
5.21 Abkürzungen für nichtmetallische Werkstoffe.........................................135
5.22 Zerstörungsfreie Prüfverfahren ...............................................................135
5.22.1 Magnetpulverprüfung (Oberächenprüfung) ....................................................... 135
5.22.2 Flüssigkeitseindringprüfung (Oberächenprüfung) ............................................... 136
5.22.3 Radiographische Prüfung (volumetrische Untersuchung) ..................................... 136
5.22.4 Ultraschallprüfung (volumetrische Untersuchung) ............................................... 136
Stellventile – Sonderheiten ................................................................. 138
6.1 Hochleistungs-Stellventile .........................................................................139
6.2 Stellventile mit geringem Durchuss .........................................................140
6.3 Hochtemperatur-Stellventile .....................................................................140
6.4 Stellventile für den Tiefsttemperatur-Einsatz .............................................141
6.5 Kavitation und partikelbeladenen Medien ausgesetzte Ventile ..................141
6.6 Innengarnituren mit kundenspezischen Kennlinien, zur Geräuschdämpfung
und Kavitationsminderung .............................................................................142
6.7 Stellventile für den Einsatz in kerntechnischen Anlagen in den USA 142
6.8 Suld-Spannungsrissen unterliegende Ventile ...........................................143
6.8.1 Revisionen der NACE MR0175 vor 2003 .................................................................. 143
6.8.2 NACE MR0175/ISO 15156 ...................................................................................... 144
6.8.3 NACE MR0103 ....................................................................................................... 145
Dampfaufbereitung ............................................................................ 146
7.1 Funktionsweise der Heißdampfkühlung ....................................................147
7.1.1 Technische Aspekte der Heißdampfkühlung ............................................................ 147
7.2 Typische Ausführungen von Heißdampfkühlern ........................................150
7.2.1 Düsenanordnung mit fester Geometrie .................................................................. 150
7.2.2 Düsenanordnung mit variabler Geometrie.............................................................. 151
7.2.3 Monoblock-Ausführung ......................................................................................... 151
7.2.5 Geometrieunterstützte Zwischenanschausführung .............................................. 152
7.3 Wirkungsweise von Dampfaufbereitungsventilen......................................153
7.4 Dampfaufbereitungsventile ......................................................................153
7.4.1 Dampfkühler ......................................................................................................... 155
7.4.2 Dampfzerstäuber ................................................................................................... 155
9

Stellventil-Handbuch | Inhalt
7.6 Bauteile eines Turbinen-Bypasssystems .....................................................156
7.6.1 Turbine-Bypassventile ............................................................................................ 156
7.6.2 Turbine-Bypass-Wasserregelventile ......................................................................... 156
7.6.3 Betätigung ............................................................................................................. 157
Installation und Wartung .................................................................... 158
8.1 Korrekte Lagerung und Schutz ..................................................................159
8.2 Korrekte Installationstechniken .................................................................159
8.2.1 Lesen der Betriebsanleitung .................................................................................... 159
8.2.2 Sauberkeit der Rohrleitungen sicherstellen .............................................................. 159
8.2.4 Gute Verrohrungspraktiken verwenden................................................................... 160
8.2.5 Innengarnitur – Spülung/Wassertest/Anfahren ...................................................... 161
8.3 Stellventilwartung ..................................................................................... 161
8.3.1 Reaktive Wartung .................................................................................................. 162
8.3.2 Präventive Wartung ............................................................................................... 162
8.3.3 Prädiktive Wartung ................................................................................................ 162
8.3.4 Verwenden der Stellventil-Diagnose ........................................................................ 162
8.3.4.1 Instrumentenluftleckage ................................................................................................163
8.3.4.2 Versorgungsdruck ..........................................................................................................163
8.3.4.3 Stellwegabweichung und Relaiseinstellung .....................................................................163
8.3.4.4 Instrumentenluftqualität ................................................................................................164
8.3.4.5 Betriebsreibung und Reibungsneigung ............................................................................164
8.3.4.6 Weitere Beispiele ............................................................................................................164
8.3.5 Weiterentwicklungen in der Diagnostik .................................................................. 164
8.4 Wartung und Ersatzteile ............................................................................165
8.4.1 Empfohlene Ersatzteile ........................................................................................... 165
8.4.2 Verwenden von Teilen in Erstausrüsterqualität (Original Equipment Manufacturer,
OEM) .............................................................................................................................. 165
8.4.3 Nachrüstung der Innengarnitur .............................................................................. 165
8.5 Wartungsarbeiten am Antrieb ................................................................... 165
8.5.1 Feder/Membran-Stellantrieb ................................................................................... 165
8.5.2 Kolbenstellantriebe ................................................................................................ 166
8.5.3 Spindel- bzw. Schaltwellenpackung ........................................................................ 166
8.5.4 Sitzringe ................................................................................................................ 166
8.5.4.1 Austauschen der Sitzringe ..............................................................................................166
8.5.4.2 Verbindungen: Kegel-zu-Spindel, Kugel-zu-Schaltwelle und Klappenscheibe-zu-
Schaltwelle ....................................................................................................................167
8.5.5 Einstelldruckbereich ............................................................................................... 167
8.5.6 Ventilstellweg ........................................................................................................ 167
Normen und Zulassungen ................................................................... 168
9.1 Stellventil-Normen ....................................................................................169
10

Stellventil-Handbuch | Inhalt
9.1.1 American Petroleum Institute (API) ......................................................................... 169
9.1.2 American Society of Mechanical Engineers (ASME) ................................................. 169
9.1.3 Europäisches Komitee für Normung (Committee for Standardization, CEN) 169
9.1.3.1 Europäische Normen für Industriearmaturen ..................................................................169
9.1.3.2 Europäische Werkstoffnormen .......................................................................................170
9.1.3.3 Europäische Flanschnormen ...........................................................................................170
9.1.4 Fluid Controls Institute (FCI) ................................................................................... 170
9.1.5 Instrument Society of America (ISA) ....................................................................... 170
9.1.6 International Electrotechnical Commission (IEC) ..................................................... 171
9.1.7 Manufacturers Standardization Society (MSS) ........................................................ 171
9.1.8 NACE International ................................................................................................. 171
9.2 Produktzulassungen für explosionsgefährdete (klassizierte) Standorte .................172
9.2.1 Zulassungen und Denitionen für explosionsgefährdete Bereiche ........................... 172
9.3 Klassizierungssysteme .............................................................................172
9.3.1 Class/Division-System ............................................................................................ 172
9.3.2 Zonensystem ......................................................................................................... 173
9.3.3 Gerätegruppen ...................................................................................................... 174
9.3.4 Geräteuntergruppen .............................................................................................. 174
9.3.4.1 Gruppe II (allgemein als die „Gasgruppe“ bezeichnet) .....................................................174
9.3.4.2 Gruppe III (allgemein als die „Staubgruppe“ bezeichnet) .................................................174
9.3.5 Schutzart ............................................................................................................... 175
9.3.5.1 Elektrische Betriebsmittel ................................................................................................175
9.3.5.2 Nichtelektrische Betriebsmittel........................................................................................176
9.3.6 Schutzniveau ......................................................................................................... 177
9.3.7 Geräteschutzniveau (Equipment Protection Level, EPL) ........................................... 177
9.4 Temperaturklasse ...................................................................................... 178
9.5 Begriffsbestimmung .................................................................................179
9.5.1 Class/Division-System ............................................................................................ 179
9.5.2 Zonensystem ......................................................................................................... 179
9.5.3 Verdrahtungspraxis ................................................................................................ 179
9.5.4 Europäische Union (EU) – ATEX-Richtlinie 2014/34/EU ............................................ 180
9.6 Schutztechniken und -methoden ..............................................................181
9.6.1 Ex-Schutz oder druckfeste Kapselung ...................................................................... 181
9.6.2 Eigensichere Technik .............................................................................................. 181
9.6.3 Nicht-zündfähig- oder Zündschutzart-n-Technik ..................................................... 182
9.6.4 Erhöhte Sicherheit .................................................................................................. 182
9.6.5 Ex-Schutz Staub oder staubgeschützte Kapselung ................................................... 183
9.7 Gehäuseschutzarten .................................................................................183
Absperrventile .................................................................................... 186
10.1 Allgemeine Arten von Armaturen ............................................................187
10.1.1 Absperrschieber ................................................................................................... 187
11

Stellventil-Handbuch | Inhalt
10.1.2 Durchgangsventile ............................................................................................... 188
10.1.3 Rückschlagklappen .............................................................................................. 191
10.1.4 Bypassventile ....................................................................................................... 192
10.1.6 Quetschventile ..................................................................................................... 193
10.1.7 Kugelhähne ......................................................................................................... 194
10.1.8 Drosselklappen .................................................................................................... 194
10.1.9 Kegelventile ......................................................................................................... 195
Magnetventile .................................................................................... 210
11.1 Magnetventile .........................................................................................211
Sicherheitsgerichtete Systeminstrumentierungen (SIS) ...................... 214
12.1 Sicherheit und Schutzebenen ..................................................................215
12.2 Sicherheitsgerichtete Systeminstrumentierung (Safety Instrumented
Systems, SIS) ...................................................................................................216
12.3 Sicherheitsnormen ..................................................................................217
12.4 Sicherheits-Integritätslevel (Safety Integrity Level, SIL) ............................ 217
12.5 Ausfallwahrscheinlichkeit im Bedarfsfall ..................................................218
12.6 Stellglieder, Abnahmeprüfungen und Techniken zum Testen eines Teils des
Stellwegs ........................................................................................................219
12.7 Teilstellwegtest ....................................................................................... 219
12.8 Online-Testmethoden für das Stellglied ...................................................220
12.9 Verwendung von digitalen Stellungsreglern für eine Teilstellwegprüfung .............220
12.10 Hochintegriertes Druckschutzsystem (High-Integrity Pressure Protection
System, HIPPS) ...............................................................................................221
12.11 Funktionalität des HIPPS .......................................................................221
12.12 Testanforderungen ...............................................................................221
Technische Daten ............................................................................... 224
13.1 Standardspezikationen für drucktragende Armaturenwerkstoffe 225
13.2 Materialeigenschaften für Armaturen für drucktragende Komponenten 232
13.3 Physische Konstanten für Kohlenwasserstoffe .........................................234
13.4 Spezischer Wärmeverhältnisfaktor (k) ................................................... 237
13.5 Physische Konstanten von verschiedenen Flüssigkeiten ........................... 238
13.6 Kältemittel 717 (Ammoniak) Eigenschaften der Flüssigkeit und des
gesättigten Dampfes ......................................................................................240
13.7 Eigenschaften von Wasser ....................................................................... 247
13.8 Eigenschaften von gesättigtem Dampf....................................................248
13.9 Eigenschaften von überhitztem Dampf ...................................................257
Rohrleitungsdaten .............................................................................. 266
14.1 Leitungsanschluss ...................................................................................267
12

Stellventil-Handbuch | Inhalt
14.2 C- Stahl und Stahllegierung - Edelstahl .....................................................267
14.3 Amerikanische Rohrleitungsanschabmessungen ................................... 275
14.3.1 Lochkreis-Ø .......................................................................................................... 275
14.3.2 Verschiedene Stehbolzen und Durchmesser .......................................................... 276
14.3.3 Flanschdurchmesser ............................................................................................ 277
14.3.4 Flanschstärke für Flanschtting ............................................................................ 278
14.4 Standardwerte für Gussstahlansche ......................................................280
14.4.1 Standardwerte für Gussstahlansche für PN 10 .................................................... 280
14.4.2 Standardwerte für Gussstahlansche für PN 16 .................................................... 281
14.4.3 Standardwerte für Gussstahlansche für PN 25 .................................................... 282
14.4.4 Standardwerte für Gussstahlansche für PN 40 .................................................... 283
14.4.5 Standardwerte für Gussstahlansche für PN 63 .................................................... 284
14.4.6 Standardwerte für Gussstahlansche für PN 100 .................................................. 284
14.4.7 Standardwerte für Gussstahlansche für PN 160 .................................................. 285
14.4.8 Standardwerte für Gussstahlansche für PN 250 .................................................. 285
14.4.9 Standardwerte für Gussstahlansche für PN 320 .................................................. 286
14.4.10 Standardwerte für Gussstahlansche für PN 400 ................................................ 286
Umrechnungen und Äquivalente ........................................................ 288
15.1 Längenäquivalente ..................................................................................289
15.2 Ganze Zoll-Millimeter-Äquivalente .......................................................... 289
15.3 Gebrochene Zoll-Millimeter-Äquivalente ................................................. 290
15.4 Weitere Gebrochene Zoll-Millimeter-Äquivalente .................................... 291
15.5 Flächen-Äquivalente ...............................................................................293
15.6 Volumenäquivalente ............................................................................... 293
15.7 Volumenratenäquivalente .......................................................................293
15.8 Massenumrechnung – Pounds zu Kilogramm ..........................................294
15.9 Druckäquivalente ....................................................................................294
15.10 Druckumrechnung – Pounds pro Quadratzoll zu bar .............................295
15.11 Formeln zur Temperaturumrechnung ...................................................296
15.12 Temperaturumrechnungen ................................................................... 296
15.13 API und Baumé-Dichtetabellen und Gewichtsfaktoren ..........................299
15.14 Weitere hilfreiche Umrechnungen.........................................................301
15.15 Metrische Präxe und Sufxe ................................................................302
Index .................................................................................................. 304
13

Kapitel 1
Einführung in Stellventile
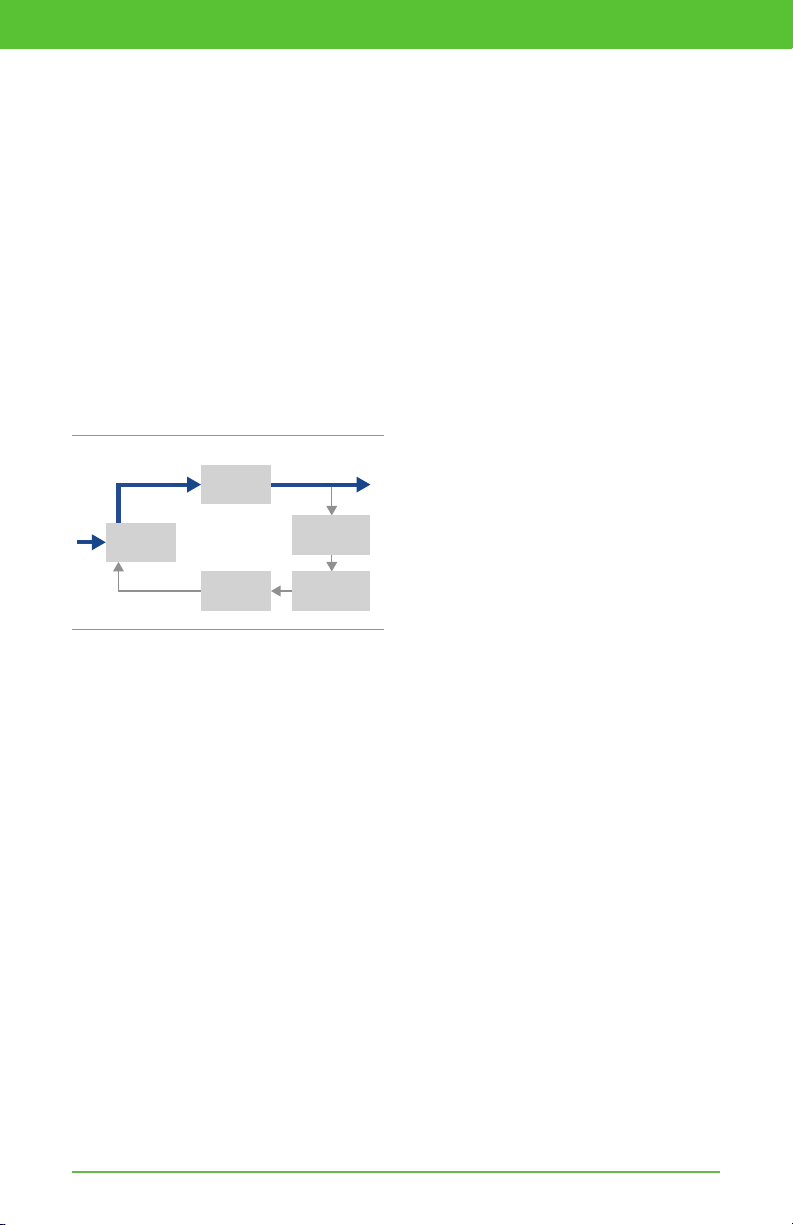
Stellventil-Handbuch | Kapitel 1: Einführung in Stellventile
1.1 Was ist ein Stellventil?
Moderne verfahrenstechnische Anlagen
nutzen ein ausgedehntes Netz von
Regelkreisen, um ein Endprodukt für den
Markt herzustellen. Diese Regelkreise sind so
ausgelegt, dass eine Prozessvariable (z. B.
Druck, Durchuss, Füllstand, Temperatur
usw.) innerhalb eines geforderten
Betriebsbereichs gehalten wird, um ein
qualitativ hochwertiges Endprodukt zu
erzeugen. Jeder dieser Regelkreise empfängt
und erzeugt intern Störungen, die sich
nachteilig auf die Prozessvariable (PV)
auswirken. Wechselwirkungen mit anderen
Regelkreisen im Netzwerk führen ebenfalls zu
Störungen, die sich auf die Prozessvariable
auswirken. Siehe Abb. 1.1.
Manipulierte Variable Geregelte Variable
Prozess
Regelventil
Controller
Abb. 1.1 Rückmeldungs-Regelkreis
Um den Einuss dieser Störgrößen zu
reduzieren, erfassen Sensoren und die
Messumformer Informationen über die
Prozessvariable (PV) und deren Beziehung zu
einem gewünschten Sollwer t. Eine
Steuereinheit verarbeitet diese Informationen
und entscheidet, was ausgeführt werden
muss, um den Wert einer Prozessvariablen
nach dem Auftreten einer Störgröße wieder
auf ihren Sollwert zurückzuführen. Wenn alle
Messungen, Vergleiche und Berechnungen
abgeschlossen sind, muss ein Stellglied die von
der Steuereinheit gewählte Strategie
umsetzen.
Das am häugsten in der Prozessindustrie
verwendete Stellglied ist das Stellventil.
Stellventile handhaben den Durchuss von
Prozessmedien wie Gas, Dampf, Wasser oder
chemischen Verbindungen, um Störgrößen
zu kompensieren und die geregelte
Prozessvariable so nahe wie möglich am
gewünschten Sollwert zu halten.
Sensor
Messum-
former
Das Stellventil ist ein wichtiger Teil des
Regelkreises. Viele Menschen, die von
Stellventilen sprechen, meinen tatsächlich
eine Regelventileinheit. Eine
Regelventileinheit besteht in der Regel aus
dem Ventilkörper, den Teilen der
Innengarnitur, einem Stellantrieb, der die
Kraft zur Betätigung des Ventils bereitstellt,
und verschiedenem anderen Zubehör, wie
z. B. Messwandler, Versorgungsdruckregler,
Handhilfsbetätigungen, Dämpfungselemente
oder Endlagenschalter.
Abhängig von der Wirkungsweise des
Verschlusselements gibt es zwei
Hauptbauformen von Stellventilen:
Hubventile und Drehventile. Hubventile, wie
in Abb. 1.2 und 1.3 gezeigt, bewegen ein
Verschlusselement in einer linearen
Bewegung in eine Sitzäche hinein bzw. aus
dieser heraus. Drehventile, wie in Abb. 1.13
und 1.17 gezeigt, bewegen ein
Verschlusselement durch eine Drehbewegung
in eine Sitzäche hinein bzw. aus dieser
heraus.
1.2 Hubstellventil – Terminologie
Die folgende Terminologie bezieht sich auf
die physischen und betrieblichen
Eigenschaften von standardmäßigen
Hubstellventilen mit Membran- oder
Kolbenantrieb. Einige der Begriffe,
insbesondere diejenigen für Stellantriebe,
gelten auch für Drehstellventile. Viele der
aufgeführten Denitionen entsprechen in der
Originalversion (Englisch) der ANSI/
ISA-75.05.01, Control Valve Terminology,
obwohl auch andere gängige Begriffe
enthalten sind. Einige der komplexeren
Begriffe werden zusätzlich erläutert. In den
weiteren Abschnitten dieses Kapitels wird die
spezische Terminologie für Drehstellventile,
für allgemeine Prozessanwendungen und
Stellventilfunktionen und -eigenschaften
deniert.
15

Stellventil-Handbuch | Kapitel 1: Einführung in Stellventile
Abb. 1.2 Hubstellventil
1. Ventiloberteil
2. Stopfbuchspackung
3. Käg- oder
Sitzringhalter
4. Ventilspindel
1
2
3
6
7
8
Abb. 1.3 Hubstellventil
5. Ventilkegel
6. Ventilkörper
7. Sitzring
8. Durchgang
4
5
Antriebsfeder: Eine im Antriebsbügel,
Antriebsgehäuse oder Kolbenzylinder
eingeschlossene Feder oder Federgruppe, die
die Antriebsspindel entgegengesetzt zu der
durch den Stelldruck erzeugten Richtung
bewegt.
Antriebsspindel: Der Teil, der den Antrieb
mit der Ventilspindel verbindet und die
Bewegung (Kraft) vom Antrieb auf die
Armatur überträgt.
Antriebsspindelverlängerung: Eine
Verlängerung der Kolbenantriebsspindel zur
Übertragung der Kolbenbewegung auf den
Stellungsregler des Ventils bzw. der Armatur.
Antriebsspindelkraft: Die für die
Positionierung des Ventilkegels (der so
genannte Ventilstellweg) zur Verfügung
stehende Netto-Stellkraft eines Antriebs.
Eckventil: Eine Ventilkonstruktion, bei der die
Einlass- und Auslassanschlüsse senkrecht
zueinander stehen. Siehe auch
Durchgangsventil.
Abb. 1.4 Eckventil
Faltenbalg-Oberteil: Ein Ventiloberteil, das
einen Faltenbalg zur Abdichtung gegen
Leckage um die Spindel des
Verschlusselements verwendet. Siehe
Abb. 1.5.
Ventiloberteil: Der Teil des Ventils, der die
Stopfbuchspackung und die
Spindelabdichtung enthält und auch zur
Führung der Ventilspindel dienen kann. Das
Ventiloberteil stellt die Hauptöffnung zum
Hohlraum des Ventilkörpers zur Montage der
Innenteile dar oder kann ein integrierter
Bestandteil des Ventilkörpers sein. Es kann
auch zum Anbau eines Antriebes an den
Ventilkörper dienen. Typische Ventiloberteile
sind druckdicht mit dem Ventilkörper
verschraubt oder verschweißt oder in den
Ventilkörper integriert. Dieser Begriff wird
häug verwendet, wenn tatsächlich das
Ventiloberteil und die dazugehörigen
Packungsteile gemeint sind. Genauer sollte
diese Gruppe von Bauteilen als
Ventiloberteileinheit bezeichnet werden.
Ventiloberteileinheit (Allgemein Ventiloberteil,
genauer Ventiloberteileinheit): Eine Einheit mit
dem Teil, durch das sich eine Ventilspindel
bewegt, und einer Vorrichtung entlang der
Spindel zur Abdichtung gegen Leckage. Die
Ventilober teileinheit dient in der Regel zur
Montage des Antriebs und zum Ausüben eines
16

Stellventil-Handbuch | Kapitel 1: Einführung in Stellventile
Drucks auf die Packungseinheit. Darüber
hinaus sorgt sie für eine korrekte Ausrichtung
des Ventilkegels zum Rest der
Regelventileinheit. Siehe Abb. 1.6.
1. Ventiloberteil
1
2
3
4
5
Abb. 1.5 Faltenbalg-Oberteil
1
2
3
4
Abb. 1.6 Ventiloberteileinheit
2. Packung
3. Stopfbuchspackung
4. Faltenbalg
5. Ventilspindel
1. Ventiloberteil
2. Packung
3. Stopfbuchspackung
4. Ventilspindel
Bodenflansch: Ein Teil, das die der
Ventiloberteilöffnung gegenüberliegende
Ventilkörperöffnung verschließt. Der
Bodenansch kann mit einer Führungsbuchse
versehen sein und/oder zur Umkehrung der
Ventilfunktion dienen.
Buchse: Eine Vorrichtung, die bewegliche
Teile wie Ventilspindel und Ventilkegel stützt
und/oder führt.
Käfig: Ein Teil der Ventilinnengarnitur, das das
Verschlusselement umgibt und eine
Durchusskennlinie und/oder eine Sitzäche
bieten kann. Der Käg bietet darüber hinaus
Stabilität, Führung, Ausgleich und
Ausrichtung, und erleichtert die Montage
anderer Teile der Ventilinnengarnitur. Die
Wände des Kägs enthalten Öffnungen, mit
denen die Durchusskennlinie des Stellventils
bestimmt wird. Siehe Abb. 1.7.
Verschlusselement: Der bewegliche Teil der
Armatur, der sich im Durchussweg bendet,
um den Durchuss durch die Armatur zu
modulieren.
Führungsbuchse: Der Teil eines
Verschlusselements, der die Bewegung des
Verschlusselements entweder in einem Käg,
einem Sitzring (Sitzführung), einem
Ventiloberteil, einem Bodenansch, einer
Spindel oder in zwei beliebigen dieser Bauteile
ausrichtet.
Zylinder: Die Kammer eines Kolbenantriebs,
in der sich der Kolben bewegt.
Zylinderdichtung: Das Dichtelement am
Anschluss des Kolbenantriebszylinders zum
Antriebsbügel.
Membran: Ein exibles und
druckempndliches Element, das die Kraft
auf den Membranteller und die
Antriebsspindel überträgt.
Membranantrieb: Eine medienbetriebene
Vorrichtung, bei der das Medium, in der
Regel Druckluft (siehe Stelldruck), auf ein
exibles Bauteil – die Membran – wirkt, um
eine Kraft zum Bewegen des
Verschlusselements zu erzeugen.
Antriebsgehäuse: Ein Gehäuse, bestehend
aus einem Ober- und einem Unterteil. Das
Gehäuse trägt die Membran und stellt eine
oder zwei Druckkammern.
Abb. 1.7 Käge (links nach rechts): Linear, Gleichprozentig, Schnellöffnend
17
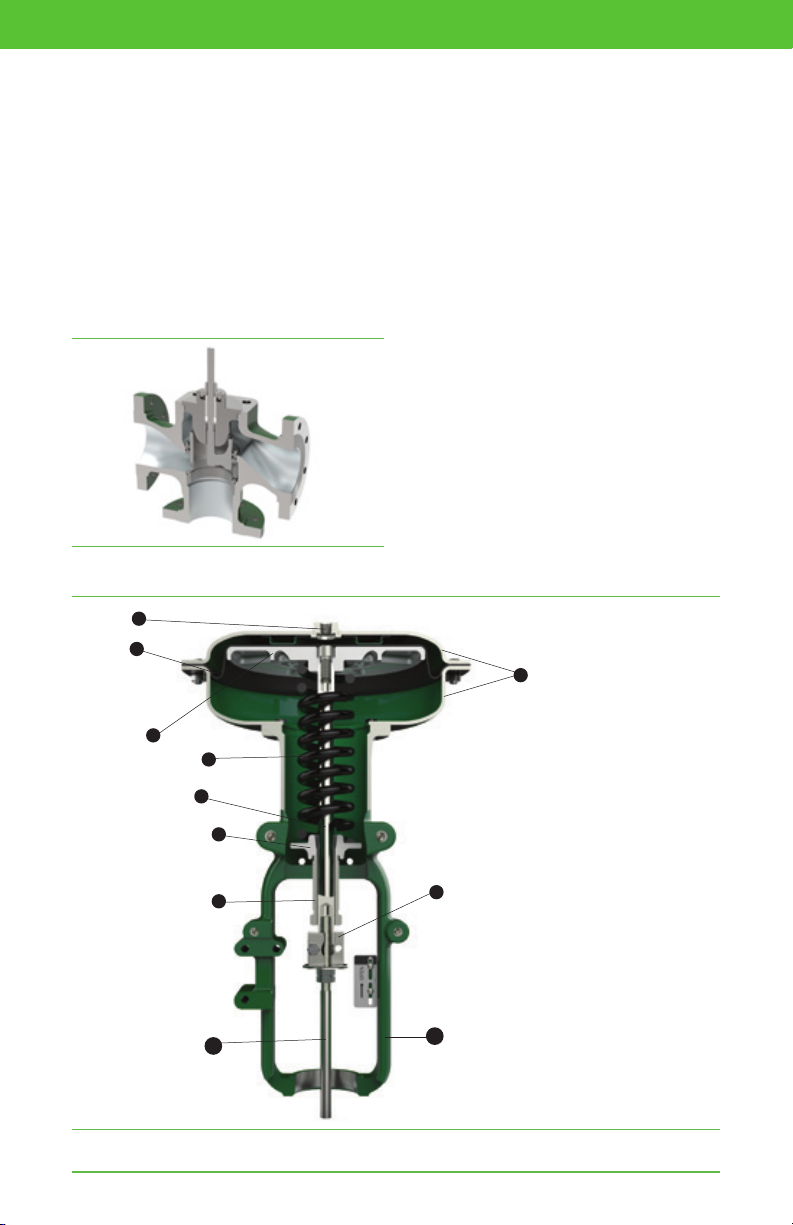
Stellventil-Handbuch | Kapitel 1: Einführung in Stellventile
Membranteller: Eine starre, konzentrisch zur
Membran bendliche Platte zur Übertragung
der Stellkraft auf die Antriebsspindel.
Direkt wirkender Stellantrieb: Ein
Stellantrieb, bei dem die Antriebsspindel
mit steigendem Stelldruck ausfährt. Siehe
Abb. 1.9.
Verlängertes Oberteil: Ein Ventiloberteil
mit größerer Abmessung zwischen
Stopfbuchspackung und dem
Oberteilansch für Einsatzbereiche mit
starken Temperaturschwankungen.
Abb. 1.8 Dreisitz-Durchgangsventil
1
3
Durchgangsventil: Eine Armatur mit
einem linear bewegten Verschlusselement,
einem oder mehreren Anschlüssen und
einem Ventilkörper, der sich durch einen
kugelförmigen Hohlraum um den
Sitzdurchgangsbereich herum auszeichnet.
Durchgangsventile können weiter unterteilt
werden in: Zweisitz-Ventile mit einem
Anschluss (Abb. 1.3), Zweisitz-Ventile mit
zwei Anschlüssen, Eckventile oder DreisitzVentile (Abb. 1.8).
Stelldruck: Ein Medium, in der Regel
Druckluft, das in einem pneumatischen
Antrieb auf die Membran oder den Kolben
aufgebracht wird.
Offset-Ventil: Eine Ventilkonstruktion, bei
der die Anschlüsse für die Ein- und
Auslassleitungen auf verschiedenen Ebenen
liegen, aber dennoch um 180 Grad
zueinander versetzt gegenüberliegen.
Stopfbuchspackung (Baugruppe): Der Teil des
Ventilober teils, der um die Spindel des
Verschlusselements zur Abdichtung gegen
Leckage verwendet wird. In der kompletten
2
4
5
6
7
8
10
Abb. 1.9 Direkt wirkender Stellantrieb
18
1. Stelldruckanschluss
2. Antriebsgehäuse
3. Membran
4. Membranteller
5. Antriebsfeder
6. Antriebsspindel
7. Federteller
8. Federeinstellvorrichtung
9
11
9. Spindelschloss
10. Ventilspindel
11. Antriebsbügel
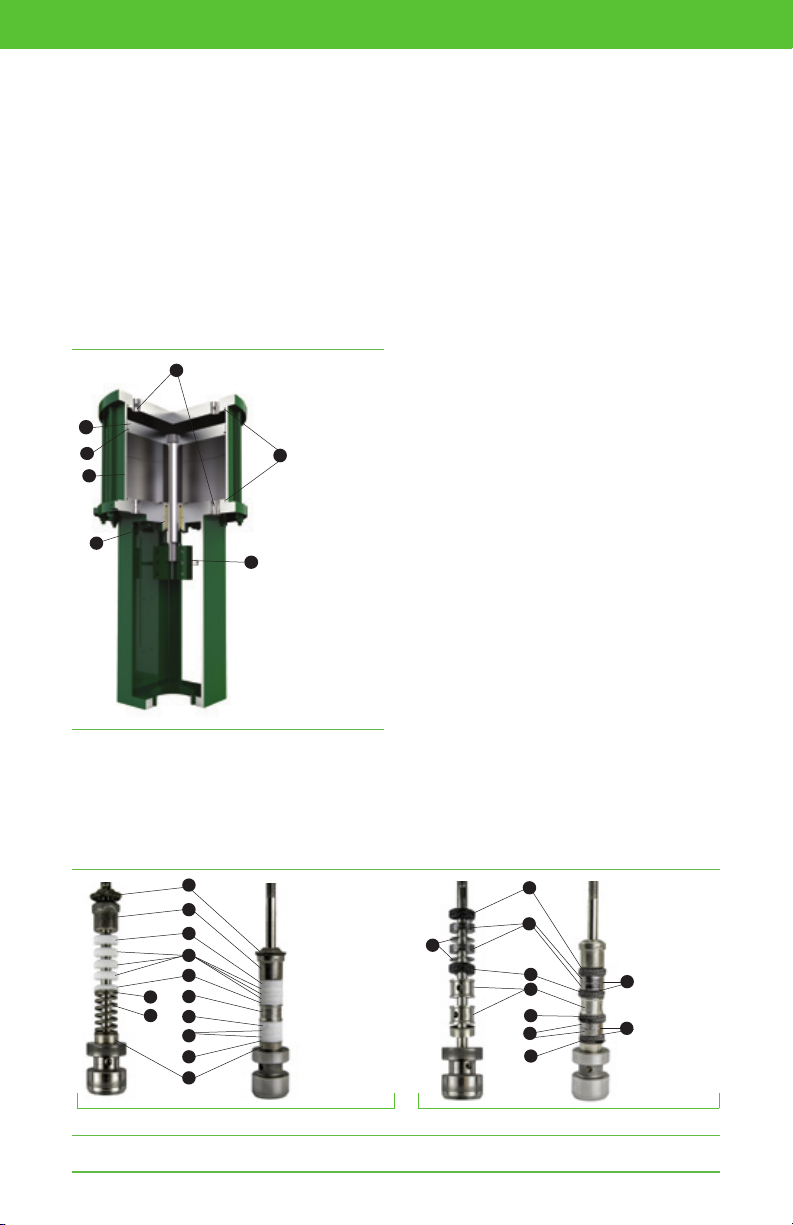
Stellventil-Handbuch | Kapitel 1: Einführung in Stellventile
Stopfbuchspackungseinheit sind verschiedene
Kombinationen von einigen oder allen der
folgenden Bauteile enthalten: Packung,
Packungsmanschette, Packungsmutter,
Sperrkammerring, Packungsfeder,
Packungsansch, Packungsanschbolzen oder
-schrauben, Packungsanschmuttern,
Packungsring, Packungsabstreifring,
Filzabstreifring, Tellerfedern, Anti-Extrusionsring.
Siehe Abb. 1.11.
Kolben: Ein starres, bewegliches und
druckempndliches Element, das die Kraft auf
die Antriebsspindel des Kolbens überträgt.
1
2
3
4
6
5
1. Stelldruckanschluss
2. Kolben
3. Kolbendichtung
4. Zylinder
7
5. Zylinderdichtung
6. Dichtungsbuchse
7. Spindelschloss
Abb. 1.10 Kolbenantrieb
Kolbenantrieb: Eine medienbetriebene
Vorrichtung, bei der das Medium, in der Regel
Druckluft, auf einen beweglichen Kolben einwirkt,
um die Bewegung der Antriebsspindel und die
Ventilsitzkraft beim Schließen zu gewährleisten.
Kolbenantriebe sind ent weder als doppelt wirkend
klassiziert, so dass die volle Leistung in beide
Richtungen entwickelt werden kann, oder als
ausfallsicher durch Feder wirkung, so dass der
Antrieb bei einem Ausfall der
Versorgungsspannung die Armatur in die
gewünschte Stellrichtung bewegt. Siehe
Abb. 1.10.
Sitzdurchgang: Die Durchussdrosselblende
eines Stellventils.
Sitzhaltering: Ein geteilter Ring, der dazu
dient, einen losen Flansch an einem
Ventilkörper zu halten.
Umgekehrt wirkender Stellantrieb: Ein
Antrieb, bei dem die Antriebsspindel mit
steigendem Stelldruck einfährt. Umgekehrt
wirkende Antriebe weisen eine
Dichtungsbuchse am oberen Ende des
Antriebsbügels auf, um eine Leckage des
Stelldrucks entlang der Antriebsspindel zu
verhindern. Siehe Abb. 1.12.
Gummimanschette: Eine Schutzvorrichtung
gegen das Eindringen von Beschädigungen
verursachenden Fremdkörpern in die
Dichtungsbuchse des Kolbenantriebs.
Dichtungsbuchse: Obere und untere Buchsen,
die den Zylinder des Kolbenantriebs gegen
Leckagen abdichten. Zur Abdichtung des
Zylinders, der Antriebsspindel und der
Antriebsspindelverlängerung werden O-Ringe aus
synthetischem Gummi in den Buchsen
verwendet.
Sitz: Der Kontaktbereich zwischen dem
Verschlusselement und seiner Gegenäche,
der die Absperrung durch die Armatur
herstellt.
7
8
Abb. 1.11 Packung
1
2
3
4
5
6
3
4
5
9
PTFE-Packung
1. Oberer Abst reifer
2. Packungsmanschette
3. Innenadapter
4. V-Ring
5. Außenadapter
6. Sperrkammerring
7. Unterlegscheibe
8. Feder
9. Grundring/Unterer
Abstreifer
1
2
4
1
3
1
2
1
Graphitpackung
1. Faserring
2. Laminierter
Dichtring
3. Sperrkammerring
4. Zinkscheibe
4
4
19

Stellventil-Handbuch | Kapitel 1: Einführung in Stellventile
Sitzanpresskraft: Die Netto-Kontaktkraft
zwischen dem Verschlusselement und dem
Sitz bei angegebenen statischen Bedingungen.
In der Praxis richtet sich die Auswahl eines
Antriebs für ein bestimmtes Stellventil danach,
wie viel Kraft zur Überwindung der statischen,
von der Spindel und den Kräften des
Prozessmediums verursachten Kräfte unter
Berücksichtigung einer ausreichenden
Sitzanpresskraft erforderlich ist.
Sitzring: Ein Teil der Ventilkörpereinheit, der
eine Sitzäche für das Verschlusselement
bildet und einen Teil der
Durchussdrosselöffnung bilden kann.
Loser Flansch: Ein Flansch, der über den
Durchussanschluss eines Ventilkörpers
passt. Er wird in der Regel durch einen
Sitzhaltering gehalten.
Federeinstellvorrichtung: Ein Fitting, die in
der Regel über ein Gewinde mit der
Antriebsspindel oder dem Antriebsbügel
verbunden ist. Sie dient zur Einstellung der
Federvorspannung (siehe
„Einstelldruckbereich“ unter „StellventilFunktionen und -Eigenschaften –
Terminologie“).
Federteller: Eine Platte, mit der die Feder in
Position gehalten wird und die eine ebene
Fläche für den Kontakt mit der
Federeinstellvorrichtung schafft.
Resultierende Kraft durch das
Prozessmedium: Die Netto-Kraft, die durch
den Druck des Prozessmediums auf das
Verschlusselement und die Spindel bei
ruhendem Medium und den angegebenen
Druckverhältnissen auf die Ventilspindel
ausgeübt wird.
Spindelschloss: Die Vorrichtung, die die
Antriebsspindel mit der Ventilspindel
verbindet.
Innengarnitur: Die internen Komponenten
eines Ventils, die den Durchuss des
geregelten Mediums modulieren. Bei einem
Durchgangsventil-Gehäuse gehören hierzu in
der Regel das Verschlusselement, der Sitzring,
der Käg, die Spindel und der Spindelbolzen.
Innengarnitur, weichdichtend: Die
Innengarnitur eines Ventils mit einem
elastomeren, plastischen oder einem anderen
leicht verformbaren Material, das entweder
im Verschlusselement oder im Sitzring
verwendet wird, um eine dichte Absperrung
bei minimalen Betätigungskräften zu
gewährleisten.
Ventilkörper: Die wesentlichen
drucktragenden Bauteile des Ventils, die auch
3
4
1
6
7
8
10
11
Abb. 1.12 Umgekehrt wirkender Stellantrieb
20
1. Stelldruckanschluss
2. Antriebsgehäuse
3. Membran
2
4. Membranteller
5
9
12
5. Dichtungsbuchse
6. Antriebsfeder
7. Antriebsspindel
8. Federteller
9. Federeinstellvorrichtung
10. Spindelschloss
11. Ventilspindel
12. Antriebsbügel

Stellventil-Handbuch | Kapitel 1: Einführung in Stellventile
die Rohrleitungsanschlüsse und den
Durchusskanal umfassen, und die
Sitzächen und das Verschlusselement
tragen. Zu den gebräuchlichsten
Ventilkörperkonstruktionen zählen:
Einweg-Ventilkörper mit einem Anschluss und
einem Ventilkegel; Zweiweg-Ventilkörper mit
zwei Anschlüssen, einem Eintritt und einem
Austritt; Dreiweg-Ventilkörper mit drei
Anschlüssen (zwei Eintritte und ein Austritt
für konvergierende oder mischende
Strömungen oder ein Eintritt und zwei
Austritte für divergierende oder umleitende
Strömungen). Der Begriff „Ventilkörper“ oder
auch „Ventilgehäuse“ wird häug verwendet,
um den gesamten Ventilkörper mit seinem
Oberteil und den dazugehörigen
Innengarniturteilen zu bezeichnen. Genauer
sollte diese Gruppe von Bauteilen als
Ventilkörpereinheit bezeichnet werden.
Stellventileinheit (Allgemein Ventilkörper oder
Ventilgehäuse, genauer Stellventileinheit): Eine
Einheit aus Ventilkörper, Ventiloberteileinheit,
Bodenansch (sofern verwendet) und
Innengarniturteilen. Die Innengarnitur
umfasst das Verschlusselement, das einen
oder mehrere Anschlüsse öffnet, schließt
oder teilweise freigibt.
Ventilkegel (Kegel): Ein Begriff, der häug in
Bezug auf das Verschlusselement bei einem
Hubventil verwendet wird.
Ventilspindel: Bei einem Hubventil das Teil,
das die Antriebsspindel mit dem
Verschlusselement verbindet.
Antriebsbügel: Die Vorrichtung, die das
Antriebsaggregat starr mit der Armatur
verbindet.
1.3 Drehstellventil – Terminologie
Die folgende Terminologie bezieht sich auf
die physischen und betrieblichen
Eigenschaften von Drehstellventilen mit
Membran- oder Kolbenantrieb. Die
Verschlusselemente (z. B. Kugeln, Scheiben,
exzentrische Kegel usw.) bei einem Drehventil
erfüllen eine vergleichbare Funktion wie die
Ventilkegel bei einem Hubstellventil. Das
heißt, sie ändern durch ihre Rotation die
Größe und Form des Durchusses, indem sie
den Dichtbereich mehr oder weniger für das
durchströmende Medium öffnen. Viele der
aufgeführten Denitionen entsprechen in der
Originalversion (Englisch) der ISA S75.05,
Control Valve Terminology, obwohl auch
andere gängige Begriffe enthalten sind.
Begriffe für Stellantriebe gelten auch für
Drehstellventile. Einige der komplexeren
Begriffe werden zusätzlich erläutert. In den
weiteren Abschnitten dieses Kapitels wird die
spezische Terminologie für allgemeine
Prozessanwendungen, Stellventilfunktionen
und -eigenschaften deniert.
Abb. 1.13 Drehstellventil
Antriebshebel: Arm, der an der Welle des
Drehventils befestigt ist, um die Bewegung
der Antriebsspindel in eine Drehkraft
(Drehmoment) umzuwandeln, um eine
Scheibe/Klappe oder Kugel eines Drehventils
zu positionieren. Der Hebel ist in der Regel
formschlüssig durch eine Verzahnung mit
enger Toleranz oder einem anderen Mittel mit
der Drehvorrichtung verbunden, um Nachlauf
und Bewegungsverlust zu minimieren.
Vollkugel: Das Durchuss-Verschlusselement
von Drehstellventilen mit einer Vollkugel mit
zylindrischem Durchuss. Der Durchuss
entspricht dem Rohrdurchmesser.
Segmentkugel: Das Durchuss-
Verschlusselement von Drehstellventilen mit
einer Segmentkugel mit teilweisem
Durchuss.
21

Stellventil-Handbuch | Kapitel 1: Einführung in Stellventile
Abb. 1.14 Segmentkugel
V-Schlitz-Kugel: Der gängigste Typ bei den
Kugelsegmentventilen. Die V-Schlitz-Kugel
weist eine polierte oder beschichtete
Teilkugeläche auf, die über den gesamten
Stellweg gegen den Dichtring rotiert. Der
V-förmige Schlitz in der Kugel ermöglicht ein
großes Stellverhältnis und erzeugt eine
gleichprozentige Durchusskennlinie.
Abb. 1.15 V-Schlitz-Kugel
Konventionelle Klappe: Das symmetrische
Verschlusselement, das in den gängigsten
Varianten von Drehabsperrklappen verwendet
wird. Hochdynamische Drehmomente begrenzen
konventionelle Klappen für den Drosselbetrieb in
der Regel auf 60 Grad der Maximaldrehung.
Dynamisch konstruierte Klappe: Eine
Absperrklappe zur Reduzierung des
dynamischen Drehmoments bei großen
Drehschritten, wodurch sie für den
Drosselbetrieb mit bis zu 90 Grad
Klappendrehung geeignet ist.
Exzenterklappe: Generische Bezeichnung für
eine Ventilausführung, bei der durch die
exzentrische Positionierung der
Klappenwelle/Klappenanschlüsse die Klappe
beim Öffnen einen leicht exzentrischen
(gekrümmten) Weg nimmt. Dadurch kann
die Klappe beim Öffnen aus dem Kontakt mit
der Dichtung geschwenkt und Reibung und
Verschleiß können reduziert werden.
Abb. 1.16 Exzenterklappe
Flanschloses Ventil: Eine bei
Drehstellventilen häug verwendete
Ventilausführung. Flanschlose Ventile werden
mithilfe von langen Durchgangsschrauben
zwischen Flanschen nach ANSI/ASME Class
gehalten (manchmal auch als
Zwischenansch- oder Sandwichbauweise
bezeichnet).
Exzenterkegel: Ausführung von
Drehstellventilen mit exzentrisch drehendem
Kegel, der in den Sitz hinein- und herausdreht
und Reibung und Verschleiß reduziert. Diese
Ausführung ist besonders für erosive
Anwendungen geeignet.
Umgekehrter Durchfluss: Der Durchuss
erfolgt von der Wellen-/Nabenseite über die
Rückseite der Klappe, der Kugel oder des
Kegels aus. Einige Drehstellventile sind in der
Lage, den Durchuss in beide Richtungen
gleich gut zu regeln. Bei anderen
Drehventilkonstruktionen kann es
erforderlich sein, das Antriebsgestänge zu
modizieren, um einen umgekehrten
Durchuss zu ermöglichen.
Augenschraube: Ein häug verwendetes
Verbindungselement zwischen
Antriebsspindel und Antriebshebel, um die
Umwandlung der Schubkraft des
Linearantriebs in eine Drehkraft
(Drehmoment) mit minimalem
Bewegungsverlust zu ermöglichen. Die
Verwendung eines StandardHubkolbenantriebs an einem
Drehventilkörper erfordert in der Regel ein
Gestänge mit zwei Augenschrauben. Bei
Auswahl eines speziell für den Betrieb von
Drehventilen konzipierten Antriebs ist jedoch
nur eine solche Augenschraube erforderlich,
wodurch auch ein Bewegungsverlust
reduziert wird.
22
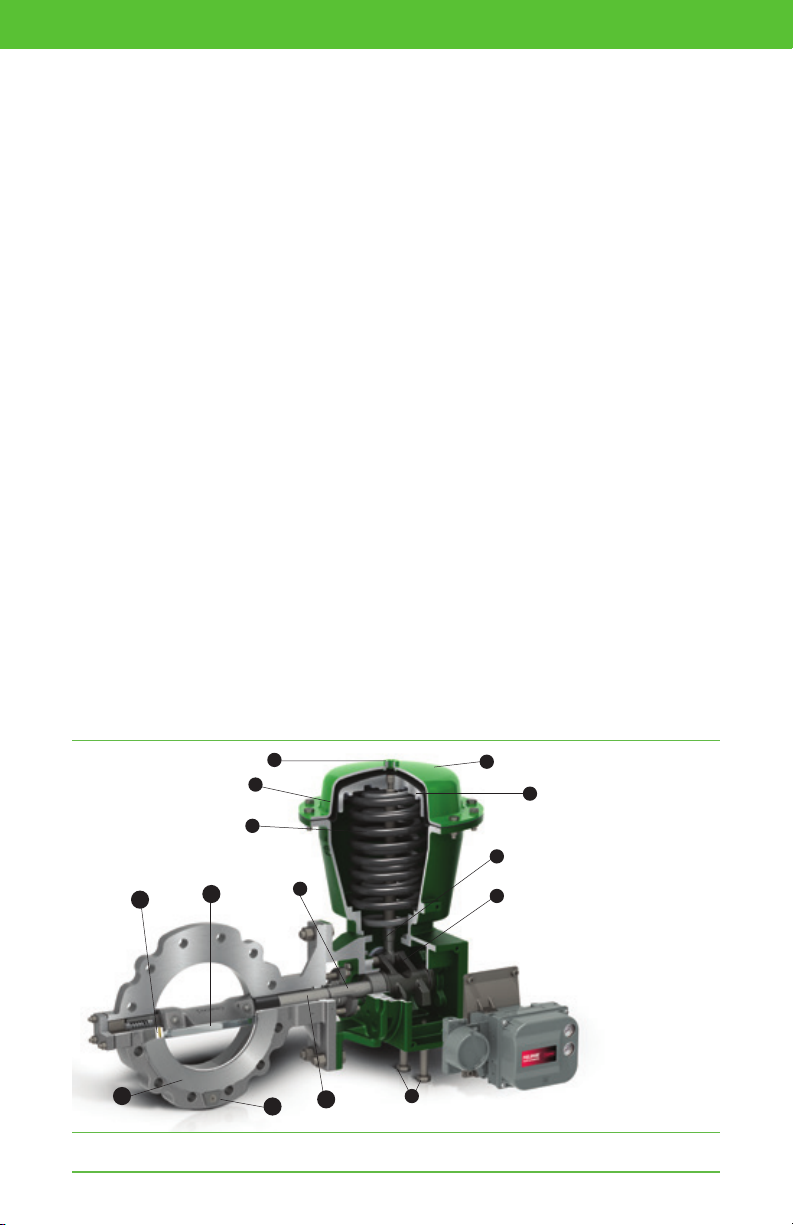
Stellventil-Handbuch | Kapitel 1: Einführung in Stellventile
Drehstellventil: Eine Ventilbauart, bei der das
Verschlusselement (Vollkugel, Teilkugel,
Scheibe, Klappe oder Kegel) im Durchussstrom
gedreht wird, um die Funktion des Ventils zu
steuern. Siehe Abb. 1.17.
Dichtring: Der dem Dichtring eines
Durchgangsventils entsprechende Teil einer
Drehregelventileinheit. Die Positionierung der
Klappe bzw. Kugel relativ zum Dichtring
bestimmt den Durchussbereich und die
Leistung der Armatur bei diesem Drehwinkel.
Klappenwelle: Der der Schaltwelle eines
Durchgangsventils entsprechende Teil einer
Drehregelventileinheit. Die Drehung der
Welle positioniert die Klappe bzw. Kugel im
Durchussstrom und regelt den Durchuss
durch die Armatur.
Gleitringdichtung: Die untere
Zylinderdichtung in einem pneumatischen
Kolbenantrieb, der für den Drehventilbetrieb
ausgelegt ist. Diese Dichtung ermöglicht eine
senkrechte und seitliche Bewegung der
Antriebsspindel ohne einen Verlust des
Stelldrucks am unteren Zylinder und
ermöglicht so die Ver wendung nur einer
Augenschraube.
Standarddurchfluss: Bei Drehstellventilen
mit separatem Dichtring oder Strömungsring
ist die Strömungsrichtung, in das Medium
durch die vor dem Dichtring liegenden
Rohrleitung in den Ventilkörper eintritt und
an der dem Dichtring gegenüberliegenden
Seite austritt. Manchmal wird dies auch als
Vorwärtsströmung oder in die Stirnseite des
Verschlusselements einströmend bezeichnet.
Siehe auch Umgekehrter Durchuss.
Starr gelagert: Eine Montageart der Klappe
bzw. Kugel auf der Ventilspindel oder dem
Wellenstumpf mit zwei diametral
gegenüberliegenden Lagern.
1.4 Stellventil-Funktionen und -Eigenschaften – Terminologie
Einstelldruckbereich: Die Kalibrierprozedur
einer Antriebsfeder, so dass sie einen
Druckbereich nutzen kann, um eine Armatur
vollständig auf seinen Nennhub zu bringen
(siehe „Eigendruckbereich einer Membran“).
Kapazität: Durchussmenge über eine
Armatur (Cv oder Kv), unter Nennbedingungen.
Durchfluss unterhalb des Regelbereichs:
Durchuss, der unterhalb des minimalen
regelbaren Durchusses bei nicht vollständig
in den Sitz eingreifenden Verschlusselement
auftritt.
Membrandruckbereich: Differenz zwischen
dem oberen und dem unteren Wert des
Membran-Stelldruckbereichs.
13
14
Abb. 1.17 Drehstellventil
1
3
5
11
8
10
12
9
2
4
6
7
1. Stelldruckanschluss
2. Antriebsgehäuse
3. Membran
4. Membranteller
5. Feder
6. Antriebsspindel
7. Hebel
8. Klappenwelle
9. Endanschlag
10. Packung
11. Klappe
12. Gehäuse
13. Dichtring
14. Dichtringhalter
23

Stellventil-Handbuch | Kapitel 1: Einführung in Stellventile
Doppelt wirkender Stellantrieb: Ein Antrieb,
bei dem pneumatische, hydraulische oder
elektrische Energie sowohl in AUF- als auch in
ZU-Richtung zugeführt wird.
Resultierende Kräfte durch das
Prozessmedium: Die auf den Ventilkegel in
einer beliebigen geöffneten Stellung durch
den auf ihn einwirkenden MedienProzessdruck erzeugte Netto-Kraft.
Effektive Membranfläche: In einem Antrieb
der Teil des Sitzquerschnitts einer Membran
oder eines Kolbens, der die Spindelkraft
erzeugt. Die effektive Membranäche kann
sich während des Hubs ändern, wobei sie
normalerweise am Anfang das Maximum und
am Ende des Hubbereichs das Minimum
beträgt. Gegossene Membranen weisen eine
geringere Änderung der effektiven
Membranäche als Flachmembranen auf;
daher werden gegossene Membranen
empfohlen.
Sicherheitsstellung ZU: Eine Bedingung, bei
der sich das Verschlusselement des Ventils in
die geschlossene Stellung bewegt, wenn die
Betätigungsenergiequelle ausfällt.
Sicherheitsstellung AUF: Eine Bedingung,
bei der sich das Verschlusselement des Ventils
in die geöffnete Stellung bewegt, wenn die
Betätigungsenergiequelle ausfällt.
Sicherheitsstellung: Eine Eigenschaft eines
Ventils und seines Stellantriebs, die bei Ausfall
der Energiezufuhr dafür sorgt, dass das
Verschlusselement des Ventils entweder
vollständig geschlossen, vollständig geöffnet
oder in der letzten Stellung verbleibt – je
nachdem, welche Stellung zum Schutz des
Prozesses und der Anlage erforderlich ist.
Durchflusskennlinie: Das Verhältnis
zwischen dem Durchuss durch die Armatur
und dem prozentualen Nennhub, da der
Nennhub zwischen 0 und 100 % variiert wird.
Dieser Begriff sollte immer als inhärente
Strömungseigenschaft oder gewählte
Durchusskennlinie zugewiesen werden
(siehe Denitionen im Abschnitt
„Prozesssteuerung – Terminologie“).
Durchflusskoeffizient (Cv): Eine auf die
Geometrie eines Ventils bezogene Konstante
bei einem bestimmten Stellweg, die zur
Bestimmung der Durchussrate verwendet
werden kann. Dies ist die Anzahl an US-
Gallonen Wasser pro Minute bei 16 °C (60 °F),
die bei einem Differenzdruck von einem
Pfund pro Quadratzoll durch die Armatur
ießt.
Ventil mit hohem Ausnutzungsgrad: Ein
Armaturentyp, der aufgrund seiner
stromlinienförmigen Innenkonturen und
minimalen Strömungsturbulenzen nur sehr
wenig Energie des Durchusses ableitet. Aus
diesem Grund erholt sich der Druck
abströmseitig der Vena Contracta auf einen
hohen Prozentsatz seines Eintrittswertes.
Beispiele für Ventile mit hohem
Ausnutzungsgrad sind gerade
Durchussventile wie z. B. Drehkugelhähne.
Eigendruckbereich einer Membran: Die
oberen und unteren Druckwerte, die auf eine
Membran wirken, um den Nennweg des
Ventilkegels bei Atmosphärendruck im
Ventilkörper zu erzeugen. Dieser Bereich wird
häug auch als Einstelldruckbereich
bezeichnet, da es sich um den Bereich
handelt, über den die Armatur bei der
Sollwerteinstellung bewegt wird.
Inhärente Strömungseigenschaften: Das
Verhältnis zwischen der Durchussrate und
dem Weg des Verschlusselementes, wenn es
aus der geschlossenen Stellung mit einem
konstanten Differenzdruck über die Armatur
in den Nennhub bewegt wird.
Federbereich: Die oberen und unteren
Druckwerte, die auf eine Membran wirken,
um den Nennhub bei Nennbedingungen im
Ventilkörper zu erzeugen. Aufgrund der auf
das Verschlusselement wirkenden Kräfte kann
der Eigendruckbereich einer Membran vom
Federbereich abweichen.
Gewählte Durchflusskennlinie: Das
Verhältnis zwischen der Durchussrate und
dem Weg des Verschlusselements, wenn es
aus der geschlossenen Stellung in den
Nennhub bewegt wird, wenn sich variierende
Prozessbedingungen auf den Differenzdruck
über die Armatur auswirken.
Ventil mit niedriger Druckrückgewinnung:
Ein Ventiltyp, der aufgrund von Turbulenzen, die
durch die Konturen des Strömungswegs
entstehen, eine erhebliche Energiemenge des
Durchusses ableitet. Entsprechend erholt sich
der Druck abströmseitig der Vena Contracta auf
einen geringeren Prozentsatz seines
24

Stellventil-Handbuch | Kapitel 1: Einführung in Stellventile
Eintrittswerts, verglichen mit einer Armatur mit
einem stromlinienförmigen Strömungsweg.
Obwohl die einzelnen Ausführungen
unterschiedlich sind, haben konventionelle
Durchgangsventile in der Regel nur geringe
Fähigkeiten zur Druckrückgewinnung.
Modifizierte gleichprozentige
Durchflusskennlinie: Eine inhärente
Strömungseigenschaft, die eine
gleichprozentige Kennlinie bei geringem Weg
des Verschlusselements und eine annähernd
lineare Kennlinie für die oberen Teile des
Stellwegs des Verschlusselements liefert.
Sicherheitsstellung geschlossenes Ventil:
Siehe „Sicherheitsstellung ZU“.
Sicherheitsstellung geöffnetes Ventil: Siehe
„Sicherheitsstellung AUF“.
Zum Schließen nach unten drücken
(Push-Down-to-Close, PDTC)Konstruktion: Eine Durchgangsventil-
Konstruktion, bei der sich das
Verschlusselement zwischen dem Antrieb und
dem Sitzring bendet, so dass die
Verlängerung der Antriebsspindel das
Verschlusselement zum Sitzring hin bewegt
und die Armatur letztlich schließt. Dieser
Begriff kann auch für
Drehventilkonstruktionen verwendet werden,
bei denen die Kugel oder Scheibe durch die
lineare Verlängerung der Antriebsspindel in
die geschlossene Stellung bewegt wird. Wird
auch als „direkt wirkend“ bezeichnet.
Zum Öffnen nach unten drücken (PushDown-to-Open, PDTO)-Konstruktion: Eine
Durchgangsventil-Konstruktion, bei der sich
der Sitzring zwischen dem Antrieb und dem
Verschlusselement bendet, so dass die
Verlängerung der Antriebsspindel das
Verschlusselement aus dem Sitzring bewegt
und die Armatur öffnet. Dieser Begriff kann
auch für Drehventilkonstruktionen verwendet
werden, bei denen die Kugel oder Scheibe
durch die lineare Verlängerung der
Antriebsspindel in die geöffnete Stellung
bewegt wird. Wird auch als „umgekehrt
wirkend“ bezeichnet.
Stellverhältnis: Das Verhältnis des größten
Durchusskoefzienten (Cv oder Kv) zum
kleinsten Durchusskoefzienten (Cv oder
Kv), innerhalb dessen die Abweichung von
der angegebenen Durchusskennlinie die
vorgegebenen Grenzen nicht überschreitet.
Ein Stellventil, das den Durchuss noch gut
regelt, wenn dieser auf das 100-fache des
minimal regelbaren Durchusses ansteigt,
hat ein Stellverhältnis von 100 bis 1. Das
Stellverhältnis kann auch als Verhältnis
der größten zur kleinsten regelbaren
Durchussmenge ausgedrückt werden.
Ventil Nenn-Durchflusskoeffizient (Cv): Der
Durchusskoefzient (Cv) eines Ventils bei
Nennhub.
Nennhub: Der Weg des Verschlusselements
von der geschlossenen oder ZU-Stellung zur
geöffneten Nenn- oder AUF-Stellung. Die
angegebene Öffnungsstellung ist maximale,
vom Hersteller empfohlene Öffnung.
Relativer Durchflusskoeffizient (Cv): Das
Verhältnis des Durchusskoefzienten (Cv)
bei angegebenen Stellweg zum
Durchusskoefzienten (Cv) bei Nennhub.
Sitzleckage: Die Menge an Prozessmedium,
die durch eine Armatur strömt, wenn sich die
Armatur in der vollständig geschlossenen
(ZU) Stellung bendet und die maximal
verfügbare Sitzanpresskraft bei angegebener
Druckdifferenz und Temperatur zur Wirkung
kommt.
Federkonstante (Ks): Die Kraftänderung pro
Änderung der Länge einer Feder um eine
Einheit. Bei Membranantrieben wird die
Federkonstante in der Regel in Pfund Kraft
pro Zoll Komprimierung angegeben.
Vena Contracta: Der Teil einer
Durchussströmung, in dem die
Strömungsgeschwindigkeit des
Prozessmediums am höchsten ist und der
statische Druck und die Querschnittsäche
des Prozessmediums am niedrigsten sind. In
einem Stellventil bendet sich die Vena
Contracta in der Regel unmittelbar hinter der
eigentlichen physischen Verengung.
1.5 Prozesssteuerung – Terminologie
Die folgenden zuvor noch nicht erklärten
Begriffe und Denitionen werden häug von
Personen verwendet, die mit Stellventilen,
Instrumentierung und entsprechendem
Zubehör arbeiten. Einige der Begriffe, die mit
25

Stellventil-Handbuch | Kapitel 1: Einführung in Stellventile
einem Asterisk (*) gekennzeichnet sind,
wurden in der Originalversion dieses
Handbuchs (Englisch) von der ISA-Norm
ISA 51.1, Process Instrumentation
Terminology, abgeleitet. Auch andere gängige
Begriffe, die überall in der Stellventilindustrie
verwendet werden, werden hier aufgeführt.
Zubehör: Eine Vorrichtung, die an eine
Regelventileinheit montiert wird, um diese
um verschiedene Funktionen zu ergänzen
oder um gewünschte Aktionen, insbesondere
die Betätigung, zu erzeugen. (Beispiele sind
Stellungsregler, Versorgungsdruckregler,
Magnetschalter, Endlagenschalter usw.)
Stellantrieb*: Eine pneumatisch, hydraulisch
oder elektrisch angetriebene Vorrichtung, die
Kraft und Bewegung zum Öffnen oder
Schließen einer Armatur liefert.
Stellantriebseinheit: Ein Stellantrieb mit
allem Zubehör, das ihn zu einer kompletten
Betätigungseinheit macht.
ANSI: Abkürzung für American National
Standards Institute.
API: Abkürzung für American Petroleum
Institute.
ASME: Abkürzung für American Society of
Mechanical Engineers.
ASTM: Früher die Abkürzung für American
Society for Testing and Materials. Als
der Geltungsbereich der Organisation
international Anwendung fand, wurde der
Name zu ASTM International geändert. ASTM
ist keine Abkürzung mehr.
Automatisches Regelsystem*: Ein
Regelsystem, das ohne menschlichen Eingriff
arbeitet.
Nachlauf: Eine Form der Totzone, die sich aus
einer vorübergehenden Diskontinuität
zwischen dem Eingang und dem Ausgang
eines Geräts ergibt, wenn der Eingang des
Geräts seine Richtung ändert. (Beispiele sind
das Umkehrspiel oder die Lose bei einer
mechanischen Verbindung.)
Bode-Diagramm*: Ein Diagramm der
logarithmischen Amplitudenverhältnisse und
Phasenwinkelwerte auf einer logarithmischen
Frequenzbasis für eine Über tragungsfunktion.
Ein Bode-Diagramm ist die häugste Form der
graschen Darstellung von Frequenzgangdaten.
Kalibrierkurve*: Eine grasche Darstellung
des Kalibrierprotokolls. Der Ausgang eines
Gerätes im Ruhezustand als Funktion seines
Eingangs im Ruhezustand. Die Kurve wird in
der Regel als prozentuale Ausgangsspanne im
Vergleich zur prozentualen Eingangsspanne
dargestellt.
Kalibrierzyklus*: Die Anwendung bekannter
Werte einer gemessenen Variablen und die
Aufzeichnung entsprechender
Ausgangswerte über den Bereich des
Messinstruments in aufsteigender und
absteigender Richtung. Eine Kalibrierkurve
wird durch Variation des Eingangs eines
Gerätes in aufsteigender und absteigender
Richtung erhalten. Die Kurve wird in der Regel
als prozentuale Ausgangsspanne im Vergleich
zur prozentualen Eingangsspanne dargestellt
und liefert eine Messung der Hysterese.
Durchflusskapazität* (Armatur): Die
Durchussmenge über eine Armatur (Cv)
unter Nennbedingungen.
Geschlossener Regelkreis: Die
Zusammenschaltung von Komponenten zur
Prozessregelung, so dass Informationen zur
Prozessvariablen kontinuierlich auf den
Sollwert der Steuereinheit zurückgeführt
werden, um eine kontinuierliche,
automatische Korrektur der Prozessvariablen
zu ermöglichen.
Verschlusselement: Ein Bauteil der
Ventilinnengarnitur (auch als Kegel, Scheibe,
Klappe, Kugelsegment oder Kugel mit vollem
Durchgang bezeichnet), das zur Modulation
des Durchusses innerhalb eines Stellventils
verwendet wird.
Steuereinheit: Eine Vorrichtung, die mithilfe
eines etablierten Algorithmus automatisch
arbeitet, um eine Regelgröße zu steuern. Der
Eingang der Steuereinheit erhält
Informationen über den Zustand der
Prozessvariablen und liefert dann ein
entsprechendes Ausgangssignal an das
Stellglied.
Regelkreis: Siehe „Geschlossener Regelkreis“
oder „Offener Regelkreis“.
Regelbereich: Der Bereich des Ventilweges,
über den ein Stellventil die
Durchusszunahme nach Installation
zwischen den normierten Werten von 0,5 und
2,0 halten kann.
26
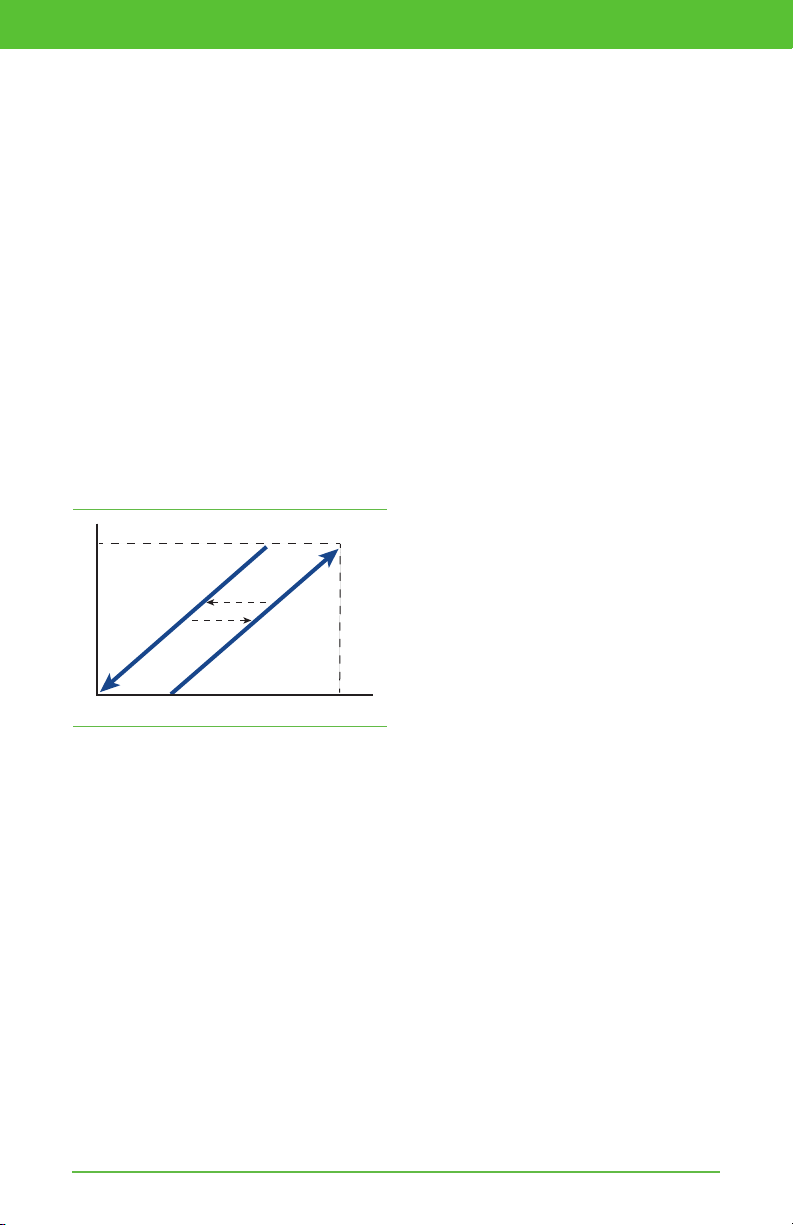
Stellventil-Handbuch | Kapitel 1: Einführung in Stellventile
Regelventileinheit: Eine Vorrichtung zur
Modulation des Durchusses durch Änderung
der Durchussgröße, die durch ein Signal
einer Steuereinheit gesteuert wird.
Totzone: Ein allgemeines Phänomen, das für
jedes Gerät gelten kann, bei dem der Bereich,
über den ein Eingangssignal durch eine
Richtungsumkehr geändert werden kann,
ohne dass eine beobachtbare Änderung des
Ausgangssignals auftritt. Bei Stellventilen ist
der Ausgang der Steuereinheit (Controller
Output, CO) der Eingang für die Ventileinheit
und die Prozessvariable (PV) der Ausgang, wie
in Abb. 1.18 dargestellt. Bei der Behandlung
einer Totzone ist es wichtig, dass sowohl die
Eingangs- als auch die Ausgangsvariablen
identiziert und dass alle quantizierbaren
Tests unter Volllastbedingungen
durchgeführt werden. Die Totzone wird in der
Regel in Prozent der Eingangsspanne
ausgedrückt.
100%
Prozessvariable
100%
Reglerausgang
Abb. 1.18 Totzone
Totzeit: Das Zeitintervall (Td), in dem nach
einer Eingabe in kleinen Schritten (meist
0,25 % bis 5 %) keine Reaktion des Systems
beobachtet wird. Diese Zeit ergibt sich aus
dem Moment, in dem der Schritt-Eingang auf
die erste beobachtbare Reaktion des Systems
eingeleitet wird. Die Totzeit kann für eine
Ventileinheit oder für den gesamten Prozess
gelten. Siehe „T63“.
Enthalpie: Eine thermodynamische Größe, die
sich aus der Summe der inneren Energie eines
Körpers und dem Produkt seines Volumens
multipliziert mit dem Druck ergibt: H = U + pV.
Wird auch als Wärmeinhalt bezeichnet.
Entropie: Das theoretische Maß an Energie,
die in einem thermodynamischen System
nicht in mechanische Arbeit umgewandelt
werden kann.
Gleichprozentige Kennlinie*: Eine inhärente
Strömungseigenschaft, die für gleiche
Inkremente des Nennhubes im Idealfall
gleichprozentige Änderungen des
Durchusskoefzienten (Cv) aus dem
vorhandenen Cv ergibt.
Rückmeldesignal*: Das Rücksignal, das sich
aus einer Messung einer direkt geregelten
Variablen ergibt. Bei einem Stellventil mit
Stellungsregler ist das Rücksignal in der Regel
eine mechanische Anzeige der Stellung der
Verschlusselementspindel, die in den
Stellungsregler rückgemeldet wird.
FCI: Abkürzung für Fluid Controls Institute.
Dieses Institut stellt Normen und
Schulungsmaterialien zur Verfügung, um
Käufer und Benutzer die Arbeitsweise und die
Verwendung von Ausrüstungen zur
Medienregelung und -aufbereitung zu
erklären.
Stellglied: Ein Gerät, das die vom Ausgang
einer Steuereinheit festgelegte Regelstrategie
umsetzt. Obwohl dieses Stellglied
verschiedene Formen annehmen kann
(Dämpfer, Ein-/Ausschaltgeräte usw.), ist das
heute in der Industrie am weitesten
verbreitete Stellglied die Regelventileinheit.
Stellventile modulieren den Durchuss von
Prozessmedien wie Gas, Dampf, Wasser oder
chemischen Verbindungen, um Störgrößen
zu kompensieren und die geregelte
Prozessvariable so nahe wie möglich am
gewünschten Sollwert zu halten.
Erste Ordnung: Ein Begriff, der sich auf das
dynamische Verhältnis zwischen dem Einund Ausgang eines Gerätes bezieht. Systeme
oder Geräte der ersten Ordnung haben nur
einen Energiespeicher und das dynamische
Übergangsverhältnis zwischen dem Ein- und
Ausgang ist durch ein exponentielles
Verhalten gekennzeichnet.
Frequenzgang-Kennlinie*: Das
frequenzabhängige Verhältnis von Amplitude
und Phase zwischen sinusförmigen Eingängen
im Ruhezustand und den daraus
resultierenden, grundlegend sinusförmigen
Ausgängen. Ausgangsamplitude und
Phasenverschiebung werden als Funktionen
der Eingangsprüffrequenz überwacht und zur
Beschreibung des dynamischen Verhaltens
des Regelgerätes verwendet.
27
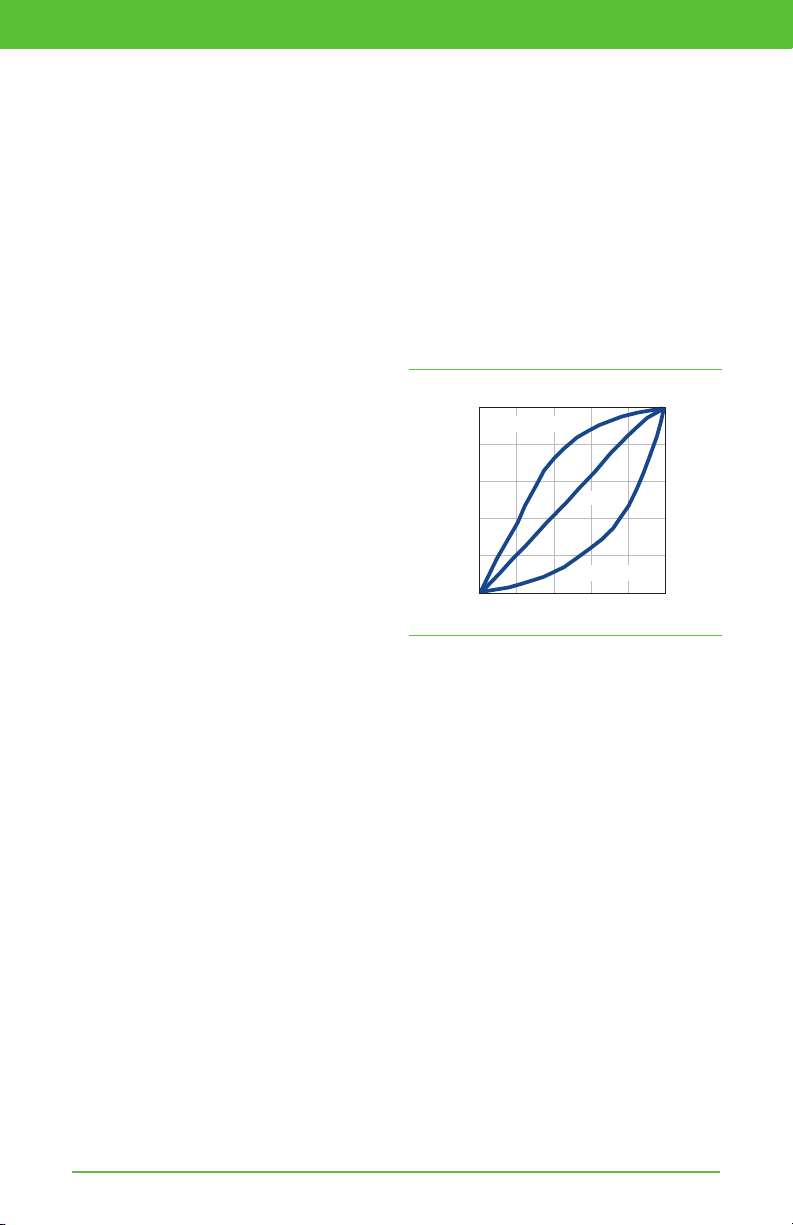
Stellventil-Handbuch | Kapitel 1: Einführung in Stellventile
100
Reibung: Eine Kraft, die dazu neigt, der
relativen Bewegung zwischen zwei sich
berührenden Flächen entgegenzuwirken. Die
zugehörige Kraft ist eine Funktion der diese
beiden Flächen zusammenhaltenden
Normalkraft und der charakteristischen
Beschaffenheit der beiden Flächen. Reibung
hat zwei Komponenten: Haftreibung und
Gleitreibung. Die Haftreibung (auch Stick/Slip
oder Haftung genannt) ist die Kraft, die
zunächst überwunden werden muss, damit es
zu einer relativen Bewegung zwischen den
beiden Oberächen kommt. Die Haftreibung
ist auch eine der Hauptursachen für die
Totzone einer Ventileinheit. Sobald die
relative Bewegung begonnen hat, ist die
Gleitreibung (auch bekannt als Laufreibung
oder Gleiten) die Kraft, die überwunden
werden muss, um die relative Bewegung
aufrechtzuerhalten.
Zunahme: Eine Bezeichnung für das
Verhältnis einer Ausgangsgrößenänderung
eines bestimmten Systems oder Geräts zur
Eingangsgrößenänderung, die die
Ausgangsgrößenänderung verursacht hat.
Die Zunahme hat zwei Komponenten:
statische Zunahme und dynamische
Zunahme. Die statische Zunahme (auch
Empndlichkeit genannt) ist das
Zunahmeverhältnis zwischen Eingang und
Ausgang und ein Indikator für die Leichtigkeit,
mit der der Eingang eine Ausgangsänderung
einleiten kann, wenn sich das System bzw.
Gerät in einem Ruhezustand bendet. Die
dynamische Zunahme ist das
Zunahmeverhältnis zwischen dem Eingang
und dem Ausgang, wenn sich das System in
einem Zustand der Bewegung oder des
Flusses bendet. Die dynamische Zunahme
ist eine Funktion der Frequenz bzw. der
Änderungsrate des Eingangs.
Härte: Die Beständigkeit von Metall gegen
plastische Verformung, meist durch
Einkerbung. Die Beständigkeit von
Kunststoffen und Gummi gegen das
Eindringen eines Eindrückpunktes in seine
Oberäche.
Nachregelung*: Eine unerwünschte
Schwingung von nennenswertem Ausmaß,
die auch nach dem Verschwinden äußerer
Reize andauert. Manchmal als Cycling oder
Grenzwertzyklus bezeichnet, ist die
Nachregelung ein Anzeichen für den Betrieb
an oder in der Nähe der Stabilitätsgrenze. Bei
Stellventilanwendungen würde eine
Nachregelung als eine Schwingung des
Stelldrucks zum Antrieb durch eine
Instabilität im oder am Ventilstellungsregler
auftreten.
Hysterese*: Die maximale Differenz des
Ausgangswertes für jeden einzelnen
Eingangswert während eines Kalibrierzyklus,
ohne Fehler durch eine Totzone. Eine
Verzögerung eines Effekts, wenn die auf einen
Körper wirkenden Kräfte verändert werden
(beispielsweise durch Viskosität oder innere
Reibung).
100
Schnellöffnend
Linear
Gleichprozentig
0
Ventil Nenn-Durchflusskoeffizient (%)
Abb. 1.19 Inhärente Ventilkennlinien
Nennhub (%)
Inhärente Kennlinie*: Das Verhältnis
zwischen dem Durchusskoefzienten und
dem Weg des Verschlusselementes, wenn es
aus der geschlossenen Stellung bei einem
konstanten Differenzdruck über die Armatur
in den Nennhub bewegt wird. In der Regel
werden diese Kennlinien auf einer Kurve
dargestellt, wobei die horizontale Achse als
prozentualer Weg und die vertikale Achse als
prozentualer Durchuss (oder Cv) bezeichnet
wird. Da der Ventildurchuss sowohl vom
Ventilweg als auch vom Differenzdruck über
die Armatur abhängt, bietet die
Durchführung von
Durchusskennlinienprüfungen bei
konstantem Differenzdruck eine
systematische Möglichkeit, eine
Ventilkennlinie mit einer anderen zu
vergleichen. Typische Ventilkennlinien, die auf
diese Weise ermittelt werden, werden als
linear, gleichprozentig und schnellöffnend
bezeichnet.
28

Stellventil-Handbuch | Kapitel 1: Einführung in Stellventile
Inhärente Durchflusszunahme: Das
Größenverhältnis der Durchussänderung
über die Armatur zur Ventilwegänderung bei
konstantem Differenzdruck. Die inhärente
Durchusszunahme ist eine inhärente
Funktion der Armaturenkonstruktion. Sie
entspricht der Steigung der inhärenten
Kennlinie an einem beliebigen Punkt auf dem
Ventilweg und ist somit eine Funktion des
Ventilweges.
Gewählte Kennlinie*: Das Verhältnis
zwischen der Durchussrate und dem Hub
des Verschlusselementes (Scheibe oder
Klappe), wenn es aus der geschlossenen
Stellung in den Nennhub bewegt wird,
während sich variierende
Prozessbedingungen auf den Differenzdruck
über die Armatur auswirken.
Durchflusszunahme nach Installation: Das
Größenverhältnis der Durchussänderung
über die Armatur zur Ventilwegänderung bei
tatsächlichen Prozessbedingungen. Die
Durchusszunahme nach Installation ist die
Durchusszunahme, die entsteht, wenn die
Armatur in ein bestimmtes System eingebaut
ist und sich der Differenzdruck entsprechend
den Vorgaben des Gesamtsystems natürlich
ändern kann. Die Durchusszunahme nach
Installation entspricht der Steigung der
gewählten Kennlinie und ist eine Funktion des
Ventilweges.
Instrumentendruck: Der Ausgangsdruck
einer automatischen Steuereinheit, der zur
Betätigung eines Stellventils verwendet wird.
I/P: Kurz für Strom-zu-Druck (I-zu-P). Wird in
der Regel für Eingangs-Messwandlermodule
verwendet.
ISA: Abkürzung für International Society for
Automation.
Linearität*: Die Stärke, wie sehr sich eine
Kurve, die sich auf zwei Variablen bezieht,
einer geraden Linie annähert. Linearität
bedeutet auch, dass die gleiche gerade Linie
sowohl für Aufwärts- und Abwärtsrichtungen
gilt. Aus diesem Grund wird die Totzone, wie
oben deniert, in der Regel als eine
Nichtlinearität betrachtet.
Lineare Kennlinie*: Eine inhärente
Strömungseigenschaft, die durch eine gerade
Linie in einem rechteckigen Diagramm des
Durchusskoefzienten (Cv) gegenüber dem
Nennhub dargestellt wird. Daher bieten
gleiche Schrittweiten des Ventilwegs gleiche
Schrittweiten des Durchusskoefzienten, Cv.
Stelldruck: Der Druck, mit dem ein
pneumatischer Antrieb bewegt wird. Dies ist
der Druck, der tatsächlich auf die Membran
oder den Kolben eines Antriebs wirkt und
kann der Instrumentendruck sein, wenn kein
Ventilstellungsregler verwendet wird.
Regelkreis: Siehe „Geschlossener Regelkreis“
oder „Offener Regelkreis“.
Regelkreisverstärkung: Die kombinierte
Zunahme aller Komponenten in einem
Regelkreis, wenn dieser als eine
Serienschaltung um den Regelkreis herum
betrachtet wird. Gelegentlich auch als
Verstärkung in einem offenen Regelkreis
bezeichnet. Es muss verständlich angegeben
werden, ob es sich um die Verstärkung eines
statischen Regelkreises oder um die
Verstärkung eines dynamischen Regelkreises
bei einer bestimmten Frequenz handelt.
Handbetätigte Regelung: Siehe „Offener
Regelkreis“.
NACE: Früher einmal die Abkürzung für
National Association of Corrosion Engineers.
Als der Geltungsbereich der Organisation
international Anwendung fand, wurde der
Name zu NACE International geändert. NACE
ist keine Abkürzung mehr.
Offener Regelkreis: Der Zustand, in dem die
Zusammenschaltung von Komponenten zur
Prozessregelung unterbrochen wird, so dass
Informationen von der Prozessvariablen nicht
mehr auf den Sollwert der Steuereinheit
zurückgeführt werden. In diesem Fall sind
keine Korrekturen an der Prozessvariablen
mehr vorgesehen. Dies wird in der Regel
dadurch erreicht, dass die Steuereinheit in die
manuelle Betriebsposition gebracht wird.
Steuermedium: Dies ist das Medium, in der
Regel Luft oder Gas, das für die Versorgung
des Ventilstellungsreglers oder der
automatischen Steuereinheit verwendet wird.
Betriebsgrenzen*: Der Bereich der
Betriebsbedingungen, denen ein Gerät ohne
eine dauerhafte Beeinträchtigung der
Betriebseigenschaften ausgesetzt werden kann.
OSHA: Abkürzung für Occupational Safety
and Health Administration. (U.S.)
29

Stellventil-Handbuch | Kapitel 1: Einführung in Stellventile
Packung: Der Teil der Ventileinheit, der zur
Abdichtung gegen Leckagen um die
Ventilscheibe bzw. -klappe oder die
Ventilspindel verwendet wird.
Stellungsregler*: Ein Stellungsregler
(Servomechanismus), der mechanisch mit
einem beweglichen Teil eines Stellglieds oder
seines Antriebs verbunden ist und seinen
Ausgang automatisch an das Stellglied
anpasst, um eine gewünschte Position
proportional zum Eingangssignal zu halten.
Prozess: Alle kombinierten Elemente im
Regelkreis, außer der Steuereinheit.
Manchmal bezieht sich „Prozess“ auch auf das
Medium, das durch den Regelkreis ießt.
Prozesserhöhung: Das Verhältnis der
Änderung einer geregelten Prozessvariablen
zu einer entsprechenden Änderung im
Ausgang der Steuereinheit.
Prozessvariabilität: Ein genaues statistisches
Maß dafür, wie genau der Prozess über den
Sollwert geregelt wird. Die Prozessvariabilität
wird in Prozent deniert (in der Regel 2 s/m),
wobei „m“ der Sollwert oder Mittelwert der
gemessenen Prozessvariablen und „s“ die
Standardabweichung der Prozessvariablen
darstellen.
Schnellöffnende Kennlinie (QuickOpening, QO)*: Eine inhärente
Strömungseigenschaft, bei der ein maximaler
Durchusskoefzient bei minimalem Weg des
Verschlusselements erreicht wird.
Bereich: Der Bereich zwischen den
Grenzwerten, innerhalb dessen eine Größe
gemessen, empfangen oder übertragen wird,
ausgedrückt durch Angabe des unteren und
oberen Grenzwertes des Bereichs. Beispiel: 3
bis 15 psi; -40 bis 100 °C (-40 bis 212 °F).
Relais: Ein Gerät, das als Leistungsverstärker
fungiert. Es nimmt ein elektrisches,
pneumatisches oder mechanisches
Eingangssignal auf und gibt einen großen
Volumenstrom an Luft oder
Hydrauliküssigkeit an den Antrieb ab. Das
Relais kann ein internes Bauteil des
Stellungsreglers oder ein separates
Ventilzubehör sein.
Reproduzierbarkeit*: Die
Reproduzierbarkeit ist eine Anzahl von
aufeinander folgenden Messungen des
Ausgangs bei gleichem Eingangswert,
identischen Betriebsbedingungen und
gleicher Durchussrichtung über den
gesamten Bereich. Sie wird üblicherweise als
Nichtreproduzierbarkeit gemessen und als
Reproduzierbarkeit in Prozent der Spanne
ausgedrückt. Sie berücksichtigt keine
Hysterese.
Auflösung: Die kleinstmögliche erforderliche
Eingangsänderung, um eine beobachtbare
Ausgangsänderung zu erzeugen, wenn keine
Umkehrung des Eingangs erfolgt. Die
Auösung wird in der Regel in Prozent der
Eingangsspanne ausgedrückt.
Ansprechzeit: Wird in der Regel durch einen
Parameter gemessen, der sowohl die Totzeit
als auch die Zeitkonstante enthält. (Siehe
„T63“, „Totzeit“ und „Zeitkonstante“.) Bei
Anwendung auf eine Armatur umfasst die
Ansprechzeit die gesamte Armatureinheit.
Zweite Ordnung: Ein Begriff, der sich auf das
dynamische Verhältnis zwischen dem Einund Ausgang eines Gerätes bezieht. Ein
System oder Gerät zweiter Ordnung verfügt
über zwei Energiespeicher, die kinetische und
potentielle Energie zwischen sich hin und her
übertragen können. Dadurch entsteht die
Möglichkeit eines Schwingungsverhaltens
und von Überschwingungen.
Empfindlichkeit*: Das Verhältnis der
Ausgangsgrößenänderung zur
Eingangsgrößenänderung, die nach dem
Erreichen des Ruhezustandes verursacht wird.
Sensor: Ein Gerät, das den Wert einer
Prozessvariablen erfasst und ein
entsprechendes Ausgangssignal an einen
Messumformer sendet. Der Sensor kann ein
integriertes Teil des Messumformers oder ein
separates Bauteil sein.
Sollwert: Ein Referenzwert, der den
gewünschten Wert der zu regelnden
Prozessvariablen darstellt.
Torsionsbewegung einer Welle: Ein
Phänomen, bei dem sich das eine Ende einer
Ventilwelle dreht und das andere nicht. Dies
tritt gelegentlich bei Drehventilen auf, bei
denen der Antrieb über eine relativ lange
Welle mit dem Verschlusselement des Ventils
verbunden ist. Während die Reibung der
Dichtung in der Armatur ein Ende der Welle in
Position hält, wird die Drehung der Welle am
30
 Loading...
Loading...