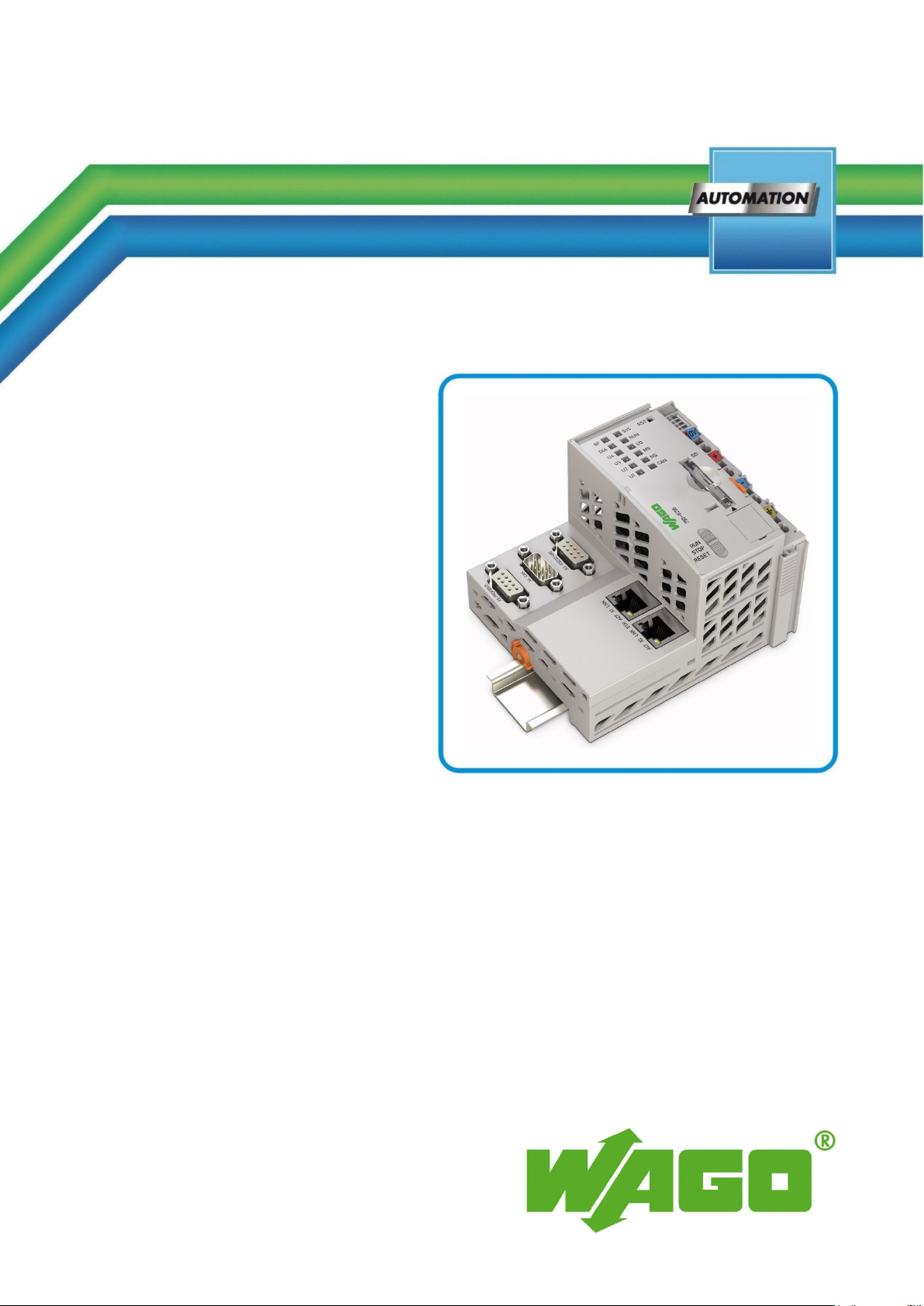
Handbuch
WAGO-I/O-SYSTEM 750
PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
750-8206(/xxx-xxx)
SPS - Controller PFC200
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)
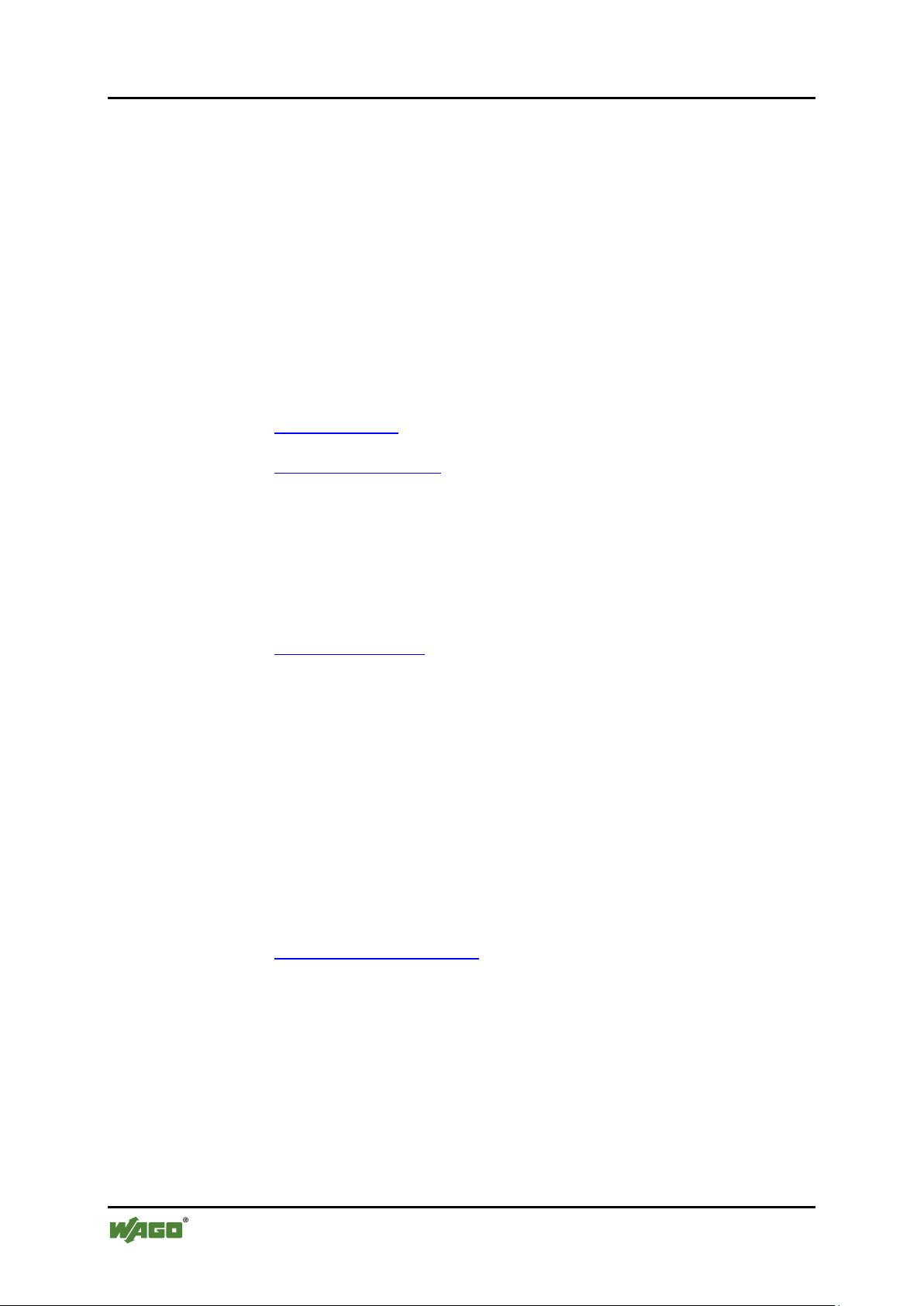
2 WAGO-I/O-SYSTEM 750
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
© 2014 by WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten.
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastraße 27
D-32423 Minden
Tel.: +49 (0) 571/8 87 – 0
Fax: +49 (0) 571/8 87 – 1 69
E-Mail: info@wago.com
Web: http://www.wago.com
Technischer Support
Tel.: +49 (0) 571/8 87 – 5 55
Fax: +49 (0) 571/8 87 – 85 55
E-Mail: support@wago.com
Es wurden alle erdenklichen Maßnahmen getroffen, um die Richtigkeit und
Vollständigkeit der vorliegenden Dokumentation zu gewährleisten. Da sich
Fehler, trotz aller Sorgfalt, nie vollständig vermeiden lassen, sind wir für
Hinweise und Anregungen jederzeit dankbar.
E-Mail: documentation@wago.com
Wir weisen darauf hin, dass die im Handbuch verwendeten Soft- und HardwareBezeichnungen und Markennamen der jeweiligen Firmen im Allgemeinen einem
Warenzeichenschutz, Markenzeichenschutz oder patentrechtlichem Schutz
unterliegen.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Inhaltsverzeichnis 3
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
Inhaltsverzeichnis
1 Hinweise zu dieser Dokumentation .......................................................... 13
1.1 Gültigkeitsbereich ................................................................................... 13
1.2 Urheberschutz ......................................................................................... 13
1.3 Symbole ................................................................................................... 14
1.4 Darstellung der Zahlensysteme ............................................................... 15
1.5 Schriftkonventionen ................................................................................ 15
2 Wichtige Erläuterungen ............................................................................ 16
2.1 Rechtliche Grundlagen ............................................................................ 16
2.1.1 Änderungsvorbehalt ........................................................................... 16
2.1.2 Personalqualifikation .......................................................................... 16
2.1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung des WAGO-I/O-SYSTEMs 750 16
2.1.4 Technischer Zustand der Geräte ......................................................... 17
2.2 Sicherheitshinweise ................................................................................. 18
2.3 Spezielle Einsatzbestimmungen für ETHERNET-Geräte ...................... 20
3 Gerätebeschreibung ................................................................................... 21
3.1 Ansicht .................................................................................................... 24
3.2 Anschlüsse ............................................................................................... 26
3.2.1 Datenkontakte/Klemmenbus .............................................................. 26
3.2.2 Leistungskontakte/Feldversorgung..................................................... 27
3.2.3 CAGE CLAMP®-Anschlüsse ............................................................. 28
3.2.4 Service-Schnittstelle ........................................................................... 29
3.2.5 Netzwerkanschlüsse – X1, X2 ............................................................ 30
3.2.6 Kommunikationsanschluss RS-232/RS-485 – X3.............................. 31
3.2.6.1 Betrieb als RS-232-Schnittstelle .................................................... 32
3.2.6.2 Betrieb als RS-485-Schnittstelle .................................................... 33
3.2.7 Feldbusanschluss CANopen – X4 ...................................................... 34
3.2.8 Feldbusanschluss PROFIBUS DP – X5 ............................................. 36
3.3 Anzeigeelemente ..................................................................................... 38
3.3.1 Anzeigeelemente Versorgung ............................................................ 38
3.3.2 Anzeigeelemente Feldbus/System ...................................................... 39
3.3.3 Anzeigeelemente Speicherkartensteckplatz ....................................... 40
3.3.4 Anzeigeelemente Netzwerk ................................................................ 41
3.4 Bedienelemente ....................................................................................... 42
3.4.1 Betriebsartenschalter .......................................................................... 42
3.4.2 Reset-Taster ........................................................................................ 43
3.5 Speicherkartensteckplatz ......................................................................... 44
3.6 Schematisches Schaltbild ........................................................................ 45
3.7 Technische Daten .................................................................................... 46
3.7.1 Gerätedaten ......................................................................................... 46
3.7.2 Systemdaten ........................................................................................ 46
3.7.3 Versorgung ......................................................................................... 46
3.7.4 Uhr ...................................................................................................... 46
3.7.5 Programmierung ................................................................................. 47
3.7.6 Klemmenbus ....................................................................................... 47
3.7.7 ETHERNET ....................................................................................... 47
3.7.8 CANopen ............................................................................................ 47
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

4 Inhaltsverzeichnis WAGO-I/O-SYSTEM 750
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
3.7.9 PROFIBUS ......................................................................................... 48
3.7.10 Serielle Schnittstelle ........................................................................... 48
3.7.11 Anschlusstechnik ................................................................................ 49
3.7.12 Klimatische Umweltbedingungen ...................................................... 49
3.8 Zulassungen ............................................................................................. 50
3.9 Normen und Richtlinien .......................................................................... 50
4 Funktionsbeschreibung ............................................................................. 51
4.1 Netzwerkkonfiguration ........................................................................... 51
4.1.1 Betrieb im Switch-Modus................................................................... 51
4.1.2 Betrieb mit getrennten Netzwerk-Schnittstellen ................................ 51
5 Montieren.................................................................................................... 52
5.1 Einbaulage ............................................................................................... 52
5.2 Gesamtaufbau .......................................................................................... 52
5.3 Montage auf Tragschiene ........................................................................ 54
5.3.1 Tragschieneneigenschaften ................................................................. 54
5.3.2 WAGO-Tragschienen ......................................................................... 55
5.4 Abstände .................................................................................................. 55
5.5 Montagereihenfolge ................................................................................ 56
5.6 Geräte einfügen ....................................................................................... 57
5.6.1 Feldbuskoppler/-controller einfügen .................................................. 57
5.6.2 Busklemme einfügen .......................................................................... 58
6 Geräte anschließen ..................................................................................... 59
6.1 Leiter an CAGE CLAMP® anschließen .................................................. 59
6.2 Einspeisekonzept ..................................................................................... 60
6.2.1 Ergänzende Einspeisevorschriften...................................................... 60
7 In Betrieb nehmen...................................................................................... 62
7.1 Einschalten des Controllers ..................................................................... 62
7.2 Ermitteln der IP-Adresse des Host-PC .................................................... 63
7.3 Einstellen einer IP-Adresse ..................................................................... 64
7.3.1 Zuweisen einer IP-Adresse mittels DHCP ......................................... 65
7.3.2 Ändern einer IP-Adresse mit dem Konfigurationstool „CBM“ über die
serielle Schnittstelle ............................................................................ 66
7.3.3 Ändern einer IP-Adresse mit „WAGO Ethernet Settings“................. 69
7.4 Testen der Netzwerkverbindung ............................................................. 71
7.5 Ausschalten/Neustart ............................................................................... 72
7.6 Reset-Funktionen auslösen ...................................................................... 73
7.6.1 Warmstart-Reset ................................................................................. 73
7.6.2 Kaltstart-Reset .................................................................................... 73
7.6.3 Software-Reset (Neustart) .................................................................. 73
7.6.4 Fixe IP-Adresse einstellen .................................................................. 73
7.6.5 Factory-Reset ...................................................................................... 74
7.7 Benutzer und Passwörter ......................................................................... 76
7.7.1 Dienste und Benutzer ......................................................................... 76
7.7.2 Gruppe WBM ..................................................................................... 77
7.7.3 Gruppe Linux-User ............................................................................. 77
7.7.4 Gruppe SNMP-User ........................................................................... 77
7.8 Konfigurieren .......................................................................................... 78
7.8.1 Konfiguration mittels Web-based Management (WBM) ................... 79
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Inhaltsverzeichnis 5
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
7.8.1.1 Benutzerverwaltung des WBM ...................................................... 80
7.8.1.2 Allgemeine Seiteninformationen ................................................... 82
7.8.1.3 Seite „Status Information“ ............................................................. 84
7.8.1.3.1 Gruppe „Controller Details“ ..................................................... 84
7.8.1.3.2 Gruppe(n) „Network Details (Xn)“ ........................................... 84
7.8.1.4 Seite „CODESYS Configuration“ ................................................. 85
7.8.1.4.1 Gruppe „General Configuration“ .............................................. 85
7.8.1.5 Seite „CODESYS Information“ .................................................... 86
7.8.1.5.1 Gruppe „CODESYS“ ................................................................ 86
7.8.1.5.2 Gruppe „Projekt Details“ .......................................................... 86
7.8.1.5.3 Gruppe(n) „Task n“ ................................................................... 86
7.8.1.6 Seite „CODESYS WebVisu“ ........................................................ 88
7.8.1.6.1 Gruppe „Webserver Configuration“ ......................................... 88
7.8.1.7 Seite „Configuration of Network Parameters“ .............................. 89
7.8.1.7.1 Gruppe „Hostname“ .................................................................. 89
7.8.1.7.2 Gruppe „Domain Name“ ........................................................... 89
7.8.1.8 Seite „TCP/IP Configuration“ ....................................................... 90
7.8.1.8.1 Gruppe „Switch Configuration“................................................ 90
7.8.1.8.2 Gruppe(n) „IP Address (Xn)“ ................................................... 90
7.8.1.8.3 Gruppe „Default Gateway“ ....................................................... 91
7.8.1.8.4 Gruppe „DNS Server“ ............................................................... 91
7.8.1.9 Seite „Configuration of ETHERNET Parameters“ ........................ 92
7.8.1.9.1 Gruppen „Interface Xn“ ............................................................ 92
7.8.1.10 Seite „Configuration of Time and Date“ ....................................... 93
7.8.1.10.1 Gruppe „Date on Device“ ......................................................... 93
7.8.1.10.2 Gruppe „Time on Device“ ........................................................ 93
7.8.1.10.3 Gruppe „Timezone“ .................................................................. 94
7.8.1.10.4 Gruppe „TZ String“ .................................................................. 94
7.8.1.11 Seite „Configuration of the users for the Web-based Management“95
7.8.1.11.1 Gruppe „Change Password for selected user“ .......................... 95
7.8.1.12 Seite „Create bootable Image“ ....................................................... 96
7.8.1.12.1 Gruppe „Create bootable image from active partition (<active
partition>“ ................................................................................. 96
7.8.1.13 Seite „Configuration of Serial Interface RS232“ ........................... 97
7.8.1.13.1 Gruppe „ Serial Interface assigned to“ ...................................... 97
7.8.1.13.2 Gruppe „Assign Owner of serial Interface (active after next
controller reboot)“ ..................................................................... 97
7.8.1.14 Seite „Reboot Controller“ .............................................................. 98
7.8.1.14.1 Gruppe „Reboot Controller“ ..................................................... 98
7.8.1.15 Seite „Firmware Backup“ .............................................................. 99
7.8.1.16 Seite „Firmware Restore“ ............................................................ 100
7.8.1.17 Seite „System Partition“ .............................................................. 101
7.8.1.17.1 Gruppe „Current active Partition“ ........................................... 101
7.8.1.17.2 Gruppe „Set inactive NAND partition active“ ........................ 101
7.8.1.18 Seite „Mass Storage“ ................................................................... 102
7.8.1.18.1 Gruppe(n) „<Device Name>“ ................................................. 102
7.8.1.18.2 Gruppe(n) „<Device Name> - FAT Format“ .......................... 102
7.8.1.19 Seite „Software Uploads“ ............................................................ 103
7.8.1.19.1 Gruppe „Upload new Software“ ............................................. 103
7.8.1.19.2 Gruppe „Activate new Software“ ........................................... 103
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

6 Inhaltsverzeichnis WAGO-I/O-SYSTEM 750
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
7.8.1.20 Seite „Configuration of Network Services“ ................................ 104
7.8.1.20.1 Gruppe „Telnet“ ...................................................................... 104
7.8.1.20.2 Gruppe „FTP“ ......................................................................... 104
7.8.1.20.3 Gruppe „FTPS“ ....................................................................... 104
7.8.1.20.4 Gruppe „HTTP“ ...................................................................... 104
7.8.1.20.5 Gruppe „HTTPS“ .................................................................... 105
7.8.1.21 Seite „Configuration of NTP Client“ ........................................... 106
7.8.1.21.1 Gruppe „NTP Client“ .............................................................. 106
7.8.1.22 Seite „Configuration of the CODESYS Services“ ...................... 107
7.8.1.22.1 Gruppe „CODESYS Webserver“............................................ 107
7.8.1.22.2 Gruppe „Communication“ ...................................................... 107
7.8.1.22.3 Gruppe „Port Authentication“ ................................................. 107
7.8.1.22.4 Gruppe „Port Authentication Password“ ................................ 107
7.8.1.23 Seite „SSH Client Settings“ ......................................................... 109
7.8.1.23.1 Gruppe „SSH Client“ .............................................................. 109
7.8.1.24 Seite „TFTP Server“ .................................................................... 110
7.8.1.24.1 Gruppe „TFTP Server“ ........................................................... 110
7.8.1.25 Seite „Configuration of SNMP parameter“ ................................. 111
7.8.1.25.1 Gruppe „General SNMP Configuration“ ................................ 111
7.8.1.26 Seite „Configuration of SNMP parameter“ ................................. 112
7.8.1.26.1 Gruppe „SNMP v1/v2c Manager Configuration“ ................... 112
7.8.1.26.2 Gruppe(n) „Actually Configured Trap Receivers“ ................. 112
7.8.1.26.3 Gruppe(n) „Trap Receiver n“ .................................................. 113
7.8.1.26.4 Gruppe „Add new Trap Receiver“ .......................................... 113
7.8.1.27 Seite „Configuration of SNMP v3 Users“ ................................... 114
7.8.1.27.1 Gruppe(n) „Actually Configured v3 Users“ ........................... 114
7.8.1.27.2 Gruppe(n) „v3 User n“ ............................................................ 114
7.8.1.27.3 Gruppe „Add new v3 User“ .................................................... 115
7.8.1.28 Seite „Diagnostic Information“ ................................................... 116
7.8.1.29 Seite „Configuration of PROFIBUS DP Slave“ .......................... 117
7.8.1.29.1 Gruppe „Set-Slave-Address Service (SSA)“ .......................... 117
7.8.2 Konfiguration mit einem Terminalprogramm (CBM) ..................... 118
7.8.3 Konfigurieren mit WAGO Ethernet Settings ................................... 119
7.8.3.1 Registerkarte Identifikation ......................................................... 121
7.8.3.2 Registerkarte Netzwerk ............................................................... 122
7.8.3.3 Registerkarte Protokoll ................................................................ 124
7.8.3.4 Registerkarte Status ..................................................................... 125
8 Laufzeitumgebung CODESYS 2.3 ......................................................... 126
8.1 Installieren des Programmiersystems CODESYS 2.3 .......................... 126
8.2 Das erste Programm mit CODESYS 2.3 ............................................... 126
8.2.1 Starten Sie das Programmiersystem CODESYS .............................. 126
8.2.2 Anlegen eines Projekts und Auswahl des Zielsystems..................... 126
8.2.3 Anlegen der Steuerungskonfiguration .............................................. 128
8.2.4 Editieren des Programmbausteins .................................................... 135
8.2.5 SPS-Programm in den Feldbuscontroller laden und ausführen
(Ethernet) .......................................................................................... 137
8.2.6 Boot-Projekt erzeugen ...................................................................... 139
8.3 Schreibweise logischer Adressen .......................................................... 139
8.4 Anlegen von Tasks ................................................................................ 140
8.4.1 Zyklische Tasks ................................................................................ 143
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)
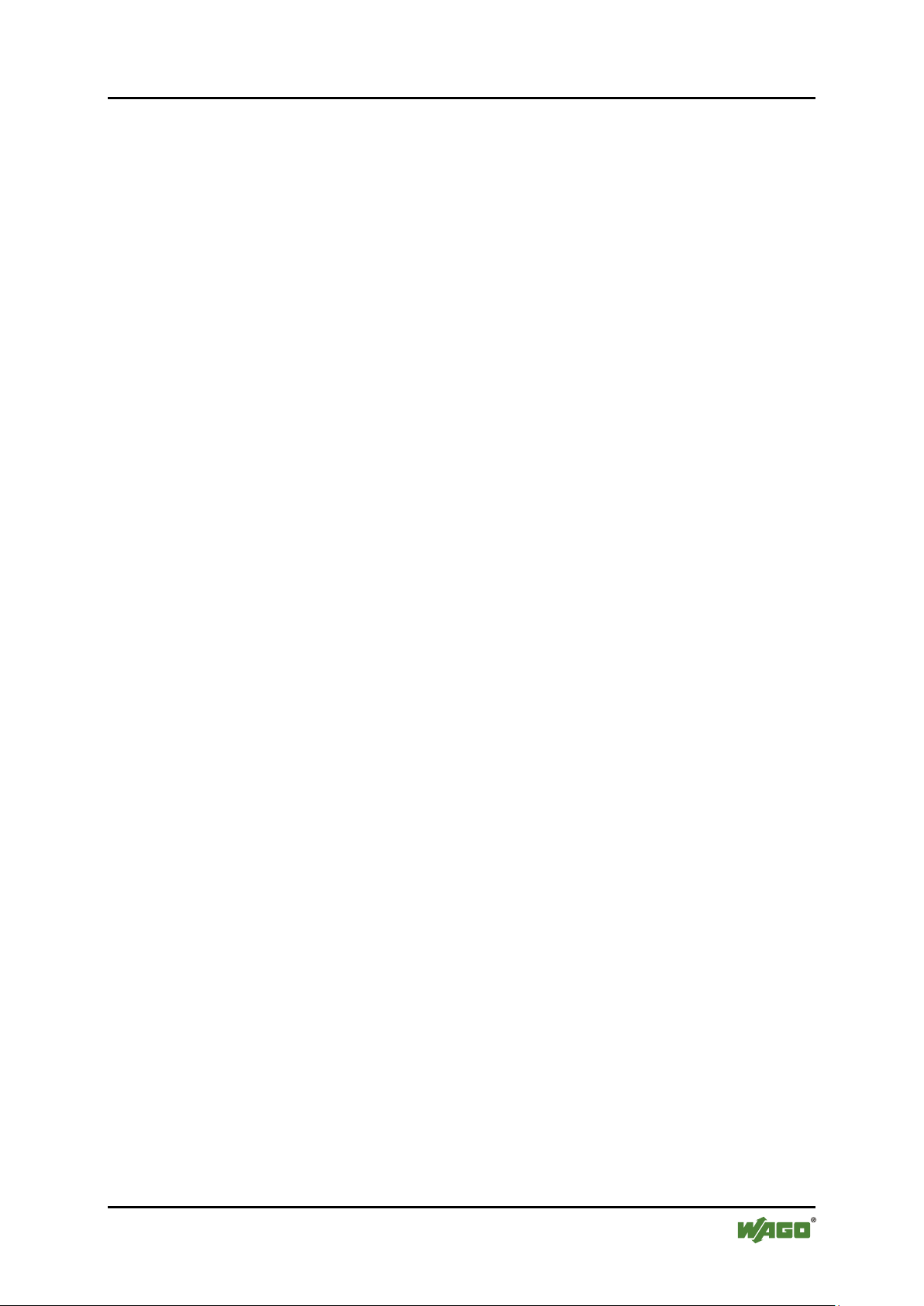
WAGO-I/O-SYSTEM 750 Inhaltsverzeichnis 7
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
8.4.2 Freilaufende Tasks............................................................................ 144
8.5 Systemereignisse ................................................................................... 144
8.5.1 Einen Ereignis-Handler anlegen ....................................................... 147
8.6 Prozessabbilder ..................................................................................... 149
8.6.1 Prozessabbild für die am Controller angeschlossenen Busklemmen 151
8.6.2 Prozessabbild für die am Feldbus angeschlossenen Slaves .............. 152
8.7 Zugriff auf die Prozessabbilder der Ein- und Ausgangsdaten über
CODESYS 2.3 ....................................................................................... 152
8.8 Adressierungsbeispiel ........................................................................... 154
8.9 Klemmenbussynchronisation ................................................................ 155
8.9.1 Fall 1: CODESYS-Task-Intervall kleiner als Klemmenbuszyklus
eingestellt .......................................................................................... 155
8.9.2 Fall 2: CODESYS-Task-Intervall kleiner als doppelter
Klemmenbuszyklus .......................................................................... 157
8.9.3 Fall 3: CODESYS-Task-Intervall größer als doppelter
Klemmenbuszyklus .......................................................................... 158
8.9.4 Fall 4: CODESYS-Task-Intervall größer als 10 ms ......................... 159
8.9.5 Klemmenbuskonfiguration ............................................................... 160
8.9.5.1 Auswirkung des Update-Modus auf CODESYS-Tasks .............. 161
8.9.5.1.1 Asynchroner Update-Modus ................................................... 161
8.9.5.1.2 Synchroner Update-Modus ..................................................... 162
8.10 Speichereinstellungen in CODESYS .................................................... 162
8.10.1 Programmspeicher ............................................................................ 162
8.10.2 Datenspeicher und Bausteinbegrenzung........................................... 163
8.10.3 Remanenter Arbeitsspeicher ............................................................. 164
8.11 CODESYS-Visualisierung .................................................................... 165
8.11.1 Grenzen der CODESYS-Visualisierung ........................................... 168
8.11.2 Beseitigung von Störungen der CODESYS-Web-Visualisierung .... 170
8.11.3 Häufig gestellte Fragen zur CODESYS-Web-Visualisierung .......... 171
9 MODBUS .................................................................................................. 173
9.1 Allgemeines ........................................................................................... 173
9.2 Features ................................................................................................. 173
9.3 Konfiguration ........................................................................................ 174
9.3.1 MODBUS-Einstellungen .................................................................. 175
9.3.2 MODBUS-TCP-Einstellungen ......................................................... 176
9.3.3 MODBUS-UDP-Einstellungen ........................................................ 176
9.3.4 MODBUS-RTU-Einstellungen ........................................................ 177
9.4 Datenaustausch ...................................................................................... 179
9.4.1 Prozessabbild .................................................................................... 180
9.4.2 Merkerbereich................................................................................... 181
9.4.3 MODBUS-Register .......................................................................... 182
9.4.4 MODBUS-Mapping ......................................................................... 182
9.4.4.1 MODBUS-Mapping für lesende Bit-Dienste FC1, FC2 .............. 182
9.4.4.2 MODBUS-Mapping für schreibende Bit-Dienste FC5, FC15 .... 183
9.4.4.3 MODBUS-Mapping für lesende Register-Dienste FC3, FC4, FC23184
9.4.4.4 MODBUS-Mapping für schreibende Register-Dienste FC6, FC16,
FC22, FC23 .................................................................................. 186
9.5 WAGO-MODBUS-Register ................................................................. 188
9.5.1 Prozessabbildeigenschaften .............................................................. 189
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

8 Inhaltsverzeichnis WAGO-I/O-SYSTEM 750
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
9.5.1.1 Register 0x1022 – Anzahl Register im MODBUS-
Eingangsprozessabbild ................................................................ 189
9.5.1.2 Register 0x1023 – Anzahl Register im MODBUS-
Ausgangsprozessabbild ................................................................ 189
9.5.1.3 Register 0x1024 – Anzahl der Bits im MODBUS-
Eingangsprozessabbild ................................................................ 189
9.5.1.4 Register 0x1025 – Anzahl der Bits im MODBUS-
Ausgangsprozessabbild ................................................................ 189
9.5.2 Netzwerkkonfiguration ..................................................................... 190
9.5.2.1 Register 0x1028 – IP-Konfiguration ........................................... 190
9.5.2.2 Register 0x102A – Anzahl der etablierten TCP Verbindungen .. 190
9.5.2.3 Register 0x1030 – MODBUS TCP Socket Timeout ................... 190
9.5.2.4 Register 0x1031 – MAC-Adresse der Ethernet-Schnittstelle 1
(eth0) ............................................................................................ 190
9.5.2.5 Register 0x1037 - MODBUS TCP Antwortverzögerung ............ 190
9.5.3 PLC-Statusregister ............................................................................ 191
9.5.4 MODBUS-Watchdog ....................................................................... 191
9.5.4.1 Register 0x1100 – Watchdog Command ..................................... 191
9.5.4.2 Register 0x1101 – Watchdog Status ............................................ 193
9.5.4.3 Register 0x1102 – Watchdog Timeout ........................................ 194
9.5.4.4 Register 0x1103 – Watchdog Config .......................................... 194
9.5.5 MODBUS Konstanten-Register ....................................................... 195
9.5.6 Elektronisches Typenschild .............................................................. 195
9.5.6.1 Register 0x2010 – Revision (Firmware Index) ........................... 196
9.5.6.2 Register 0x2011 – Serienkennung ............................................... 196
9.5.6.3 Register 0x2012 – Gerätekennung ............................................... 196
9.5.6.4 Register 0x2013 – Major Firmware Version ............................... 196
9.5.6.5 Register 0x2014 – Minor Firmware Version ............................... 196
9.5.6.6 Register 0x2015 – MBS Version ................................................. 196
9.6 Diagnose ................................................................................................ 197
9.6.1 Diagnose für den MODBUS-Master ................................................ 197
9.6.2 Diagnose für das Laufzeitsystem...................................................... 197
9.6.3 Diagnose über den Error-Server ....................................................... 197
10 CANopen-Master und -Slave .................................................................. 200
10.1 Objektverzeichnis .................................................................................. 200
10.2 Kommunikationsprofil .......................................................................... 200
10.2.1 Masterkonfiguration ......................................................................... 204
10.3 Datenaustausch ...................................................................................... 205
10.3.1 Kommunikationsobjekte des Controllers ......................................... 206
10.3.2 Feldbusspezifische Adressierung ..................................................... 206
10.3.3 Beispiele für die Definition von PFC-Feldbusvariablen .................. 209
10.3.3.1 CODESYS-Zugriff auf PFC-Variablen ....................................... 210
10.3.3.2 Maximale Indizes ......................................................................... 210
10.3.4 Steuerungskonfiguration des CANopen-Masters ............................. 212
10.3.4.1 Master auswählen ........................................................................ 212
10.3.4.2 Master-Parameter einstellen ........................................................ 213
10.3.4.3 Einfügen der Slaves ..................................................................... 215
10.3.4.4 Konfigurieren der Slave PDOs .................................................... 221
10.3.4.5 Konfigurieren der Service Data Objekte ..................................... 224
10.3.5 Steuerungskonfiguration des CANopen-Slaves ............................... 227
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Inhaltsverzeichnis 9
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
10.3.5.1 Konfiguration der CANopen-Variablen ...................................... 228
10.3.5.2 Konfiguration der CANopen-Parameter ...................................... 229
10.4 Diagnose des Feldbuskopplers .............................................................. 230
10.4.1 DiagGetBusState() und DiagGetState() ........................................... 230
10.4.2 Erstellen von Diagnosefunktionen in CODESYS 2.3 ...................... 231
10.4.3 Aufruf des Diagnosebausteins .......................................................... 233
10.4.4 Durchführen der Busdiagnose mittels DiagGetBusState() ............... 234
10.4.5 Durchführen der Teilnehmerdiagnose mittels DiagGetState() ......... 236
10.4.6 Auswerten der CANopen-Diagnose (Emergency-Nachrichten) ...... 237
10.5 Datenaustausch von einfachen CAN-Teilnehmern mit dem PFC200 im
CANopen-Netzwerk .............................................................................. 239
10.6 Datenaustausch von einfachen CAN-Teilnehmern mit dem PFC200 im
CAN Layer2 Netzwerk ......................................................................... 242
11 PROFIBUS DP-V1-Slave-Schnittstelle .................................................. 243
11.1 In Betrieb nehmen ................................................................................. 243
11.1.1 GSD-Datei ........................................................................................ 243
11.1.2 Konfigurieren ................................................................................... 243
11.1.2.1 Informationen zum Prozessabbild der Feldbusvariablen ............. 244
11.1.2.2 Definition der Soll-Konfiguration ............................................... 246
11.1.2.3 Definition der Ist-Konfiguration .................................................. 246
11.1.3 Parametrieren .................................................................................... 250
11.1.3.1 Parametrieren über CODESYS .................................................... 251
11.1.3.2 Parametrieren über die GSD-Datei .............................................. 253
11.1.4 Erweiterte Konfigurationsprüfung (Anlauf bei Soll- ungleich Ist-
Ausbau)............................................................................................. 255
11.1.4.1 Diagnose von Konfigurationsfehlern ........................................... 255
11.2 PROFIBUS-Stationsdiagnose ............................................................... 256
11.2.1 Aufbau der Stationsdiagnose ............................................................ 258
11.2.1.1 Stationsstatus 1 … 3 .................................................................... 259
11.2.1.1.1 Stationsstatus 1 (Byte 0) ......................................................... 260
11.2.1.1.2 Stationsstatus 2 (Byte 1) ......................................................... 262
11.2.1.1.3 Stationsstatus 3 (Byte 2) ......................................................... 262
11.2.1.2 DP-Master-Adresse ...................................................................... 263
11.2.1.3 Herstellerkennung ........................................................................ 263
11.2.2 WAGO-Systemdiagnose .................................................................. 263
11.2.3 Kennungsbezogene Diagnose ........................................................... 266
11.2.4 Modulstatus ...................................................................................... 267
11.2.5 Kanalbezogene Diagnose ................................................................. 268
11.2.5.1 Fehlertypen der I/O-Module ........................................................ 269
11.2.6 Statusmeldungen............................................................................... 270
11.2.7 Alarmmeldungen .............................................................................. 272
11.3 Stationsadresse über den Feldbus setzen (SSA) .................................... 274
11.4 Erweiterte DP-V1-Funktionalitäten ...................................................... 274
11.4.1 Inbetriebnahme- und Wartungsfunktionen (I&M) ........................... 274
11.4.2 I&M0-Datensatz ............................................................................... 275
11.4.3 I&M1-Datensatz ............................................................................... 276
11.4.4 I&M2-Datensatz ............................................................................... 276
11.4.5 I&M3-Datensatz ............................................................................... 276
11.4.6 I&M4-Datensatz ............................................................................... 277
11.5 PROFIBUS-spezifische CODESYS-Funktionen .................................. 278
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

10 Inhaltsverzeichnis WAGO-I/O-SYSTEM 750
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
12 Diagnose .................................................................................................... 279
12.1 Betriebs- und Statusmeldungen ............................................................. 279
12.1.1 Anzeigeelemente Versorgung .......................................................... 279
12.1.2 Anzeigeelemente Feldbus/System .................................................... 280
12.2 Diagnosemeldungen (I/O-LED) ............................................................ 285
12.2.1 Ablauf der Blinksequenz .................................................................. 285
12.2.2 Beispiel einer Diagnosemeldung mittels Blinkcode ......................... 286
12.2.3 Bedeutung der Blinkcodes und Maßnahmen zur Fehlerbehebung ... 287
13 Service ....................................................................................................... 294
13.1 Speicherkarte einfügen und entfernen ................................................... 294
13.1.1 Speicherkarte einfügen ..................................................................... 294
13.1.2 Speicherkarte entfernen .................................................................... 294
14 Demontieren ............................................................................................. 296
14.1 Geräte entfernen .................................................................................... 296
14.1.1 Feldbuskoppler/-controller entfernen ............................................... 296
14.1.2 Busklemme entfernen ....................................................................... 297
15 Anhang ...................................................................................................... 298
15.1 Aufbau der Prozessdaten für die Busklemmen ..................................... 298
15.1.1 Digitaleingangsklemmen .................................................................. 299
15.1.1.1 1-Kanal-Digitaleingangsklemmen mit Diagnose ........................ 299
15.1.1.2 2-Kanal-Digitaleingangsklemmen ............................................... 299
15.1.1.3 2-Kanal-Digitaleingangsklemmen mit Diagnose ........................ 299
15.1.1.4 2-Kanal-Digitaleingangsklemmen mit Diagnose und
Ausgangsdaten ............................................................................. 300
15.1.1.5 4-Kanal-Digitaleingangsklemmen ............................................... 300
15.1.1.6 8-Kanal-Digitaleingangsklemmen ............................................... 300
15.1.1.7 8-Kanal-Digitaleingangsklemme PTC mit Diagnose und
Ausgangsdaten ............................................................................. 301
15.1.1.8 16-Kanal-Digitaleingangsklemmen ............................................. 301
15.1.2 Digitalausgangsklemmen ................................................................. 302
15.1.2.1 1-Kanal-Digitalausgangsklemmen mit Eingangsdaten ................ 302
15.1.2.2 2-Kanal-Digitalausgangsklemmen .............................................. 302
15.1.2.3 2-Kanal-Digitalausgangsklemmen mit Diagnose und
Eingangsdaten .............................................................................. 303
15.1.2.4 4-Kanal-Digitalausgangsklemmen .............................................. 304
15.1.2.5 4-Kanal-Digitalausgangsklemmen mit Diagnose und
Eingangsdaten .............................................................................. 304
15.1.2.6 8-Kanal-Digitalausgangsklemmen .............................................. 304
15.1.2.7 8-Kanal-Digitalausgangsklemmen mit Diagnose und
Eingangsdaten .............................................................................. 305
15.1.2.8 16-Kanal-Digitalausgangsklemmen ............................................ 305
15.1.2.9 8-Kanal-Digitaleingangsklemmen/-Digitalausgangsklemmen .... 306
15.1.3 Analogeingangsklemmen ................................................................. 307
15.1.3.1 1-Kanal-Analogeingangsklemmen .............................................. 307
15.1.3.2 2-Kanal-Analogeingangsklemmen .............................................. 307
15.1.3.3 4-Kanal-Analogeingangsklemmen .............................................. 308
15.1.3.4 3-Phasen-Leistungsmessklemme ................................................. 309
15.1.3.5 8-Kanal-Analogeingangsklemmen .............................................. 309
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Inhaltsverzeichnis 11
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
15.1.4 Analogausgangsklemmen ................................................................. 310
15.1.4.1 2-Kanal-Analogausgangsklemmen .............................................. 310
15.1.4.2 4-Kanal-Analogausgangsklemmen .............................................. 310
15.1.5 Sonderklemmen ................................................................................ 311
15.1.5.1 Zählerklemmen ............................................................................ 311
15.1.5.2 Pulsweitenklemmen ..................................................................... 313
15.1.5.3 Serielle Schnittstellen mit alternativem Datenformat .................. 313
15.1.5.4 Serielle Schnittstellen mit Standard-Datenformat ....................... 314
15.1.5.5 Datenaustauschklemmen ............................................................. 314
15.1.5.6 SSI-Geber-Interface-Busklemmen .............................................. 314
15.1.5.7 Weg- und Winkelmessung ........................................................... 315
15.1.5.8 DC-Drive Controller .................................................................... 317
15.1.5.9 Steppercontroller .......................................................................... 318
15.1.5.10 RTC-Modul .................................................................................. 319
15.1.5.11 DALI/DSI-Masterklemme ........................................................... 319
15.1.5.12 DALI-Multi-Master-Klemme ...................................................... 320
15.1.5.13 LON®-FTT-Klemme .................................................................... 322
15.1.5.14 Funkreceiver EnOcean ................................................................. 322
15.1.5.15 MP-Bus-Masterklemme ............................................................... 322
15.1.5.16 Bluetooth® RF-Transceiver .......................................................... 323
15.1.5.17 Schwingstärke/Wälzlagerüberwachung VIB I/O ........................ 324
15.1.5.18 KNX/EIB/TP1-Klemme .............................................................. 324
15.1.5.19 AS-Interface-Masterklemme ....................................................... 325
15.1.6 Systemklemmen ............................................................................... 326
15.1.6.1 Systemklemmen mit Diagnose .................................................... 326
15.1.6.2 Binäre Platzhalterklemmen .......................................................... 326
15.2 CODESYS-Bibliotheken ....................................................................... 328
15.2.1 Allgemeine Bibliotheken .................................................................. 328
15.2.1.1 CODESYS-Systembibliotheken .................................................. 328
15.2.1.2 SysLibCom.lib ............................................................................. 329
15.2.1.3 SysLibFile.lib ............................................................................... 329
15.2.1.4 SysLibFileAsync.lib .................................................................... 330
15.2.1.5 SysLibRtc.lib ............................................................................... 330
15.2.1.6 BusDiag.lib .................................................................................. 330
15.2.1.7 mod_com.lib ................................................................................ 331
15.2.1.8 SerComm.lib ................................................................................ 331
15.2.1.9 WagoConfigToolLIB.lib ............................................................. 331
15.2.1.10 WagoLibCpuUsage.lib ................................................................ 347
15.2.1.11 WagoLibDiagnosticIDs.lib .......................................................... 347
15.2.1.12 WagoLibLed.lib ........................................................................... 348
15.2.1.13 WagoLibNetSnmp.lib .................................................................. 348
15.2.1.14 WagoLibNetSnmpManager.lib .................................................... 348
15.2.1.15 WagoLibSSL.lib .......................................................................... 349
15.2.1.16 WagoLibTerminalDiag.lib ........................................................... 349
15.2.2 Bibliotheken für die CANopen- und CANLayer2-Anbindung ........ 350
15.2.2.1 WagoCANLayer2_02.lib ............................................................. 350
15.2.2.2 WagoCANopen_02.lib ................................................................ 350
15.2.3 Bibliotheken für die PROFIBUS-Anbindung .................................. 351
15.2.3.1 WAGO_DPS_01.lib .................................................................... 351
Abbildungsverzeichnis ...................................................................................... 352
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

12 Inhaltsverzeichnis WAGO-I/O-SYSTEM 750
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
Tabellenverzeichnis ........................................................................................... 356
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)
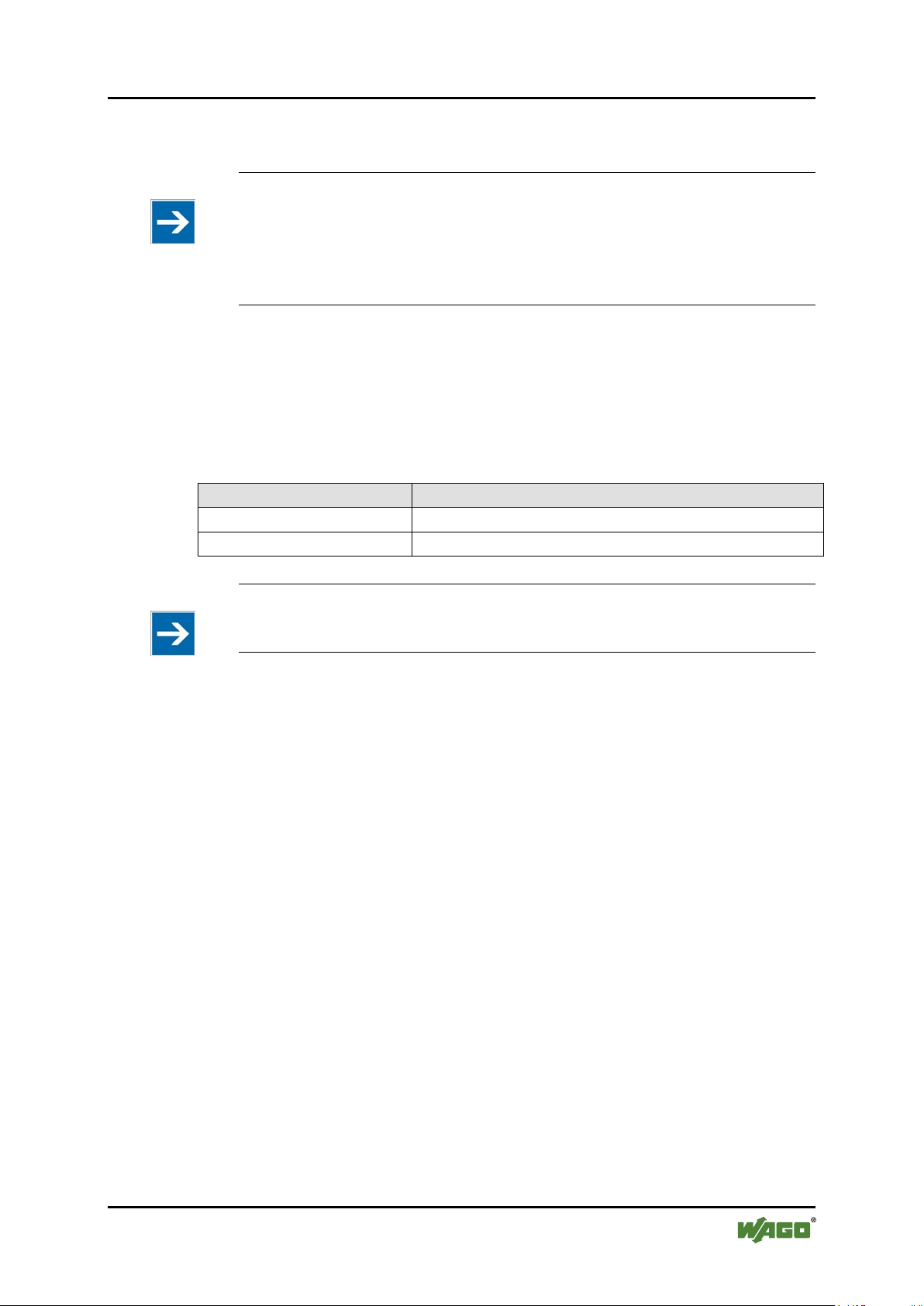
WAGO-I/O-SYSTEM 750 Hinweise zu dieser Dokumentation 13
Tabelle 1: Varianten
Bestellnummer/Variante
Bezeichnung
750-8206
PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
750-8206/025-000
PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS/T
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
1 Hinweise zu dieser Dokumentation
Hinweis
1.1 Gültigkeitsbereich
Dokumentation aufbewahren!
Diese Dokumentation ist Teil des Produkts. Bewahren Sie deshalb die
Dokumentation während der gesamten Nutzungsdauer des Produkts auf.
Geben Sie die Dokumentation an jeden nachfolgenden Benutzer des
Produkts weiter. Stellen Sie darüber hinaus sicher, dass gegebenenfalls jede
erhaltene Ergänzung in die Dokumentation mit aufgenommen wird.
Die vorliegende Dokumentation gilt für den Controller „PFC200 CS 2ETH RS
CAN DPS“ (750-8206) und die in der nachfolgenden Tabelle aufgelisteten
Varianten.
Hinweis
Gültigkeit der Angaben für Varianten
Die Angaben in dieser Dokumentation gelten für die aufgelisteten
Varianten, soweit nicht anders angegeben.
Die vorliegende Dokumentation gilt ab SW-Version 02.02.12(03).
1.2 Urheberschutz
Diese Dokumentation, einschließlich aller darin befindlichen Abbildungen, ist
urheberrechtlich geschützt. Jede Weiterverwendung dieser Dokumentation, die
von den urheberrechtlichen Bestimmungen abweicht, ist nicht gestattet. Die
Reproduktion, Übersetzung in andere Sprachen sowie die elektronische und
fototechnische Archivierung und Veränderung bedarf der schriftlichen
Genehmigung der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG, Minden.
Zuwiderhandlungen ziehen einen Schadenersatzanspruch nach sich.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)
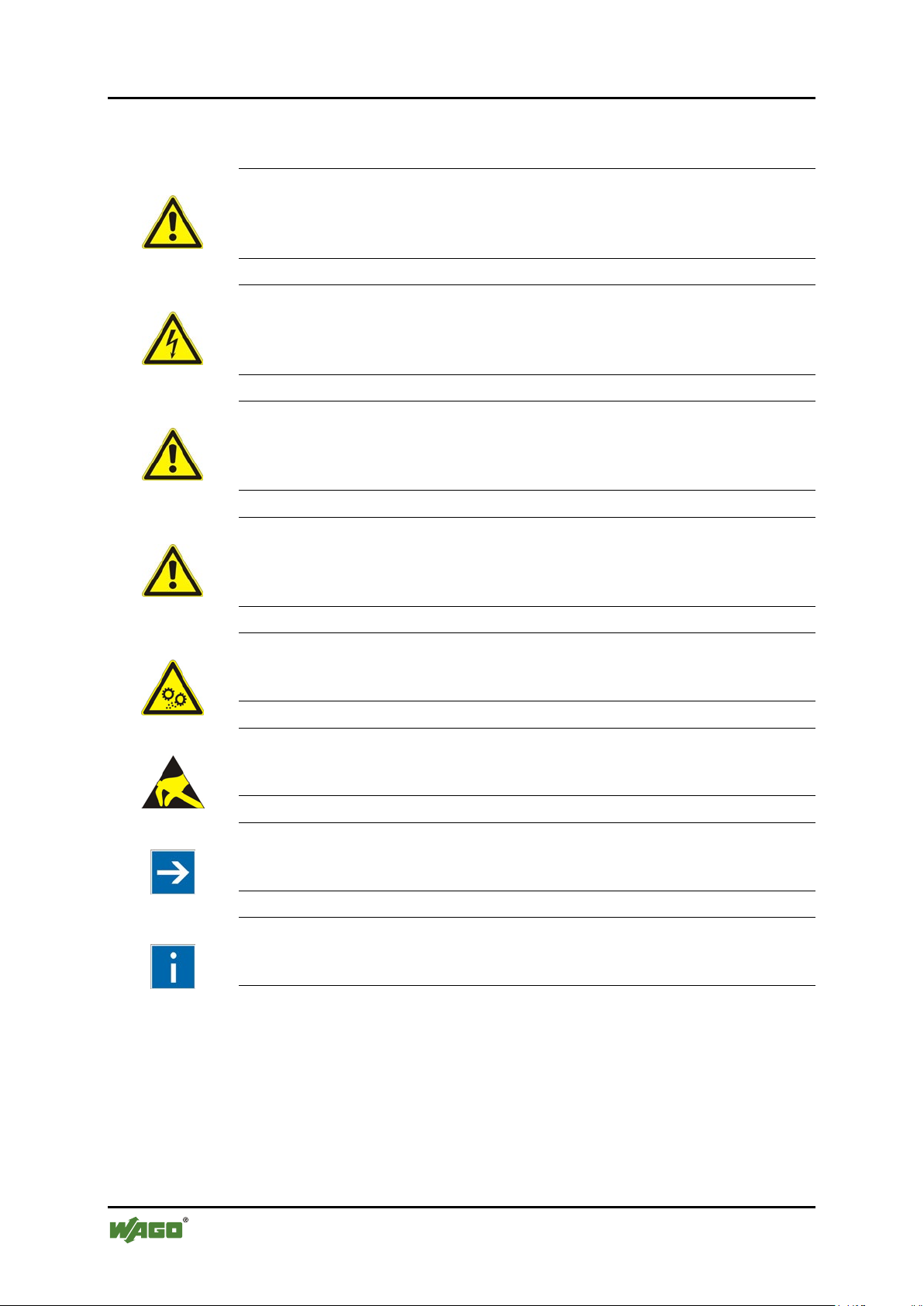
14 Hinweise zu dieser Dokumentation WAGO-I/O-SYSTEM 750
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
1.3 Symbole
GEFAHR
GEFAHR
WARNUNG
VORSICHT
Warnung vor Personenschäden!
Kennzeichnet eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod
oder schwere Körperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht
vermieden wird.
Warnung vor Personenschäden durch elektrischen Strom!
Kennzeichnet eine unmittelbare Gefährdung mit hohem Risiko, die Tod
oder schwere Körperverletzung zur Folge haben wird, wenn sie nicht
vermieden wird.
Warnung vor Personenschäden!
Kennzeichnet eine mögliche Gefährdung mit mittlerem Risiko, die Tod oder
(schwere) Körperverletzung zur Folge haben kann, wenn sie nicht
vermieden wird.
Warnung vor Personenschäden!
Kennzeichnet eine mögliche Gefährdung mit geringem Risiko, die leichte
oder mittlere Körperverletzung zur Folge haben könnte, wenn sie nicht
vermieden wird.
ACHTUNG
Warnung vor Sachschäden!
Kennzeichnet eine mögliche Gefährdung, die Sachschaden zur Folge haben
könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
ESD
Warnung vor Sachschäden durch elektrostatische Aufladung!
Kennzeichnet eine mögliche Gefährdung, die Sachschaden zur Folge haben
könnte, wenn sie nicht vermieden wird.
Hinweis
Wichtiger Hinweis!
Kennzeichnet eine mögliche Fehlfunktion, die aber keinen Sachschaden zur
Folge hat, wenn sie nicht vermieden wird.
Information
Weitere Information
Weist auf weitere Informationen hin, die kein wesentlicher Bestandteil
dieser Dokumentation sind (z. B. Internet).
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)
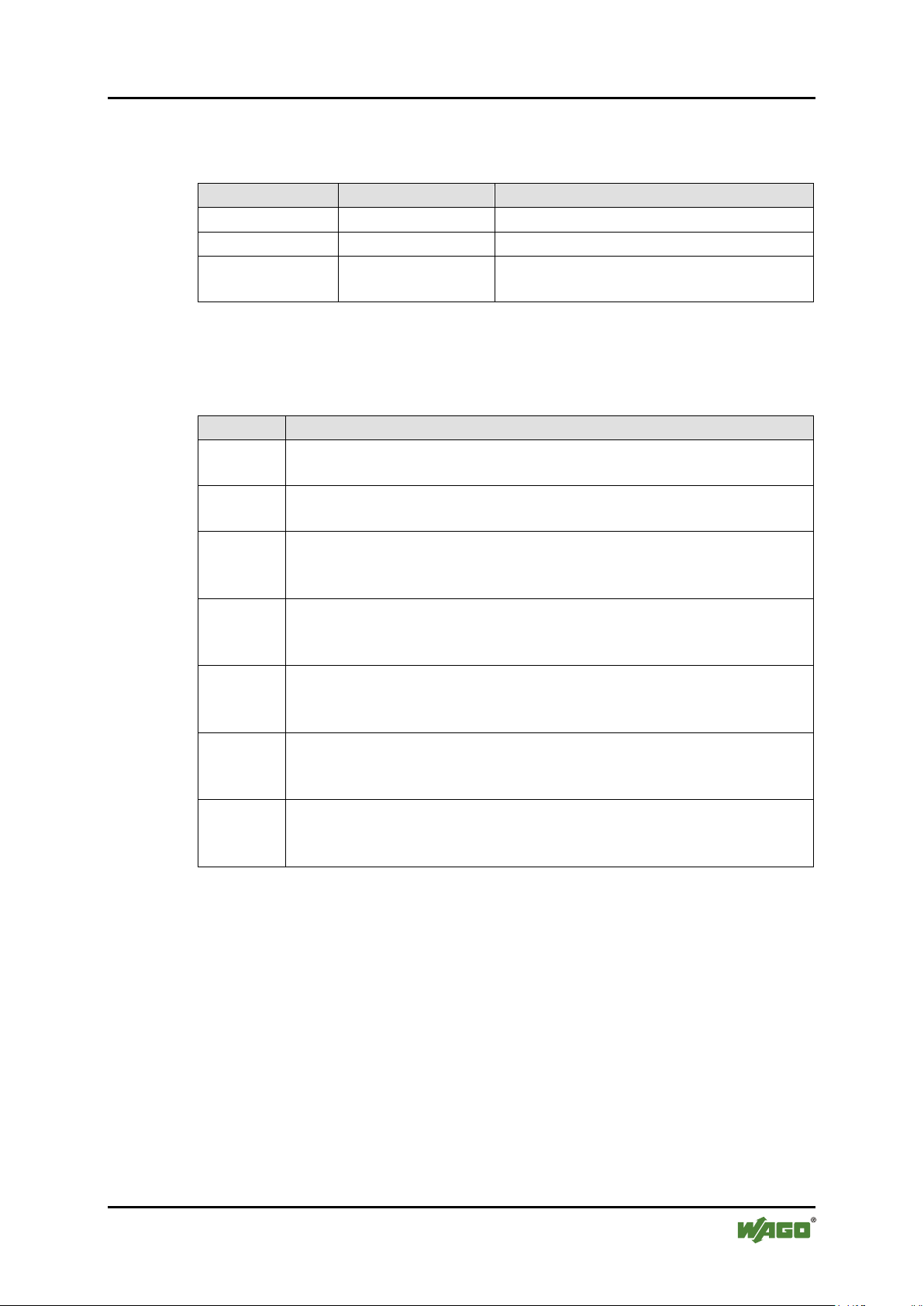
WAGO-I/O-SYSTEM 750 Hinweise zu dieser Dokumentation 15
Tabelle 2: Darstellungen der Zahlensysteme
Zahlensystem
Beispiel
Bemerkung
Dezimal
100
Normale Schreibweise
Hexadezimal
0x64
C-Notation
Binär
'100'
'0110.0100'
In Hochkomma,
Nibble durch Punkt getrennt
Tabelle 3: Schriftkonventionen
Schriftart
Bedeutung
kursiv
Namen von Pfaden und Dateien werden kursiv dargestellt z. B.:
C:\Programme\WAGO-I/O-CHECK
Menü
Menüpunkte werden fett dargestellt z. B.:
Speichern
>
Ein „Größer als“- Zeichen zwischen zwei Namen bedeutet die
Datei > Neu
Eingabe
Bezeichnungen von Eingabe- oder Auswahlfeldern werden fett
Messbereichsanfang
„Wert“
Eingabe- oder Auswahlwerte werden in Anführungszeichen
Geben Sie unter Messbereichsanfang den Wert „4 mA“ ein.
[Button]
Schaltflächenbeschriftungen in Dialogen werden fett dargestellt und
[Eingabe]
[Taste]
Tastenbeschriftungen auf der Tastatur werden fett dargestellt und in
[F5]
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
1.4 Darstellung der Zahlensysteme
1.5 Schriftkonventionen
Auswahl eines Menüpunktes aus einem Menü z. B.:
dargestellt z. B.:
dargestellt z. B.:
in eckige Klammern eingefasst z. B.:
eckige Klammern eingefasst z. B.:
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

16 Wichtige Erläuterungen WAGO-I/O-SYSTEM 750
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
2 Wichtige Erläuterungen
Dieses Kapitel beinhaltet ausschließlich eine Zusammenfassung der wichtigsten
Sicherheitsbestimmungen und Hinweise. Diese werden in den einzelnen Kapiteln
wieder aufgenommen. Zum Schutz vor Personenschäden und zur Vorbeugung von
Sachschäden an Geräten ist es notwendig, die Sicherheitsrichtlinien sorgfältig zu
lesen und einzuhalten.
2.1 Rechtliche Grundlagen
2.1.1 Änderungsvorbehalt
Die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG behält sich Änderungen, die dem
technischen Fortschritt dienen, vor. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung
oder des Gebrauchsmusterschutzes sind der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co.
KG vorbehalten. Fremdprodukte werden stets ohne Vermerk auf Patentrechte
genannt. Die Existenz solcher Rechte ist daher nicht auszuschließen.
2.1.2 Personalqualifikation
Sämtliche Arbeitsschritte, die an den Geräten des WAGO-I/O-SYSTEMs 750
durchgeführt werden, dürfen nur von Elektrofachkräften mit ausreichenden
Kenntnissen im Bereich der Automatisierungstechnik vorgenommen werden.
Diese müssen mit den aktuellen Normen und Richtlinien für die Geräte und das
Automatisierungsumfeld vertraut sein.
Alle Eingriffe in die Steuerung sind stets von Fachkräften mit ausreichenden
Kenntnissen in der SPS-Programmierung durchzuführen.
2.1.3 Bestimmungsgemäße Verwendung des WAGO-I/OSYSTEMs 750
Feldbuskoppler, Feldbuscontroller und Busklemmen des modularen
WAGO-I/O-SYSTEMs 750 dienen dazu, digitale und analoge Signale von
Sensoren aufzunehmen und an Aktoren auszugeben oder an übergeordnete
Steuerungen weiterzuleiten. Mit den programmierbaren Feldbuscontrollern ist
zudem eine (Vor-)Verarbeitung möglich.
Die Geräte sind für ein Arbeitsumfeld entwickelt, welches der Schutzklasse IP20
genügt. Es besteht Fingerschutz und Schutz gegen feste Fremdkörper bis
12,5 mm, jedoch kein Schutz gegen Wasser. Der Betrieb der Geräte in nasser und
staubiger Umgebung ist nicht gestattet, sofern nicht anders angegeben.
Der Betrieb von Geräten des WAGO-I/O-SYSTEMs 750 im Wohnbereich ist
ohne weitere Maßnahmen nur zulässig, wenn diese die Emissionsgrenzen
(Störaussendungen) gemäß EN 61000-6-3 einhalten. Entsprechende Angaben
finden Sie im Kapitel „Gerätebeschreibung“ > „Normen und Richtlinien“ im
Handbuch zum eingesetzten Feldbuskoppler/-controller.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Wichtige Erläuterungen 17
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
Für den Betrieb des WAGO-I/O-SYSTEMs 750 in explosionsgefährdeten
Bereichen ist ein entsprechender Gehäuseschutz gemäß der Richtlinie 94/9/EG
erforderlich. Zusätzlich ist zu beachten, dass eine Baumusterprüfbescheinigung
erwirkt werden muss, die den korrekten Einbau des Systems im Gehäuse bzw.
Schaltschrank bestätigt.
2.1.4 Technischer Zustand der Geräte
Die Geräte werden ab Werk für den jeweiligen Anwendungsfall mit einer festen
Hard- und Software-Konfiguration ausgeliefert. Alle Veränderungen an der Hardoder Software sowie der nicht bestimmungsgemäße Gebrauch der Komponenten
bewirken den Haftungsausschluss der WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG.
Wünsche an eine abgewandelte bzw. neue Hard- oder Software-Konfiguration
richten Sie bitte an die WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)
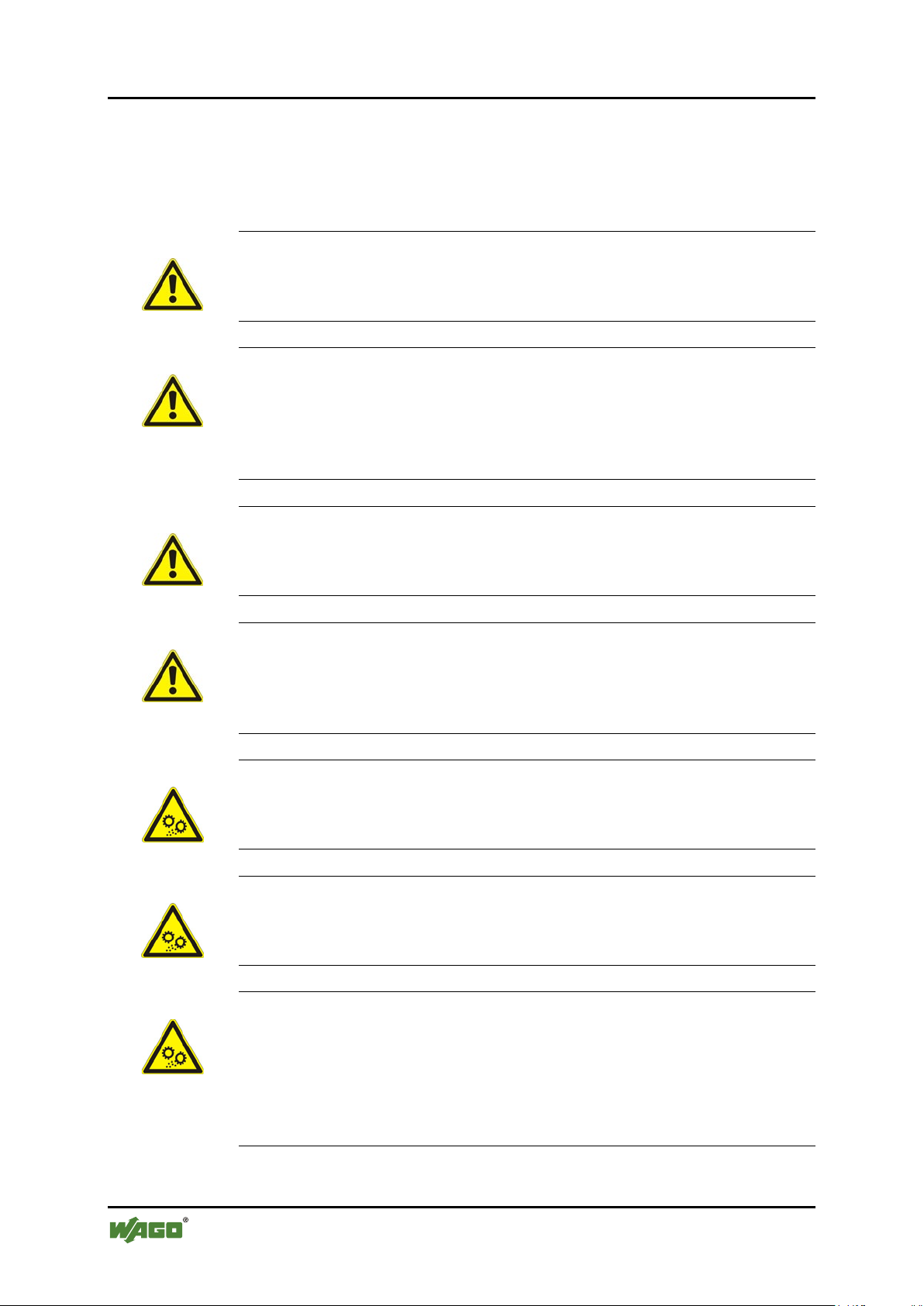
18 Wichtige Erläuterungen WAGO-I/O-SYSTEM 750
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
2.2 Sicherheitshinweise
Beim Einbauen des Gerätes in Ihre Anlage und während des Betriebes sind
folgende Sicherheitshinweise zu beachten:
GEFAHR
GEFAHR
GEFAHR
Nicht an Geräten unter Spannung arbeiten!
Schalten Sie immer alle verwendeten Spannungsversorgungen für das Gerät
ab, bevor Sie es montieren, Störungen beheben oder Wartungsarbeiten
vornehmen.
Nur in Gehäusen, Schränken oder elektrischen Betriebsräumen
einbauen!
Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 mit seinen Geräten ist ein offenes
Betriebsmittel. Bauen Sie dieses ausschließlich in abschließbaren Gehäusen,
Schränken oder in elektrischen Betriebsräumen auf. Ermöglichen Sie nur
autorisiertem Fachpersonal den Zugang mittels Schlüssel oder Werkzeug.
Unfallverhütungsvorschriften beachten!
Beachten Sie bei der Montage, Inbetriebnahme, Wartung und Störbehebung
die für Ihre Maschine zutreffenden Unfallverhütungsvorschriften wie
beispielsweise die BGV A 3, „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“.
GEFAHR
ACHTUNG
ACHTUNG
ACHTUNG
Auf normgerechten Anschluss achten!
Zur Vermeidung von Gefahren für das Personal und Störungen an Ihrer
Anlage, verlegen Sie die Daten- und Versorgungsleitungen normgerecht und
achten Sie auf die korrekte Anschlussbelegung. Beachten Sie die für Ihre
Anwendung zutreffenden EMV-Richtlinien.
Nicht in Telekommunikationsnetzen einsetzen!
Verwenden Sie Geräte mit ETHERNET-/RJ-45-Anschluss ausschließlich in
LANs. Verbinden Sie diese Geräte niemals mit Telekommunikationsnetzen,
wie z. B. mit Analog- oder ISDN-Telefonanlagen.
Defekte oder beschädigte Geräte austauschen!
Tauschen Sie defekte oder beschädigte Geräte (z. B. bei deformierten
Kontakten) aus, da die Funktion der betroffenen Geräte langfristig nicht
sichergestellt ist.
Geräte vor kriechenden und isolierenden Stoffen schützen!
Die Geräte sind unbeständig gegen Stoffe, die kriechende und isolierende
Eigenschaften besitzen, z. B. Aerosole, Silikone, Triglyceride (Bestandteil
einiger Handcremes). Sollten Sie nicht ausschließen können, dass diese
Stoffe im Umfeld der Geräte auftreten, bauen Sie die Geräte in ein Gehäuse
ein, das resistent gegen oben genannte Stoffe ist. Verwenden Sie generell
zur Handhabung der Geräte saubere Werkzeuge und Materialien.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)
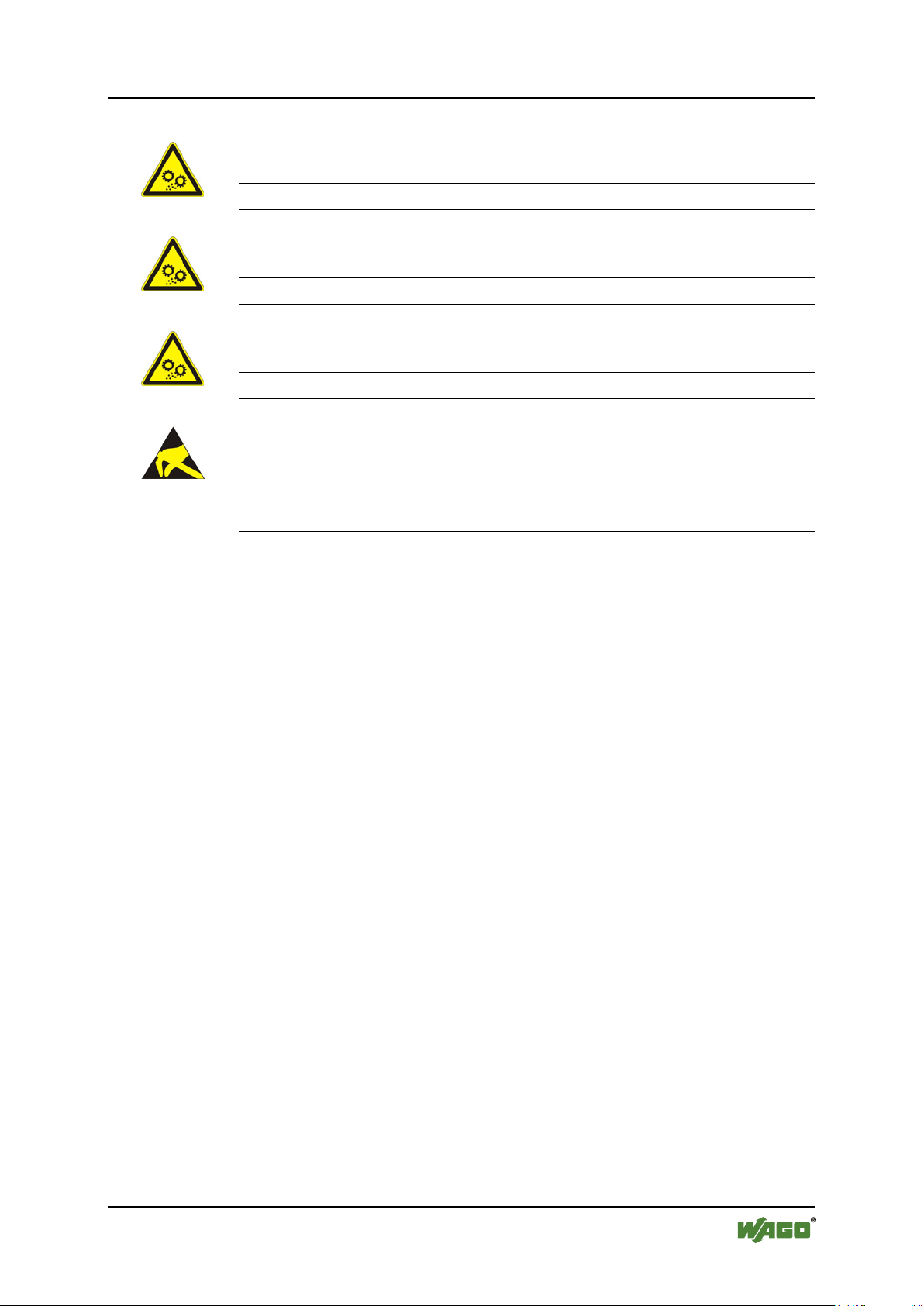
WAGO-I/O-SYSTEM 750 Wichtige Erläuterungen 19
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
ACHTUNG
Nur mit zulässigen Materialien reinigen!
Reinigen Sie verschmutzte Kontakte mit ölfreier Druckluft oder mit Spiritus
und einem Ledertuch.
ACHTUNG
Kein Kontaktspray verwenden!
Verwenden Sie kein Kontaktspray, da in Verbindung mit Verunreinigungen
die Funktion der Kontaktstelle beeinträchtigt werden kann.
ACHTUNG
Verpolungen vermeiden!
Vermeiden Sie die Verpolung der Daten- und Versorgungsleitungen, da dies
zu Schäden an den Geräten führen kann.
ESD
Elektrostatische Entladung vermeiden!
In den Geräten sind elektronische Komponenten integriert, die Sie durch
elektrostatische Entladung bei Berührung zerstören können. Beachten Sie
die Sicherheitsmaßnahmen gegen elektrostatische Entladung gemäß
DIN EN 61340-5-1/-3. Achten Sie beim Umgang mit den Geräten auf gute
Erdung der Umgebung (Personen, Arbeitsplatz und Verpackung).
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

20 Wichtige Erläuterungen WAGO-I/O-SYSTEM 750
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
2.3 Spezielle Einsatzbestimmungen für ETHERNETGeräte
Wo nicht speziell beschrieben, sind ETHERNET-Geräte für den Einsatz in
lokalen Netzwerken bestimmt. Beachten Sie folgende Hinweise, wenn Sie
ETHERNET-Geräte in Ihrer Anlage einsetzen:
• Verbinden Sie Steuerungskomponenten und Steuerungsnetzwerke nicht mit
einem offenen Netzwerk wie dem Internet oder einem Büronetzwerk.
WAGO empfiehlt, Steuerungskomponenten und Steuerungsnetzwerke
hinter einer Firewall anzubringen.
• Beschränken Sie den physikalischen und elektronischen Zugang zu
sämtlichen Automatisierungskomponenten auf einen autorisierten
Personenkreis.
• Ändern Sie vor der ersten Inbetriebnahme unbedingt die standardmäßig
eingestellten Passwörter! Sie verringern so das Risiko, dass Unbefugte
Zugriff auf Ihr System erhalten.
• Ändern Sie regelmäßig die verwendeten Passwörter! Sie verringern so das
Risiko, dass Unbefugte Zugriff auf Ihr System erhalten.
• Ist ein Fernzugriff auf Steuerungskomponenten und Steuerungsnetzwerke
erforderlich, sollte ein „Virtual Private Network“ (VPN) genutzt werden.
• Führen Sie regelmäßig eine Bedrohungsanalyse durch. So können Sie
prüfen, ob die getroffenen Maßnahmen Ihrem Schutzbedürfnis entsprechen.
• Wenden Sie in der sicherheitsgerichteten Gestaltung Ihrer Anlage „Defense-
in-depth“-Mechanismen an, um den Zugriff und die Kontrolle auf
individuelle Produkte und Netzwerke einzuschränken.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Gerätebeschreibung 21
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
3 Gerätebeschreibung
Bei dem Controller „PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS“ (750-8206) handelt es
sich um ein Automatisierungsgerät, das die Steuerungsaufgaben einer SPS/PLC
erledigen kann. Er ist zur Montage auf einer Hutschiene geeignet und zeichnet
sich durch verschiedene Schnittstellen aus.
Dieser Controller kann für Anwendungen im Maschinen- und Anlagenbau sowie
in der Prozessindustrie und der Gebäudetechnik eingesetzt werden.
Am Controller können Sie alle verfügbaren Busklemmen des WAGO-I/OSYSTEM 750 (Serien 750 und 753) anschließen. Dadurch kann er analoge und
digitale Signale aus dem Automatisierungsumfeld intern verarbeiten oder über
eine der vorhandenen Schnittstellen anderen Geräten zur Verfügung stellen.
Automatisierungsaufgaben lassen sich in allen IEC-61131-3-kompatiblen
Sprachen mit dem Programmiersystem CODESYS 2.3 (WAGO-I/O-PRO)
realisieren.
Die Implementierung der CODESYS-Taskabarbeitung ist für Linux mit
Echtzeiterweiterungen optimiert, um die maximale Leistung für
Automatisierungsaufgaben bereitzustellen. Zur Visualisierung steht neben der
Entwicklungsumgebung auch die Web-Visualisierung zur Verfügung.
Der Controller stellt physikalisch 256 MByte Programmspeicher (Flash), 256
MByte Datenspeicher (RAM) und 128 kByte Remanentspeicher (Retain,
NVRAM) bereit. Durch die interne Verwaltung sind die Speicherbereiche ggf.
nicht voll nutzbar.
Das Dateisystem auf dem internen Speicher stellt 64 MByte für Anwendungen
bereit. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, Dateien auf einer steckbaren
Speicherkarte oder in einer internen RAM-Disk abzuspeichern.
Für die IEC 61131-3-Programmierung in CODESYS-Applikationen stellt der
Controller 16 MByte Programmspeicher, 64 MByte Datenspeicher und 128 kByte
Remanent-Speicher (Retain- und Merkervariablen) in einem integrierten NVRAM
zur Verfügung.
Zwei Ethernet-Schnittstellen und der integrierte, abschaltbare Switch ermöglichen
die Verdrahtung
• in einem Netzwerk in Linientopologie mit einer gemeinsamen MAC-
Adresse und IP-Adresse für beide Schnittstellen oder
• in zwei getrennten Netzwerken mit einer gemeinsamen MAC-Adresse und
eigenen IP-Adressen für jede Schnittstelle.
Beide Schnittstellen unterstützen:
• 10BASE-T / 100BASE-TX
• Voll-/Halbduplex
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)
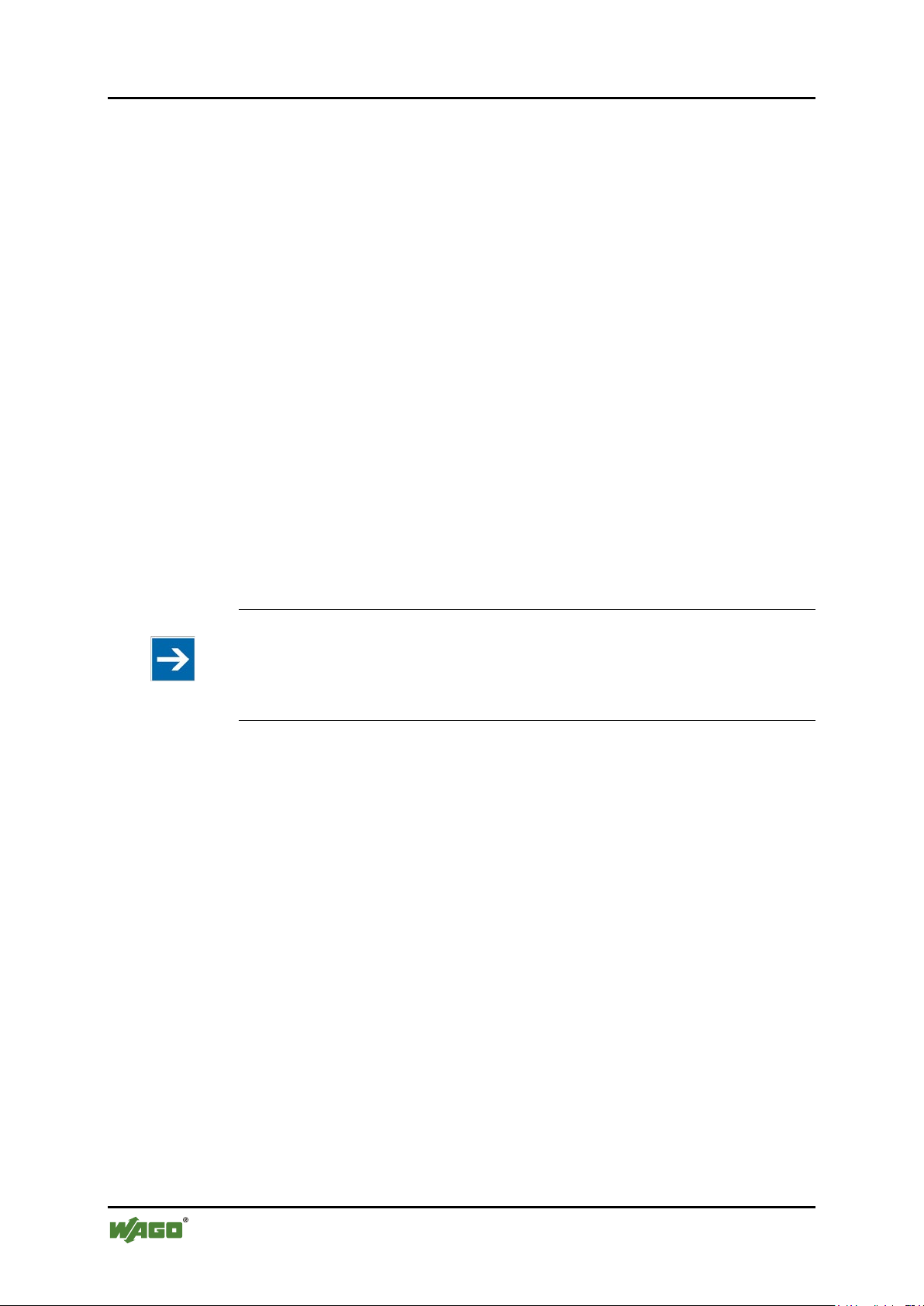
22 Gerätebeschreibung WAGO-I/O-SYSTEM 750
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
• Autonegotiation
• Auto-MDI(X)
Für den Prozessdatenaustausch sind folgende Feldbusanschaltungen
implementiert:
• MODBUS-TCP
• MODBUS-UDP
• MODBUS-RTU (über RS-232 oder RS-485)
• CANopen-Master/Slave
• PROFIBUS-Slave
In dem Controller werden sämtliche Eingangssignale der Sensoren
zusammengeführt. Nach Anschluss des Controllers ermittelt dieser alle in dem
Busknoten gesteckten Busklemmen und erstellt daraus ein lokales Prozessabbild.
Hierbei kann es sich um eine gemischte Anordnung von analogen
(Datenaustausch wortweise) und digitalen (Datenaustausch bitweise)
Busklemmen handeln.
Hinweis
Kein direkter Zugriff vom Feldbus auf das Prozessabbild der
Busklemmen!
Benötigte Daten aus dem Klemmenbus-Prozessabbild müssen explizit im
CODESYS-Programm auf die Daten im Feldbus-Prozessabbild gemappt
werden und umgekehrt! Ein direkter Zugriff ist nicht möglich!
Die Feldbuskonfiguration ist mit der Steuerungskonfiguration von CODESYS 2.3
möglich.
Zur Konfiguration steht ihnen weiterhin das Web-based Management (WBM) zur
Verfügung. Es umfasst verschiedene dynamische HTML-Seiten, über die unter
anderem Informationen über die Konfiguration und den Status des Controllers
abgerufen werden können. Das WBM ist bereits im Gerät gespeichert und wird
über einen Internet-Browser dargestellt und bedient. Darüber hinaus können sie
im implementierten Dateisystem eigene HTML-Seiten hinterlegen oder
Programme direkt aufrufen.
Die im Auslieferungszustand installierte Firmware basiert auf Linux mit
speziellen Echtzeiterweiterungen des RT-Preempt-Patches. Zudem sind neben
verschiedenen Hilfsprogrammen folgende Anwenderprogramme auf dem
Controller installiert:
• ein SNMP-Server/Client
• ein Telnet-Server
• ein FTP-, FTPS-Server
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)
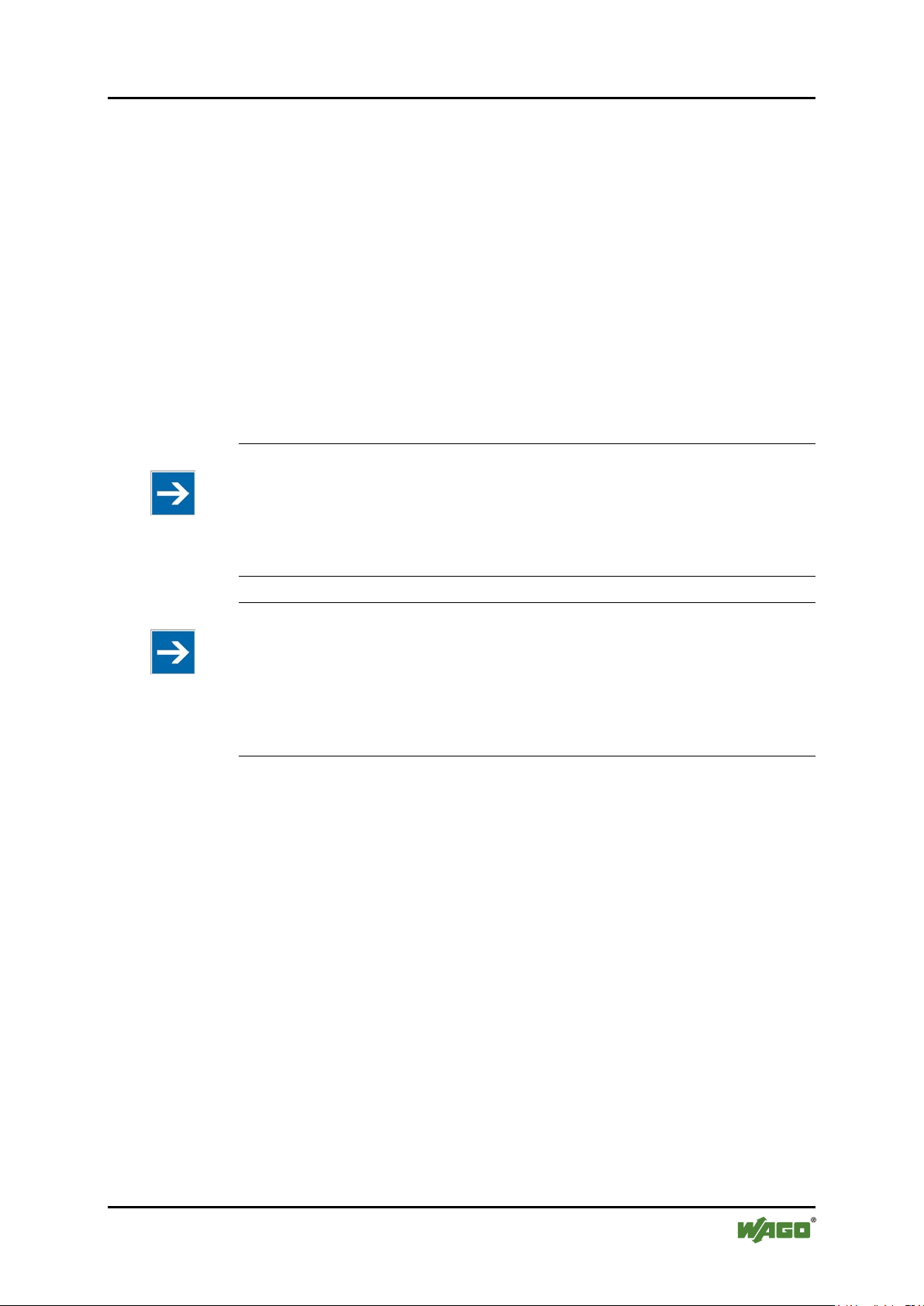
WAGO-I/O-SYSTEM 750 Gerätebeschreibung 23
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
• ein SSH-Server/-Client
• ein Web-Server
• ein NTP-Client
• ein BootP- und DHCP-Daemon
• die CODESYS-Laufzeitumgebung
Entsprechend der IEC-61131-3-Programmierung erfolgt die Bearbeitung der
Prozessdaten vor Ort im Controller. Die daraus erzeugten
Verknüpfungsergebnisse können direkt an die Aktoren ausgegeben oder über
einen angeschlossenen Feldbus an die übergeordnete Steuerung übertragen
werden.
Hinweis
Speicherkarte ist nicht im Lieferumfang enthalten!
Beachten Sie, der Controller wird ohne Speicherkarte ausgeliefert.
Für die Nutzung einer Speicherkarte müssen Sie diese separat dazu
bestellen.
Der Controller kann auch ohne Speicherkartenerweiterung betrieben
werden, die Verwendung einer Speicherkarte ist optional.
Hinweis
Nur empfohlene Speicherkarte verwenden!
Setzen Sie ausschließlich die von WAGO erhältliche Speicherkarte SD
(Art.-Nr. 758-879/000-001) ein, da diese für industrielle Anwendungen
unter erschwerten Umweltbedingungen und für den Einsatz im Controller
spezifiziert ist.
Die Kompatibilität zu anderen im Handel erhältlichen Speichermedien kann
nicht gewährleistet werden.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)
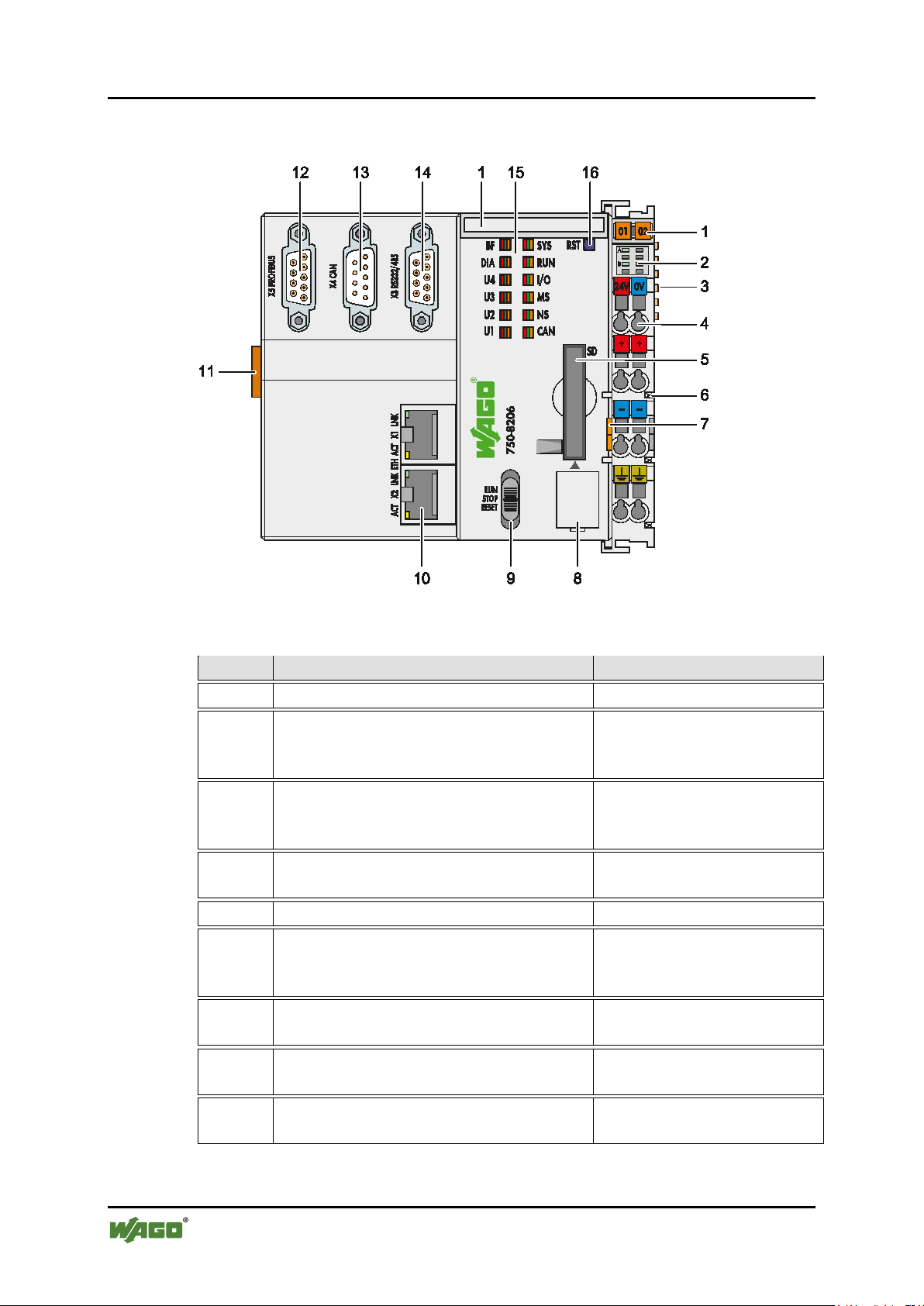
24 Gerätebeschreibung WAGO-I/O-SYSTEM 750
Tabelle 4: Legende zur Abbildung „Ansicht“
Position
Beschreibung
Siehe Kapitel
1
Beschriftungsmöglichkeit (Mini-WSB)
---
„Anzeigeelemente“ >
Versorgung“
„Anschlüsse“ >
Klemmenbus“
CAGE CLAMP®-Anschlüsse für
Spannungsversorgung
„Anschlüsse“ > „CAGE
CLAMP®-Anschlüsse“
5
Steckplatz für Speicherkarte
„Speicherkartensteckplatz“
„Anschlüsse“ >
Feldversorgung“
„Montieren“ > „Geräte
einfügen und entfernen“
„Anschlüsse“ > „ServiceSchnittstelle“
„Bedienelemente“ >
„Betriebsartenschalter“
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
3.1 Ansicht
Abbildung 1: Ansicht
2 LED-Anzeigen – Versorgung
3 Datenkontakte
„Anzeigeelemente
„Datenkontakte/
4
6
Leistungskontakte für Versorgung
nachfolgender Busklemmen
„Leistungskontakte/
7 Entriegelungslasche
8 Service-Schnittstelle (hinter Klappe)
9 Betriebsartenschalter
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)
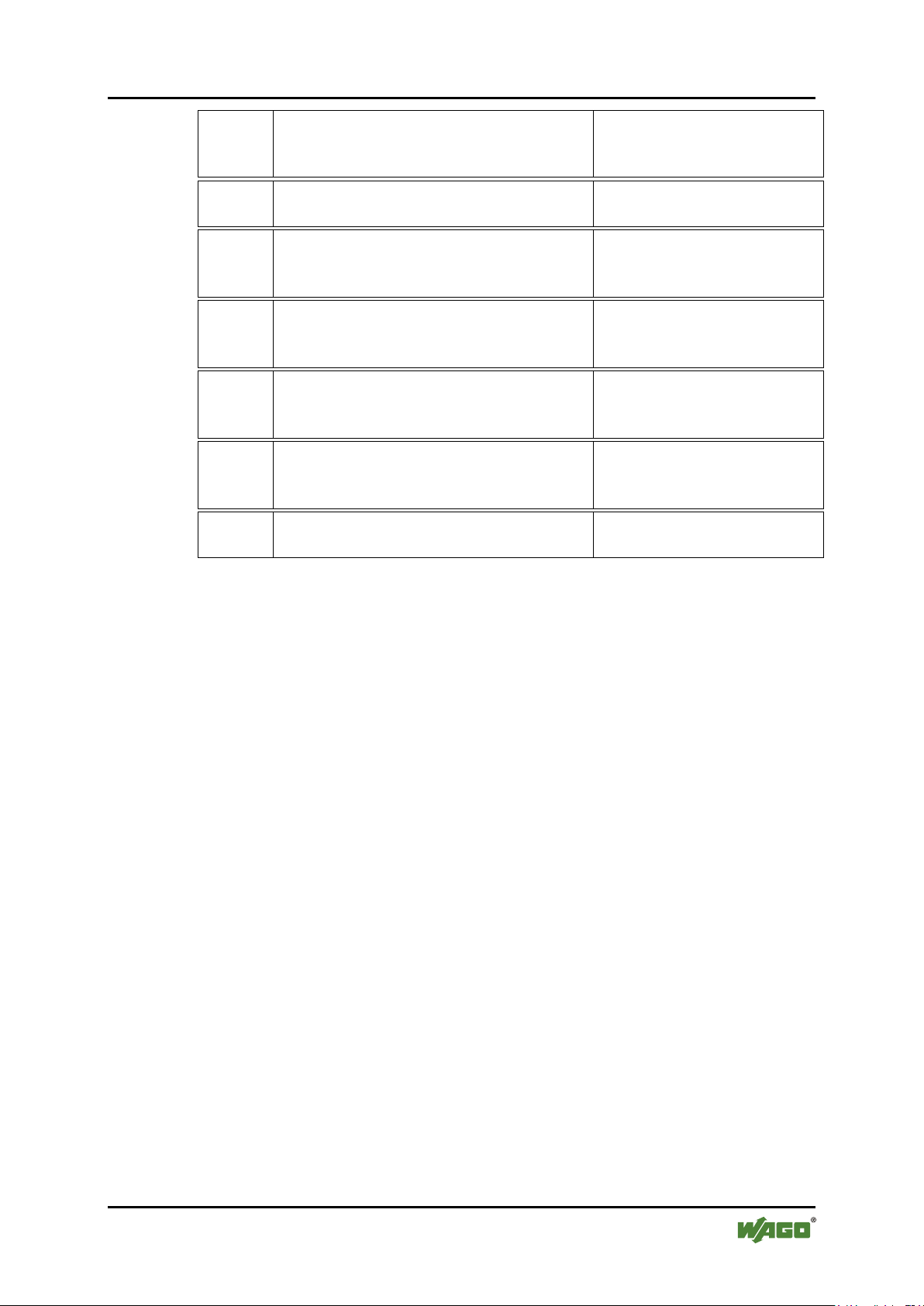
WAGO-I/O-SYSTEM 750 Gerätebeschreibung 25
„Anschlüsse“ >
ETHERNET – X1, X2“
„Montieren“ > „Geräte
einfügen und entfernen“
„Anschlüsse“ >
PROFIBUS DP – X5“
„Anschlüsse“ >
– X4“
„Anschlüsse“ >
RS-232/RS-485 – X3“
„Anzeigeelemente“ >
Feldbus/System“
„Bedienelemente“ > „ResetTaster“
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
10 ETHERNET-Anschlüsse
11 Verriegelungsscheibe
12 Feldbusanschluss – PROFIBUS
13 Feldbusanschluss – CANopen
14 Serielle Schnittstelle
15 LED-Anzeigen – System
16 Reset-Taster (hinter Bohrung)
„Netzwerkanschlüsse
„Feldbusanschluss
„Feldbusanschluss CANopen
„Kommunikationsanschluss
„Anzeigeelemente
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)
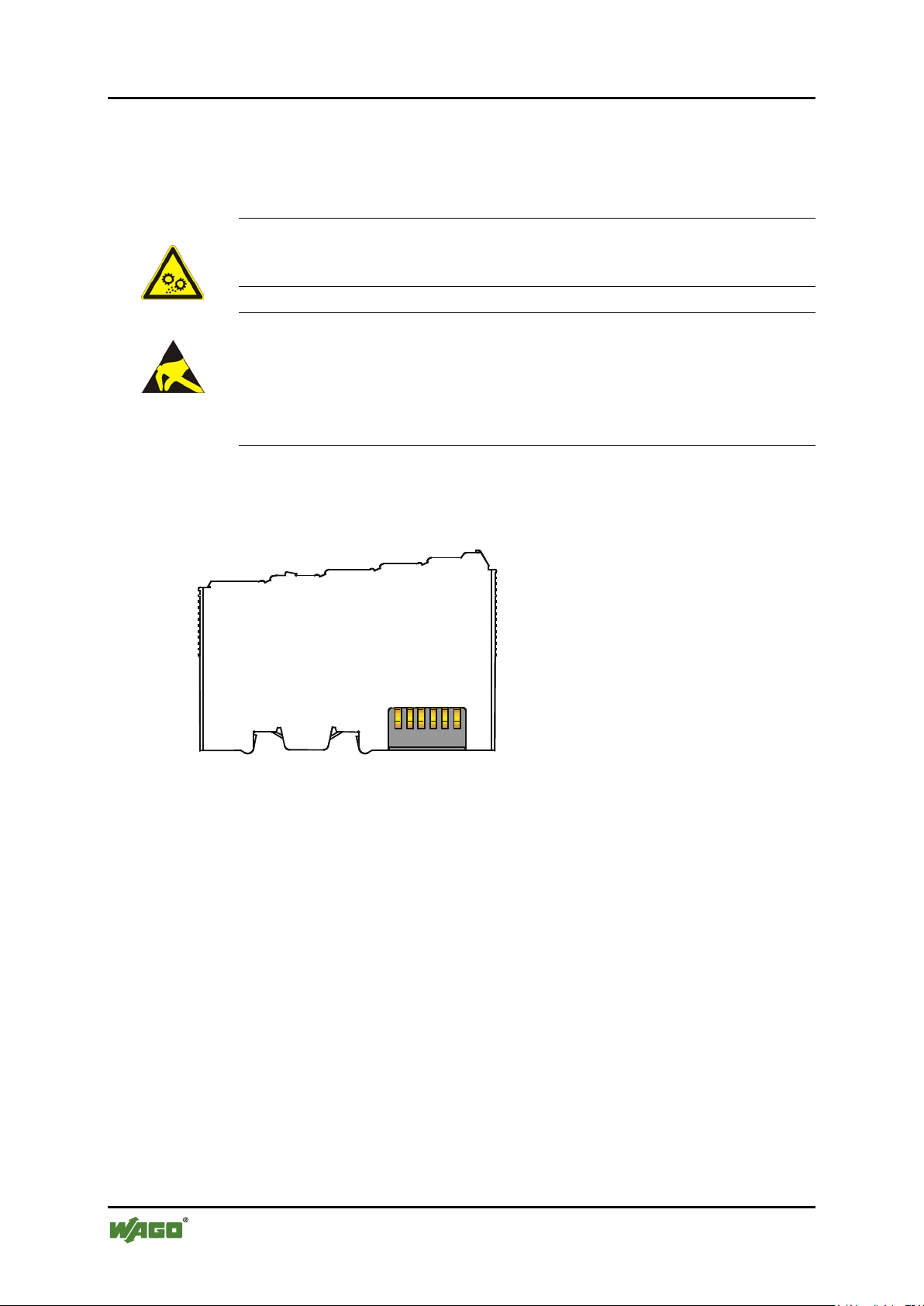
26 Gerätebeschreibung WAGO-I/O-SYSTEM 750
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
3.2 Anschlüsse
3.2.1 Datenkontakte/Klemmenbus
ACHTUNG
ESD
Busklemmen nicht auf Goldfederkontakte legen!
Um Verschmutzung und Kratzer zu vermeiden, legen Sie die Busklemmen
nicht auf die Goldfederkontakte.
Auf gute Erdung der Umgebung achten!
Die Geräte sind mit elektronischen Bauelementen bestückt, die bei
elektrostatischer Entladung zerstört werden können. Achten Sie beim
Umgang mit den Geräten auf gute Erdung der Umgebung (Personen,
Arbeitsplatz und Verpackung). Berühren Sie keine elektrisch leitenden
Bauteile, z. B. Datenkontakte.
Die Kommunikationen zwischen Controller und Busklemmen sowie die
Systemversorgung der Busklemmen erfolgt über den Klemmenbus. Er besteht aus
6 Datenkontakten, die als selbstreinigende Goldfederkontakte ausgeführt sind.
Abbildung 2: Datenkontakte
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)
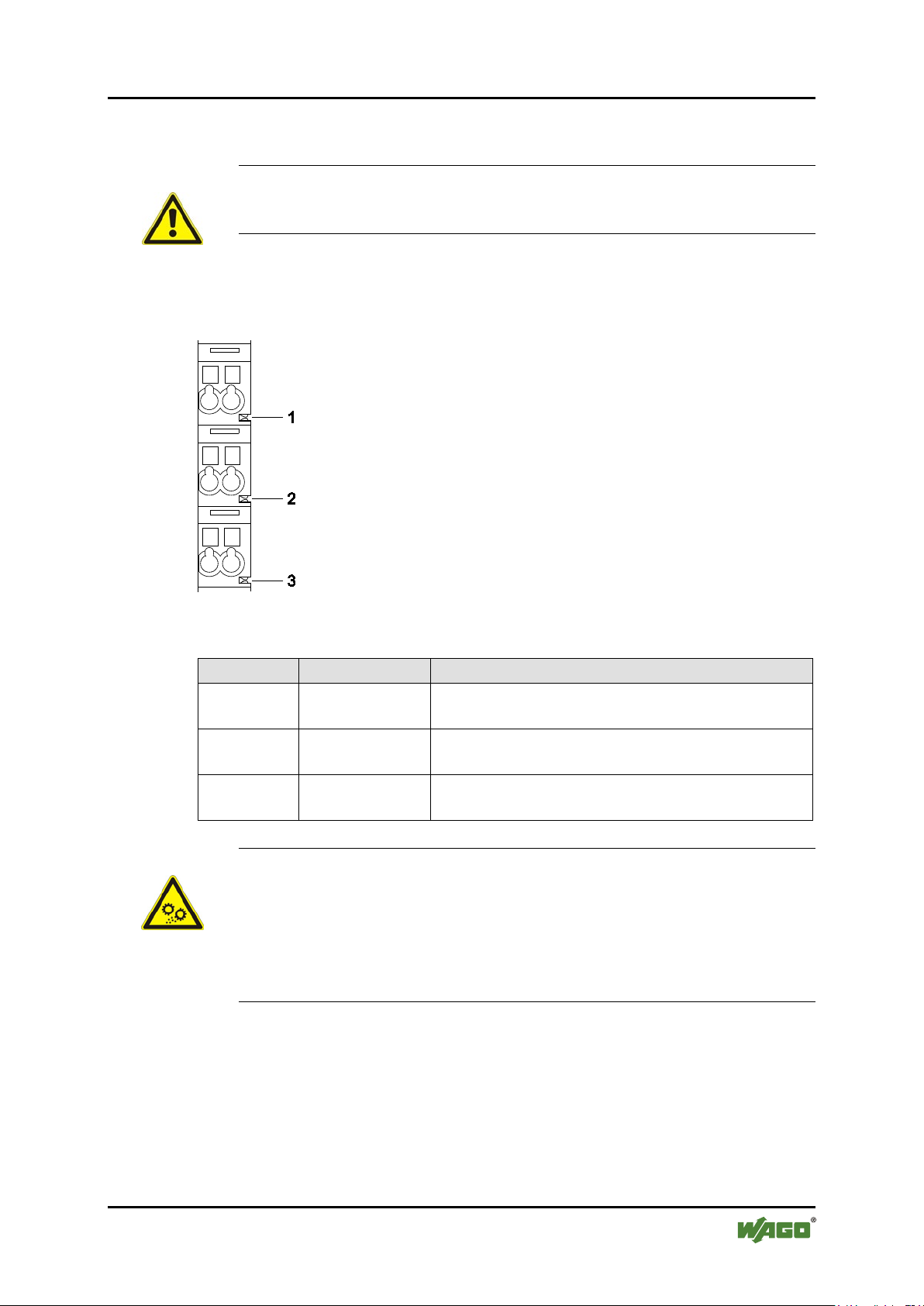
WAGO-I/O-SYSTEM 750 Gerätebeschreibung 27
Tabelle 5: Legende zur Abbildung „Leistungskontakte“
Kontakt
Typ
Funktion
Weiterleitung des Potentials (UV)
für die Feldversorgung
Weiterleitung des Potentials (0 V)
für die Feldversorgung
Weiterleitung des Potentials (Erde)
für die Feldversorgung
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
3.2.2 Leistungskontakte/Feldversorgung
VORSICHT
Verletzungsgefahr durch scharfkantige Messerkontakte!
Da die Messerkontakte sehr scharfkantig sind, besteht bei unvorsichtiger
Hantierung mit den Busklemmen Verletzungsgefahr.
Der Controller 750-8206 besitzt 3 selbstreinigende Leistungskontakte für die
Weiterleitung der Feldversorgungsspannung an nachfolgende Busklemmen. Die
Kontakte sind als Federkontakte ausgeführt.
Abbildung 3: Leistungskontakte
1 Federkontakt
2 Federkontakt
3 Federkontakt
ACHTUNG
Maximalen Strom über Leistungskontakte nicht überschreiten!
Der maximale Strom, der über die Leistungskontakte fließen darf, beträgt
10 A. Durch größere Ströme können die Leistungskontakte beschädigt
werden.
Achten Sie bei der Konfiguration des Systems darauf, dass dieser Strom
nicht überschritten wird. Sollte das der Fall sein, müssen Sie eine
zusätzliche Potentialeinspeiseklemme einsetzen.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)
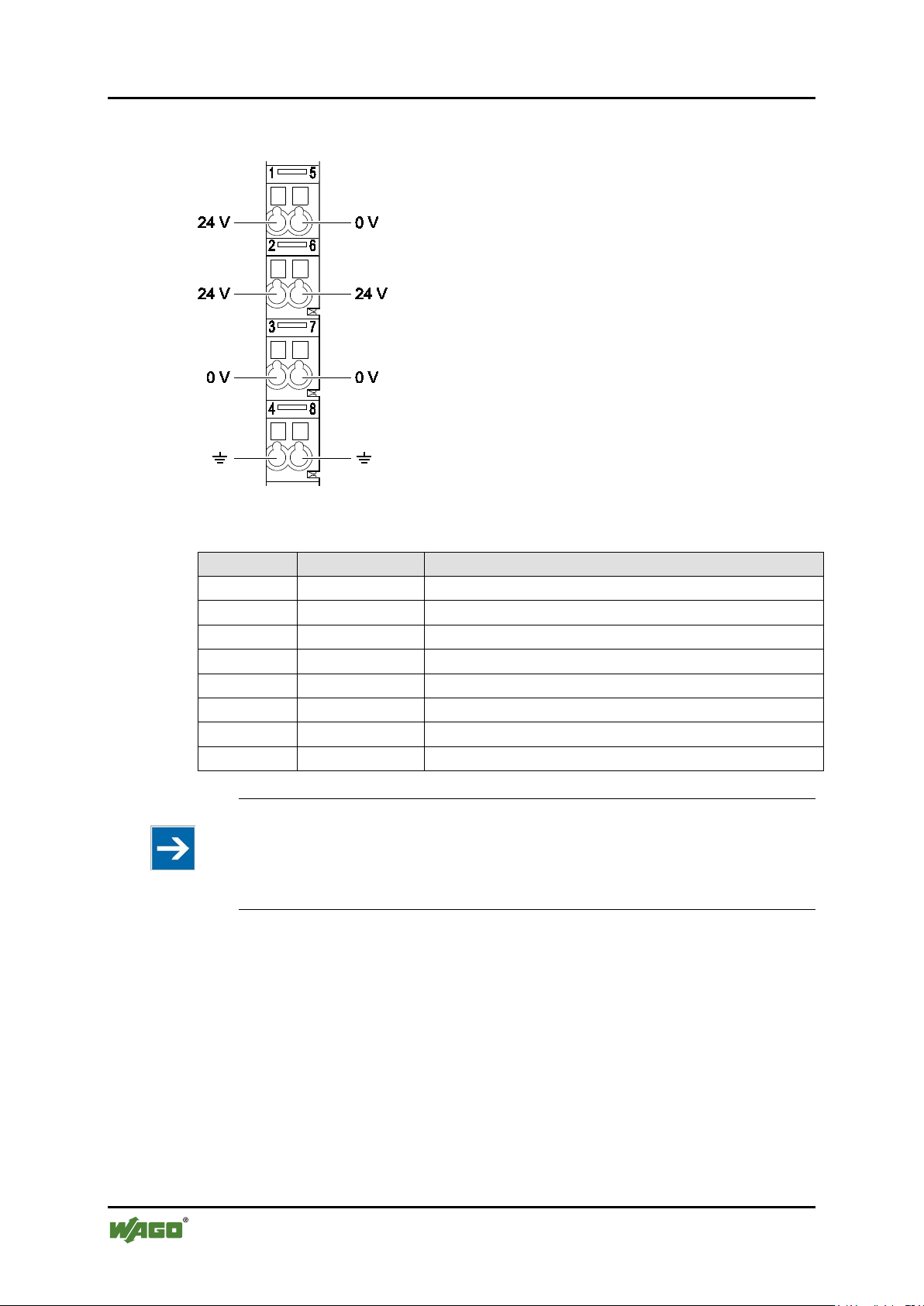
28 Gerätebeschreibung WAGO-I/O-SYSTEM 750
Tabelle 6: Legende zur Abbildung „CAGE CLAMP®-Anschlüsse“
Anschluss
Bezeichnung
Beschreibung
1
24 V
Systemversorgungsspannung +24 V
2
+
Feldversorgungsspannung UV
3
-
Feldversorgungsspannung 0 V
4
Erde
Feldversorgungsspannung Erde
5
0 V
Systemversorgungsspannung 0 V
6
+
Feldversorgungsspannung UV
7
-
Feldversorgungsspannung 0 V
8
Erde
Feldversorgungsspannung Erde
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
3.2.3 CAGE CLAMP®-Anschlüsse
Abbildung 4: CAGE CLAMP
®
-Anschlüsse
Hinweis
Für den Einsatz im Schiffbau ergänzende Einspeisevorschriften
beachten!
Beachten Sie für den Einsatz im Schiffbau die ergänzenden
Einspeisevorschriften für die Versorgungsspannung im Kapitel „Geräte
anschließen“ > … > „Ergänzende Einspeisevorschriften“!
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)
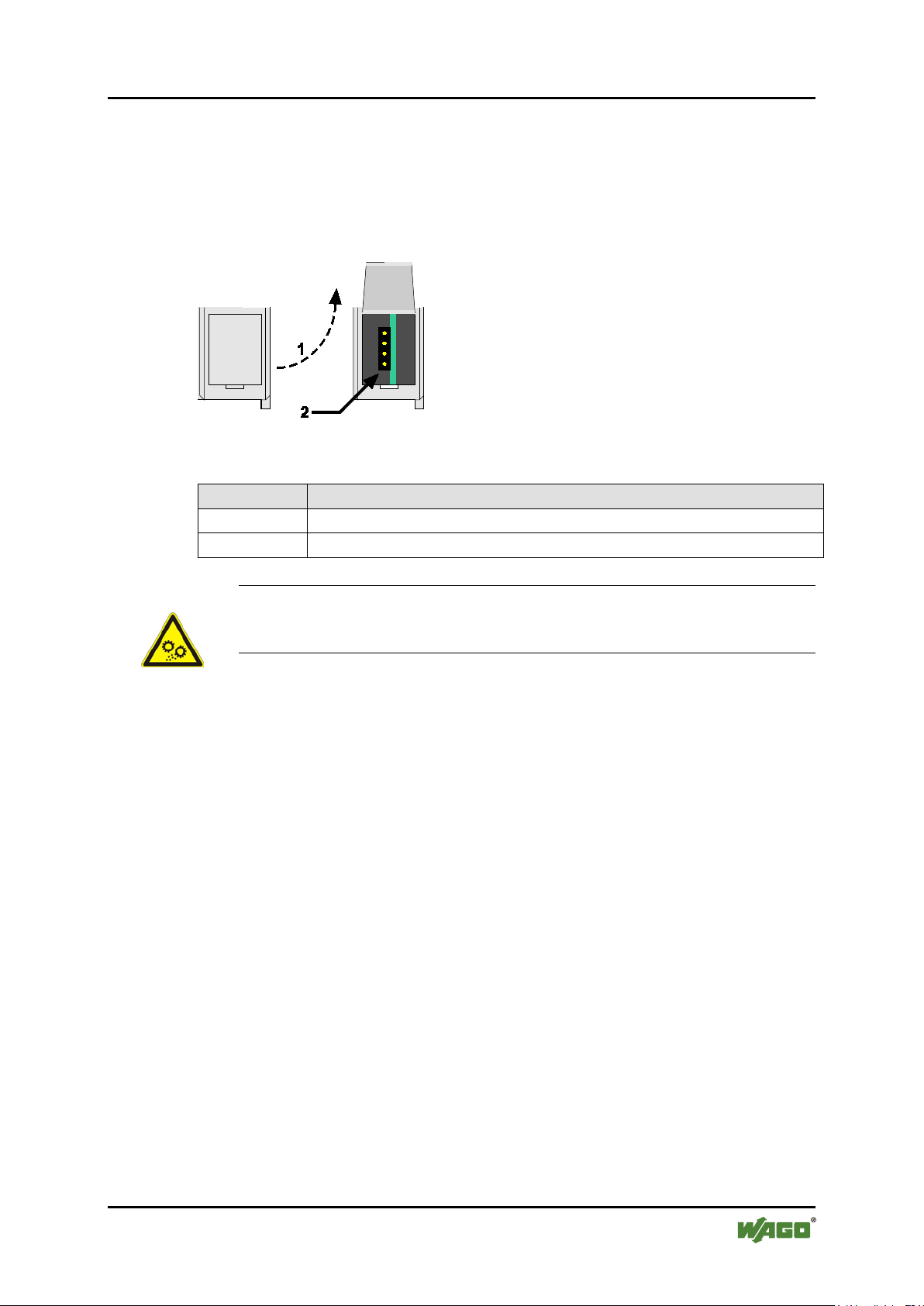
WAGO-I/O-SYSTEM 750 Gerätebeschreibung 29
Tabelle 7: Service-Schnittstelle
Nummer
Beschreibung
1
Abdeckklappe öffnen
2
Service-Schnittstelle
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
3.2.4 Service-Schnittstelle
Die Service-Schnittstelle befindet sich hinter der Abdeckklappe.
Sie wird für die Kommunikation mit WAGO-I/O-CHECK, WAGO-I/O-PRO und
zum Firmware-Download genutzt.
Abbildung 5: Service-Schnittstelle (geschlossene und geöffnete Abdeckklappe)
ACHTUNG
Gerät muss spannungsfrei sein!
Um Geräteschäden zu vermeiden, ziehen und stecken Sie das
Kommunikationskabel nur, wenn das Gerät spannungsfrei ist!
Der Anschluss an die 4-polige Stiftleiste unter der Abdeckklappe erfolgt über die
Kommunikationskabel mit den Bestellnummern 750-920, 750-923 oder über den
WAGO-Funkadapter mit der Bestellnummer 750-921.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)
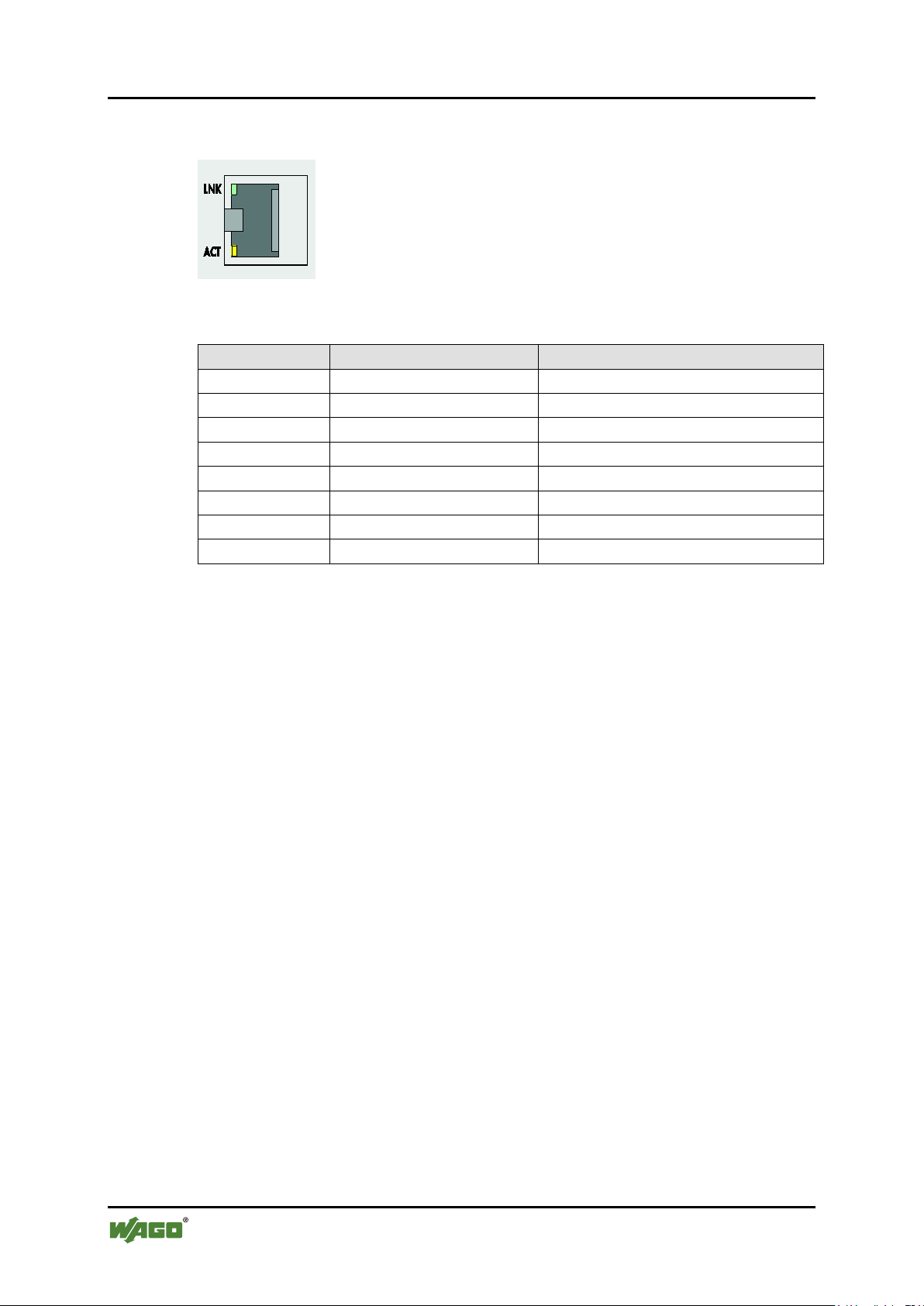
30 Gerätebeschreibung WAGO-I/O-SYSTEM 750
Tabelle 8: Legende zur Abbildung „Netzwerkanschlüsse – X1, X2“
Kontakt
Signal
Beschreibung
1
TD+
Transmit Data +
2
TD-
Transmit Data -
3
RD+
Receive Data +
4
NC
Nicht belegt
5
NC
Nicht belegt
6
RD-
Receive Data -
7
NC
Nicht belegt
8
NC
Nicht belegt
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
3.2.5 Netzwerkanschlüsse – X1, X2
Abbildung 6: Netzwerkanschlüsse – X1, X2
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Gerätebeschreibung 31
Tabelle 9: Legende zur Abbildung „Kommunikationsanschluss RS-232/RS-485 – X3“
RS-232
RS-485
Signal
Beschreibung
Signal
Beschreibung
1
NC
Nicht belegt
NC
Nicht belegt
2
RxD
Receive Data
NC
Nicht belegt
3
TxD
Transmit Data
RxD/TxD-P
Receive/transmit data +
4
NC
Nicht belegt
NC
Nicht belegt
5
FB_GND
Masse
FB_GND
Masse
6
NC
Nicht belegt
FB_5V
Versorgung
7
RTS
Request to send
NC
Nicht belegt
8
CTS
Clear to send
RxD/TxD-N
Receive/transmit data -
9
NC
Nicht belegt
NC
Nicht belegt
Gehäuse
Schirm
Schirmung
Schirm
Schirmung
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
Kommunikati ons ansc hlus s
3.2.6 Kommunikationsanschluss RS-232/RS-485 – X3
Abbildung 7: Kommunikationsanschluss RS-232/RS-485 – X3
Kontakt
ACHTUNG
Die galvanische Trennung zwischen dem Feldbussystem und der Elektronik
erfolgt über DC/DC-Wandler und über Optokoppler im Feldbus-Interface.
Falsche Parametrierung kann zu Schäden am Kommunikationspartner
führen!
Die Spannungspegel betragen -12 V bzw. +12 V für RS-232 und -5 V bzw.
+5 V für RS-485.
Wenn die Schnittstellen am Controller und am Kommunikationspartner
unterschiedlich sind (RS-232 <> RS-485 oder RS-485 <> RS-232), kann
dies zu Schäden an der Schnittstelle des Kommunikationspartners führen.
Achten Sie daher bei der Parametrierung des Controllers darauf, dass die
Schnittstelle passend zum Kommunikationspartner eingestellt ist!
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

32 Gerätebeschreibung WAGO-I/O-SYSTEM 750
Tabelle 10: Funktion der RS-232-Signale bei DTE/DCE
Datenrichtung
DTE
DCE
2
RxD
Eingang
Ausgang
3
TxD
Ausgang
Eingang
5
FB_GND
---
---
7
RTS
Ausgang
Eingang
8
CTS
Eingang
Ausgang
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
3.2.6.1 Betrieb als RS-232-Schnittstelle
Abhängig vom Gerätetyp DTE (z. B. PC) oder DCE (z. B. PFC, Modem) haben
die RS-232-Signale unterschiedliche Datenrichtungen.
Kontakt Signal
Für eine DTE-zu-DCE-Verbindung werden die Signale direkt (1:1) verbunden.
Abbildung 8: Anschluss bei DTE-DCE-Verbindung (1:1)
Für eine DTE-zu-DTE-Verbindung werden die Signale gekreuzt (cross-over)
verbunden.
Abbildung 9: Anschluss bei DTE-DTE-Verbindung (cross-over)
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Gerätebeschreibung 33
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
3.2.6.2 Betrieb als RS-485-Schnittstelle
Um Reflektionen am Leitungsende zu minimieren, muss die RS-485-Leitung an
beiden Enden mit einem Leitungsabschluss abgeschlossen werden. Falls
erforderlich, kann je 1 Pull-Up- bzw. Pull-Down-Widerstand eingesetzt werden.
Diese sorgen für einen definierten Pegel auf dem Bus, wenn kein Teilnehmer
aktiv ist, d.h. alle Teilnehmer sich im „Tri-State“-Zustand befinden.
Hinweis
Busabschluss beachten!
Das RS-485-MODBUS-Bussegment muss an beiden Seiten abgeschlossen
sein!
Es dürfen nicht mehr als 2 Abschlüsse pro Bussegment eingesetzt werden!
In Stich- oder Abzweigstrecken darf kein Abschluss eingesetzt werden!
Der Betrieb ohne korrekten Abschluss des RS-485-MODBUS-Netzes kann
zu Übertragungsfehlern führen.
Abbildung 10: RS-485-Busabschluss
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

34 Gerätebeschreibung WAGO-I/O-SYSTEM 750
Tabelle 11: Legende zur Abbildung „Feldbusanschluss CANopen – X4“
Kontakt
Signal
Beschreibung
1
-
Nicht benutzt
2
CAN_L
CAN Signal Low
3
GND
Erde
4
-
Nicht benutzt
5
Drain Shield
Schirmanschluss
6
-
Nicht benutzt
7
CAN_H
CAN Signal High
8
-
Nicht benutzt
9
CAN_V+
Nicht benutzt
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
3.2.7 Feldbusanschluss CANopen – X4
Abbildung 11: Feldbusanschluss CANopen – X4
Hinweis
Die galvanische Trennung zwischen dem CANopen-Bussystem und der
Elektronik erfolgt über DC/DC-Wandler und über Optokoppler im FeldbusInterface.
Der Leitungsschirm muss auf CAN-Shield gelegt werden. Dieser ist im Geräte mit
1 MΩ gegenüber Erde (Tragschienenkontakt) abgeschlossen. Eine niederohmige
Anbindung der Schirmung an Erde kann nur extern (z. B. durch eine
Potentialeinspeiseklemme) erfolgen. Es ist eine zentrale Erdkontaktierung für die
gesamte CANopen-Busleitungsschirmung anzustreben.
Um Reflektionen am Leitungsende zu minimieren, muss die CANopen-Leitung an
beiden Enden mit einem Leitungsabschluss abgeschlossen werden.
Busabschluss beachten!
Das CANopen-Bussegment muss an beiden Seiten abgeschlossen sein!
Es dürfen nicht mehr als 2 Abschlüsse pro Bussegment eingesetzt werden!
In Stich- oder Abzweigstrecken darf kein Abschluss eingesetzt werden!
Der Betrieb ohne korrekten Abschluss des CANopen-Netzes kann zu
Übertragungsfehlern führen.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Gerätebeschreibung 35
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
Hinweis
Zulässige Verlustleistung der Widerstände beachten!
Im normalen Betrieb reichen 1/4Watt-Widerstände aus. Im Kurzschlussfall
(24V-Versorgung gegen eine Busleitung) wird der Widerstand mit einer
Verlustleistung von (Kurzschluss-Ausgangsstrom des Transceivers *
Versorgungsspannung) belastet. Der Widerstand muss dann für diese
Verlustleistung ausgelegt sein.
Abbildung 12: CANopen-Standardbusabschluss
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

36 Gerätebeschreibung WAGO-I/O-SYSTEM 750
Tabelle 12: Legende zu Abbildung „Feldbusanschluss PROFIBUS DP – X5“
Kontakt
Signal
Beschreibung
1
NC
Nicht belegt
2
NC
Nicht belegt
3
PB+
Receive/transmit data +
4
NC
Nicht belegt
5
PB_GND
Masse
6
PB_+5V
Versorgung
7
NC
Nicht belegt
8
PB–
Receive/transmit data -
9
NC
Nicht belegt
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
3.2.8 Feldbusanschluss PROFIBUS DP – X5
Abbildung 13: Feldbusanschluss PROFIBUS DP – X5
Hinweis
Die galvanische Trennung zwischen dem PROFIBUS und der Elektronik erfolgt
über DC/DC-Wandler und über Übertrager im Feldbus-Interface.
Das PROFIBUS-Segment muss an beiden Enden mit einem Leitungsabschluss
nach PROFIBUS-Norm abgeschlossen werden. Der Abschluss ist passiv und wird
vom Busteilnehmer gespeist. Er sorgt für einen definierten Pegel auf dem Bus,
wenn kein Teilnehmer aktiv ist, d.h. alle Teilnehmer sich im „Tri-State“-Zustand
befinden.
Busabschluss beachten!
Das Bussegment muss an beiden Enden abgeschlossen sein!
Es dürfen nicht mehr als 2 Abschlüsse pro Bussegment zugeschaltet sein!
Mindestens 1 der beiden Abschlüsse muss durch den Busteilnehmer gespeist
werden!
Der Betrieb ohne korrekten Abschluss des PROFIBUS-Netzes kann zu
Übertragungsfehlern führen.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Gerätebeschreibung 37
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
Abbildung 14: PROFIBUS-Leitungsabschluss gemäß EN 50170
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

38 Gerätebeschreibung WAGO-I/O-SYSTEM 750
Tabelle 13: Legende zur Abbildung „Anzeigeelemente Versorgung“
Bezeichnung
Farbe
Beschreibung
A
Grün/aus
Status der Systemversorgungsspannung
B
Grün/aus
Status der Feldversorgungsspannung
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
3.3 Anzeigeelemente
3.3.1 Anzeigeelemente Versorgung
Abbildung 15: Anzeigeelemente Versorgung
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Gerätebeschreibung 39
Tabelle 14: Legende zur Abbildung „Anzeigeelemente Feldbus/System“
Bezeichnung
Farbe
Beschreibung
Rot/Grün/Orange/
Aus
Rot/Grün/Orange/
Aus
Rot/Grün/Orange/
Aus
MS
Ohne Funktion
NS
Ohne Funktion
Rot/Grün/Orange/
Aus
Rot/Grün/Orange/
Aus
Rot/Grün/Orange/
Aus
Anwender-LED 4, programmierbar über
„WagoLibLed.lib“.
Anwender-LED 3, programmierbar über
„WagoLibLed.lib“.
Anwender-LED 2, programmierbar über
„WagoLibLed.lib“.
Anwender-LED 1, programmierbar über
„WagoLibLed.lib“.
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
3.3.2 Anzeigeelemente Feldbus/System
Abbildung 16: Anzeigeelemente Feldbus/System
SYS
RUN
I/O
CAN
BF
DIA
U4
U3
Rot/Grün/Orange/
Aus
Rot/Grün/Orange/
Aus
Systemstatus
PLC-Programmstatus
Klemmenbusstatus
CANopen-Status
PROFIBUS-Status
PROFIBUS-Diagnose
die Funktionsbausteine der Bibliothek
die Funktionsbausteine der Bibliothek
U2
U1
Rot/Grün/Orange/
Aus
Rot/Grün/Orange/
Aus
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)
die Funktionsbausteine der Bibliothek
die Funktionsbausteine der Bibliothek

40 Gerätebeschreibung WAGO-I/O-SYSTEM 750
Tabelle 15: Legende zur Abbildung „Anzeigeelemente Speicherkartensteckplatz“
Bezeichnung
Farbe
Beschreibung
SD
Gelb/Aus
Speicherkartenstatus
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
3.3.3 Anzeigeelemente Speicherkartensteckplatz
Abbildung 17: Anzeigeelemente Speicherkartensteckplatz
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Gerätebeschreibung 41
Tabelle 16: Legende zur Abbildung „Anzeigeelemente RJ45-Buchsen“
Bezeichnung
Farbe
Beschreibung
LNK
Grün/Aus
ETHERNET-Verbindungsstatus
ACT
Gelb/Aus
ETHERNET-Datenaustausch
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
3.3.4 Anzeigeelemente Netzwerk
Abbildung 18: Anzeigeelemente RJ45-Buchsen
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

42 Gerätebeschreibung WAGO-I/O-SYSTEM 750
Tabelle 17: Betriebsartenschalter
Position
Betätigung
Funktion
Normalbetrieb
CODESYS-2-Applikation läuft.
Stop
CODESYS-2-Applikation angehalten.
Reset Warmstart oder
Betrieb nehmen“ > „Reset-Funktionen auslösen“)
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
3.4 Bedienelemente
3.4.1 Betriebsartenschalter
Abbildung 19: Betriebsartenschalter
RUN Rastend
STOP Rastend
RESET Tastend
In Verbindung mit dem Reset-Taster können weitere Funktionen ausgelöst
werden.
Reset Kaltstart
(abhängig von der Betätigungsdauer, siehe Kapitel „In
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Gerätebeschreibung 43
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
3.4.2 Reset-Taster
Abbildung 20: Reset-Taster
Der Reset-Taster ist durch eine Bohrung im Gehäuse mit einem geeigneten
Gegenstand (z. B. Kugelschreiber) bedienbar.
Abhängig von der Position des Betriebsartenschalters können Sie mit dem ResetTaster unterschiedliche Funktionen auslösen: Software-Reset, Factory-Reset oder
Fix-IP-Address.
Informationen zu den Funktionen finden Sie im Kapitel „In Betrieb nehmen“ >
„Reset-Funktionen auslösen“.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

44 Gerätebeschreibung WAGO-I/O-SYSTEM 750
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
3.5 Speicherkartensteckplatz
Abbildung 21: Speicherkartensteckplatz
Die Speicherkarte wird mit einem Push/Push-Mechanismus im Gehäuse
verriegelt. Das Stecken und Ziehen der Karte ist im Kapitel „Service“ >
„Speicherkarte einfügen und entfernen“ beschrieben!
Die Speicherkarte ist durch eine Abdeckklappe geschützt. Die Abdeckklappe ist
plombierbar.
Hinweis
Speicherkarte ist nicht im Lieferumfang enthalten!
Beachten Sie, der Controller wird ohne Speicherkarte ausgeliefert.
Für die Nutzung einer Speicherkarte müssen Sie diese separat dazu
bestellen.
Der Controller kann auch ohne Speicherkartenerweiterung betrieben
werden, die Verwendung einer Speicherkarte ist optional.
Hinweis
Nur empfohlene Speicherkarte verwenden!
Setzen Sie ausschließlich die von WAGO erhältliche Speicherkarte SD
(Art.-Nr. 758-879/000-001) ein, da diese für industrielle Anwendungen
unter erschwerten Umweltbedingungen und für den Einsatz im Controller
spezifiziert ist.
Die Kompatibilität zu anderen im Handel erhältlichen Speichermedien kann
nicht gewährleistet werden.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Gerätebeschreibung 45
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
3.6 Schematisches Schaltbild
Abbildung 22: Schematisches Schaltbild
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

46 Gerätebeschreibung WAGO-I/O-SYSTEM 750
Tabelle 18: Technische Daten - Gerätedaten
Breite
112 mm
Höhe (ab Oberkante Tragschiene)
65 mm
Tiefe
100 mm
Gewicht
250 g
Tabelle 19: Technische Daten – Systemdaten
CPU
Cortex A8, 600 MHz
Betriebssystem
Echtzeit-Linux® 3.6 (mit RTPreemption-Patch)
Hauptspeicher (RAM)
256 Mbyte
Interner Speicher (Flash)
256 Mbyte
Remanentspeicher (Retain, NVRAM)
128 kbyte
Speicherkartensteckplatz
Push/Push-Mechanismus,
Abdeckungsklappe plombierbar
Speicherkartentyp
SD und SDHC bis 32 Gbyte
Speicherkarte 758-879/000-001 gültig.)
Tabelle 20: Technische Daten – Versorgung
Spannungsversorgung
DC 24 V (-25 % … +30 %)
Eingangsstrom max. (24 V)
550 mA
Summenstrom für Busklemmen (5 V)
1700 mA
Potentialtrennung
500 V System/Versorgung
Tabelle 21: Technische Daten – Uhr
Drift - Systemuhr (25 °C)
20 ppm
Drift - RTC (25 °C)
3 ppm
Pufferzeit RTC
30 Tage
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
3.7 Technische Daten
3.7.1 Gerätedaten
3.7.2 Systemdaten
3.7.3 Versorgung
(Alle zugesicherten Eigenschaften sind
nur in Verbindung mit der WAGO-
3.7.4 Uhr
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Gerätebeschreibung 47
Tabelle 22: Technische Daten – Programmierung
Programmierung
WAGO-I/O-PRO V2.3
IEC 61131-3
AWL, KOP, FUP, ST, AS
Programmspeicher (Flash)
16 Mbyte
Datenspeicher (RAM)
64 Mbyte
Remanentspeicher (Retain + Merker,
NVRAM)
128 kbyte
Tabelle 23: Technische Daten – Klemmenbus
Anzahl Busklemmen (pro Knoten)
64
mit Busverlängerung
250
Ein- und Ausgangsprozessabbild max.
1000 Worte
Tabelle 24: Technische Daten – ETHERNET
ETHERNET
2 x RJ-45 (switched oder separated
Mode)
Übertragungsmedium
Twisted Pair S-UTP, 100 Ω, Cat 5,
100 m maximale Leitungslänge
Übertragungsrate
10/100 Mbit/s; 10Base-T/100Base-TX
Protokolle
DHCP, DNS, SNTP, FTP, FTPS,
MODBUS (TCP, UDP)
MODBUS - Ein- und
1000 Worte,
„MODBUS“ > … > „Merkerbereich“)
Tabelle 25: Technische Daten – CANopen
CANopen - Ein- und
Ausgangsprozessabbild max.
2000 Worte
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
3.7.5 Programmierung
3.7.6 Klemmenbus
3.7.7 ETHERNET
SNMP, HTTP, HTTPS, SSH,
Ausgangsprozessabbild max.
Hinweis
Kein direkter Zugriff vom Feldbus auf das Prozessabbild der
Busklemmen!
Benötigte Daten aus dem Klemmenbus-Prozessabbild müssen explizit im
CODESYS-Programm auf die Daten im Feldbus-Prozessabbild gemappt
werden und umgekehrt! Ein direkter Zugriff ist nicht möglich!
3.7.8 CANopen
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)
zusätzlich MODBUS-Zugriff auf
Merkerbereich (Siehe Kapitel

48 Gerätebeschreibung WAGO-I/O-SYSTEM 750
Tabelle 26: Technische Daten – PROFIBUS
PROFIBUS - Ein- und
Ausgangsprozessabbild max.
244 Byte in 80 Steckplätzen
Tabelle 27: Technische Daten – Serielle Schnittstelle
Schnittstelle
1 x serielle Schnittstelle gemäß
(umschaltbar), 9-polige Sub-D-Buchse
Protokolle
MODBUS RTU
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
Hinweis
Kein direkter Zugriff vom Feldbus auf das Prozessabbild der
Busklemmen!
Benötigte Daten aus dem Klemmenbus-Prozessabbild müssen explizit im
CODESYS-Programm auf die Daten im Feldbus-Prozessabbild gemappt
werden und umgekehrt! Ein direkter Zugriff ist nicht möglich!
3.7.9 PROFIBUS
Hinweis
Kein direkter Zugriff vom Feldbus auf das Prozessabbild der
Busklemmen!
Benötigte Daten aus dem Klemmenbus-Prozessabbild müssen explizit im
CODESYS-Programm auf die Daten im Feldbus-Prozessabbild gemappt
werden und umgekehrt! Ein direkter Zugriff ist nicht möglich!
3.7.10 Serielle Schnittstelle
TIA/EIA 232 und TIA/EIA 485
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Gerätebeschreibung 49
Tabelle 28: Technische Daten – Verdrahtungsebene
Anschlusstechnik
CAGE CLAMP®
Leiterquerschnitt
0,08 mm² … 2,5 mm², AWG 28 … 14
Abisolierlänge
8 mm … 9 mm / 0.33 in
Tabelle 29: Technische Daten – Leistungskontakte
Leistungskontakte
Federkontakt, selbstreinigend
Spannungsabfall bei I
max.
< 1 V bei 64 Busklemmen
Tabelle 30: Technische Daten – Datenkontakte
Datenkontakte
Gleitkontakte, hartvergoldet,
selbstreinigend
Tabelle 31: Technische Daten – klimatische Umweltbedingungen
Betriebstemperaturbereich
0 °C …55 °C
Betriebstemperaturbereich bei
Temperaturbereich (750-xxx/025-xxx)
-20 °C … +60 °C
Lagertemperaturbereich
-25 °C … +85 °C
Lagertemperaturbereich bei
Temperaturbereich (750-xxx/025-xxx)
-40 °C … +85 °C
Relative Feuchte
max. 5 % … 95 %, ohne Betauung
Beanspruchung durch Schadstoffe
gem. IEC 60068-2-42 und
IEC 60068-2-43
Max. Schadstoffkonzentration bei einer
SO2 ≤ 25 ppm
H2S ≤ 10 ppm
Besondere Bedingungen
Die Komponenten dürfen nicht ohne
Strahlung auftreten können.
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
3.7.11 Anschlusstechnik
3.7.12 Klimatische Umweltbedingungen
Komponenten mit erweitertem
Komponenten mit erweitertem
relativen Feuchte < 75 %
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)
Zusatzmaßnahmen an Orten eingesetzt
werden, an denen Staub, ätzende
Dämpfe, Gase oder ionisierende

50 Gerätebeschreibung WAGO-I/O-SYSTEM 750
Konformitätskennzeichnung
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
3.8 Zulassungen
Folgende Zulassungen wurden für den Controller „PFC200 CS 2ETH RS CAN
DPS“ (750-8206) erteilt:
CULUS
UL508
Folgende Schiffszulassungen wurden nur für die Standardversion des Controllers
„PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS“ (750-8206) erteilt:
GL (Germanischer Lloyd) Cat. A, B, C, D (EMC 1)
3.9 Normen und Richtlinien
Der Controller „PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS“ (750-8206) erfüllt folgende
EMV-Normen:
EMV CE-Störfestigkeit gem. EN 61000-6-2: 2005
EMV CE-Störaussendung gem. EN 61000-6-3: 2007 + A1: 2011
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Funktionsbeschreibung 51
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
4 Funktionsbeschreibung
4.1 Netzwerkkonfiguration
Die ETHERNET-Schnittstellen X1 und X2 des Controllers können wahlweise im
Switch-Modus oder als getrennte Netzwerk-Schnittstellen betrieben werden.
Der Switch-Modus kann zur Laufzeit ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Im Auslieferungszustand und während der Erst-Inbetriebnahme ist der SwitchModus eingeschaltet. Der „Configuration Mode“ ist auf „DHCP“ eingestellt.
Für das Interface X1 kann eine feste IP-Adresse („Fix IP-Address“) eingestellt
werden.
Die Einstellung einer festen IP-Adresse hat keine Auswirkung auf den zuvor
eingestellten Modus.
4.1.1 Betrieb im Switch-Modus
Für den Betrieb im Switch-Modus gelten die TCP/IP-Einstellungen wie die IPAdresse oder die Subnetzmaske sowohl für X1 als auch für X2.
Beim Umschalten in den Switch-Modus werden die Einstellungen von X1 als
neue gemeinsame Konfiguration für X1 und X2 übernommen.
Das Gerät ist dann über die vormals für X2 eingestellte IP-Adresse nicht mehr
erreichbar. Für CODESYS-Applikationen, die X2 zur Kommunikation nutzen,
muss dies berücksichtigt werden.
4.1.2 Betrieb mit getrennten Netzwerk-Schnittstellen
Im Betrieb mit getrennten Netzwerk-Schnittstellen können die beiden
ETHERNET-Schnittstellen separat konfiguriert und eingesetzt werden.
Zu beachten ist, dass die beiden Schnittstellen nach wie vor über die gleiche
MAC-Adresse verfügen. Daher dürfen sie nicht im gleichen Netzsegment
betrieben werden.
Beim Umschalten in den Betrieb mit getrennten Schnittstellen wird die
Schnittstelle X2 mit den letzten für sie gültigen Einstellungswerten initialisiert.
Die Verbindungen, die über die X1-Schnittstelle laufen, bleiben bestehen.
Bei Betrieb mit getrennten Schnittstellen und fest eingestellter IP-Adresse kann
das Gerät über die Schnittstelle X2 weiterhin über die regulär eingestellte IPAdresse erreicht werden.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

52 Montieren WAGO-I/O-SYSTEM 750
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
5 Montieren
5.1 Einbaulage
Neben dem horizontalen und vertikalen Einbau sind alle anderen Einbaulagen
erlaubt.
Hinweis
Bei vertikalem Einbau Endklammer verwenden!
Montieren Sie beim vertikalen Einbau zusätzlich unterhalb des
Feldbusknotens eine Endklammer, um den Feldbusknoten gegen Abrutschen
zu sichern.
WAGO-Bestellnummer 249-116 Endklammer für TS 35, 6 mm breit
WAGO-Bestellnummer 249-117 Endklammer für TS 35, 10 mm breit
5.2 Gesamtaufbau
Die maximale Gesamtausdehnung eines Feldbusknotens ohne Feldbuskoppler/controller beträgt 780 mm inklusive Endklemme. Die Breite der Endklemme
beträgt 12 mm. Die übrigen Busklemmen verteilen sich also auf einer Länge von
maximal 768 mm.
Beispiele:
• An einen Feldbuskoppler/-controller können 64 Ein- und
Ausgangsbusklemmen der Breite 12 mm gesteckt werden.
• An einen Feldbuskoppler/-controller können 32 Ein- und
Ausgangsbusklemmen der Breite 24 mm gesteckt werden.
Ausnahme:
Die Anzahl der gesteckten Busklemmen hängt außerdem vom jeweiligen
Feldbuskoppler/-controller ab, an dem sie betrieben werden. Beispielsweise
beträgt die maximale Anzahl der anreihbaren Busklemmen an einem
PROFIBUS-DP/V1-Feldbuskoppler/-controller 63 Busklemmen ohne passive
Busklemmen und Endklemme.
ACHTUNG
Maximale Gesamtausdehnung eines Feldbusknotens beachten!
Die maximale Gesamtausdehnung eines Feldbusknotens ohne
Feldbuskoppler/-controller und ohne die Nutzung einer Busklemme 750-628
(Kopplerklemme zur Klemmenbusverlängerung) darf eine Länge von
780 mm nicht überschreiten.
Beachten Sie zudem Einschränkungen einzelner Feldbuskoppler/-controller.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Montieren 53
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
Hinweis
Gesamtausdehnung mit Kopplerklemme zur Klemmenbusverlängerung
erhöhen!
Mit der Busklemme 750-628 (Kopplerklemme zur
Klemmenbusverlängerung) können Sie die Gesamtausdehnung eines
Feldbusknotens erhöhen. Bei einem solchen Aufbau stecken Sie nach der
letzten Busklemme eines Klemmenblocks eine Busklemme 750-627
(Endklemme zur Klemmenbusverlängerung. Diese verbinden Sie per RJ-45Patch-Kabel mit der Kopplerklemme zur Klemmenbusverlängerung eines
weiteren Klemmenblocks.
So können Sie mit maximal 10 Busklemmen zur Klemmenbusverlängerung
einen Feldbusknoten mechanisch in maximal 11 Blöcke aufteilen.
Die zulässige Kabellänge zwischen zwei Blöcken beträgt 5 Meter.
Weitere Informationen finden Sie in den Handbüchern der Busklemmen
750-627 und 750-628).
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

54 Montieren WAGO-I/O-SYSTEM 750
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
5.3 Montage auf Tragschiene
5.3.1 Tragschieneneigenschaften
Alle Komponenten des Systems können direkt auf eine Tragschiene gemäß
EN 50022 (TS 35, DIN Rail 35) aufgerastet werden.
ACHTUNG
Tragschienen weisen unterschiedliche mechanische und elektrische Merkmale
auf. Für den optimalen Aufbau des Systems auf einer Tragschiene sind
Randbedingungen zu beachten:
• Das Material muss korrosionsbeständig sein.
• Die meisten Komponenten besitzen zur Ableitung von elektromagnetischen
• Die Tragschiene muss die im System integrierten EMV-Maßnahmen und
Ohne Freigabe keine WAGO-fremden Tragschienen verwenden!
WAGO liefert normkonforme Tragschienen, die optimal für den Einsatz mit
dem WAGO-I/O-SYSTEM geeignet sind. Sollten Sie andere Tragschienen
einsetzen, muss eine technische Untersuchung und eine Freigabe durch
WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG vorgenommen werden.
Einflüssen einen Ableitkontakt zur Tragschiene. Um Korrosionseinflüssen
vorzubeugen, darf dieser verzinnte Tragschienenkontakt mit dem Material
der Tragschiene kein galvanisches Element bilden, das eine
Differenzspannung über 0,5 V (Kochsalzlösung von 0,3 % bei 20 °C)
erzeugt.
die Schirmung über die Busklemmenanschlüsse optimal unterstützen.
• Eine ausreichend stabile Tragschiene ist auszuwählen und ggf. mehrere
Montagepunkte (alle 20 cm) für die Tragschiene zu nutzen, um Durchbiegen
und Verdrehung (Torsion) zu verhindern.
• Die Geometrie der Tragschiene darf nicht verändert werden, um den
sicheren Halt der Komponenten sicherzustellen. Insbesondere beim Kürzen
und Montieren darf die Tragschiene nicht gequetscht oder gebogen werden.
• Der Rastfuß der Komponenten reicht in das Profil der Tragschiene hinein.
Bei Tragschienen mit einer Höhe von 7,5 mm sind Montagepunkte
(Verschraubungen) unter dem Knoten in der Tragschiene zu versenken
(Senkkopfschrauben oder Blindnieten).
• Die Metallfedern auf der Gehäuseunterseite müssen einen niederimpedanten
Kontakt zur Tragschiene haben (möglichst breitflächige Auflage).
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Montieren 55
Tabelle 32: WAGO-Tragschienen
Bestellnummer
Beschreibung
210-113 /-112
35 x 7,5;
1 mm
Stahl gelb chromatiert; gelocht/ungelocht
210-114 /-197
35 x 15;
1,5 mm
Stahl gelb chromatiert; gelocht/ungelocht
210-118
35 x 15;
2,3 mm
Stahl gelb chromatiert; ungelocht
210-198
35 x 15;
2,3 mm
Kupfer; ungelocht
210-196
35 x 7,5;
1 mm
Aluminium; ungelocht
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
5.3.2 WAGO-Tragschienen
Die WAGO-Tragschienen erfüllen die elektrischen und mechanischen
Anforderungen.
5.4 Abstände
Für den gesamten Feldbusknoten sind Abstände zu benachbarten Komponenten,
Kabelkanälen und Gehäuse-/Rahmenwänden einzuhalten.
Abbildung 23: Abstände
Die Abstände schaffen Raum zur Wärmeableitung und Montage bzw.
Verdrahtung. Ebenso verhindern die Abstände zu Kabelkanälen, dass
leitungsgebundene elektromagnetische Störungen den Betrieb beeinflussen.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

56 Montieren WAGO-I/O-SYSTEM 750
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
5.5 Montagereihenfolge
Feldbuskoppler/-controller und Busklemmen des WAGO-I/O-SYSTEMs 750/753
werden direkt auf eine Tragschiene gemäß EN 50022 (TS 35) aufgerastet.
Die sichere Positionierung und Verbindung erfolgt über ein Nut- und FederSystem. Eine automatische Verriegelung garantiert den sicheren Halt auf der
Tragschiene.
Beginnend mit dem Feldbuskoppler/-controller werden die Busklemmen
entsprechend der Projektierung aneinandergereiht. Fehler bei der Projektierung
des Knotens bezüglich der Potentialgruppen (Verbindungen über die
Leistungskontakte) werden erkannt, da Busklemmen mit Leistungskontakten
(Messerkontakte) nicht an Busklemmen angereiht werden können, die weniger
Leistungskontakte besitzen.
VORSICHT
Verletzungsgefahr durch scharfkantige Messerkontakte!
Da die Messerkontakte sehr scharfkantig sind, besteht bei unvorsichtiger
Hantierung mit den Busklemmen Verletzungsgefahr.
ACHTUNG
Busklemmen nur in vorgesehener Reihenfolge stecken!
Alle Busklemmen verfügen an der rechten Seite über Nuten zur Aufnahme
von Messerkontakten. Bei einigen Busklemmen sind die Nuten oben
verschlossen. Andere Busklemmen, die an dieser Stelle linksseitig über
einen Messerkontakt verfügen, können dann nicht von oben angesteckt
werden. Diese mechanische Kodierung hilft dabei, Projektierungsfehler zu
vermeiden, die zur Zerstörung der Komponenten führen können. Stecken
Sie Busklemmen daher ausschließlich von rechts und von oben.
Hinweis
Busabschluss nicht vergessen!
Stecken Sie immer eine Busendklemme 750-600 an das Ende des
Feldbusknotens! Die Busendklemme muss in allen Feldbusknoten mit
Feldbuskopplern/-controllern des WAGO-I/O-SYSTEMs 750 eingesetzt
werden, um eine ordnungsgemäße Datenübertragung zu garantieren!
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Montieren 57
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
5.6 Geräte einfügen
ACHTUNG
5.6.1 Feldbuskoppler/-controller einfügen
Arbeiten an Geräten nur spannungsfrei durchführen!
Arbeiten unter Spannung können zu Schäden an den Geräten führen.
Schalten Sie daher die Spannungsversorgung ab, bevor Sie an den Geräten
arbeiten.
1. Wenn Sie den Feldbuskoppler/-controller gegen einen bereits vorhandenen
Feldbuskoppler/-controller austauschen, positionieren Sie den neuen
Feldbuskoppler/-controller so, dass Nut und Feder zur nachfolgenden
Busklemme verbunden sind.
2. Rasten Sie den Feldbuskoppler/-controller auf die Tragschiene auf.
3. Drehen Sie die Verriegelungsscheibe mit einer Schraubendreherklinge, bis
die Nase der Verriegelungsscheibe hinter der Tragschiene einrastet (siehe
nachfolgende Abbildung). Damit ist der Feldbuskoppler/-controller auf der
Tragschiene gegen Verkanten gesichert.
Mit dem Einrasten des Feldbuskopplers/-controllers sind die elektrischen
Verbindungen der Datenkontakte und (soweit vorhanden) der Leistungskontakte
zur gegebenenfalls nachfolgenden Busklemme hergestellt.
Abbildung 24: Verriegelung Controller
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

58 Montieren WAGO-I/O-SYSTEM 750
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
5.6.2 Busklemme einfügen
1. Positionieren Sie die Busklemme so, dass Nut und Feder zum
Feldbuskoppler/-controller oder zur vorhergehenden und gegebenenfalls zur
nachfolgenden Busklemme verbunden sind.
Abbildung 25: Busklemme einsetzen (Beispiel)
2. Drücken Sie die Busklemme in den Verbund, bis die Busklemme auf der
Tragschiene einrastet.
Abbildung 26: Busklemme einrasten (Beispiel)
Mit dem Einrasten der Busklemme sind die elektrischen Verbindungen der
Datenkontakte und (soweit vorhanden) der Leistungskontakte zum
Feldbuskoppler/-controller oder zur vorhergehenden und gegebenenfalls zur
nachfolgenden Busklemme hergestellt.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Geräte anschließen 59
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
6 Geräte anschließen
6.1 Leiter an CAGE CLAMP® anschließen
CAGE CLAMP®-Anschlüsse von WAGO sind für ein-, mehr- oder feindrahtige
Leiter ausgelegt.
Hinweis
Nur einen Leiter pro CAGE CLAMP® anschließen!
Sie dürfen an jedem CAGE CLAMP®-Anschluss nur einen Leiter
anschließen. Mehrere einzelne Leiter an einem Anschluss sind nicht
zulässig.
Müssen mehrere Leiter auf einen Anschluss gelegt werden, verbinden Sie diese in
einer vorgelagerten Verdrahtung, z. B. mit WAGO-Durchgangsklemmen.
Ausnahme:
Sollte es unvermeidbar sein, zwei mehr- oder feindrahtige Leiter an einem CAGE
CLAMP®-Anschluss anzuschließen, müssen Sie eine gemeinsame Aderendhülse
verwenden. Folgende Aderendhülsen sind einsetzbar:
Länge 8 mm
Nennquerschnitt
1 mm² für zwei mehr- oder feindrahtige Leiter
max.
mit je 0,5 mm²
WAGO-Produkt 216-103 oder Produkte mit gleichen Eigenschaften.
1. Zum Öffnen der CAGE CLAMP® führen Sie das Betätigungswerkzeug in
die Öffnung oberhalb des Anschlusses ein.
2. Führen Sie den Leiter in die entsprechende Anschlussöffnung ein.
3. Zum Schließen der CAGE CLAMP® entfernen Sie das
Betätigungswerkzeug wieder. Der Leiter ist festgeklemmt.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)
Abbildung 27: Leiter an CAGE CLAMP
®
anschließen

60 Geräte anschließen WAGO-I/O-SYSTEM 750
Tabelle 33: Filterklemmen für die 24V-Versorgung
Bestellnr.
Bezeichnung
Beschreibung
750-626
Supply Filter
Filterklemme für Systemversorgung und
(750-613)
750-624
Supply Filter
Filterklemme für die 24V-Feldversorgung
(750-602, 750-601, 750-610)
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
6.2 Einspeisekonzept
6.2.1 Ergänzende Einspeisevorschriften
Das WAGO-I/O-SYSTEM 750 kann auch im Schiffbau bzw. Off-/OnshoreBereichen (z. B. Arbeitsplattformen, Verladeanlagen) eingesetzt werden. Dies
wird durch die Einhaltung der Anforderungen einflussreicher
Klassifikationsgesellschaften, z. B. Germanischer Lloyd und Lloyds Register,
nachgewiesen.
Der zertifizierte Betrieb des Systems erfordert Filterklemmen für die 24VVersorgung.
Feldversorgung (24 V, 0 V), d. h. für
Feldbuskoppler/-controller und Bus Einspeisung
Daher ist zwingend folgendes Einspeisekonzept zu beachten.
Abbildung 28: Einspeisekonzept
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 Geräte anschließen 61
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
Hinweis
Für Potentialausgleich Einspeiseklemme verwenden!
Setzen Sie hinter der Filterklemme 750-626 eine zusätzliche
Potentialeinspeiseklemme 750-601/-602/-610 dann ein, wenn Sie den
unteren Leistungskontakt für Potentialausgleich beispielsweise zwischen
Schirmanschlüssen verwenden wollen und einen zusätzlichen Abgriff für
dieses Potential benötigen.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

62 In Betrieb nehmen WAGO-I/O-SYSTEM 750
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
7 In Betrieb nehmen
7.1 Einschalten des Controllers
Überprüfen Sie vor Einschalten des Controllers, dass Sie
• den Controller ordnungsgemäß montiert haben
(siehe Kapitel „Montieren“),
• alle benötigten Datenleitungen (siehe Kapitel „Anschlüsse“) an die
entsprechenden Schnittstellen angeschlossen und mit den an den
Steckverbindern vorhanden Arretierungsschrauben befestigt haben,
• die Elektronik- und Feldversorgung angeschlossen haben
(siehe Kapitel „Anschlüsse“),
• die Endklemme (750-600) gesteckt haben
(siehe Kapitel „Montieren“),
• einen angemessenen Potentialausgleich an Ihrer Maschine/Anlage
durchgeführt haben (siehe Systembeschreibung 750-xxx) und
• die Schirmung ordnungsgemäß durchgeführt haben (siehe
Systembeschreibung 750-xxx).
Zum Einschalten des Controllers und der daran angeschlossenen Busklemmen
schalten Sie an Ihrem Netzteil die Versorgungsspannung ein.
Das Starten des Controllers wird durch ein kurzes grünes Aufblinken aller LEDs
signalisiert. Nach einigen weiteren Sekunden signalisiert die SYS-LED den
erfolgreichen Bootvorgang des Controllers. Gleichzeitig wird das RuntimeSystem CODESYS 2.3 gestartet.
Wurde das gesamte System erfolgreich gestartet, leuchten die SYS und die I/OLED grün.
Ist kein ausführbares IEC-61131-3 Programm auf dem Controller hinterlegt oder
steht der RUN-STOP-Schalter auf STOP, leuchtet die RUN-LED rot.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 In Betrieb nehmen 63
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
7.2 Ermitteln der IP-Adresse des Host-PC
Damit der Host-PC mit dem Controller über das ETHERNET-Netzwerk
kommunizieren kann, müssen sich beide im gleichen Subnetz befinden.
Zum Ermitteln der IP-Adresse des Host-PC (mit Betriebssystem Microsoft
Windows®) mittels der Eingabeaufforderung gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Öffnen Sie die Eingabeaufforderung.
Geben sie dazu im Eingabefeld unter Start > Ausführen… > Öffnen:
(Windows® XP) oder Start > Programme/Dateien durchsuchen
(Windows® 7) den Befehl „cmd“ ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der
[OK]-Schaltfläche oder der [Enter]-Taste.
2. Geben Sie in der Eingabeaufforderung den Befehl „ipconfig“ ein und
bestätigen Sie die Eingabe mit der [Enter]-Taste.
3. Es erscheinen die IP-Adresse, Subnetzmaske und das Standard-Gateway mit
den dazugehörigen Parametern.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

64 In Betrieb nehmen WAGO-I/O-SYSTEM 750
Tabelle 34: Voreingestellte IP-Adressierungen der Ethernet-Schnittstellen
Ethernet-Schnittstelle
Voreinstellung
X1/X2
Dynamische Vergabe der IP-Adresse mittels "Dynamic
Host Configuration Protocol" (DHCP)
Tabelle 35: Netzmaske 255.255.255.0
Host-PC
Subnetzadressraum für den Controller
192.168.1.2
192.168.1.3 … 192.168.1.254
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
7.3 Einstellen einer IP-Adresse
Im Auslieferungszustand des Controllers ist für die ETHERNET-Schnittstelle
(Port X1 und Port X2) folgende IP-Adressierung aktiv:
Damit ein PC und der Controller miteinander kommunizieren können, passen Sie
mit einem der vorhandenen Konfigurationswerkzeuge (WBM, WAGO Ethernet
Settings, CBM) die IP-Adressierung an Ihre Systemstruktur an (siehe Kapitel
„Konfigurieren“).
Beispiel zum Einbinden des Controllers (192.168.1.17) in ein bestehendes
Netzwerk:
Wenn die IP-Adresse Ihres Host-PC z. B. 192.168.1.2 lautet, dann muss sich der
Controller im selben Subnetz befinden. Das heißt, bei der Netzmaske
255.255.255.0 müssen die ersten drei Stellen des Controllers mit denen Ihres PC
übereinstimmen. Daraus ergibt sich für den Controller folgender Adressraum:
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 In Betrieb nehmen 65
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
7.3.1 Zuweisen einer IP-Adresse mittels DHCP
Der PFC200 kann seine IP-Adresse dynamisch (DHCP/BootP) von einem Server
beziehen.
Im Gegenteil zu festen IP-Adressen werden dynamisch zugewiesene Adressen
nicht permanent gespeichert. Daher ist bei jedem Neustart des Controllers die
Anwesenheit eines BootP- oder DHCP-Servers erforderlich.
Wurde die IP-Adresse mittels DHCP vergeben (Standardeinstellung), so kann
diese über die Einstellungen bzw. die Ausgaben des jeweiligen DHCP-Servers
ermittelt werden.
Im Beispielbild ist die entsprechende Ausgabe von „Open DHCP“ zu sehen.
Abbildung 29: „Open DHCP, Beispielbild“
In Verbindung mit einem an das DHCP angebundenen DNS-Server ist es
möglich, das Gerät über seinen Hostnamen zu erreichen.
Dieser besteht aus dem Präfix „PFC200-“ und den letzten 6 Stellen der MACAdresse (im Beispielbild: „00:30:DE:FF:00:5A“). Die MAC-Adresse des Gerätes
ist auf dem seitlich am Gerät angebrachten Etikett aufgedruckt.
Der Hostname im abgebildeten Beispiel ist damit „PFC200-FF005A“.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

66 In Betrieb nehmen WAGO-I/O-SYSTEM 750
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
7.3.2 Ändern einer IP-Adresse mit dem Konfigurationstool „CBM“ über die serielle Schnittstelle
Über das auf der Linux-Konsole erreichbare Konfigurationstool „CBM“ können
Sie u. a. den ETHERNET-Schnittstellen X1 und X2 eine neue IP-Adresse
zuweisen. Weitere Informationen zu CBM erhalten Sie im Kapitel
„Konfigurieren“.
Vorbereitung:
Schließen Sie einen PC mit einem Terminalprogramm an die serielle Schnittstelle
X3 an.
1. Starten Sie das Konfigurationstool, indem Sie den Befehl "cbm" in der
Kommandozeile eingeben und mit der [Enter]-Taste bestätigen.
Abbildung 30: CBM – Startbild
2. Wählen Sie im Main Menu über die Tastatur (Pfeiltasten oder
Nummernblock) den Eintrag Networking aus und drücken Sie die [Enter]Taste.
Abbildung 31: CBM – Auswahl „Networking“
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 In Betrieb nehmen 67
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
3. Wählen Sie im Menü Networking den Eintrag TCP/IP aus und drücken Sie
die [Enter]-Taste.
Abbildung 32: CBM – Auswahl „TCP/IP“
4. Wählen Sie Menü TCP/IP den Eintrag IP Address aus und drücken Sie die
[Enter]-Taste.
Abbildung 33: CBM – Auswahl „IP-Address“
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

68 In Betrieb nehmen WAGO-I/O-SYSTEM 750
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
5. Wählen Sie im Menü TCP/IP Configuration den Eintrag IP-Address aus
und drücken Sie die [Enter]-Taste.
Abbildung 34: CBM – Auswahl der IP-Adresse
6. Geben Sie im Menü Change IP Address die neue IP-Adresse ein und
bestätigen Sie diese mittels [OK]. Wollen Sie ohne eine Änderung ins
Hauptmenü zurückkehren, wählen Sie [Abort].
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)
Abbildung 35: CBM – Eingabe der neuen IP-Adresse

WAGO-I/O-SYSTEM 750 In Betrieb nehmen 69
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
7.3.3 Ändern einer IP-Adresse mit „WAGO Ethernet Settings“
Die Microsoft-Windows®-Anwendung „WAGO Ethernet Settings“ ist eine
Software, mit welcher Sie den Controller identifizieren und die
Netzwerkeinstellungen konfigurieren können.
Hinweis
Softwareversion beachten!
Verwenden Sie zur Konfiguration des Controllers mindestens die Version
5.4.2.3 vom 30.07.2013 von „WAGO Ethernet Settings“!
Zur Datenkommunikation können Sie WAGO-Kommunikationskabel oder
WAGO-Funkadapter oder ggf. das IP-Netzwerk verwenden.
1. Schalten Sie die Betriebsspannung des Controllers aus.
2. Schließen Sie das Kommunikationskabel 750-920 an die Service-
Schnittstelle des Controllers und an eine serielle Schnittstelle Ihres PCs an.
3. Schalten Sie die Betriebsspannung des Controllers wieder ein.
4. Starten Sie das Programm WAGO Ethernet Settings.
Abbildung 36: WAGO Ethernet Settings – Startbildschirm
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Identifizieren], um den angeschlossenen
PFC200 einzulesen und zu identifizieren.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

70 In Betrieb nehmen WAGO-I/O-SYSTEM 750
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
6. Wählen Sie das Register „Netzwerk“:
Abbildung 37: WAGO Ethernet Settings – Register Netzwerk
7. Damit Sie eine feste Adresse vergeben können, wählen Sie in der Zeile
„Bezugsquelle“ unter „Eingabe“ den Wert „Statische Konfiguration“ aus.
Standardmäßig ist DHCP aktiviert.
8. Geben Sie in der Spalte „Eingabe“ die gewünschte IP-Adresse und
gegebenenfalls die Adresse der Subnetzmaske und des Gateways ein.
9. Klicken Sie auf die Schaltfläche [Schreiben], um die Adresse in den
PFC200 zu übernehmen. (Beim Klicken auf die Schaltfläche [Schreiben]
wird WAGO Ethernet Settings Ihren Controller automatisch neu starten.
Daher nimmt diese Aktion ca. 30. Sekunden in Anspruch.)
10. Nun können Sie WAGO Ethernet Settings schließen oder bei Bedarf direkt
im Web-based-Management weitere Einstellungen vornehmen. Klicken sie
dazu auf [WBM] im rechten Fensterbereich.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 In Betrieb nehmen 71
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
7.4 Testen der Netzwerkverbindung
Um zu überprüfen, ob Sie den Controller unter der von Ihnen vergebenen IPAdresse im Netzwerk erreichen, führen Sie den Netzwerkdienst „ping“ durch:
1. Öffnen Sie die Eingabeaufforderung.
Geben sie dazu im Eingabefeld unter Start > Ausführen… > Öffnen:
(Windows® XP) oder Start > Programme/Dateien durchsuchen
(Windows® 7) den Befehl „cmd“ ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der
[OK]-Schaltfläche oder der [Enter]-Taste.
2. Geben Sie in der Eingabeaufforderung den Befehl „ping“ und die IP-
Adresse des Controllers (z. B. ping 192.168.1.17)ein und bestätigen
Sie die Eingabe mit der [Enter]-Taste.
Hinweis
Host-Einträge der ARP-Tabelle zu löschen!
Gegebenenfalls ist es sinnvoll, vor Ausführung des „pings“ die aktuellen
Host-Einträge der ARP-Tabelle mit „arp -d *“ zu löschen (unter Windows®
7 als Administrator ausführen). Damit ist sichergestellt, dass kein veralteter
Eintrag Grund für einen nicht erfolgreichen „ping“ ist.
3. Ihr PC sendet eine Anfrage, die vom Controller beantwortet wird. Die
Antwort erscheint in der Eingabeaufforderung. Wenn die Fehlermeldung
„Timeout“ erscheint, hat der Controller sich nicht ordnungsgemäß gemeldet.
Überprüfen Sie bitte Ihre Netzwerkeinstellung.
Abbildung 38: Beispiel eines Funktionstests
4. Haben Sie den Test erfolgreich durchgeführt, dann schließen Sie die
Eingabeaufforderung.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

72 In Betrieb nehmen WAGO-I/O-SYSTEM 750
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
7.5 Ausschalten/Neustart
Um den Controller auszuschalten, schalten Sie die Versorgungsspannung ab.
Um einen Neustart des Controllers durchzuführen, betätigen Sie den Reset-ALLTaster und halten ihn länger als 7 Sekunden gedrückt, bis alle LED ausgehen.
Der Controller führt dann einen Neustart durch.
Alternativ schalten Sie Sie den Controller aus und anschließend wieder ein.
Der Neustart des Controllers wird durch kurzes grünes Aufleuchten aller LEDs
signalisiert.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 In Betrieb nehmen 73
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
7.6 Reset-Funktionen auslösen
Mit dem Betriebsartenschalter und dem Reset-Taster (RST) können Sie
verschiedene Reset-Funktionen auslösen.
7.6.1 Warmstart-Reset
Bei einem Warmstart-Reset wird die CODESYS-2-Anwendung zurückgesetzt.
Dies entspricht dem CODESYS-2-IDE-Befehl „Reset“.
Um einen Warmstart-Reset durchzuführen, bringen Sie den Betriebsartenschalter
in die Reset-Position und halten ihn dort länger als 2 Sekunden aber kürzer als 7
Sekunden.
Die Ausführung wird durch ein kurzes Erlöschen der roten „RUN“-LED nach
dem Loslassen des Betriebsartenschalters signalisiert.
7.6.2 Kaltstart-Reset
Bei einem Kaltstart-Reset wird die CODESYS-2-Anwendung zurückgesetzt und
der Speicher mit den Retain-Variablen gelöscht.
Dies entspricht dem CODESYS-2-IDE-Befehl „Reset (Kalt)“.
Um einen Kaltstart-Reset durchzuführen, bringen Sie den Betriebsartenschalter in
die Reset-Position und halten ihn dort länger als 7 Sekunden.
Die Ausführung wird nach Ablauf der 7 Sekunden durch ein längeres Erlöschen
der roten „RUN“-LED signalisiert. Lassen Sie den Betriebsartenschalter
anschließend wieder los.
7.6.3 Software-Reset (Neustart)
Bei einem Software-Reset wird der Controller neu gestartet.
Um einen Software-Reset durchzuführen, bringen Sie den Betriebsartenschalter in
die RUN- oder STOP-Position und betätigen Sie den Reset-Taster (RST) länger
als 1 Sekunde aber kürzer als 8 Sekunden.
Die Ausführung wird durch ein kurzes grünes Aufleuchten aller LEDs signalisiert.
7.6.4 Fixe IP-Adresse einstellen
Mit diesem Vorgang wird die IP-Adresse für die Schnittstelle X1 auf die feste
Adresse „192.168.1.17“ eingestellt.
Bei eingeschaltetem Switch wird die feste Adresse auch für die Schnittstelle X2
verwendet.
Bei ausgeschaltetem Switch wird die ursprüngliche Adresseinstellung für die
Schnittstelle X2 nicht verändert.
Es wird kein Reset durchgeführt.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

74 In Betrieb nehmen WAGO-I/O-SYSTEM 750
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
Um die Einstellung vorzunehmen, bringen Sie den Betriebsartenschalter in die
STOP-Position und betätigen Sie den Reset-Taster (RST) länger als 8 Sekunden.
Die Ausführung wird durch eine orange blinkende „SYS“-LEDs signalisiert.
Um die Einstellung aufzuheben, führen Sie einen Software-Reset durch oder
schalten sie den Controller aus und wieder ein.
7.6.5 Factory-Reset
Bei einem Factory-Reset wird der Auslieferungszustand wiederhergestellt.
Anschließend wird der Controller neu gestartet.
Hinweis
Nachinstallierte Firmware-Funktionen werden überschrieben!
Mit dem Factory-Reset werden nachinstallierte Firmware-Funktionen
überschrieben, da die Firmware auf die auf dem Gerät aufgedruckte Version
zurückgesetzt wird.
Nach dem Zurücksetzen auf den Auslieferungszustand stehen
gegebenenfalls einige der in diesem Handbuch beschriebenen Funktionen
nicht mehr zur Verfügung.
Um den aktuellen Betriebszustand wiederherstellen zu können, benötigen
Sie:
• ein Backup der aktuell programmierten Applikation,
• die aktuell installierte Firmware,
• die zum Auslieferungszustand passende Handbuchversion.
Bei Rückfragen wenden Sie Sich an den WAGO-Support.
Um einen Factory-Reset durchzuführen, bringen Sie den Betriebsartenschalter in
die Position „RESET“ und betätigen Sie den Reset-Taster (RST) länger als 1
Sekunde und weniger als 8 Sekunden. Lassen Sie den Reset-Taster (RST) kurz los
(< 1 Sekunde) und betätigen Sie ihn erneut solange, bis die „CAN“-LED rot
leuchtet. Wenn die „CAN“-LED rot leuchtet, lassen Sie den Betriebsartenschalter
und den Reset-Taster los.
Nach den ersten 1 … 8 Sekunden bootet der Controller neu (alle LEDs leuchten
orange) und nach weiteren 3 Sekunden beginnt der „Factory-Reset“-Vorgang. Er
wird durch ein aufeinander folgendes rotes Aufleuchten aller LEDs signalisiert.
Alternativ können Sie den Factory-Reset auch beim Einschalten des Controllers
auslösen. Halten Sie hierzu beim Einschalten für mindestens 3 Sekunden den
Betriebsartenschalter in der Position „RESET“ und den Reset-Taster (RST)
gedrückt, bis die „CAN“-LED rot leuchtet. Wenn die „CAN“-LED rot leuchtet,
lassen Sie den Betriebsartenschalter und den Reset-Taster los.
Hinweis
Reset-Vorgang nicht unterbrechen!
Wird der Reset-Taster (RST) zu früh (nach dem Reset-Vorgang)
losgelassen, dann schaltet der Controller in einen Fertigungsmodus
(signalisiert durch eine grün leuchtende „CAN“-LED). In diesem Fall
schalten Sie den Controller aus und wieder ein.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 In Betrieb nehmen 75
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
Hinweis
Nicht Ausschalten!
Die Wiederherstellung des Auslieferungszustandes darf nicht unterbrochen
werden. Schalten Sie daher den Controller nicht aus!
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

76 In Betrieb nehmen WAGO-I/O-SYSTEM 750
Tabelle 36: Dienste und Benutzer
WBM
Linux
Web Based Management
(WBM)
Linux®-Konsole
X X X
Console Based Management
(CBM)
CODESYS
X
Telnet X X X
FTP X X X
FTPS X X X
SSH X X X
SNMP X
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
7.7 Benutzer und Passwörter
Im Controller gibt es mehrere Gruppen von Benutzern, die für unterschiedliche
Dienste verwendet werden können.
Bei allen Benutzern sind Standardpassworte eingestellt. Es wird dringend
empfohlen, diese bei der Inbetriebnahme zu ändern!
Hinweis
Passwörter ändern
Die im Auslieferungszustand voreingestellten Standard-Passwörter sind in
dieser Betriebsanleitung dokumentiert und bieten so keinen hinreichenden
Schutz! Ändern Sie die Passwörter entsprechend Ihren Erfordernissen!
7.7.1 Dienste und Benutzer
In der folgenden Tabelle sind alle passwortgeschützten Dienste und die
dazugehörigen Benutzer aufgelistet.
Dienst
admin
user
root
admin
user
X X
SNMP-Benutzer
X X
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 In Betrieb nehmen 77
Tabelle 37: WBM-Benutzer
Benutzer
Rechte
Voreingestelltes Passwort
admin
Alle (administrator)
wago
user
Eingeschränkt
user
guest
Nur Anzeige
---
Tabelle 38: Linux®-Benutzer
Benutzer
Besonderheit
Home-Verzeichnis
Voreingestelltes
Passwort
root
Superuser
/root
wago
admin
CODESYSBenutzer
/home/admin
wago
user
Einfacher Benutzer
/home/user
user
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
7.7.2 Gruppe WBM
Das WBM hat eine eigene Benutzerverwaltung. Die hier verwendeten Benutzer
sind aus Sicherheitsgründen von den übrigen Benutzergruppen im System isoliert.
Nähere Informationen sind im Kapitel „Benutzerverwaltung des WBM“ zu
finden.
7.7.3 Gruppe Linux-User
Die Gruppe der Linux®-User umfasst die eigentlichen Benutzer des
Betriebssystems, die von den meisten Services ebenfalls verwendet werden.
Die Passworte für diese Benutzer sind über eine Terminalverbindung über
SSH/RS-232 zu konfigurieren.
7.7.4 Gruppe SNMP-User
Der SNMP-Dienst verwaltet seine eigenen Benutzer. Hier sind im
Auslieferungszustand keine Benutzer hinterlegt.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

78 In Betrieb nehmen WAGO-I/O-SYSTEM 750
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
7.8 Konfigurieren
Zur Konfiguration des PFC200 stehen Ihnen folgende Wege zur Verfügung:
• Zugriff über den PC mittels Internet-Browser auf das Web-based
Management (Kapitel „Konfiguration mittels Web-based Management
(WBM)“)
• Zugriff über den PC mittels eines Terminalprogramms (über Ethernet
und/oder RS-232-Schnittstelle) auf das „Console-based Management
(CBM)“ (Kapitel „Konfiguration mit einem Terminalprogramm“)
• Zugriff über das SPS-Programm CODESYS mittels der
WagoConfigToolLIB.lib (Kapitel „Anhang“ > „WagoConfigToolLIB.lib“)
• Zugriff über den PC mittels „WAGO Ethernet Settings“ (Kapitel
„Konfigurieren mit ‚WAGO-Ethernet Settings‘“).
Das CBM stellt im Wesentlichen dieselben Parameter zur Konfiguration des
PFC200 zur Verfügung wie das WBM. Ausgenommen sind lediglich Parameter,
die nicht sinnvoll in einem Terminalfenster dargestellt werden können.
Die Erläuterungen zu den Parametern entnehmen Sie bitte ab Kapitel „Seite
‚Information‘“.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 In Betrieb nehmen 79
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
7.8.1 Konfiguration mittels Web-based Management (WBM)
Die HTML-Seiten (im Folgenden kurz: Seiten) des Web-based Managements
dienen zur Konfiguration des PFC200. Für den Zugriff auf das WBM über einen
Internet-Browser gehen Sie folgendermaßen vor:
1. Verbinden Sie den PFC200 über die ETHERNET-Schnittstelle X1 mit dem
ETHERNET-Netzwerk.
2. Um auf die Seiten zuzugreifen, geben Sie in die Adresszeile Ihres Internet-
Browsers die IP-Adresse des Controllers gefolgt von „/wbm“ ein, z. B.
„http://192.168.1.17/wbm“. Beachten Sie, dass sich PC und PFC200 im
selben Subnetz befinden müssen (siehe dazu Kapitel „Einstellen einer IPAdresse“). Wenn Sie die IP-Adresse nicht kennen und nicht ermitteln
können, schalten Sie den Controller mit der „Fix IP Address“-Funktion auf
die voreingestellte Adresse „192.168.1.17“ um (siehe Kapitel „ResetFunktionen auslösen“ > „Fixe IP-Adresse einstellen“).
Wenn Sie einen DHCP-Server auf Ihrem PC installiert haben und über DHCP auf
das WBM zugreifen möchten, nutzen Sie die andere Schnittstelle. Detaillierte
Informationen dazu erhalten Sie im Kapitel „Zuweisen einer IP-Adresse mittels
DHCP“.
Hinweis
Startseite des PFC200 anzeigen
Zeigt der PFC200 nicht die Startseite an, vergewissern Sie sich, dass die
Einstellungen Ihres Internet-Browsers das Umgehen des Proxyservers für
lokale Adressen gestattet. Ferner kontrollieren Sie, ob sich Ihr PC im
gleichen Subnetz befindet wie der PFC200.
Hinweis
Auslastung durch CODESYS-Programm berücksichtigen
Wenn der PFC200 durch ein CODESYS-Programm ausgelastet ist, kann
dies zu einer verlangsamten Verarbeitung im WBM führen. Unter
Umständen werden deshalb Timeout-Fehler gemeldet. Es ist deshalb
sinnvoll, vor umfangreichen Konfigurationen über das WBM die
CODESYS-Applikation zu stoppen.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

80 In Betrieb nehmen WAGO-I/O-SYSTEM 750
Tabelle 39: Benutzereinstellungen im Auslieferungszustand
Benutzer
Passwort
user
user
admin
wago
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
Einige Seiten des WBM sind passwortgeschützt. Wählen Sie erstmalig einen
Eintrag aus der Navigationsleiste, erscheint die Passwortabfrage:
Abbildung 39: Authentifizierung eingeben
7.8.1.1 Benutzerverwaltung des WBM
Um Einstellungen nur durch einen ausgewählten Personenkreis zu erlauben,
begrenzen Sie über die Benutzerverwaltung den Zugriff auf die Funktionen des
WBM.
Hinweis
Passwörter ändern
Die Standard-Passwörter sind in dieser Betriebsanleitung dokumentiert und
bieten so keinen hinreichenden Schutz. Ändern Sie die Passwörter
entsprechend Ihren Erfordernissen. Siehe dazu Kapitel „Seite
‚Administration - Users’“.
Solange Sie die Passwörter nicht ändern, wird nach dem Einloggen bei jeder
aufgerufenen Webseite ein entsprechender Warnhinweis erscheinen.
Abbildung 40: Passworterinnerung
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 In Betrieb nehmen 81
Tabelle 40: Zugriffsrechte für die WBM-Seiten
Navigation
WBM-Seite
Benutzer
Information
Status Information
---
CODESYS
– Information
CODESYS Information
---
– General Configuration
CODESYS Configuration
user, admin
– WebVisu
CODESYS WebVisu
---
Networking
– Host/Domain Name
Configuration of Network Parameters
user, admin
– TCP/IP
TCP/IP Configuration
user, admin
– Ethernet
Configuration of Ethernet Parameters
user, admin
Clock
Configuration of Date and Time
user, admin
Administration
– Users
Configuration of the users for the Webbased Management
admin
– Create Image
Create bootable Image
admin
– Serial Interface
Configuration of Serial Interface RS233
admin
– Reboot
Reboot Controller
admin
Package Server
– Firmware Backup
Firmware Backup
admin
– Firmware Restore
Firmware Restore
admin
– System Partition
System Partition
admin
Mass Storage
Mass Storage
admin
Software Uploads
Software Uploads
admin
Ports and Services
– Network Services
Configuration of Network Services
user, admin
– NTP Client
Configuration of NTP Client
user, admin
– CODESYS Services
Configuration of the CODESYS Services
user, admin
– SSH
SSH Client Settings
user, admin
– TFTP
TFTP Server
user, admin
SNMP
– General Configuration
Configuration of SNMP parameter general
admin
– v1/v2c
Configuration of SNMP parameter v1/v2c
admin
– v3
Configuration of SNMP v3 Users
admin
Diagnostic
Diagnostic Information
---
PROFIBUS DP
Configuration of PROFIBUS DP Slave
user, admin
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
Hinweis
Zugriffsrechte beachten
Die User im WBM berechtigen ausschließlich für den Zugriff auf die
Webseiten. Die User-Verwaltung für die Steuerungsanwendungen wird
separat angelegt.
Für die Seiten des WBM sieht der Zugriff folgendermaßen aus:
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

82 In Betrieb nehmen WAGO-I/O-SYSTEM 750
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
7.8.1.2 Allgemeine Seiteninformationen
Abbildung 41: WBM-Browser-Fenster (Beispiel)
In der Kopfzeile des Browser-Fensters wird der Gerätename angezeigt.
Auf der linken Seite des Browser-Fensters wird der Navigationsbaum angezeigt.
Über den Navigationsbaum können Sie die einzelnen Seiten und, falls vorhanden,
deren Unterseiten erreichen.
Auf der rechten Seite wird ein Statusbereich mit folgenden Elementen angezeigt:
Abbildung 42: WBM-Statusinformationen (Beispiel)
• WBM Status:
Hier ist zu erkennen, ob das WBM aktuell im Hintergrund mit dem Gerät
kommuniziert. Das heißt, es wurden eine oder mehrere Anfragen gesendet,
und der Browser wartet auf Antwort. In der Grafik ist dann eine Bewegung
sichtbar. Dieser Fall tritt auf, wenn beim initialen Aufruf der Seite Daten
ausgelesen werden, wenn der Benutzer ein Änderungsformular abgeschickt
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 In Betrieb nehmen 83
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
hat oder wenn Daten automatisch zyklisch nachgeladen werden, wie z. B.
die Inhalte des Statusbereichs.
• Local Time:
Lokalzeit auf dem Gerät
• Local Date:
Lokales Datum auf dem Gerät
• PLC Switch:
Zustand des Betriebsartenschalters
• LEDs:
Hier werden die Zustände der LEDs des Gerätes angezeigt. Alle LEDs
werden symbolisiert über eine Grafik, und sind beschriftet mit ihrer
jeweiligen Bezeichnung (z. B. SYS, RUN, ...). Es sind folgende Farben
möglich:
- grau:
LED ist aus
- vollflächige Farbe (grün, rot, gelb, orange):
Die LED ist in der jeweiligen Farbe angeschaltet
- halbflächige Farbe:
Die LED blinkt in der entsprechenden Farbe. Die andere Hälfte der Fläche
ist dann entweder grau oder ebenfalls gefärbt. Letzteres bedeutet, dass die
LED sequentiell in verschiedenen Farben blinkt.
Solange der Mauszeiger sich über einer LED befindet, öffnet sich ein
Tooltip mit weiteren Informationen. Der angezeigte Text enthält die
Meldung, die die LED in ihren aktuellen Zustand versetzt hat. Hier ist auch
die Zeitangabe der Meldung enthalten.
Die im WBM angezeigten Zustände entsprechen nicht zu jedem Zeitpunkt
genau denen auf dem PFC200. Die Daten haben bei der Übertragung eine
Laufzeit und können auch nur in einem bestimmten Intervall abgefragt
werden. Die Zeitdauer zwischen zwei Abfragen beträgt 30 Sekunden.
Die Inhalte der einzelnen Seiten und Unterseiten sind in den nachfolgenden
Kapiteln erläutert.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

84 In Betrieb nehmen WAGO-I/O-SYSTEM 750
Tabelle 41: WBM-Seite „Status Information“ – Gruppe „Controller Details“
Parameter
Bedeutung
Product Description
Bezeichnung des Controllers
Order Number
Bestellnummer des Controllers
Anzeige, dass das Laufzeitsystem CODESYS
vorhanden ist.
Firmware Revision
Firmware-Stand
Tabelle 42: WBM-Seite „Status Information“ – Gruppe(n) „Network Details (Xn)“
Parameter
Bedeutung
Status der ETHERNET-Schnittstelle
(aktiviert/deaktiviert)
MAC-Adresse, die zur Identifikation und
Adressierung des Controllers dient.
IP Address
Aktuelle IP-Adresse des Controllers
Subnet Mask
Aktuelle Subnetzmaske des Controllers
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
7.8.1.3 Seite „Status Information“
Die nachfolgenden Tabellen erläutern die auf der Seite aufgeführten Parameter:
7.8.1.3.1 Gruppe „Controller Details“
Licence Information
7.8.1.3.2 Gruppe(n) „Network Details (Xn)“
Wenn der Switch eingeschaltet ist, wird für beide Anschlüsse eine Gruppe
(„Network Details“) angezeigt.
Wenn der Switch ausgeschaltet ist, wird für jeden Anschluss eine eigene Gruppe
(„Network Details X1“ / „Network Details X2“) angezeigt.
State
Mac Address
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 In Betrieb nehmen 85
Tabelle 43: WBM-Seite „CODESYS Configuration” – Gruppe „General Configuration“
Anzeigefelder
Bedeutung
Hier wählen Sie aus, welche CODESYS-Version Sie
benutzen wollen.
None
CODESYS wird nicht aktiviert.
2
CODESYS Version 2 wird benutzt.
Hier wählen Sie das Speichermedium aus, auf dem
das Bootprojekt gespeichert wird.
Das Bootprojekt wird auf der
Speicherkarte gespeichert.
Das Bootprojekt wird im internen
Flash-Speicher gespeichert.
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
7.8.1.4 Seite „CODESYS Configuration“
Auf der Seite „CODESYS Configuration“ finden Sie die Einstellungen zu dem in
CODESYS erstellten Boot-Projekt.
7.8.1.4.1 Gruppe „General Configuration“
CODESYS Version
(Boot-Device)
Hinweis
„Internal Flash“ nicht immer verfügbar!
Das Speichern des Bootprojekts im internen Flash ist nur möglich, wenn das
Betriebssystem aus dem internen Flash gestartet wurde.
Wenn das Betriebssystem von der Speicherkarte gestartet wurde, ist die
Option „Internal Flash“ nicht anwählbar.
Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Submit]. Die
Änderung wird sofort wirksam.
Hinweis
Controller nach dem Umschalten neu starten!
Nach dem Umschalten müssen Sie den Controller neu starten, damit
eventuell noch offene Dateien korrekt umgeschaltet werden.
Memory Card
Internal Flash
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

86 In Betrieb nehmen WAGO-I/O-SYSTEM 750
Tabelle 44: WBM-Seite „CODESYS Information” – Gruppe „CODESYS“
Anzeigefelder
Bedeutung
Hier wird die Version des aktuell aktivierten
Gruppe werden ausgeschaltet.).
Hier wird die Versionsnummer des CODESYS-
wenn CODESYS eingeschaltet ist.
Hier wird der CODESYS-Betriebszustand angezeigt.
eingeschaltet ist.
STOP
SPS-Programm wird nicht ausgeführt.
RUN
SPS-Programm wird ausgeführt.
Hier wird die Anzahl der Tasks im CODESYS-
wenn CODESYS eingeschaltet ist.
Tabelle 45: WBM-Seite „CODESYS Information” – Gruppe „Projekt Details“
Anzeigefelder
Bedeutung
Date
Anzeige von Projektinformationen, die der
(in CODESYS unter Projekt > Projektinformation...).
lange Beschreibungstexte dargestellt.
Description
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
7.8.1.5 Seite „CODESYS Information“
Auf der Seite „CODESYS Information“ finden Sie alle Informationen zu dem in
CODESYS erstellten SPS-Programm.
7.8.1.5.1 Gruppe „CODESYS“
CODESYS-Laufzeitsystems angezeigt (bei
Version
ausgeschaltetem Laufzeitsystem wird „None“
angezeigt und die nachfolgenden Felder dieser
Version Number
CODESYS State
Number of Tasks
7.8.1.5.2 Gruppe „Projekt Details“
Title
Version
Author
Webservers angezeigt. Dieses Feld ist nur sichtbar,
Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn CODESYS
Programm angezeigt. Dieses Feld ist nur sichtbar,
Programmierer im SPS-Programm eingetragen hat
Die Informationen erscheinen nur bei einem
ausgeführten SPS-Programm.
Unter „Description“ werden bis zu 1024 Zeichen
7.8.1.5.3 Gruppe(n) „Task n“
Bei Ausführung des SPS-Programms wird für jeden Task eine eigene Gruppe
angezeigt. Standardmäßig wird nur die Gruppenüberschrift mit der Task-Nummer,
dem Task-Namen und der Task-ID angezeigt.
Um die Gruppe zu erweitern und die folgenden Informationen anzuzeigen,
klicken Sie [+].
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 In Betrieb nehmen 87
Tabelle 46: WBM-Seite „CODESYS Information” – Gruppe(n) „Task n“
Anzeigefeld
Bedeutung
Cycle count
Anzahl der Task-Umläufe seit Systemstart
Cycletime (µsec)
Aktuell gemessene Task-Laufzeit der Task
Cycletime min (µsec)
Minimale Task-Laufzeit des Tasks seit Systemstart
Cycletime max (µsec)
Maximale Task-Laufzeit des Tasks seit Systemstart
Durchschnittliche Task-Laufzeit des Tasks seit
Systemstart
Status
Status des Tasks (z. B. RUN, STOP)
Mode
Ausführungsmodus des Tasks (z. B. zyklisch)
Priority
Eingestellte Priorität des Tasks
Interval (msec)
Eingestelltes Task-Intervall
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
Cycletime avg (µsec)
Um die Informationen zu verbergen, klicken Sie [-].
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

88 In Betrieb nehmen WAGO-I/O-SYSTEM 750
Tabelle 47: WBM-Seite „CODESYS WebVisu” – Gruppe „Webserver Configuration“
Anzeigefelder
Bedeutung
CODESYS Webserver
State
Hier wird der Status (enabled/disabled) des
CODESYS-Webservers angezeigt.
Hier wählen Sie aus, ob bei alleiniger Eingabe der
Visualisierung angezeigt werden soll.
Web-based
Management
Das Web-based Management wird
angezeigt.
CODESYS
WebVisu
Die CODESYS-Web-Visualisierung
wird angezeigt.
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
7.8.1.6 Seite „CODESYS WebVisu“
Auf der Seite „CODESYS WebVisu“ finden Sie die Einstellungen zu der in
CODESYS erstellten Web-Visualisierung.
7.8.1.6.1 Gruppe „Webserver Configuration“
IP-Adresse des Controllers das Web-based
Management oder die CODESYS-Web-
Default Webserver
Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Submit]. Die
Änderung wird sofort wirksam.
Im Auslieferzustand wird bei alleiniger Eingabe der IP-Adresse das WBM
aufgerufen.
Zur Aktualisierung der Anzeige nach einer Umschaltung geben Sie die IP-Adresse
in der Adresszeile des Web-Browsers neu ein.
Voraussetzung für die Anzeige der Web-Visualisierung ist ein eingeschalteter
CODESYS-Webserver (im WBM unter „Ports and Services“ -> „CODESYS
Services“) und das Vorhandensein einer entsprechend konfigurierten CODESYS
Anwendung.
Unabhängig von der Einstellung des Default-Webservers kann jederzeit das
WBM mit „http://<ip-adresse>/wbm“ und die Web-Visualisierung mit „http://<ipadresse>/webvisu“ aufgerufen werden.
Weitere Informationen zu der CODESYS-Web-Visualisierung erhalten Sie im
gleichnamigen Kapitel.
Hinweis
Mögliche Fehlermeldungen beim Aufruf der Web-Visualisierung
Die Anzeige „500 - Internal Server Error“ weist auf einen nicht
eingeschalteten CODESYS Webserver hin.
Eine Seite mit der Überschrift „WebVisu not available“ weist darauf hin,
dass keine CODESYS Applikation mit Web-Visualisierung in den
Controller geladen wurde.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 In Betrieb nehmen 89
Tabelle 48: WBM-Seite „Configuration of Network Parameters“ – Gruppe „Hostname“
Parameter
Bedeutung
Wenn Sie die dynamische Zuweisung einer IP-
Name des aktuell verwendeten Hosts angezeigt.
Geben Sie hier den Hostnamen ihres PCs ein, der
soll.
Tabelle 49: WBM-Seite „Configuration of Network Parameters“ – Gruppe „Domain Name“
Parameter
Bedeutung
Domain Name
Hier stellen Sie den Domainnamen ein.
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
7.8.1.7 Seite „Configuration of Network Parameters“
Auf der Seite „Configuration of Network Parameters“ finden Sie die
Einstellungen zu den allgemeinen TCP/IP-Parametern.
7.8.1.7.1 Gruppe „Hostname“
Currently used
Configured
Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Submit]. Die
Änderung wird nach den nächsten Controller-Reboot wirksam.
7.8.1.7.2 Gruppe „Domain Name“
Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Submit]. Die
Änderung wird sofort wirksam.
Adresse über DHCP ausgewählt haben, wird hier der
nach dem Controller-Neustart verwendet werden
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

90 In Betrieb nehmen WAGO-I/O-SYSTEM 750
Tabelle 50: WBM-Seite „TCP/IP Configuration“ – Gruppe „Switch Configuration“
Parameter
Bedeutung
Hier schalten Sie den Switch ein oder aus.
Beide Schnittstellen werden mit einer
IP-Adresse betrieben.
Jede Schnittstelle wird mit einer
eigenen IP-Adresse betrieben.
Tabelle 51: WBM-Seite „TCP/IP Configuration“ – Gruppe(n) „IP Address (Xn)“
Parameter
Bedeutung
Hier wählen Sie aus, ob Sie eine statische oder
dynamische IP-Adressierung verwenden möchten.
Static IP
Statische IP-Adressierung
DHCP
Dynamische IP-Adressierung
BootP
Dynamische IP-Adressierung
Hier geben Sie eine statische IP-Adresse ein. Diese
IP“ aktiviert ist.
Hier geben Sie die Subnetzmaske ein. Diese ist
aktiviert ist.
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
7.8.1.8 Seite „TCP/IP Configuration“
Auf der Seite „TCP/IP Configuration“ finden Sie die TCP/IP-Einstellungen zu
den ETHERNET-Schnittstellen.
7.8.1.8.1 Gruppe „Switch Configuration“
Interfaces
Switched
Separated
Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie die Schaltfläche [Submit]. Die
Änderung wird sofort wirksam.
7.8.1.8.2 Gruppe(n) „IP Address (Xn)“
Wenn der Switch eingeschaltet ist, wird für beide Anschlüsse eine Gruppe („IP
Address“) angezeigt.
Wenn der Switch ausgeschaltet ist, wird für jeden Anschluss eine eigene Gruppe
(„IP Address X1“ / „IP Address X2“) angezeigt.
Configuration Type
IP Address
Subnet Mask
ist aktiv, wenn im Feld Configuration Type „Static
aktiv, wenn im Feld Configuration Type „Static IP“
Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Submit].
Die Änderungen werden sofort wirksam.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 In Betrieb nehmen 91
Tabelle 52: WBM-Seite „TCP/IP Configuration“ – Gruppe „Default Gateway“
Parameter
Bedeutung
Hier wählen Sie aus, ob Sie den Standard-Gateway
des eigenen Netzwerks liegt.
Den Standard-Gateway wird nicht
verwendet.
Enabled
Der Standard-Gateway wird verwendet.
Hier wählen Sie aus, für welchen Anschluss Sie den
Zieladresse außerhalb des eigenen Netzwerks liegt.
Der Standard-Gateway wird nicht
verwendet.
Der Standard-Gateway wird für
Anschluss X1 verwendet.
Der Standard-Gateway wird für
Anschluss X2 verwendet.
Hier stellen Sie die Adresse des Standard-Gateways
ein.
Tabelle 53: WBM-Seite „TCP/IP Configuration“ – Gruppe „DNS Server“
Parameter
Bedeutung
Hier werden die Adressen der eingetragenen DNS-
wurde, erscheint die Anzeige „Configured: None“.
New server IP
Hier fügen Sie weitere DNS-Adressen hinzu.
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
7.8.1.8.3 Gruppe „Default Gateway“
Hinweis
State
Standard-Gateway, wenn die Zieladresse außerhalb
Dieses Feld ist nur sichtbar,
wenn der Switch
nutzen möchten. Der Controller verwendet den
eingeschaltet (enabled) ist.
Disabled
Standard-Gateway nutzen möchten. Der Controller
verwendet den Standard-Gateway, wenn die
Interface
Dieses Feld ist nur sichtbar,
wenn der Switch
ausgeschaltet (disabled) ist.
None
X1
X2
Gateway
Maximal 1 Standard-Gateway einstellen!
Wird der Standard-Gateway über den DHCP-Server vorgegeben, darf im
„Separated“-Modus bei allen Kombinationen („DHCP“/„Static“,
„DHCP“/„DHCP“ etc.) nur maximal 1 Standard-Gateway eingestellt
werden.
Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Submit]. Die
Änderung wird sofort wirksam.
7.8.1.8.4 Gruppe „DNS Server“
DNS-Server 1, 2, …
Server angezeigt. Wenn kein Server eingetragen
Um den ausgewählten DNS-Server zu löschen, klicken Sie auf die Schaltfläche
[Delete]. Die Änderung wird sofort wirksam.
Um den eingegebenen DNS-Server hinzuzufügen, klicken Sie auf die Schaltfläche
[Add]. Die Änderung wird sofort wirksam.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

92 In Betrieb nehmen WAGO-I/O-SYSTEM 750
Tabelle 54: WBM-Seite „Configuration of ETHERNET Parameters“ – Gruppen „Interface Xn“
Parameter
Bedeutung
Hier können Sie das Interface aktivieren bzw.
deaktivieren.
Bei aktivierter Autonegotiation werden die
Gegenstelle ausgehandelt.
Informationen können nur
Informationen können
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
7.8.1.9 Seite „Configuration of ETHERNET Parameters“
Auf der Seite „Configuration of ETHERNET Parameters“ finden Sie die
Einstellungen zu ETHERNET TCP/IP.
7.8.1.9.1 Gruppen „Interface Xn“
Für jeden Anschluss wird eine eigene Gruppe („Interface X1“ / „Interface X2“)
angezeigt.
Enabled
Autonegotiation on
Speed/Duplex
Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Submit].
Die Änderungen werden sofort wirksam.
Verbindungsmodalitäten automatisch mit der
Hier wählen Sie die Übertragungsgeschwindigkeit
und das Duplex-Verfahren aus:
10 Mbit Halbduplex
gesendet oder empfangen
100 Mbit Halbduplex
werden.
10 MBit Vollduplex
gleichzeitig gesendet und
100 Mbit Vollduplex
empfangen werden.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 In Betrieb nehmen 93
Tabelle 55: WBM-Seite „Configuration of Time and Date“ – Gruppe „Date on Device“
Parameter
Bedeutung
Local
Hier stellen Sie das Datum ein.
Tabelle 56: WBM-Seite „Configuration of Time and Date“ – Gruppe „Time on Device“
Parameter
Bedeutung
Local
Hier stellen Sie die lokale Uhrzeit ein.
UTC
Hier stellen Sie die GMT-Zeit ein.
12 h format
Umschaltung zwischen 12h- und 24h-Darstellung
der Uhrzeit.
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
7.8.1.10 Seite „Configuration of Time and Date“
Auf der Seite „Configuration of Time and Date“ finden Sie die Einstellungen zu
Datum und Uhrzeit.
7.8.1.10.1 Gruppe „Date on Device“
Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Change
date]. Die Änderung wird sofort wirksam.
7.8.1.10.2 Gruppe „Time on Device“
Um die Änderung der Uhrzeiten zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche
[Change time]. Die Änderung wird sofort wirksam.
Um die Änderung des Uhrzeitenformats zu übernehmen, klicken Sie auf die
Schaltfläche [Change format]. Die Änderung wird sofort wirksam.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

94 In Betrieb nehmen WAGO-I/O-SYSTEM 750
Tabelle 57: WBM-Seite „Configuration of Time and Date“ – Gruppe „Time Zone“
Parameter
Bedeutung
Hier wählen Sie die für Ihr Land zutreffende
Zeitzone aus. Grundeinstellung:
AST/ADT
„Atlantic Standard Time“, Halifax
„Eastern Standard Time“, New York,
Toronto
„Central Standard Time“, Chicago,
Winnipeg
„Mountain Standard Time“, Denver,
Edmonton
„Pacific Standard Time“, Los
Angeles, Whitehouse:
Greenwich Main Time“, GB, P, IRL,
IS, …
„Central European Time“, B, DK, D,
F, I, CRO, NL, …
„East European Time“, BUL, FI, GR,
TR, …
CST
„China Standard Time“
JST
„Japan/Korea Standard Time“
Tabelle 58: WBM-Seite „Configuration of Time and Date“ – Gruppe „TZ String“
Parameter
Bedeutung
TZ String
Für nicht über den Parameter „Timezone“
vmd/1.7.0/wwwman/man5/TZ.5.html
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
7.8.1.10.3 Gruppe „Timezone“
EST/EDT
CST/CDT
MST/MDT
Timezone
Um die Änderung der Zeitzone zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche
[Change]. Die Änderung wird sofort wirksam.
7.8.1.10.4 Gruppe „TZ String“
PST/PDT
GMT/BST
CET/CEST
EET/EEST
auswählbare Zeitzonen geben Sie hier die für Sie
zutreffende Zeitzone ein. Eine Übersicht aller
Zeitzonen erhalten Sie unter
http://home.tiscali.nl/~t876506/TZworld.html
Informationen dazu, wie Sie den TZ-String in Linux
editieren, erhalten Sie unter http://www.minixvmd.org/pub/Minix-
Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Change]. Die
Änderung wird sofort wirksam.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 In Betrieb nehmen 95
Tabelle 59: WBM-Seite „Configuration of the users for the Web-based Management” – Gruppe
„Change Password for selected user“
Parameter
Bedeutung
Hier wählen Sie den Benutzer („user“ oder „admin“)
aus, für den Sie ein neues Passwort vergeben wollen.
Hier geben Sie das neue Passwort für den unter
]!"#$%&'()*+,./:;<=>?@[\^_`{|}~-
Hier geben Sie zur Kontrolle das neue Passwort
erneut ein.
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
7.8.1.11 Seite „Configuration of the users for the Web-based Management“
Auf dieser Seite finden Sie die Einstellungen zur User-Aministration.
7.8.1.11.1 Gruppe „Change Password for selected user“
Select User
„Select User“ ausgewählten Benutzer ein.
New Password
Zulässige Zeichen für das Passwort sind folgende
ASCII-Zeichen: a … z, A … Z, 0 … 9, Leerzeichen
und sowie die Sonderzeichen:
Confirm Password
Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Change
Password]. Die Änderung wird sofort wirksam.
Hinweis
Zulässige Zeichen für WBM-Passworte beachten!
Werden außerhalb des WBM (z. B. über CBM) Passworte mit unzulässigen
Zeichen für das WBM eingestellt, ist ein Zugriff auf die WBM-Seiten nicht
mehr möglich!
Hinweis
Zugriffsrechte beachten
Die User im WBM berechtigen ausschließlich für den Zugriff auf die
Webseiten. Die User-Verwaltung für die Steuerungsanwendungen wird
separat angelegt.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

96 In Betrieb nehmen WAGO-I/O-SYSTEM 750
Tabelle 60: WBM-Seite „Create Bootable Image” – Gruppe „Create bootable image from active
partition)“
Parameter
Bedeutung
Hier wird die mögliche Zielpartition angezeigt, an
zu erstellende Image zur Auswahl:
System wurde gebootet
von
Zielpartition für
„bootable Image“
Memory Card
Internal Flash
Internal Flash
Memory Card
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
7.8.1.12 Seite „Create bootable Image“
Auf der Seite „Create bootable Image“ können Sie ein boot-fähiges Image
erstellen.
7.8.1.12.1 Gruppe „Create bootable image from active partition (<active partition>“
Die aktive Partition, von der gebootet wurde, wird in der Überschrift in Klammern
angezeigt.
dem das Image gespeichert werden soll.
Abhängig von welchem Medium gebootet wurde,
steht nach dem Bootvorgang folgendes Ziel für das
Destination
Nachdem das mögliche Ziel ermittelt und ausgegeben wurde, wird dieses
zunächst überprüft und das Ergebnis unterhalb der Einstellungen angezeigt:
- Freier Speicher auf dem Ziel-Device:
Beträgt der freie Speicher weniger als 5%, wird eine entsprechende
Warnung ausgegeben. Sie können den Kopiervorgang trotzdem starten. Ist
der freie Speicher definitiv zu gering, wird eine entsprechende Meldung
ausgegeben, und der Vorgang kann nicht gestartet werden.
- Device in Benutzung durch CODESYS:
Wird das Device durch CODESYS benutzt, wird eine entsprechende
Warnung ausgegeben. Sie können den Kopiervorgang trotzdem starten,
davon wird jedoch abgeraten!
Um den Kopiervorgang zu starten, klicken Sie die Schaltfläche [Start Copy]. Bei
positivem Test-Ausgang startet der Vorgang sofort. Wurden Fehler festgestellt,
wird eine entsprechende Meldung angezeigt und der Vorgang wird nicht gestartet.
Falls Warnungen vorliegen, werden diese noch einmal angezeigt und Sie müssen
bestätigen, dass Sie den Vorgang trotzdem fortsetzen möchten.
Hinweis
Schreibschutz der Speicherkarte entfernen!
Da während des Boot-Vorgangs auch schreibend auf die Speicherkarte
zugegriffen wird, darf die Speicherkarte zur Erstellung des Images und
während des Betriebs nicht schreibgeschützt sein.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 In Betrieb nehmen 97
Tabelle 61: WBM-Seite „Configuration of Serial Interface RS232” – Gruppe „ Assign Owner of
serial Interface“
Parameter
Bedeutung
Hier wählen Sie aus, dass die serielle Schnittstelle
der Linux®-Konsole zugewiesen wird.
Hier wählen Sie aus, dass die serielle Schnittstelle
Funktionsbausteine darauf zugreifen kann.
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
7.8.1.13 Seite „Configuration of Serial Interface RS232“
Auf der Seite „Configuration of Serial Interface RS232“ finden Sie die
Einstellungen zur seriellen Schnittstelle.
7.8.1.13.1 Gruppe „ Serial Interface assigned to“
Hier wird die Applikation angezeigt, der die serielle Schnittstelle aktuell
zugewiesen ist.
7.8.1.13.2 Gruppe „Assign Owner of serial Interface (active after next controller reboot)“
Hier können Sie die Applikation auswählen, der die serielle Schnittstelle nach
dem nächsten Controller-Reboot zugewiesen wird.
Linux® Console
Unassigned (usage by
Applications, Libraries,
CODESYS)
ACHTUNG
Vor dem Umschalten auf „Linux Console“ RS-485-Geräte entfernen!
Durch die Umschaltung auf „Linux Console“ können angeschlossene RS485-Geräte beschädigt werden! Entfernen Sie daher diese Geräte vor dem
Umschalten!
Um die Änderung zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche [Change
Owner]. Die Änderung wird nach dem nächsten Controller-Reboot wirksam.
keiner Applikation zugewiesen wird und frei ist,
damit beispielsweise das CODESYS-Programm über
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

98 In Betrieb nehmen WAGO-I/O-SYSTEM 750
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
7.8.1.14 Seite „Reboot Controller“
Auf der Seite „Reboot Controller“ finden sie die Einstellungen zum
Systemneustart.
7.8.1.14.1 Gruppe „Reboot Controller“
Um das System neu zu starten, klicken Sie die Schaltfläche [Reboot].
Hinweis
Boot-Zeitdauer berücksichtigen!
Der Boot-Vorgang benötigt einige Zeit. Während dieser Zeit können Sie
nicht auf den PFC200 zugreifen.
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

WAGO-I/O-SYSTEM 750 In Betrieb nehmen 99
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
7.8.1.15 Seite „Firmware Backup“
Auf der Seite „Firmware Backup“ finden Sie die Einstellungen zum FirmwareBackup.
Wählen Sie in der Gruppe Packages die wiederherzustellenden Packages aus.
Markieren Sie dazu die entsprechenden Einträge.
Hinweis
Nur ein Package zum Netzwerk kopierbar!
Wenn Sie „Network“ als Speicherziel eingestellt haben, ist je
Speichervorgang nur ein Package auswählbar.
Wählen Sie im Auswahlfeld Destination das Speicherziel aus.
Hinweis
Kein Backup von Speicherkarte!
Von der Speicherkarte aus ist ein Backup auf den internen Flash-Speicher
nicht möglich.
Um die automatische Update-Funktion zu aktivieren, markieren Sie das
Kontrollfeld Activate „auto update feature“.
Hinweis
Backup-Zeit berücksichtigen
Das Erzeugen der Backup-Dateien kann einige Minuten dauern. Stoppen sie
vor dem Backup-Vorgang das CODESYS-Programm, um diese Zeit weiter
zu verkürzen.
Um den Backup-Vorgang zu starten, klicken Sie die Schaltfläche [Submit].
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)

100 In Betrieb nehmen WAGO-I/O-SYSTEM 750
750-8206 PFC200 CS 2ETH RS CAN DPS
7.8.1.16 Seite „Firmware Restore“
Auf der Seite „Firmware Restore“ finden Sie die Einstellungen zur
Wiederherstellung der Firmware.
Wählen Sie im Auswahlfeld Source den Speicherort aus.
Wählen Sie in der Gruppe Packages die wiederherzustellenden Packages aus.
Markieren Sie dazu die entsprechenden Einträge.
Geben Sie im Eingabefeld CODESYS backup file den Namen der Backup-Datei
für das CODESYS-Projekt ein oder klicken Sie auf die Schaltfläche [Browse], um
die Datei im Explorer auszuwählen.
Geben Sie im Eingabefeld Settings backup file den Namen der Backup-Datei für
die Einstellungen ein oder klicken Sie auf die Schaltfläche [Browse], um die
Datei im Explorer auszuwählen.
Geben Sie im Eingabefeld System backup file den Namen der Backup-Datei für
die Systemdaten ein oder klicken Sie auf die Schaltfläche [Browse], um die Datei
im Explorer auszuwählen.
Hinweis
Reset durch Wiederherstellung
Durch die Wiederherstellung des Systems, der Einstellungen oder von
CODESYS wird ein Reset ausgeführt!
Um den Wiederherstellvorgang zu starten, klicken Sie die Schaltfläche [Submit].
Handbuch
Version 1.1.0, gültig ab SW-Version 02.02.12(03)
 Loading...
Loading...