ProMinent DULCOTEST ICT 2 Assembly And Operating Instructions Manual
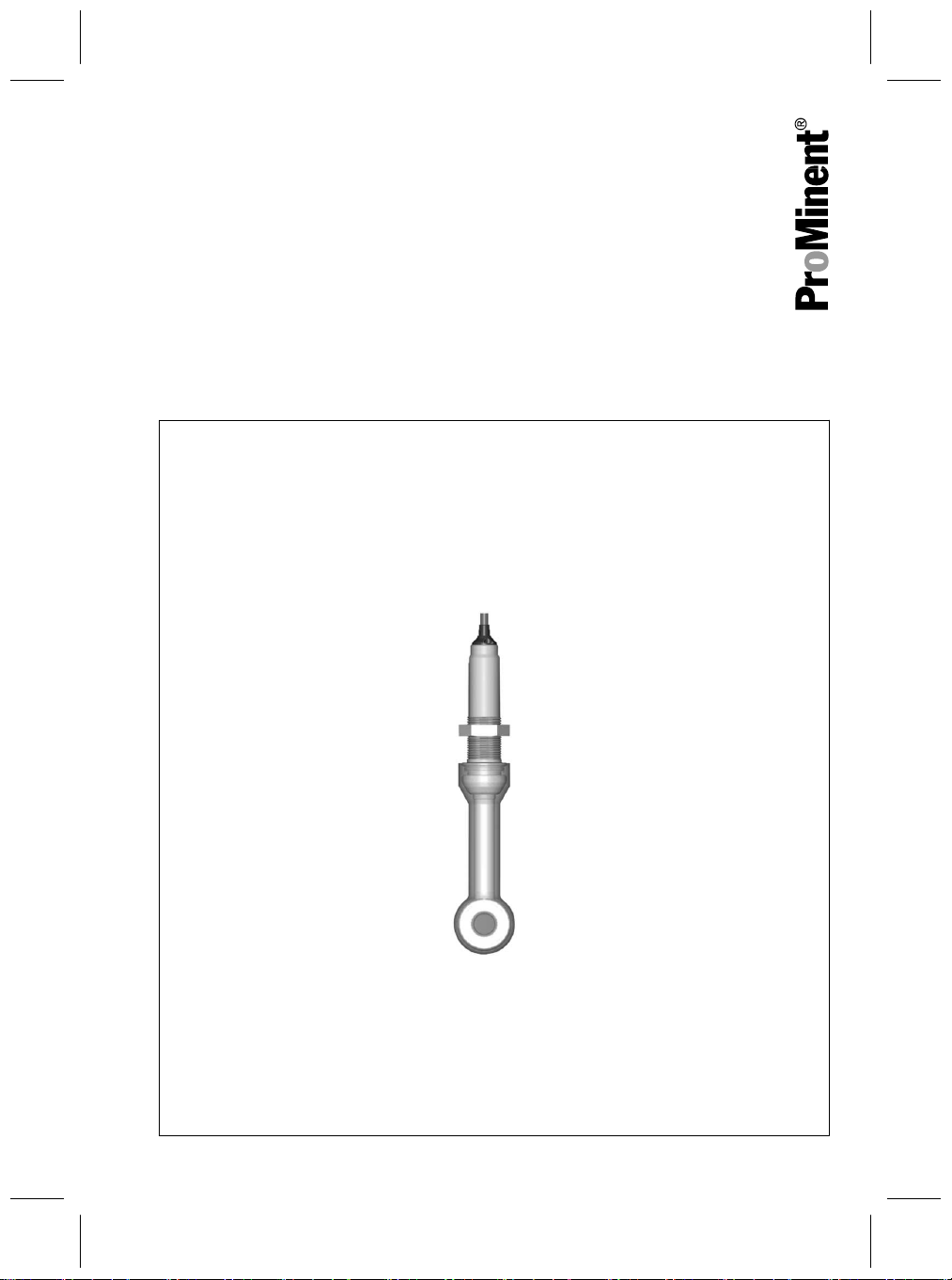
DULCOTEST® Sensor ICT 2
Inductive conductivity sensor
Assembly and operating instructions
A1845
Induktiver Leitfähigkeitssensor
DE/EN
986948 Version: BA DT 154 04/18 DE
Please carefully read these operating instructions before use. · Do not discard.
The operator shall be liable for any damage caused by installation or operating errors.
The latest version of the operating instructions are available on our homepage.
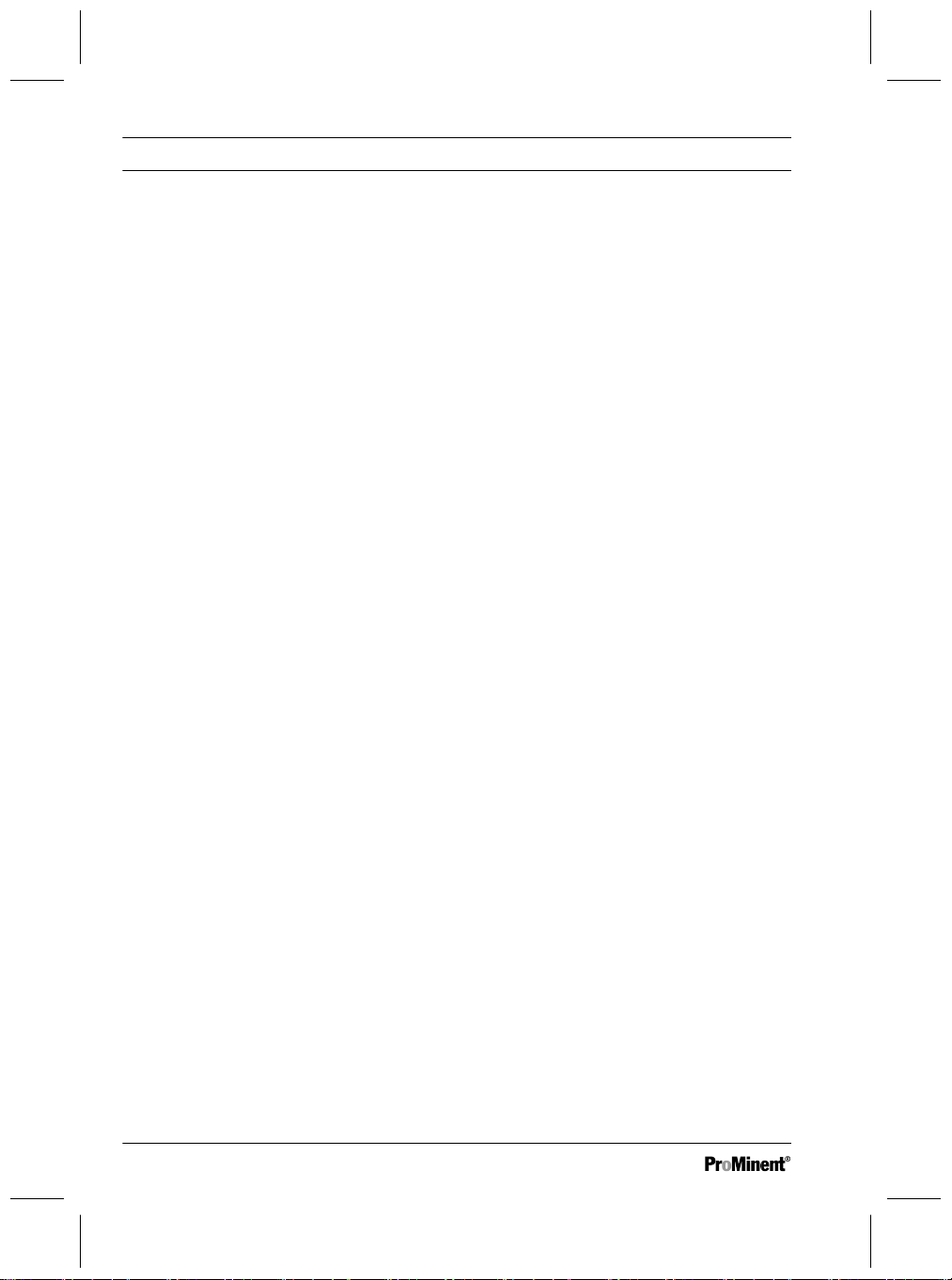
Overall Table of Con‐
tents
DE
DULCOTEST® Sensor ICT 2
Induktiver Leitfähigkeitssensor..... 3
1 Einleitung................................ 7
1.1 Kennzeichnung der Warn‐
hinweise............................... 7
1.2 Benutzer-Qualifikation.......... 9
1.3 Allgemeine Sicherheitshin‐
weise.................................. 10
1.4 Bestimmungsgemäße Ver‐
wendung............................ 11
1.5 Angaben für den Notfall..... 11
2 Funktionsbeschreibung......... 12
2.1 Aufbau und Funktion.......... 13
2.2 Zellkonstante und Einbau‐
faktor.................................. 14
3 Transportieren und Lagern... 17
3.1 Transport............................ 17
4 Installieren, elektrisch........... 18
5 Montieren.............................. 20
6 In Betrieb nehmen................. 22
7 Wartung, Fehler beheben
und Reparieren .................... 25
8 Bestellhinweise..................... 26
9 Altteileentsorgung................. 27
10 Technische Daten............... 28
11 Maßblätter........................... 32
12 Eingehaltene Richtlinien/
Normen............................... 34
EN
DULCOTEST® Sensor ICT 2
Inductive conductivity sensor..... 38
1
Introduction........................... 42
1.1 Labelling of Warning Infor‐
mation................................ 42
1.2 User qualification............... 44
1.3 General safety informa‐
tion..................................... 45
1.4 Intended use...................... 46
1.5 Information in the event of
an emergency.................... 46
2 Functional description........... 47
2.1 Construction and Func‐
tion..................................... 48
2.2 Cell constant and installa‐
tion factor........................... 49
3 Transport and Storage.......... 52
3.1 Transport............................ 52
4 Installation, electrical............. 53
5 Assembly.............................. 55
6 Start up................................. 57
7 Maintenance, Trouble‐
shooting and Repair.............. 60
8 Ordering Information............. 61
9 Disposal of Used Parts......... 62
10 Technical data..................... 63
11 Dimensional drawings......... 67
12 Directives / standards
adhered to........................... 69
Overall Table of Contents
2
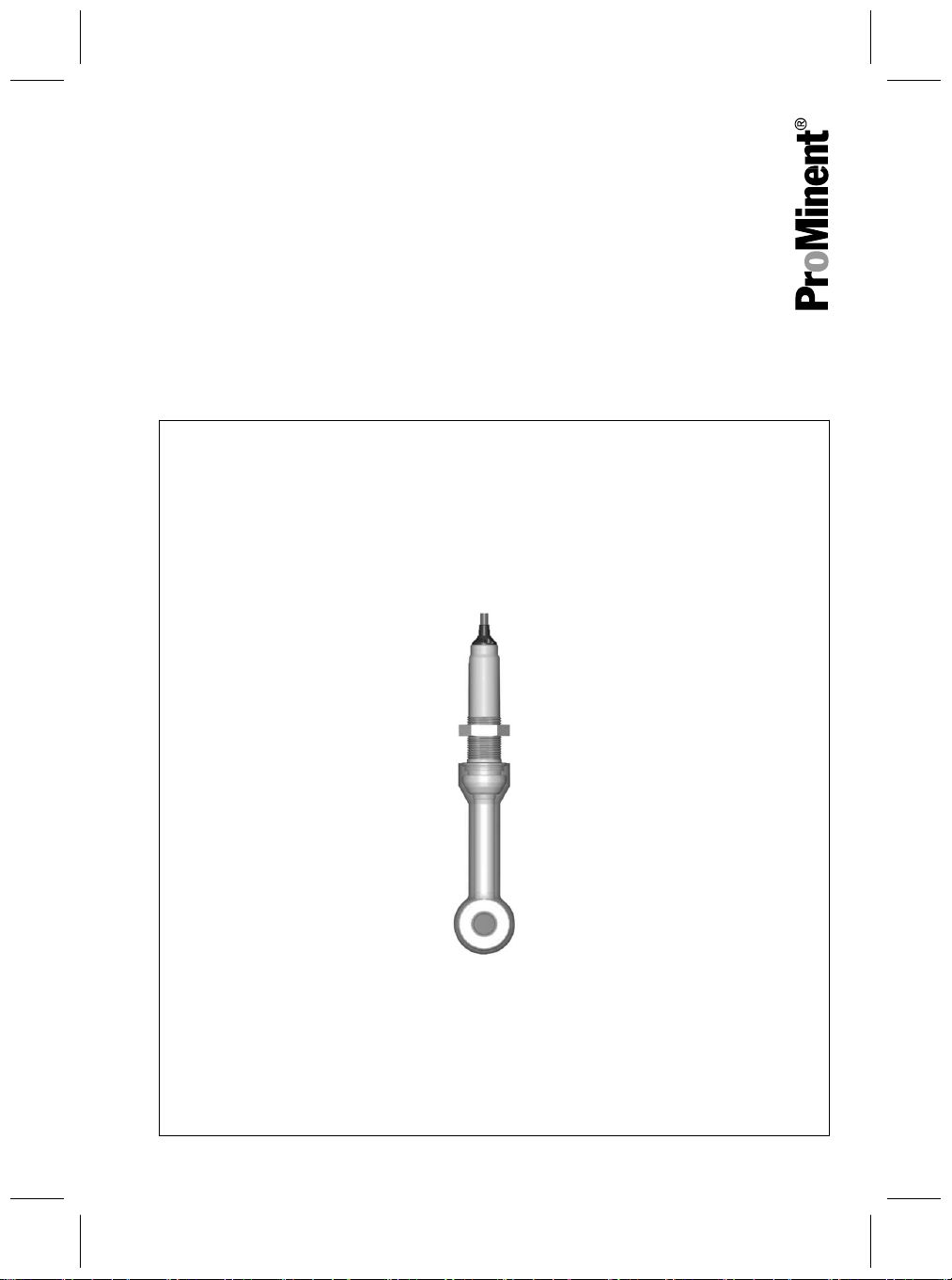
DULCOTEST® Sensor ICT 2
Induktiver Leitfähigkeitssensor
Montage- und Betriebsanleitung
A1845
DE
986948 Version: BA DT 154 04/18 DE
Betriebsanleitung bitte zuerst vollständig durchlesen. · Nicht wegwerfen.
Bei Schäden durch Installations- oder Bedienfehler haftet der Betreiber.
Die neueste Version einer Betriebsanleitung ist auf unserer Homepage verfügbar.
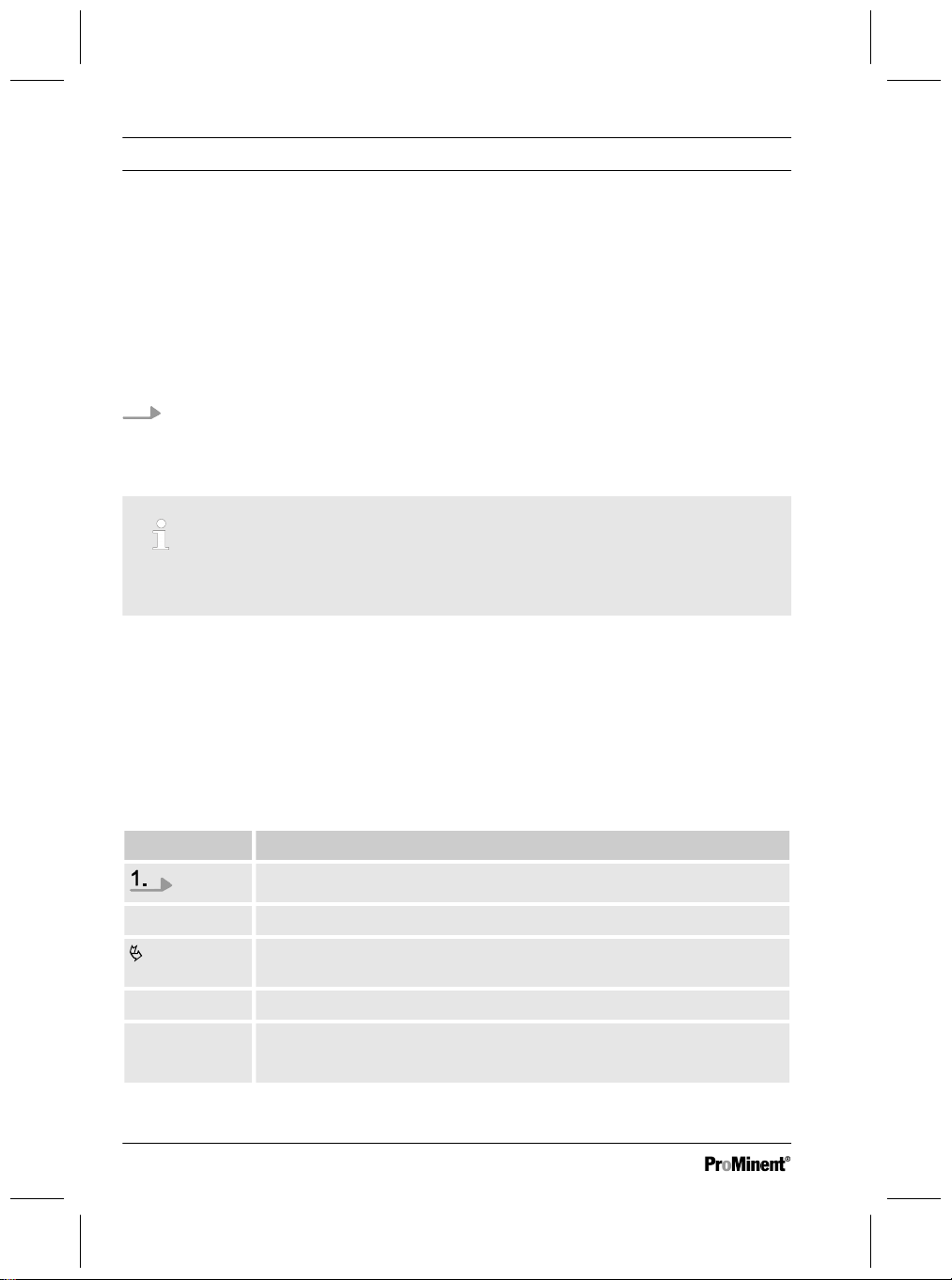
Allgemeine Gleichbehandlung Dieses Dokument verwendet die nach der
Grammatik männliche Form in einem
neutralen Sinn, um den Text leichter
lesbar zu halten. Es spricht immer Frauen
und Männer in gleicher Weise an. Die
Leserinnen bitten wir um Verständnis für
diese Vereinfachung im Text.
Ergänzende Anweisungen
Lesen Sie bitte die ergänzenden Anweisungen durch.
Infos
Eine Info gibt wichtige Hinweise für das richtige Funktionieren des Geräts oder
soll Ihre Arbeit erleichtern.
Warnhinweise
Warnhinweise sind mit ausführlichen Beschreibungen der Gefährdungssituation ver‐
sehen, siehe
Ä Kapitel 1.1 „Kennzeichnung der Warnhinweise“ auf Seite 7
.
Zur Hervorhebung von Handlungsanweisungen, Verweisen, Auflistungen, Ergebnissen
und anderen Elementen können in diesem Dokument folgende Kennzeichnungen ver‐
wendet werden:
Tab. 1: Weitere Kennzeichnung
Kennzeichen Beschreibung
Handlung Schritt-für-Schritt.
⇨ Ergebnis einer Handlung.
Links auf Elemente bzw. Abschnitte dieser Anleitung oder mitgel‐
tende Dokumente.
n
Auflistung ohne festgelegte Reihenfolge.
[Taster]
Anzeigeelemente (z. B. Signalleuchten).
Bedienelemente (z. B. Taster, Schalter).
Ergänzende Anweisungen
4

Kennzeichen Beschreibung
„Anzeige/GUI“
Bildschirmelemente (z. B. Schaltflächen, Belegung von Funktions‐
tasten).
CODE
Darstellung von Softwareelementen bzw. Texten.
Ergänzende Anweisungen
5
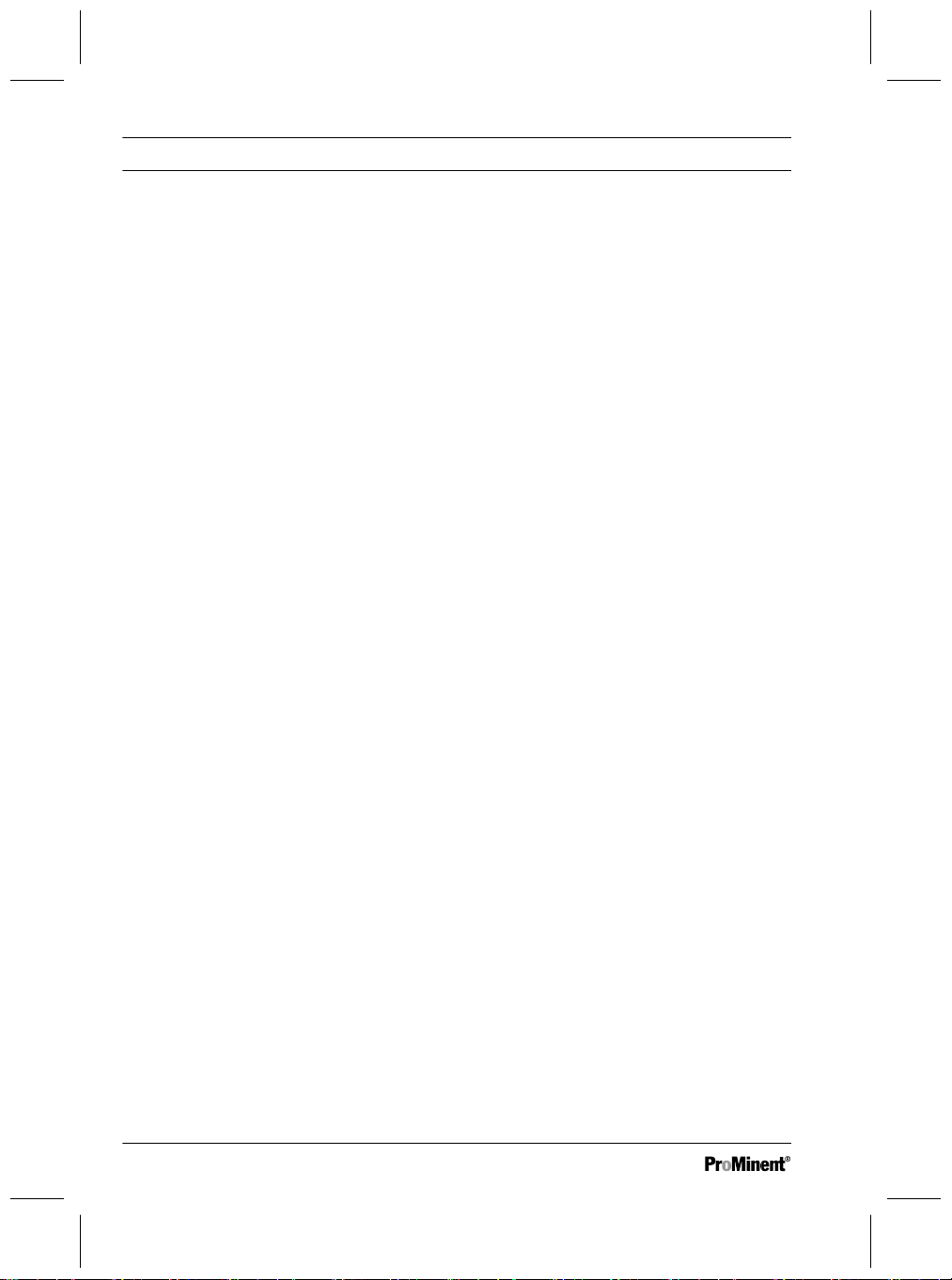
Inhaltsverzeichnis
1 Einleitung................................................................................................................ 7
1.1 Kennzeichnung der Warnhinweise................................................................. 7
1.2 Benutzer-Qualifikation.................................................................................... 9
1.3 Allgemeine Sicherheitshinweise................................................................... 10
1.4 Bestimmungsgemäße Verwendung............................................................. 11
1.5 Angaben für den Notfall................................................................................ 11
2 Funktionsbeschreibung......................................................................................... 12
2.1 Aufbau und Funktion.................................................................................... 13
2.2 Zellkonstante und Einbaufaktor.................................................................... 14
3 Transportieren und Lagern................................................................................... 17
3.1 Transport...................................................................................................... 17
4 Installieren, elektrisch........................................................................................... 18
5 Montieren.............................................................................................................. 20
6 In Betrieb nehmen................................................................................................ 22
7 Wartung, Fehler beheben und Reparieren .......................................................... 25
8 Bestellhinweise..................................................................................................... 26
9 Altteileentsorgung................................................................................................. 27
10 Technische Daten................................................................................................. 28
11 Maßblätter............................................................................................................. 32
12 Eingehaltene Richtlinien/Normen......................................................................... 34
13 Index..................................................................................................................... 35
Inhaltsverzeichnis
6
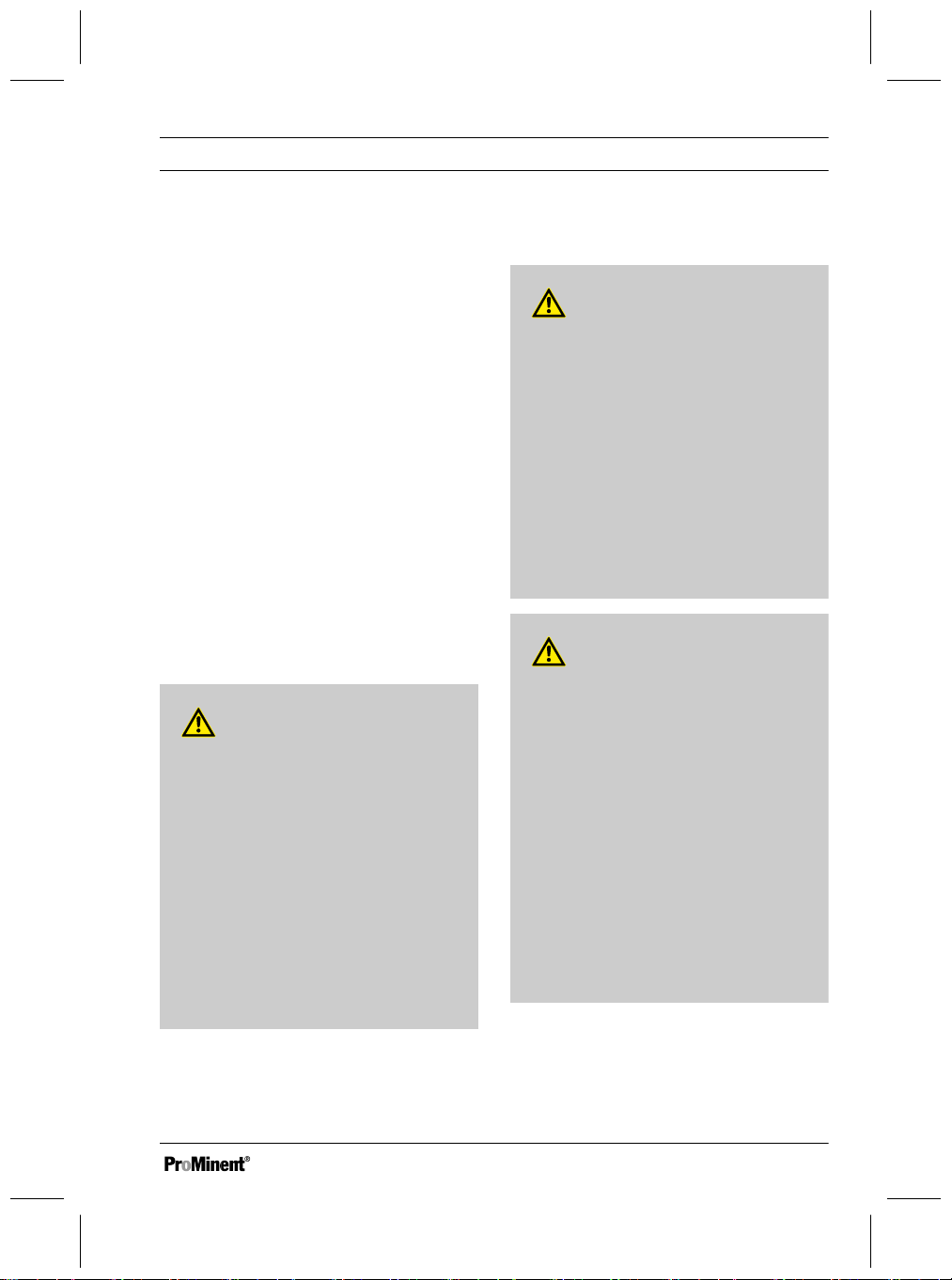
1 Einleitung
Diese Betriebsanleitung beschreibt die
technischen Daten und Funktionen des
DULCOTEST® Sensors für Induktive Leit‐
fähigkeit, ICT 2
1.1 Kennzeichnung der Warn‐
hinweise
Einleitung
Diese Betriebsanleitung beschreibt die
technischen Daten und Funktionen des
Produktes. Die Betriebsanleitung gibt aus‐
führliche Warnhinweise und ist in klare
Handlungsschritte aufgegliedert.
Warnhinweise und Hinweise gliedern sich
nach dem folgenden Schema. Hierbei
kommen verschiedene, der Situation
angepasste, Piktogramme zum Einsatz.
Die hier aufgeführten Piktogramme dienen
nur als Beispiel.
GEFAHR!
Art und Quelle der Gefahr
Folge: Tod oder schwerste Verlet‐
zungen.
Maßnahme, die ergriffen werden
muss, um diese Gefahr zu ver‐
meiden.
Beschriebene Gefahr
– Bezeichnet eine unmittelbar
drohende Gefahr. Wenn die
Situation nicht gemieden wird,
sind Tod oder schwerste Ver‐
letzungen die Folge.
WARNUNG!
Art und Quelle der Gefahr
Mögliche Folge: Tod oder
schwerste Verletzungen.
Maßnahme, die ergriffen werden
muss, um diese Gefahr zu ver‐
meiden.
– Bezeichnet eine möglicher‐
weise gefährliche Situation.
Wenn die Situation nicht
gemieden wird, können Tod
oder schwerste Verletzungen
die Folge sein.
VORSICHT!
Art und Quelle der Gefahr
Mögliche Folge: Leichte oder
geringfügige Verletzungen. Sach‐
beschädigung.
Maßnahme, die ergriffen werden
muss, um diese Gefahr zu ver‐
meiden.
– Bezeichnet eine möglicher‐
weise gefährliche Situation.
Wenn die Situation nicht
gemieden wird, können leichte
oder geringfügige Verlet‐
zungen die Folge sein. Darf
auch für Warnung vor Sach‐
schäden verwendet werden.
Einleitung
7
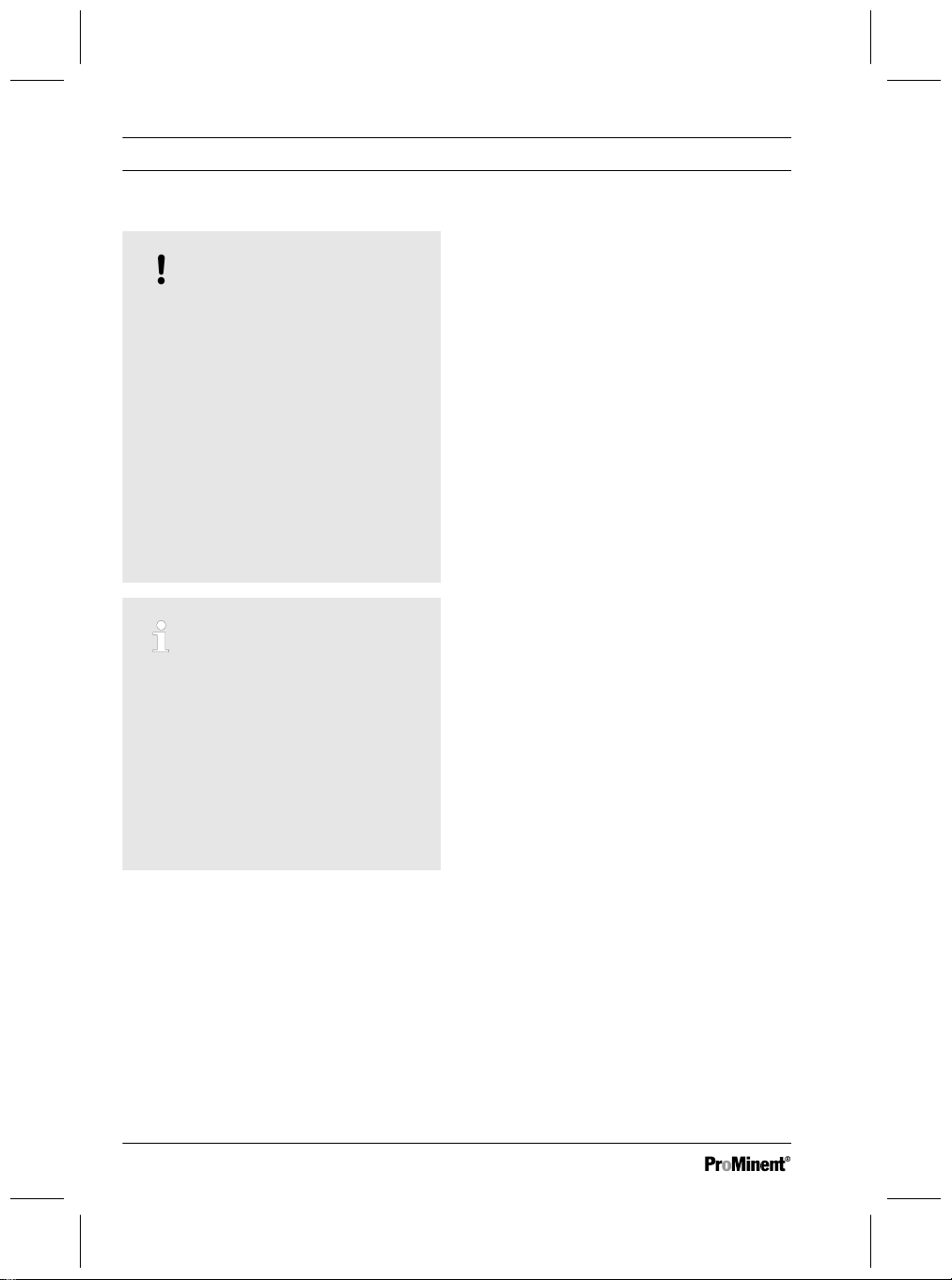
HINWEIS!
Art und Quelle der Gefahr
Schädigung des Produkts oder
seiner Umgebung.
Maßnahme, die ergriffen werden
muss, um diese Gefahr zu ver‐
meiden.
– Bezeichnet eine möglicher‐
weise schädliche Situation.
Wenn die Situation nicht
gemieden wird, kann das Pro‐
dukt oder etwas in seiner
Umgebung beschädigt
werden.
Art der Information
Anwendungstipps und Zusatzinfor‐
mation.
Quelle der Information. Zusätzliche
Maßnahmen.
–
Bezeichnen Anwendungstipps
und andere besonders nütz‐
liche Informationen. Es ist kein
Signalwort für eine gefährliche
oder schädliche Situation.
Einleitung
8
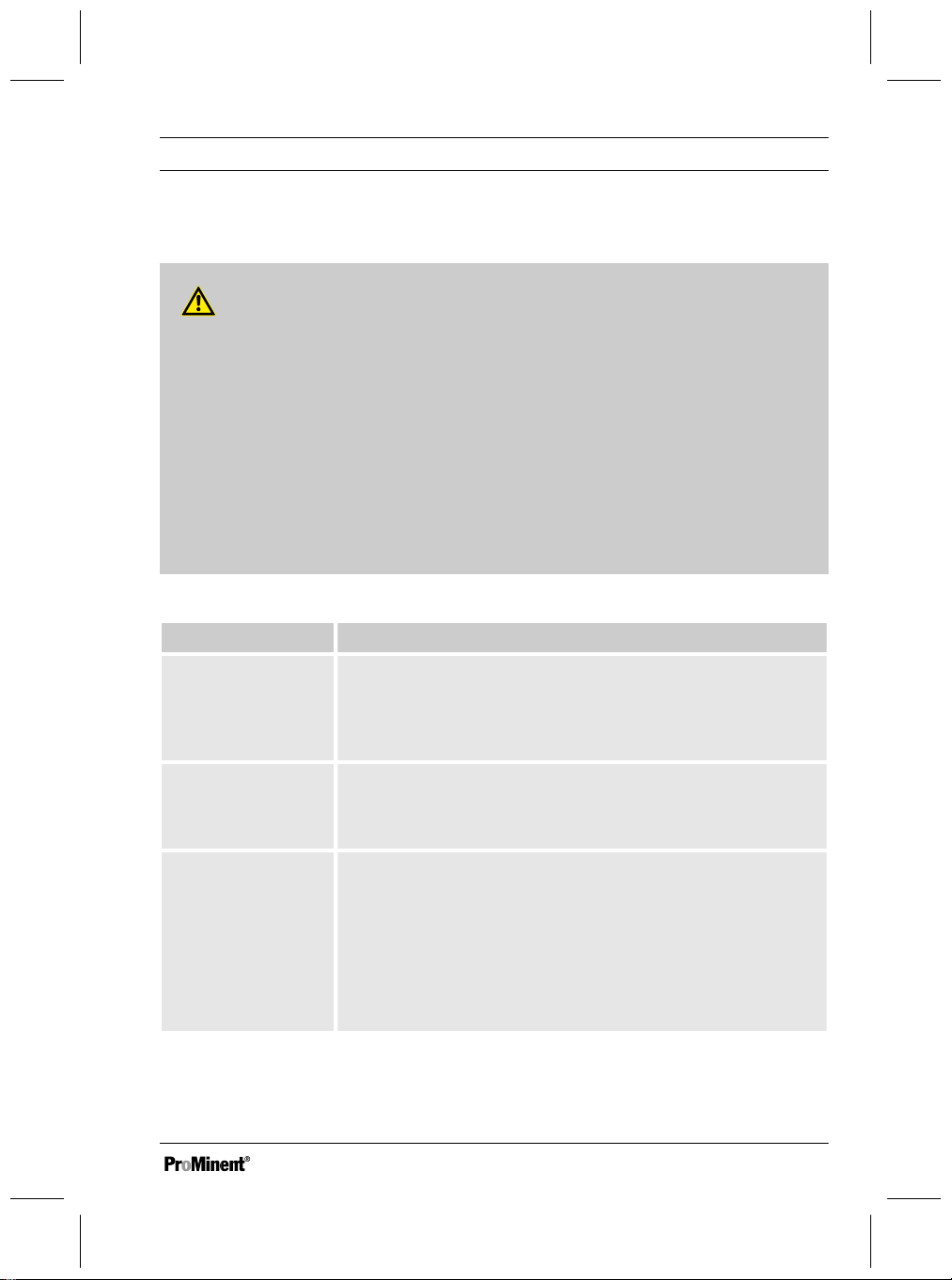
1.2 Benutzer-Qualifikation
WARNUNG!
Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation des Personals
Der Betreiber der Anlage/des Gerätes ist für die Einhaltung der Qualifikationen
verantwortlich.
Wenn unqualifiziertes Personal Arbeiten an dem Gerät vornimmt oder sich im
Gefahrenbereich des Gerätes aufhält, entstehen Gefahren, die schwere Verlet‐
zungen und Sachschäden verursachen können.
– Alle Tätigkeiten nur durch dafür qualifiziertes Personal durchführen lassen.
– Unqualifiziertes Personal von den Gefahrenbereichen fernhalten.
Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die sonstigen allgemein
anerkannten sicherheitstechnischen Regeln einhalten.
Ausbildung Definition
unterwiesene Person Als unterwiesene Person gilt, wer über die übertragenen Auf‐
gaben und möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten
unterrichtet und erforderlichenfalls angelernt, sowie über die
notwendigen Schutzeinrichtungen und Schutzmaßnahmen
belehrt wurde.
geschulter Anwender Als geschulter Anwender gilt, wer die Anforderungen an eine
unterwiesene Person erfüllt und zusätzlich eine anlagenspezifi‐
sche Schulung bei dem Hersteller oder einem autorisierten Ver‐
triebspartner erhalten hat.
ausgebildete Fach‐
kraft
Als ausgebildete Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner Ausbildung,
Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen
Bestimmungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und
mögliche Gefahren erkennen kann. Eine ausgebildete Fach‐
kraft muss in der Lage sein, die ihr übertragenen Arbeiten unter
Zuhilfenahme von Zeichnungsdokumentation und Stücklisten
selbständig durchzuführen. Zur Beurteilung der fachlichen Aus‐
bildung kann auch eine mehrjährige Tätigkeit auf dem betreff‐
enden Arbeitsgebiet herangezogen werden.
Einleitung
9
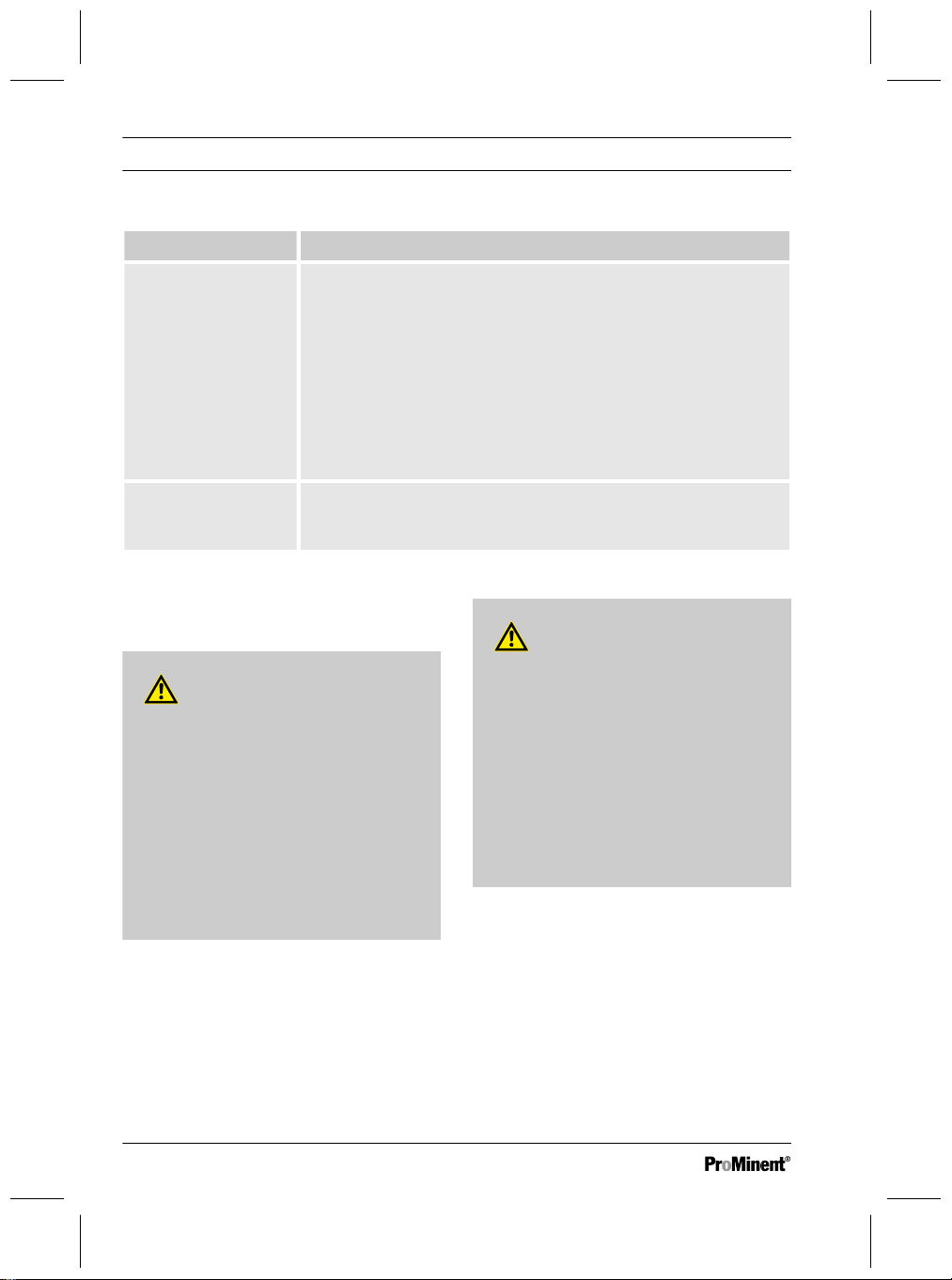
Ausbildung Definition
Elektrofachkraft Die Elektrofachkraft ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung,
Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen
Normen und Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an elektri‐
schen Anlagen auszuführen und mögliche Gefahren selbst‐
ständig zu erkennen und zu vermeiden. Eine Elektrofachkraft
muss in der Lage sein, die ihr übertragenen Arbeiten unter
Zuhilfenahme von Zeichnungsdokumentation, Stücklisten,
Klemmen- und Schaltplänen selbständig durchzuführen. Die
Elektrofachkraft ist speziell für das Arbeitsumfeld, in dem die
Elektrofachkraft tätig ist, ausgebildet und kennt die relevanten
Normen und Bestimmungen.
Kundendienst Als Kundendienst gelten Servicetechniker, die von dem Her‐
steller für die Arbeiten an der Anlage nachweislich geschult und
autorisiert wurden.
1.3 Allgemeine Sicherheitshin‐
weise
WARNUNG!
Unbefugter Zugriff!
Mögliche Folge: Tod oder
schwerste Verletzungen
– Maßnahme: Sichern Sie das
Gerät gegen unbefugten
Zugriff
– Der Sensor darf nur durch
hierfür ausgebildetes Personal
montiert, installiert, gewartet
und betrieben werden
VORSICHT!
Funktionseinschränkung
Mögliche Folge: Leichte oder
geringfügige Verletzungen. Sach‐
beschädigung
– Den Sensor regelmäßig auf
Verunreinigungen überprüfen
– Die gültigen nationalen Vor‐
schriften für Pflege-, War‐
tungs- und Kalibrierintervalle
einhalten
Einleitung
10
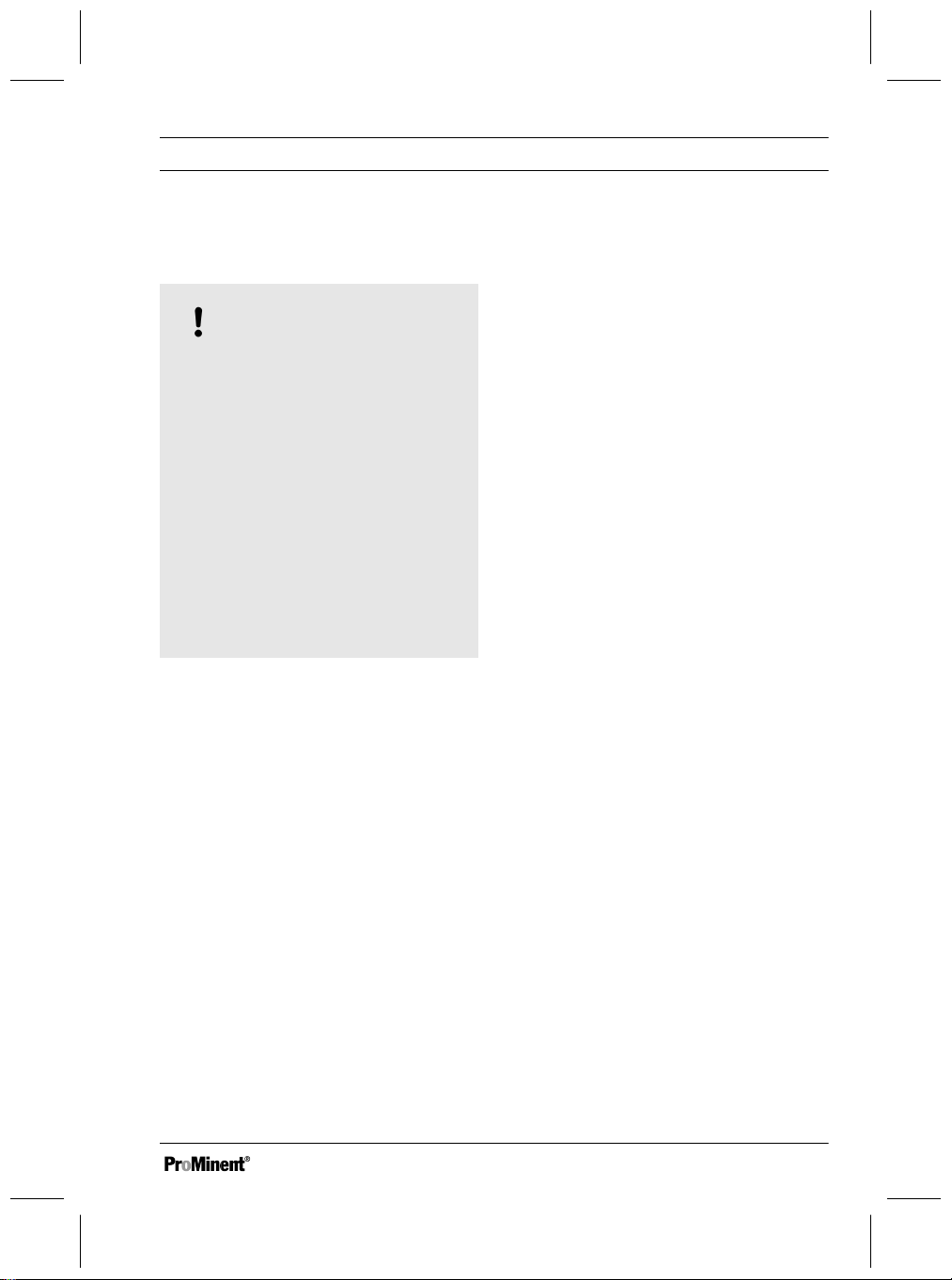
1.4 Bestimmungsgemäße Ver‐
wendung
HINWEIS!
Bestimmungsgemäße Verwendung
– Der Sensor darf nur zum
Messen und Regeln der Induk‐
tiven Leitfähigkeit verwendet
werden
– Alle anderen Verwendungen
oder ein Umbau sind verboten
– Der Sensor ist kein Sicher‐
heitsbauteil im Sinne der DIN
EN ISO 13849-1:2008-12.
Sollte es sich bei Ihren Messund Regelkreis um einen kriti‐
schen Prozess handeln, dann
liegt es in Ihrer Verantwortung
diesen Prozess abzusichern
1.5 Angaben für den Notfall
n Im Notfall den Regler Spannungsfrei
machen
n Falls aus der Durchlaufarmatur Flüs‐
sigkeit austritt, die bauseitig instal‐
lierten Absperrhähne am Zu- und
Ablauf schließen
n Vor dem Öffnen der Durchlaufarmatur
die Sicherheitshinweise des Anlagen‐
betreibers beachten
Einleitung
11
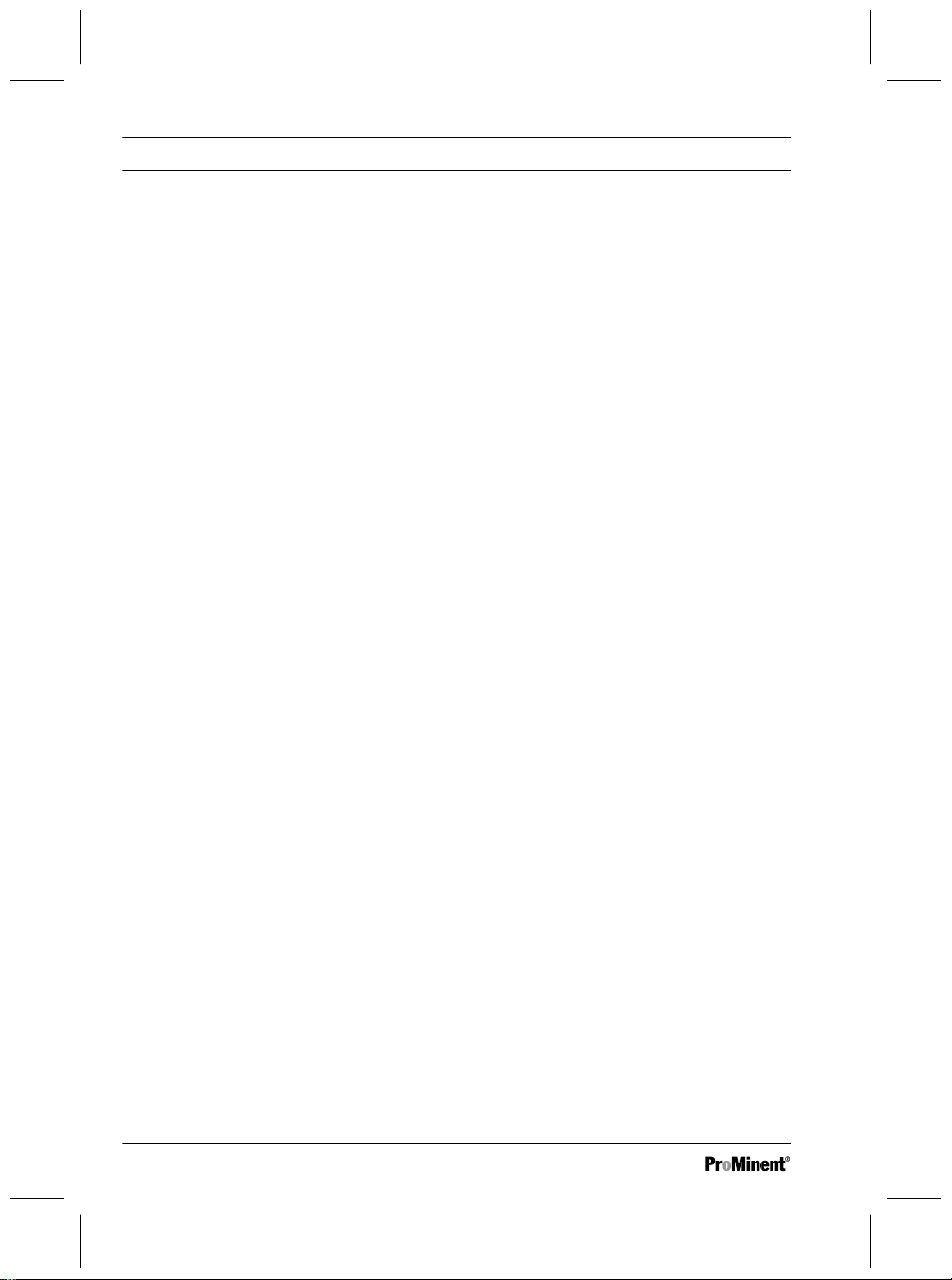
2 Funktionsbeschreibung
Kurzbeschreibung der Funktion
Der Sensor ICT 2 dient zum Messen der
elektrolytischen Leitfähigkeit über einen
weiten Messbereich. Der Sensor kann in
wenig bis stark verschmutzen Wässern
oder in aggressiven Medien eingesetzt
werden, die sich gegenüber PFA/
Chemraz® chemisch inaktiv verhalten. Der
Sensor ist insbesondere auch zum
Messen hoher Leitfähigkeiten bis
[2000 mS/cm]
geeignet, da keine Elektro‐
denpolarisation auftritt.
Der Sensor ist zum Messen im Durch‐
fluss, für den Einbau in Tanks, Rohrlei‐
tungen oder in die Eintaucharmatur IMAICT 2 vorgesehen.
Die maximal erlaubte Medientemperatur
beträgt 125 °C.
Anwendungsbereiche:
n Produktionsprozesse der chemischen
Industrie
n Phasentrennung von Produktgemi‐
schen
n Konzentrationsbestimmung von
aggressiven Chemikalien
Funktionsbeschreibung
12
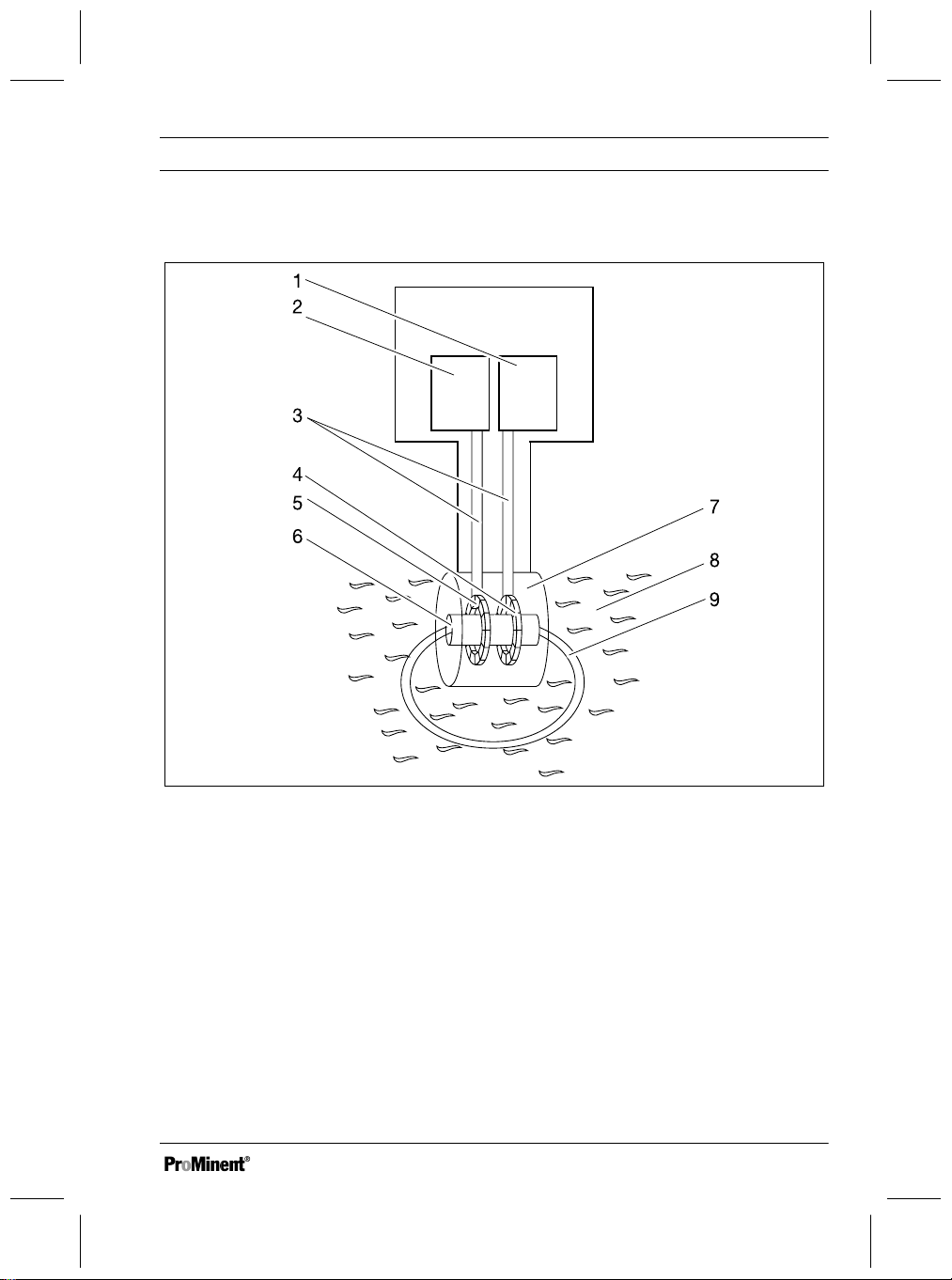
2.1 Aufbau und Funktion
A1417
Abb. 1: Messprinzip
1. Oszillator
2. Empfänger und Signalverarbeitung
3. Kabel
4. Sendespule
5. Empfangsspule
6. Bohrung
7. Sensorkopf
8. Messwasser
9. induzierter Strom
Funktionsbeschreibung
13
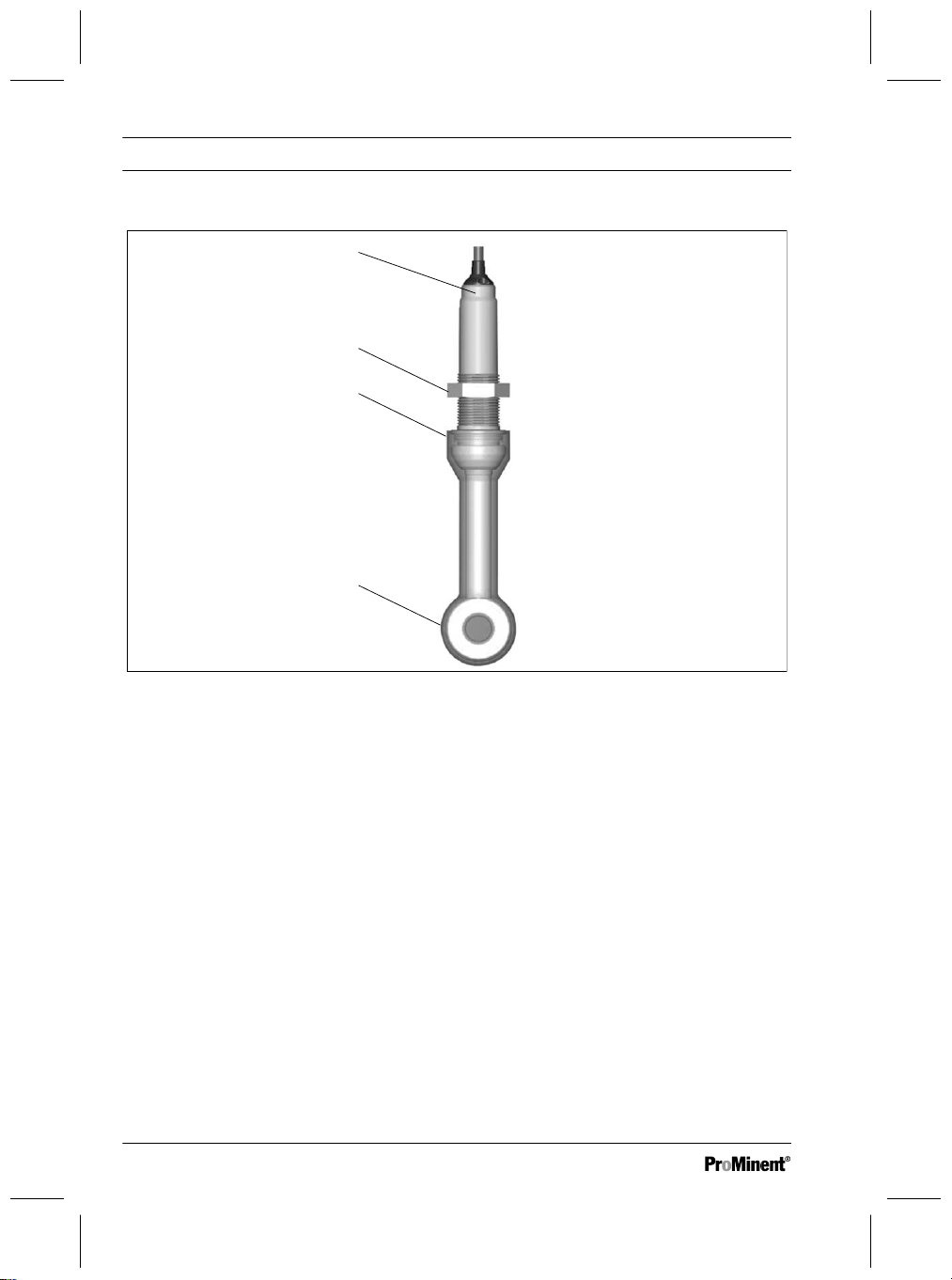
10
11
12
13
A1846
Abb. 2: Aufbau des Sensors
10. Sensorkabel
11. Befestigungsmutter G 3/4" (kunden‐
seitig)
12.
Dichtung Chemraz
®
13. Sensorkopf mit Bohrung
2.2 Zellkonstante und Einbaufaktor
Die elektrolytische Leitfähigkeit der Flüssigkeit hängt hauptsächlich von der Ionenkon‐
zentration ab. Bei der Messung müssen jedoch auch die geometrischen Gegebenheiten
der Sensorumgebung und die Geometrie des Sensors selbst berücksichtigt werden.
Die Geometrie des Sensors wird durch die Zellkonstante
[ZK]
vollständig beschrieben.
Die geometrischen Gegebenheiten der Sensorumgebung werden durch den Einbaufaktor
[f]
beschrieben. Der Einbaufaktor
[f]
kann bei einem ausreichenden Wandabstand des
Sensorkopfes (
[a]
> 30 mm) unberücksichtigt bleiben. Bei kleineren Wandabständen wird
der Einbaufaktor im Fall elektrisch isolierender Rohre (1) größer 1, im Fall elektrisch lei‐
tende Rohre (2) kleiner 1, siehe Abb. 3
Funktionsbeschreibung
14
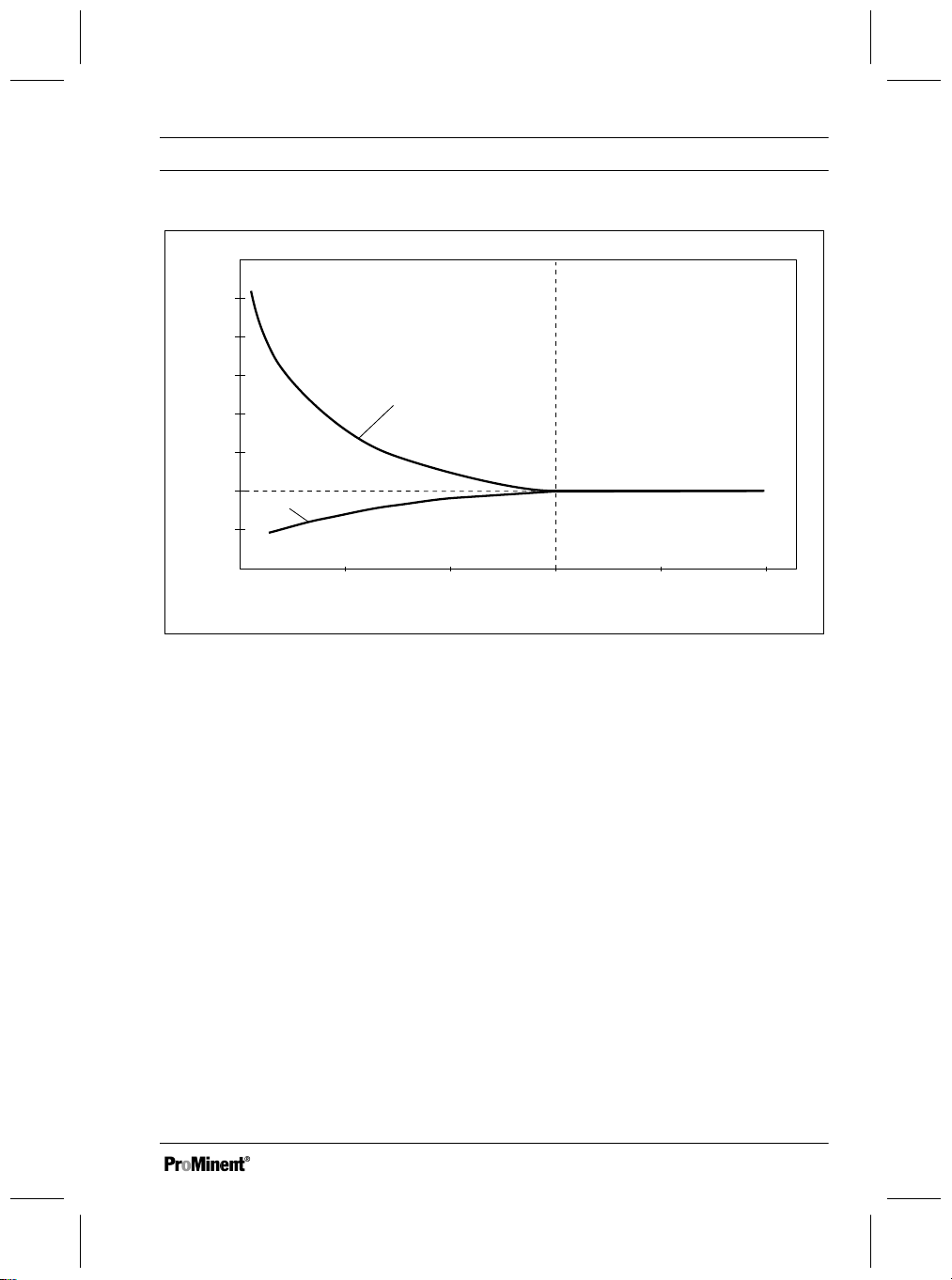
1,0
II.
0,8
1,2
1,4
2
1
mm50403020100
A1847
I.
Abb. 3: Abhängigkeit Einbaufaktor zu Wandabstand
I. Einbaufaktor
[f]
II. Wandabstand
[a]
Der Einbaufaktor
[f]
in Abhängigkeit vom Wandabstand
[a]
des Sensors (für elektrisch
isolierende Rohre (1) und elektrisch leitende Rohre (2))
Funktionsbeschreibung
15
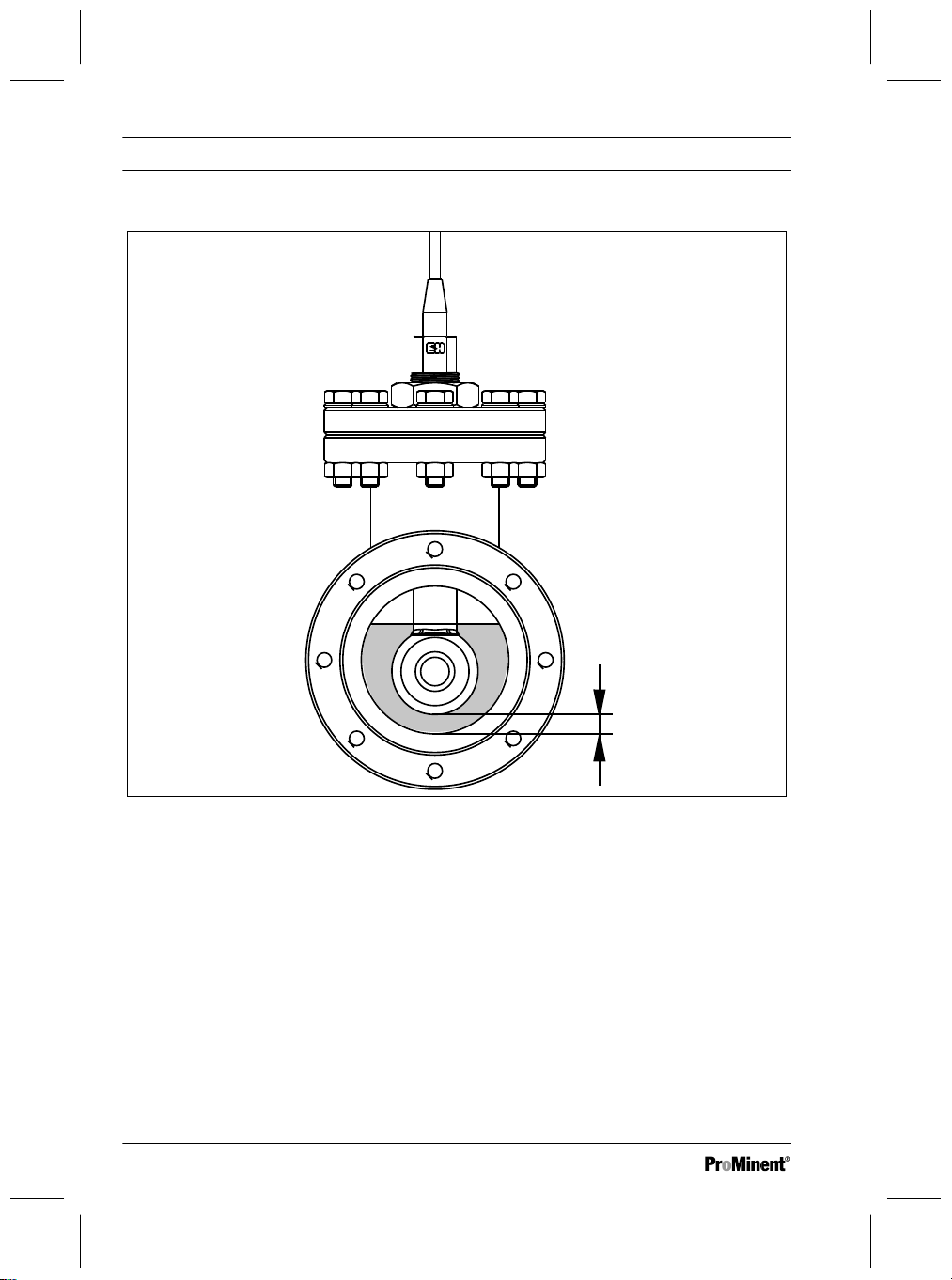
a
A1849
Abb. 4: Wandabstand [a]
Funktionsbeschreibung
16

3 Transportieren und Lagern
HINWEIS!
Originalverpackung
Schädigung des Produkts
– Transportieren, versenden und
lagern Sie den Sensor nur in
der Originalverpackung
– Bewahren Sie die Verpackung
komplett mit den Styropor‐
teilen auf
Lagerung
Zulässige Umgebungstemperatur: -10
°C ... +50 °C
Feuchtigkeit: maximal 90 % relative Luft‐
feuchtigkeit, nicht kondensierend
Sonstige: Kein Staub, kein direktes Son‐
nenlicht
3.1 Transport
Der Transport sollte in der Originalverpa‐
ckung und innerhalb der zulässigen
Umweltbedingungen erfolgen. Weitere
Besonderheiten sind beim Transport nicht
zu beachten.
Transportieren und Lagern
17
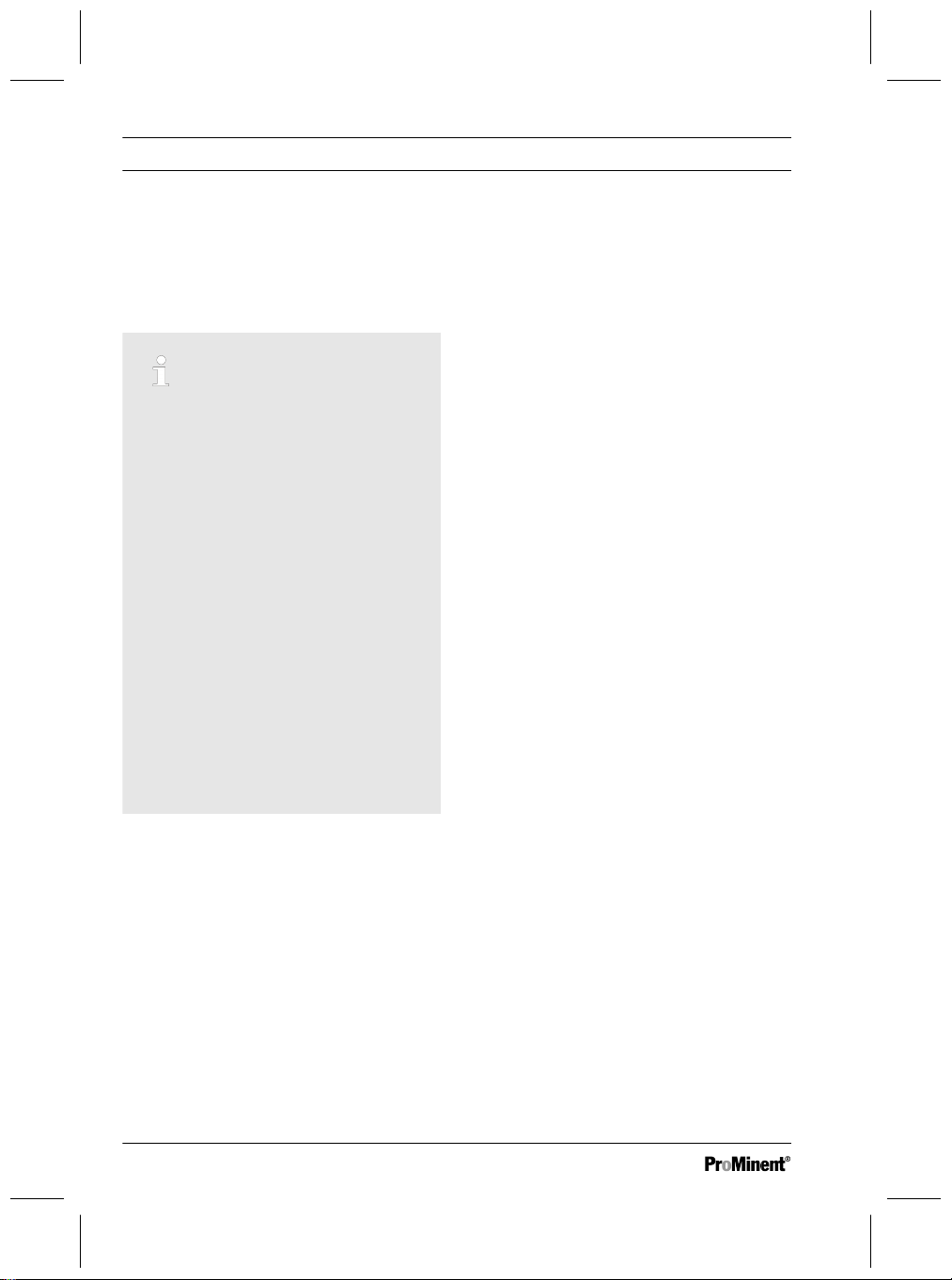
4 Installieren, elektrisch
n Benutzer Qualifikation: Elektrofach‐
kraft, siehe
Ä Kapitel 1.2 „Benutzer-
Qualifikation“ auf Seite 9
Schließen Sie den Sensor nur bei
abgeschalteter Speisespannung
an.
Kürzen Sie das Anschlusskabel
des Sensors nicht. Sonst wird das
Messergebnis verfälscht.
Beachten Sie beim Installieren die
entsprechenden nationalen Vor‐
schriften.
Verwenden Sie nur passende
Aderendhülsen.
Verwenden Sie ein Netzkabel mit
Schutzleiter. Über den Schutzleiter
muss die Abschirmung des Sen‐
sorkabels geerdet werden, wenn
ein Störpotenzial vorhanden ist.
Hierzu muss auch der Stecker und
die Steckdose entsprechend konfi‐
guriert sein.
Installieren, elektrisch
18
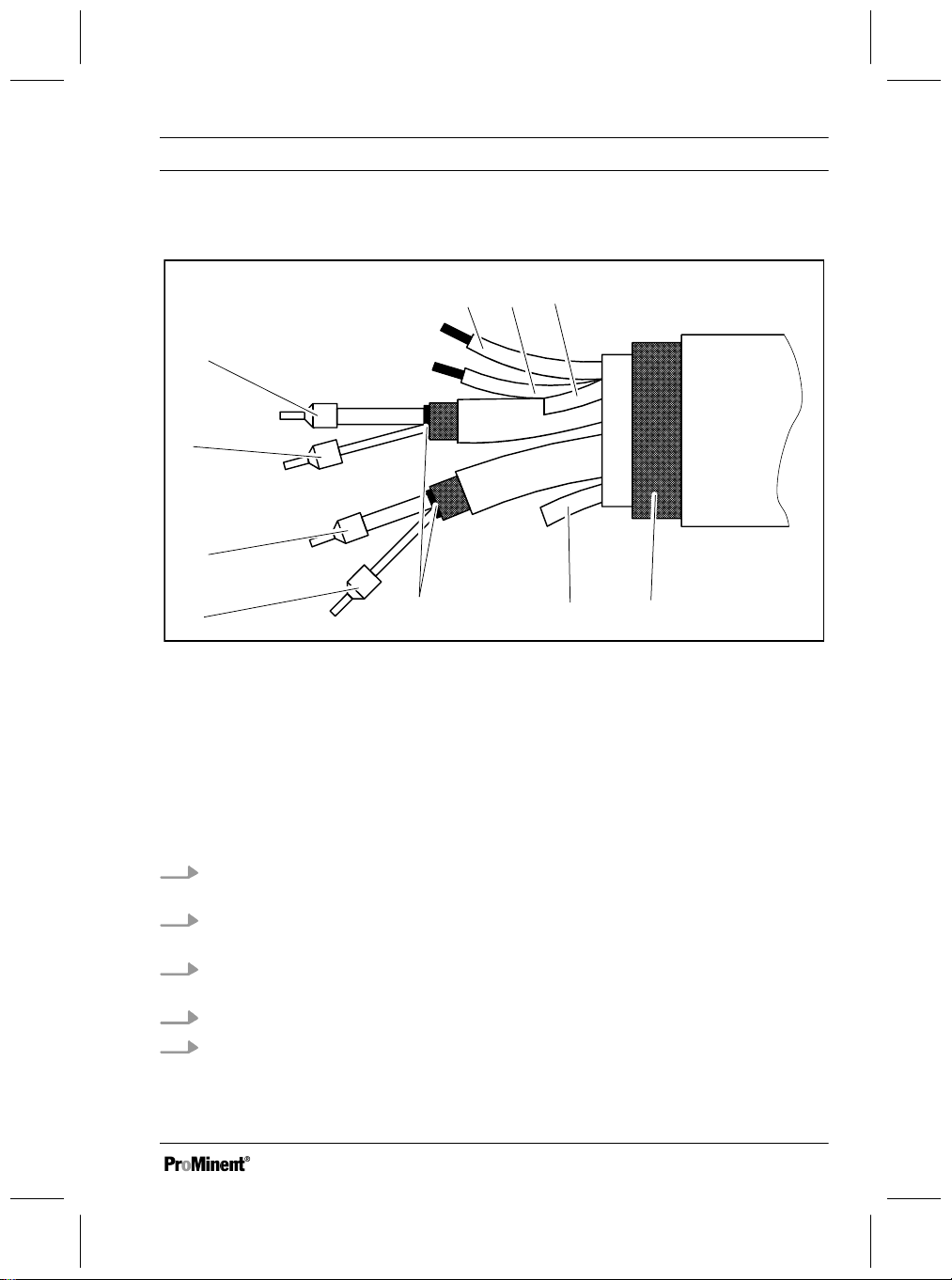
Installieren des Sensors
8
9
4 **
11
10
5*
7
12
3*
6
1
2
A1848
Abb. 5: Benennung der Kabel mit ihren Adern.
1 Weiß
2 Rot
3 Gelb (Dieses Kabel abschneiden)*
4 Gesamtschirm**
5 Braun (Dieses Kabel abschneiden)*
6 Halbleiter-Abschirmung
7 Weiß
8 Grün
9 Blau
10 Rot
11 Blau
12 Rot
Schließen Sie den Sensor an den Regler an, gemäß dem Klemmenanschlussplan des
Reglers.
1. Mess-Signalkabel (weißes Kabel): Schließen Sie die rote und blaue Ader entspre‐
chend der Betriebsanleitung des jeweiligen Mess- und Regelgerätes an.
2. Ansteuersignal (rotes Kabel): Schließen Sie die rote und blaue Ader entsprechend
der Betriebsanleitung des jeweiligen Mess- und Regelgerätes an.
3. Grüne und weiße Adern: Schließen Sie den Temperatursensor Pt 100 entspre‐
chend der Betriebsanleitung des jeweiligen Mess- und Regelgerätes an.
4. Braune und gelbe Ader abschneiden, diese werden nicht benötigt.
5. Wenn ein Störpotenzial vorhanden ist, dann den Gesamtschirm über das Netz‐
kabel erden.
Installieren, elektrisch
19
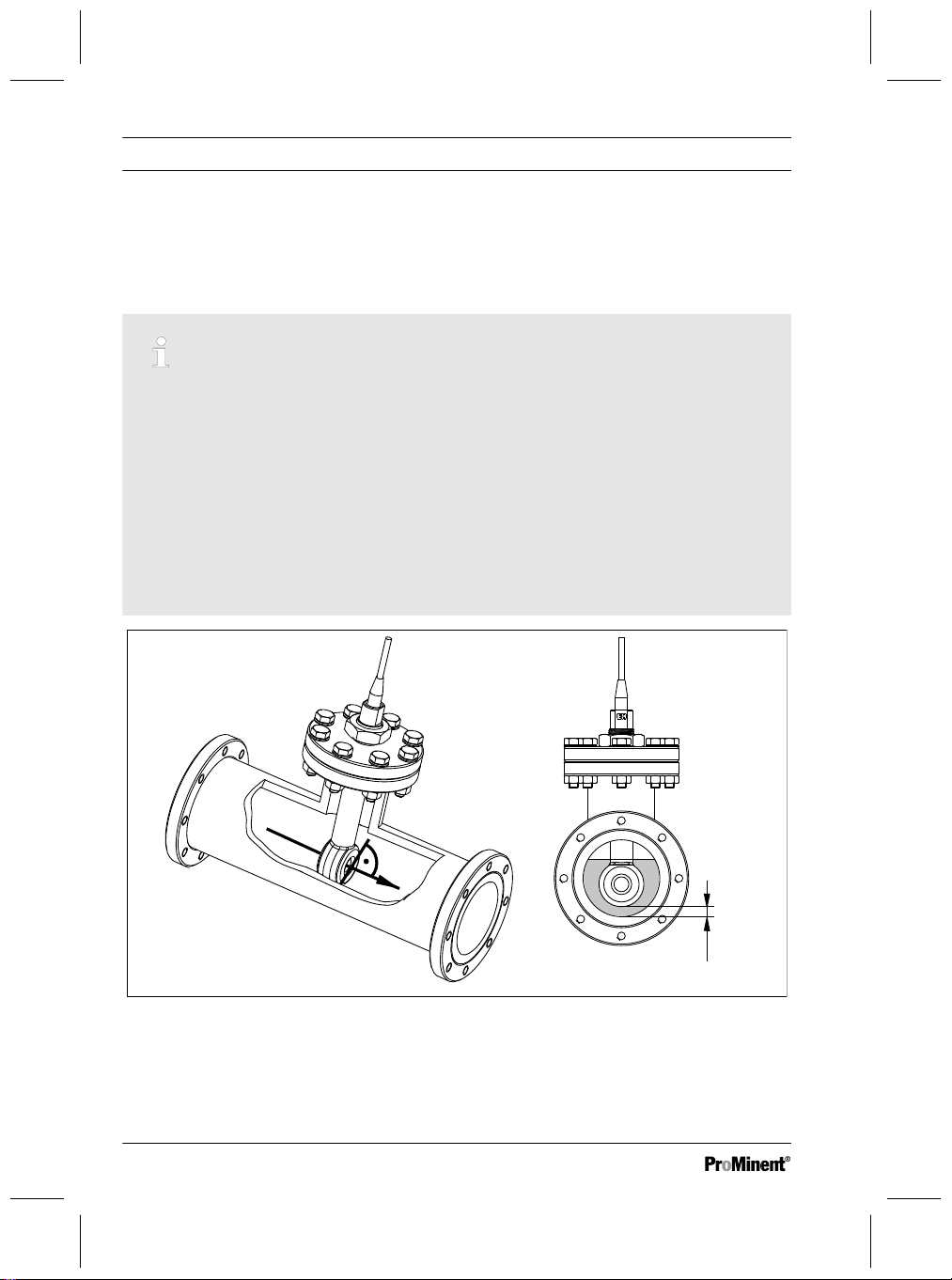
5 Montieren
n Benutzer Qualifikation: ausgebildete Fachkräfte, siehe
Ä Kapitel 1.2 „Benutzer-Qua‐
lifikation“ auf Seite 9
Montagehinweise
Achten Sie darauf, dass die Achsen von Sensor und Rohr senkrecht aufeinander
stehen. Sie dürfen das Gewinde nicht verkanten, um die Stabilität der Messstelle
bei druckbeaufschlagten Prozessen zu gewährleisten.
Die Achse durch die Bohrung des Sensorkopfes muss mit der Rohrachse zusam‐
menfallen.
Der Sensorkopf muss während des Messvorgangs immer mit Messwasser
bedeckt sein, sonst kommt es zu falschen Messergebnissen.
Wenn Sie eine Messgenauigkeit besser als 10 % benötigen, müssen Sie in der
Nähe des Sensors einen Probenahmehahn installieren, um Messwasserproben
entnehmen zu können.
a
A1850
Abb. 6: Rohrleitungseinbau mit Stutzen / a = Wandabstand
Montieren
20
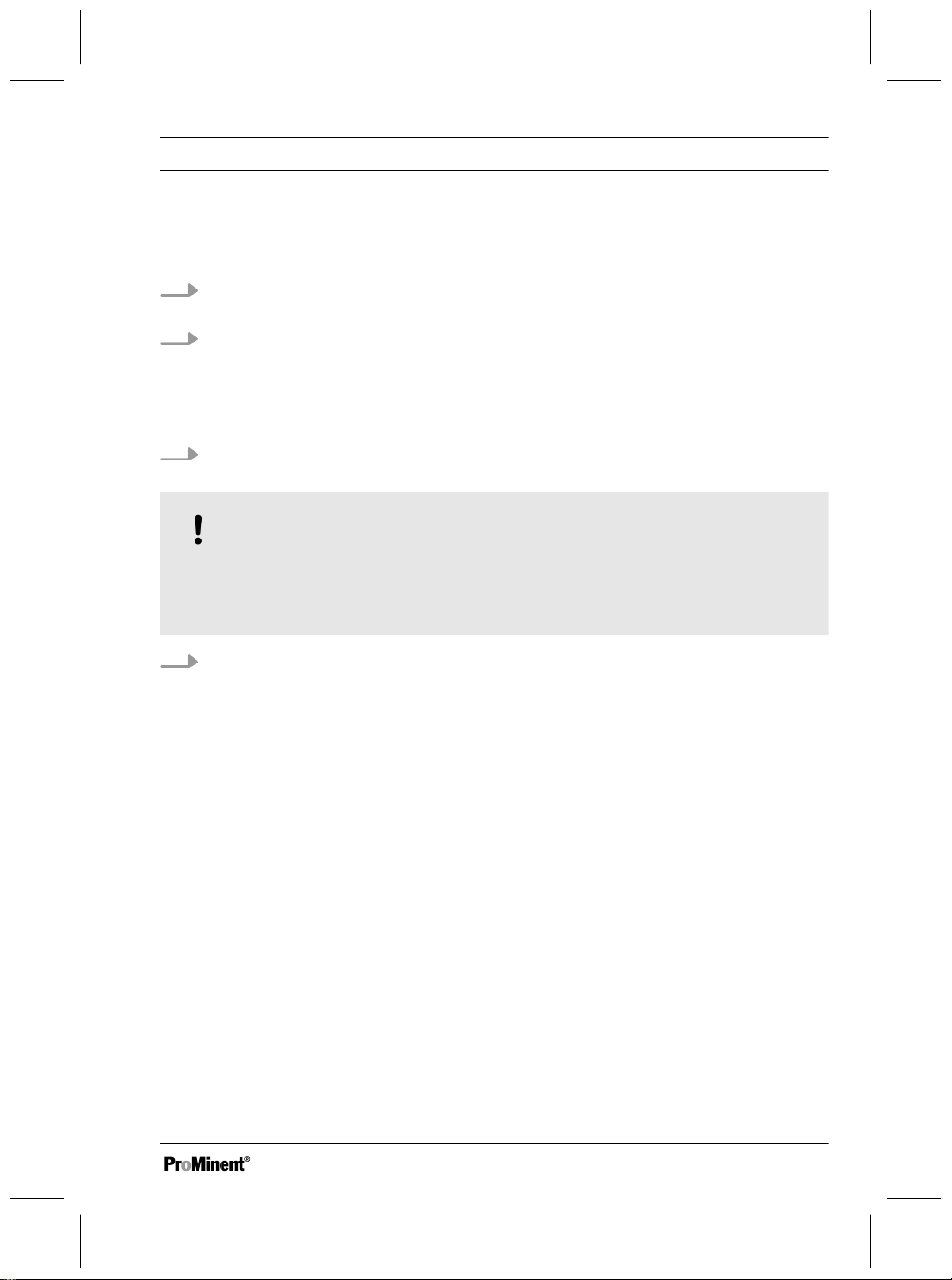
Der Sensor ICT 2 kann in Tanks und in Rohre direkt eingebaut werden oder über einen
Flansch bzw. eine Eintaucharmatur als Adapter.
1. Führen Sie vor dem Einbauen des Sensors die Inbetriebnahme bis einschließlich
der Nullpunktkalibrierung durch.
2. Setzen Sie den Sensor in die Öffnung der medienführenden Rohrleitung oder den
Tank ein, dabei muss die Flachdichtung auf der Innenseite von Rohrleitung oder
Tank sitzen.
In strömenden Medien müssen Sie die Bohrung des Sensorkopfes in der Mitte des
Rohrquerschnitts platzieren.
3. Drehen Sie den Sensor so, dass die Bohrung des Sensorkopfes in Strömungsrich‐
tung weist (Pfeil).
HINWEIS!
Definierter Anzugsdrehmoment
Der Anzugsdrehmoment ist unbedingt einzuhalten. Ansonsten kann es im Betrieb
der Anlage zu Folgeschäden kommen.
4. Ziehen Sie die Befestigungsmutter mit 20 Nm an.
Montieren
21
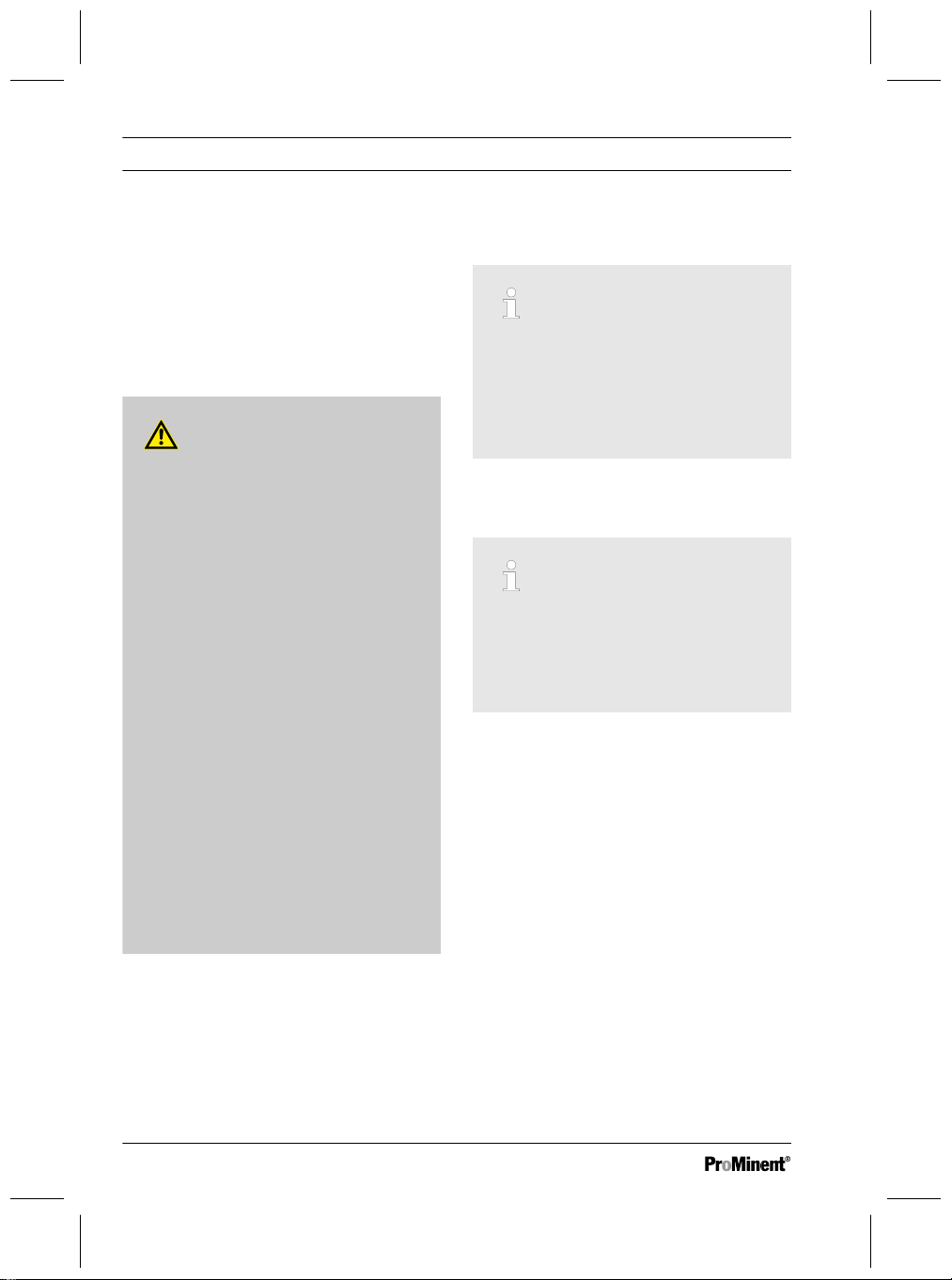
6 In Betrieb nehmen
n Benutzer Qualifikation: ausgebildete
Fachkräfte, siehe
Ä Kapitel 1.2
„Benutzer-Qualifikation“ auf Seite 9
Voreinstellungen
WARNUNG!
Gefährdung durch einen
Gefahrstoff!
Mögliche Folge: Tod oder
schwerste Verletzungen.
Beachten Sie beim Umgang mit
Gefahrstoffen, dass die aktuellen
Sicherheitsdatenblätter der Gefahr‐
stoff-Hersteller vorliegen. Die not‐
wendigen Maßnahmen ergeben
sich aus dem Inhalt des Sicher‐
heitsdatenblatts. Da aufgrund
neuer Erkenntnisse, das Gefähr‐
dungspotenzial eines Stoffes jeder‐
zeit neu bewertet werden kann, ist
das Sicherheitsdatenblatt regel‐
mäßig zu überprüfen und bei
Bedarf zu ersetzen.
Für das Vorhandensein und den
aktuellen Stand des Sicherheitsda‐
tenblatts und die damit verbundene
Erstellung der Gefährdungsbeurtei‐
lung der betroffenen Arbeitsplätze
ist der Anlagenbetreiber verant‐
wortlich.
Betriebsanleitung des jewei‐
ligen Reglers
Nehmen Sie die notwendigen Ein‐
stellungen an dem von Ihnen ver‐
wendeten Regler vor, wie in der
Betriebsanleitung des jeweiligen
Reglers beschrieben.
Nullpunkt kalibrieren
Nullpunkt kalibrieren
Nehmen Sie die notwendige Kalib‐
rierung an dem von Ihnen verwen‐
deten Regler vor, wie in der
Betriebsanleitung des jeweiligen
Reglers beschrieben.
n Den Nullpunkt müssen Sie beim in
Betrieb nehmen kalibrieren.
n Den Nullpunkt müssen Sie bei jedem
Wechseln des Messbereiches kalib‐
rieren
n Den Nullpunkt dürfen Sie nur mit
absolut trockenem Sensorkopf kalib‐
rieren
n Den Nullpunkt dürfen Sie nur in aus‐
gebautem Zustand an Umgebungsluft
kalibrieren
n Während des Kalibrierens müssen
Sie mit dem Sensorkopf mehr als 20
mm Abstand zu allen Gegenständen
halten
n Den Nullpunkt müssen Sie vor der
Steilheit kalibrieren
In Betrieb nehmen
22
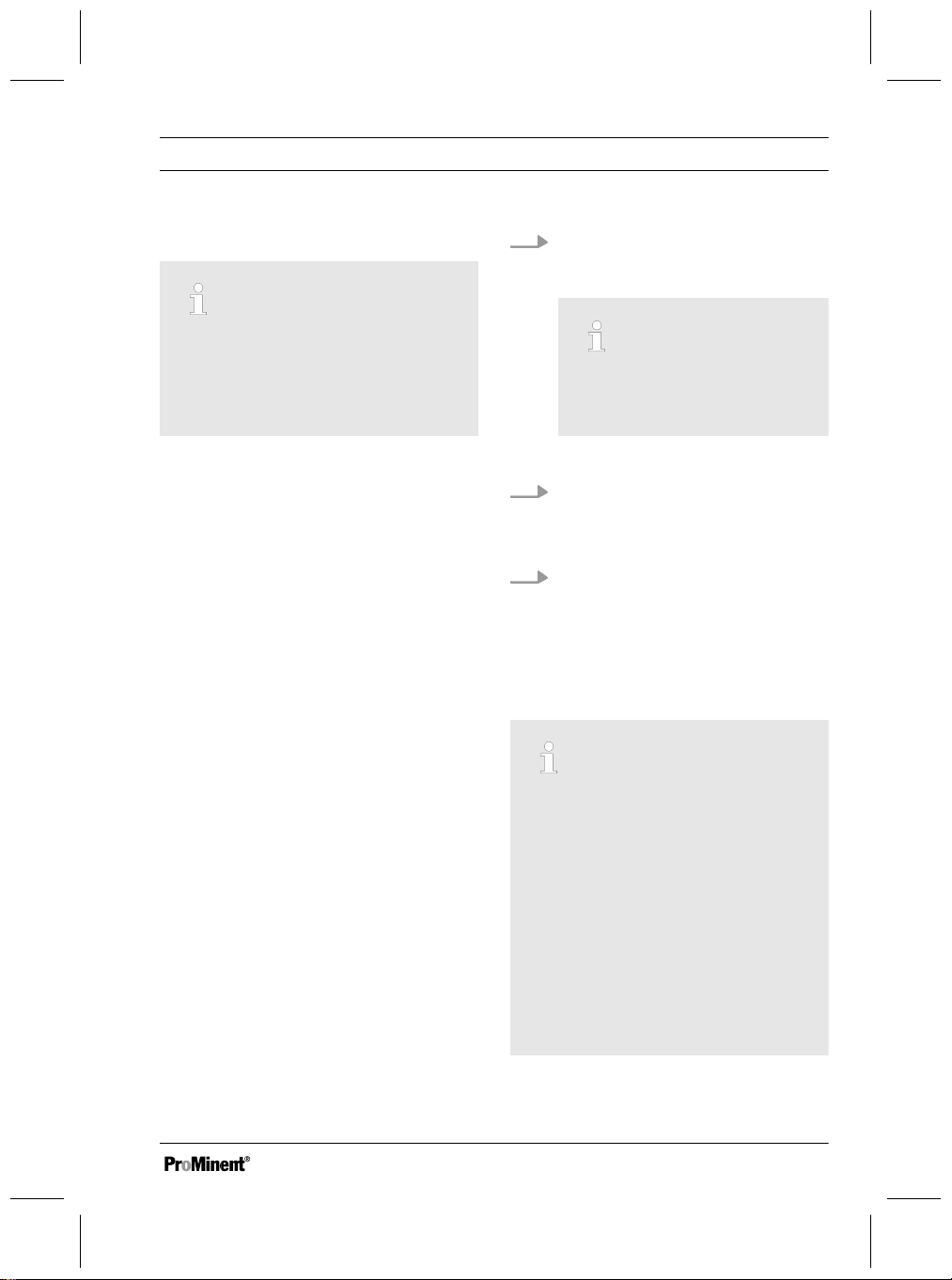
Steilheit kalibrieren
Steilheit kalibrieren
Nehmen Sie die notwendige Kalib‐
rierung an dem von Ihnen verwen‐
deten Regler vor, wie in der
Betriebsanleitung des jeweiligen
Reglers beschrieben.
n Die folgenden Handlungsanwei‐
sungen müssen immer durchgeführt
werden
n Das Messwasser muss am Sensor
während des Kalibrierens gleich‐
mäßig, blasen- und turbulenzfrei
fließen oder stehen
n Wenn in fließendem Messwasser
kalibriert wird, muss es während des
Kalibrierens eine konstante elektrolyti‐
sche Leitfähigkeit haben
n Die Achse durch die Bohrung des
Sensorkopfes muss mit der Rohr‐
achse übereinstimmen
1. Bedecken Sie den Sensorkopf kom‐
plett mit Messwasser (eintauchen
oder Umgebung fluten)
Nun gibt es drei alternative
Vorgehensweisen für unter‐
schiedliche Ansprüche:
Messgenauigkeit von ca. 10 %
2. Stellen Sie den Temperaturkoeffizi‐
enten α des Messwassers im Ein‐
stellmenü des Reglers ein (bei 25
°C)
3. Geben Sie den Einbaufaktor des
Sensors im Einstellmenü des Reg‐
lers ein. Der Einbaufaktor ist „1“,
wenn der Sensor wie vorge‐
schrieben montiert wurde.
Hohe Messgenauigkeit /Kalibrieren mit
Referenzmessgerät
Üblicherweise erfolgt die Kalibrie‐
rung des ICT 1 im eingebauten
Zustand mit einem Referenzmess‐
gerät (z. B. einem Handmessgerät
für konduktive Leitfähigkeit).
Bereiten Sie das Handmessgerät
wie in der Anleitung für das Refe‐
renzmessgerät beschrieben vor.
Um die Messgenauigkeit des ICT 1
ausnutzen zu können, muss die
Kalibrierung des Referenzmessge‐
räts auf mindestens 1 % genau
sein.
In Betrieb nehmen
23
 Loading...
Loading...