ProMinent DULCOTEST CDE Series, DULCOTEST CDE 2-mA-0.5 ppm, DULCOTEST CDE 2-mA-2 ppm, DULCOTEST CDE 2-mA-10 ppm, DULCOTEST CDE 3-mA-0.5 ppm Assembly And Operating Instructions Manual
Page 1
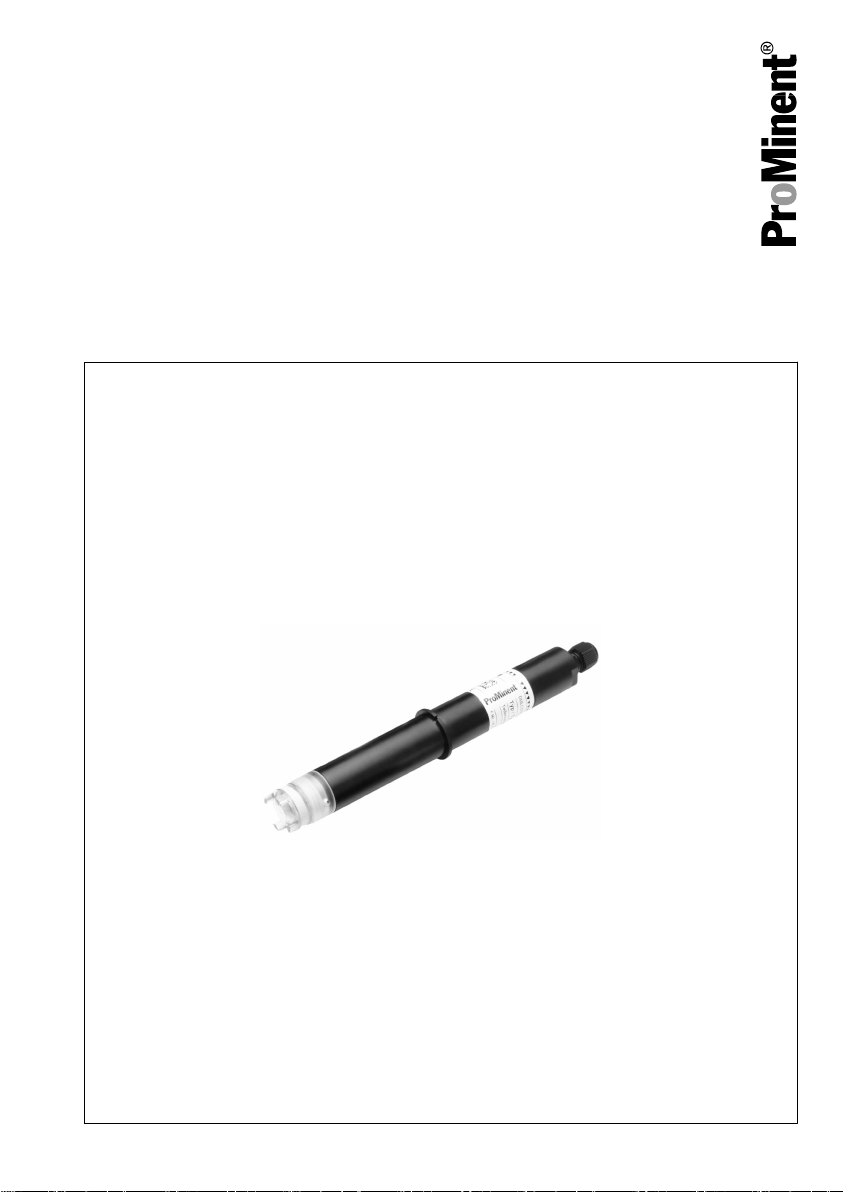
Assembly and operating instructions
A1265
DULCOTEST® Sensor CDE
Typ/Type: CDE 2-mA-0.5 ppm; CDE 2-mA-2
ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0.5 ppm
DE/EN
Please carefully read these operating instructions before use. · Do not discard.
The operator shall be liable for any damage caused by installation or operating errors.
The latest version of the operating instructions are available on our homepage.
Target group: commercial use.Part no.: 986656 Ver.: BA DT 161 05/19 DE/EN
Page 2
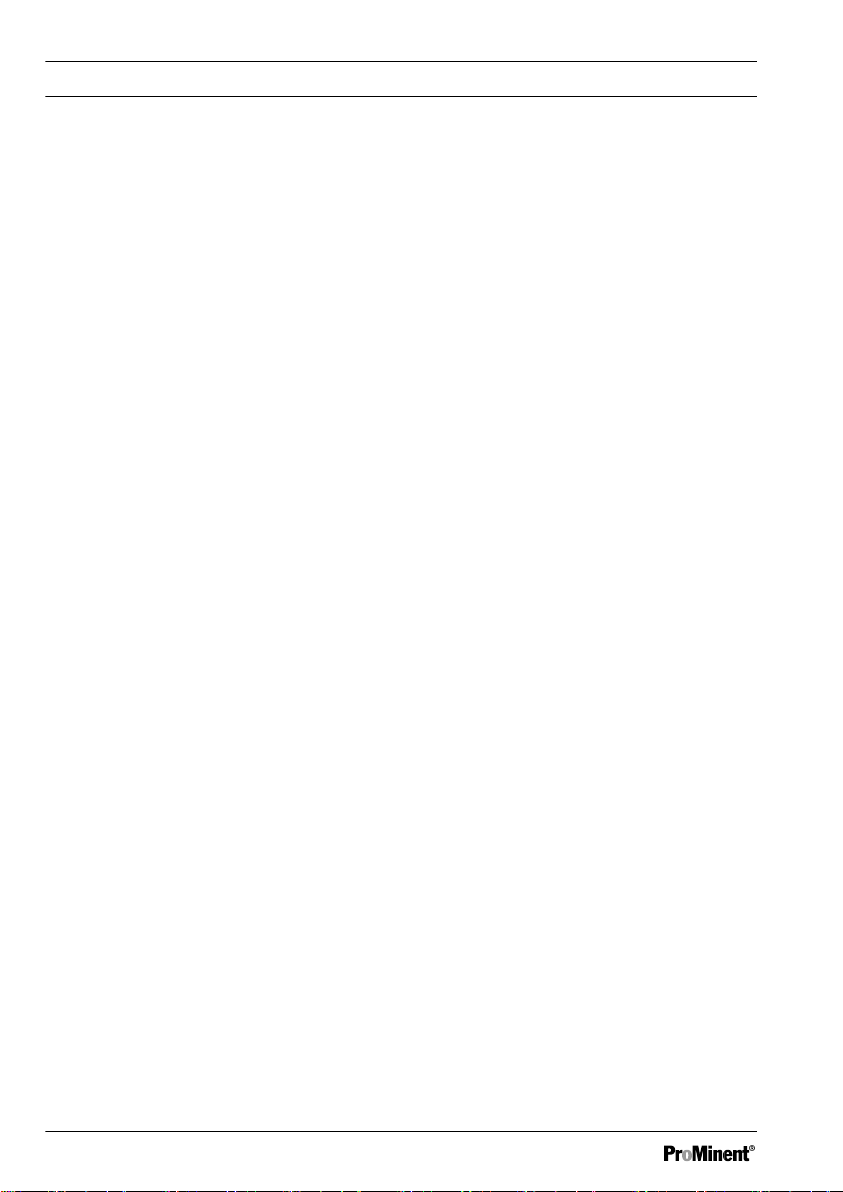
Overall Table of Contents
Overall Table of Con‐
tents
DE
DULCOTEST® Sensor CDE Typ:
CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2
ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-
mA-0,5 ppm......................................... 4
1 Der erste Überblick........................ 8
1.1 Bestimmungsgemäße Verwen‐
dung........................................... 9
2 Sicherheit und Qualifikation......... 10
2.1 Kennzeichnung der Warnhin‐
weise........................................ 10
2.2 Allgemeine Sicherheitshin‐
weise........................................ 11
2.3 Benutzer-Qualifikation.............. 12
3 Aufbau und Funktion................... 14
3.1 Aufbau...................................... 14
3.2 Funktion.................................... 15
4 Lagern und transportieren des
Sensors....................................... 16
4.1 Lagern...................................... 16
4.2 Transport.................................. 16
4.3 Verpackungsmaterial................ 16
5 Montieren.................................... 17
5.1 Herstellen des Elektrolyten....... 18
5.2 Elektrolyt einfüllen.................... 19
5.3 Sensor in die Bypassarmatur
einbauen................................... 20
6 Installieren................................... 22
7 Inbetriebnahme........................... 24
7.1 Kalibrieren................................ 24
8 Störungen, Fehlersuche und
Fehlerbeseitigung........................ 27
9 Wartungs- und Reparaturar‐
beiten am Sensor........................ 29
10 Sensor vorübergehend oder
ganz außer Betrieb nehmen...... 30
11 Altteileentsorgung...................... 31
12 Bestellhinweise für Ersatzteile/
Verbrauchsmaterial................... 32
13 Technische Daten..................... 35
14 Eingehaltene Richtlinien/
Normen...................................... 37
EN
DULCOTEST® Sensor CDE Type:
CDE 2-mA-0.5 ppm; CDE 2-mA-2
ppm; CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-
mA-0.5 ppm....................................... 41
1 Initial overview............................. 45
1.1 Intended use............................. 46
2 Safety and qualification............... 47
2.1 Labelling of Warning Informa‐
tion............................................ 47
2.2 General safety information....... 48
2.3 User qualification...................... 49
3 Construction and function............ 51
3.1 Construction............................. 51
3.2 Function.................................... 52
4 Storage and Transport of the
Sensor......................................... 53
4.1 Storage..................................... 53
4.2 Transport.................................. 53
4.3 Packaging material................... 53
5 Assembly..................................... 54
5.1 Production of electrolyte........... 55
5.2 Filling electrolyte....................... 56
5.3 Installing sensor in the bypass
fitting......................................... 57
6 Installation................................... 59
7 Commissioning............................ 61
7.1 Calibration................................ 61
8 Faults, Fault Detection and Trou‐
bleshooting.................................. 64
9 Maintenance and Repair Work
on the Sensor.............................. 66
10 Remove sensor from operation
either temporarily or perma‐
nently......................................... 67
2
Page 3

11 Disposal of used parts............... 68
12 Ordering information for spare
parts/consumables.................... 69
13 Technical data........................... 72
14 Directives / standards adhered
to............................................... 74
Overall Table of Contents
3
Page 4
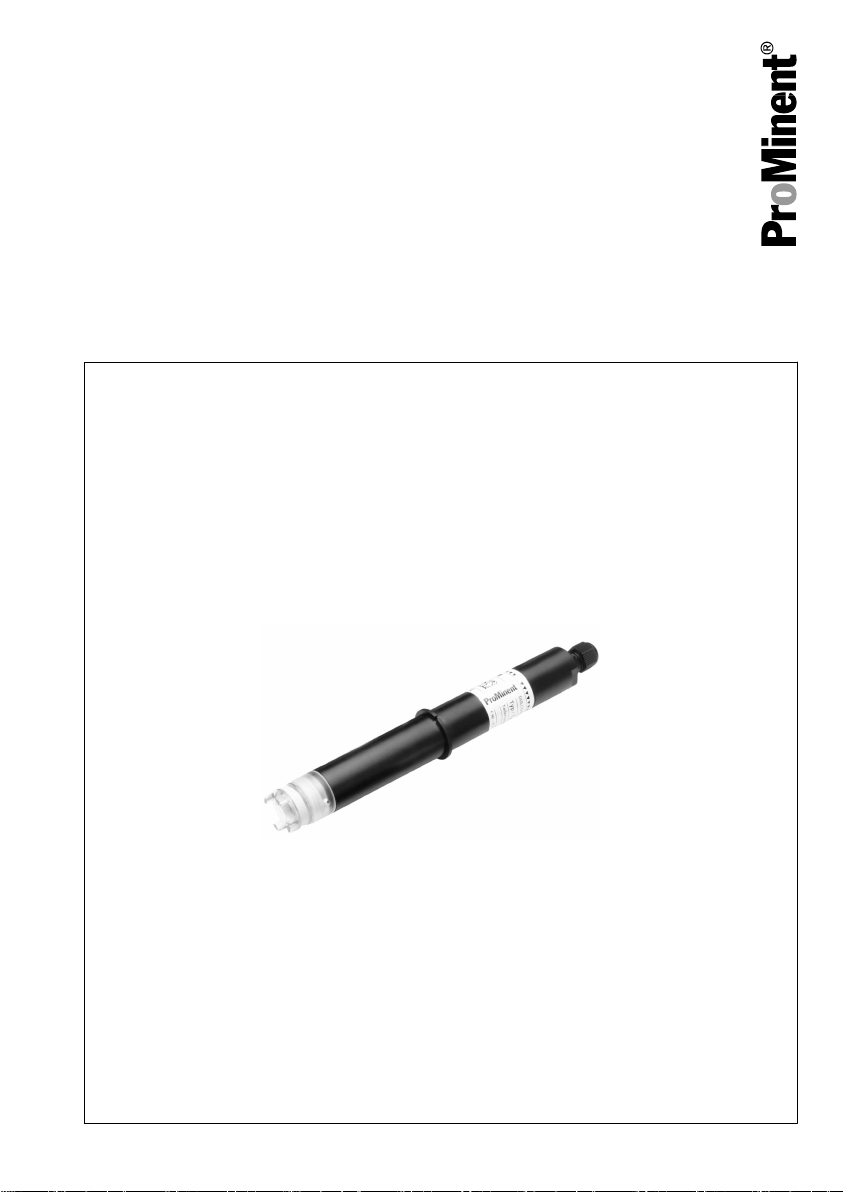
Montage- und Betriebsanleitung
A1265
DULCOTEST® Sensor CDE
Typ: CDE 2-mA-0,5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm;
CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0,5 ppm
DE
Betriebsanleitung bitte zuerst vollständig durchlesen. · Nicht wegwerfen.
Bei Schäden durch Installations- oder Bedienfehler haftet der Betreiber.
Die neueste Version einer Betriebsanleitung ist auf unserer Homepage verfügbar.
Zielgruppe: gewerbliche Nutzung.Teile-Nr: 986656 Version: BA DT 161 05/19 DE
Page 5
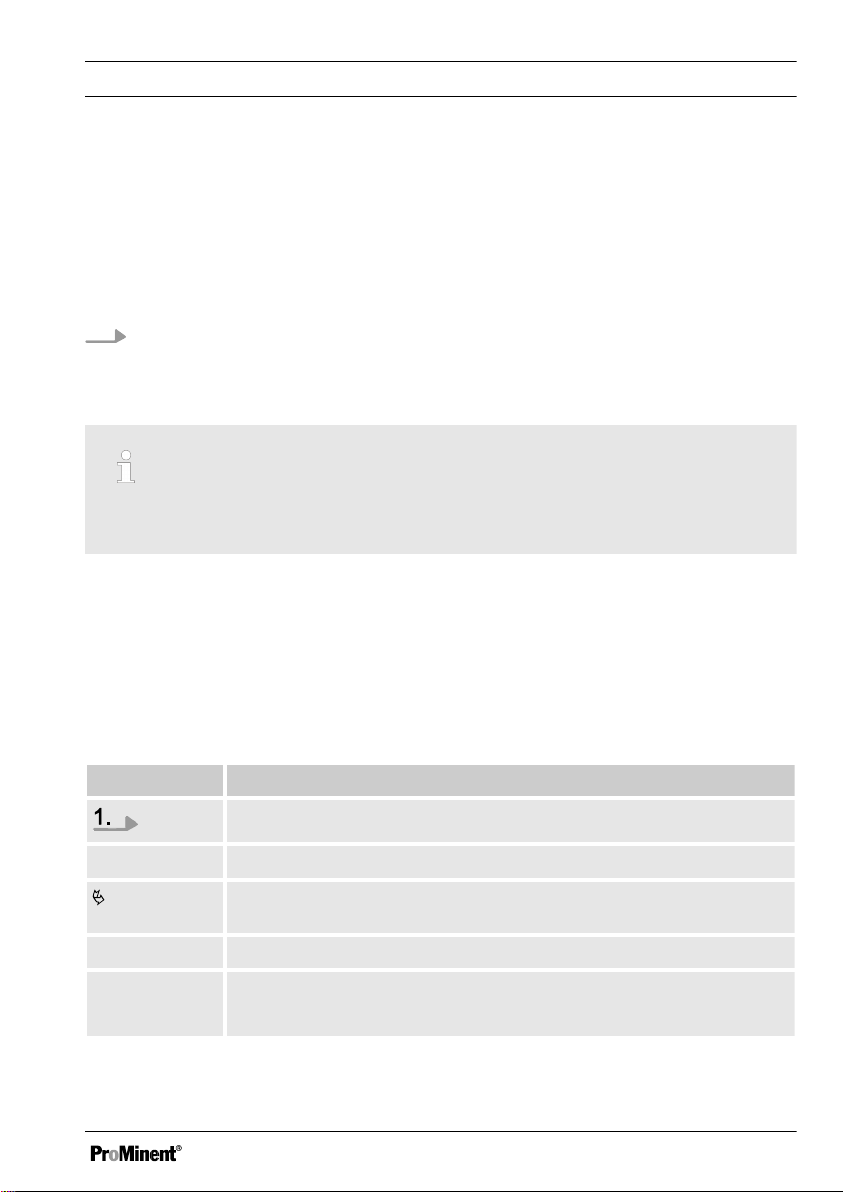
Ergänzende Anweisungen
Allgemeine Gleichbehandlung Dieses Dokument verwendet die nach der
Grammatik männliche Form in einem neutralen
Sinn, um den Text leichter lesbar zu halten. Es
spricht immer Frauen und Männer in gleicher
Weise an. Die Leserinnen bitten wir um Ver‐
ständnis für diese Vereinfachung im Text.
Ergänzende Anweisungen
Lesen Sie bitte die ergänzenden Anweisungen durch.
Infos
Eine Info gibt wichtige Hinweise für das richtige Funktionieren des Geräts oder soll Ihre
Arbeit erleichtern.
Warnhinweise
Warnhinweise sind mit ausführlichen Beschreibungen der Gefährdungssituation versehen, siehe
Ä Kapitel 2.1 „Kennzeichnung der Warnhinweise“ auf Seite 10
Zur Hervorhebung von Handlungsanweisungen, Verweisen, Auflistungen, Ergebnissen und anderen
Elementen können in diesem Dokument folgende Kennzeichnungen verwendet werden:
.
Tab. 1: Weitere Kennzeichnung
Kennzeichen Beschreibung
Handlung Schritt-für-Schritt.
⇨ Ergebnis einer Handlung.
Links auf Elemente bzw. Abschnitte dieser Anleitung oder mitgeltende Doku‐
mente.
n
[Taster]
5
Auflistung ohne festgelegte Reihenfolge.
Anzeigeelemente (z. B. Signalleuchten).
Bedienelemente (z. B. Taster, Schalter).
Page 6
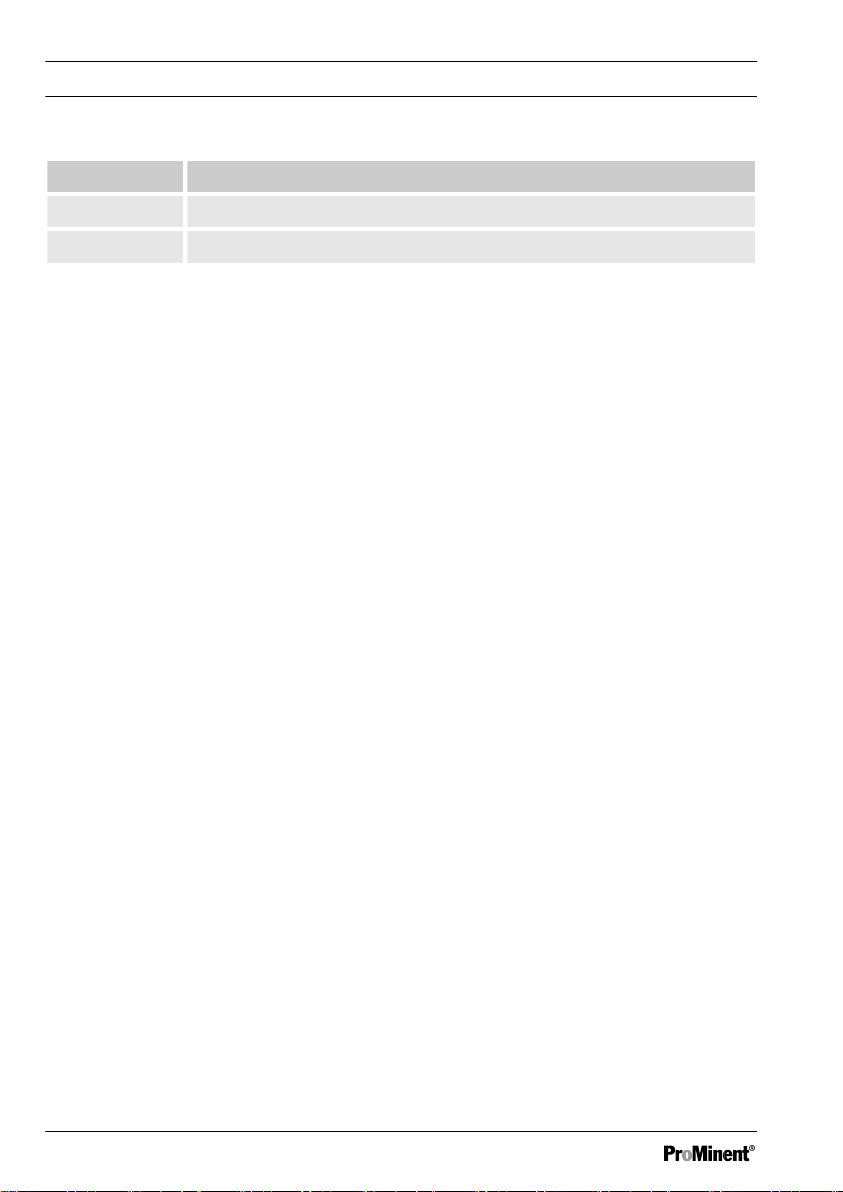
Ergänzende Anweisungen
Kennzeichen Beschreibung
„Anzeige/GUI“
CODE
Bildschirmelemente (z. B. Schaltflächen, Belegung von Funktionstasten).
Darstellung von Softwareelementen bzw. Texten.
6
Page 7

Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
1 Der erste Überblick................................................................................................................. 8
1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung............................................................................... 9
2 Sicherheit und Qualifikation.................................................................................................. 10
2.1 Kennzeichnung der Warnhinweise............................................................................... 10
2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise................................................................................... 11
2.3 Benutzer-Qualifikation.................................................................................................. 12
3 Aufbau und Funktion............................................................................................................. 14
3.1 Aufbau.......................................................................................................................... 14
3.2 Funktion........................................................................................................................ 15
3.2.1 Typische Anwendungen............................................................................................ 15
4 Lagern und transportieren des Sensors................................................................................ 16
4.1 Lagern.......................................................................................................................... 16
4.2 Transport...................................................................................................................... 16
4.3 Verpackungsmaterial.................................................................................................... 16
5 Montieren.............................................................................................................................. 17
5.1 Herstellen des Elektrolyten........................................................................................... 18
5.2 Elektrolyt einfüllen........................................................................................................ 19
5.3 Sensor in die Bypassarmatur einbauen....................................................................... 20
6 Installieren............................................................................................................................. 22
7 Inbetriebnahme..................................................................................................................... 24
7.1 Kalibrieren.................................................................................................................... 24
8 Störungen, Fehlersuche und Fehlerbeseitigung................................................................... 27
9 Wartungs- und Reparaturarbeiten am Sensor...................................................................... 29
10 Sensor vorübergehend oder ganz außer Betrieb nehmen.................................................... 30
11 Altteileentsorgung................................................................................................................. 31
12 Bestellhinweise für Ersatzteile/Verbrauchsmaterial.............................................................. 32
13 Technische Daten................................................................................................................. 35
14 Eingehaltene Richtlinien/Normen.......................................................................................... 37
15 Index..................................................................................................................................... 38
7
Page 8

Der erste Überblick
1 Der erste Überblick
Standardlieferumfang
Diese Montage- und Betriebsanleitung beschreibt die technischen Daten und Funktionen des
DULCOTEST® Sensor Typ CDE für Chlordioxid-Konzentration in tensidfreiem Wasser.
Tab. 2: Standardlieferumfang CDE 2
n 1 Sensor CDE komplett mit Sensorkappe, Schutzkappe und Klemmring.
– Typ CDE 2-mA-0,5 ppm, oder
– Typ CDE 2-mA-2 ppm, oder
– Typ CDE 2-mA-10 ppm.
1 Set zur Herstellung des Elektrolyten:
n 1 Flasche Grundelektrolyt,
n 1 Röhrchen mit Pulver,
n 1 Etikett für den hergestellten Elektrolyten.
1 Betriebsanleitung.
1 Schraubendreher.
Standardlieferumfang CDE 3
Tab. 3: Standardlieferumfang CDE 3
n 1 Sensor CDE 3 komplett mit Sensorkappe, Schutzkappe und Klemmring.
– Typ CDE 3-mA-0,5 ppm.
1 Flasche Elektrolyt.
1 Betriebsanleitung.
1 Schraubendreher.
8
Page 9
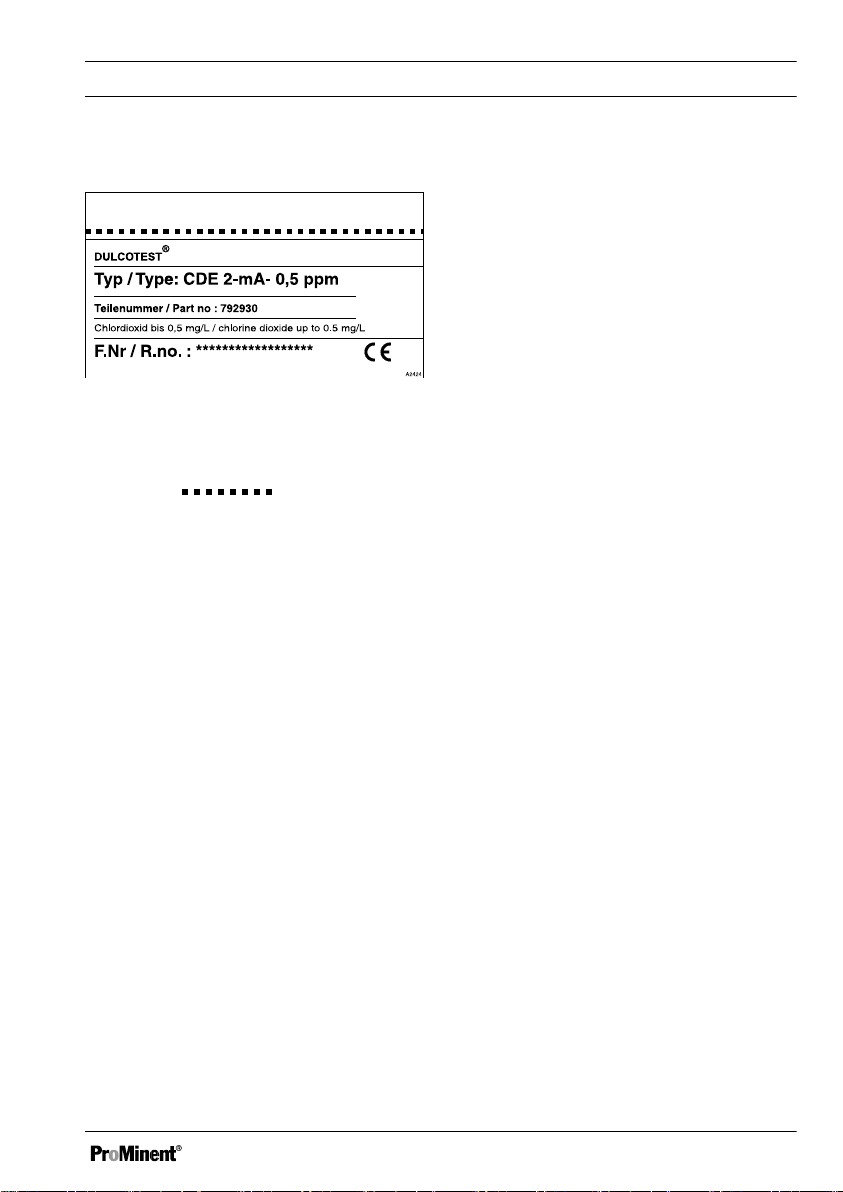
Der erste Überblick
Typenschild
Abb. 1: Typenschild auf Sensorschaft und Ver‐
packung
Das Typenschild gibt Ihnen Auskunft über:
n Symbol zur Zuordnung des
Sensors zum richtigen Elektrolyten
n Produktgruppe, hier DULCOTEST
n Typ, hier z. B. CDE 2-mA-0,5 ppm
n Teilenummer
n Messgröße, hier Chlordioxid (ClO2)
n Obere Messbereichsgrenze in mg/L
n F.Nr. = Fertigungscharge
n CE-Kennzeichnung
Das Typenschild befindet sich sowohl auf dem
Sensorschaft als auch auf der Verpackung des
Sensors.
Sensor und Verpackung lassen sich durch die
Kennzeichnung einander zuordnen.
®
1.1 Bestimmungsgemäße Ver‐
wendung
Sie dürfen den Sensor nur zum Bestimmen und
Regeln der Konzentrationen von Chlordioxid
(ClO2) in Wässern verwenden.
Sie dürfen den Sensor nur in tensidfreien Wäs‐
sern oder Lösungen verwenden.
Alle anderen Verwendungen oder ein Umbau
sind verboten.
Der Sensor ist kein Sicherheitsbauteil im Sinne
der DIN EN ISO 13849-1:2008-12.
Sollte es sich bei Ihrem Mess- und Regelkreis
um einen kritischen Prozess handeln, dann
liegt es in Ihrer Verantwortung diesen Prozess
abzusichern.
9
Page 10
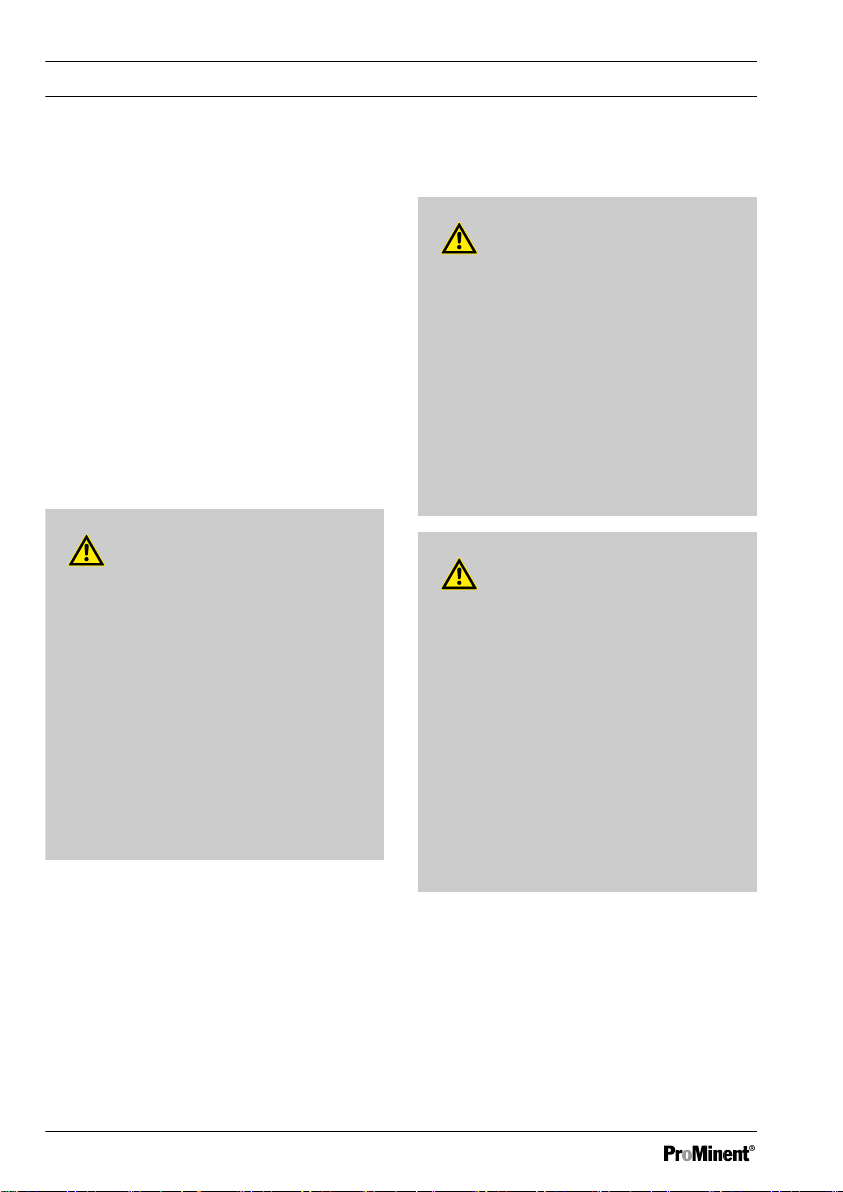
Sicherheit und Qualifikation
2 Sicherheit und Qualifikation
2.1 Kennzeichnung der Warn‐
hinweise
Einleitung
Diese Betriebsanleitung beschreibt die techni‐
schen Daten und Funktionen des Produktes.
Die Betriebsanleitung gibt ausführliche Warn‐
hinweise und ist in klare Handlungsschritte auf‐
gegliedert.
Warnhinweise und Hinweise gliedern sich nach
dem folgenden Schema. Hierbei kommen ver‐
schiedene, der Situation angepasste, Piktogr‐
amme zum Einsatz. Die hier aufgeführten Pik‐
togramme dienen nur als Beispiel.
GEFAHR!
Art und Quelle der Gefahr
Folge: Tod oder schwerste Verlet‐
zungen.
Maßnahme, die ergriffen werden muss,
um diese Gefahr zu vermeiden.
Beschriebene Gefahr
– Bezeichnet eine unmittelbar dro‐
hende Gefahr. Wenn die Situation
nicht gemieden wird, sind Tod
oder schwerste Verletzungen die
Folge.
WARNUNG!
Art und Quelle der Gefahr
Mögliche Folge: Tod oder schwerste
Verletzungen.
Maßnahme, die ergriffen werden muss,
um diese Gefahr zu vermeiden.
– Bezeichnet eine möglicherweise
gefährliche Situation. Wenn die
Situation nicht gemieden wird,
können Tod oder schwerste Ver‐
letzungen die Folge sein.
VORSICHT!
Art und Quelle der Gefahr
Mögliche Folge: Leichte oder geringfü‐
gige Verletzungen. Sachbeschädigung.
Maßnahme, die ergriffen werden muss,
um diese Gefahr zu vermeiden.
– Bezeichnet eine möglicherweise
gefährliche Situation. Wenn die
Situation nicht gemieden wird,
können leichte oder geringfügige
Verletzungen die Folge sein. Darf
auch für Warnung vor Sach‐
schäden verwendet werden.
10
Page 11
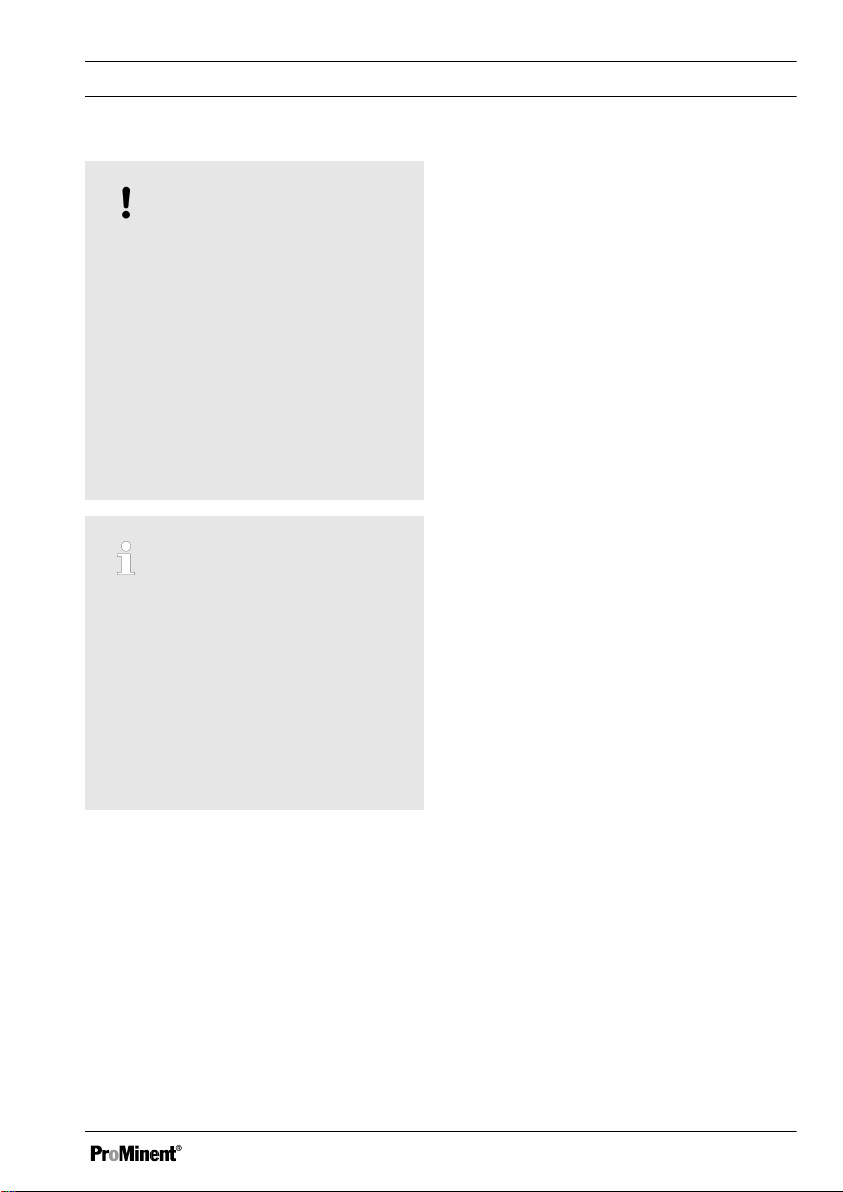
HINWEIS!
Art und Quelle der Gefahr
Schädigung des Produkts oder seiner
Umgebung.
Maßnahme, die ergriffen werden muss,
um diese Gefahr zu vermeiden.
– Bezeichnet eine möglicherweise
schädliche Situation. Wenn die
Situation nicht gemieden wird,
kann das Produkt oder etwas in
seiner Umgebung beschädigt
werden.
Art der Information
Anwendungstipps und Zusatzinforma‐
tion.
Quelle der Information. Zusätzliche
Maßnahmen.
–
Bezeichnen Anwendungstipps und
andere besonders nützliche Infor‐
mationen. Es ist kein Signalwort
für eine gefährliche oder schäd‐
liche Situation.
2.2 Allgemeine Sicherheitshin‐
weise
Unbefugter Zugriff!
Sichern Sie das Gerät gegen unbefugten
Zugriff.
Sie dürfen den Sensor nur durch hierfür ausge‐
bildetes Personal montieren, installieren,
warten und betreiben lassen.
Sicherheit und Qualifikation
Funktionseinschränkung
Prüfen Sie den Sensor regelmäßig auf Verun‐
reinigungen.
Prüfen Sie die Membrankappe regelmäßig auf
anhaftende Luftblasen (Sichtkontrolle).
Halten Sie die gültigen nationalen Vorschriften
für Pflege-, Wartungs- und Kalibrierintervalle
ein.
Betriebsvoraussetzungen
Sie dürfen den Sensor nur in Bypassarmaturen
einsetzen, die korrekte Anströmparameter (l/h,
siehe Technische Daten) sicherstellen.
Am Auslauf der Bypassarmaturen muss ein
freier Auslauf oder maximal 1 bar Gegendruck
anstehen. Beachten Sie den maximalen
Betriebsdruck der jeweiligen Einzelkompo‐
nenten.
Wenn Sie den Sensor länger als ca. eine
Woche ohne Dosiermedium im Messwasser
betreiben, dann ist eine Schädigung nicht aus‐
geschlossen. Bei längeren Pausenzeiten
müssen Sie den Sensor elektrisch ausschalten.
Nach längeren Spannungsunterbrechungen
(> 2 h) müssen Sie den Sensor wieder ein‐
laufen lassen und kalibrieren.
Sie dürfen den Sensor nicht länger als ca. eine
Woche ohne Chlordioxid betreiben, da eine
Schädigung nicht ausgeschlossen werden
kann. Bei längeren Pausezeiten müssen Sie
den Sensor elektrisch ausschalten.
11
Page 12
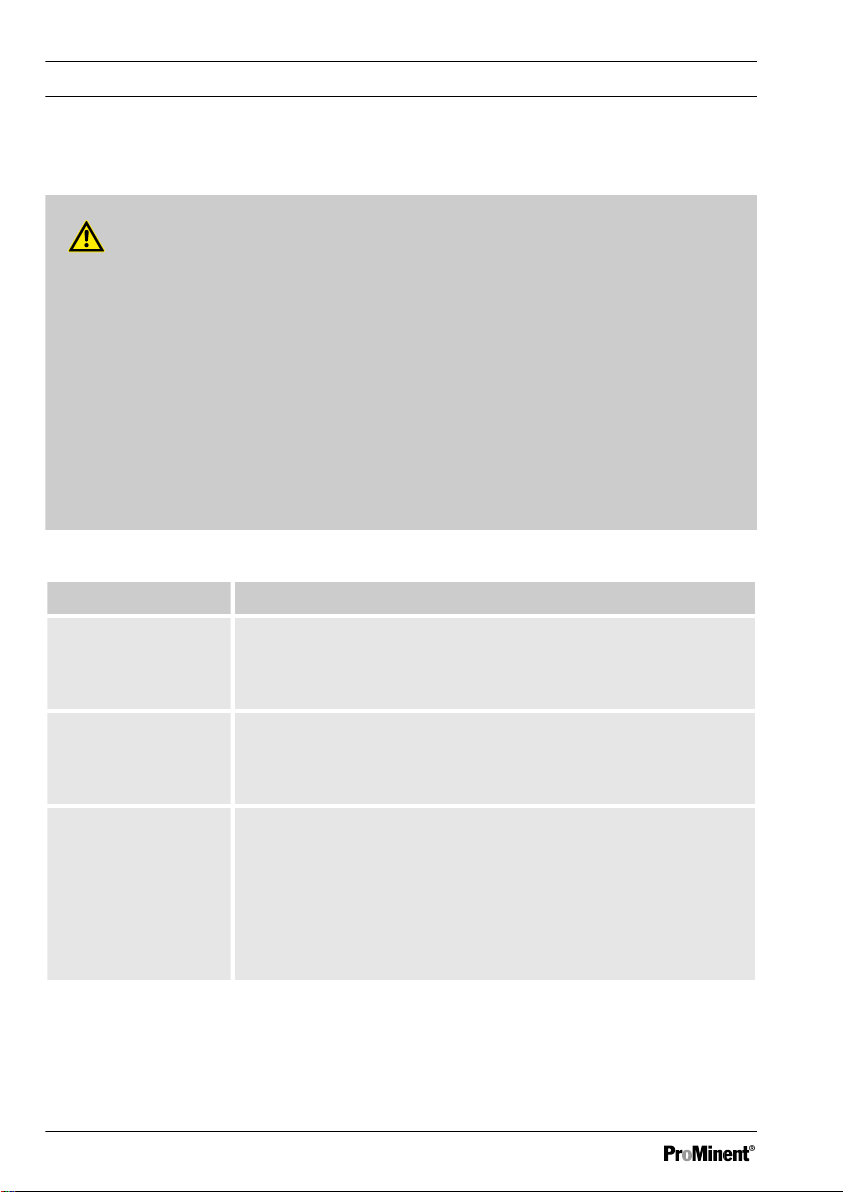
Sicherheit und Qualifikation
2.3 Benutzer-Qualifikation
WARNUNG!
Verletzungsgefahr bei unzureichender Qualifikation des Personals
Der Betreiber der Anlage/des Gerätes ist für die Einhaltung der Qualifikationen verantwort‐
lich.
Wenn unqualifiziertes Personal Arbeiten an dem Gerät vornimmt oder sich im Gefahrenbe‐
reich des Gerätes aufhält, entstehen Gefahren, die schwere Verletzungen und Sachschäden
verursachen können.
– Alle Tätigkeiten nur durch dafür qualifiziertes Personal durchführen lassen.
– Unqualifiziertes Personal von den Gefahrenbereichen fernhalten.
Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die sonstigen allgemein anerkannten
sicherheitstechnischen Regeln einhalten.
Ausbildung Definition
unterwiesene Person Als unterwiesene Person gilt, wer über die übertragenen Aufgaben und
möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet und
erforderlichenfalls angelernt, sowie über die notwendigen Schutzein‐
richtungen und Schutzmaßnahmen belehrt wurde.
geschulter Anwender Als geschulter Anwender gilt, wer die Anforderungen an eine unterwie‐
sene Person erfüllt und zusätzlich eine anlagenspezifische Schulung
bei dem Hersteller oder einem autorisierten Vertriebspartner erhalten
hat.
ausgebildete Fachkraft Als ausgebildete Fachkraft gilt, wer aufgrund seiner Ausbildung, Kennt‐
nisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestim‐
mungen die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche
Gefahren erkennen kann. Eine ausgebildete Fachkraft muss in der
Lage sein, die ihr übertragenen Arbeiten unter Zuhilfenahme von Zeich‐
nungsdokumentation und Stücklisten selbständig durchzuführen. Zur
Beurteilung der fachlichen Ausbildung kann auch eine mehrjährige
Tätigkeit auf dem betreffenden Arbeitsgebiet herangezogen werden.
12
Page 13
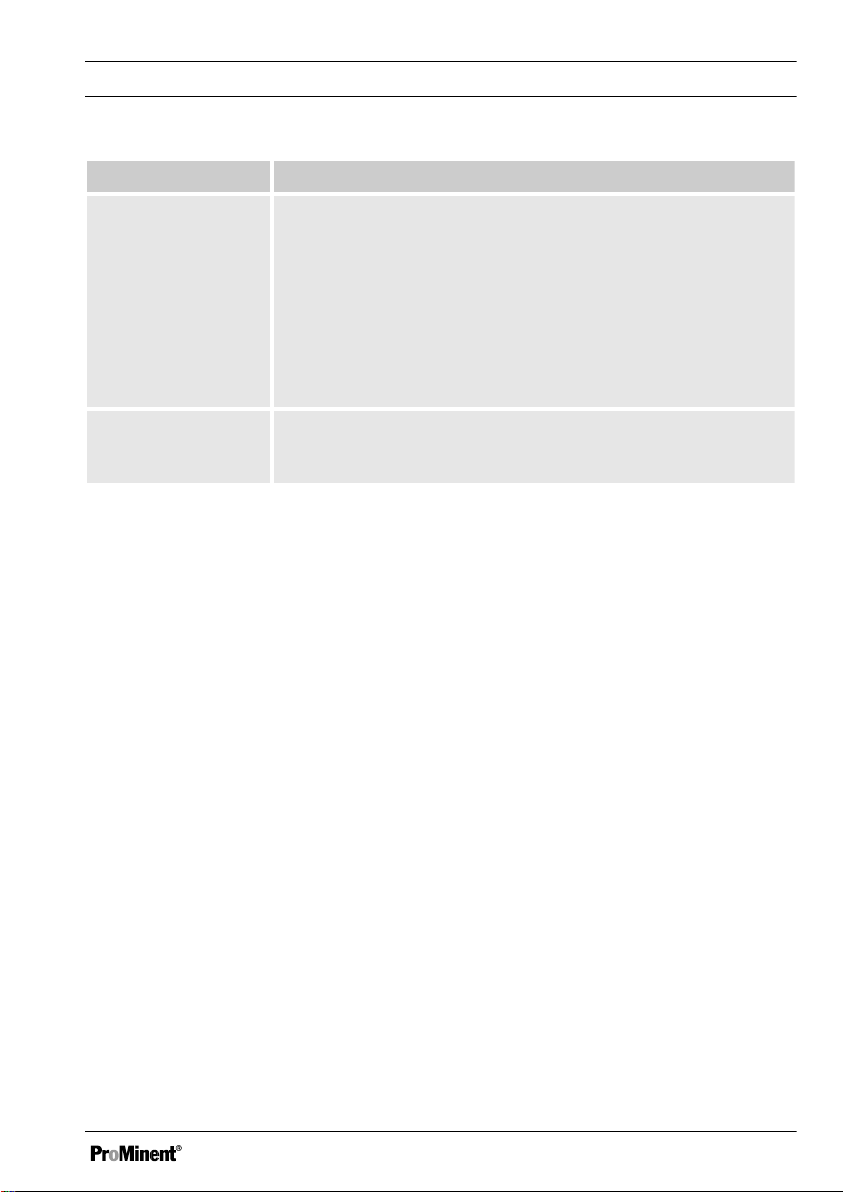
Sicherheit und Qualifikation
Ausbildung Definition
Elektrofachkraft Die Elektrofachkraft ist aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kennt‐
nisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Normen und
Bestimmungen in der Lage, Arbeiten an elektrischen Anlagen auszu‐
führen und mögliche Gefahren selbstständig zu erkennen und zu ver‐
meiden. Eine Elektrofachkraft muss in der Lage sein, die ihr übertra‐
genen Arbeiten unter Zuhilfenahme von Zeichnungsdokumentation,
Stücklisten, Klemmen- und Schaltplänen selbständig durchzuführen.
Die Elektrofachkraft ist speziell für das Arbeitsumfeld, in dem die Elekt‐
rofachkraft tätig ist, ausgebildet und kennt die relevanten Normen und
Bestimmungen.
Kundendienst Als Kundendienst gelten Servicetechniker, die von dem Hersteller für
die Arbeiten an der Anlage nachweislich geschult und autorisiert
wurden.
13
Page 14
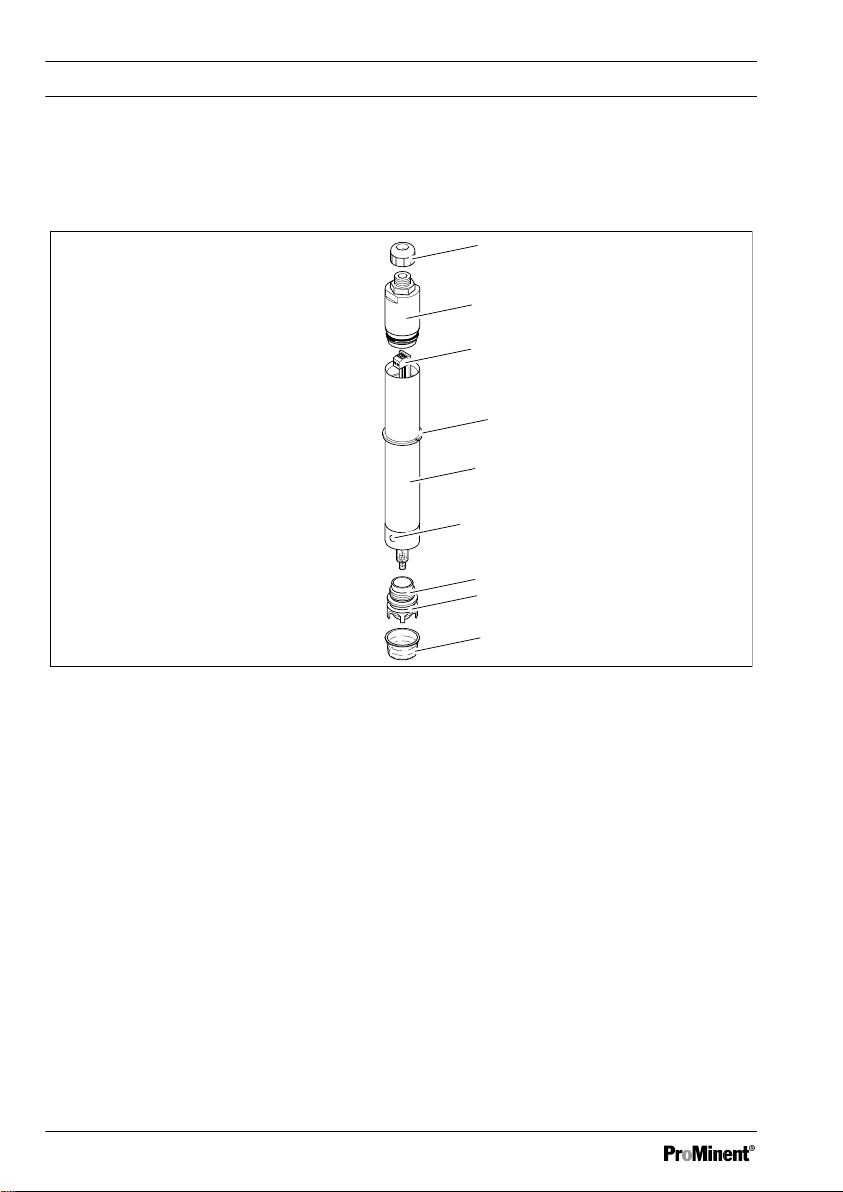
1
9
8
7
6
5
3
4
2
A2776
Aufbau und Funktion
3 Aufbau und Funktion
3.1 Aufbau
Abb. 2: Der Aufbau des Sensors
1. Kabeldurchführung M12-Verschraubung
2. Oberteil
3. 2-Leiter-Anschluss
4. Klemmscheibe
5. Elektrodenschaft
Der Sensor DULCOTEST® CDE für Chlordioxid
(ClO2) ist ein membranbedeckter Zwei-Elekt‐
roden-Sensor. Der Sensor besteht aus der
Membrankappe und dem Sensorschaft. Die mit
Elektrolyt befüllte Membrankappe stellt die
Messkammer dar. Eine in der Membrankappe
befindliche nichtporöse Membran lässt das im
Wasser gelöste Chlordioxid hindurchtreten. Die
Elektroden des Sensorschafts tauchen in die
6. Entlüftungsbohrung
7. Membrankappe
8. Schlauchdichtung
9. Membranschutzkappe
Messkammer ein. Über den Elektroden im Sen‐
sorschaft befindet sich die Verstärkerelektronik.
Darüber sitzt der elektrische Anschluss. Unten
im Sensorschaft ist der Temperatursensor für
die Temperaturkompensation integriert.
14
Page 15

3.2 Funktion
Mit dem Sensor DULCOTEST® CDE können
Sie die Konzentration von Chlordioxid (ClO2)
selektiv messen, auch in Gegenwart von freiem
Chlor. Die Querempfindlichkeit gegenüber
freiem Chlor beträgt < 2 %.
Der Sensor ist ein membranbedeckter, ampero‐
metrischer Zwei-Elektroden-Sensor.
Das Chlordioxid tritt durch die Membran hin‐
durch und wird an der Arbeitselektrode elektro‐
chemisch umgesetzt.
Das aus der Umsetzung entstehende Primär‐
stromsignal wird elektronisch verstärkt, tempe‐
raturkompensiert und als unkalibriertes 4 ... 20
mA-Signal zum Mess-/ Regelgerät übermittelt.
3.2.1 Typische Anwendungen
Typ CDE 2
Der Typ CDE 2 wird z. B. bei der Trinkwasser‐
desinfektion bzw. Wasseraufbereitung zur
Getränkeherstellung eingesetzt. In Medien, die
oberflächenentspannende Mittel (Tenside,
waschaktive Substanzen) enthalten, dürfen Sie
den Sensor nicht einsetzen. Der dauerhafte
Betrieb bei Medientemperaturen von 5 °C bis
45 °C ist möglich.
Aufbau und Funktion
Typ CDE 3
Der Typ CDE 3 wird bei der Chlordioxidbe‐
handlung von trinkwasserähnlichem Heiß‐
wasser bis 60 °C eingesetzt, z. B. zur Legionel‐
lenbekämpfung.
15
Page 16
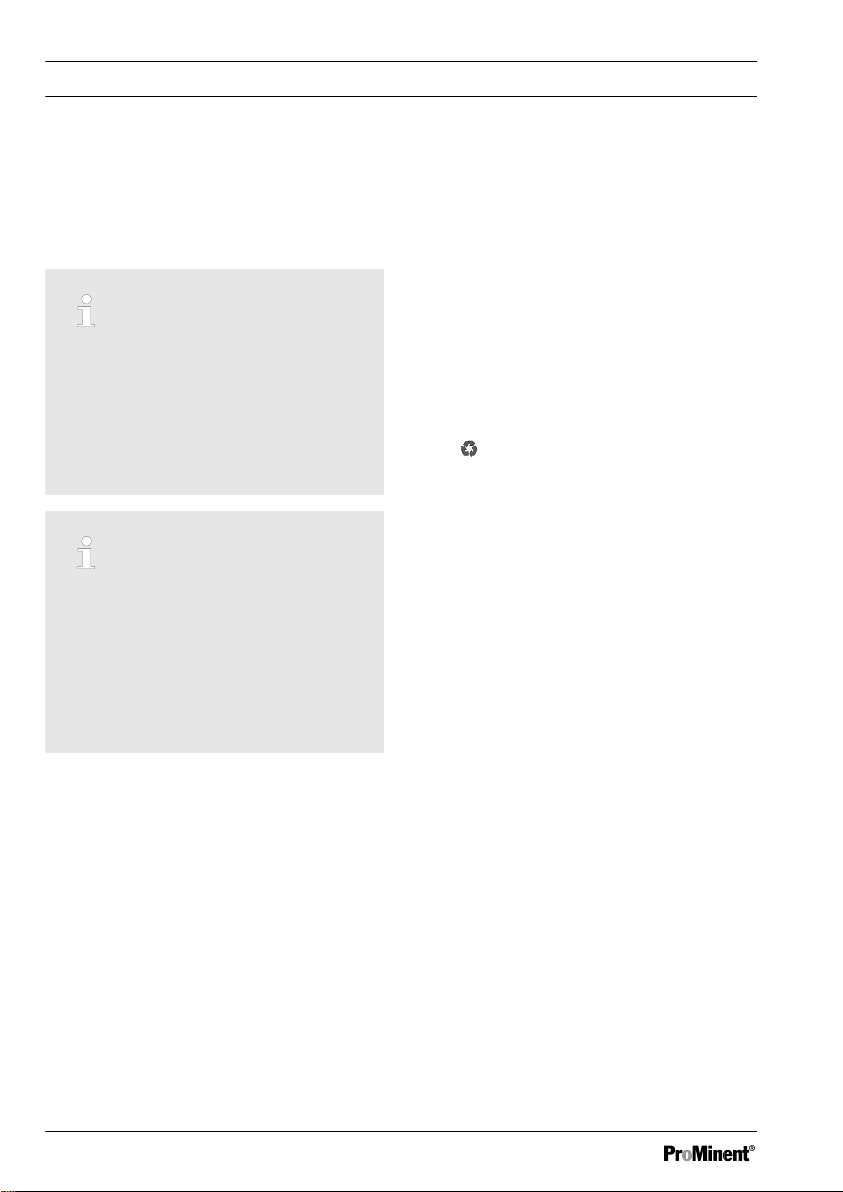
Lagern und transportieren des Sensors
4 Lagern und transportieren des Sensors
Benutzer-Qualifikation: unterwiesene Person,
siehe
Ä Kapitel 2.3 „Benutzer-Qualifikation“
auf Seite 12
Originalverpackung
Schädigung des Produkts.
–
Transportieren, versenden und
lagern Sie den Sensor in der Origi‐
nalverpackung.
–
Bewahren Sie die Verpackung mit
den Styroporteilen auf.
Maximale Lagerdauer
Schädigung des Produkts.
Bei Überlagern des Sensors schicken
Sie den Sensor zur Kontrolle oder
Überholung an den Hersteller ein.
Andernfalls ist die sichere Funktion und
die Messgenauigkeit des Sensors nicht
mehr sicher gestellt.
4.2 Transport
Der Transport sollte in der Originalverpackung
und innerhalb der zulässigen Umweltbedin‐
gungen erfolgen. Weitere Besonderheiten sind
beim Transport nicht zu beachten.
4.3 Verpackungsmaterial
Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial
umweltgerecht. Alle Komponenten der Verpa‐
ckung sind mit dem entsprechenden RecyclingCode versehen.
4.1 Lagern
Zulässige Umgebungstemperatur: +5 °C ... +50
°C.
Feuchtigkeit: maximal 90 % relative Luftfeuch‐
tigkeit, nicht kondensierend.
Sonstige: Kein Staub, kein direktes Sonnen‐
licht.
Maximale Lagerdauer des Sensors in der Origi‐
nalverpackung und normaler Atmosphäre: 2
Jahre.
16
Page 17
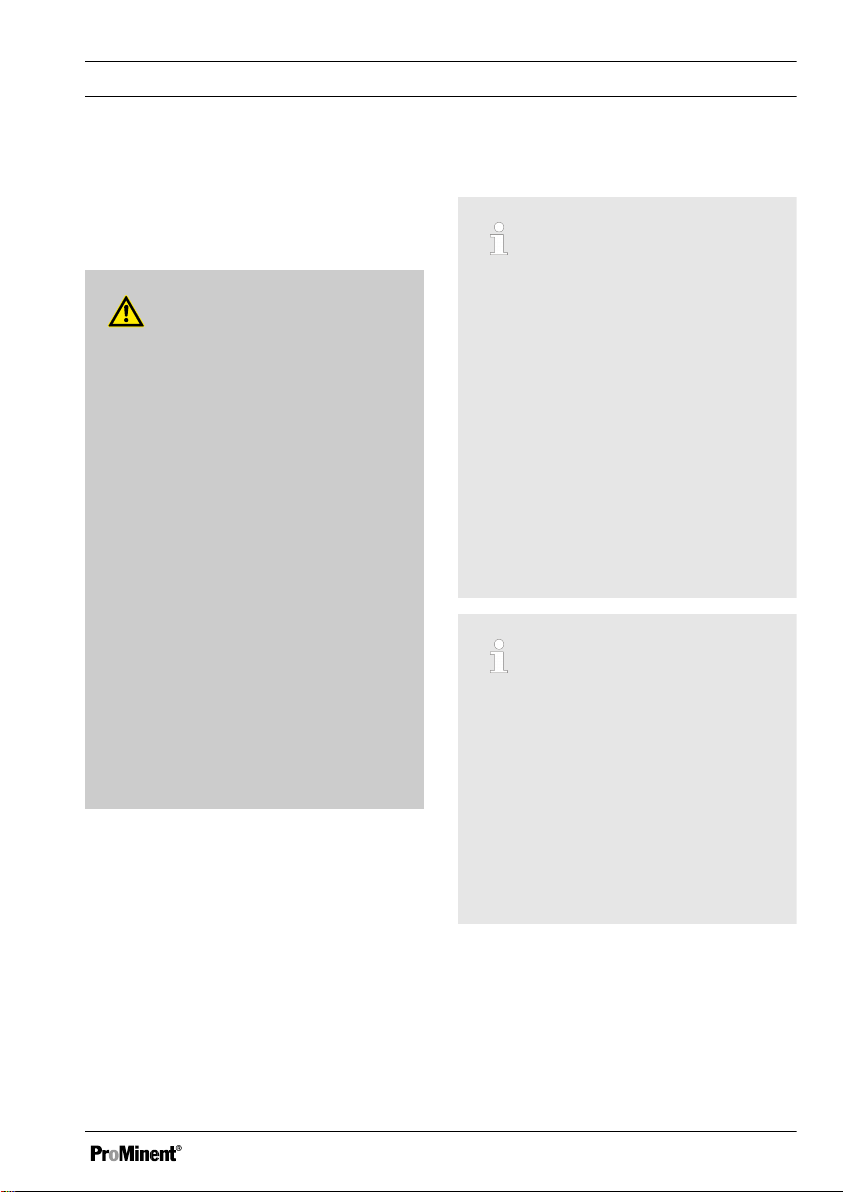
5 Montieren
n Benutzer-Qualifikation: geschulter
Anwender, siehe
Qualifikation“ auf Seite 12
WARNUNG!
Gefährdung durch einen Gefahrstoff!
Mögliche Folge: Tod oder schwerste
Verletzungen.
Beachten Sie beim Umgang mit
Gefahrstoffen, dass die aktuellen
Sicherheitsdatenblätter der GefahrstoffHersteller vorliegen. Die notwendigen
Maßnahmen ergeben sich aus dem
Inhalt des Sicherheitsdatenblatts. Da
aufgrund neuer Erkenntnisse, das
Gefährdungspotenzial eines Stoffes
jederzeit neu bewertet werden kann, ist
das Sicherheitsdatenblatt regelmäßig
zu überprüfen und bei Bedarf zu
ersetzen.
Für das Vorhandensein und den aktu‐
ellen Stand des Sicherheitsdatenblatts
und die damit verbundene Erstellung
der Gefährdungsbeurteilung der betrof‐
fenen Arbeitsplätze ist der Anlagenbe‐
treiber verantwortlich.
Ä Kapitel 2.3 „Benutzer-
Montieren
Elektrolyt
–
Der Elektrolyt ist oxidationsemp‐
findlich: Halten Sie die Elektrolyt‐
flasche nach Gebrauch stets ver‐
schlossen.
–
Füllen Sie den Elektrolyten nicht in
andere Gefäße um.
–
Der Elektrolyt darf nicht überlagert
sein, Haltbarkeitsdatum, siehe Eti‐
kett auf der Elektrolytflasche.
–
Füllen Sie den Elektrolyt möglichst
blasenfrei ein. Kleinere Luftblasen
stören nicht, größere Luftblasen
steigen zum oberen Rand der
Membrankappe und beeinflussen
die Messung.
Membrankappe und die Elek‐
troden nicht berühren
Sie dürfen die Membran der Membran‐
kappe und die Elektroden unten am
Sensor nicht berühren, beschädigen
oder mit fettigen Substanzen in Berüh‐
rung bringen. Der Sensor arbeitet sonst
nicht mehr genau. In diesem Fall,
ersetzen Sie die Membrankappe durch
eine neue Membrankappe oder schi‐
cken Sie den Sensor zum Reinigen der
Elektroden zum Hersteller.
17
Page 18

A2723
Montieren
5.1 Herstellen des Elektrolyten
Stellen Sie den gebrauchsfähigen Elektrolyten aus den mitgelieferten Set zur Herstellung des Elekt‐
rolyten selbst her. Diese einzelnen Komponenten gelten im Gegensatz zum gebrauchsfähigen
Elektrolyten nicht als Gefahrgut. Befolgen Sie folgende Arbeitsschritte.
1 Set zur Herstellung des Elektrolyten:
n 1 Flasche Grundelektrolyt,
n 1 Röhrchen mit Pulver,
n 1 Etikett für den hergestellten Elektrolyten.
Abb. 3: Herstellen des Elektrolyten
1. Schützen Sie sich mit geeigneten Mitteln wie z. B. Schutzhandschuhen und Schutzbrille (1),
laut Sicherheitsdatenblatt der Komponenten.
2. Öffnen Sie die Flasche des Grundelektrolyten und das Röhrchen mit Pulver (2).
3. Führen Sie das Röhrchen in Schräglage vollständig in die Öffnung der Flasche des Grunde‐
lektrolyten ein (3).
4. Überführen Sie das Pulver vollständig in die Flasche des Grundelektrolyten (4).
5. Verschließen Sie die Flasche. und schütteln Sie die Flasche bis sich das Pulver vollständig
aufgelöst hat, ≧ 10 Sekunden (5).
Es dürfen im Elektrolyten keine Feststoffe und Schlieren sichtbar sein.
ð
6. Entfernen (6) Sie das Etikett des Grundelektrolyten.
7. Ersetzen (7) Sie das Etikett durch das mitgelieferte Etikett.
Jetzt können Sie den hergestellten Elektrolyten verwenden (8).
ð
18
Page 19
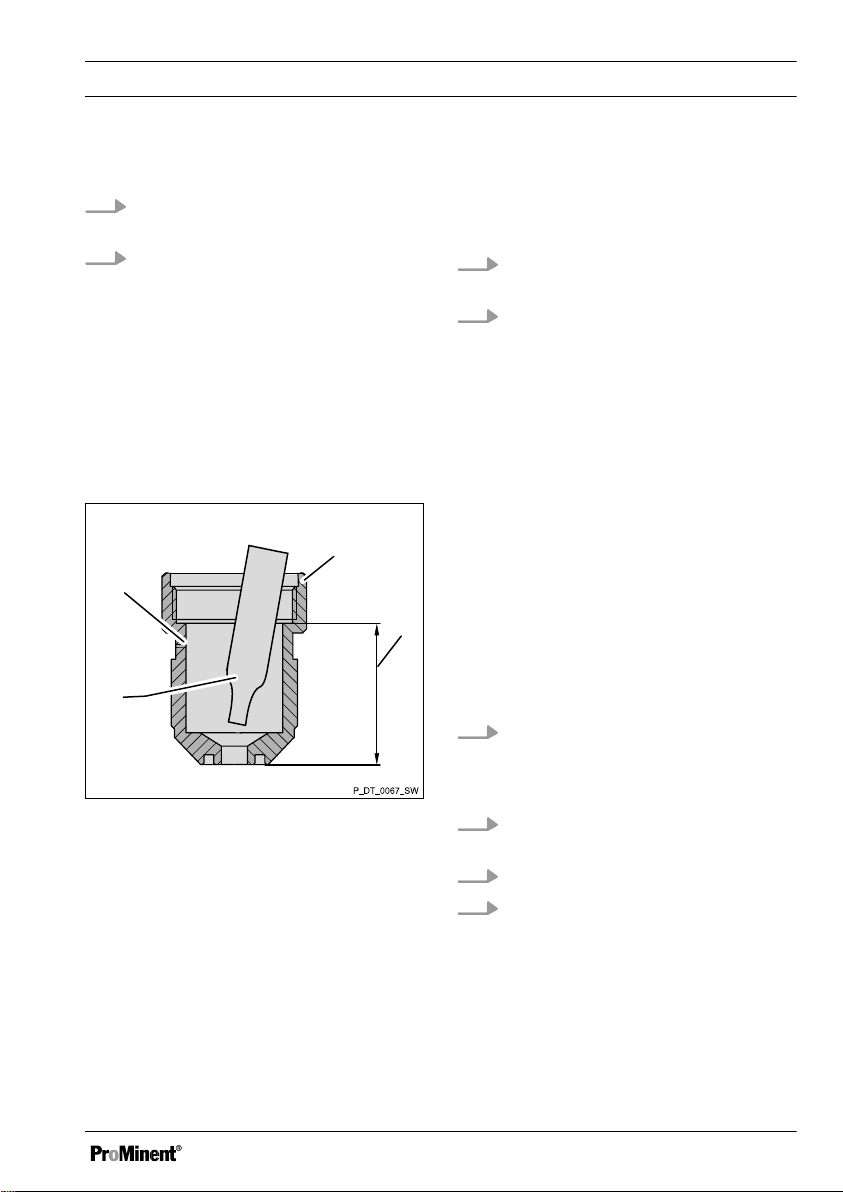
3
4
2
1
Montieren
5.2 Elektrolyt einfüllen
1. Öffnen Sie die Elektrolyt-Flasche und
schrauben Sie die Tülle auf.
2. Füllen Sie den Elektrolyt möglichst bla‐
senfrei ein.
Setzen Sie die Elektrolyt-Flasche auf die
Membrankappe auf und drücken Sie
den Elektrolyten langsam in einem Zug
aus der Elektrolyt-Flasche, ziehen Sie
dabei die Elektrolyt-Flasche gleichmäßig
zurück.
Die Membrankappe ist komplett
ð
gefüllt, wenn die Membrankappe
randvoll mit dem Elektrolyt ist.
Abb. 4: Elektrolytfüllung
1 Membrankappe
2 Elektrolyt Füllhöhe
3 Pipette
4 Entlüftungsbohrung
3. Setzen Sie den Sensor senkrecht auf
die gefüllte Membrankappe auf.
4. Halten Sie die Entlüftungsbohrung nicht
mit z. B. den Fingern zu, sonst kann
sich bei dem Zusammenschrauben
Druck aufbauen und die Membran
beschädigt werden.
Beim Zusammenschrauben muss über‐
schüssiger Elektrolyt durch die Entlüf‐
tungsbohrung unter der Schlauchdich‐
tung entweichen können. Die
Entlüftungsbohrung muss hierbei den
höchsten Punkt bilden um ein zuverläs‐
siges Entweichen der Luft zu ermögli‐
chen.
Wenn beim Zusammenschrauben
ð
kein Elektrolyt entweicht, dann ist
die Membrankappe nicht ausrei‐
chend gefüllt gewesen. Wieder‐
holen Sie den Vorgang und füllen
Sie die Membrankappe vollständig.
5. Drehen Sie die Membrankappe von
Hand bis zum Anschlag ein, so dass
kein freier Spalt zwischen Membran‐
kappe und Sensor zu sehen ist.
6. Spülen Sie den ausgetretenen Elektrolyt
mit sauberen Wasser ab.
7. Verschließen Sie die Elektrolyt-Flasche.
8. Spülen Sie mit einem Wasserstrahl den
Elektrolyt von der Tülle der ElektrolytFlasche ab.
Der Sensor ist nun fertig für den
ð
Einbau in die Bypassarmatur.
19
Page 20
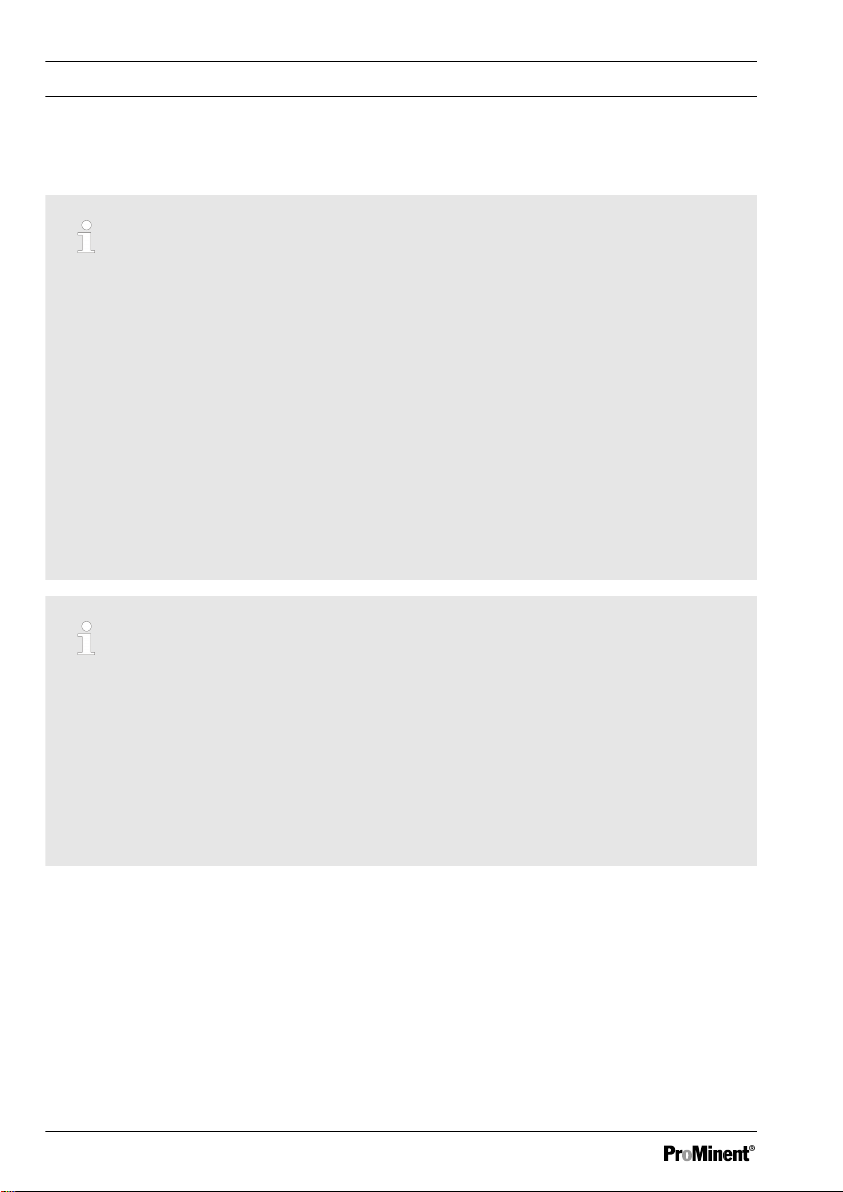
Montieren
5.3 Sensor in die Bypassarmatur einbauen
Mindestdurchfluss (l/h)
Den Mindestdurchfluss (l/h, siehe Technische Daten) nicht unterschreiten:
–
Überwachen Sie den Durchfluss am angeschlossenen Regler. Wird der Messwert des
Durchflusses zur Regelung verwendet, muss die Regelung bei Unterschreitung der
Mindestdurchflussmenge abschalten bzw. auf Grundlast schalten.
–
Den Sensor nur in Bypassarmaturen vom Typ DLG III A , DLG III B oder im DGM
(Modul 25 mm) einsetzen. Bei Verwendung anderer Bypassarmaturen sind die Messer‐
gebnisse vor der Inbetriebnahme, durch geeignete Messmethoden, zu überprüfen.
–
Vermeiden Sie Installationen, die Luftblasen im Messwasser entstehen lassen.
–
An der Membran des Sensors haftende Luftblasen können einen zu geringen
Messwert verursachen. Ein zu geringer Messwert kann in einem Regelkreis zu
einer falscher Dosierung führen.
Beachten Sie auch die Anweisungen und Sicherheitshinweise der Betriebsanleitung der
Bypassarmatur.
Einbauhinweise
Bauen Sie den Sensor nicht in eine vollständig geschlossene Armatur ein. Wenn kein freier
Auslauf vorhanden ist, dann öffnen Sie den Probenahmehahn.
–
Sie dürfen den Sensor nur langsam in die Bypassarmatur einschieben bzw. heraus‐
ziehen. Die Membran kann sonst beschädigt werden.
–
Sie dürfen die Membran mit keinem Gegenstand in Berührung bringen um eine Schädi‐
gung und Belegung der Membran zu vermeiden.
–
Sie müssen den Sensor nach der Inbetriebnahme immer feucht halten, z. B. darf die
Bypassarmatur nie trockenlaufen.
20
Page 21
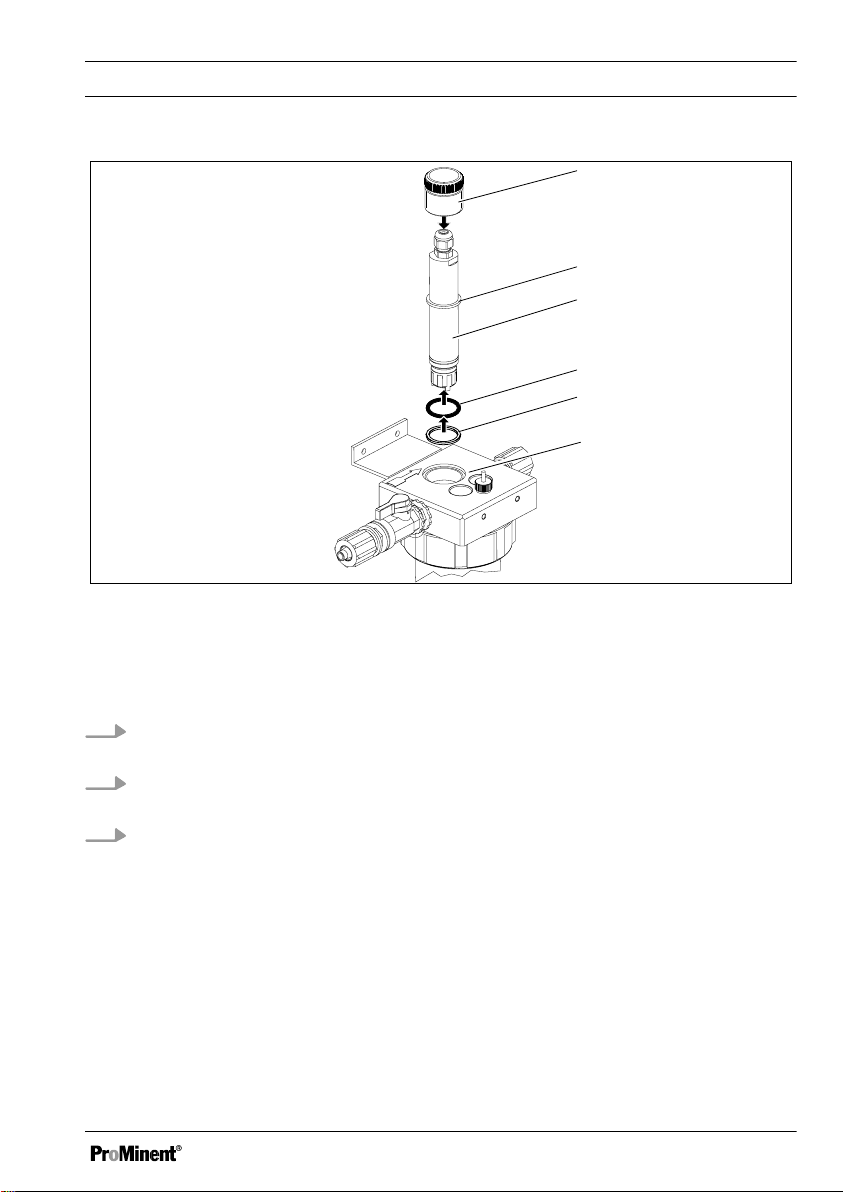
A0645
1
2
3
4
5
6
Abb. 5: Einbausituation
1. Gewindehülse.
2. Klemmscheibe.
3. Sensor.
Montieren
4. O-Ring.
5. Unterlegscheibe.
6. Bypassarmatur z. B. DLG.
1. Schieben Sie den im Montage-Kit befindlichen O-Ring (4) und die Unterlegscheibe (5) von
unten über den Sensor bis zur Klemmscheibe (2).
2. Bypassarmatur DLG III: Führen Sie den Sensor in den DLG III ein und ziehen Sie den
Gewindestopfen fest.
3. Bypassarmatur DGM: Führen Sie den Sensor in den DGM ein und ziehen Sie die Klemm‐
schraube fest an, bis der O-Ring abdichtet.
Die richtige Einbautiefe des Sensors ist durch die Klemmscheibe festgelegt. Bei einer
ð
Bypassarmatur eines anderen Herstellers beachten Sie zusätzlich die Betriebsanleitung
des jeweiligen Bypassarmatur-Herstellers.
21
Page 22
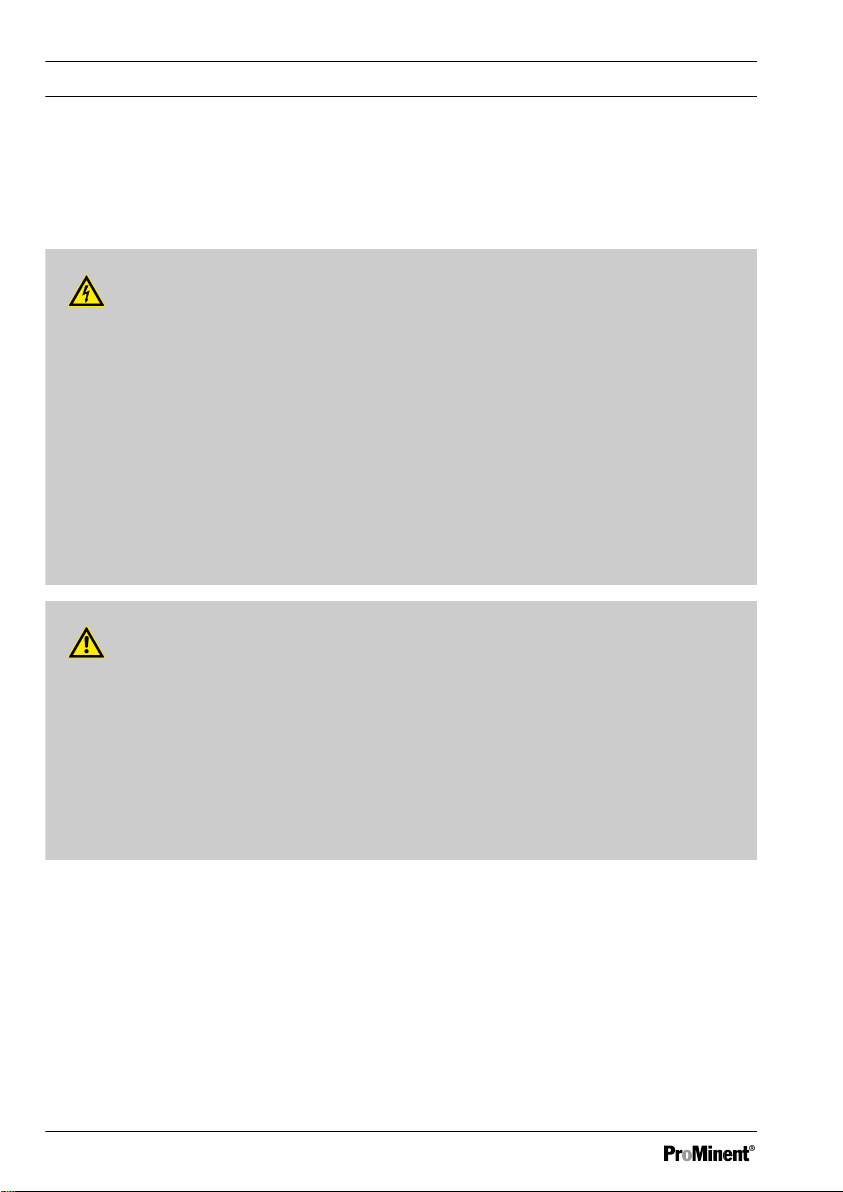
Installieren
6 Installieren
n Benutzer-Qualifikation: ausgebildete Fachkräfte bzw. Elektrofachkraft,
Qualifikation“ auf Seite 12
WARNUNG!
Anschluss des Sensors an Fremdgeräte
Mögliche Folge: Tod oder schwerste Verletzungen
– Das angeschlossene Mess/Regelgerät muss vom Sensor galvanisch getrennt sein.
– Die Versorgungsspannung 16 V DC darf nicht unterschritten werden, auch nicht kurz‐
zeitig.
– Die Stromquelle muss mit min. 35 mA bei min. 16 V DC belastbar sein.
– Eine zu geringe Versorgungsspannung kann einen fehlerhaften Messwert verursa‐
chen.
Bei dem Anschluss des Sensors an ein Mess/Regelgerät von ProMinent sind die Anforde‐
rungen erfüllt.
VORSICHT!
Fehldosierung
Mögliche Folge: Leichte oder geringfügige Verletzungen. Sachbeschädigung.
– Schalten Sie bei Intervallbetrieb das Mess/Regelgerät nicht ab.
– Schalten Sie die Dosiervorrichtungen (z. B. Pumpen) eventuell zeitverzögert zu.
– Das zu messende Wasser muss immer das entsprechende Dosiermedium in ausrei‐
chender Menge enthalten.
– Ansonsten müssen Sie mit verlängerten Einlaufzeiten rechnen.
Ä Kapitel 2.3 „Benutzer-
22
Page 23
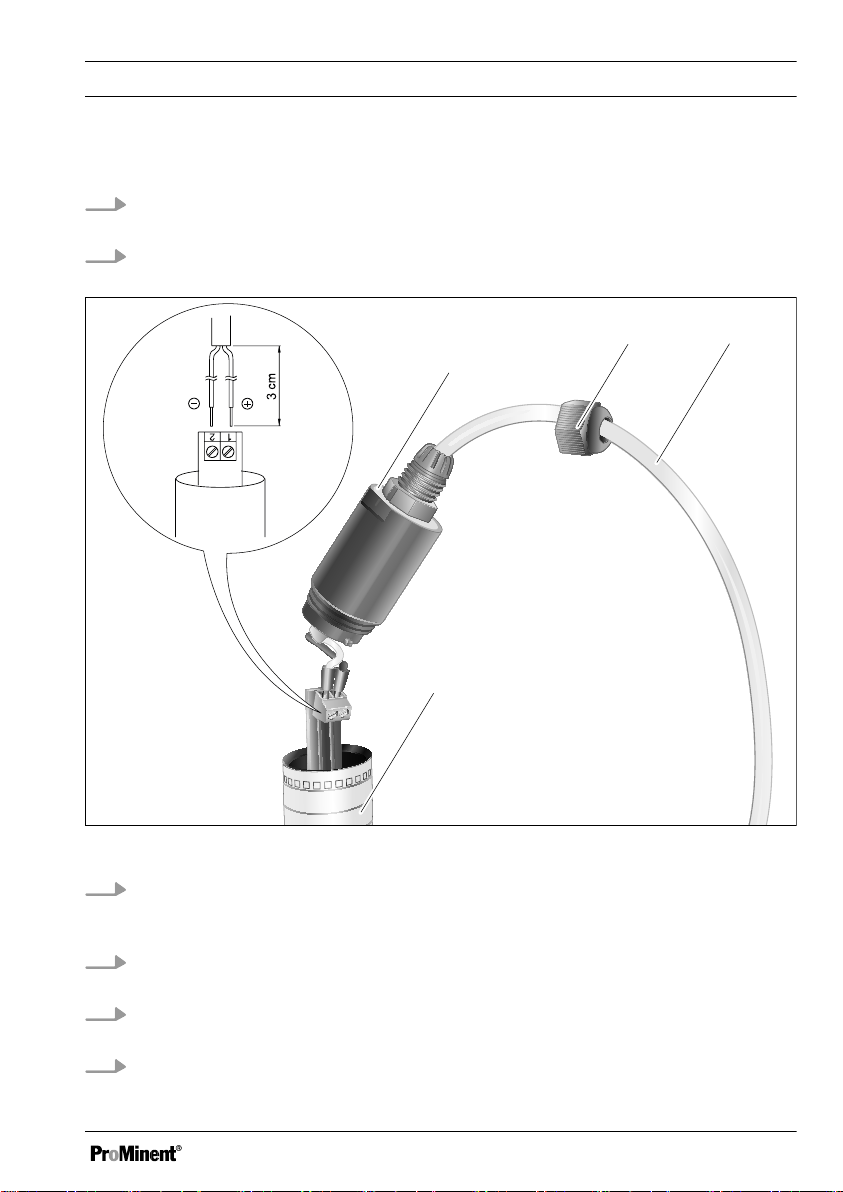
1
2
A2419
2 3
1
4
Installieren
Elektrische Installation
1. Drehen Sie das Oberteil (1) des Sensors eine Viertelumdrehung gegen den Uhrzeigersinn
und ziehen Sie das Oberteil ab.
2. Lösen Sie die Klemmmutter (2) der M12-Verschraubung und führen Sie die Messleitung (3)
durch die Klemmmutter.
Abb. 6: 2-Leiter-Anschluss
3. Entfernen Sie den Kabelmantel auf einer Länge von ca. 30 mm. Isolieren Sie die Kabelenden
ca. 5 mm ab, versehen Sie die Kabelenden mit Aderendhülsen (⌀ max = 0,5 mm2) und ver‐
binden Sie die Kabelenden mit dem 2-Leiter-Anschluss: 1 = Plus, 2 = Minus.
4. Schieben Sie das Oberteil des Sensors ganz auf den Sensorschaft (4) und ziehen Sie das
Oberteil des Sensors im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag an.
5. Schieben Sie die Messleitung so weit wie möglich in das Oberteil des Sensors, zur Zugent‐
lastung.
6. Ziehen Sie die Klemmmutter (2) der M12-Verschraubung fest.
23
Page 24
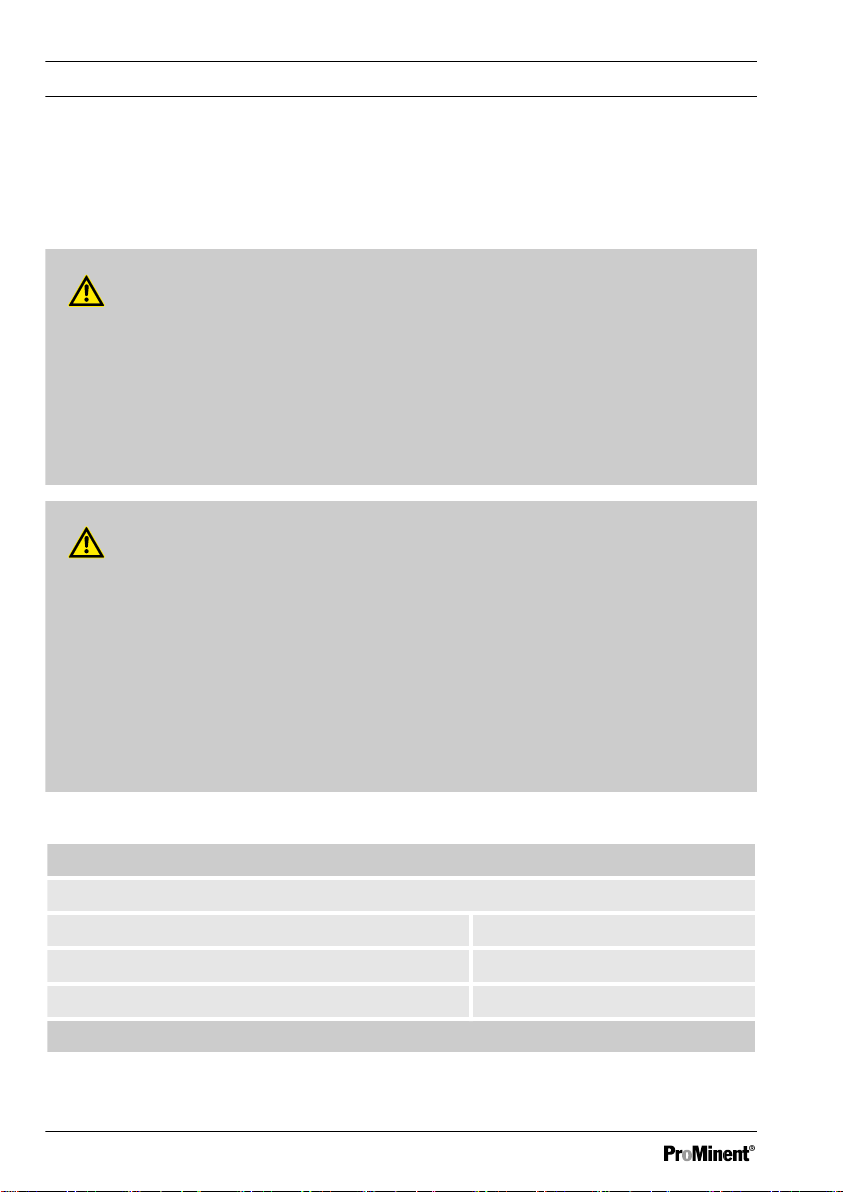
Inbetriebnahme
7 Inbetriebnahme
n Benutzer-Qualifikation: geschulter Anwender,
auf Seite 12
VORSICHT!
Fehldosierung durch Sensorausfall
Mögliche Folge: Leichte oder geringfügige Verletzungen. Sachbeschädigung.
– Bei einem Sensorausfall kann ein falscher Messwert am Eingang des Mess-/Regelge‐
räts anstehen.
– Dieser falsche Messwert kann zu unkontrollierter Dosierung führen.
– Stellen Sie deshalb betreiberseitig sicher, dass keine Folgeschäden entstehen können.
VORSICHT!
Fehldosierung durch vorzeitige Sensoralterung
Mögliche Folge: Leichte oder geringfügige Verletzungen. Sachbeschädigung.
Maßnahme: Den Sensor in Messpausen nicht von der Spannungsversorgung trennen.
Ausnahme: Wenn die Messpause länger als eine Woche dauert und fällt der Anteil an Des‐
infektionsmittel im Messwasser in diesem Zeitraum auf 0 ppm zurück, dann müssen Sie den
Sensor elektrisch trennen.
– Nach Betrieb ohne Desinfektionsmittel ist mit einer erneuten Einlaufzeit zu rechnen.
Schalten Sie die Dosiervorrichtung eventuell zeitverzögert zu.
Ä Kapitel 2.3 „Benutzer-Qualifikation“
Einlaufzeit
Um einen stabilen Anzeigewert anzuzeigen, benötigt der Sensor eine bestimmte Einlaufzeit.
Bei der Erstinbetriebnahme: 1 ... 24 h (Ø 6 h)*
Bei der Wiederinbetriebnahme: 1 ... 24 h (Ø 3 h)*
Bei der Elektrolyt- oder Membranwechsel: 0,5 h
* die genaue Einlaufzeit wird durch die Applikation bestimmt.
24
Page 25

7.1 Kalibrieren
Kalibrieren bei erhöhter Wasser‐
temperatur
Chlordioxid ist im Wasser im Gegen‐
satz zu Chlor nur physikalisch gelöst.
Chlordioxid gast bei erhöhten Tempera‐
turen (> 30 °C) sehr schnell aus dem
Wasser aus. Daher ist schnelles
Arbeiten bei der DPD-Messung not‐
wendig. Zwischen der Probenentnahme
und dem Versetzen mit Reagenzien
darf keinesfalls mehr als 1 Minute
liegen. Der rote Farbstoff ist direkt am
Probeentnahmeort durch Reagenzzu‐
gabe zu erzeugen. Dann ist schnellst‐
möglich am Probeentnahmeort mit
einem geeigneten Fotometer die Mes‐
sung durchzuführen.
Inbetriebnahme
VORSICHT!
– Nach einem Membrankappen-
oder Elektrolytwechsel müssen
Sie einen Steilheitsabgleich durch‐
führen.
– Für eine einwandfreie Funktion
des Sensors müssen Sie den
Steilheitsabgleich in regelmäßigen
Abständen wiederholen. Die Kalib‐
rierintervalle betragen je nach
Wasserqualität 3 ... 4 Wochen.
– Vermeiden Sie Luftblasen im
Messwasser. Luftblasen können
eine falsche Dosierung verursa‐
chen. So können an der Membran
des Sensors haftende Luftblasen
einen zu geringen Messwert verur‐
sachen und somit zu einer Über‐
dosierung führen.
– Beachten Sie die gültigen natio‐
nalen Vorschriften für Kalibrierin‐
tervalle.
Voraussetzungen:
–
Konstanter Durchfluss in der
Bypassarmatur.
–
Konstante Temperatur des Mess‐
wassers.
–
Gleiche Temperatur von Mess‐
wasser und Sensor (ca. 15
Minuten warten).
–
Der Sensor ist eingelaufen.
–
Konstanter pH-Wert.
25
Page 26

Inbetriebnahme
Nullpunktabgleich:
Wenn der Sensor an einem Mess-/Regelgerät
von ProMinent betrieben wird, dann ist ein Null‐
punktabgleich in der Regel nicht notwendig.
Machen Sie aber einen Nullpunktabgleich,
wenn Sie den Sensor an der unteren Messbe‐
reichsgrenze einsetzen.
1. Tauchen Sie den Sensor in einen Eimer
mit sauberem Wasser ohne Desinfek‐
tions- oder Oxidationsmittel (z. B. han‐
delsübliches stilles Mineralwasser).
2. Rühren Sie mit dem Sensor bis der
Messwert am Mess-/Regelgerät 5
Minuten stabil bleibt.
3. Gleichen Sie das Mess-/Regelgerät auf
Null ab, entsprechend der Betriebsanlei‐
tung des Mess-/Regelgeräts.
4. Bauen Sie den Sensor wieder in die
Bypassarmatur (z. B. DGMA; DLG III)
ein.
Steilheitsabgleich:
1. Ermitteln Sie den Desinfektionsmittelge‐
halt des Messwassers mit einem geeig‐
neten Messbesteck (z. B. DPD 1).
2. Stellen Sie den ermittelten Wert am
Mess-/Regelgerät ein, entsprechend der
Betriebsanleitung des Mess-/Regelge‐
räts.
3. Wiederholen Sie die Kalibrierung nach
einem Tag, um sicher zu gehen, dass
der Sensor seine maximale Empfindlich‐
keit (Steilheit) erreicht hat.
26
Page 27

Störungen, Fehlersuche und Fehlerbeseitigung
8 Störungen, Fehlersuche und Fehlerbeseitigung
Benutzer-Qualifikation: unterwiesene Person, siehe
auf Seite 12
Tab. 4: Hinweise zur Fehlersuche und Beseitigung
Fehler mögliche Ursache Abhilfe
Ä Kapitel 2.3 „Benutzer-Qualifikation“
Der Sensor nicht ist
kalibrierbar und der
Messwert des Sen‐
sors ist größer als
die DPD-Messung.
Der Sensor ist nicht
kalibrierbar und der
Messwert des Sen‐
sors ist kleiner als
die DPD-Messung.
Einlaufzeit zu gering. Einlaufzeit beachten.
Membrankappe beschädigt. Membrankappe austauschen.
Störende Wasserinhaltsstoffe. Wasser auf störende Inhaltsstoffe
untersuchen und Abhilfe schaffen.
Kurzschluss in der Messleitung. Kurzschluss suchen und beseitigen.
Abstand zwischen Membran/Elekt‐
rode zu groß.
DPD-Chemikalien überaltert. Neue DPD-Chemikalien verwenden,
pH-Wert < pH 6. pH-Wert anheben (pH 6 ... 9,5).
Einlaufzeit zu gering. Einlaufzeit beachten.
Messwasserdurchfluss zu klein. Messwasserdurchfluss korrigieren.
Luftblasen außen an der Membran. Den Messwasserdurchfluss inner‐
Tenside im Messwasser (Membran
ist durchsichtig).
Membrankappe bis zum Anschlag
zuschrauben.
Kalibrieren wiederholen.
halb des erlaubten Bereichs
erhöhen.
Tenside beseitigen und Membran‐
kappe austauschen.
Sensor einlaufen lassen und kalib‐
rieren; evtl. Sensor Typ CDP ver‐
wenden.
Beläge haben die Membran ver‐
stopft.
Beläge auf der Membrankappe.
Kein Elektrolyt in der Membran‐
kappe.
27
Membrankappe austauschen,
Sensor einlaufen lassen und kalib‐
rieren.
Neuen Elektrolyten einfüllen.
Page 28

A2420
1
2
Störungen, Fehlersuche und Fehlerbeseitigung
Fehler mögliche Ursache Abhilfe
Der Messwert des
Sensors ist 0 ppm
und eine Fehlermel‐
dung am
Mess-/Regelgerät
erscheint.
Der Messwert des
Sensors ist instabil.
Referenzelektrode (2) verbraucht
(zeigt glänzende Stellen).
Sensor mit falscher Polung an das
Mess-/Regelgerät angeschlossen.
Sensor zum Regenerieren ein‐
senden.
Sensor richtig an das Mess-/Regel‐
gerät anschließen.
Messleitung gebrochen. Messleitung austauschen.
ClO2-Gehalt unterhalb der unteren
Messbereichsgrenze.
ClO2-Gehalt anheben und anschlie‐
ßend Kalibrierung wiederholen bzw.
geeigneten Sensor verwenden.
Sensor defekt. Sensor zum Regenerieren ein‐
senden.
Mess-/Regelgerät defekt. Mess-/Regelgerät mit Sensor-Simu‐
lator überprüfen (DULCOMETER
®
Simulator, Bestnr. 1004042), wenn
defekt, dann reparieren.
Membran beschädigt. Membrankappe austauschen;
Sensor einlaufen lassen und kalib‐
rieren.
Luftblasen außen an der Membran. Luftblasen durch Klopfen entfernen
und ggf. Durchfluss erhöhen.
Ursache am Mess-/Regelgerät . Ursache beheben.
Abb. 7: Elektroden
1 Arbeitselektrode (Material: Gold).
2 Gegen- und Referenzelektrode (Material: Silber mit Silberchlorid galvanisch beschichtet).
28
Page 29

Wartungs- und Reparaturarbeiten am Sensor
9 Wartungs- und Reparaturarbeiten am Sensor
Benutzer-Qualifikation: unterwiesene Person,
siehe
Ä Kapitel 2.3 „Benutzer-Qualifikation“
auf Seite 12
Wartungsintervall:
Warten Sie den Sensor regelmäßig, um eine
Überdosierung durch einen Sensorausfall zu
vermeiden.
Beachten Sie die gültigen nationalen Vor‐
schriften für Wartungsintervalle.
Abhängig von der Wasserqualität wöchentlich
bis monatlich.
Membran reinigen:
Wenn die Membran verunreinigt ist und sich
der Sensor nicht kalibrieren lässt, können Sie
versuchen die Membran vorsichtig zu reinigen.
Bauen Sie zuerst den Sensor aus. Locker haft‐
ende Verschmutzungen entfernen:
Spülen Sie die Membran unter einem
Wasserstrahl.
Nun müssen Sie den Sensor mit
ð
Elektrolyt befüllen, einlaufen lassen
und neu kalibrieren.
VORSICHT!
– Berühren Sie die Elektroden nicht
oder bringen Sie die Elektroden
nicht mit fetthaltigen Substanzen
in Berührung.
– Die Membran nie mit alkalischen
Lösungen, Reinigungsreagenzien,
Bürsten oder ähnlichem reinigen.
Wartungsarbeiten:
1. Überprüfen Sie die Membrankappe auf
Ablagerungen oder Luftblasen.
Falls notwendig entfernen Sie die
ð
Ablagerungen, siehe
reinigen:“ auf Seite 29
2. Überprüfen Sie den Anzeigewert des
Sensors am Mess-/Regelgerät durch ein
geeignetes Messbesteck (z. B. DPD).
Wenn nötig, kalibrieren Sie den
ð
Sensor neu.
Ä „Membran
.
Membran wechseln:
Wenn eine Kalibrierung auch nach der Reini‐
gung der Membran nicht mehr möglich ist oder
ist die Membran beschädigt, dann müssen Sie
die Membrankappe wechseln.
Siehe hierzu, Kapitel
Reparatur des Sensors:
Der Sensor kann nur im Herstellerwerk repa‐
riert werden. Senden Sie den Sensor dazu in
der Originalverpackung an den Hersteller ein.
„Kalibrieren“
.
29
Page 30

Sensor vorübergehend oder ganz außer Betrieb nehmen
10 Sensor vorübergehend oder ganz außer Betrieb nehmen
Benutzer-Qualifikation: unterwiesene Person,
siehe
Ä Kapitel 2.3 „Benutzer-Qualifikation“
auf Seite 12
1. Klemmen Sie den Sensor elektrisch ab.
2. Machen Sie die Bypassarmatur
drucklos.
3. Lösen Sie die Klemmmutter.
4. Öffnen Sie den Probenahmehahn und
ziehen Sie den Sensor langsam aus der
Bypassarmatur heraus
5. Schrauben Sie die Membrankappe ab
und entsorgen Sie die Membrankappe.
6. Spülen Sie die Elektroden mit einem
Wasserstrahl rückstandsfrei ab.
7. Trocknen Sie die Elektroden mit einem
faserfreien Tuch ab und lassen Sie die
Elektroden 24 h trocken liegen.
Schrauben Sie zum Schutz der Elekt‐
roden eine neue leere Membrankappe
locker auf.
8. Stecken Sie zum Schutz der Membran‐
kappe die Membranschutzkappe auf.
9. Lagern Sie den Sensor wie
beschrieben.
transportieren des Sensors“
auf Seite 16
Ä Kapitel 4 „Lagern und
.
30
Page 31

11 Altteileentsorgung
n Benutzer-Qualifikation: unterwiesene
Person, siehe
Qualifikation“ auf Seite 12
HINWEIS!
Vorschriften Altteileentsorgung
– Beachten Sie die zurzeit für Sie
gültigen nationalen Vorschriften
und Rechtsnormen
Der Hersteller nimmt die dekontaminierten Alt‐
geräte bei ausreichender Frankierung der Sen‐
dung zurück.
Bevor Sie das Gerät einschicken, müssen Sie
das Gerät dekontaminieren. Dazu müssen Sie
alle Gefahrenstoffe restlos entfernen. Beachten
Sie dazu das Sicherheitsdatenblatt ihres
Dosiermediums.
Eine aktuelle Dekontaminationserklärung steht
als Download auf der Homepage zur Verfü‐
gung.
Ä Kapitel 2.3 „Benutzer-
Altteileentsorgung
Hinweis auf Sammelsystem EU
Dieses Gerät ist entsprechend der europä‐
ischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und
Elektronik-Altgeräte mit dem Symbol der durch‐
gestrichenen Mülltonne gekennzeichnet. Das
Gerät darf nicht über den Hausmüll entsorgt
werden. Nutzen Sie für die Rückgabe die Ihnen
zur Verfügung stehenden Rückgabe- und Sam‐
melsysteme und beachten Sie die örtlichen
gesetzlichen Vorgaben.
31
Page 32

Bestellhinweise für Ersatzteile/Verbrauchsmaterial
12 Bestellhinweise für Ersatzteile/Verbrauchsmaterial
Der Sensor kann nur im Komplettset bestellt
werden, dieses Komplettset besteht aus:
Bestelladresse für Ersatzteile und Zubehör: Die
aktuelle Adresse für die Bestellung von Ersatz‐
teilen und Zubehör finden Sie auf der Home‐
page des Herstellers ProMinent.
32
Page 33

Bestellhinweise für Ersatzteile/Verbrauchsmaterial
Standardlieferumfang Komplettset CDE 2
Tab. 5: Standardlieferumfang Komplettset CDE 2
n 1 Sensor CDE komplett mit Sensorkappe, Schutzkappe und Klemmring.
– Typ CDE 2-mA-0,5 ppm, oder
– Typ CDE 2-mA-2 ppm, oder
– Typ CDE 2-mA-10 ppm.
1 Set zur Herstellung des Elektrolyten:
n 1 Flasche Grundelektrolyt,
n 1 Röhrchen mit Pulver,
n 1 Etikett für den hergestellten Elektrolyten.
1 Betriebsanleitung.
1 Schraubendreher.
Standardlieferumfang Komplettset CDE 3
Tab. 6: Standardlieferumfang Komplettset CDE 3
n 1 Sensor CDE 3 komplett mit Sensorkappe, Schutzkappe und Klemmring.
– Typ CDE 3-mA-0,5 ppm.
1 Flasche Elektrolyt.
1 Betriebsanleitung.
1 Schraubendreher.
Bezeichnung des Komplettsets. Bestellnummer
CDE 2-mA-0.5 ppm. 792930
CDE 2-mA-2 ppm. 792929
CDE 2-mA-10 ppm. 792928
CDE 3-mA-0.5 ppm. 1026154
33
Page 34

Bestellhinweise für Ersatzteile/Verbrauchsmaterial
Tab. 7: Folgende Ersatzteile/Verbrauchsmaterial und Zubehör sind für die Sensoren erhältlich:
Bezeichnung Bestellnummer
1 Zweidraht-Messleitung (2 x 0,25 mm2, Ø 4 mm).
725122
Set zur Herstellung des Elektrolyten für den Sensor Typ CDE 2. 506272
1 Flasche Elektrolyt (100 ml) CDM 1 für den Sensor Typ CDE 3. 506271
1 Membrankappe CDE 2 komplett. 790488
1 Membrankappe CDE 3 komplett. 1026578
1 Montage-Kit für DGM. 791818
1 Montage-Kit für DLG III. 815079
34
Page 35

Technische Daten
13 Technische Daten
Parameter Wert
Messgröße: Chlordioxid (ClO2).
Anwendungsbereich: CDE 2: Trinkwasser und Wasser ähnlicher Qualität, tensidfrei.
CDE 3: wie CDE 2 jedoch bis 60 °C.
Messbereiche: CDE 2-mA-0,5 ppm: 0,01 ... 0,5 mg/l, Normsteilheit: 24 mA/ppm.
CDE 2-mA-2 ppm: 0,02 ... 2 mg/l, Normsteilheit: 6 mA/ppm.
CDE 2-mA-10 ppm: 0,1 ... 10 mg/l, Normsteilheit: 1,2 mA/ppm.
CDE 3-mA-0,5 ppm 0,01 ... 0,5 mg/l, Normsteilheit: 24 mA/ppm.
pH-Bereich: 4,0 ... 11.
Temperaturbereich: CDE 2: 5 ... 45 °C (temperaturkompensiert). Keine Temperatursprünge.
CDE 3: 5 ... 60 °C (temperaturkompensiert). Keine Temperatursprünge.
Lagertemperatur: 5 ... 50 °C.
Auflösung: entspricht der unteren Messbereichsgrenze.
Maximaler Betriebs‐
druck:
Anströmung (Durch‐
fluss):
Querempfindlichkeit: O3 und Chlor < 2 %.
Standzeit der Mem‐
brankappe:
Werkstoff: CDE 2: Membrankappe, PVC, klar.
Versorgungsspan‐
nung:
35
DGM: 1,0 bar (freier Auslauf), kein Unterdruck.
DLG III: 1,0 bar (freier Auslauf), kein Unterdruck.
Bypassarmatur DLG III A/B / DGM.
optimal: 60 ... 80 l/h; mindestens: 40 l/h; maximal: 120 l/h.
Ø 1 Jahr, abhängig von der Wasserqualität.
Die Anwesenheit von oberflächenentspannenden Mitteln (Tensiden) kann
die Standzeit erheblich verringern. ProMinent bietet einen tensidfesten
Sensor Typ CDP 1-mA-2 ppm an.
CDE 3: Membrankappe, PMMA.
CDE 2: Sensorschaft, PVC, schwarz und PMMA, farblos.
CDE 3: Sensorschaft, PVC-C.
16 ... 24 V DC.
Page 36

Technische Daten
Parameter Wert
Ausgangssignal: 4 ... 20 mA.
Schutzart: IP 65.
36
Page 37

Eingehaltene Richtlinien/Normen
14 Eingehaltene Richtlinien/Normen
EU-Richtlinien:
n Niederspannungsrichtlinie (2014/35/EU).
n EMV-Richtlinie (2014/30/EU).
n RoHS-Richtlinie (2011/65/EU).
Internationale Normen:
n EN 61010-1.
n EN 60335-1.
n EN 60529.
n EN 61326-1.
Die CE-Konformitätserklärung finden Sie als
Download auf unserer Homepage.
37
Page 38

Index
15 Index
A
Allgemeine Gleichbehandlung ......... 5
Anströmung .................... 35
Anwendungsbereich ...............35
Arbeitselektrode ................. 28
Auflösung ..................... 35
Ausgangssignal ................. 35
B
Benutzer-Qualifikation ..............12
Bestelladresse .................. 32
Bypassarmatur .................. 21
D
Durchfluss ..................... 35
E
Einbauhinweise ..................21
Einbausituation .................. 21
Eingehaltene Normen .............. 37
Einlaufzeit ..................... 24
Elektrolyt (100 ml) ................ 34
Ersatzteile ..................... 32
EU-Richtlinien .................. 37
F
Fehlerbeseitigung ................ 27
Fehlersuche ....................27
Flasche mit Elektrolyt .............. 34
Frage: Was kann ich an dem Sensor
warten, reinigen und reparieren? ....... 29
Frage: Was muss ich beachten wenn ich
den Sensor stilllege oder entsorge? ..... 30
Frage: Welche Ersatzteile/Verbrauchsma‐
terial gibt es? ................... 32
Frage: Welche Normen werden einge‐
halten? ....................... 37
Frage: Welche Normen wurden ange‐
wendet und welche Technischen Daten
gibt es? ...................... 37
Frage: Wie ist der Sensor aufgebaut? .... 14
Frage: Wie kalibriere ich den Sensor? .... 25
Frage: Wie lange kann ich den Sensor
lagern? ....................... 16
Frage: Wie nehme ich den Sensor in
Betrieb? ...................... 24
Frage: Wie sind die grundlegenden Funk‐
tionen des Sensors? ...............15
Frage: Wie suche ich Fehler und behebe
diese? ....................... 27
Frage: Wieso ist der Sensor kein Sicher‐
heitsbauteil? .................... 9
Frage: Wo finde ich die Konformitätser‐
klärung? ...................... 37
G
Gegen- und Referenzelektrode ........ 28
Gleichbehandlung ................. 5
H
Handlung Schritt-für-Schritt ........... 5
I
Inbetriebnahme ..................24
Internationale Normen ............. 37
K
Komplettset .................... 33
Konformitätserklärung ..............37
L
Lagertemperatur ................. 35
38
Page 39

Index
Legionellenbekämpfung ............ 15
Lieferumfang .................... 8
Links auf Elemente bzw. Abschnitte dieser
Anleitung oder mitgeltende Dokumente .... 5
M
mA-Signal ..................... 15
Maximale Lagerdauer .............. 16
Maximaler Betriebsdruck ............ 35
Membran reinigen ................ 29
Membran wechseln ............... 29
Membrankappe ..................34
Messbereich ................... 35
Messgröße .................... 35
Montage-Kit .................... 32
N
Normsteilheit ................... 35
Nullpunktabgleich ................ 26
O
Originalverpackung ............... 16
P
pH-Bereich .................... 35
Q
Querempfindlichkeit ............... 35
R
Recycling ..................... 16
Referenzelektrode
Reparatur ..................... 29
................ 28
S
Schutzart ..................... 35
Sensorausfall ................... 24
Sicherheitsbauteil ................. 9
Standardlieferumfang ............... 8
Standzeit der Membrankappe ......... 35
Steilheitsabgleich ................ 26
Störung ...................... 27
T
Temperaturbereich ............... 35
Tenside ...................... 15
Typenschild .....................9
V
Verbrauchsmaterial ............... 32
W
Warnhinweise ...................10
Wartung ...................... 29
waschaktive Substanzen ............ 15
Weitere Kennzeichnung ............. 5
Werkstoff ..................... 35
Z
Zubehör ...................... 32
39
Page 40

ProMinent GmbH
Im Schuhmachergewann 5 - 11
69123 Heidelberg
Telefon: +49 6221 842-0
Telefax: +49 6221 842-215
E-Mail: info@prominent.com
Internet: www.prominent.com
986656, 5, de_DE
© 2019
Page 41

Assembly and operating instructions
A1265
DULCOTEST® Sensor CDE
Type: CDE 2-mA-0.5 ppm; CDE 2-mA-2 ppm;
CDE 2-mA-10 ppm; CDE 3-mA-0.5 ppm
EN
Please carefully read these operating instructions before use. · Do not discard.
The operator shall be liable for any damage caused by installation or operating errors.
The latest version of the operating instructions are available on our homepage.
Target group: commercial use.Part no.: 986656 Version: BA DT 161 05/19 DE
Page 42

Supplemental directives
General non-discriminatory approach In order to make it easier to read, this docu‐
ment uses the male form in grammatical struc‐
tures but with an implied neutral sense. It is
aimed equally at both men and women. We
kindly ask female readers for their under‐
standing in this simplification of the text.
Supplementary information
Please read the supplementary information in its entirety.
Information
This provides important information relating to the correct operation of the unit or is intended
to make your work easier.
Warning information
Warning information includes detailed descriptions of the hazardous situation, see
‘Labelling of Warning Information’ on page 47
The following symbols are used to highlight instructions, links, lists, results and other elements in
this document:
.
Ä Chapter 2.1
Tab. 1: More symbols
Symbol Description
Action, step by step.
⇨ Outcome of an action.
Links to elements or sections of these instructions or other applicable docu‐
ments.
n
[Button]
List without set order.
Display element (e.g. indicators).
Operating element (e.g. button, switch).
42
Page 43

Symbol Description
Supplemental directives
‘Display /GUI’
CODE
Screen elements (e.g. buttons, assignment of function keys).
Presentation of software elements and/or texts.
43
Page 44

Table of contents
Table of contents
1 Initial overview....................................................................................................................... 45
1.1 Intended use................................................................................................................. 46
2 Safety and qualification......................................................................................................... 47
2.1 Labelling of Warning Information.................................................................................. 47
2.2 General safety information........................................................................................... 48
2.3 User qualification.......................................................................................................... 49
3 Construction and function..................................................................................................... 51
3.1 Construction................................................................................................................. 51
3.2 Function........................................................................................................................ 52
3.2.1 Typical applications................................................................................................... 52
4 Storage and Transport of the Sensor.................................................................................... 53
4.1 Storage......................................................................................................................... 53
4.2 Transport...................................................................................................................... 53
4.3 Packaging material....................................................................................................... 53
5 Assembly............................................................................................................................... 54
5.1 Production of electrolyte............................................................................................... 55
5.2 Filling electrolyte........................................................................................................... 56
5.3 Installing sensor in the bypass fitting............................................................................ 57
6 Installation............................................................................................................................. 59
7 Commissioning...................................................................................................................... 61
7.1 Calibration.................................................................................................................... 61
8 Faults, Fault Detection and Troubleshooting........................................................................ 64
9 Maintenance and Repair Work on the Sensor...................................................................... 66
10 Remove sensor from operation either temporarily or permanently....................................... 67
11 Disposal of used parts........................................................................................................... 68
12 Ordering information for spare parts/consumables............................................................... 69
13 Technical data....................................................................................................................... 72
14 Directives / standards adhered to......................................................................................... 74
15 Index..................................................................................................................................... 75
44
Page 45

Initial overview
1 Initial overview
Standard scope of supply
These operating instructions provide information on the technical data and functions of the
DULCOTEST® sensor type CDE for chlorine dioxide concentrations in surfactant-free water.
Tab. 2: Standard scope of supply of CDE 2
n 1 sensor CDE complete with sensor cap, protective cap and clamp ring.
– Type CDE 2-mA-0.5 ppm, or
– Type CDE 2-mA-2 ppm, or
– Type CDE 2-mA-10 ppm.
1 set to produce the electrolyte:
n 1 bottle of supporting electrolyte,
n 1 tube with powder,
n 1 label for the electrolyte produced.
1 set of operating instructions.
1 screwdriver.
Standard scope of supply of CDE 3
Tab. 3: Standard scope of supply of CDE 3
n 1 sensor CDE 3 complete with sensor cap, protective cap and clamp ring.
– Type CDE 3-mA-0.5 ppm.
1 bottle of electrolyte.
1 set of operating instructions.
1 screwdriver.
45
Page 46

Initial overview
Nameplate
Fig. 1: Nameplate on the sensor shaft and
packaging
The nameplate provides information on:
n Symbol to assign the sensor
to the right electrolyte
n Product group, here DULCOTEST
n Type, here e.g. CDE 2-mA-0.5 ppm
n Part number
n Measured variable, here chlorine dioxide
(ClO2)
n Upper measuring range limit in mg/l
n F. No. = Production batch
n CE mark
The nameplate is located both on the sensor
shaft as well as on the sensor packaging.
Sensor and packaging can be matched to each
other by the label.
®
The sensor is not a safety component in the
sense of DIN EN ISO 13849-1:2008-12. If there
is a critical process in your measurement and
control circuit, then it is your responsibility to
make sure this process is safe.
1.1 Intended use
The sensor may only be used to determine and
control concentrations of chlorine dioxide (ClO2)
in water.
Only use the sensor in surfactant-free water or
solutions.
All other uses or modifications are prohibited.
46
Page 47

2 Safety and qualification
2.1 Labelling of Warning Infor‐
mation
Introduction
These operating instructions provide informa‐
tion on the technical data and functions of the
product. These operating instructions provide
detailed warning information and are provided
as clear step-by-step instructions.
The warning information and notes are categor‐
ised according to the following scheme. A
number of different symbols are used to denote
different situations. The symbols shown here
serve only as examples.
Safety and qualification
WARNING!
Nature and source of the danger
Possible consequence: Fatal or very
serious injuries.
Measure to be taken to avoid this
danger.
– Denotes a possibly hazardous sit‐
uation. If the situation is disre‐
garded, it could result in fatal or
very serious injuries.
DANGER!
Nature and source of the danger
Consequence: Fatal or very serious
injuries.
Measure to be taken to avoid this
danger.
Description of hazard
– Denotes an immediate threatening
danger. If the situation is disre‐
garded, it will result in fatal or very
serious injuries.
CAUTION!
Nature and source of the danger
Possible consequence: Slight or minor
injuries. Material damage.
Measure to be taken to avoid this
danger.
– Denotes a possibly hazardous sit‐
uation. If the situation is disre‐
garded, it could result in slight or
minor injuries. May also be used
as a warning about material
damage.
47
Page 48

Safety and qualification
NOTICE!
Nature and source of the danger
Damage to the product or its surround‐
ings.
Measure to be taken to avoid this
danger.
– Denotes a possibly damaging sit‐
uation. If the situation is disre‐
garded, the product or an object in
its vicinity could be damaged.
Type of information
Hints on use and additional information.
Source of the information. Additional
measures.
–
Denotes hints on use and other
useful information. It does not indi‐
cate a hazardous or damaging sit‐
uation.
2.2 General safety information
Unauthorised access!
Ensure that there can be no unauthorised
access to the device.
Only trained personnel may fit, install, maintain
and operate this sensor.
Functional limitations
Regularly check the sensor for dirt.
Check the diaphragm cap regularly for air bub‐
bles adhering to it (visual check).
Observe the applicable national guidelines
relating to maintenance, service and calibration
intervals.
Operational prerequisites
Only use the sensor in bypass fittings that
ensure the correct flow parameters (l/h, see
Technical data).
Ensure that there is a free flow or at most a
back pressure of 1 bar at the outlet of the
bypass fitting. Note the maximum operating
pressure for the individual components.
Damage cannot be ruled out if the sensor is
operated for longer than approx. one week in
process water without feed chemical. Switch off
the sensor electrically during longer pauses.
It is necessary to run in and recalibrate the
sensor following longer interruptions to the
power supply (> 2 h).
Damage cannot be ruled out if the sensor is
operated for longer than approx. one week
without chlorine dioxide. Switch off the sensor
electrically during longer pauses.
48
Page 49

Safety and qualification
2.3 User qualification
WARNING!
Danger of injury with inadequately qualified personnel
The operator of the system / equipment is responsible for ensuring that the qualifications are
fulfilled.
If inadequately qualified personnel work on the unit or loiter in the hazard zone of the unit,
this could result in dangers that could cause serious injuries and material damage.
– All work on the unit should therefore only be conducted by qualified personnel.
– Unqualified personnel should be kept away from the hazard zone.
The pertinent accident prevention regulations, as well as all other generally acknowledged
safety regulations, must be adhered to.
Training Definition
Instructed personnel An instructed person is deemed to be a person who has been
instructed and, if required, trained in the tasks assigned to him and pos‐
sible dangers that could result from improper behaviour, as well as
having been instructed in the required protective equipment and protec‐
tive measures.
Trained user A trained user is a person who fulfils the requirements made of an
instructed person and who has also received additional training specific
to the system from the manufacturer or another authorised distribution
partner.
Trained, qualified per‐
sonnel
49
A trained, qualified employee is deemed to be a person who is able to
assess the tasks assigned to him and recognize possible hazards
based on his training, knowledge and experience, as well as knowledge
of pertinent regulations. A trained, qualified employee must be able to
perform the tasks assigned to him independently with the assistance of
drawing documentation and parts lists. The assessment of a person's
technical training can also be based on several years of work in the rel‐
evant field.
Page 50

Safety and qualification
Training Definition
Electrical technician An electrical technician is able to complete work on electrical systems
and recognise and avoid possible dangers independently based on his
technical training and experience as well as knowledge of pertinent
standards and regulations. An electrical technician must be able to per‐
form the tasks assigned to him independently with the assistance of
drawing documentation, parts lists, terminal and circuit diagrams. The
electrical technician must be specifically trained for the working environ‐
ment in which the electrical technician is employed and be conversant
with the relevant standards and regulations.
Service The Service department refers to service technicians, who have
received proven training and have been authorised by the manufacturer
to work on the system.
50
Page 51

3 Construction and function
1
9
8
7
6
5
3
4
2
A2776
3.1 Construction
Construction and function
Fig. 2: Construction of the sensor
1. Cable feed-through, M12 threaded con‐
nector
2. Top part
3. 2-wire connector
4. Clamp disc
5. Electrode shaft
6. Vent hole
7. Diaphragm cap
8. Hose seal
9. Diaphragm protective cap
The DULCOTEST® CDE sensor for chlorine
dioxide (ClO2) is a diaphragm-covered twoelectrode sensor. The sensor consists of the
diaphragm cap and sensor shaft. The electro‐
lyte-filled diaphragm cap constitutes the meas‐
uring chamber. A non-porous diaphragm
located in the diaphragm cap allows the
chlorine dioxide soluble in the water to per‐
meate through. The electrodes on the sensor
shaft are immersed in the measuring chamber.
Amplifier electronics are located above the
electrodes in the sensor shaft. The electrical
connector is positioned above this. The tem‐
perature sensor for temperature compensation
is integrated in the lower part of the sensor
shaft.
51
Page 52

Construction and function
3.2 Function
Use the DULCOTEST® CDE sensor to selec‐
tively measure the concentration of chlorine
dioxide (ClO2), even in the presence of free
chlorine. The cross-sensitivity to free chlorine is
< 2 %.
The sensor is a diaphragm-covered, ampero‐
metric two-electrode sensor.
The chlorine dioxide passes through the dia‐
phragm and is electrochemically transformed
on the working electrode.
The primary current signal from this implemen‐
tation is electronically amplified, temperaturecompensated and transmitted as an uncali‐
brated 4 ... 20 mA signal to the measuring/
control unit.
3.2.1 Typical applications
Type CDE 2
The type CDE 2 is used, among other things,
for disinfecting potable water or water treatment
for beverage production. The sensor may not
be used in media containing agents decreasing
the surface tension (surfactants, activecleansing substances). Continuous operation at
media temperatures of 5 °C to 45 °C is pos‐
sible.
Type CDE 3
Type CDE 3 is used in the chlorine dioxide
treatment of hot water similar to drinking water
up to 60 °C, e.g. for legionella control.
52
Page 53

Storage and Transport of the Sensor
4 Storage and Transport of the Sensor
User qualification: instructed user, see
Ä Chapter 2.3 ‘User qualification’ on page 49
Original packaging
Damage to the product.
–
Only transport, ship and store the
sensor in its original packaging.
–
Retain the packaging including the
polystyrene inserts.
Maximum storage period
Damage to the product.
If the sensor is stored for a long period
of time, return it to the manufacturer for
checking or servicing. Otherwise the
safe operation and measuring accuracy
of the sensor can no longer be reliably
guaranteed.
4.2 Transport
The sensor should be transported in its original
packaging and in compliance with the permis‐
sible environmental conditions. No further spe‐
cial conditions have to be observed in relation
to transport.
4.3 Packaging material
Dispose of packaging material in an environ‐
mentally responsible way. All packaging com‐
ponents carry the corresponding recycling code
.
4.1 Storage
Permissible ambient temperature: +5°C ...
+50°C.
Humidity: maximum 90% relative air humidity,
non-condensing.
Other: No dust, no direct sunlight.
Maximum storage period of the sensor in its
original packaging and normal atmosphere: 2
Years.
53
Page 54

Assembly
5 Assembly
n User qualification: trained user, see
Ä Chapter 2.3 ‘User qualification’
on page 49
WARNING!
Danger from hazardous substances!
Possible consequence: Fatal or very
serious injuries.
Please ensure when handling haz‐
ardous substances that you have read
the latest safety data sheets provided
by the manufacture of the hazardous
substance. The actions required are
described in the safety data sheet.
Check the safety data sheet regularly
and replace, if necessary, as the
hazard potential of a substance can be
re-evaluated at any time based on new
findings.
The system operator is responsible for
ensuring that these safety data sheets
are available and that they are kept up
to date, as well as for producing an
associated hazard assessment for the
workstations affected.
Electrolyte
–
The electrolyte is sensitive to oxi‐
dation: Always keep the electrolyte
bottle sealed after use.
–
Do not decant electrolytes into
other containers.
–
Do not store electrolyte beyond its
"Use by" date and note the "Use
by" date on the label on the elec‐
trolyte bottle.
–
Pour in the electrolyte, preferably
free of bubbles. Small air bubbles
are not a problem, larger air bub‐
bles rise to the upper edge of the
diaphragm cap and affect the
measurement.
Do not touch the diaphragm cap
and electrodes
Do not touch or damage the diaphragm
in the diaphragm cap and the elec‐
trodes at the bottom of the sensor nor
bring them into contact with greasy
substances. Otherwise the sensor will
no longer work accurately. In this case,
replace the diaphragm cap with a new
diaphragm cap or return the sensor to
the manufacturer to have the elec‐
trodes cleaned.
54
Page 55

A2723
Assembly
5.1 Production of electrolyte
Produce the ready-to-use electrolyte using the set supplied for independent production of electro‐
lyte. Unlike ready-to-use electrolyte, these individual components are not regarded as hazardous
materials. Take the following steps.
1 set to produce the electrolyte:
n 1 bottle of supporting electrolyte,
n 1 tube with powder,
n 1 label for the electrolyte produced.
Fig. 3: Production of electrolyte
1. Take appropriate measures, such as protective gloves and goggles (1), to protect yourself,
according to the Material Safety Data Sheets for the components.
2. Open the bottle of supporting electrolyte and the tube with powder (2).
3. Guide the tube at an angle fully into the opening of the bottle of supporting electrolyte (3).
4. Completely transfer the powder into the bottle of supporting electrolyte (4).
5. Close the bottle and shake the bottle until the powder has fully dissolved, ≧ 10 seconds (5).
No solids and streaks should be visible in the electrolyte.
ð
6. Remove (6) the label from the supporting electrolyte.
7. Replace (7) the label with the label supplied.
You can now use the electrolyte you have produced (8).
ð
55
Page 56

3
4
2
1
Assembly
5.2 Filling electrolyte
1. Open the electrolyte bottle and screw on
the nozzle.
2. Pour in the electrolyte, preferably free of
bubbles.
Place the electrolyte bottle on the dia‐
phragm cap and slowly press the elec‐
trolyte in a single stream from the elec‐
trolyte bottle, at the same time evenly
pulling back the electrolyte bottle.
The diaphragm cap is completely
ð
full if the diaphragm cap is filled to
the brim with electrolyte.
Fig. 4: Electrolyte filling
1 Diaphragm cap
2 Electrolyte filling height
3 Pipette
4 Vent hole
3. Place the sensor vertically onto the filled
diaphragm cap.
4. Do not use your fingers, or similar, to
close the vent hole, otherwise pressure
can build up when it is screwed shut and
the diaphragm can be damaged.
When screwing it shut, allow excess
electrolyte to escape through the vent
hole under the hose seal. The vent hole
must form the highest point to ensure
the reliable escape of air.
If no electrolyte escapes when
ð
screwing is shut, then the dia‐
phragm cap has not been suffi‐
ciently filled. Repeat this process
and fully fill the diaphragm cap.
5. Turn the diaphragm cap manually as far
as the stop so that no gap can be seen
between the diaphragm cap and the
sensor.
6. Rinse off any escaped electrolyte with
clean water.
7. Close the electrolyte bottle.
8. Rinse the electrolyte from the nozzle of
the electrolyte bottle under running
water.
The sensor is now ready to be
ð
installed in the bypass fitting.
56
Page 57

Assembly
5.3 Installing sensor in the bypass fitting
Minimum flow (l/h)
Do not drop below the minimum flow (l/h, see Technical Data):
–
Monitor the flow at the connected controller. If the measured value of the flow is used
for control, switch off the control if the minimum flow rate is undershot or switch to the
basic load.
–
Only install the sensor in bypass fittings of type DLG III A, DLG III B or DGM (25 mm
module). Use appropriate measuring methods to check the measured results before
commissioning if using other bypass fittings.
–
Avoid installations that allow air bubbles to form in the sample water.
–
Air bubbles, which adhere to the diaphragm of the sensor, can result in too low a
measured value. Too low a measured value can lead to incorrect metering within a
control circuit.
Also observe the instructions and safety information contained in the operating instructions
for the bypass fitting.
Installation instructions
Do not fit the sensor into a fully closed fitting. Open the sampling tap if there is not a free
outlet.
–
Only push in or pull out the sensor slowly to or from the bypass fitting. Otherwise the
diaphragm could be damaged.
–
Do not allow the diaphragm to come into contact with any objects to prevent damage to
and contamination of the diaphragm.
–
Always keep the sensor moist after commissioning, that is to say never allow the
bypass fitting to run dry.
57
Page 58

A0645
1
2
3
4
5
6
Assembly
Fig. 5: Installation situation
1. Threaded sleeve.
2. Clamp disc.
3. Sensor.
4. O-ring.
5. Washer.
6. Bypass fitting e.g. DLG.
1. Push the O-ring (4) and the washer (5) included in the installation kit from below over the
sensor as far as the clamp disc (2).
2. Bypass fitting DLG III: Guide the sensor into the DLG III and tighten the threaded plug.
3. Bypass fitting DGM: Insert the sensor into the DGM and tighten the clamping screw until the
O-ring seals.
The correct insertion depth of the sensor is defined by the clamp disc. When using a
ð
bypass fitting by another manufacturer, also refer to the operating instructions issued by
the manufacturer of the bypass fitting.
58
Page 59

Installation
6 Installation
n User qualification: trained qualified personnel or electrical technician,
ification’ on page 49
WARNING!
Sensor connection on external equipment
Possible consequence: Fatal or very serious injuries
– Ensure that the connected measuring/control device is galvanically isolated from the
sensor.
– Do not allow the supply voltage to fall below 16 V DC, even for short periods of time.
– Ensure that the current source can be loaded with a minimum of 35 mA at a min‐
imum of 16 V DC.
– Too low a supply voltage may result in an incorrect measured value.
The requirements are automatically met when connecting the sensor to a ProMinent meas‐
uring/control unit.
CAUTION!
Incorrect metering
Possible consequence: Slight or minor injuries. Material damage.
– Do not switch off the measuring/control unit during intermittent operation.
– Switch on the feeder assemblies (e.g. pumps) with a time delay if necessary.
– Ensure that the water to be measured always contains a sufficient quantity of the
appropriate feed chemical,
– otherwise you will have to factor in longer run in periods.
Ä Chapter 2.3 ‘User qual‐
59
Page 60

1
2
A2419
2 3
1
4
Installation
Electrical installation
1. Turn the top part (1) of the sensor a quarter turn anticlockwise and remove the top part.
2. Loosen the clamping nut (2) from the M12 threaded connector and feed the measuring line
(3) through the clamping nut.
Fig. 6: 2-wire connector
3. Strip the insulation from the cable to a length of approx. 30 mm. Strip the cable ends by
approx. 5 mm, fit the cable ends with cable end sleeves (⌀ max = 0.5 mm2) and connect the
cable ends to the 2-wire connector: 1 = plus, 2 = minus.
4. Push the top part of the sensor fully onto the sensor shaft (4) and tighten the top part of the
sensor clockwise as far as the stop.
5. Push the measuring line as far as possible into the top part of the sensor to relieve tension.
6. Tighten the clamping nut (2) on the M12 threaded connector.
60
Page 61

Commissioning
7 Commissioning
n User qualification: trained user,
CAUTION!
Incorrect metering due to sensor failure
Possible consequence: Slight or minor injuries. Material damage.
– If a sensor fails then there may be an incorrect measured value at the input of the
measuring/control unit.
– This incorrect measured value can lead to uncontrolled metering.
– The operator should therefore ensure that no subsequent damage results from this.
CAUTION!
Incorrect metering due to premature ageing of the sensor
Possible consequence: Slight or minor injuries. Material damage.
Measure: Do not disconnect the sensor from the power supply during measuring breaks.
Exception: Electrically disconnect the sensor if there is a break between measurements
lasting more than a week and the proportion of disinfectant in the sample water falls during
this period to 0 ppm.
– An extra run in period will be necessary following operation without disinfectant. Switch
on the feeder assembly with a time delay if necessary.
Ä Chapter 2.3 ‘User qualification’ on page 49
Run in period
The sensor requires a specific run in period to display a steady display value.
With initial commissioning: 1 ... 24 h (Ø 6 h)*
With re-commissioning: 1 ... 24 h (Ø 3 h)*
When replacing electrolyte or diaphragm: 0.5 h
* the exact run in period depends on the application.
61
Page 62

Commissioning
7.1 Calibration
Calibration at a higher water tem‐
perature
In contrast to chlorine, chlorine dioxide
can only be physically dissolved in
water.
At high temperatures (> 30 °C),
chlorine dioxide gasses out of the water
very quickly. It is therefore essential
that DPD measurements are performed
quickly. Never leave more than 1
minute between taking the sample and
mixing it with reagents. The red dye
should be generated by the addition of
the reagent directly at the sampling
point. Then use a suitable photometer
to perform the measurement as quickly
as possible at the sampling point.
CAUTION!
– Perform slope calibration following
the replacement of a diaphragm
cap or electrolyte.
– Repeat slope calibration at regular
intervals to ensure correct opera‐
tion of the sensor. The calibration
intervals are 3 ... 4 weeks,
depending on the quality of the
water.
– Avoid air bubbles in the sample
water. Air bubbles can result in
incorrect metering. Air bubbles
that adhere to the diaphragm of
the sensor may cause too low a
measured value and thus lead to
over-metering.
– Please note the applicable
national guidelines for calibration
intervals.
Requirements:
–
Constant flow in the bypass fitting.
–
Constant temperature of the
sample water.
–
Identical temperature of sample
water and sensor (wait approx. 15
minutes).
–
The sensor has been run in.
–
Constant pH value.
62
Page 63

Zero point calibration:
Zero point calibration is not generally neces‐
sary if the sensor is operated with a ProMinent
measuring/control unit. However, perform zero
point calibration if you are using the sensor at
the lower threshold of the measuring range.
1. Immerse the sensor in a bucket of clean
water without disinfectant or oxidant
(e.g. commercially available still mineral
water).
2. Use the sensor to stir until the measured
value on the measuring/control unit is
stable for 5 minutes.
3. Calibrate the measuring/control unit to
zero in accordance with the operating
instructions for the measuring/control
unit.
4. Re-install the sensor in the bypass fitting
(e.g. the DGMA; DLG III).
Slope calibration:
1. Immediately determine the disinfectant
content of the sample water using a suit‐
able measuring kit (e.g. DPD 1).
2. Set the value determined on the meas‐
uring/control unit in accordance with the
operating instructions for the measuring/
control unit.
3. Repeat calibration after one day to
ensure that the sensor has reached its
maximum sensitivity (slope).
Commissioning
63
Page 64

Faults, Fault Detection and Troubleshooting
8 Faults, Fault Detection and Troubleshooting
User qualification: instructed user, see
Tab. 4: Information on Troubleshooting and Fault Elimination
Fault Possible cause Remedy
Ä Chapter 2.3 ‘User qualification’ on page 49
The sensor cannot
be calibrated and
sensor's measured
value is greater
than the DPD
measurement.
The sensor cannot
be calibrated and
the sensor's meas‐
ured value is lower
than the DPD
measurement.
Run in period too short. Observe the run in period.
Diaphragm cap damaged. Replace diaphragm cap.
Troublesome substances in the
water.
Short circuit in the measuring line. Identify short circuit and eliminate.
Distance between diaphragm/elec‐
trode is too great.
DPD chemicals out of date. Use new DPD chemicals, repeat cal‐
pH value < pH 6. Increase pH value (pH 6 ... 9.5).
Run in period too short. Observe the run in period.
Sample water flow rate too low. Correct sample water flow.
Air bubbles on the outside of the dia‐
phragm.
Surfactants in the sample water (dia‐
phragm is transparent).
Deposits have blocked the dia‐
phragm.
Check water for troublesome sub‐
stances and remedy this.
Screw the diaphragm cap to the
stop.
ibration.
Increase the sample water flow
within the permitted range.
Remove surfactants and replace
diaphragm cap.
Allow sensor to run in and calibrate;
use a CDP type sensor if necessary.
Replace diaphragm cap; allow
sensor to run in and calibrate.
The sensor’s meas‐
ured value is 0 ppm
and an error mes‐
Deposits on the diaphragm cap.
No electrolyte in the diaphragm cap. Fill with new electrolyte.
Reference electrode (2) worn out
(showing shiny points).
Sensor connected to the measuring/
control unit with incorrect polarity.
Return sensor for regeneration.
Connect sensor correctly to the
measuring /control device.
64
Page 65

A2420
1
2
Faults, Fault Detection and Troubleshooting
Fault Possible cause Remedy
sage appears on
the
measuring/control unit
.
Measuring line broken. Replace measuring line.
ClO2 content below the lower meas‐
uring range limit.
Sensor faulty. Return sensor for regeneration.
Measuring /control unit faulty. Check the measuring/control unit
Increase ClO2 content and then
recalibrate and/or use a suitable
sensor.
using a sensor simulator (DULCOM‐
ETER® Simulator, order no.
1004042), repair if faulty.
The sensor’s meas‐
ured value is
unstable.
Diaphragm damaged. Replace diaphragm cap; allow
sensor to run in and calibrate.
Air bubbles on the outside of the dia‐
phragm.
The cause lies with the measuring/
control unit.
Remove air bubbles by tapping them
and increase flow rate if necessary.
Eliminate cause.
Fig. 7: Probes
1 Working electrode (material: gold).
2 Counter and reference electrode (material: silver with silver chloride, galvanically coated).
65
Page 66

Maintenance and Repair Work on the Sensor
9 Maintenance and Repair Work on the Sensor
User qualification: instructed user, see
Ä Chapter 2.3 ‘User qualification’ on page 49
Maintenance interval:
Maintain the sensor regularly in order to avoid
over-metering in the event of a sensor failure.
Please note the applicable national guidelines
for maintenance intervals.
Cooling water: weekly to monthly, depending
on water quality.
Cleaning the diaphragm:
Try to clean the diaphragm carefully if the dia‐
phragm is dirty and the sensor cannot be cali‐
brated. First dismantle the sensor. Gently
remove any adhering dirt:
Rinse the diaphragm under a gentle
stream of cold water.
Now fill the sensor with electrolyte,
ð
allow it to run in and recalibrate.
CAUTION!
– Do not touch the electrodes or
bring them into contact with sub‐
stances containing grease.
– Never try to clean the diaphragm
with alkaline solutions, cleaning
reagents or using mechanical
means (brush or similar).
Maintenance work:
1. Check the diaphragm cap for deposits
or air bubbles.
Remove deposits when necessary,
ð
see
Ä ‘Cleaning the diaphragm:’
on page 66
2. Use a suitable measuring instrument
(e.g. DPD) to check the display value of
the sensor on the measuring/control
unit.
Re-calibrate the sensor if neces‐
ð
sary.
.
Replacing the diaphragm:
Replace the diaphragm cap if calibration is no
longer possible even after the diaphragm has
been cleaned or if the diaphragm is damaged.
To do so, refer to the Calibration
chapter.
Repair of the sensor:
The sensor can only be repaired in the manu‐
facturer's factory. To do so, return to the manu‐
facturer in its original packaging.
66
Page 67

Remove sensor from operation either temporarily or permanently
10 Remove sensor from operation either temporarily or per‐
manently
User qualification: instructed user, see
Ä Chapter 2.3 ‘User qualification’ on page 49
1. Disconnect the sensor electrically.
2. Ensure that the bypass fitting is at
atmospheric pressure.
3. Loosen the clamping nut.
4. Open the sampling tap and pull the
sensor slowly out of the bypass fitting
5. Unscrew the diaphragm cap and dis‐
pose of the diaphragm cap.
6. Rinse the probes in running water until
free of residue.
7. Use a lint-free cloth to wipe the elec‐
trodes and allow them to dry for 24
hours. Loosely screw on a new empty
diaphragm cap to protect the electrodes.
8. Fit the diaphragm protective cap to pro‐
tect the diaphragm cap.
9. Store the sensor, as described.
Ä Chapter 4 ‘Storage and Transport of
the Sensor’ on page 53
.
67
Page 68

Disposal of used parts
11 Disposal of used parts
n User qualification: instructed user, see
Ä Chapter 2.3 ‘User qualification’
on page 49
NOTICE!
Regulations governing the disposal of
used parts
– Note the national regulations and
legal standards that currently
apply in your country
The manufacturer will take back decontami‐
nated used devices providing they are covered
by adequate postage.
Decontaminate the device before returning it for
repair. To do so, remove all traces of haz‐
ardous substances. Refer to the Material Safety
Data Sheet for your feed chemical.
A current Declaration of Decontamination is
available to download on the ProMinent web‐
site.
Sign indicating EU collection system
In accordance with the European Directive
2012/19/EU on waste electrical and electronic
equipment, this device features the symbol
showing a waste bin with a line through it. The
device must not be disposed of along with
domestic waste. To return the device, use the
return and collection systems available and
observe the local legal requirements.
68
Page 69

Ordering information for spare parts/consumables
12 Ordering information for spare parts/consumables
The sensor can only be ordered as a complete
set comprising:
Ordering address for spare parts and accesso‐
ries: The current address for ordering spare
parts and accessories can be found on the
manufacturer’s homepage ProMinent.
69
Page 70

Ordering information for spare parts/consumables
Standard scope of supply, complete set CDE 2
Tab. 5: Standard scope of supply, complete set CDE 2
n 1 sensor CDE complete with sensor cap, protective cap and clamp ring.
– Type CDE 2-mA-0.5 ppm, or
– Type CDE 2-mA-2 ppm, or
– Type CDE 2-mA-10 ppm.
1 set to produce the electrolyte:
n 1 bottle of supporting electrolyte,
n 1 tube with powder,
n 1 label for the electrolyte produced.
1 set of operating instructions.
1 screwdriver.
Standard scope of supply, complete set CDE 3
Tab. 6: Standard scope of supply, complete set CDE 3
n 1 sensor CDE 3 complete with sensor cap, protective cap and clamp ring.
– Type CDE 3-mA-0.5 ppm.
1 bottle of electrolyte.
1 set of operating instructions.
1 screwdriver.
Designation of the complete set. Order number
CDE 2-mA-0.5 ppm. 792930
CDE 2-mA-2 ppm. 792929
CDE 2-mA-10 ppm. 792928
CDE 3-mA-0.5 ppm. 1026154
70
Page 71

Ordering information for spare parts/consumables
Tab. 7: The following spare parts/consumables and accessories are available for the sensors:
Description Order number
1 two-wire measuring line (2 x 0.25 mm2, Ø 4 mm).
725122
Set to produce electrolyte for the sensor type CDE 2. 506272
1 electrolyte bottle (100 ml) CDM 1 for sensor type CDE 3. 506271
1 diaphragm cap CDE 2 complete. 790488
1 diaphragm cap CDE 3 complete. 1026578
1 installation kit for DGM. 791818
1 installation kit for DLG III. 815079
71
Page 72

Technical data
13 Technical data
Parameter Value
Measured variable: Chlorine dioxide (ClO2).
Field of application: CDE 2: Potable water and water of similar quality, surfactant-free.
CDE 3: as CDE 2 but up to 60°C.
Measuring ranges: CDE 2-mA-0.5 ppm: 0.01 ... 0.5 mg/l, standard slope: 24 mA/ppm.
CDE 2-mA-2 ppm: 0.02 ... 2 mg/l, standard slope: 6 mA/ppm.
CDE 2-mA-10 ppm: 0.1 ... 10 mg/l, standard slope: 1.2 mA/ppm.
CDE 3-mA-0.5 ppm 0.01 ... 0.5 mg/l, standard slope: 24 mA/ppm.
pH-range: 4.0 ... 11.
Temperature range: CDE 2: 5 ... 45°C (temperature-compensated). No sudden changes in
temperature.
CDE 3: 5 ... 60 °C (temperature-compensated). No sudden changes in
temperature.
Storage tempera‐
ture:
Dissolution: corresponds to the lower measuring range limit.
Maximum operating
pressure:
Flow: Bypass fitting DLG III A/B / DGM.
Cross-sensitivity: O3 and chlorine < 2%.
Service life of the
diaphragm cap:
5 ... 50 °C.
DGM: 1.0 bar (free flow), no negative pressure.
DLG III: 1.0 bar (free flow), no negative pressure.
Optimum: 60 ... 80 l/h; at least: 40 l/h; maximum: 120 l/h.
Ø 1 year, depending on the water quality.
The presence of agents decreasing the surface tension (surfactants) can
significantly reduce the service life. ProMinent offers a surfactant-proof
sensor type CDP 1-mA-2 ppm.
72
Page 73

Parameter Value
Material: CDE 2: Diaphragm cap, PVC, clear.
CDE 3: Diaphragm cap, PMMA.
CDE 2: Sensor shaft, PVC, black and PMMA, colourless.
CDE 3: Sensor shaft, PVC-C.
Supply voltage: 16 ... 24 V DC.
Output signal: 4 ... 20 mA.
Degree of protection: IP 65.
Technical data
73
Page 74

Directives / standards adhered to
14 Directives / standards adhered to
EU directives:
n Low Voltage Directive (2014/35/EU).
n EMC Directive (2014/30/EU).
n RoHS Directive (2011/65/EU).
International standards:
n EN 61010-1.
n EN 60335-1.
n EN 60529.
n EN 61326-1.
You will find the EC Declaration of Conformity
to download on our homepage.
74
Page 75

15 Index
A
Accessories .................... 69
Action, step by step ............... 42
active-cleansing substances .......... 52
B
Bottle with electrolyte .............. 71
Bypass fitting ................... 58
C
Cleaning the diaphragm ............ 66
Combating legionella .............. 52
Commissioning .................. 61
Complete set ................... 70
Consumables ................... 69
Counter and reference electrodes ...... 65
Cross-sensitivity ................. 72
D
Declaration of Conformity ........... 74
Degree of protection ...............72
Diaphragm cap .................. 71
Dissolution .....................72
Index
I
Installation instructions ............. 58
Installation kit ................... 69
Installation situation ............... 58
International standards ............. 74
L
Links to elements or sections of these
instructions or other applicable documents 42
M
mA signal ..................... 52
Maintenance ................... 66
Material ...................... 72
Maximum operating pressure ......... 72
Maximum storage period ............ 53
Measured variable ................ 72
Measuring range ................. 72
More symbols ...................42
N
Nameplate .....................46
Non-discriminatory approach ......... 42
E
Electrolyte (100 ml) ............... 71
EU directives ................... 74
O
Ordering address .................69
Original packaging ................ 53
Output signal ................... 72
F
Fault ........................ 64
Field of application ................72
Flow ........................ 72
G
General non-discriminatory approach .... 42
75
P
pH range ......................72
Q
Question: How do I calibrate the sensor? .. 62
Question: How do I locate and remedy
faults? ....................... 64
Page 76

Index
Question: How do I put the sensor into
operation? ..................... 61
Question: How is the sensor constructed? . 51
Question: How long can I store the sensor? 53
Question: What are the basic functions of
the sensor? .................... 52
Question: What do I need to consider
when decommissioning or disposing of the
sensor? ...................... 67
Question: What maintenance, cleaning
and repair work can I carry out on the
sensor? ...................... 66
Question: What spare parts/consumables
are there? ..................... 69
Question: What standards were applied
and what technical data is available? .... 74
Question: Where can I find the Declaration
of Conformity? .................. 74
Question: Which standards are complied
with? ........................ 74
Question: Why isn't the sensor a safety
component? ....................46
R
Recycling ..................... 53
Reference electrode ............... 65
Repair ....................... 66
Replacing the diaphragm ............ 66
Run in period ................... 61
S
Scope of delivery .................45
Sensor failure ................... 61
Service life of the diaphragm cap ....... 72
Slope calibration ................. 63
Spare parts .................... 69
Standard scope of supply ........... 45
Standard slope .................. 72
Standards complied with ............ 74
Storage temperature .............. 72
Surfactants .................... 52
T
Temperature range ............... 72
Troubleshooting ................. 64
U
User qualification .................49
W
Warning information ............... 47
Working electrode ................ 65
Z
Zero point calibration .............. 63
76
Page 77

ProMinent GmbH
Im Schuhmachergewann 5 - 11
69123 Heidelberg
Telephone: +49 6221 842-0
Fax: +49 6221 842-419
Email: info@prominent.com
Internet: www.prominent.com
986656, 5, en_GB
© 2019
Page 78

78 79
Page 79

Page 80

ProMinent GmbH
Im Schuhmachergewann 5 - 11
69123 Heidelberg, Germany
Telephone: +49 6221 842-0
Fax: +49 6221 842-419
Email: info@prominent.com
Internet: www.prominent.com
986656, 1, en_GB
© 2019
 Loading...
Loading...