Kashina 505 User Guide
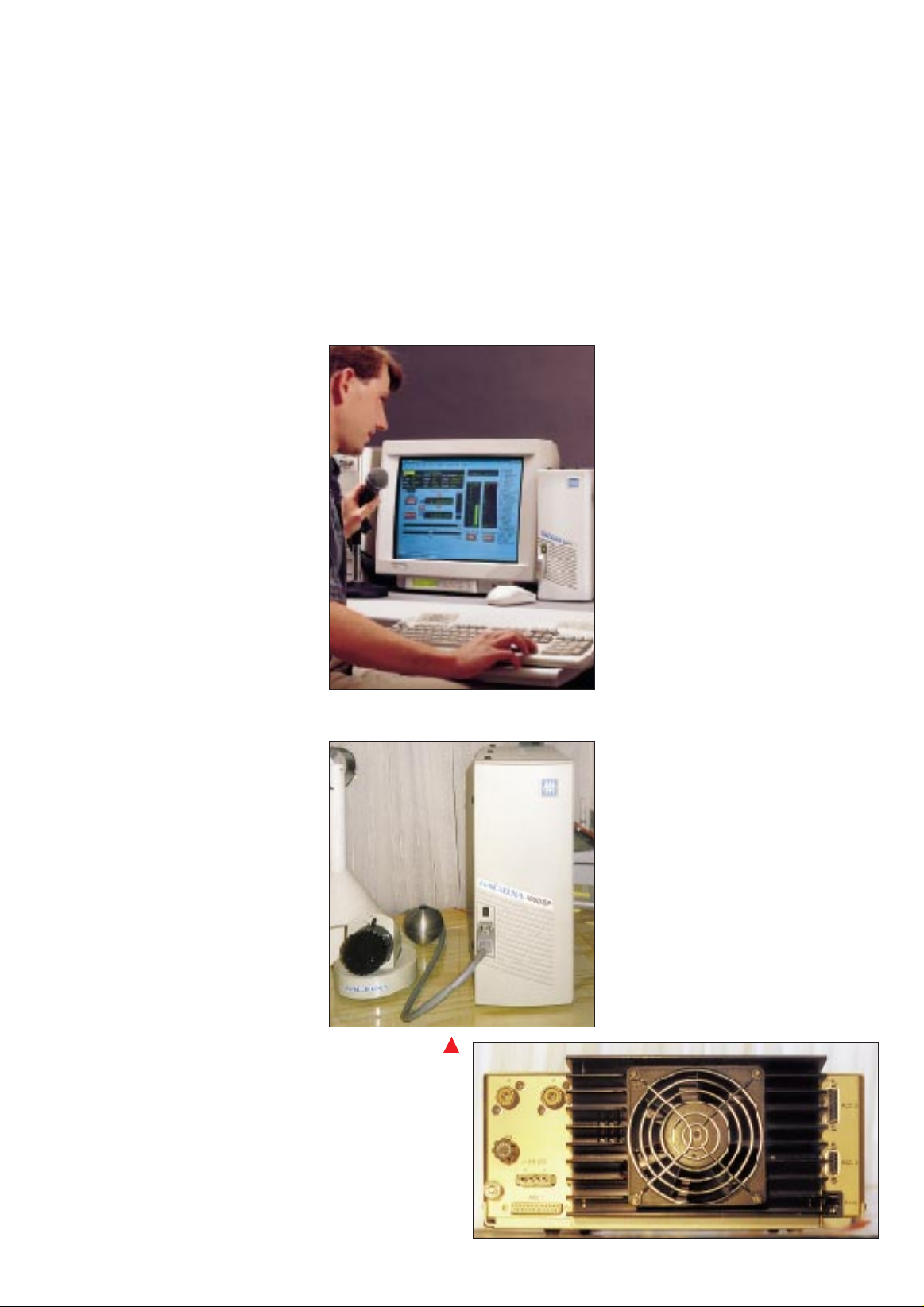
Amateurfunk
Praxistest: PC-gesteuerter
KW-Transceiver Kachina 505 DSP
ULRICH HACKER – DK2BJ
Einen Ausblick auf die Amateurfunkstation des kommenden Jahrtausends
eröffnet der neue komplett PC-gesteuerte Transceiver Kachina 505 DSP,
der aus den USA kommt. Hervorragende HF-Eigenschaften gepaart mit
zeitgemäßer Bedienung zeichnen dieses beeindruckende Gerät aus. Durch
die immer aktuellste Version der Steuersoftware aus dem Internet verändert und verbessert sich das Gerät auch nach Kauf noch.
Wer den Gebrauch von Computern im Amateurfunk als pietätlos in Bausch und Bogen
ablehnt oder dem Aufbau möglichst zahlreicher repräsentativer Geräte mit maximalem
Aufwand an Bedienelementen den Vorrang
einräumt, wird sich für diese Ausführungen
vielleicht nicht interessieren.
Wer aber bereit ist, sich auf etwas im Amateurgerätebereich wirklich Neues einzulassen, lernt einen komplett PC-gesteuerten
Transceiver mit exzellenten technischen Daten kennen, weit über eine neue Spielerei als
Konzession an das PC-Zeitalter hinausgehend. Kommerzielle Funkanwender und
Militär arbeiten schon lange so – und damit
ist auch die Provenienz des hier vorgestellten Gerätes grob umrissen.
■ Erster Eindruck
Der Kachina 505 DSP polarisiert: Entweder
läßt man die Finger gleich davon (was der
Bauer nicht kennt...) oder man verfällt ihm
innerhalb kurzer Zeit. Zugegeben: Dem
Normalamateur verlangt er schon einiges an
Gewöhnung ab. Bereits beim Auspacken
glaubt man eher ein Festspannungsnetzteil in
Händen zu halten (Bilder 1 und 2).
Anstelle einer filigran gestalteten Frontplatte
schaut den Betrachter lediglich eine Sub-DBuchse an, wie man sie von den Rückseite
der Computertower her kennt. Auf der Rückseite (Bild 3) finden sich ein Anschluß für die
Spannungsversorgung und als einziger Hinweis auf ein HF-Gerät zwei PL-Buchsen für
die Antennenanschlüsse. Der mächtige Kühlkörper mit eingebautem Lüfter (für Tropenverhältnisse dimensioniert!) könnte ja auch
einem Netzteil zugeordnet werden.
Das Gerät kann man flach oder senkrecht
aufstellen bzw. es auch in die Nebenkammer
oder auf den Dachboden (!) expedieren, halt
dahin, wo die Koaxialkabel der Antennen
ankommen. Zum Shack, d.h. dem Arbeitsplatz mit PC, führt lediglich ein einziges bis
zu 23 m langes und 7 mm dickes graues
Steuerkabel.
Vom altgewohnten Amateurfunkshack bleiben nur noch das Mikrofon und die Morsetaste erhalten. Der Kopfhörer bereits kann
auch durch das Sound-System des Computers mit der systemimmanenten Beigabe di-
Bild 1: So sieht die Amateurfunkstation mit
einem Kachina 505 DSP aus.
Bild 2:
Für Funkamateure,
die die Frequenz nicht
mit der Maus oder
Up/Down-Tasten
einstellen möchten,
gibt es noch einen
optionalen Drehknopf.
Bild 3:
Die Rückfront
mit dem imposanten
Kühlkörper und
dem Lüfter
gitaler Aufzeichnungsmöglichkeiten interessanter QSO-Passagen ersetzt werden.
Angeschlossen werden diese Requisiten an
ein kleines Bedienteil von der Größe eines
CD-ROM-Laufwerks (Bild 4), das in einen
5,25"-Schacht des Computergehäuses Platz
findet. Für die Montage brauchte ich 10 min.
Mit dem Einschalter, zwei LEDs zur Betriebs- und Sendeanzeige sowie einer Buchsenleiste für die Rückseite des Computers
endet hier die Hardware. Wäre da nicht oft
die verräterische Morsetaste, würde nichts
darauf hindeuten, daß man eine Amateurfunkstelle vor sich hat.
Das Innenleben des Transceivers (Bild 5) ist
Ausdruck eines professionellen und gediegenen Gesamtkonzepts. Alle Leiterplatten
sind steckbar und mehrheitlich durch Weißblechgehäuse abgeschirmt. Lediglich der
optional erhältliche und sehr empfehlenswerte Antennentuner (Bild 6) ist frei einsehbar und interessanterweise per Fuzzy-Logik
abgestimmt.
Nachdem die per Diskette mitgelieferte Software auf dem PC installiert wurde (Minimalforderung Windows 3.11 und 386er) und
man das Kernprogramm ggf. durch die allerneueste Version aus dem Internet ersetzt hat,
kann es losgehen (eine lauffähige Demoversion, die auch ohne Gerät alle Funktionen zugänglich macht, gibt es übrigens unter
www.kachina-az.com
Die auf dem Bildschirm erscheinende virtuelle Frontplatte (Bild 7) mag dem an JapanTransceiver gewöhnten Blick zunächst etwas
mager erscheinen, doch alle gerade nicht zur
Bedienung anstehenden Nebenfunktionen
stehen im Hintergrund bereit. Nur was man
ständig braucht, ist immer da: Lautstärkesteller, das kalibrierte S-Meter, Sendekontrollanzeigen, Datum, Uhrzeit sowie natürlich die Frequenzanzeigen für Senden und
Empfang.
Die Abstimmung kann entweder per Maus
geschehen oder viel praktischer mit den
Pfeil-auf- und Pfeil-ab-Tasten erfolgen. Zur
Wahl der Abstimmgeschwindigkeit läßt sich
jedes Digit bis zur 1-Hz-Stelle wählen. Der
KC 505 DSP verfügt also trotz PLL über
eine quasianaloge Abstimmung! Nur beim
suchenden DXer wird während der Umgewöhnung der sonst in der Griffmulde des
Abstimmknopfes nudelnde Zeigefinger häu-
im Internet!).
http://
520 • FA 5/98
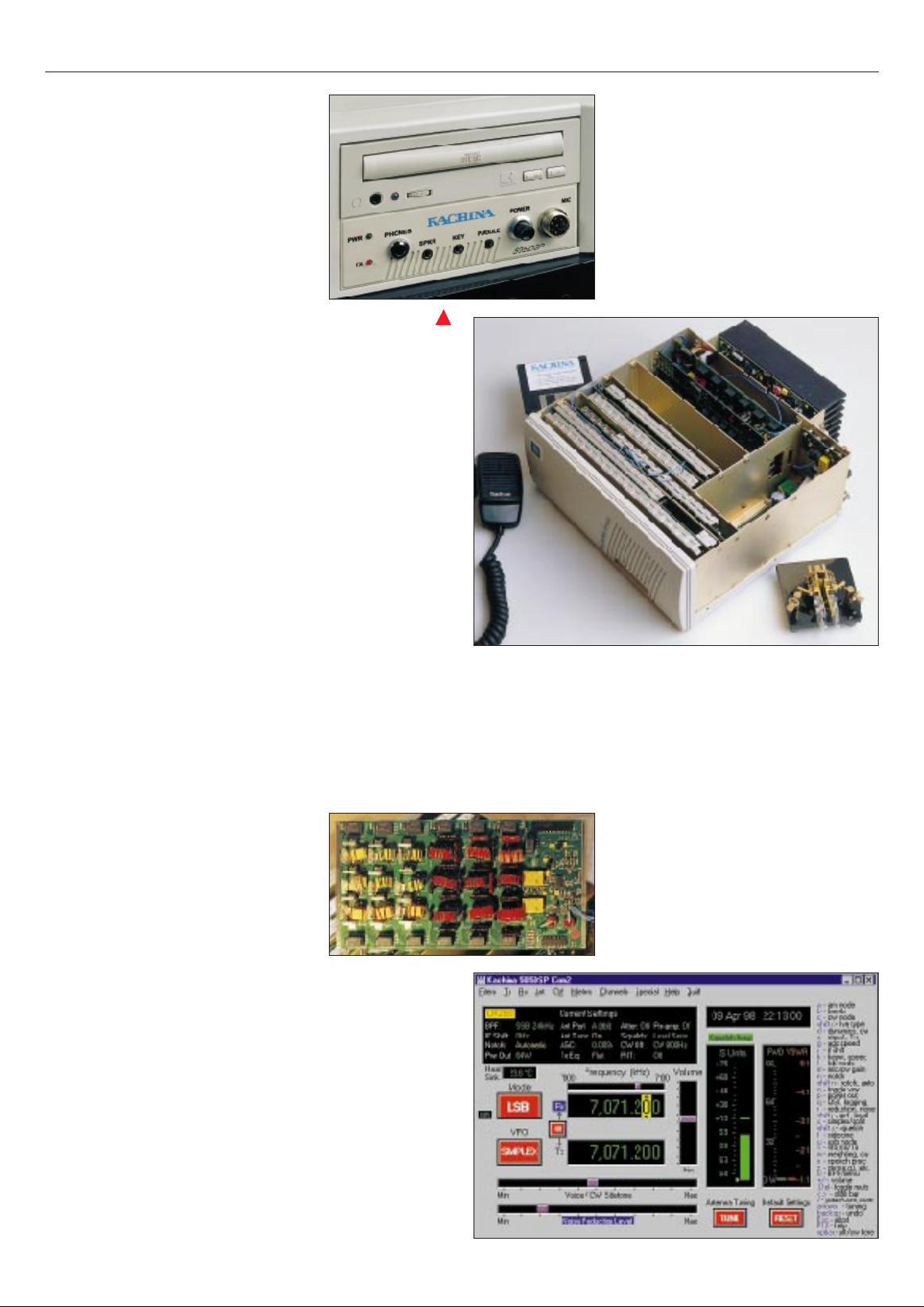
Amateurfunk
figer ins Leere stochern. Da dies bei einigen
Erstbenutzern offenbar zu traumatischen
Entzugserscheinungen führte, bietet der Hersteller mittlerweile einen externen optionalen Abstimmknopf an (Bild 2).
■ Beeindruckende
Empfängereigenschaften
Alltägliche DX-Situation: Frühe Abendstunde im 40-m-Band, zwischen anderen
Signalen eingepfercht mit mäßiger Lautstärke und durch diverse Störungen belastet
ruft VO1WET in SSB CQ Europe. Auf meinem alten Transceiver (ein sogenannter Mittelklassetransceiver japanischer Herkunft
mit allen neun KW-Bändern und zusätzlichem CW-Quarzfilter, vor Jahren als für
den anspruchsvollen DXer geeignet angepriesen) ist die Signalqualität so schlecht,
daß man sich sehr wohl überlegen muß, ob
man ein QSO beginnen sollte.
Auf dem Kachina 505 DSP, SSB-Filter auf
2,1 kHz eingestellt und Noise Reduction
(Lärmwegrechnungssystem des hervorragend konzipierten DSP-Teils des Kachina)
eingeschaltet – und VO1WET ist glasklar zu
hören! Von der Gegenseite wird dem
Sprachsignal Collins-Qualität bescheinigt
(was älteren OMs wohl noch etwas sagt).
Die maximale Signalstärke liegt mit S 7 nicht
viel über dem Störpegel, doch der Vergleichstransceiver zeigt währenddessen einen
um etwa zwei S-Stufen höheren. Konventionell bedienbare Transceiver neuester Bauart
aus Fernost mit DSP mögen da etwas günstiger abschneiden, aber wohl kaum den
Kachina übertreffen.
Solch hervorragende Empfängereigenschaften kommen durch folgendes Konzept zustande:
– nur zwei Zwischenfrequenzen, 75 MHz
und 40 kHz, wobei letztere direkt auf den
DSP (96 dB Dynamik!) arbeitet,
– Mischer und Anpassungsverstärker in
Hochpegelausführung,
– saubere Oszillatorsignale (DDS-PLL) mit
etwa 100 dB Rauschabstand zu den Seitenbändern bereits in 5 kHz Abstand
zum Nutzsignal (nur schwer meßbar, da
die meisten Spektrumanalysatoren nicht
über einen so hohen Dynamikbereich
verfügen),
– Realisierung ausgesprochen steilflankiger
Filter durch entsprechende Programmierung des DSP (die Qualitäten dieser durch
Software realisierten Filter liegen bei denen bester Quarzfilter),
– sehr effizientes Geräuschverminderungs-
system, ebenfalls per Software über DSP
realisiert
Bild 4:
Kachina-PC-Steuereinschub in einem
5,25"-Schacht.
Die Front enthält
neben dem Einschalter lediglich die
Buchsen für Mikrofon,
Lautsprecher und
die beiden Tastenanschlüsse sowie
zwei Leuchtdioden.
Bild 5: Im Innenleben
des Transceivers
äußert sich das pro-
fessionelle und ge-
diegene Gesamt-
konzept. Alle Leiter-
platten sind steckbar
und mehrheitlich
durch Weißblechge-
häuse abgeschirmt.
bei breitbandiger 50-Ω-Technik und großsignalfester Bauweise gilt in der Empfängerentwicklung der Profis seit über 25
Jahren als der Goldweg. Der KC 505 DSP
verfügt über einen Doppelbalance-SchottkyHochstrom-Ringmischer im Eingang, der
beste Anpassung auch im Sperrbereich des
nachfolgenden breiten Filters garantiert.
Bild 6:
Der optional
erhältliche Antennentuner ist nicht
abgeschirmt und
wird per Fuzzy-Logik
abgestimmt.
Fotos: Kachina (1),
Nils Schiffhauer,
DK8OK (2), DK2JB (3)
Die Beschränkung auf zwei Zwischenfrequenzen wirkt sich überaus positiv aus, denn
je „seltener“ gemischt wird, desto weniger
unerwünschte Nebenprodukte entstehen.
Ein Eingangs-IP3 von +30 dBm darf heute
als absoluter professioneller Spitzenwert gelten (in Einzelexemplaren auch von Funkamateuren realisiert). Der Kachina liegt da
mit seinen typischen +18 dBm Werksangabe
recht gut im Rennen. Neuere Geräte bewegten sich alle über +20 dBm! Jedes einzelne
wird übrigens mit Meßprotokoll ausgeliefert.
Mein Testexemplar wies sogar einen Eingangs-IP3 von +21,5 dBm auf, nicht etwa
durchs CW-Filter gemessen oder bei eingeschaltetem 20-dB-Eingangsabschwächer (der
ist trotzdem nötig, wenn man in den Abendstunden an breitbandigen Drahtantennen arbeitet) gemessen.
Für etwa 500 DM soll ein amateurbandselektives und automatisch umgeschaltetes
Eingangsfilter als Zubehör angeboten werden, das Probleme solcher Art beseitigen
dürfte. Ich habe den 505 DSP zu allen Tageszeiten an einer 7-Band-Vertikal R 7000
betrieben.
An Antennen dieser Kategorie treten auch
ohne Eingangsfilter kaum einmal Intermodulationsprodukte auf.
Die erste Zwischenfrequenz über der höchsten Nutzfrequenz bei relativ grober Vorselektion und dann Mischung auf eine niedrige zweite ZF mit hochselektiven Filtern
Bild 7:
Die virtuelle
Frontplatte des
Kachina 505 DSP
FA 5/98 • 521
 Loading...
Loading...