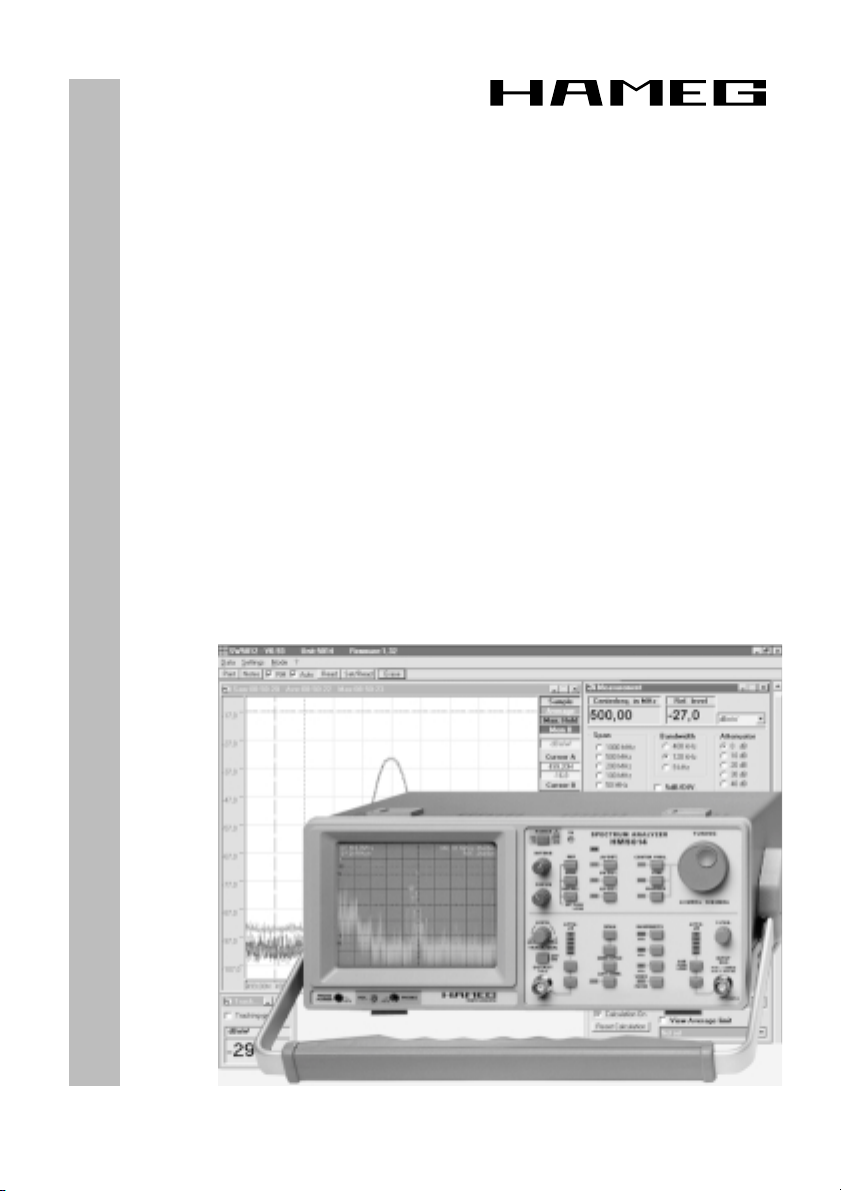
DEUTSCH
®
Instruments
Handbuch
Spektrumanalysator
HM5012/14
Software
SW5012
MANUAL•HANDBUCH•MANUEL

Spektrumanalysator HM5012 / HM5014
Spektrumanalysator HM5012 und HM5014................................... 6
HZ530-Sondensatz für EMV-Diagnose (Lieferbares Zubehör) .... 7
Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung ............................... 4
CE-Konformitätserklärung ............................................................... 4
HZ560 Transient Limiter................................................................... 8
Allgemeines ....................................................................................... 9
Symbole ............................................................................................... 9
Aufstellung des Gerätes ..................................................................... 9
Sicherheit ........................................................................................... 10
Betriebsbedingungen ........................................................................ 11
Wartung ............................................................................................. 12
Netzspannungsumschaltung ....................................................... 12
Funktionsprinzip ........................................................................... 13
Betriebshinweise ......................................................................... 14
Bedienelemente............................................................................... 16
Erste Messungen ............................................................................. 28
St. 201000 Zim/tke
2
Einführung in die Spektrum-Analyse ........................................... 30
Grundlagen Spektrum-Analysatoren ........................................... 31
Anforderungen an Spektrum-Analysatoren ................................ 33
Frequenzmessung ....................................................................... 34
Stabilität ....................................................................................... 34
Auflösung ..................................................................................... 35
Rauschen ..................................................................................... 36
Video-Filter ................................................................................... 38
Empfindlichkeit - Max. Eingangspegel ........................................ 38
Frequenzgang .............................................................................. 39
Mitlaufgeneratoren ...................................................................... 40
CODES serielle Schnittstelle RS232 ............................................. 42
Spektrum-Analysator HM 5012 / HM5014 ................................. 42
Befehle vom PC zum HM 5012 / 5014 ....................................... 42
Abfrage der Parameter: ............................................................... 43
Änderungen vorbehalten

Inhaltsverzeichnis
Software SW5012
Software SW5012 ........................................................................... 46
Pulldown Menue 1: ......................................................................... 46
Pulldown Menue 2: (Einstellung Mode Normal) ........................ 49
Pulldown Menue 3: ......................................................................... 49
Funktionsweise des EMC-Modes, Aufgabe der Software ......... 51
Änderungen vorbehalten
Data .............................................................................................. 46
Settings ........................................................................................ 49
Mode ............................................................................................ 49
Betriebsarten ............................................................................... 50
Normal Mode ............................................................................... 50
Correction on ............................................................................... 50
Calculation on............................................................................... 50
Definition neuer Komponenten ................................................... 52
Erstellen einer Konfiguration ....................................................... 54
Definieren der Grenzlinien ........................................................... 55
Test erstellen ............................................................................... 56
EMC-Tests durchführen .............................................................. 58
3

Allgemeine Hinweise zur CE-Kennzeichnung
HAMEG Meßgeräte erfüllen die Bestimmungen der EMV Richtlinie. Bei der Konformitätsprüfung werden von HAMEG die gültigen Fachgrund- bzw. Produktnormen zu Grunde gelegt. In
Fällen wo unterschiedliche Grenzwerte möglich sind, werden von HAMEG die härteren Prüfbedingungen angewendet. Für die Störaussendung werden die Grenzwerte für den Geschäftsund Gewerbebereich sowie für Kleinbetriebe angewandt (Klasse 1B). Bezüglich der Störfestigkeit
finden die für den Industriebereich geltenden Grenzwerte Anwendung.
Die am Meßgerät notwendigerweise angeschlossenen Meß- und Datenleitungen beeinflußen die
Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte in erheblicher Weise. Die verwendeten Leitungen sind
jedoch je nach Anwendungsbereich unterschiedlich. Im praktischen Meßbetrieb sind daher in
Bezug auf Störaussendung bzw. Störfestigkeit folgende Hinweise und Randbedingungen unbedingt zu beachten:
1. Datenleitungen
Die Verbindung von Meßgeräten bzw. ihren Schnittstellen mit externen Geräten (Druckern,
Rechnern, etc.) darf nur mit ausreichend abgeschirmten Leitungen erfolgen. Sofern die Bedienungsanleitung nicht eine geringere maximale Leitungslänge vorschreibt, dürfen Datenleitungen
(Eingang/Ausgang, Signal/Steuerung) eine Länge von 3 Metern nicht erreichen und sich nicht
außerhalb von Gebäuden befinden. Ist an einem Geräteinterface der Anschluß mehrerer
Schnittstellenkabel möglich, so darf jeweils nur eines angeschlossen sein.
Bei Datenleitungen ist generell auf doppelt abgeschirmtes Verbindungskabel zu achten. Als IEEEBus Kabel sind die von HAMEG beziehbaren doppelt geschirmten Kabel HZ72S bzw. HZ72L
geeignet.
2. Signalleitungen
Meßleitungen zur Signalübertragung zwischen Meßstelle und Meßgerät sollten generell so
kurz wie möglich gehalten werden. Falls keine geringere Länge vorgeschrieben ist, dürfen
Signalleitungen (Eingang/Ausgang, Signal/Steuerung) eine Länge von 3 Metern nicht erreichen
und sich nicht außerhalb von Gebäuden befinden.
Alle Signalleitungen sind grundsätzlich als abgeschirmte Leitungen (Koaxialkabel - RG58/U) zu
verwenden. Für eine korrekte Masseverbindung muß Sorge getragen werden. Bei Signalgeneratoren müssen doppelt abgeschirmte Koaxialkabel (RG223/U, RG214/U) verwendet werden.
3. Auswirkungen auf die Meßgeräte
Beim Vorliegen starker hochfrequenter elektrischer oder magnetischer Felder kann es trotz
sorgfältigen Meßaufbaues über die angeschlossenen Meßkabel zu Einspeisung unerwünschter
Signalteile in das Meßgerät kommen. Dies führt bei HAMEG Meßgeräten nicht zu einer Zerstörung oder Außerbetriebsetzung des Meßgerätes.
Geringfügige Abweichungen des Meßwertes über die vorgegebenen Spezifikationen hinaus
können durch die äußeren Umstände in Einzelfällen jedoch auftreten.
Dezember 1995
HAMEG GmbH
4
Änderungen vorbehalten
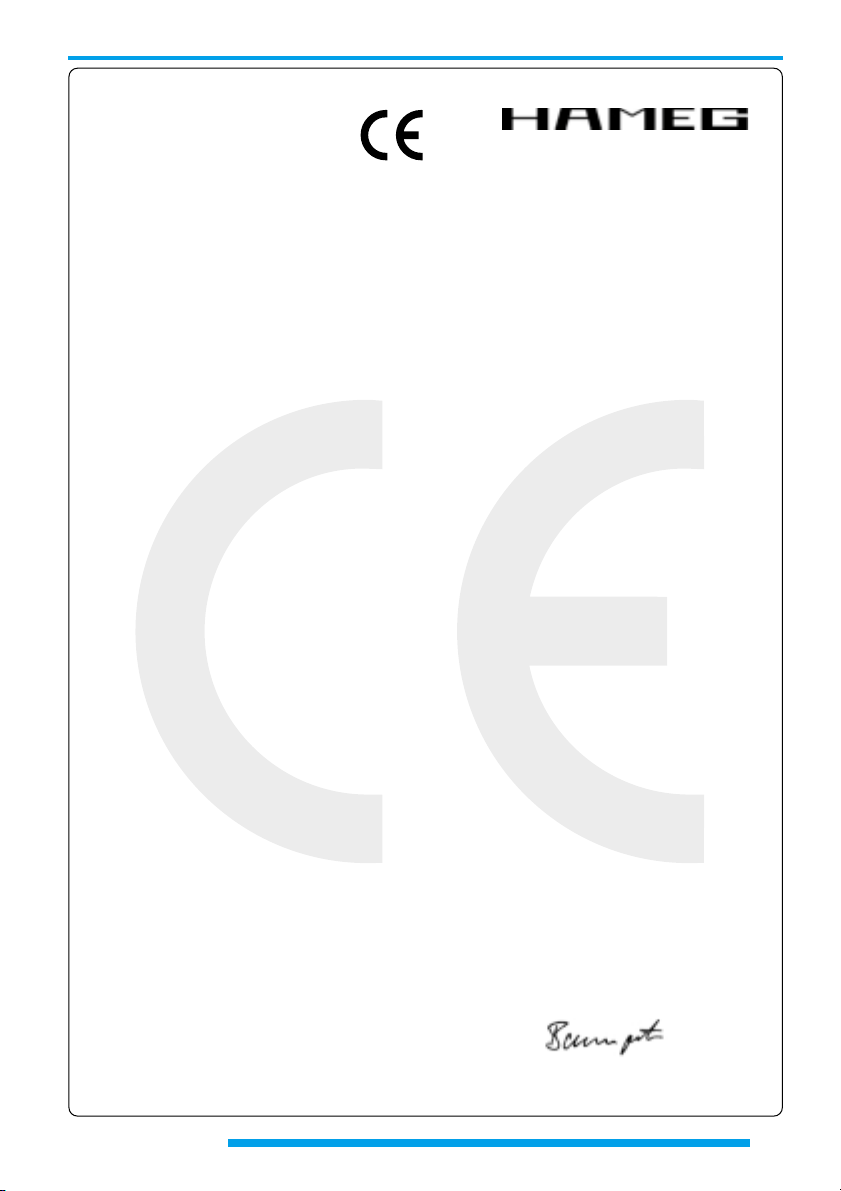
KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
DECLARATION OF CONFORMITY
DECLARATION DE CONFORMITE
Name und Adresse des Herstellers HAMEG GmbH
Manufacturer´s name and address Kelsterbacherstraße 15-19
Nom et adresse du fabricant D - 60528 Frankfurt
HAMEG S.a.r.l.
5, av de la République
F - 94800 Villejuif
Die HAMEG GmbH / HAMEG S.a.r.l bescheinigt die Konformität für das Produkt
The HAMEG GmbH / HAMEG S.a.r.l herewith declares conformity of the product
HAMEG GmbH / HAMEG S.a.r.l déclare la conformite du produit
®
Instruments
Bezeichnung / Product name / Designation:
Typ / Type / Type:
mit / with / avec:
Optionen / Options / Options:
mit den folgenden Bestimmungen / with applicable regulations / avec les directives suivantes
EMV Richtlinie 89/336/EWG ergänzt durch 91/263/EWG, 92/31/EWG
EMC Directive 89/336/EEC amended by 91/263/EWG, 92/31/EEC
Directive EMC 89/336/CEE amendée par 91/263/EWG, 92/31/CEE
Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG ergänzt durch 93/68/EWG
Low-Voltage Equipment Directive 73/23/EEC amended by 93/68/EEC
Directive des equipements basse tension 73/23/CEE amendée par 93/68/CEE
Angewendete harmonisierte Normen / Harmonized standards applied / Normes harmonisées utilisées
Sicherheit / Safety / Sécurité
EN 61010-1: 1993 / IEC (CEI) 1010-1: 1990 A 1: 1992 / VDE 0411: 1994
EN 61010-1/A2: 1995 / IEC 1010-1/A2: 1995 / VDE 0411 Teil 1/A1: 1996-05
Überspannungskategorie / Overvoltage category / Catégorie de surtension: II
Verschmutzungsgrad / Degree of pollution / Degré de pollution: 2
Elektromagnetische Verträglichkeit / Electromagnetic compatibility /
Compatibilité électromagnétique
EN 61326-1/A1
Störaussendung / Radiation / Emission: Tabelle / table / tableau 4; Klasse / Class / Classe B.
Störfestigkeit / Immunity / Imunitee: Tabelle / table / tableau A1.
EN 61000-3-2/A14
Oberschwingungsströme / Harmonic current emissions / Émissions de courant harmonique: Klasse / Class / Classe D.
EN 61000-3-3
Spannungsschwankungen u. Flicker / Voltage fluctuations and flicker /
Fluctuations de tension et du flicker.
Datum /Date /Date Unterschrift / Signature /Signatur
Spektrum-Analysator/Spectrum Analyzer/Analyseur de spectre
HM5012/ 5014
-
-
15.01.2001
E. Baumgartner
Technical Manager
Directeur Technique
Änderungen vorbehalten
5

Spektrumanalysator HM5012 u. HM5014
I Durchgehender Frequenzbereich von 0,15MHz bis 1,05GHz.
I 5stellige Digitalanzeige für Mitten- u. Marker-Frequenz (Aufl. 0,1MHz).
I Amplitudenbereich –100 bis +13dBm;
I Auflösungsbandbreiten 9kHz, 120 kHz, 400kHz- und Video-Filter
I Max Hold-Function, Digitales AVERAGE
I Tracking Generator (nur HM 5014), Freq. 0,15MHz bis 1,05GHz,
Pegel +1dBm bis –50dBm (an 50
Die Geräte HM5012 und
HM5014 eignen sich für fast
alle Arten der Signalanalyse
im Frequenzbereich von
0,15MHz bis 1,05GHz. Beide Modelle besitzen eine
Einstellmöglichkeit für den
Span. Mit diesem ist das auf
dem Bildschirm sichtbare
Frequenzspektrum zwischen 1MHz und 1000MHz
einstellbar. Vor allem die damit verbundene höhere Auflösung in den kleineren
Bereichen erlaubt insbesondere die Analyse von schmalbandigen Signalen.
Ein anderer, qualitativ wesentlicher Gesichtspunkt ist, daß auch die Amplituden-
werte der dargestellten Signale recht genau erfaßbar sind. Der gesamte Meßbereich, einschließlich der zuschaltbaren Eingangsteiler, erstreckt sich von -100dBm
bis +13dBm, wovon 80dB (10dB/cm) auf den Anzeigebereich der Bildröhre
entfallen. Selektive Pegelmessungen können im „Zero-Span“-Betrieb durchgeführt werden.
ΩΩ
Ω).
ΩΩ
Im HM5014 befindet sich zusätzlich ein Tracking- (Mitlauf)-Generator, mit dem
auch Frequenzgang-Messungen an Vierpolen durchführbar sind. Dabei handelt
es sich um eine vom Spektrum-Analysator gesteuerte frequenzsynchrone Signalquelle, deren Frequenzbereich von 150kHz bis 1,05GHz reicht. Der Ausgangspegel ist zwischen –50dBm und +1dBm in 10dB-Stufen und variabel veränderbar.
Die Geräte HM5012 und HM5014 sind äußerst preiswert. Sie erlauben zahlreiche Anwendungen im gesamten Bereich der HF-Meßtechnik, wie z.B. bei der
qualitativen EMV-Messung. Dabei zeichnen sich die Geräte durch eine gleichbleibend hohe Meßrate und äußerst geringe Störstrahlung aus. Mit ihrer guten
Ausstattung und der einfachen Bedienung sind sie wieder ein Beweis für die
überzeugende Leistungsfähigkeit von HAMEG-Produkten.
6
Änderungen vorbehalten

Technische Daten
Frequenzeigenschaften
Frequenz Bereich: 0,15MHz bis 1050MHz
Auflösung der Frequenz Anzeige:
10kHz (5½ Digit im Readout)
Centerfrequenzanzeige: 0 bis 1050MHz
Genauigkeit Mittenfrequenz: ±100kHz
Stabilität (Drift): <150kHz/Std.
Frequenzhub: 1MHz bis 1000MHz
mit 1-2-5 Teilung +0Hz/cm (Zero Span)
Linearitätsgenauigkeit: ±5%
Marker Auflösung (Frequenz): 5½ Digit
Marker Auflösung (Pegel): 3½ Digit
Marker Readout Genauigkeit:
±(0,1% Span + 100kHz)
ZF-Bandbreite (-3dB):
Auflösung: 9kHz, 120kHz, 400kHz
Video Filter: 4kHz
Wobelzeit: 40ms, 320ms
Amplitudeneigenschaften
Messbereich: -100dBm bis +13dBm
Mittlerer Angezeigter Rauschpegel:
-102dBm (120kHz RBW)
Anzeigegenauigkeit: ±2dB
Eingangsabschwächer: 0 bis 40dB (4 x 10dB)
Genauigkeit der Abschwächer: ±1dB
Maximale Eingangspegel:
Abschwächer > 20dB +20dBm (0,1W)
Abschwächer = 0dB +10dBm
DC ±25V
Anzeigebereich: 40dB, 80dB (5/10 dB/cm)
Messeinheit: dBm
Referenzpegel: -99dBm bis +13dBm
Referenzpegelgenauigkeit: ±2dBm
Intermodulation (3. Ordnung): <-75dBc
(2 Signale, jedes -27dBm, Frequenzabstand >3MHz)
Harmonische Störungen
(2.te und 3.te): <-75dBc
Ein-/Ausgangs-Charakteristiken
HF-Eingang: BNC(F) Impedanz: 50Ω
Tastkopfspannung:+6V(Nahfeld Sonde HZ530)
Tracking Generator Ausgang (HM5014):
BNC(F) Impedanz: 50Ω
Spezialfunktionen
Average: 32 Messungen
SAVE/RECALL: 10 Einstellungen
Max. HOLD:
HOLD: Signal wird in Speicher gehalten
Aktuelles Signal minus gespeichertes Signal
A-B:
AM Demodulator: Kopfhörer
Tracking generator
Ausgangspegel Bereich: -50dBm bis +1dBm
(10dB Stufen + Variabel)
Ausgangsabschwächer: 0 bis 40dB (4 x 10dB)
Ausgangsfreq. Bereich:0,15MHz bis 1050MHz
Frequenzgang:(0,15MHz bis 1050MHz) ±1,5dB
HF-Störer:
Harmonisch >-20dBc
Nicht Harmonisch >-20dBc
Allgemeines
Betriebsbedingungen: 10° bis 40°C
Röhre: 8 x 10cm; Innenraster
Strahldrehung: auf Frontseite einstellbar
Netzanschluß: 115 / 230V, 50-60Hz
Leistungsaufnahme :ca. 33W/(HM5014 ca. 43W)
Schutzart: Schutzklasse I (VDE 0411)
Gewicht: ca. 6kg
Gehäusemaße: B 285, H 125, T 380mm
Mit verstellbarem Aufstell-Tragegriff
HZ530-Sondensatz für EMV-Diagnose (Lieferbares Zubehör)
Der HZ530-Sondensatz besteht aus drei aktiven Breitbandsonden für die EMV-Diagnose
in der Entwicklung elektronischer Baugruppen und Geräte auf Laborebene. Er enthält eine
aktive Magnetfeldsonde (H-Feld-Sonde), einen aktiven E-Feld-Monopol und eine aktive
Änderungen vorbehalten
7
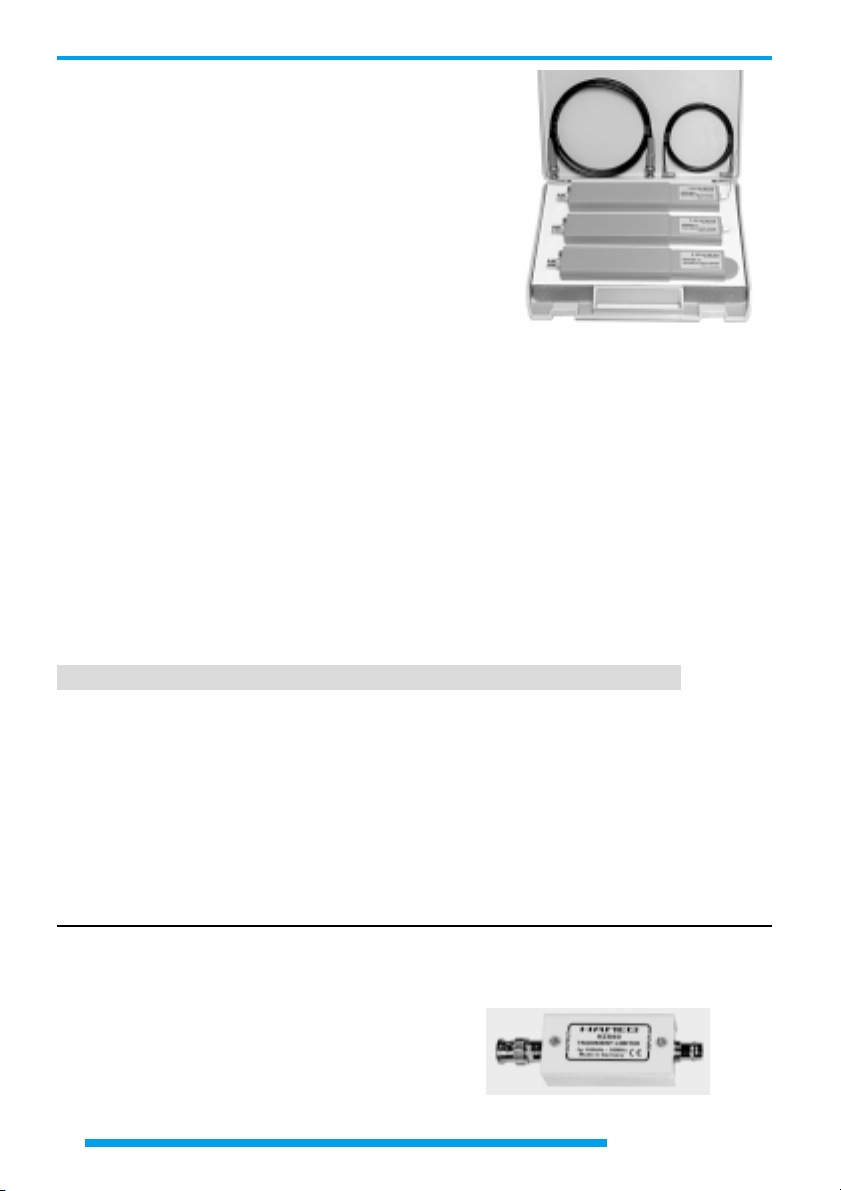
Hochimpedanzsonde. Die Sonden sind zum Anschluß
an einen Spektrumanalysator vorgesehen und haben
daher einen koaxialen Ausgang mit einem Wellenwiderstand von 50Ω. Die H-Feld-Sonde gibt einen der
magnetischen Wechsel-Feldstärke proportionalen Pegel
ab. Mit ihr können Störquellen in elektronischen Baugruppen relativ eng lokalisiert werden und Abschirmungen auf „undichte“ Stellen untersucht werden.
Die Hochimpedanzsonde ermöglicht eine Untersuchung
des Störpegels auf einzelnen Kontakten oder Leiterbahnen. Sie belastet den zu prüfenden Meßpunkt mit
nur 2pF. Dadurch kann direkt in der Schaltung gemessen werden, ohne nennenswerte Veränderungen der Verhältnisse durch den Meßeingriff.
Der E-Feld-Monopol wird z.B. verwendet, um die Wirkung von Abschirmmaßnahmen zu
prüfen. Mit ihm kann auch die Gesamtwirkung von Filtermaßnahmen beurteilt werden,
soweit sie etwa das Gerätegehäuse verlassende Kabel und Leitungen betreffen. Ferner
kann man mit dem E-Feld-Monopol Relativmessungen zu Abnahmeprotokollen durchführen. Die Sonden haben je nach Typ eine Bandbreite von 100kHz bis über 1000MHz.
Der Anschluß der Sonden an Spektrumanalysator, Meßempfänger oder Oszilloskop
erfolgt über ein ca. 1,5m langes BNC-Koaxialkabel. Die in den Sonden schon eingebauten
Vorverstärker (Verstärkung ca. 30 dB) erübrigen den Einsatz von externen Zusatzgeräten.
Die Sonden werden entweder durch einsetzbare Batterien/Akkus betrieben oder können
direkt aus dem HAMEG Spektrumanalysator HM5012/14 mit Spannung versorgt werden.
Mittels eines Akkusatzes hat jede Sonde eine Betriebsdauer von ca. 20 - 30 Stunden.
Technische Daten:
Frequenzbereiche: 100kHz – 1.0GHz
Versorgungsspannung: 6V aus HM5012/14 oder Batterie
Stromaufnahme: ca. 10-24 mA
Sondenmaße: 40x19x195mm
Gehäuse: Kunststoff, innen elektrisch geschirmt
Lieferform: 3 Sonden im Transportkoffer
1 BNC-Kabel 1,5m, 1 Spannungsversorgungskabel
Batterien (Type Mignon) gehören nicht zum Lieferumfang
HZ560 Transient Limiter
Zum Schutz des Eingangskreises von Spektrum-analysatoren insbesondere bei der Verwendung der Netznachbildung HM6050
Frequenzbereich: 150kHz-30MHz
8
Änderungen vorbehalten
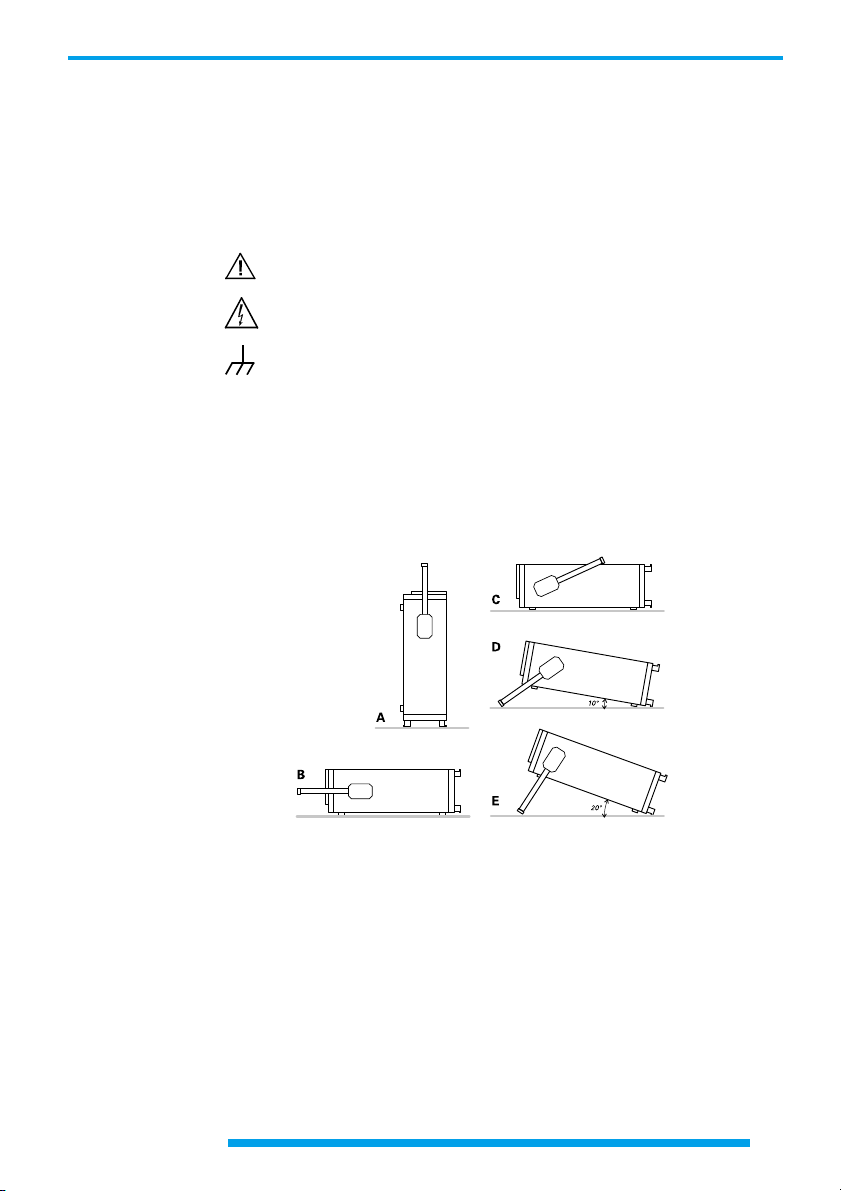
Allgemeines
Sofort nach dem Auspacken sollte das Gerät auf mechanische
Beschädigungen und lose Teile im Innern überprüft werden.
Falls ein Transportschaden vorliegt, ist sofort der Lieferant zu
informieren. Das Gerät darf dann nicht in Betrieb gesetzt werden.
Symbole
Bedienungsanleitung beachten
Hochspannung
Erde
Aufstellung des Gerätes
Für die optimale Betrachtung des Bildschirmes kann das Gerät
in drei verschiedenen Positionen aufgestellt werden (siehe
Bilder C, D, E). Wird das Gerät nach dem Tragen senkrecht
aufgesetzt, bleibt der Griff automatisch in der Tragestellung
stehen, siehe Abb. A.
Bedienungsanleitung
Änderungen vorbehalten
Will man das Gerät waagerecht auf eine Fläche stellen, wird der
Griff einfach auf die obere Seite des Gerätes gelegt (Abb. C).
Wird eine Lage entsprechend Abb. D gewünscht (10° Neigung),
ist der Griff, ausgehend von der Tragestellung A, in Richtung
Unterkante zu schwenken bis er automatisch einrastet. Wird für
die Betrachtung eine noch höhere Lage des Bildschirmes erforderlich, zieht man den Griff wieder aus der Raststellung und
drückt ihn weiter nach hinten, bis er abermals einrastet (Abb. E
mit 20° Neigung).
9
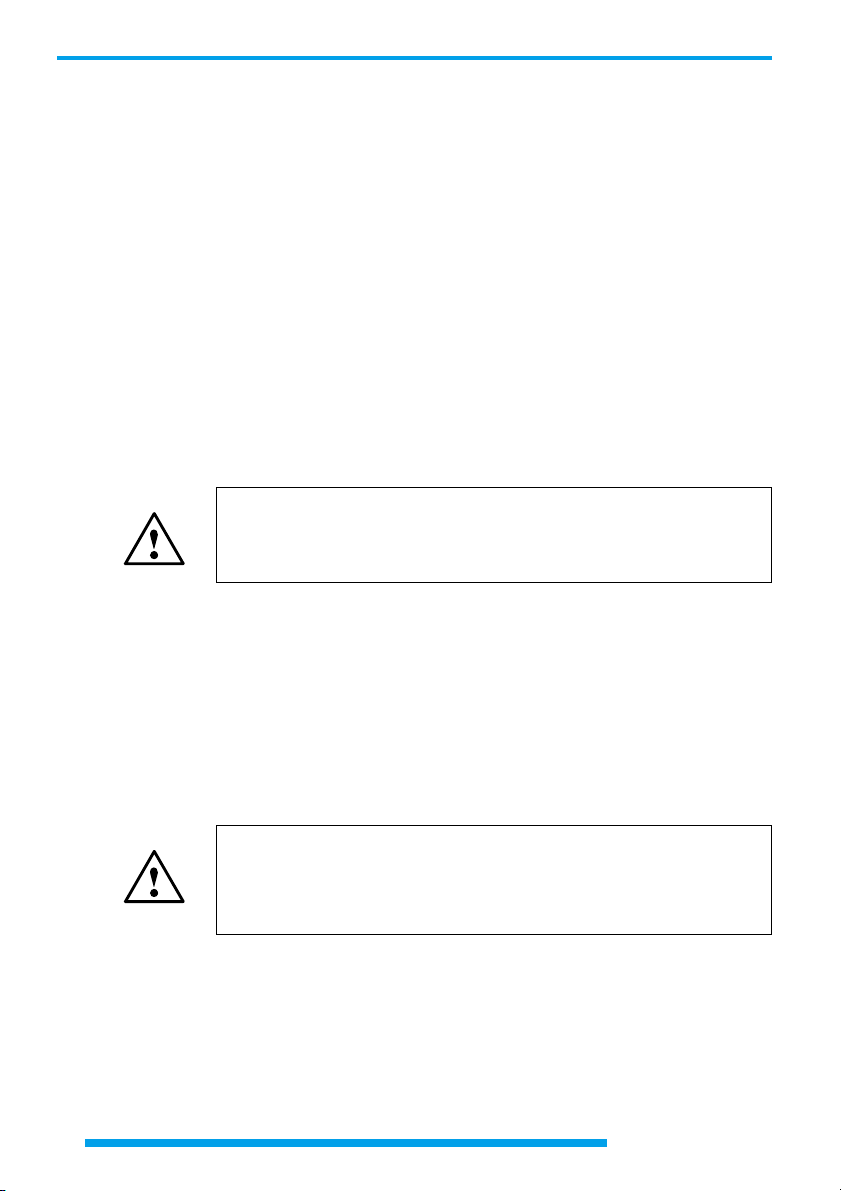
Bedienungsanleitung
Der Griff läßt sich auch in eine Position für waagerechtes Tragen
bringen. Hierfür muß man diesen in Richtung Oberseite schwenken und, wie aus Abb. B ersichtlich, ungefähr in der Mitte schräg
nach oben ziehend einrasten. Dabei muß das Gerät gleichzeitig
angehoben werden, da sonst der Griff sofort wieder ausrastet.
Sicherheit
Dieses Gerät ist gemäß VDE 0411 Teil 1, Sicherheitsbestimmungen für elektrische Meß-, Steuer-, Regel- und Laborgeräte, gebaut und geprüft und hat das Werk in sicherheits-
technisch einwandfreiem Zustand verlassen. Es entspricht damit auch den Bestimmungen der europäischen Norm EN 610101 bzw. der internationalen Norm IEC 1010-1. Um diesen Zustand
zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muß
der Anwender die Hinweise und Warnvermerke beachten, die in
dieser Bedienungsanleitung, im Testplan und in der ServiceAnleitung enthalten sind.
Gehäuse, Chassis und alle Meßanschlüsse sind mit dem
Netzschutzleiter verbunden. Das Gerät entspricht den
Bestimmungen der Schutzklasse I.
Die berührbaren Metallteile sind gegen die Netzpole mit 2200V
Gleichspannung geprüft.
10
Durch Verbindung mit anderen Netzanschlußgeräten können
u.U. netzfrequente Brummspannungen im Meßkreis auftreten.
Dies ist bei Benutzung eines Schutz-Trenntransformators der
Schutzklasse II leicht zu vermeiden. Das Gerät darf aus Sicherheitsgründen nur an vorschriftsmäßigen Schutzkontaktsteckdosen betrieben werden.
Der Netzstecker muß eingeführt sein, bevor Signalstromkreise angeschlossen werden.
Die Auftrennung der Schutzkontaktverbindung ist
unzulässig.
Die meisten Elektronenröhren generieren γ-Strahlen. Bei diesem Gerät bleibt die Ionendosisleistung weit unter dem
gesetzlich zulässigen Wert von 36 pA/kg.
Wenn anzunehmen ist daß ein gefahrloser Betrieb nicht mehr
möglich ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen
Änderungen vorbehalten

unabsichtlichen Betrieb zu sichern. Diese Annahme ist berechtigt,
• wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen hat,
• wenn das Gerät lose Teile enthält,
• wenn das Gerät nicht mehr arbeitet,
• nach längerer Lagerung unter ungünstigen Verhältnissen
(z.B. im Freien oder in feuchten Räumen),
• nach schweren Transportbeanspruchungen
(z.B. mit einer Verpackung, die nicht den Mindestbedingungen von Post, Bahn oder Spedition entsprach).
Betriebsbedingungen
Der zulässige Umgebungstemperaturbereich während des Betriebs reicht von +10°C... +40°C. Während der Lagerung oder
des Transports darf die Temperatur zwischen -40°C und +70°C
betragen. Hat sich während des Transports oder der Lagerung
Kondenswasser gebildet, muß das Gerät ca. 2 Stunden akklimatisiert werden, bevor es in Betrieb genommen wird. Das Meßgerät ist zum Gebrauch in sauberen, trockenen Räumen bestimmt. Es darf nicht bei besonders großem Staub- bzw.
Feuchtigkeitsgehalt der Luft, bei Explosionsgefahr sowie bei
aggressiver chemischer Einwirkung betrieben werden. Die
Betriebslage ist beliebig. Eine ausreichende Luftzirkulation
(Konvektionskühlung) ist jedoch zu gewährleisten. Bei Dauerbetrieb ist folglich eine horizontale oder schräge Betriebslage
(Aufstellbügel) zu bevorzugen.
Bedienungsanleitung
Garantie
Änderungen vorbehalten
Jedes Gerät durchläuft vor dem Verlassen der Produktion einen
Qualitätstest mit 10-stündigem ,,burn-in”. Im intermittierenden
Betrieb wird dabei fast jeder Frühausfall erkannt. Dem folgt ein
100% Test jedes Gerätes, bei dem alle Betriebsarten und die
Einhaltung der technischen Daten geprüft werden.
Dennoch ist es möglich, daß ein Bauteil erst nach längerer
Betriebsdauer ausfällt. Daher wird auf alle Geräte eine Funktions-
garantie von 2 Jahren gewährt. Voraussetzung ist, daß im
Gerät keine Veränderungen vorgenommen wurden. Für Versendungen per Post, Bahn oder Spedition wird empfohlen, die
Originalverpackung zu verwenden. Transport- oder sonstige
Schäden, verursacht durch grobe Fahrlässigkeit, werden von
der Garantie nicht erfaßt.
11
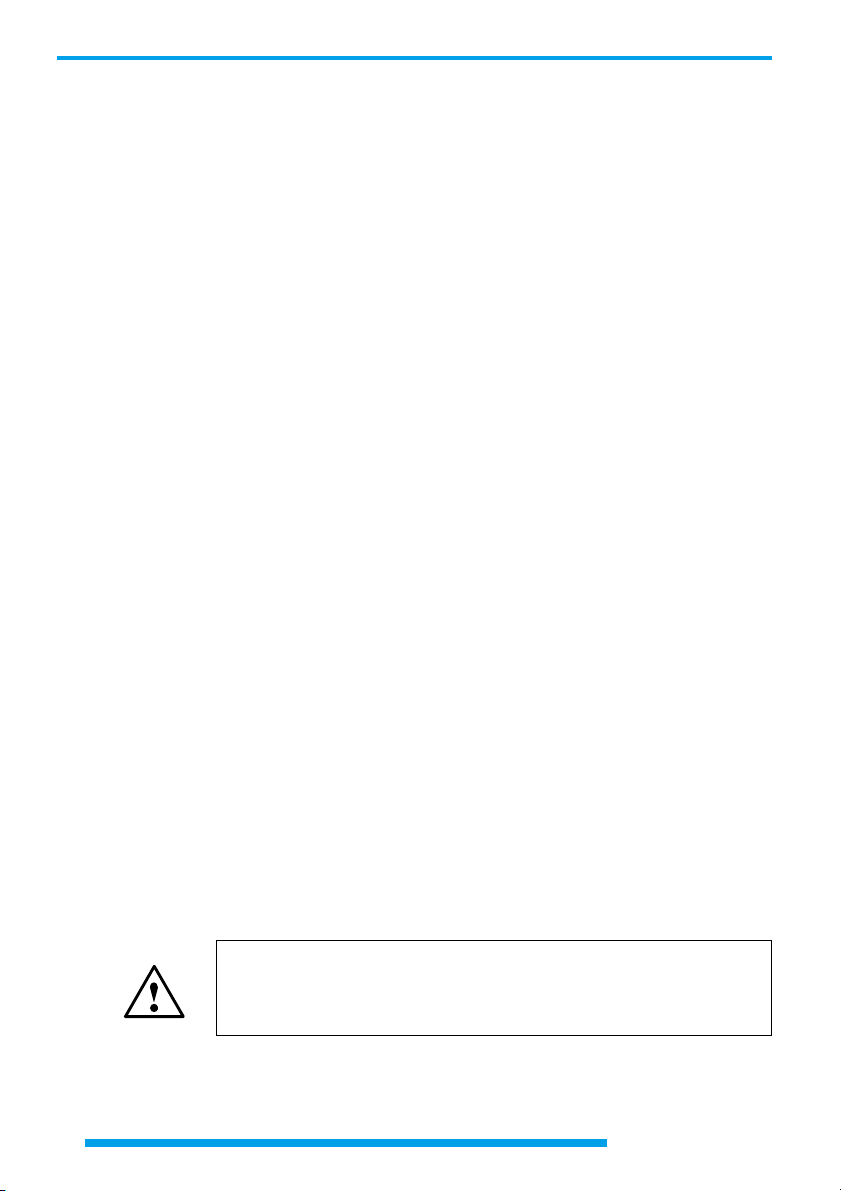
Bedienungsanleitung
Bei einer Beanstandung sollte man am Gehäuse des Gerätes
eine stichwortartige Fehlerbeschreibung anbringen. Wenn dabei gleich der Name und die Telefon-Nr. (Vorwahl und Ruf- bzw.
Durchwahl-Nr. oder Abteilungsbezeichnung) für evtl. Rückfragen angegeben wird, dient dies einer beschleunigten Abwicklung.
Wartung
Verschiedene wichtige Eigenschaften des Spektrum-Analysators
sollten in gewissen Zeitabständen sorgfältig überprüft werden.
Nur so besteht eine weitgehende Sicherheit, daß alle Signale
mit der den technischen Daten zugrundeliegenden Exaktheit
dargestellt werden.
Die Außenseite des Spektrum-Analysators sollte regelmäßig
mit einem Staubpinsel gereinigt werden. Hartnäckiger Schmutz
an Gehäuse und Griff, den Kunststoff- und Aluminiumteilen läßt
sich mit einem angefeuchteten Tuch (Wasser +1% Entspannungsmittel) entfernen. Bei fettigem Schmutz kann Brennspiritus oder Waschbenzin (Petroleumäther) benutzt werden. Die
Sichtscheibe darf nur mit Wasser oder Waschbenzin (aber nicht
mit Alkohol oder Lösungsmitteln) gereinigt werden, sie ist dann
noch mit einem trockenen, sauberen, fusselfreien Tuch nachzureiben. Nach der Reinigung sollte sie mit einer handelsüblichen
antistatischen Lösung, geeignet für Kunststoffe, behandelt
werden. Keinesfalls darf die Reinigungsflüssigkeit in das Gerät
gelangen. Die Anwendung anderer Reinigungsmittel kann die
Kunststoff- und Lackoberflächen angreifen.
Netzspannungsumschaltung
Bei Lieferung ist das Gerät auf 230V Netzspannung eingestellt.
Die Umschaltung auf 115V erfolgt am Netzspannungsumschalter
mittels eines kleinen Schraubenziehers, der in den dafür vorgesehenen Schlitz zu stecken ist. Der Netzspannungsumschalter
befindet sich hinter einer Öffnung auf der Geräterückwand und
zeigt die eingestellte Netzspannung an.
Die Netzspannungsumschaltung darf nur erfolgen,
wenn zuvor das Netzkabel aus der Netzsteckerbuchse
entfernt wurde.
Dann müssen die Netzsicherungen entfernt und durch Sicherungen ersetzt werden, die der gewählten Netzspannung ent-
12
Änderungen vorbehalten
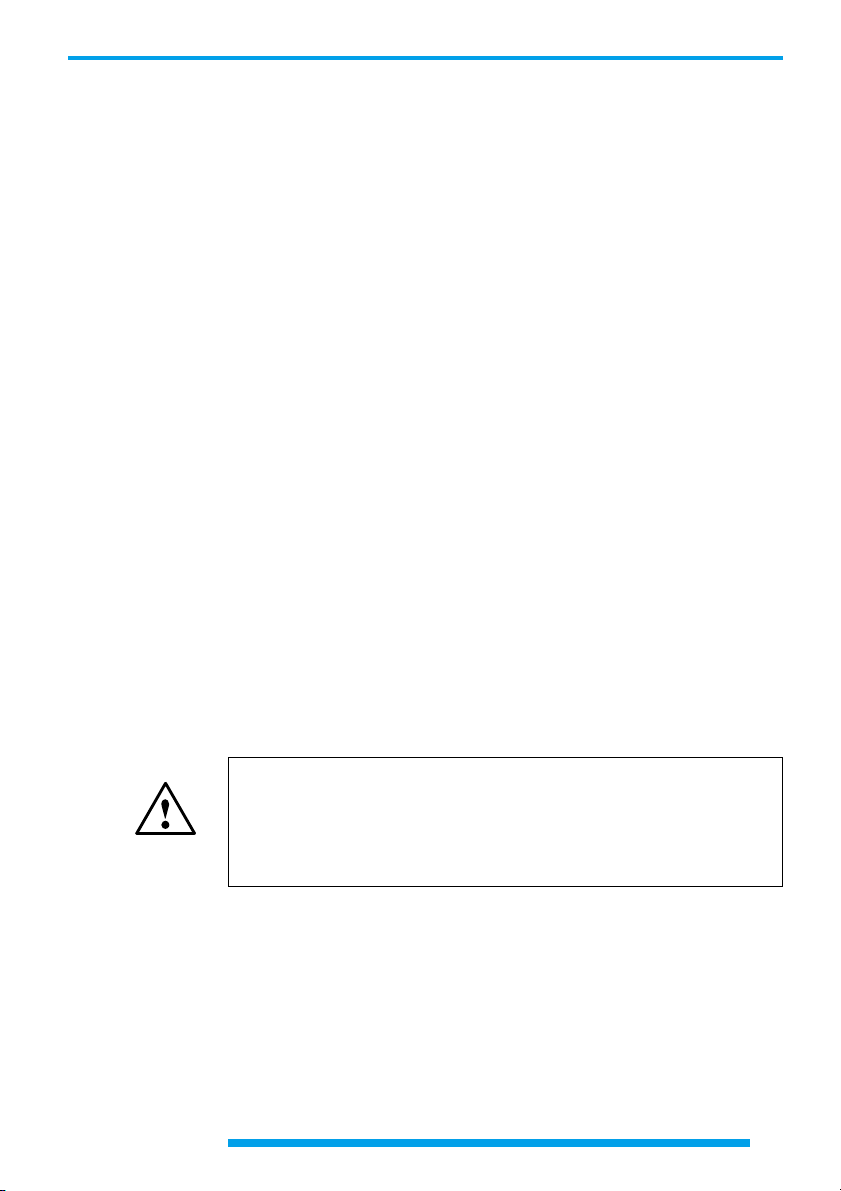
Funktionsprinzip
sprechen (siehe Tabelle). Netzsteckerbuchse und Sicherungshalter bilden eine Einheit und sind (auf der Geräterückseite) von
außen zugänglich. Mit einem geeigneten Schraubenzieher
(Klingenbreite ca. 2mm) werden die, an der linken und rechten
Seite des Sicherungshalters befindlichen Kunststoffarretierungen
nach Innen gedrückt. Der Ansatzpunkt ist am Gehäuse mit zwei
schrägen Führungen markiert. Beim Entriegeln wird der
Sicherungshalter durch Druckfedern nach außen gedrückt und
kann entnommen werden. Jede Sicherung kann dann entnommen und ebenso ersetzt werden. Es ist darauf zu achten, daß die
zur Seite herausstehenden Kontaktfedern nicht verbogen werden. Das Einsetzen des Sicherungshalters ist nur möglich, wenn
der Führungssteg zur Buchse zeigt. Der Sicherungshalter wird
gegen den Federdruck eingeschoben, bis beide Kunstoffarretierungen einrasten.
Die Verwendung ,,geflickter” Sicherungen oder das Kurzschließen des Sicherungshalters ist unzulässig. Dadurch entstehende
Schäden fallen nicht unter die Garantieleistungen.
Sicherungstype:Sicherungstype:
Sicherungstype:
Sicherungstype:Sicherungstype:
Größe 5 x 20 mm; 250V~, C;
IEC 127, Bl. III; DIN 41 662
(evtl. DIN 41 571, Bl. 3).
Abschaltung: träge (T)
Netzspannung 115V~ ±10%: Sich. Nennstrom T 630mA
Netzspannung 230V~ ±10%: Sich. Nennstrom T 315mA
Kenndaten mit Toleranzangaben gelten nach einer
Anwärmzeit von min. 60 Minuten und bei einer Umgebungstemperatur von 23°C ± 2°C. Werte ohne Toleranzangabe sind Richtwerte eines durchschnittlichen
Gerätes.
Funktionsprinzip
Der HM5012/14 ist ein Spektrumanalysator für den Frequenzbereich von 150kHz bis 1050 MHz.
Damit lassen sich Spektralkomponenten elektrischer Signale im
Frequenzbereich von 0,15MHz bis 1050MHz erfassen. Das zu
erfassende Signal bzw. seine Anteile müssen sich periodisch
wiederholen. Im Gegensatz zu Oszilloskopen, mit denen im Yt-
Änderungen vorbehalten
13
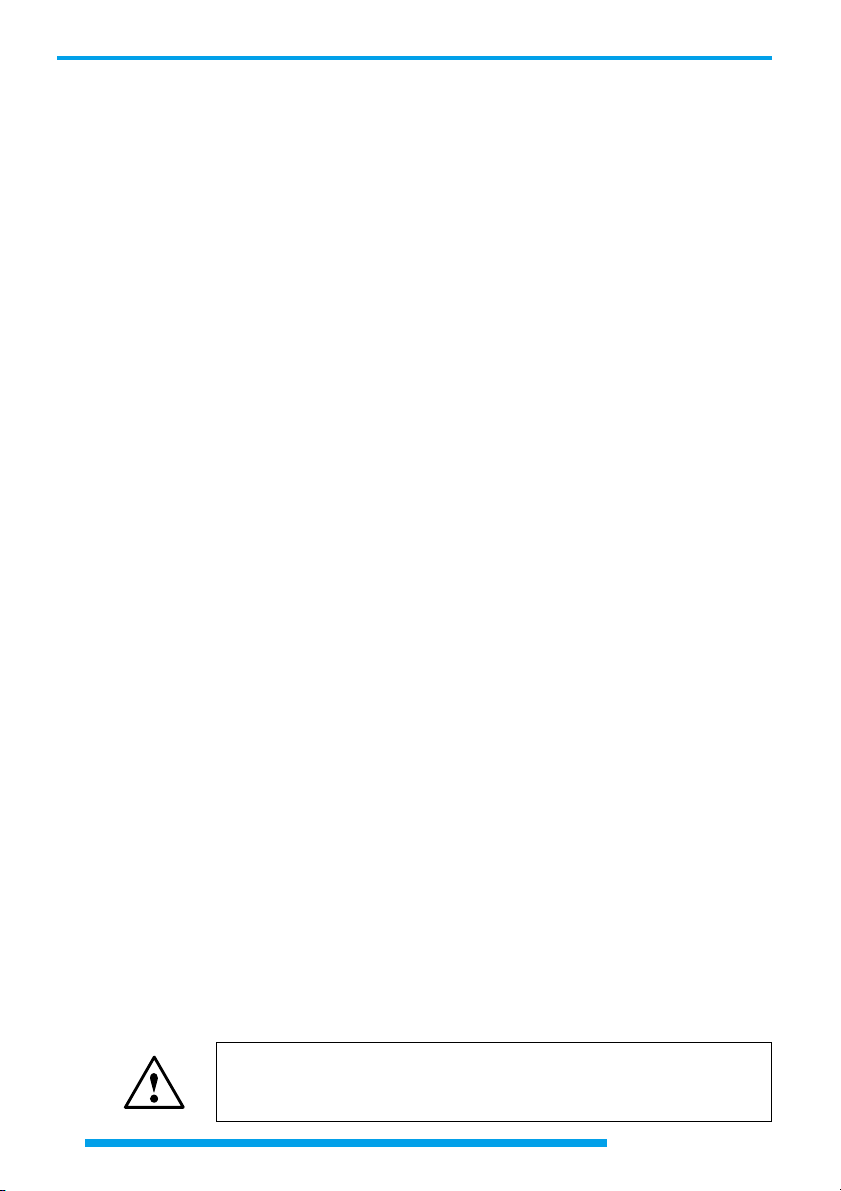
Funktionsprinzip
Betrieb Amplituden auf der Zeitebene dargestellt werden, erfolgt mit dem Spektrum-Analysator die Darstellung der Amplituden auf der Frequenzebene (Y/f). Dabei werden die einzelnen
Spektralkomponenten sichtbar, aus denen sich “ein Signal”
zusammensetzt. Im Gegensatz dazu zeigt ein Oszilloskop das
aus den einzelnen Spektralkomponenten bestehende Signal als
daraus resultierende Signalform.
Der Spektrum-Analysator arbeitet nach dem Prinzip des Dreifach-Superhet-Empfängers. Das zu messende Signal (fin =
0,15MHz - 1050MHz) wird der 1. Mischstufe zugeführt und mit
dem Signal eines variablen Oszillators (fosz von ca. 1350MHz ca. 2400MHz) gemischt. Dieser Oszillator wird als 1st LO (Local
Oscillator) bezeichnet. Die Differenz von Eingangs- und Oszillator-Signal (f
über ein auf 1350MHz abgestimmtes Filter auf eine Verstärkerstufe. Dieser folgen 2 weitere Mischstufen, Oszillatoren, Verstärker und Bandfilter für die jeweilige Zwischenfrequenz, 2.ZF
= 30,00MHz und 3.ZF = 10,70MHz. In der dritten ZF-Stufe wird
das Signal wahlweise über ein Bandpaßfilter mit einer Bandbreite von 400kHz, 120kHz oder 9 kHz geführt und gelangt auf einen
AM-Demodulator. Das Signal (Video-Signal) wird logarithmiert
und gelangt direkt oder über einen Tiefpaß (Videofilter) auf einen
Verstärker, der die Y-Ablenkplatten der Strahlröhre ansteuert.
Mit zunehmender Signalamplitude wird der Elektronenstrahl in
Richtung oberer Rasterrand abgelenkt. Der Anzeigebereich des
Bildschirms umfaßt 80dB entsprechend 10dB/DIV. Die X-Ablenkung der Strahlröhre erfolgt mit einer sägezahnförmigen Spannung. Die vom Sägezahn-Generator stammende Spannung
kann auch einer Gleichspannung überlagert werden, mit der die
Mittenfrequenz des ersten Oszillators (1st LO) geändert wird.
- fin = fZF) gelangt als 1. Zwischenfrequenz-Signal
LO
Abhängig vom Spannungshub der Sägezahnspannung, die mit
der SCANWIDTH-(Scanwidth = Abtastbreite)-Einstellung bestimmt wird, erfaßt der Spektrum-Analysator einen bestimmten
Frequenzbereich. Im ZERO SCAN-Betrieb bestimmt nur die
Gleichspannung die Frequenz des ersten Oszillators, d.h. es
wird nur eine Frequenz dargestellt.
Betriebshinweise
14
Vor der Inbetriebnahme des HM5012/14 ist unbedingt
der Abschnitt „Sicherheit“ zu lesen und die darin
enthaltenen Hinweise zu beachten.
Änderungen vorbehalten
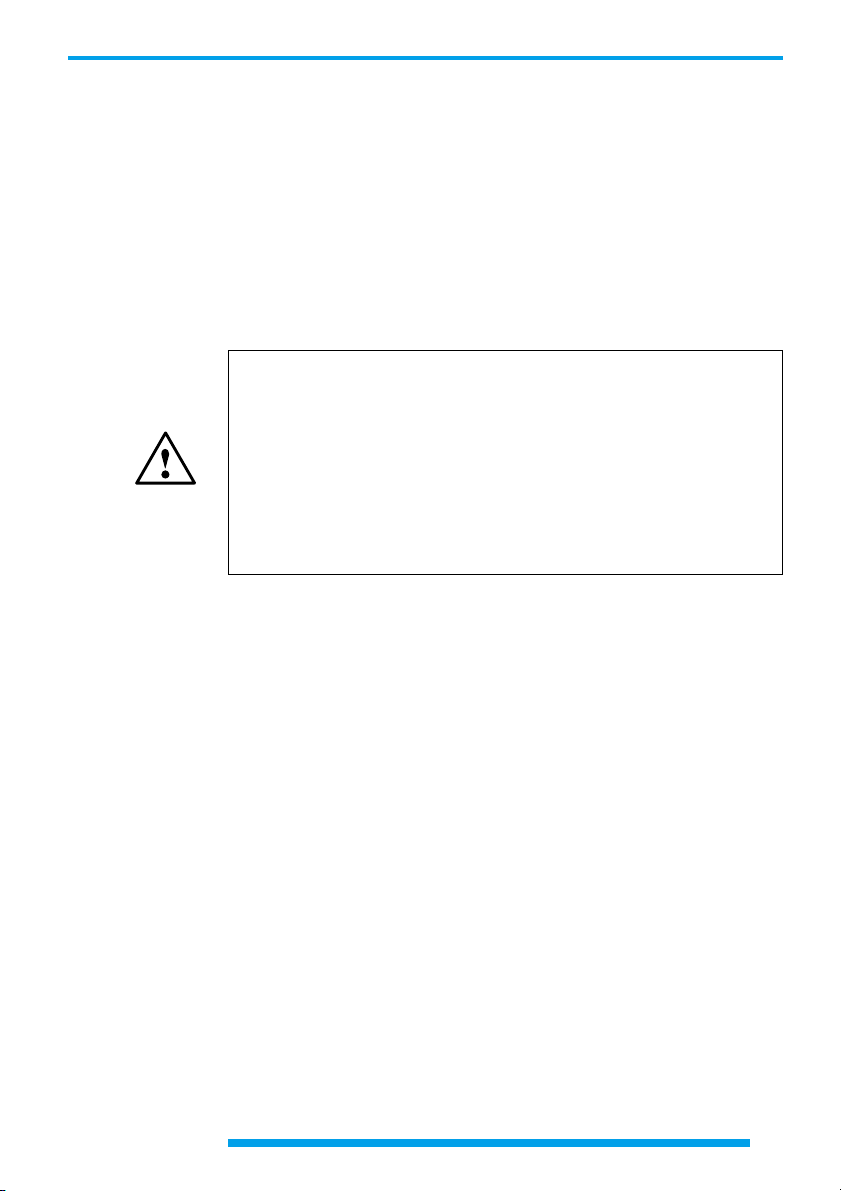
Funktionsprinzip
Für den Betrieb des Gerätes sind keine besonderen Vorkenntnisse erforderlich. Die übersichtliche Gliederung der Frontplatte
und die Beschränkung auf die wesentlichen Funktionen erlauben ein effizientes Arbeiten sofort nach der Inbetriebnahme.
Trotzdem sollten einige grundsätzliche Hinweise für den störungsfreien Betrieb beachtet werden.
Die empfindlichste Baugruppe ist die Eingangsstufe des Spektrum-Analysators. Sie besteht aus dem Eingangs-Abschwächer,
einem Tiefpaßfilter und der ersten Mischstufe.
Ohne Eingangssignal-Abschwächung dürfen folgende
Pegel am Eingang (50
+10dBm (0,7V
eff
spannung. Mit 40dB Abschwächung sind maximal
+20dBm zulässig.
Diese Grenzwerte dürfen nicht überschritten werden,
da ansonsten mit der Zerstörung der Eingangsbaugruppe zu rechnen ist!
Bei Messungen an einer Netznachbildung ist der Eingang des
Spektrumanalysators unbedingt durch einen Eingangspannungsbegrenzer (HZ560) zu schützen. Andernfalls besteht die Gefahr,
daß der Eingangssignal-Abschwächer und/oder die erste Mischstufe zerstört werden.
ΩΩ
Ω
) nicht überschritten werden:
ΩΩ
) Wechselspannung; ±25Volt Gleich-
Änderungen vorbehalten
Bei der Untersuchung von unbekannten Signalen sollte zunächst geprüft werden, ob unzulässig hohe Spannungen vorliegen. Außerdem ist es empfehlenswert, die Messung mit maximaler Abschwächung und dem maximal erfaßbaren Frequenzbereich (0,15MHz - 1050MHz) zu beginnen. Trotzdem ist zu
berücksichtigen, daß unzulässig hohe Signalamplituden auch
außerhalb des erfaßten Frequenzbereichs vorliegen können, die
zwar nicht angezeigt werden können (z.B. 1200MHz), jedoch
zur Übersteuerung und in Extremfall zur Zerstörung des 1.
Mischers führen können.
Der Frequenzbereich von 0Hz bis 150kHz ist für den SpektrumAnalysator nicht spezifiziert. In diesem Bereich angezeigte
Spektralkomponenten sind bezüglich ihrer Amplitude nur bedingt auswertbar.
15
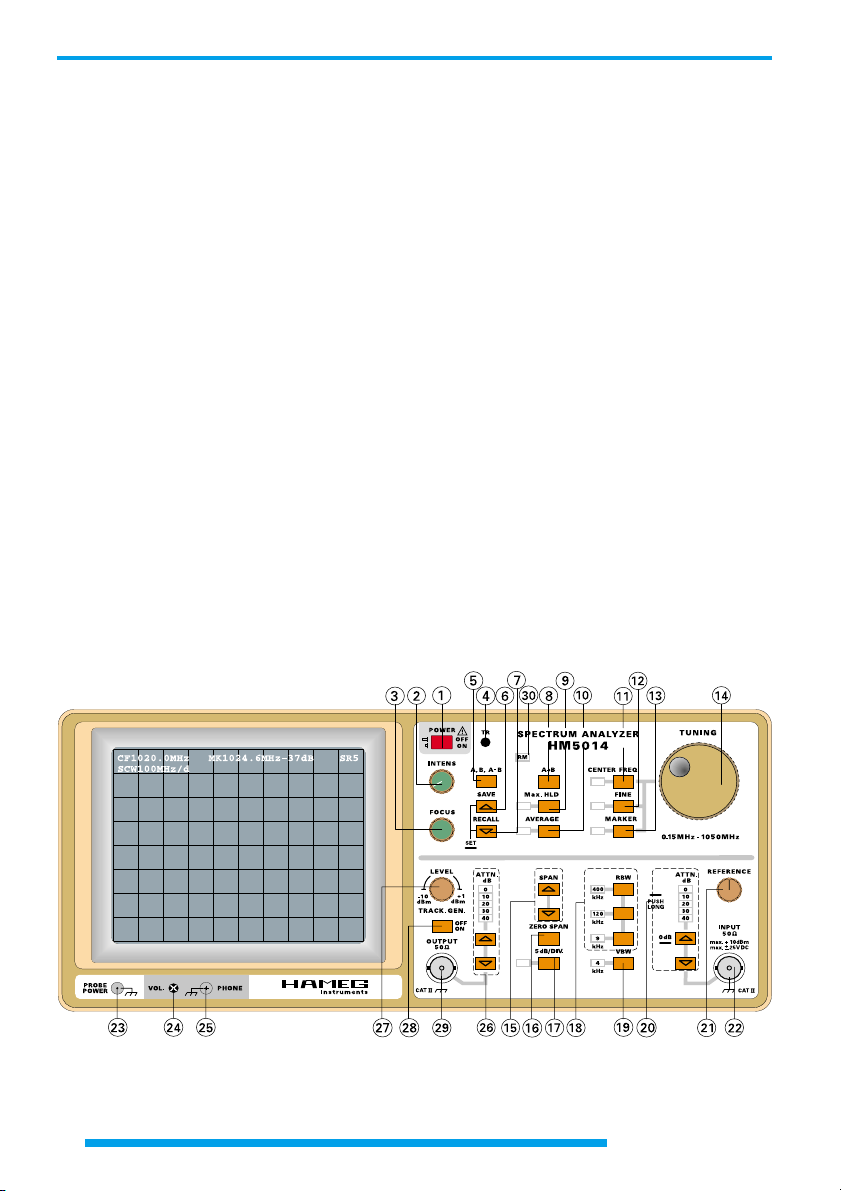
Bedienelemente
Eine besonders hohe Einstellung der Intensität (INTENS.) ist
nicht erforderlich, weil im Rauschen versteckte Signale dadurch
nicht deutlicher sichtbar gemacht werden können. Im Gegenteil, wegen des dabei größer werdenden Strahldurchmessers
werden solche Signale, auch bei optimaler Schärfeeinstellung
(FOCUS), schlechter erkennbar. Normalerweise sind auf Grund
des Darstellungsprinzips beim Spektrum-Analysator alle Signale
schon bei relativ geringer Intensitätseinstellung gut erkennbar.
Außerdem wird damit eine einseitige Belastung der Leuchtschicht
- im Bereich des Rauschens - vermindert.
Auf Grund des Umsetzungsprinzips moderner SpektrumAnalysatoren ist bei einer eingestellten Mittenfrequenz von
0MHz auch ohne anliegendes Signal eine Spektrallinie auf dem
Bildschirm sichtbar. Sie ist immer dann sichtbar, wenn die
Frequenz des 1st LO in den Bereich der 1. Zwischenfrequenz
fällt. Diese Linie wird oft als als sogenannter „Zero-Peak“
bezeichnet. Sie wird durch den Trägerrest des 1. Mischers
(Local-Oscillator-Durchgriff) verursacht. Die dargestellte Signalkurve entspricht hierbei der Durchlaßkurve des ZF-Bandpaßfilters. Der Pegel dieser Spektrallinie ist von Gerät zu Gerät
verschieden. Eine Abweichung von der vollen Bildschirmhöhe
stellt also keine Fehlfunktion des Gerätes dar.
Bedienelemente
(1) POWER:
Der Netz-Tastenschalter, mit den Symbolen für die Ein- (ON)
und Aus (OFF)-Stellung. Wird der Netztastenschalter in die
16
Änderungen vorbehalten

Bedienelemente
Stellung ON geschaltet, dauert es ca. 10 Sekunden bis am
unteren Rasterrand der Strahlröhre die Basislinie (Rauschband)
sichtbar wird.
(2) FOCUS: Strahlschärfe-Einsteller.
(3) INTENS:
Einsteller für die Strahlhelligkeit (Intensität). Die Strahlintensität
sollte nicht heller eingestellt sein, wie es die Umgebungshelligkeit unbedingt erfordert.
(4) TR:
Mit dem TR (Trace rotation = Strahldrehung)-Potentiometer läßt
sich mit einem Schraubenzieher der Einfluß des Erdmagnetfeldes
auf die Strahlablenkung ausgleichen, der trotz einer hochwertigen Mumetall-Abschirmung der Bildröhre unvermeidbar ist, Die
Basislinie kann so beeinflußt werden, daß sie fast parallel zur
untersten Rasterlinie verläuft. Eine geringfügige kissenförmige
Ablenkverzeichnung ist unvermeidbar und beeinflußt die
Meßgenauigkeit nicht.
(5) A/B/A-B: Das Gerät besitzt zwei Meßwertspeicher, den Spei-
cher A und den Speicher B. Aktuelle Meßergebnisse werden
grundsätzlich in den A-Speicher geschrieben, während in den BSpeicher nur Kopien des A-Speichers abgelegt werden können.
Die Funktion A-B erlaubt die Subtraktion der B-Speicherinhalte
von den aktuellen im Speicher A abgelegten Meßergebnissen.
(6) SAVE:
Änderungen vorbehalten
Aufrufen:
Die Anzeige der Speicherinhalte der Speicher A, B und der
Differenz der Speicherinhalte (A-B) erfolgt durch wiederholten
kurzen Tastendruck auf die Taste A/B/A-B. Auf dem Bildschirm
wird im Readout angezeigt (A, B oder A-B) welcher Speicherinhalt momentan auf dem Bildschirm dargestellt wird.
Die Funktion dient zur Speicherung von bis zu 10 Geräteeinstellungen. Wurde eine Geräteeinstellung gespeichert, so ist diese
durch die RECALL-Funktion wieder aufrufbar. Häufig benutzte
Geräteeinstellungen lassen sich auf diese Weise sehr schnell und
zuverlässig einstellen. Die Speicherung der Geräteeinstellung bleibt
auch nach dem Ausschalten des Geräts erhalten.
Funktion aktivieren: Taste SAVE lange drücken.
17
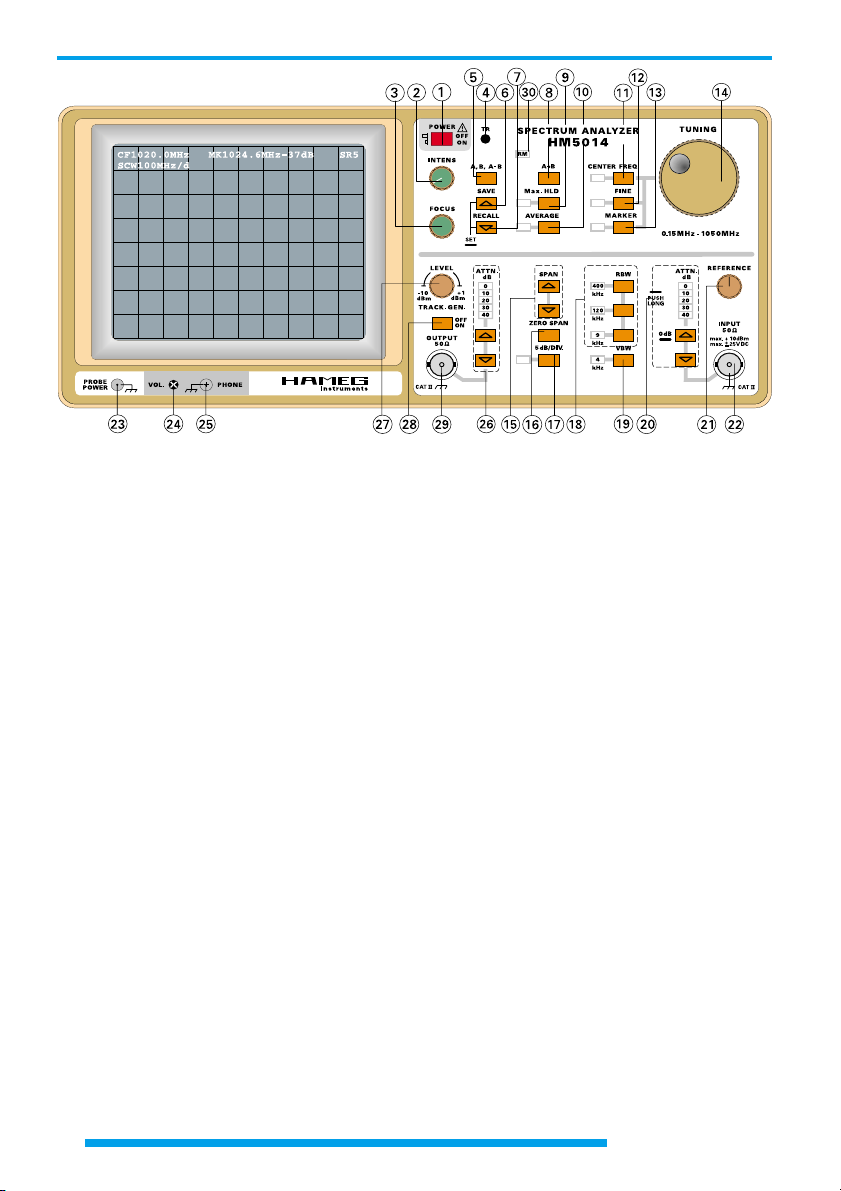
Bedienelemente
Hinweis:
Die Funktion SAVE kann nicht aktiviert werden solange AVERAGE
bzw. Max.HLD eingeschaltet ist. Ein akustisches Signal weist
auf diesen Umstand hin.
Speicherplatz wählen:
Nach dem Aufruf der SAVE-Funktion kann durch wiederholtes
kurzes Drücken der SAVE-Taste die Speicherplatznummer bis
max. 9 erhöht werden, durch kurzes Drücken der RECALL-Taste
bis minimal 0 verringert werden.
18
SPEICHERN:
Wird nach Auswahl der Speicherplatznummer die Taste SAVE
lange gedrückt wird die Geräteeinstellung gespeichert und die
SAVE-Funktion verlassen.
Hinweis:
Die Funktionen AVERAGE und MAX.HLD können nicht Teil einer
Geräteeinstellung sein, die gespeichert werden soll, d.h. sind
diese Funktionen aktiviert, so kann die Funktion SAVE nicht
ausgeführt werden. Ein akustisches Signal weist auf diesen
Umstand hin.
Abbruch:
Soll keine Geräteeinstellung gespeichert werden, so genügt es
ca. 3 sec zu warten. Nach Ablauf dieser Zeit wird die SAVEFunktion automatisch verlassen.
Änderungen vorbehalten

Bedienelemente
(7) RECALL
Mit Hilfe von RECALL werden Geräteeinstellungen, die zuvor
über SAVE gespeichert wurden, aufgerufen.
Funktion aktivieren: Taste RECALL lange drücken.
Hinweis:
Die Funktionen RECALL kann nicht aktiviert werden solange
AVERAGE bzw. MAX.HLD eingeschaltet ist. Ein akustisches
Signal weist auf diesen Umstand hin.
Speicherplatz wählen:
Nach dem Aufruf der RECALL-Funktion muß die Speicherplatznummer der gewünschten Geräteeinstellung angewählt werden. Hierzu kann die Speicherplatznummer durch wiederholtes
kurzes Drücken der SAVE-Taste die Speichernummer bis max.
9 erhöht und durch Drücken der RECALL-Taste bis minimal 0
verringert werden. Oberhalb von Speicher 9 können die 2 EMVPRESETS abgerufen werden.
AUFRUFEN:
Wird nach Auswahl der gewünschten Speicherplatznummer die
Taste RECALL lange gedrückt, so wird das Geräte auf die
gespeicherten Parameterwerte eingestellt.
(8) A➜B:
Änderungen vorbehalten
Abbruch:
Soll keine Geräteeinstellung gespeichert werden, so genügt es
ca. 3 sec zu warten. Nach Ablauf dieser Zeit wird die SAVEFunktion automatisch verlassen.
Speicherinhalt kopieren:
Soll eine Kopie eines aktuellen Meßergebnisses (A) in den
Anzeigespeicher B geschrieben werden, so muß die Taste
A➜B kurz gedrückt werden.
Hinweis:
Nach Ablage einer Kopie aus A in B wird der Speicherinhalt B
dargestellt. Kurzer Tastendruck auf die Taste „ A/B/A-B“ schaltet zur Darstellung A-B und erneuter Tastendruck zur Darstellung A.
19

Bedienelemente
(9) Max.HLD (Maximum Hold)
Die Funktion Max.Hold erlaubt die automatische Speicherung
der vom Gerät erfassten maximalen Signalpegel. Die Meßergebnisanzeige wird nur dann aktualisiert wenn ein neu erfasster
Meßwert größer als die bis zu diesem Zeitpunkt erfassten
Werte ist. Meßwerte, die kleiner als die vorherigen Werte sind
werden nicht zur Anzeige gebracht. Die Funktion erlaubt somit
die zuverlässige Messung von Signalgrößtwerten und von gepulsten HF-Signalen. Bei gepulsten Signalen ist vor dem Ablesen
des Meßergebnisses auf jeden Fall solange zu warten bis keine
Aktualisierung der Meßergebnisdarstellung mehr zu erkennen
ist.
20
Hinweis:
Bei gepulsten Signalen sollte mit möglichst kleinem SPAN,
möglichst großer Meßbandbreite (BANDWIDTH) und ausgeschaltetem Videofilter gearbeitet werden um Einschwingfehler
der Filter zu vermeiden. Die Benutzung der langsameren
Wobbelzeit (SWT) kann je nach Situation empfehlenswert sein.
AUFRUFEN:
Taste Max.HLD drücken. Die zugeordnete LED zeigt die Aktivierung der Funktion an.
Hinweis:
Soll die Anzeige einer Meßwertaufnahme (Max.HLD) gelöscht
werden, so muß die Funktion Max.HLD beendet und danach
wieder neu aufgerufen werden.
Änderungen vorbehalten

Bedienelemente
Abbruch:
Taste Max.HLD drücken. Das Erlöschen der zugeordneten LED
zeigt den Abbruch der Funktion Max.HLD an.
(10) AVERAGE
Mit Hilfe der AVERAGE-Funktion lassen sich Rauschanteile in
der Ergebnisdarstellung mitteln und dadurch reduzieren. Auf
diese Weise können Spektralanteile, die sonst vom Rauschen
überdeckt wären gut erfassen. Die AVERAGE-Funktion wird
durch kurzes Drücken der Taste AVERAGE eingeschaltet. Die
zugeordnete LED zeigt die Anwahl der AVERAGE-Funktion an.
Hinweis:
Die Rauschmittelung (digital) über die AVERAGE-Funktion ist im
Gegensatz zu der Mittelung über das Video-Filter auch bei
größeren Wobbelhüben (SPAN) benutzbar, ohne daß die Gefahr
von Einschwingfehlern durch das Videofilter besteht.
AUFRUFEN:
Taste AVERAGE drücken. Die zugeordnete LED zeigt die Aktivierung der Funktion AVERAGE an.
Hinweis:
Soll die Anzeige eines gemittelten Meßergebnisses (AVERAGE
ON) gelöscht werden, so muß die Funktion AVERAGE beendet
und danach wieder neu aufgerufen werden.
(11) CENTER FREQ.: Durch Druck auf die Taste CENTER FREQ.
Änderungen vorbehalten
Abbruch:
Taste AVERAGE drücken. Das Erlöschen der zugeordneten LED
zeigt die Beendigung der Funktion AVERAGE an.
wird die Eingabe für die Mittenfrequenz geöffnet und die
zugeordnete LED leuchtet. Danach kann die Mittenfrequenz
über den Drehknopf (14) eingestellt werden. Die eingestellte
Frequenz wird im Bildschirm oben links hinter dem Buchstaben
C angezeigt.
Hinweis:
Wird die Mittenfrequenz reduziert bzw. der SPAN erhöht, so ist
u.U. auch ohne angelegtes Signal eine Spektrallinie zu sehen.
Diese wird häufig als “Nullfrequenz-Marke” (ZERO-Peak) bezeichnet und ist für Analysatoren nach dem Superhet-Prinzip
üblich. Es handelt sich dabei um den Träger des 1.LO (1.
21

Bedienelemente
(12) FINE:
Oszillator), der sichtbar wird, wenn seine Frequenz in den
Durchlaßbereich des 1.ZF-Filters fällt. Der Pegel der “Nullfrequenz-Marke” ist von Gerät zu Gerät verschieden und nicht
als Kalibrierpegel zu verwenden.
Wird die Taste FINE gedrückt (LED leuchtet), so erfolgt die
Frequenzeingabe (LED CENTER FREQ. leuchtet) oder die Bewegung des Markers (LED MARKER leuchtet) in feinen Stufen.
22
Erneuter Tastendruck auf die Taste FINE (LED leuchtet nicht)
schaltet die feine Drehknopfeingabe aus.
(13) MARKER:
Zur Auswertung der Meßergebniskurve ist das Gerät mit einem
auf der Kurve laufenden Marker (X) ausgerüstet. Der Marker
kann in X-Richtung mit Hilfe des Drehknopfes bewegt werden
und folgt hierbei in Y-Richtung der Meßwertkurve. Um den
Marker bewegen zu können muß zunächst die Taste Marker
betätigt werden (LED leuchtet). Danach kann der Marker über
den Drehknopf bewegt werden. Die zahlenmäßige Angabe von
Markerfrequenz und Amplitude erfolgt im Readout.
(Beispiel: M100.00MHz -29dBm)
Hinweis:
Die Funktion FINE hat auch Wirkung auf die Eingabe der
Markerposition.
Änderungen vorbehalten

Bedienelemente
(14) Drehgeber:
Der Drehgeber dient, je nach Anwahl von CENTER FREQ. bzw.
MARKER zur Eingabe von Mittenfrequenz (CENTER FREQ.)
oder Markerfrequenz.
(15) SPAN:
Über die beiden Tasten SPAN wird der Frequenzhub (Wobbelbereich) des Analysators eingestellt. Die Anzeige des SPAN
erfolgt in der rechten oberen Ecke des Bildschirm und ist mit
dem Buchstaben S gekennzeichnet. Bei einer SPAN-Einstellung
von 1000MHz (full span = volle Bereichserfassung) ist die
Frequenzachse in 100MHz Schritten je (senkrechter) Rasterlinie
skaliert. Ausgehend von der mittleren Rasterlinie erhöht sich die
Frequenz um jeweils 100MHz je Teilung in Richtung rechter
Rasterrand. Die Frequenz einer dort dargestellten Spektrallinie
beträgt somit 500MHz + 5x100MHz = 1000MHz. Sinngemäß
verringert sich die Frequenz in Richtung linker Rasterrand. Die
äußerste linke Rasterlinie entspricht in diesem Falle 0MHz.
(16) ZERO SPAN:
Änderungen vorbehalten
Die Taste ZERO SPAN dient zur direkten Anwahl eines SPAN
(Wobbelhubs) von 0Hz. Wird ein SPAN von 0Hz gewählt, so
arbeitet der Analysator als selektiver Pegelmesser, der über die
Mittenfrequenz (CENTER FREQ.) abgestimmt werden kann.
Die Anzeige des gemessenen Pegels erfolgt durch eine waagrechte Linie dargestellt.
Das obenstehende Bild soll zur Erläuterung der Begriffe SPAN,
Mittenfrequenz, Skalenumfang und Attenuator dienen. Das
graue Feld stellt den maximalen Meßbereich des HM 5012 dar,
während das weiße Feld den auf dem Bildschirm darstellbaren
Bereich zeigt. Die Höhe dieses „Fensters“ liegt durch den
23

Bedienelemente
Skalenumfang von 80 dB fest, jedoch läßt sich der Darstellungsbereich durch das Ein- bzw. Ausschalten von Dämpfungs-
gliedern des Eingangsabschwächers (ATTN) nach oben und
unten verschieben. Die Breite des Darstellungsbereichs wird
durch den Wobbelhub (SPAN) des Analysators eingestellt.
Dieser kann den gesamten grauen Bereich umfassen oder auch
nur einen Teilbereich. Die Lage dieses Bereichs wird in XRichtung durch die Mittenfrequenz (CENTER FREQ.) eingestellt. Es ist in aller Regel sinnvoll (Auflösung der Darstellung) die
Mittenfrequenz und den SPAN so klein zu wählen, daß das
Signal problemlos dargestellt werden kann. Ein unnötig großer
SPAN ist eher ungünstig.
Über die Taste „Zero Span“ kann unmittelbar in den Zero-SpanModus geschaltet werden. Durch erneutes Drücken dieser
Taste wird der ursprüngliche Span wiederhergestellt.
24
Hinweis:
Das Gerät ist darauf programmiert, in Abhängigkeit von Span,
Auflösungs- und Videofilter die Sweepzeit optimal anzupassen.
Sollte dies nicht möglich sein, wird „uncal“ im Readout eingeblendet, um anzuzeigen, daß die Meßwerte nicht amplitudenrichtig wiedergegeben werden.
(17) 5dB/Div.
Durch kurzes Drücken dieser Taste wird die vertikale Skalierung
jeweils von 5dB/Div. und 10dB/Div. und umgekehrt geschaltet.
Dabei wird der Referenzpegel beibehalten.
Änderungen vorbehalten

Bedienelemente
Hinweis:
In der 5dB/Div.-Stellung kann das Rauschen dabei vom Schirm
"verschwinden".
(18) BANDWIDTH:
Das Gerät ist mit den Auflösungsfiltern 9kHz, 120 kHz und 400
KHz ausgerüstet, die über die Tasten BANDWIDTH gewählt
werden können. Eine zugeordnete LED zeigt die eingeschaltete
Bandbreite an.
Hinweis:
Bei gepulsten Signalen sollte eine möglichst große Meßbandbreite und die Funktion Max.HLD verwendet werden.
(19) VIDEO FILTER:
Das Videofilter dient zur Mittelung und damit zur Reduktion von
Rauschanteilen. Bei der Messung kleiner Pegelwerte, die in der
Größenordnung des durchschnittlichen Rauschens liegen, kann
das Video-Filter (Tiefpaß) zur Rauschminderung eingesetzt werden. Dadurch lassen sich unter Umständen noch schwache Signale erkennen, die ansonsten im Rauschen untergehen würden.
Hinweis:
Es ist zu beachten, daß ein zu großer Frequenzbereich (SPAN)
bei eingeschaltetem Video-Filter zu fehlerhaften (zu kleinen)
Amplitudenwerten führen kann. (UNCAL-Anzeige). In diesem
Fall ist der SPAN zu verringern. Hierzu muß mit Hilfe der
Mittenfrequenzeinstellung (CENTER FREQ.) zuerst das zu untersuchende Signal in die Nähe der Bildschirmmitte gebracht
werden, danach kann der SPAN verringert werden.
(20) ATTN: Die 2 Tasten zur Einstellung des Eingangsabschwächers
Änderungen vorbehalten
Wird der Span verringert, ohne daß das interessierende Signal
ungefähr in der Bildschirmmitte abgebildet wird, so kann es
vorkommen, daß das Signal außerhalb des Bildschirms „fällt“.
Bei gepulsten Signalen sollte das Videofilter möglichst nicht
benutzt werden, um Meßfehler (Einschwingzeit) zu vermeiden.
müssen jeweils kurz gedrückt werden, um die Einstellung in
10dB-Schritten zu verändern.
25

Bedienelemente
Achtung:
Wegen der besonders empfindlichen Eingangsstufe kann
die 0dB-Stellung nur durch langes Drücken erreicht
werden. Dies verhindert versehentliches Einschalten
dieser Stellung.
An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, daß
die max. zulässigen Eingangsspannungen nicht überschritten werden dürfen. Dieses ist insbesondere deshalb wichtig, weil ein Spektrum-Analysator auf Grund
seines Anzeigeprinzips unter Umständen nur ein Teilspektrum des gerade anliegenden Signals darstellt;
d.h. es können, außerhalb des sichtbar dargestellten
Frequenzbereiches Pegel am Eingang anliegen, die zur
Zerstörung der Eingangsstufen führen können.
26
(21) Reference Level
Mit dem Drehgeber REFERENCE wird der sogenannte Referenzpegel gewählt, auf diesen Pegel ist der gesamte Bildschirminhalt bezogen. Der Referenzpegel wird immer der obersten
horizontalen Linie auf der Bildröhre abgebildet.
(22) INPUT:
50Ω-Eingang des Spektrum-Analysators. Ohne EingangssignalAbschwächung beträgt die maximal zulässige Eingangsspannung
±25V Gleichspannung bzw. +10dBm Wechselspannung. Bei
Änderungen vorbehalten

Erste Messungen
höchster Eingangssignal-Abschwächung (40dB) sind maximal
+20dBm zulässig. Diese Grenzwerte dürfen nicht überschritten
werden.
(23) PROBE POWER:
Die Buchse PROBE POWER dient zur Stromversorgung der
Nahfeldsonden HZ 530 und ist nur zu deren Betrieb vorgesehen.
Das dazu notwendige Spezialkabel ist dem Sondensatz beigefügt.
(24) VOL.: Lautstärkeeinsteller für den Kopfhörer
(25) Phone:
Anschlußbuchse für einen Kopfhörer. Der Kopfhörer sollte einen
3,5mm Klinkenstecker besitzen und eine Impedanz > 8Ω aufweisen.
(26) ATTN. (nicht im HM5012 enthalten)
Der Ausgangsabschwächer des HM5014 besitzt 5 Stellungen,
die über die UP/DOWN-Tasten ausgewählt werden können.
Der Aschwächer dient dazu, den Ausgangspegel des TrackingGenerators zu vermindern.
(27) LEVEL (nicht im HM 5012 enthalten)
Mit dem Level-Einsteller kann der Ausgangspegel des TrackingGenerators variabel in Schritten von 0.2dB verändert werden.
Der Regelumfang beträgt 11dB. Der Pegel wird im Readout
angezeigt, auch abhängig von der Einstellung des Abschwächers.
Achtung: Auch wenn der Tracking-Generator ausgeschaltet ist,
kann der Pegel verändert werden, dies ist im Readout sichtbar.
Um jedoch dieses Signal am Ausgang (29) anliegen zu haben,
muß immer der Tracking-Generator vorher eingeschaltet werden. Diese Funktion dient dem Schutz empfindlicher Verbraucher.
(28) Tracking Generator (nicht im HM5012 enthalten)
Änderungen vorbehalten
Nach jedem Einschalten des Gerätes ist der Tracking-Generator
zunchst ausgeschaltet, um angeschlossene Verbraucher zu
schützen. Im Readout wird dies durch das kleine „t“ dargestellt.
Durch kurzes Drücken auf die Taste TRACK. GEN. wird der
Tracking-Generator eingeschaltet. Im Readout erscheint nun ein
großes „T“ und der Pegel, und eine Leuchtdiode für den
Abschwächer (26) leuchtet. Durch nochmaliges kurzes Drücken
der Taste TRACK. GEN. wird der TG wieder ausgeschaltet.
27

Erste Messungen
(29) Output (nicht im HM5012 enthalten)
50Ω-Ausgang des Tracking-Generators. Der Ausgangspegel
wird mit dem Drehgeber LEVEL (27) und den Abschwächer-
tasten (26) eingestellt. Er kann zwischen +1dBm und -50dBm
betragen.
(30) RM (Remote) LED
Die RM-LED zeigt an, daß das Gerät über die serielle Schnittstel-
le ferngesteuert betrieben wird. Es ist daher nicht möglich,
Eingaben über die Frontplatte vorzunehmen, wenn die LED
leuchtet. Dieser Zustand wird entweder durch ein Schnittstellenkommando beendet, oder durch Ausschalten des Gerätes. In
den Fernsteuer-(remote-)-Modus gelangt man nur über ein
Kommando über die serielle Schnittstelle.
Erste Messungen
Einstellungen:
Bevor ein unbekanntes Signal an den Meßeingangs angelegt
wird, sollte geprüft werden, daß das Signal keinen Gleichspannungsanteil von >± 25 V aufweist und die maximale Amplitude des zu untersuchenden Signals kleiner als +20 dBm ist.
ATTN:
Als Vorsichtsmaßnahme gegen Überlastung des Eingangsteils
sollten alle vier 10dB-Abschwächer eingeschaltet sein (Tasten
gedrückt).
28
Änderungen vorbehalten

Erste Messungen
Frequenzeinstellung:
CENTER FREQ. auf 500 MHz (C500MHz) einstellen und einen
SPAN von 1000 MHz (S1000MHz) wählen.
Bandwidth:
Es sollte zu Anfang einer Messung das 400 kHz-Filter eingeschaltet und das Videofilter ausgeschaltet sein.
Verschiebt sich die Frequenzbasislinie (Rauschband) nach oben,
wenn die Eingangssignal-Abschwächung verringert wird, ist
dies ein mögliches Indiz für eine außerhalb des Frequenzbereichs befindliche Spektrallinie mit zu hoher Amplitude. Ist mit
diesen Einstellungen kein Signal erkennbar, so kann die Eingangsabschwächung schrittweise verringert werden.
In jedem Fall muß sich die Einstellung des Abschwächers nach
dem größten anliegenden Signal (Nicht Zero-Peak) richten. Die
richtige Aussteuerung des Geräts ist dann gegeben, wenn das
größte Signal (Frequenzbereich „0 Hz“ - 1000 MHz) bis an die
oberste Rasterlinie (Referenzlinie) heranreicht, diese jedoch
nicht überschreitet. Im Falle einer Überschreitung muß zusätzliche Eingangsdämpfung eingeschaltet werden bzw. ist ein
externes Dämpfungsglied geeigneter Dämpfung und Leistung
zu verwenden.
Änderungen vorbehalten
Messungen im Full-SPAN (S1000MHz) sind in aller Regel nur als
Übersichtsmessungen sinnvoll. Sollen die nun erkannten Signale analysiert werden, so muß der SPAN verringert werden.
Hierzu muß zuvor das interessierende Signal über eine Veränderung der Mittenfrequenz (CENTER FREQ.) zuerst in die Bildschirmmitte gebracht werden und danach kann der SPAN
reduziert werden.
29

Einführung in die Spektrum-Analyse
Danach kann die Auflösungsbandbreite (BANDWIDTH) verringert und gegebenenfalls das Videofilter eingeschaltet werden.
Der Warnhinweis UNCAL darf nicht eingeblendet sein, da sonst
Meßfehler zu befürchten sind.
Meßwerte ablesen:
Um die Meßwerte zahlenmäßig zu erfassen besteht der einfachste Weg in der Benutzung des Markers. Hierzu wird der
Marker über den Drehknopf (LED MARKER leuchtet) auf die
interessierende Signalspitze gesetzt (gegebenfalls Funktion FINE
benutzen) und der angezeigte Markerwert abgelesen. Bei der
angezeigten Amplitude ist automatisch die eingeschaltete Dämpfung des Eingangsabschwächers (ATTN) berücksichtigt.
Soll ein Meßwert ohne Benutzung des Markers erfaßt werden,
so ist zuerst der Abstand, gemessen in dB , von der obersten
Rasterlinie ab, die dem im Readout angezeigten Referenzpegel
entpricht, bis zur Spitze des Signals zu ermitteln. Zu beachten ist
, daß die Skalierung 5 dB/Div. oder 10 dB/Div. betragen kann. Bei
dem Referenzwert ist bereits die Stellung des Eingangsabschwächers berücksichtigt, sie braucht daher nicht vom
Bediener extra hineingerechnet werden.
Das im Bild darestellte Signal weist einen Amplitudenabstand
von etwa -16dB zu der Referenzlinie auf. Die Referenzlinie
entspreche z. B. -27dBm, als Skalierung sei 10dB/Div. gewählt.
Folglich besitzt das Signal damit einen Pegel von (-27dBm) +
(-16dB) = -43dBm. In dieser Pegelangabe ist bereits die Stellung
des Eingangsabschwächers berücksichtigt. Eine Umrechnung
durch den Bediener ist daher nicht mehr nötig.
Einführung in die Spektrum-Analyse
Die Analyse von elektrischen Signalen ist ein Grundproblem für
viele Ingenieure und Wissenschaftler. Selbst wenn das eigentliche Problem nicht elektrischer Natur ist, werden oftmals die
interessierenden Parameter durch die unterschiedlichsten
Wandler in elektrische Signale umgewandelt. Dies umfaßt
ebenso Wandler für mechanische Größen wie Druck oder
Beschleunigung, als auch Meßwertumformer für chemische
und biologische Prozesse. Die Wandlung der physikalischen
Parameter ermöglicht anschließend die Untersuchung der verschiedenen Phänomene im Zeit- und Frequenzbereich.
30
Änderungen vorbehalten

Einführung in die Spektrum-Analyse
Der traditionelle Weg, elektrische Signale zu analysieren, ist ihre
Darstellung in der Amplituden-Zeit-Ebene. Diese erfolgt u.a. mit
Oszilloskopen im Yt-Betrieb, d.h. es werden Informationen über
Amplituden und zeitliche Zusammenhänge erkennbar. Allerdings lassen sich damit nicht alle Signale ausreichend charakterisieren, wie z.B. bei der Darstellung einer Signalform, die aus
verschiedenen sinusförmigen Bestandteilen zusammengesetzt
ist. Mit einem Oszilloskop würde nur die Summe aller Bestandteile sichtbar werden und die einzelnen Frequenz- und Amplituden-Anteile wären meistens nicht erfaßbar.
Mit der Fourier-Analyse läßt sich nachweisen, daß sich periodische Zeitfunktionen als Überlagerung harmonischer periodischer Funktionen darstellen lassen. Hierdurch läßt sich eine
beliebige, noch so komplizierte Zeitfunktion einer charakteristischen Spektralfunktion in der Frequenzebene zuordnen.
Diese Informationen lassen sich am besten durch SpektrumAnalysatoren ermitteln. Mit ihnen erfolgt die Signaldarstellung in
der Amplituden-Frequenz-Ebene (Yf). Dabei werden die einzelnen Spektralkomponenten und ihre Amplituden angezeigt.
Die hohe Eingangsempfindlichkeit und der große Dynamikbereich von Spektrum-Analysatoren ermöglichen die Analyse
von Signalen, die mit einem Oszilloskop nicht darstellbar sind.
Ähnlich verhält es sich mit dem Nachweis von Verzerrungen
sinusförmiger Signale, dem Nachweis niedriger AmplitudenModulation und Messungen im Bereich der AM- und FMTechnik, wie Trägerfrequenz, Modulationsfrequenz oder
Modulationsgradmessungen. Ebenso lassen sich Frequenzkonverter in Bezug auf Übertragungsverluste und Verzerrungen
einfach charakterisieren.
Eine weitere Anwendung von Spektrum-Analysatoren, die mit
Mitlaufsendern ausgerüstet sind, sind Messungen an Vierpolen,
wie z.B. Frequenzgangmessungen an Filtern und Verstärkern.
Grundlagen Spektrum-Analysatoren
Spektrum-Analysatoren lassen sich nach zwei grundsätzlichen
Verfahren unterscheiden: gewobbelte- bzw. abgestimmte sowie Echtzeit-Analysatoren. Echtzeit-Analysatoren nach dem
Prinzip der diskreten Fouriertransformation bestehen aus der
Parallelschaltung einer Vielzahl von frequenzselektiven Indikatoren. Es können dabei so viele diskrete Frequenzen zur Anzeige
Änderungen vorbehalten
31

Einführung in die Spektrum-Analyse
gebracht werden, wie Filter vorhanden sind. Die Grenze der
Wirtschaftlichkeit wird hier je nach Anzahl und Güte der Filter
teilweise schnell erreicht.
Fast alle modernen Spektrum-Analysatoren, so auch der
HM5012, arbeitet deshalb nach dem Überlagerungsprinzip
(Superheterodyne-Prinzip). Ein Verfahren ist dabei, die Mittenfrequenz eines Bandpaßfilters über den gewünschten Frequenz-
bereich abzustimmen. Ein Detektor erzeugt dabei eine vertikale
Ablenkung auf dem Bildschirm, und ein durchstimmbarer Generator sorgt für die synchrone Abstimmung der Filtermittenfrequenz und der Horizontalablenkung. Dieses einfache Prinzip
ist relativ preiswert, hat jedoch große Nachteile in Bezug auf
Selektion und Empfindlichkeit; unter anderem auf Grund der
nicht konstanten Bandbreite bei abgestimmten Filtern.
Die gebräuchlichste Art der Spektrum-Analysatoren unterscheidet sich hiervon insofern, daß f ür die Selektion ein Bandpaßfilter
mit fester Mittenfrequenz verwendet wird. Es läßt zu jedem
Zeitpunkt denjenigen Anteil der zu analysierenden Funktion
passieren, für den gilt f
auf eine feste Zwischenfrequenz werden die Nachteile des
Systems mit abstimmbarem Bandpaßfilter umgangen.
inp
(t) = fLO(t)±fZF. Durch die Umsetzung
32
Der nutzbare Frequenzbereich und die Grenzempfindlichkeit
eines Spektrum-Analysators hängen zum größten Teil vom
Konzept und der technischen Ausführung des Eingangsteils ab.
Das HF-Eingangsteil wird durch die Komponenten Eingangsabschwächer, Eingangsfilter, Mischer und Umsetzoszillator (LO)
bestimmt.
Das zu analysierende Signal gelangt über den in 10dB-Schritten
schaltbaren Eingangsabschwächer auf ein Eingangsfilter. Dieses Filter erfüllt mehrere Aufgaben: Es verhindert in gewissem
Maße den Mehrfachempfang eines Signals, den Direktempfang
der Zwischenfrequenz (ZF-Durchschlag) und unterdrückt die
Rückwirkung des Oszillators auf den Eingang. Der Eingangsmischer ist zusammen mit dem durchstimmbaren Oszillator (1.
LO) für die Umsetzung der Eingangssignale zuständig. Er bestimmt die frequenzabhängige Amplitudencharakteristik und
die dynamischen Eigenschaften des Gerätes.
Der Analysator arbeitet wie ein elektronisch abgestimmter
Schmalbandempfänger. Die Frequenzabstimmung erfolgt durch
Änderungen vorbehalten

Einführung in die Spektrum-Analyse
eine Sägezahnspannung, welche dem Umsetzoszillator (,,Local
Oscillator”; LO) zugeführt wird. Die gleiche Sägezahnspannung
wird synchron der Horizontalablenkung des Bildschirms zugeführt. Die Ausgangsspannung des Empfängers wird der Vertikalablenkung als Darstellung der Amplitude über der Frequenz
angeboten. Der Analysator wird in seinem Frequenzbereich
durch Änderung (Wobbelung) der Abstimmspannung für den LO
abgestimmt. Die Zwischenfrequenz erhält man, indem die Frequenz des LO mit dem Eingangssignal gemischt wird. Ein Signal
auf dem Bildschirm wird sichtbar, sobald die Differenz zwischen
dem Eingangssignal und der Frequenz des LO gleich der
Zwischenfrequenz ist. Die Selektion wird durch die Eigenschaften des Zwischenfrequenzfilters bestimmt und ist unabhängig
vom Eingangssignal. Die Abstimmfrequenz ist ebenfalls unabhängig vom Eingangssignal. Sie muß jedoch in Einklang mit den
Eigenschaften des ZF-Filters stehen.
Zwischen dem zu analysierenden Frequenzbereich und der
Auflösungsbandbreite bestehen physikalische Zusammenhänge, die bei einer Unterschreitung einer Mindestanalysezeit zu
Fehlern in der Amplitudendarstellung führen. Dies läßt sich
durch automatische Verknüpfung zwischen Frequenzbereich,
Auflösungsbandbreite und Analysezeit vermeiden, hat jedoch in
den Fällen Nachteile, wo es auf schnelle qualitative Analyse von
Signalen ankommt. Im Spektrum-Analysator erfolgt eine automatische Umschaltung der Filterbandbreite in Verbindung mit
dem Frequenzbereich (SPAN), jedoch wird eine unkorrekte
Filtereinstellung mit der UNCAL.-Anzeige signalisiert.
Durch das Funktionsprinzip des Superheterodyne-Spektrumanalysators, erscheint auf der linken Bildschirmseite, auch ohne
Eingangssignal, eine Spektrallinie, welche als ,,NullfrequenzMarke” oder ,,LO-Frequenz-Durchgriff” bezeichnet wird. Dies
tritt auf, wenn die Frequenz des LO gleich der ZF-Frequenz ist.
Eine Ausweitung des Frequenzbereiches um 0Hz ist nicht
möglich, da der LO dann mit der Zwischenfrequenz schwingt
und die ZF-Filter-Charakteristik abgebildet wird. Ein Kondensator am Eingang des Analysators wirkt darüber hinaus als Hochpaß und verhindert, daß Gleichspannung zum Mischer gelangt.
Anforderungen an Spektrum-Analysatoren
Die verschiedenen Einsatzgebiete der Spektrum-Analysatoren
erfordern von diesen Geräten vielfältige Eigenschaften, die sich
zum Teil untereinander ausschließen oder sich nur durch großen
Aufwand zusammenfassen lassen.
Änderungen vorbehalten
33

Einführung in die Spektrum-Analyse
Das Anwendungsgebiet der Spektrum-Analysatoren liegt vor
allen Dingen dort, wo die Genauigkeit und das zeitliche Auflö-
sungsvermögen sowie die geringe Dynamik des Oszilloskopes
bei der Signalanalyse nicht mehr ausreichen.
Dabei stehen großer Frequenzabstimmbereich, Filteranforderungen zwischen extrem schmalbandig und ,,full span”-
Darstellung sowie hohe Eingangsempfindlichkeit nicht unbedingt im Gegensatz zueinander. Sie lassen sich jedoch zusammen mit hoher Auflösung, großer Stabilität, möglichst geradem
Frequenzgang, und geringem Eigenklirrfaktor meist nur unter
großem Aufwand realisieren.
Frequenzmessung
Moderne Spektrum-Analysatoren bieten 3 verschiedene Arten
die Frequenzachse zu ,,scannen”: den gesamten Bereich in
einem ,,sweep” (full span), pro Einheit (Div.) und Festfrequenzbetrieb (Darstellung im Zeitbereich, ,,Zero Scan”).
Die Betriebsart ,,full span” wird benutzt, um das Vorhandensein
von Signalen im nutzbaren Frequenzbereich des SpektrumAnalysators festzustellen. Hierbei wird der gesamte Frequenzbereich von 0Hz bis zur oberen Grenzfrequenz des Analysators
auf dem Bildschirm dargestellt. Für diese Betriebsart gibt es
keine spezielle Schalterstellung. Sie liegt mit einer Mittenfrequenz-Einstellung von 500MHz und der SPAN-Einstellung
1000MHz/Div. vor.
In den meisten Fällen wird ein kleinerer Span eingesetzt, um
bestimmte Signale oder Frequenzbereiche genauer zu untersuchen. Das ,,Zoomen” auf einen bestimmten Bereich erfolgt
mittels der Mittenfrequenzabstimmung. Die eingestellte Mittenfrequenz läßt sich dabei auf dem Display kontrollieren. Die
Skalierung der Frequenzachse wird durch den Schalter Span
vorgenommen.
Stabilität
34
In der ,,zero span”-Betriebsart arbeitet der Analysator als ein auf
eine diskrete Frequenz abgestimmter Empfänger mit wählbaren Bandbreiten.
Es ist wichtig, daß der Spektrum-Analysator eine größere
Frequenzstabilität besitzt als das Signal, das untersucht werden
soll. Die Frequenzstabilität ist abhängig von der Stabilität des
Umsetz- (Local-) Oszillators. Dabei wird zwischen Kurzzeit- und
Änderungen vorbehalten

Auflösung
Einführung in die Spektrum-Analyse
Langzeitstabilität unterschieden. Ein Maß für die Kurzzeit-Stabilität ist die Rest-FM. Sie wird allgemein in Hzpp spezifiziert.
Rauschseitenbänder sind ein Maß f ür die spektrale Reinheit des
(Local-) Oszillators, und gehen ebenfalls in die Kurzzeit-Stabilität
eines Spektrum-Analysators ein. Sie werden spezifiziert durch
eine Dämpfung in dB und einen Abstand in Hz, bezogen auf das
zu untersuchende Signal bei einer bestimmten Filterbandbreite.
Die Langzeit-Stabilität eines Spektrum-Analysators wird überwiegend durch die Frequenzdrift des Umsetz-Oszillators (LO)
bestimmt. Sie ist ein Maß dafür, um wieviel die Frequenz sich
innerhalb bestimmter Zeitbereiche ändert. Eine Frequenzdrift
von max. 150kHz/Std., wie sie beim HM5012/14 vorliegt, ist ein
sehr guter Wert für ein Gerät, das keinen Synthesizer für die
Abstimmung benutzt.
Bevor die Frequenz eines Signals mit dem Spektrum-Analysator
gemessen werden kann, muß dieses Signal ermittelt bzw.
aufgelöst werden. Auflösung heißt dabei, es muß von benachbarten Signalen im zu untersuchenden Spektrum unterschieden
werden. Diese Möglichkeit ist eine entscheidende Voraussetzung für viele Applikationen mit dem Spektrum-Analysator, und
wird grundsätzlich, neben anderen Faktoren, durch dessen
kleinste ZF-Filterbandbreite bestimmt.
Änderungen vorbehalten
Wichtige Kennwerte für die Trennbarkeit zweier benachbarter
Spektrallinien mit stark unterschiedlicher Amplitude sind die
Bandbreite und die Flankensteilheit der ZF-Filter. Die Bandbreite
wird als Frequenz angegeben, bei der der Signalpegel gegenüber der Mittenfrequenz um 3dB abgefallen ist. Das Verhältnis
der 60dB-Bandbreite zur 3dB-Bandbreite wird als Formfaktor
bezeichnet. Dabei gilt: je kleiner der Formfaktor, desto besser
die Fähigkeit des Spektrum-Analysators, eng benachbarte Signale zu trennen.
Ist z.B. der Formfaktor eines Filters im Spektrum-Analysator
15:1, dann müssen zwei in der Amplitude um 60dB unterschiedliche Signale sich in der Frequenz mindestens um den Faktor 7,5
der ZF-Filterbandbreite unterscheiden, um einzeln erkennbar zu
sein. Andernfalls erscheinen sie als ein Signal auf dem Bildschirm.
Der Formfaktor ist jedoch nicht der allein bestimmende Faktor
zur Unterscheidung zweier eng benachbarter Signale mit unter-
35

Einführung in die Spektrum-Analyse
schiedlicher Amplitude. Ebenso wird die Trennbarkeit durch
Rest-FM und die spektrale Reinheit der internen Oszillatoren
beeinflußt. Diese erzeugen Rausch-Seitenbänder, und verschlechtern dadurch die erreichbare Auflösung. Rausch-Seitenbänder werden im Bereich der Basis der ZF-Filter sichtbar, und
verschlechtern die Sperrbereichs-Dämpfung der ZF-Filter.
Ist die kleinste ZF-Bandbreite z.B. 10kHz, dann ist der kleinste
Frequenzabstand, um 2 Spektrallinien voneinander zu trennen,
ebenfalls 10kHz. Dies ist deshalb der Fall, weil der SpektrumAnalysator seine eigene ZF-Filterkurve darstellt, wenn er ein
Signal im Spektrum detektiert. Da die Auflösung des SpektrumAnalysators durch seine ZF-Filterbandbreite bestimmt wird,
könnte man annehmen, daß bei unendlich schmaler Filterbandbreite auch eine unendlich hohe Auflösung erzielt werden
kann. Die Einschränkung ist dabei, daß die nutzbare ZF-Bandbreite durch die Stabilität des Spektrum-Analysators (Rest-FM)
begrenzt wird. D.h., bei einer Rest-FM des Spektrum-Analysators
von z.B. 10kHz, ist die kleinste sinnvolle ZF-Bandbreite, die
verwendet werden kann um ein einzelnes 10kHz-Signal zu
bestimmen, ebenfalls 10kHz. Ein schmalbandigeres ZF-Filter
würde in diesem Fall mehr als eine Spektrallinie auf dem
Bildschirm abbilden, oder ein jitterndes Bild (je nach Wobbelgeschwindigkeit), oder ein nur zum Teil geschriebenes Bild erzeugen. Außerdem besteht eine weitere praktische Einschränkung
für die schmalste Filterbandbreite: die Abtast- oder Scan-Geschwindigkeit im Verhältnis zur gewählten Filterbandbreite.
Dabei gilt: je schmaler die Filterbandbreite ist, desto geringer
muß die Scangeschwindigkeit sein, um dem Filter korrektes
Einschwingen zu ermöglichen.
Rauschen
36
Wird die Scangeschwindigkeit zu groß gewählt, d.h. die Filter
sind u.U. noch nicht eingeschwungen, so resultiert dies in
unkorrekter Amplitudendarstellung des Spektrums. Im allgemeinen werden die einzelnen Spektrallinien dann mit zu niedriger Amplitude dargestellt. Auf diese Weise sind praktische
Grenzen für die kleinste Filterbandbreite gesetzt.
Die Empfindlichkeit ist ein Maß für die Fähigkeit des SpektrumAnalysators, kleine Signale zu messen. Die maximale Empfindlichkeit wird durch das Eigenrauschen bestimmt. Hier unterscheidet man grundsätzlich zwei Arten: thermisches- und nicht-
Änderungen vorbehalten

Einführung in die Spektrum-Analyse
thermisches Rauschen.Das thermische Rauschen wird mit der
Formel
P
= K ⋅ T ⋅ B
N
beschrieben. Dabei ist:
P
= Rauschleistung in Watt
N
K = Boltzmann Konstante (1,38 ⋅ 10
T = absolute Temperatur (K)
B = Bandbreite des Systems in Hz
Diese Gleichung zeigt, daß die Größe des Rauschens direkt
proportional zur Bandbreite ist. Daraus folgt, daß eine Bandbreitenreduzierung der Filter um eine Dekade das Rauschen
prinzipiell um 10dB senkt, was wiederum eine Empfindlichkeitssteigerung des Systems um 10dB bedingt.
Alle weiteren Rauschquellen des Analysators werden als nichtthermisch angenommen. Unerwünschte Abstrahlungen, Verzerrungen auf Grund nichtlinearer Kennlinien und Fehlanpassungen sind Quellen von nicht-thermischem Rauschen.
Unter der Übertragungsgüte oder Rauschzahl versteht man
normalerweise die nicht-thermischen Rauschquellen, zu denen
das thermische Rauschen addiert wird, um die Gesamtrauschzahl des Systems zu erhalten. Dieses Rauschen, welches auch
auf dem Schirm sichtbar wird, bestimmt die Empfindlichkeit
eines Spektrum-Analysators.
-23
Joule/K)
Änderungen vorbehalten
Da der Rauschpegel sich mit der Bandbreite ändert, ist es
notwendig sich beim Empfindlichkeitsvergleich zweier
Analysatoren auf die gleiche Filterbandbreite zu beziehen.
Spektrumanalysatoren werden über ein breites Frequenzband
gewobbelt, sind aber eigentlich schmalbandige Meßinstrumen-
te. Alle Signale die im Frequenzbereich des Spektrum-Analysators
liegen, werden auf eine Zwischenfrequenz konvertiert und
durchlaufen so die ZF-Filter. Der Detektor hinter dem ZF-Filter
sieht nur den Rauschanteil, der innerhalb der schmalen Filterbandbreite liegt. Daher wird auf dem Sichtschirm nur das
Rauschen dargestellt, welches innerhalb des Durchlaßbereiches
des ZF-Filters liegt. Bei der Messung diskreter Signale wird die
maximale Empfindlichkeit also mit dem schmalsten ZF-Filter
erreicht.
37

Einführung in die Spektrum-Analyse
Video-Filter
Die Messung kleiner Signale kann sich immer dann schwierig
gestalten, wenn die Signalamplitude im gleichen Pegelbereich
wie das mittlere Rauschen des Spektrum-Analysators liegt. Um
für diesen Fall die Signale besser sichtbar zu machen, läßt sich
im Signalweg des Spektrum-Analysators hinter dem ZF-Filter
ein Video-Filter zuschalten. Durch dieses Filter, mit einer Bandbreite von wenigen kHz, wird das interne Rauschen des Spektrum-Analysators gemittelt. Dadurch wird unter Umständen ein
sonst im Rauschen verstecktes Signal sichtbar.
Wenn die ZF-Bandbreite sehr schmal im Verhältnis zum eingestellten SPAN ist, sollte das Video-Filter nicht eingeschaltet
werden, da dies zu einer zu niedrig dargestellten Amplitude auf
Grund der Bandbreitenbegrenzung führen kann. (Eine nicht
zulässige Kombination der eingestellten Parameter wird durch
die UNCAL. Anzeige im READOUT angezeigt).
Empfindlichkeit - Max. Eingangspegel
Die Spezifikation der Eingangsempfindlichkeit eines SpektrumAnalysators ist etwas willkürlich. Eine Möglichkeit der Spezifikation ist, die Eingangsempfindlichkeit als den Pegel zu definieren,
bei dem die Signalleistung der mittleren Rauschleistung des
Analysators entspricht. Da ein Spektrum-Analysator immer
Signal plus Rauschen mißt, erscheint bei Erfüllung dieser Definition das zu messende Signal 3dB oberhalb des Rauschpegels.
38
Die maximal zulässige Eingangsspannung für einen SpektrumAnalysator ist der Pegel, der zur Zerstörung (Burn Out) der
Eingangsstufe führt. Dies ist bei einem Pegel von +10dBm für
den Eingangsmischer, und +20dBm für den Eingangsabschwächer der Fall. Bevor der ,,burn out”-Pegel erreicht wird,
setzt eine Verstärkungskompression beim Spektrum-Analysator
ein. Diese ist unkritisch, solange eine Kompression von 1dB
nicht überschritten wird.
Darüber hinaus kann davon ausgegangen werden, daß der
Analysator Nichtlinearitäten auf Grund von Übersteuerung produziert. Außerdem steigt die Gefahr einer unbemerkten Überlastung der Eingangsstufe, weil sich einzeln dargestellte Spektrallinien in der Abbildung auf dem Bildschirm auch bei einsetzender
Verstärkungskompression meist nur unmerklich verändern. Auf
jeden Fall entspricht die Abbildung der Amplituden nicht mehr
den tatsächlichen Verhältnissen.
Änderungen vorbehalten

Einführung in die Spektrum-Analyse
Bei jeder Signalanalyse entstehen im Spektrum-Analysator
selbst Verzerrungsprodukte, und zwar größtenteils verursacht
durch die nichtlinearen Eigenschaften der Eingangsstufe. Sie
bewegt sich beim HM5012/14 in der Größenordnung von 70dB
unterhalb des Eingangspegels, solange dieser nicht größer als
-27dBm ist. Um größere Eingangssignale verarbeiten zu kön-
nen, ist dem Mischer ein Eingangsabschwächer vorgeschaltet.
Das größte Eingangssignal, welches dem Spektrum-Analysator
bei jeder beliebigen Stellung des Abschwächers verarbeiten
kann ohne ein bestimmtes Maß an Verzerrungen zu überschreiten, wird der ,,optimale Eingangspegel” genannt. Das Signal
wird dabei soweit abgeschwächt, daß der Mischer keinen
größeren Pegel als -27dBm angeboten bekommt. Anderenfalls
werden die spezifizierten 70dB Oberwellenabstand nicht eingehalten. Diese 70dB verzerrungsfreier Bereich werden auch als
nutzbarer Dynamikbereich des Analysators bezeichnet. Zum
Unterschied dazu wird der (darstellbare) Anzeigebereich definiert als das Verhältnis vom größten zum kleinsten gleichzeitig
angezeigten Pegel, ohne daß Intermodulationsprodukte des
Analysators auf dem Bildschirm sichtbar sind.
Der maximale Dynamikbereich eines Spektrum-Analysators
läßt sich aus den Spezifikationen ermitteln. Den ersten Hinweis
gibt die Spezifikation für die Verzerrungen. So beträgt dieser
Wert z.B. für beide Spektrum-Analysatoren 70dB bis zu einem
Eingangspegel von -27dBm am Eingang bei 0dB Eingangsabschwächung. Um diese Werte nutzbar zu machen, muß der
Spektrum-Analysator in der Lage sein, Pegel von -97dBm erkennen zu lassen. Die dafür erforderliche ZF-Bandbreite sollte nicht
zu schmal sein, sonst ergeben sich Schwierigkeiten auf Grund
von Seitenbandrauschen und Rest-FM. Die ZF-Bandbreite von
9kHz ist ausreichend, um Spektrallinien mit diesem Pegel
darzustellen. Der verzerrungsfreie Meßbereich kann durch eine
Reduzierung des Eingangspegels weiter ausgedehnt werden.
Die einzige Einschränkung bildet dann die Empfindlichkeit des
Spektrum-Analysators.
Frequenzgang
Änderungen vorbehalten
Die maximal mögliche Dynamik wird erreicht, wenn die Spektrallinie mit dem höchsten Pegel den Referenzpegel gerade
noch nicht überschreitet.
Der Frequenzgang eines Spektrum-Analysators läßt sich als
seine Amplitudenstabilität über der Frequenz beschreiben. Um
39

Einführung in die Spektrum-Analyse
einen möglichst guten Frequenzgang zu erhalten, müssen die
Mischerverluste möglichst frequenzunabhängig sein. Für exakte Amplitudendarstellungen sollte der Frequenzgang im gesamten Bereich möglichst geringe Schwankungen aufweisen. Jedoch ist gerade diese Eigenschaft nur durch entsprechend
großen Aufwand zu erzielen. Das System muß schon vom
Prinzip her sehr frequenzlinear sein, weil sich Abweichungen
meist nur sehr schwer auskalibrieren lassen. Für die Aufgabenstellung eines Spektrum-Analysators, verschiedene Signalpegel
bei unterschiedlichen Frequenzen zu messen, ist ein möglichst
enger Frequenzgang erforderlich; ansonsten wäre sein Nutzen
stark eingeschränkt.
Mitlaufgeneratoren
Mitlaufgeneratoren (Tracking Generatoren) sind spezielle Generatoren, bei denen die Frequenz des Ausgangssignals vom
Spektrum-Analysator gesteuert wird. So wird ein Ausganssignal
erzeugt, welches exakt der Abstimmung (tuning) des SpektrumAnalysators folgt. Auf Grund dieser Besonderheit erweitert ein
Mitlaufgenerator (nur im HM5014) die Anwendungsmöglich-
keiten eines Spektrum-Analysators wesentlich. Im ,,full-scanmode” erzeugt der Mitlaufgenerator ein gewobbeltes Signal
über seinen gesamten zur Verfügung stehenden Frequenzbereich. Wird ein kleinerer Span verwendet, so wird ein Sinussignal erzeugt, dessen Frequenz sich mit der MittenfrequenzEinstellung des Spektrum-Analysators verändert.
40
Die Ursache für den exakten ,,Mitlauf” (Tracking) zwischen der
steuernden und der generierten Frequenz liegt darin, daß sowohl der Spektrum-Analysator als auch der Mitlaufgenerator
vom gleichen spannungsgesteuerten Oszillator kontrolliert werden; d.h. beide Baugruppen werden über den Local-Oszillator
des Spektrum-Analysators synchronisiert. Das Ausgangssignal
des Mitlaufgenerators wird durch Mischen zweier Oszillatorsignale erzeugt. Das eine Signal wird im Mitlaufgenerator selbst
erzeugt, das Andere im Spektrum-Analysator. Ist die durch
Mischung erzeugte Frequenz gleich der Zwischenfrequenz des
Spektrum-Analysators, dann ist die Ausgangsfrequenz des
Mitlaufgenerators gleich der Eingangsfrequenz des SpektrumAnalysators. Diese Bedingung gilt für alle ,,Span-Modi”.
Der Begriff ,,mitlaufen” oder Tracking bedeutet dabei, daß sich
die Frequenz der Ausgangsspannung immer in der Mitte des
Durchlaßfilters des Spektrum-Analysators befindet. Oberwellen
Änderungen vorbehalten

des Signals, seien sie im Mitlaufgenerator selbst oder im
Spektrum-Analysator entstanden, liegen so außerhalb des
Durchlaßbereiches der Filter im Spektrum-Analysator. Auf diese
Weise wird nur die Grundfrequenz des Mitlaufgenerators auf
dem Bildschirm dargestellt. Frequenzgangmessungen über einen sehr großen Bereich sind so möglich, ohne daß die Messung von spektralen Unzulänglichkeiten des Generatorsignals
beeinflußt wird. Die Empfindlichkeit des Systems wird durch
das Eigenrauschen, und somit durch die Filterbandbreite des
Spektrum-Analysators begrenzt. Die schmalste zur Messung
nutzbare Bandbreite wird durch die Rest-FM des Mitlaufgenerators bestimmt, sowie durch die Frequenzabweichung
beim ,,tracking” zwischen Generator und Spektrum-Analysator.
Ausschlaggebend ist dabei wieder die Qualität des LO im
Spektrum-Analysator und außerdem der PLL zur Nachsteuerung
der Frequenz im Mitlaufgenerator. Für Frequenzgang- und
Dämpfungsmessungen an Verstärkern oder Filtern wird der
Mitlaufgenerator (nur im HM5014 enthalten) eingeschaltet. Die
Ausgangsspannung des Mitlaufgenerators wird an dem zu
untersuchenden Bauteil eingespeist und die an dessen Ausgang
anliegende Spannung dem Eingang des Spektrum-Analysators
zugeführt. In dieser Konfiguration bilden die Geräte ein in sich
geschlossenes, gewobbeltes Frequenzmeßsytem. Eine pegelabhängige Regelschleife im Mitlaufgenerator stellt die erforderliche Amplitudenstabilität im gesamten Frequenzbereich sicher.
Reflexionsfaktor und Rückflußdämpfung lassen sich mit diesem
System messen, und somit auch Stehwellenverhältnisse ermitteln.
Änderungen vorbehalten
41

Anhang A
CODES serielle Schnittstelle RS232
Spektrum-Analysator HM 5012 / HM5014
RS232-Parameter beim Einschalten:
4800 Baud, 8 Datenbits, 1 Stopbit, No Parity
Meldung beim Einschalten: HAMEG HM5012 Vx-xx / HM5014 Vx-xx
Befehle vom PC zum HM 5012 / 5014
Allgemeiner Aufbau: Als erstes Zeichen eines jeden Befehls muss das ‘#’ [Ox23]
gesendet werden. Dann folgen Characters z.B. TG für Tracking Generator. Die dann
folgenden Zeichen werden für die einzelnen Befehle weiter unten genau definiert.
Abgeschlossen wird jeder Befehl mit dem Zeichen „OxOd“ (= Enter-Taste). Es wird nicht
zwischen Gross- und Kleinschreibweise der Buchstaben unterschieden (z.B.: TG = tg). Die
Angabe der Masseinheit ist immer eindeutig (z.B.: Span immer in MHz), und wird deshalb
nicht mit angegeben.
Liste der Einstellbefehle:
((E) Bedeutet Enter-Taste)
#kl0 (E) = Key-Lock off
#kl1 (E) = Key-Lock on (Remote-LED leuchtet)
#tg0 (E) = Tracking-Generator off
#tg1 (E) = Tracking-Generator on
#vf0 (E) = Video-Filter off
#vf1 (E) = Video-Filter on
#tl+01.0 (E) = Tracking Level von +1.0 dB
#tl-50.0 (E) = bis -50.0 dB in 0.2 dB-Schritten
#rl-27.0 (E) = Referenz Level von -27.0 dB
#rl-99.6 (E) = bis -99.6 dB in 0.4 Schritten
#at0 (E) = Attenuator 0 (10, 20, 30, 40) dB
#bw400 (E) = Bandwidth 400 (120,9) kHz
#sp1000(E) = Span 1000 (1000,500,200,...5,2,1) MHz
#sp0 (E) = Span Zerospan
#db5 (E) = 5 dB/Div.
#db10 (E) = 10 dB/Div.
#cf0500.000 (E) = Centerfrequenz in xxxx.xxx MHz
#dm0 (E) = Detect mode off
#dm1 (E) = Detect mode on
#sa (E) = Speichert Signal A in Speicher B
#vm0 (E) = Anzeige: Signal A
#vm1 (E) = Anzeige: Signal B (gespeichertes Signal)
#vm2 (E) = Anzeige: Signal A-B
#vm3 (E) = Anzeige: Average (Mittelwert)
#vm4 (E) = Anzeige: Max. Hold
#br4800 (E) = Baudrate 4800 (9600, 38400, 115200) Bd.
#bm1 (E) = Signaltransfer in Blöcken (2048 Byte)
2044 Signalbyte, 3 Prüfsummenbyte und hex: 0x0d
42
Änderungen vorbehalten

Anhang A
#rc0 (E) = Recall (0 bis 9)
#sv0 (E) = Save (0 bis 9)
Spezielle Befehle für EMV-Messungen, nur sinnvoll mit Zero-Span:
#es0 (E) = „1-Sekunden-Sweep“ sperren
#es1 (E) = „1-Sekunden-Sweep“ freigeben (1 Sekunde Meßzeit; Zero-Span
#ss1 (E) = Startet „1-Sekunden-Sweep“ bei eingestellter Centerfrequenz
#ss2 (E) = Startet „1-Sekunden Sweep“ mit Centerfrequenz und ändert
Beispiel EMV-Messung:
#es1 (Funktion freigeben), #ss2 (messen), #ss2 ..., #ss2, #es0 (Funktion sperren).
Nachdem ein Kommando empfangen und ausgeführt wurde, sendet der SpektrumAnalysator „RD (hex: 0x0d)“ zurück.
Parameterabfrage (Liste der Abfagebefehle):
Syntax:
#xx (E) = sende Parameter xx (xx = tg, tl, rl, vf, at, bw, sp, cf, db, kl, hm,
1. Beispiel:
„#uc (unkalibriert)“: PC sendet #uc (CR). Instrument antwortet mit: uc0 (kalibriert)
oder uc1 (unkalibriert)
einschalten und 9/120/400kHz Bandbreite wählen)
nach dem Meßvorgang die Centerfrequenz mit der Schrittweite
der eingestellten Bandbreite. (Bandbreite: 400, 120, 10 (9) kHz)
vn, vm, uc)
2. Beispiel:
„#tl“, PC fragt Tracking-Generator Pegel ab: PC sendet #tl1 (CR). Instrument antwortet mit: TL-12.4 (CR)
3. Beispiel: PC sendet Befehlssequenz an Analysator:
#kl1 (E) = Schaltet „Remote“ ein.
#cf0752.00 (E) = Setzt Centerfrequenz auf 752MHz
#sp2 (E) = Setzt Span auf 2 MHz
#bw120 (E) = Setzt Bandbreite auf 120kHz
#kl0 (E) = Schaltet auf manuelle Bedienung
4. Beispiel: „#vn“: PC fragt Software-Version ab (z.B. „1.00“)
5. Beispiel: „#hm“: PC fragt nach Gerätetype (z.B. HM5014)
Änderungen vorbehalten
43

44
Änderungen vorbehalten

Manual
Software
SW5012
Instruments
Änderungen vorbehalten
45

Software SW5012
Beschreibung der Funktionen und der Einstellungen.
Übersicht über die Menüs.
Pulldown Menue 1:
Data
Load
Save
Settings Laden, bzw. Speichern der Geräteein-
stellungen,
Measurements Laden, bzw. Speichern der Meßwerte
46
New/Copy
Änderungen vorbehalten

Edit
Delete
Änderungen vorbehalten
Neuanlegen, Kopieren, Ändern (Editieren), Löschen der vier
folgenden verschiedenen Themen:
Limitdefinition
Definition der Grenzwertlinien
Loss/Gain-Components
Festlegung der Verstärker- und Kabeldämpfungswerte usw.
durch Meßwerte (Dämpfungsverlauf).
Config
Zusammenstellung der Einzelteile für einen Meßaufbau und
Übernahme der Verstärker- und Dämpfungswerte zur Berück-
sichtigung im Gesamtmessergebnis.
EMC-Test
Festlegung der Geräteeinstellung für einen Test: Start-, Stopfrequenz, Dämpfungseinstellung, Filterbandbreite usw.
47

Print
bewirkt Vorschau auf den Druckjob und erlaubt Starten des
Drucks
48
Printer Setup
Printerkonfiguration
Database Selection
Wählt die Datenbank aus
Änderungen vorbehalten

Exit Verlassen des Programms
Pulldown Menue 2: (Einstellung Mode Normal)
Settings
Configuration
Einrichten der seriellen Schnittstelle, Auswahl des COM-Ports
und der Übertragungsrate oder automatische Erkennung.
Measurement
Öffnen des Fensters für die Geräteeinstellung und des
Darstellungsfensters für die aktuellen Meßwerte.
Display Mode
gliedert sich in zwei Bereiche: Spektrumanalysator und die
Darstellung auf dem Computerbildschirm.
Tracking Fenster für die Bedienung des Trackinggenerators (nur HM5014).
Pulldown Menue 3:
Mode
Normal Bedienung des Analysators, Fernsteuerung vom PC und die
EMC Erweiterte Bedienung des Analysators zur Messung der Stör-
Änderungen vorbehalten
Datenübernahme, Auswertung und Abspeicherung auf dem
PC.
strahlung über Antennen unter Berücksichtigung des Antennen-
gewinns, Dämpfung von Kabeln, Verstärkern usw.
49

Autostore
Betriebsarten:
Normal Mode
Zeitgesteuerte Messungen im Normal Mode mit automatischer Speicherung im PC.
Die Bedienung des Spektrumanalysators, wie der Bediener es von der
Frontplatte gewohnt ist, geschieht im Normal Mode des Programms.
Im Mode Menue Normal anklicken, erlaubt die normale Fernbedienung des Spektrumanalysators von der Programmoberfäche durch
Auswahl der gewünschten Einstellung im Measurement Fenster,
vorausgesetzt, die Remotefunktion in der zweiten Leiste ist aktiv
(RM). Durch Anklicken im vorgegebenen Fenster wird Remote on
(Häkchen sichtbar), oder Remote ausgeschaltet.
Bei der Einstellung Remote on kann die Center-Frequency durch
Eingabe eines Zahlenwertes und anschließendem Return gewählt
werden, z. B. in 0.01 MHz-Schritten.
Die Ref-Level Anzeige wird automatisch mit einer Änderung des
Attenuators aktualisiert. In dem nebenstehenden Feld läßt sich auch die
angezeigte Einheit auswählen. Außerdem lassen sich der Span, die
Filterbandbreite, die Skalierung und das Video-Filter ein-, bzw. aus- oder
umschalten.
Correction on
Calculation on
50
Die "Funktion Correction" ermöglicht das Nachmessen von einzelnen Störlinien unter den Bedingungen des EMC-Modus. Mit
"Correction on" werden die Korrekturdaten der gewählten EMC-
Konfiguration berücksichtigt. Dabei können die Grenzwertlinien gewählt und angezeigt werden.
In dem Fenster Display Mode beziehen sich der linke Teil "Analyzer"
und "Settings" auf das Gerät. Der rechte Teil mit Read/View bezieht
sich auf die Darstellung auf dem Rechnerbildschirm.
Mit Save A ¡ B wird der Referenzspeicher mit einer neuen Kurve A
geladen.
Änderungen vorbehalten

In dem Fenster Settings können 10 verschiedene Einstellungen abgespeichert und wieder geladen werden. Es sind die 10 Speicher, die auch
von der Frontplatte erreicht werden können. Für den Spektrumanalysator
können als Anzeige ausgewählt werden: Sample (aktuelle Kurve A),
Referenz B oder A-B. Ist die Calculation aktiv, kann eine der Kurven
"Max. Hold" oder "Average" angezeigt werden. Die Funktion
"Calculation on" ist hier notwendig, da Max. Hold und Average
während des aktiven Zeitraums gebildet werden. Durch Anklicken der
Leiste Reset Calculation wird die Meßzeit erneut gestartet.
In dem rechten Fenster "Read/View" werden die zu übertragenden
und anzuzeigenden Kurven ausgewählt. Die Farben der dargestellten
Kurven sind am rechten Rand des Kurvenfensters erläutert, sowie
oberhalb der Kurven die Zeit der letzten Erfassung. Wird zum Beispiel
beim Spektrumanalysator die Funktion Calculation off geschaltet, dann
werden die Kurven "Max. Hold" und "Average" nicht mehr aktuali-
siert, da am Analysator die Erfassung abgeschaltet ist. Sollen die Kurven
aus dem Anzeigefenster gelöscht werden, dann ist die Funktion
"Erase" zu betätigen. Bei einer Änderung der Centerfrequency werden
automatisch die angezeigten Kurven gelöscht und nach der Übertragung neu berechnet.
Funktionsweise des EMC-Modes, Aufgabe der Software
Der EMC-Modus dieser Software erlaubt es, den HAMEG Spektrumanalysator als Teil eines Precompliance-Meßsystems einzusetzen,
das im Normalfall aus mehreren Komponenten besteht. Außerdem
können im Rahmen des Programms eigene Meßabläufe und Gerätezusammenstellungen definiert werden.
Änderungen vorbehalten
Typische Gerätezusammenstellungen sind:
Netznachbildung, BNC-Kabel und Meßgerät (Spektrumanalysator),
oder
Antenne, Verstärker, Kabel und Meßgerät.
Die Software soll nun die Arbeit erleichtern, d.h. diese Komponenten zu
einem einheitlichen System verknüpft werden; die Frequenzgänge der
Einzelkomponenten werden im angezeigten Meßergebnis berücksichtigt.
Der Frequenzgang der verwendeten Komponenten wird in einer
Teiledefinition als Wertetabelle, die den Frequenzgang definiert,
abgelegt und abgespeichert. Der Meßaufbau wird als Reihenschaltung der einzelnen Komponenten in einem Fenster definiert und als
ein Meßsystem abgespeichert.
51

Darüber hinaus stellt die Software auch einen Quasipeak und einen
richtigen Average zur Verfügung. Dazu wird 1s lang im Zerospan auf
einer Frequenz gemessen und sehr viele Daten gesammelt und der
Mittelwert gebildet. In einer weiteren Berechnung werden die Ergebnisse für die Quasipeakmessung mittels eines Digitalfilters ermittelt.
Es ergibt sich nun folgende Vorgehensweise um die Software zu
konfigurieren:
1. Der Frequenzgang aller Komponenten muß dem System mitgeteilt
werden. Es können beliebig viele Komponenten angelegt werden. Sie
müssen sich jedoch alle im Namen unterscheiden.
2. Die verwendeten Komponenten werden zu einem Meßsystem zusam-
mengestellt und mit einem aussagefähigen Namen, z. B. Netznachbildung abgespeichert. Maximal fünf Komponenten können zu einer
Konfiguration zusammengefaßt werden, was im Normalfall auch ausreichen dürfte. Alle nicht verwendeten Komponenten werden durch ein
ideales Kabel ersetzt, das bei jeder Frequenz weder eine Dämpfung noch
eine Verstärkung besitzt. Es können beliebig viele dieser Konfigurationen
erstellt werden. Voraussetzung dafür ist jedoch, daß jede einen anderen
Namen erhält.
3. Die Norm schreibt die Einhaltung verschiedener Grenzwerte vor. Um diese
anzuzeigen, müssen sie vorher definiert werden. Es können beliebig viele
Grenzwerte definiert werden, die sich immer im Namen unterscheiden
müssen, aber nur zwei können gleichzeitig angezeigt werden.
4. Jetzt können die Grenzwertlinien und die Konfiguration zu einem EMC-
Test zusammengefügt werden. Zusätzlich muß noch die Startfrequenz,
Stoppfrequenz, Bandbreite, die Dämpfung und die zu verwendende
Meßmethode angeben werden.
Nach diesen Grundeinstellungen sind die Voraussetzungen geschaffen komplexe EMC-Tests größtenteils automatisch auszuführen.
Definition neuer Komponenten
Um eine neue Komponente hinzuzufügen, muß man aus dem Menü
Data den Eintrag New/Copy die Loss/Gain-Components auswäh-
len. Danach wird das gleichnamige Fenster angezeigt.
In dem oberen Feld wird die Bezeichnung der neuen Komponente
eingegeben. Es sind maximal 80 Zeichen möglich; auch Leerzeichen
sind erlaubt. Tastatureingaben müssen immer mit der Taste Return
beendet werden. Danach wird durch Drücken des Knopfes Add New
die neue Komponente der Datenbank hinzugefügt.
52
Änderungen vorbehalten

Die Daten aus einer bestehenden Komponente können dann über die
Copy Funktion in die neue Komponente kopiert werden. Diese
Vorgehensweise empfiehlt sich, wenn nur wenige Daten unterschiedlich sind. Als nächster Schritt wird zum Beispiel der Frequenzgang einer Komponente definiert. Um dies zu tun, den Knopf View
limitdefinition betätigen, oder alternativ, schließen des Fensters
und das Menü
Data/ Edit/ (Loss/Gain-Components) auswählen.
Dann wird sich folgendes Fenster öffnen:
Änderungen vorbehalten
53

Zuerst sollten Sie den Typ dieser Komponente auswählen. Es kann
sich um eine Antenne (Antenna), ein Dämpfungselement (Loss
component) oder ein Verstärkungselement handeln.
Bei der Auswahl einer Antenne ist zu beachten, daß sich der Frequenzgang auf einen bestimmten Meßabstand bezieht; dieser Abstand ist
im Feld “Distance (m)” in Meter anzugeben.
Nun können Sie den Frequenzgang eingeben, indem Sie in dem Feld
“Freq. in MHz” die Frequenz eingeben und in dem Feld “Level” den
dazugehörigen Korrekturwert (dB). Drücken Sie danach in dem Feld
“Level” die “Returntaste”, um die Eingabe zu bestätigen und den
Eintrag in die Tabelle zu übernehmen. Die Reihenfolge spielt dabei keine
Rolle; es wird automatisch nach aufsteigender Frequenz sortiert.
Ist Ihnen bei der Eingabe ein Fehler passiert, ist dies nicht weiter
schlimm. Wählen Sie mit der Maus den falschen Eintrag in der Tabelle
aus; dieser wird entsprechend farblich hervorgehoben. Drücken Sie
danach die Entfernentaste. Der Eintrag wird aus der Tabelle entfernt,
die Tabelle neu sortiert und auch die Grafik neu gezeichnet.
Nachdem Sie alle Stützstellen eingegeben haben, gibt es noch die
Möglichkeit in dem Feld “Memo” Zusatzangaben zu machen, z.B.
Datum der letzten Kalibrierung, den Namen des Bearbeiters oder
irgend einen Kommentar.
Auf diese Weise können Sie alle Komponenten, die von Ihnen
verwendet werden, im System bekannt machen und dafür sorgen,
daß diese auch entsprechend verrechnet werden.
Erstellen einer Konfiguration
Unter der Bezeichnung Konfiguration verstehen wir eine Zusammenstellung mehrerer Komponenten zu einem einheitlichen Meßsystem.
Fügen Sie eine neue Konfiguration hinzu und wählen Sie “Data/Edit/
C
onfig”. Damit öffnet sich das Fenster "Configuration".
In diesem Fenster ist der Signalverlauf angedeutet. Das Signal bewegt sich vom DUT in Richtung des Spektrumanalysators.
Falls Ihre Konfiguration eine Antenne beinhaltet, so muß diese in das
1. (oberste) Feld eingetragen werden, denn diese ist dem DUT am
nächsten. Antennen dürfen immer nur in das 1. Feld eingetragen
54
Änderungen vorbehalten

werden. Eine Konfiguration kann logischerweise immer nur eine
Antenne beinhalten. Danach kommen die nächsten Komponenten,
wie zum Beispiel:
Dämpfungselemente, Verstärker und Kabel. In allen unbesetzten
Feldern muß das ideale Kabel eingetragen werden. Das ideale Kabel
hat weder Dämpfung noch Verstärkung und damit auch keinen Einfluß
auf die Messung.
Definieren der Grenzlinien
Fügen Sie eine neue Grenzlinie hinzu und wählen Sie “Data/Edit/
Limitdefinition”. Dadurch öffnet sich das Fenster "Limit-definition".
Wählen Sie als erstes die Einheit, in der die Grenzen definiert sind. Falls
es sich um eine Grenze für gestrahlte Größen handelt, wählen Sie das
Feld “ Radiated” aus und geben in diesem Fall den Abstand ein, für den
diese Grenzdefinition gilt.
Wenn die Grenze mit dem Logarithmus der Frequenz fallen oder steigen
soll, wählen Sie
“Logarithmic def.”. Als nächstes geben Sie die
Änderungen vorbehalten
55

Test erstellen
Frequenzen und die Pegel ein. Falls Sie möchten, können Sie auch
noch ein Memo eintragen.
Fügen Sie einen neuen EMC-Test hinzu und wählen Sie das Fenster
“
Data/Edit/EMC-Test”. Das Fenster “Test-Settings” öffnet sich
dann.
56
Wählen Sie zuerst die entsprechende Konfiguration und die Grenzlinien aus. Geben Sie danach die Startfrequenz und die Stoppfrequenz
ein. Das Meßgerät wird später beim Test bei der Startfrequenz
beginnen und dann jeweils um die Bandbreite versetzt bis zur Stopfrequenz durchfahren. Wichtig ist auch die Einstellung des Reflevels
und der Einheit. Achten Sie darauf, daß das Meßgerät nicht übersteuert und wählen Sie den Attenuator entsprechend. Als nächstes
wählen Sie die Bandbreite und die entsprechenden Detektoren.
Nun haben Sie noch die Möglichkeit die Polarisation anzugeben. Wenn
Sie horizontal wie auch vertikal wählen, wird zuerst in der horizontalen
Ebene gemessen und danach auf der vertikalen Ebene. Die beiden
Messungen werden überlagert, so daß nur der maximale Wert
übernommen wird.
Die nächste Entscheidung die Sie treffen müssen ist der Meßmodus.
Änderungen vorbehalten

Step:
Bei diesem Modus wird jede Frequenz 1s lang gemessen (Zerospan).
Die erste Messung beginnt bei der Startfrequenz. Anschließend wird
die Meßfrequenz um den Betrag der Meßbandbreite (Bandwidth)
erhöht und erneut gemessen, bis die Stopfrequenz erreicht ist. Zu der
Meßzeit von einer Sekunde kommt noch die Zeit der Datenübertragung und Berechnung hinzu, so daß sich selbst bei einem schnellen
Rechner immer noch Schrittzeiten von 1,5 bis 2s ergeben. Der Vorteil
dieser Methode ist eine genaue Messung über den gesamten Bereich; dies muß man sich jedoch durch eine hohe Meßdauer erkaufen.
Sweep + Step:
Bei diesem Modus wird der größtmögliche Span bezüglich der Bandbreite gewählt. Nun wird mit der Max-hold Erfassung die Centerfrequenz
zwischen der Startfrequenz bis zur Stoppfrequenz so oft versetzt, bis der
komplette Bereich abgedeckt wurde (Sweep). Die Erfassung läuft pro
Centerfrequenz so lange, wie es in dem Punkt “Meas. Time” (in
Sekunden) eingegeben wurde. Danach wird überprüft, ob sich bei einer
Änderungen vorbehalten
57

Frequenz der gemessene Pegel den “Lim. distance” Wert überschritten hat. Ist dies der Fall, werden die so ermittelten Frequenzen
einzeln nachgemessen (Step). Wobei wiederum auf jeder Frequenz
1s lang gemessen wird. Diese Methode hat den Vorteil, daß die
Messung relativ schnell beendet ist. Man hat allerdings nur auf den
Frequenzen nachgemessen, die sich entsprechend den Grenzen
angenähert haben.
EMC-Tests durchführen
Um einen EMC-Test durchzuführen, müssen Sie die Software in den
EMC-Mode umschalten. Wählen Sie hierzu das Menü Mode und
58
danach EMC. Dadurch wird das EMC Fenster geöffnet.
Wählen Sie nun im EMC-Fenster den entsprechenden EMC-Test aus
und starten Sie diesen durch Druck auf die Taste Start. Sie werden
nach einem Dateinamen gefragt; geben Sie diesen Ihren Wünschen
entsprechend ein. Beachten Sie jedoch, daß dieser den Beschränkungen des Betriebssystems unterliegt. Unter diesem Namen wird die
Messung gespeichert. Dies ist eine externe Datei, sie ist also nicht
Bestandteil der Datenbank. Danach folgen Sie den Anweisungen auf
Änderungen vorbehalten

dem Bildschirm; diese werden je nach Test unterschiedlich sein.
Die Felder Peak, Qpeak, Average, Sweep haben nichts mit der
Messung zu tun; sie entscheiden lediglich was auf dem Bildschirm
angezeigt wird. Gemessen wird das, was in dem Test definiert wurde.
Im Stopbetrieb wird die Grafik nach jewails 50 Meßschritten aktualisiert, während dies im Sweep-Mode erst nach Beendigung des
Sweeps erfolgt.
Sie können die Messung jederzeit mit der Taste Stop unterbrechen.
Es ist möglich, daß das System etwas träge auf die Unterbrechung
reagiert, normaler weise genügt jedoch ein Druck auf die Stop-Taste.
Denken Sie jedoch daran, daß es nicht möglich ist, die Messung zu
einem späteren Zeitpunkt weiterzuführen. Sie können jedoch die
unterbrochenen Messungen ganz normal laden, ansehen und drukken.
Änderungen vorbehalten
59

Instruments
®
Germany
HAMEG Service
Kelsterbacher Str. 15-19
60528 FRANKFURT am Main
Tel. (069) 67805 - 24 -15
Telefax (069) 67805 - 31
E-mail:
service@hameg.de
Oscilloscopes
Multimeters
Counters
Frequency Synthesizers
Generators
R- and LC-Meters
Spectrum Analyzers
Power Supplies
Curve Tracers
Time Standards
HAMEG GmbH
Industriestraße 6
63533 Mainhausen
Tel. (06182) 8909 - 0
Telefax (06182) 8909 - 30
E-mail:
France
HAMEG S.a.r.l
5-9, av. de la République
94800-VILLEJUIF
Tél. (1) 4677 8151
Telefax (1) 4726 3544
E-mail:
Spain
HAMEG S.L.
Villarroel 172-174
08036 BARCELONA
Teléf. (93)4301597
Telefax (93)321220
E-mail:
Great Britain
HAMEG LTD
74-78 Collingdon Street
LUTON Bedfordshire LU1 1RX
Phone (01582) 413174
Telefax (01582) 456416
E-mail:
sales@hameg.de
hamegcom@magic.fr
email@hameg.es
sales@hameg.co.uk
Printed in Germany
United States of America
HAMEG, Inc.
266 East Meadow Avenue
EAST MEADOW, NY 11554
Phone (516) 794 4080
Toll-free (800) 247 1241
Telefax (516) 794 1855
42 - 5014 - 00D0
E-mail:
Hongkong
HAMEG LTD
Flat B, 7/F,
Wing Hing Ind. Bldg.,
499 Castle Peak Road,
Lai Chi Kok, Kowloon
Phone (852) 2 793 0218
Telefax (852) 2 763 5236
E-mail:
hamegny@aol.com
hameghk@netvigator.com
 Loading...
Loading...