Page 1
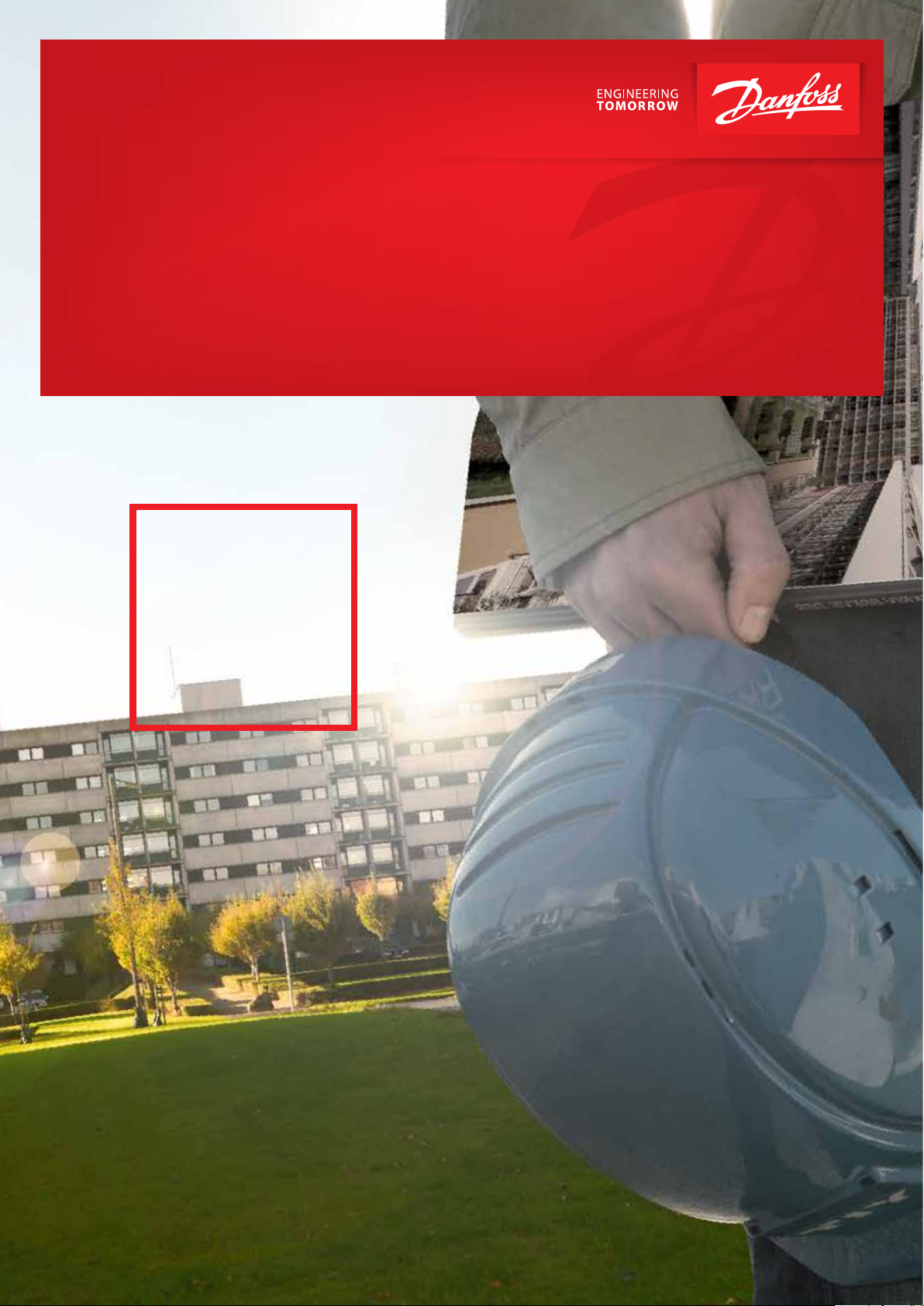
Handbuch über Fernwärmeanwendungen
Zukunftssichere Lösungen
Unser Know-how für Sie
zusammengefasst.
>30
Jahre Erfahrung
mit Fernwärmeanwendungen
und mehr als 5 Millionen
Installationen weltweit
Page 2

Index
Handbuch über Fernwärmeanwendungen
Einführung in das Handbuch
4 Fernwärme von innen betrachtet
6 Anpassung der Fernwärme an die Gebäudeerfordernisse
8 Hinweise zum Gebrauch des Handbuchs
9 Vergleich von Applikationen
10 Die FW-Applikationen im Überblick
.....................
3
Allgemeine Prinzipien ................................13
14 Hydraulischer Abgleich: Reglertypen
16 Hydraulischer Abgleich: Regelfunktionen
18 Leerlauunktionen
21 Witterungsführung
Empfohlene Applikationen ..................... 23
27 1. Anwendungen der Trinkwassererwärmung
35 2. Indirekt und direkt angeschlossene Raumheizungsanwendungen
43 3. Versorgungssysteme für Wohnungsstationen
53 4. Direkt und indirekt angeschlossene Raumheizung sowie
Trinkwassererwärmung im Durchussprinzip mittels
Wärmeübertrager
63 5.
71 6. Direkt und indirekt angeschlossene Raumheizungen und
79 7. Zweistuge Applikationen
85 8. Indirekt angeschlossene Raumheizung und sekundärseitig
89 9. Indirekt angeschlossene Raumheizung und sekundärseitig
Direkt und indirekt angeschlossene Raumheizung sowie
Trinkwassererwärmung mittels Speicherladesystem
Trinkwassererwärmung im SWE (Registerspeicher)
angeschlossenes Speicherladesystem (Applikation S.1.2)
angeschlossenem SWE (Registerspeicher) S.1.3
Über Danfoss District Energy ...................92
Anlage ............................................................. 96
98 Abkürzungen
98 Applikationssymbole
99 Literaturverweise
Page 3

Seite 3 – 11
Einführung in das Handbuch
• Fernwärme von innen betrachtet
• Die Bedeutung der Fernwärme
• Anpassung der Fernwärme an die Gebäudeerfordernisse
3
Page 4
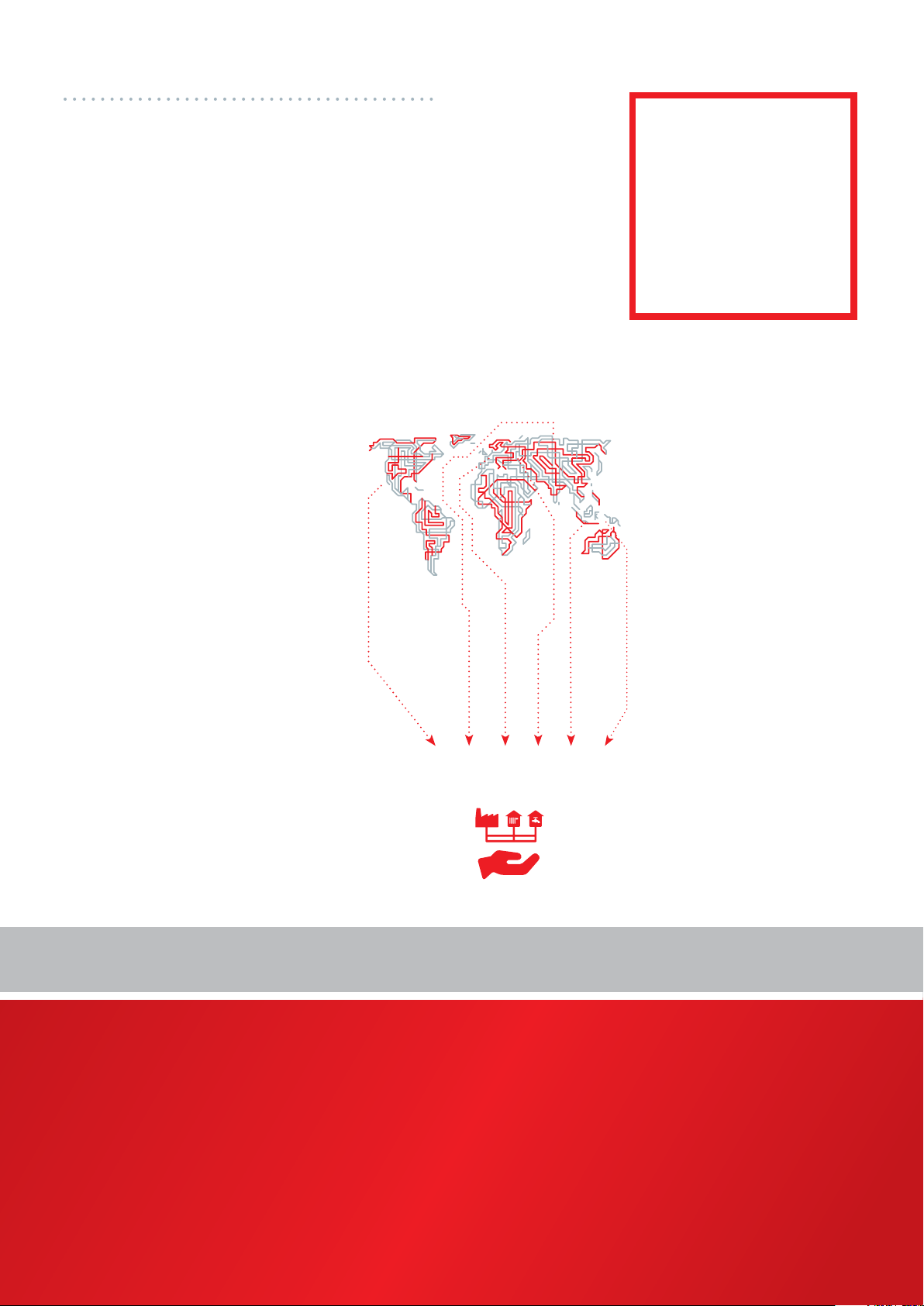
4
Fernwärme –
von innen betrachtet
Seit mehr als 35 Jahren bemüht sich
Danfoss intensiv und in enger
Zusammenarbeit mit seinen Kunden
darum, die passenden Lösungen
für Fernwärmesysteme anzubieten.
Unabhängig von der Größe des
jeweiligen Projekts oder den
dazugehörigen Spezikationen
überzeugen die Komponenten und
Übergabestationen von Danfoss in
Anwendungen rund um den Globus.
113 Mio.
Tonnen CO2 werden jährlich in
Europa dadurch eingespart, da
9 bis 10% des Wärmebedarfs
mittels Fernwärme bereit
gestellt werden. Das entspricht
dem jährlichen Gesamtausstoß
an CO2-Emissionen in Belgien.
Dies ist die Plattform, um nicht
nur Erfahrungen und Know-how
weiterzugeben, sondern auch um
Empfehlungen für leistungsoptimierte
Fernwärmeanwendungen und
Schlüsselkomponenten zu geben.
AnwendungsKnow-how
Empfehlungen von Danfoss
Hintergrund dieses Handbuchs
Version 1.0
Jahr 2012
1. Ausgabe
Redaktion:
Danfoss A/S – District Energy
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg
Dänemark
fernwaerme.danfoss.de
Kontakt:
District Energy – Application Centre:
Jan Eric Thorsen, Manager
Tel.-Nr.: + 45 7488 4494
E-Mail: jet@danfoss.com
Oddgeir Gudmundsson, Application
Specialist, Tel.-Nr.: + 45 7488 2527,
E-Mail: og@danfoss.com
Danfoss District Energy ist der führende
Anbieter von Produkten, Systemen und
Dienstleistungen im Bereich der
wärme/Fernkältesysteme und verfügt
über jahrzehntelange Erfahrung in
dieser Branche.
Das versetzt Danfoss in die Lage, seine
Kunden in aller Welt mit dem nötigen
Fachwissen und Know-how zu unterstützen, um energieeziente Lösungen zu entwickeln.
Fern-
Page 5

Einleitung 5
Grüne
Fernwärme
Fernwärme- und Fernkältenetze sind ideale Lösungen für grüne Städte
oder Stadtbezirke. In dicht besiedelten urbanen Regionen, in denen der
Wärmebedarf zwangsläug am größten ist, erweisen sie sich als ideales Mittel,
um die vor Ort verfügbaren erneuerbaren Energien und überschüssige Abwärme
sinnvoll zu nutzen. Mit derartigen Systemen lassen sich erwiesenermaßen
beträchtliche Einsparungen beim Primärenergieverbrauch erzielen und die
CO2-Emissionen reduzieren – und darüber hinaus können die Bürgerinnen und
Bürger ein Maß an Komfort und Zuverlässigkeit genießen, das dem erwarteten
Standard vollauf entspricht.
Netzbedingungen und Systemauslegung
Fernwärmenetze in Städten und urbanen Regionen dieser Welt unterscheiden
sich hinsichtlich Größe, Aufbau und Rahmenbedingungen. Temperaturen,
Betriebsdrücke als auch die technischen Anforderungen
berücksichtigt werden, um eine verlässliche
Nutzerkomfort zu gewährleisten.
und sichere Versorgung als auch
der Gebäude müssen
Trends in der Fernwärme
Heutzutage wird der Wärme- und Fernwärmesektor von mehreren
Trends beeinusst.
Endverbraucher in puncto
Diese Trends werden durch die höheren Erwartungen der
Komfort, Versorgungssicherheit, Produktentwicklung
und Alltagstauglichkeit sowie durch die vom Gesetzgeber vorgeschriebene
Energieezienz diktiert. All
Fernwärmeanwendung
dies hat dazu geführt, dass die jeweilige
Folgendes bieten muss:
• Reduziertes Temperatur- und Druckniveau in FW-Netzen
• Energieezienter Betrieb mit besserer Regelerausführung
• Überwachung der Energieleistung und Abrechnung nach individuellem Verbrauch
• Sichere Wärmeversorgung
Fernwärme von der ersten bis zur vierten Generation
1G: Dampf
Dampfsysteme, Heizungsrohre
in Betonkanälen
Temperaturniveau
< 200 oC
Energieezienz / Temperatur Level
Energieeffizienz
Fernwärmenetz
Dampf-
speicher
Kohle-
abfall
Lokale Fernwärme Fernwärme Fernwärme Fernwärme
1G / 1880-1930 2G / 1930-1980 3G / 1980-2020 4G / 2020-2050
Wärmespeicher
BHKW Kohle
BHKW Öl
Kohle-
abfall
2G: vor Ort 3G: Vorgefertigt 4G: Vierte Generation
Hochdruck Heißwassersystem
Schwere Armaturen
Große, vor Ort gebaute Stationen
> 100 oC
Großflächige
Solaranlagen
Biomasse
BHKW Biomasse
Industrielle Abwärme
Wärme-
speicher
BHKW Müll
BHKW Kohle
BHKW Öl
Gas, Abfall,
Öl, Kohle
Vorisolierte Rohre, industriell
gefertigte Kompaktübergabestationen
(mit Wärmedämmung)
Messen und Überwachen
< 100 oC
Saisonale
Wärmespeicher
Großflächige
Solaranlagen
Geothermie
Fotovoltaik,
Wellenenergie
Wind,
(überschüssige Elektrizität)
Wärme-
speicher
Industrielle
Abwärme
BHKW
Müllver-
brennung
Entwicklung (Fernwärmegeneration/
die jeweils besten verfügbaren Technologien der Periode)
Geringer Energiebedarf
Intelligentes Netz
(Interaktion der
Energiequellen, Verteilung
und Verbrauch erfolgt
optimiert)
2-Wege Fernwärme
<50-60oC (70oC)
Zukünftige
Energiequellen
Biomasse
Konversion
2-Wege
Fernwärme
BHKW
Biomasse
Zentrale
Fernkälteanlage
Zentrale
Wärmepumpe
Auch
Niedrigenergiehäuser
Fernkältenetz
Kältespeicher
Page 6
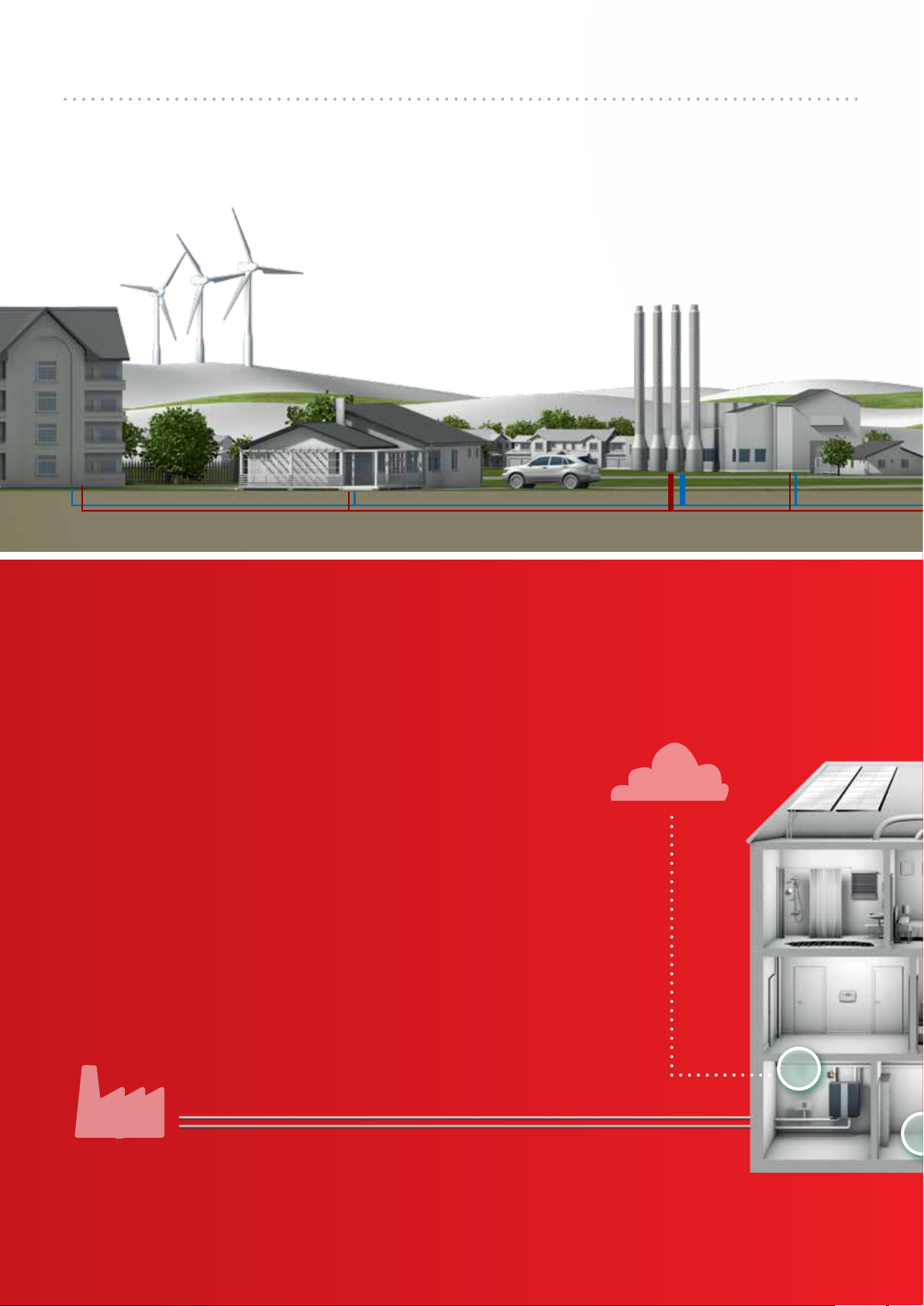
Fernwärme6
Anpassung der
Fernwärme ...
Systeminfrastruktur und
verfügbare Wärmequellen
Wo Fernwärme als Wärmequelle verfügbar ist, erweist sie sich als die beste Wahl.
Fernwärme schont nicht nur den Geldbeutel, sondern ist auch für die Gesellschaft
als Ganzes von Vorteil. Wo keine Fernwärme verfügbar ist, sollten Sie die
vorhandenen Alternativen bestmöglich nutzen und vor allem auf erneuerbare
Energien zurückgreifen. Die beste Lösung erhalten Sie stets, wenn es Ihnen gelingt,
die Infrastruktur und Auslegung des Systems mit den verfügbaren Energiequellen,
dem jeweiligen Gebäudetyp und den Bedürfnissen Ihrer Kunden in Einklang zu
bringen.
1
2
Page 7
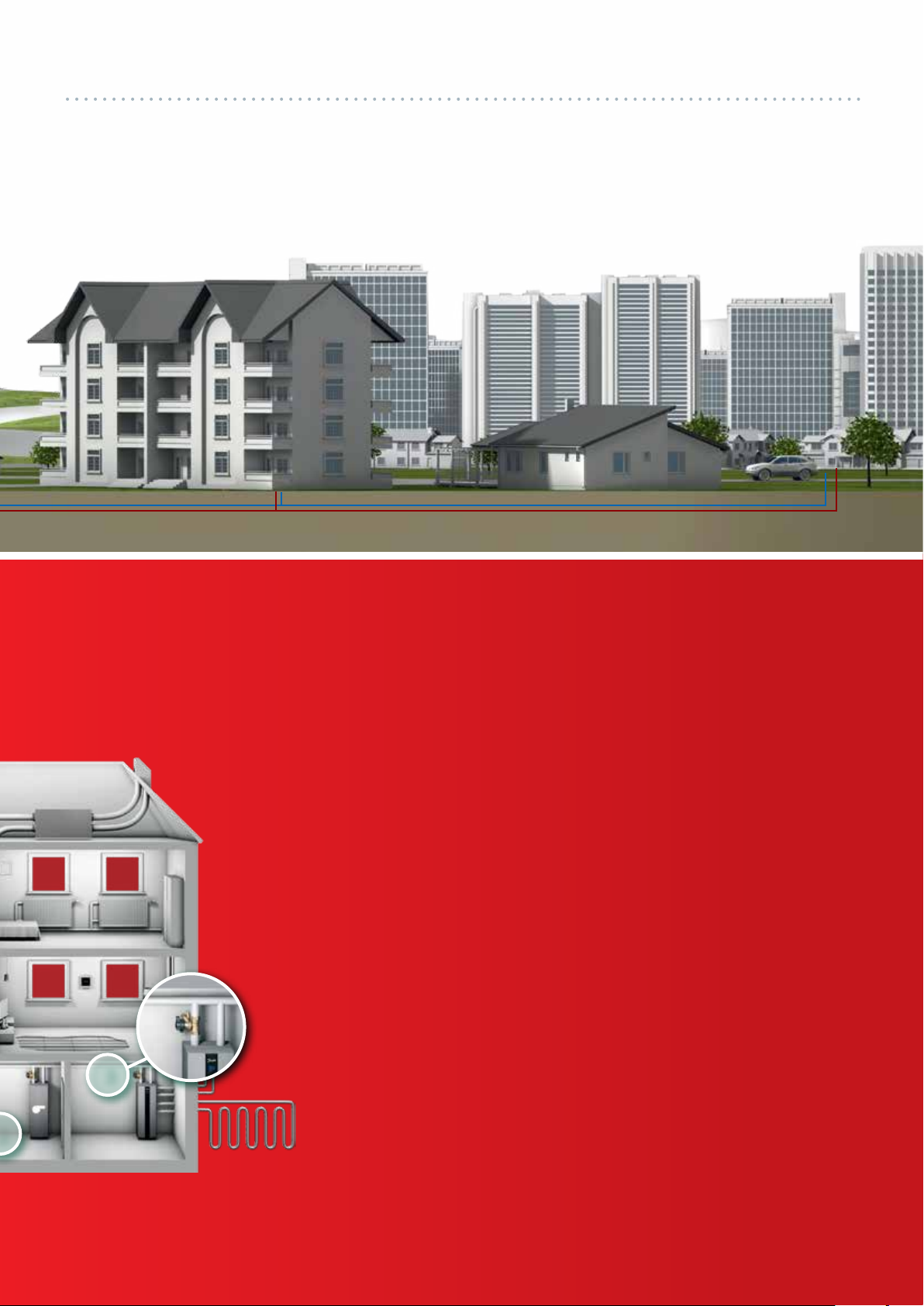
Fernwärme 7
3
... an die Erfordernisse
des Gebäudes
Beispiele für Regelungen,
die Heizsysteme optimieren
1. Anpassung an die Außentemperaturen
Wenn die Vorlauftemperatur im Heizsystem auf die Außentemperatur reagiert,
protiert der Endverbraucher sowohl von einem höheren Komfort als auch
von geringeren Heizkosten. In Einfamilienhäusern betragen die Energieeinsparungen durch Witterungsführung durchschnittlich 10%, können sich aber
durchaus auf bis zu 40% belaufen.
2. Nutzung verfügbarer Energiequellen
Geeignete Regelmechanismen gewährleisten eine optimale Wärmeleistung und
passen die Wärmeversorgung an den tatsächlichen Wärmebedarf des Gebäudes
an – ganz gleich, ob in einem Gebäude eine oder mehrere Wärmequellen genutzt
werden. Auf diese Weise wird für hohen Komfort und niedrigen Energieverbrauch
gesorgt.
3. Hydraulischer Abgleich = Einsparungen und Komfort
Ein Heizsystem, welches hydraulisch korrekt abgeglichen wurde, versorgt
sämtliche Räume mit der passenden Heizleistung – und zwar ungeachtet der
Lastbedingungen. Energie wird dadurch gespart, dass die Temperaturen an den
Heizbedarf in jedem Teil des Heizsystems angepasst werden.
Page 8

Hinweise zum Gebrauch dieses Handbuchs8
Ein umfassender
Überblick
Beim Anschluss eines Gebäudes an ein Fernwärmenetz sind verschiedene
Optionen für die Heizung und die Trinkwassererwärmung verfügbar.
Das Ziel dieses Handbuchs ist es, einen umfassenden Überblick über
die verschiedenen Applikationen zu geben, wobei die von Danfoss
empfohlenen Applikationen einen besonderen Schwerpunkt bilden.
Sämtliche Applikationen sind bildlich dargestellt und die Beschreibungen
schließen auch das jeweilige Funktionsprinzip sowie die verfügbaren Optionen ein.
Zu den empfohlenen Applikationen sind auch die wesentlichen Vorzüge
und Einschränkungen sowie Vergleiche unterschiedlicher Applikationen und
belegter Vorteile enthalten.
Alle Applikationen werden wie folgt kategorisiert:
Von Danfoss empfohlene Applikation
Primäre Alternative zu der von Danfoss empfohlenen Applikation
Sekundäre Alternative zu der von Danfoss empfohlenen Applikation
Sinn und Zweck von
Applikationensvergleichen
Um die Vorzüge und Einschränkungen
der diversen Applikationen
verständlicher zu machen,
sind qualitative und quantitative
Parameter enthalten.
Dabei wird nicht speziell auf Danfoss
Produkte oder ausführlich auf die
theoretischen Grundlagen der
Bauteile und Applikationen
eingegangen.
Produktspezische Informationen
entnehmen Sie den Datenblättern zu den
jeweiligen Produktgruppen. Weiterführende
nden Sie in allgemeinen technischen
Unterlagen, sowie wissenschaftlichen
Veröentlichungen.
theoretische Grundlagen
Page 9
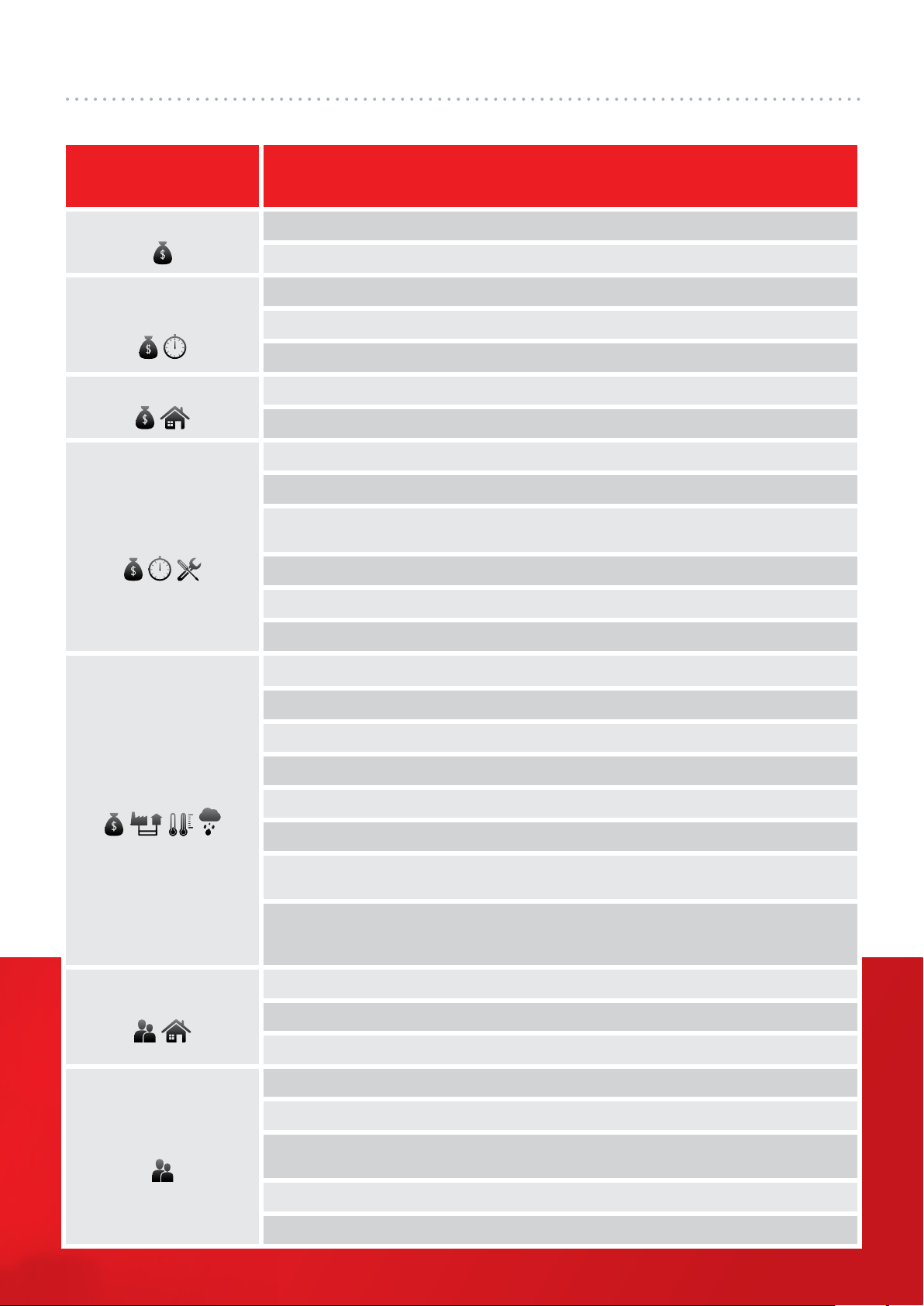
Vergleich von Applikationen 9
Vergleichsparameter Beschreibung
Einsparung von Investitionskosten
Einsparungen bei der
Installationszeit
Einsparungen beim Platzbedarf
Einsparungen bei Service-/
Wartungsarbeiten
Kosten für den Kauf des Heizsystems und der erforderlichen Bauteile.
Kürzere Entwicklungs- und Planungszeit für Planer/Entwickler
Die für die Installation und Inbetriebnahme des Heizsystems erforderliche Zeit
Gewicht der Installation
Komplexität des Systems
Möglichkeit, weniger Platz im Gebäude zu beanspruchen, der dann anderweitig genutzt werden kann
Kompaktere Installation des Heizsystems
Konformität mit der Trinkwasserverordnung (3-Liter-Regel)
Durch den geringen Inhalt des TWW-Systems wird die Legionellenvermehrung eingeschränkt.
Bei Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip wird die Vermehrung von Legionellen im
Vergleich zur TWW-Zirkulation eingeschränkt.
Einfaches und robustes System
Weniger und kürzere Servicearbeiten schlagen sich in geringeren Service-/Wartungskosten nieder.
Geringeres Temperatur-/Druckniveau und weniger Wärmeverluste im Fernwärmenetz und im Heizsystem
Effektivität der Wärmeübertragung des Heizsystems (Wärmeübertragers)
Energieeffizienz
Sicherer Systembetrieb
Verbraucherkomfort
Niedrigere Rücklauftemperatur von der Fernwärmestation zurück ins Netz
Witterungsgeführtes Heizsystem
Hocheffizientes Heizsystem
Energiesparpotenzial
Optimale Anpassung der Temperatur des Sekundärkreises an die Wärmelast des Gebäudes
Geringere hydraulische Last für eine Gruppe von Verbrauchern dank Wärmeübertragerlösung
(weniger Wärmeverluste und Pumpenenergie)
TWW-Qualität: Vermeidung von Bakterienvermehrung – dank Trinkwassererwärmung
im Durchflussprinzip entfällt die Speicherung von Trinkwarmwasser; Konformität mit der
Trinkwasserverordnung (3-Liter-Regel)
Risiko von Leckage und Kontaminierung der FW-Wasserversorgung
Risiko einer Gefährdung durch hohe Temperaturen (z.B. heiße Heizkörper)
Unbegrenzte Entnahme von TWW
Optimales Raumtemperaturniveau
Wohnklima
Länge des Wartungsintervalls (bei langen Wartungsintervallen gibt es nur sehr wenige
Versorgungsunterbrechungen in großen Abständen)
Geräuschpegel des Systems
Wartezeit, bis Trinkwarmwasser gezapft werden kann
Page 10
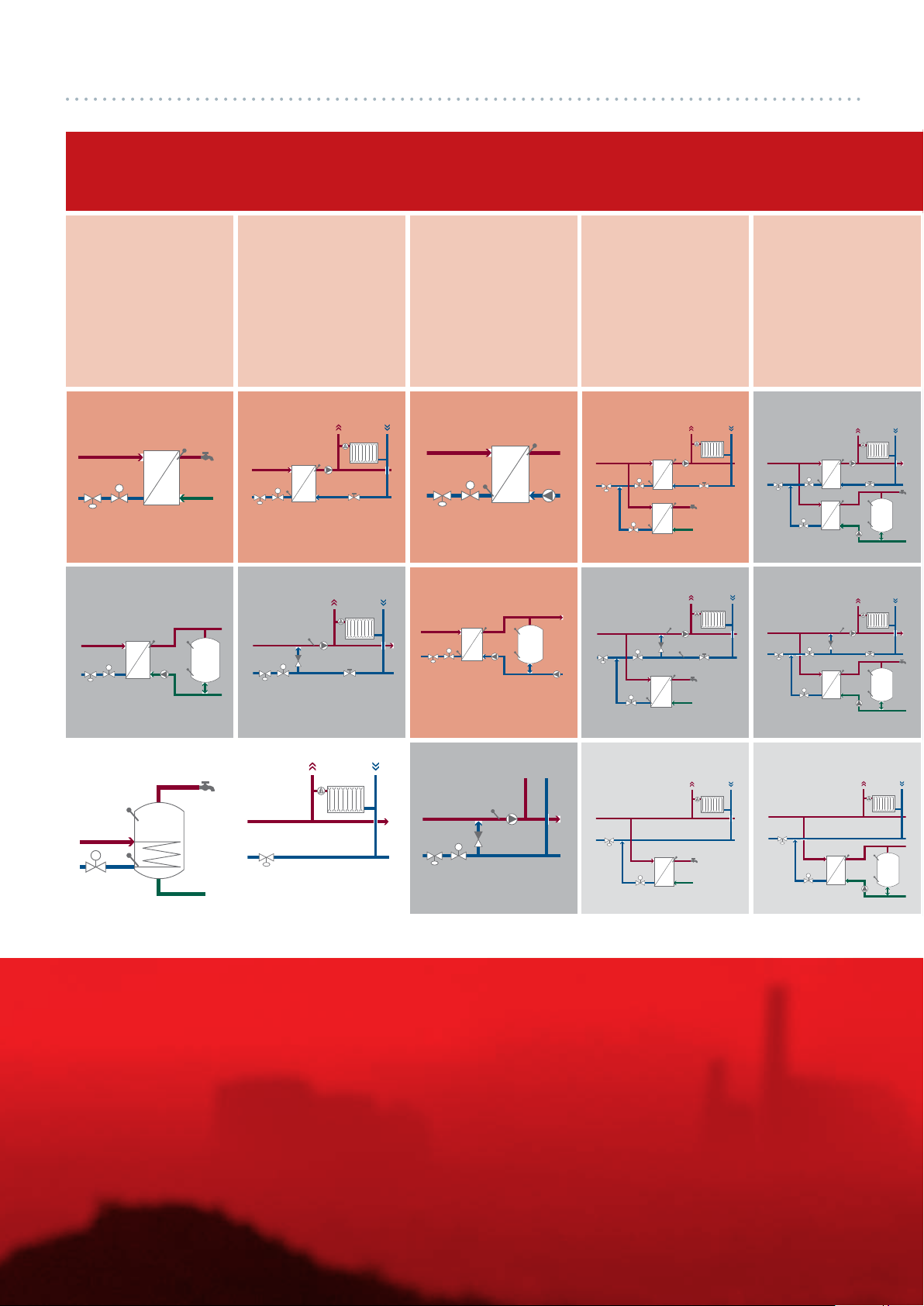
FW-Applikationstypen 10
Überblick über die Applikationstypen
Trinkwarmwasser-
anwendungen
0.1
1
*
0.2
1
*
1
2
Indirekt und direkt
angeschlossene
Raumheizungs-
anwendungen
1.0
1
*
2.0
1
*
3
Versorgungssysteme
für
Wohnungsstationen
1.F
1
*
2.F
1
*
4
Direkt und indirekt angeschlossene Raumheizung
sowie Trinkwasser-
erwärmung im
Durchussprinzip
1.1
2.1
5
Direkt und indirekt angeschlossene Raumheizung
sowie Trinkwasser-
erwärmung mittels
Speicherladesystem
1.2
2.2
0.3
Beim Anschluss eines Gebäudes an ein Fernwärmenetz sind zahlreiche Optionen
zum Heizen des Gebäudes und für die Trinkwassererwärmung verfügbar.
In diesem Handbuch werden die unterschiedlichen Applikationen gemäß
ihren Hauptkomponenten sowie nach der jeweiligen Heizungs- und TWWBereitungs-Applikation nummeriert. Hinter der Applikation 1.1 verbirgt
sich bspw. eine direkt angeschlossene Heizung mit Trinkwassererwärmung
im Durchussprinzip. Hierbei handelt es sich um eine Kombination aus
Applikation 1.0 (Direkt angeschlossene Heizung) und Applikation 0.1
(Trinkwassererwärmung im Durchussprinzip).
3.0
3.F
1
*
3.1
3.2
Page 11

FW-Applikationstypen 11
6
Direkt und indirekt angeschlossene Raumheizung
sowie Trinkwasser-
erwärmung mittels
SWE (Registerspeicher)
1.3
2.3
1.1.1
1.1.2
7
Zweistuge
Applikationen
8
Indirekt angeschlossene
Raumheizung
und sekundärseitig
angeschlossene
Trinkwassererwärmung m.
Speicherladesystem
S.1.2
1
*
9
Indirekt angeschlossene
Raumheizung und sekun-
därseitig angeschlossene
Trinkwassererwärmung
mittels SWE
(Registerspeicher)
S.1.3
1
*
3.3
1
Anwendungsabhängig auch als Kombiventil möglich
*
Von Danfoss empfohlene Applikation
Primäre Alternative zu der von Danfoss empfohlenen Applikation
Sekundäre Alternative zu der von Danfoss empfohlenen Applikation
Von Danfoss nicht empfohlen
Applikation 0.1 + Applikation 1.0 = Applikation 1.1
+ =
1
*
1
*
Page 12
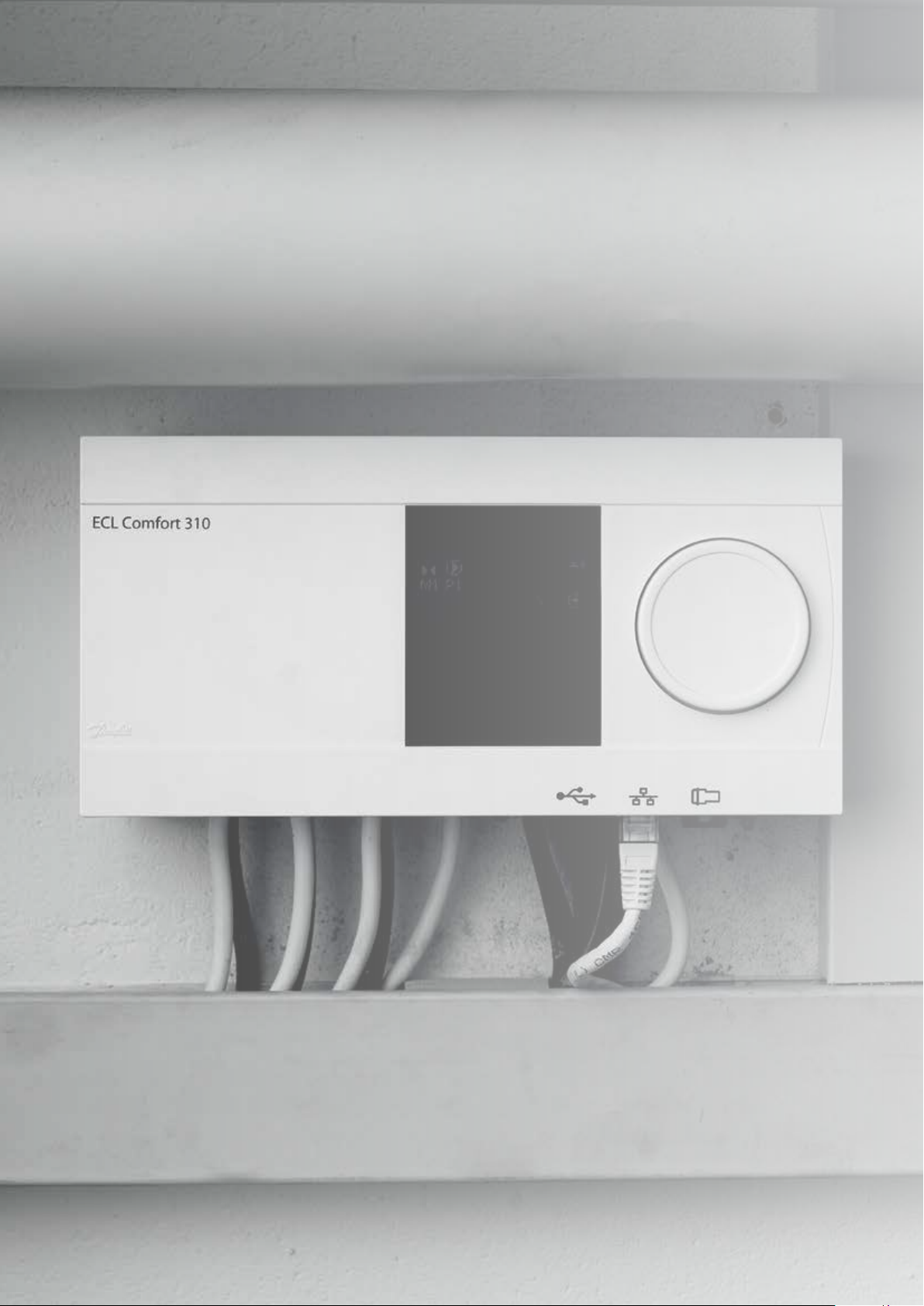
Page 13

Seite 13 – 21 13
Allgemeines Prinzip
Der eziente Betrieb von Fernwärme-Übergabestationen ist unmittelbar
der Bauart des Sekundärheizsystems, des Wärmeübertragers und der
Regelgeräte auf der Primärseite des Fernwärmenetzes abhängig. Tagesund jahreszeitlich bedingte Verbrauchsschwankungen lassen auch den
Dierenzdruck merklich schwanken– und zwar infolge des variierenden
Durchusses im Primärvorlauf. Dieses Phänomen wirkt sich auf den
Vorlauf der
Anforderungen
Abgleich von Übergabestation und Heizsystem zu gewährleisten.
Der erforderliche Volumenstrom im Vorlauf einer Übergabestation
wird vom Wärmebedarf der angeschlossenen Gebäude bestimmt. Der
Wärmebedarf wird in der Regel anhand von drei Parametern ermittelt:
Raumheizungsver brauch sowie Lüftungs- und TWW-Bedarf.
Übergabestation im Gebäude aus. Deshalb müssen bestimmte
erfüllt werden, um die Regelung und den hydraulischen
von
• Hydraulischer Abgleich
• Reglertypen
• Regelfunktionen
• Leerlauunktionen (nur für TWW)
• Witterungsführung
Page 14
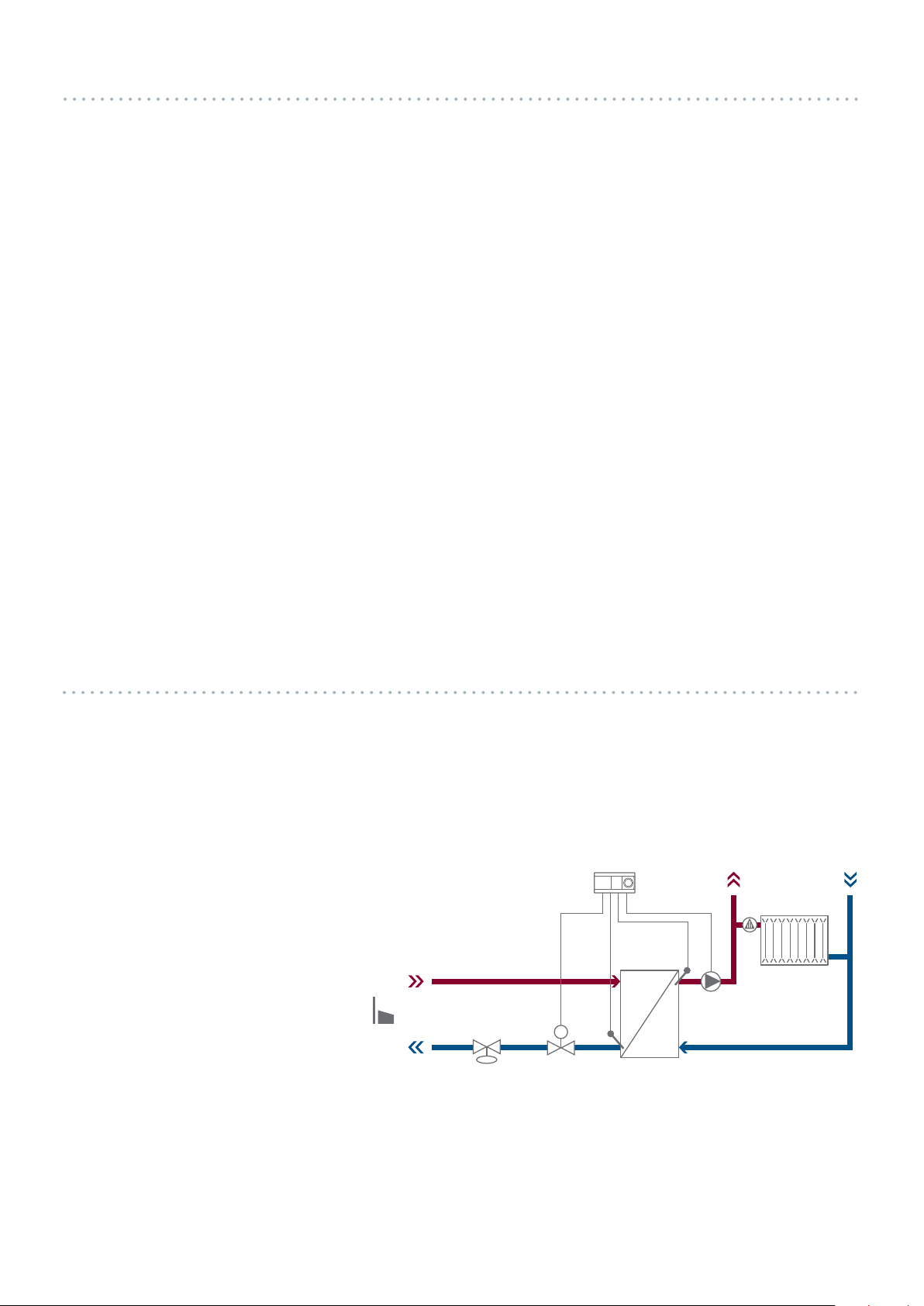
Reglertypen
Flow controller
Volumenstromregler,
Dierenzdruckregler und
Volumenstrombegrenzer
Hydraulischer Abgleich14
Mit der Verwendung von Dierenzdruckreglern, Volumenstromreglern
und Volumenstrombegrenzern wird
das Ziel verfolgt, einen idealen
hydraulischen Abgleich im Fernwärmenetz zu gewährleisten. Ein idealer
hydraulischer Abgleich im Fernwärmenetz bedeutet, dass bei jedem Verbraucher
genau der laut Spezikation
erforderliche FW-Volumenstrom
ankommt. Bei Verwendung eines
Dierenzdruckreglers verbessern sich
die Betriebsbedingungen für das
Regelventil ganz beträchtlich.
Volumenstromregler
Volumenstromregelung in einem
indirekt
Heizsystem.
angeschlossenen FW-
Vorteile:
• Genau denierte Spezikation für
die Ventilauslegung
• Einfache Einstellung der
Übergabestation
• Stabilisierung der
Temperaturregelung
• Geringerer Geräuschpegel
im System
• Längere Lebensdauer der
Regelgeräte
• Ideale Verteilung des Wassers
im Versorgungsnetz
• Begrenzung der Wassermenge
im Netz
Der Volumenstromregler stellt sicher,
dass
der voreingestellte maximale
Volumenstrom
überschritten wird. Die Volumenstromregelung wird in Systemen
verwendet, in denen der Dierenzdruck nur geringfügig variiert und in
denen der maximale FW-Volumenstrom – unabhängig vom Dierenzdruck im System – nicht überschritten
werden darf. In der Regel wird dieser
Regler
in Systemen verwendet, bei
denen der maximale Volumenstrom zur
Heizkostenberechnung herangezogen
wird, sowie in Systemen, wo die max.
Volumenstrombegrenzung unter der
max. Kapazität des Systems liegt -
z.B. wo TWW priorisiert wird.
im FW-Vorlauf nicht
1
*
1
*
Anwendungsabhängig auch als Kombiventil möglich
Page 15
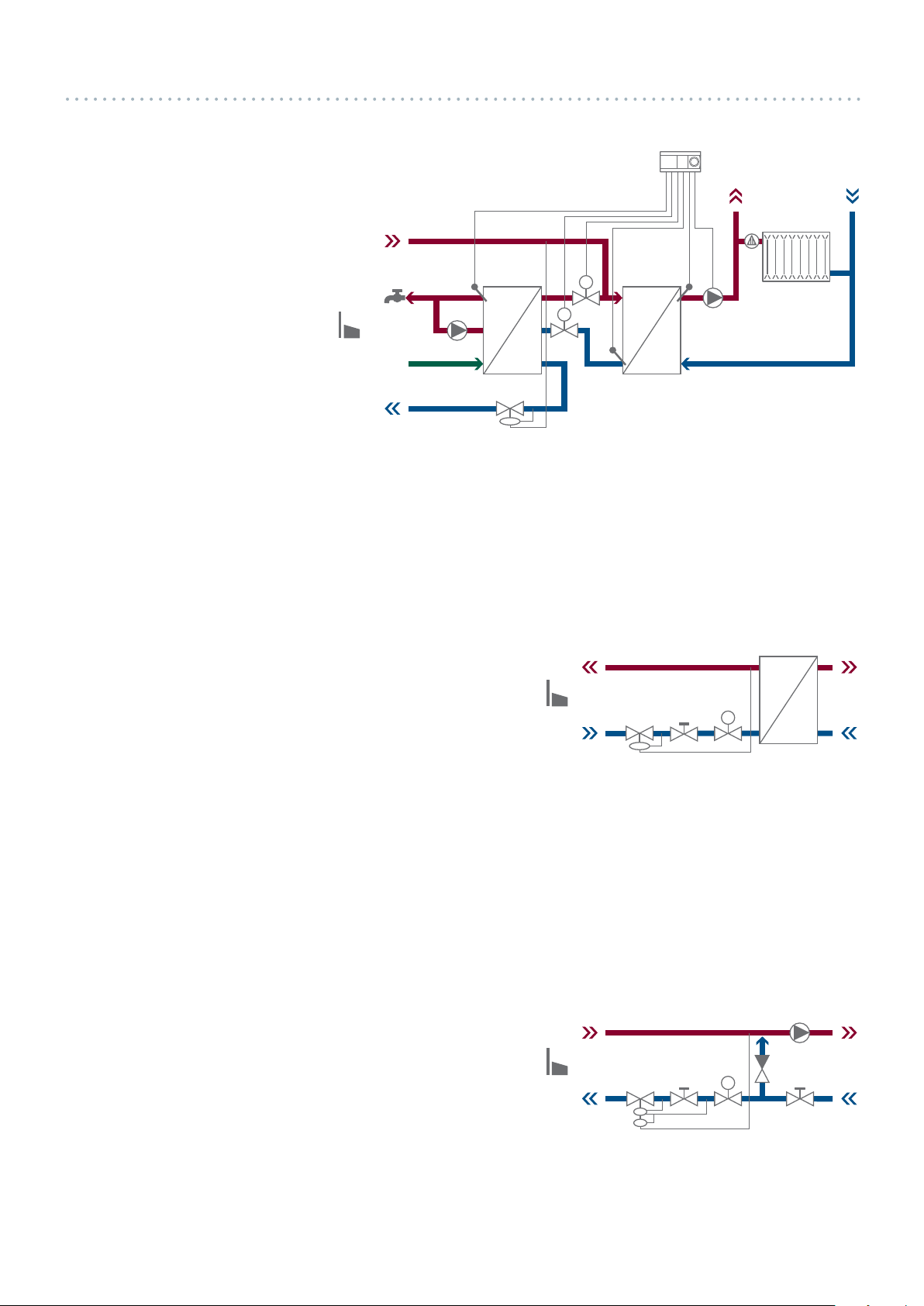
Reglertypen 15
Dierential pressure ctrl
Dierenzdruckregler
Dierenzdruckregelung in einem
Fernwärmenetz mit Heizung und
TWW-Bereitung.
Der Dierenzdruckregler hält einen
konstanten Dierenzdruck im
gesamten System. Das sorgt nicht nur
für eine bessere Ventilautorität
sondern auch für einen besseren
hydraulischen Abgleich im
Fernwärmenetz. Bei variablem
Dierenzdruck kommt ein
Dierenzdruckregler zum Einsatz.
Kombinierter Volumenstrombegrenzer und Dierenzdruckregler
Kombinierte Volumenstrombegrenzung und Dierenzdruckregelung
in einem Fernwärmenetz.
Diese funktioniert im Prinzip wie ein Dierenzdruckregler mit
integrierter Einstelldrossel. Sie regelt den Dierenzdruck über
eine Reihe von Widerständen (Ventilen, Wärmeübertragern usw.),
zu denen auch die Einstelldrossel zählt. Ein Volumenstrombegrenzer sollte in Applikationen mit indirekt angeschlossener Hausanlage
installiert werden, bei denen der maximale Volumenstrom
die Grundlage für die Heizkostenberechnung bildet.
Kombinierter Volumenstrom-
und Dierenzdruckregler
Kombinierte Volumenstrom- und Dierenzdruckregelung in
einer direkt angeschlossenen Hausanlage.
1
*
Der Dierenzdruckregler sorgt für einen konstanten Dierenzdruck
über dem System mit der unteren Membran. Die obere Membran
dient der Volumenstromregelung. Unabhängig vom
Dierenzdruck über dem System hält sie einen konstanten
Druck über der Einstelldrossel. So lässt sich ein maximaler
Volumenstrom einstellen. Der kombinierte Volumenstromund Dierenzdruckregler wird für direkt angeschlossene
Systeme empfohlen, in denen der FW-Volumenstrom zur
Heizkostenumlegung herangezogen wird und in denen
ein variabler Dierenzdruck herrscht.
Page 16
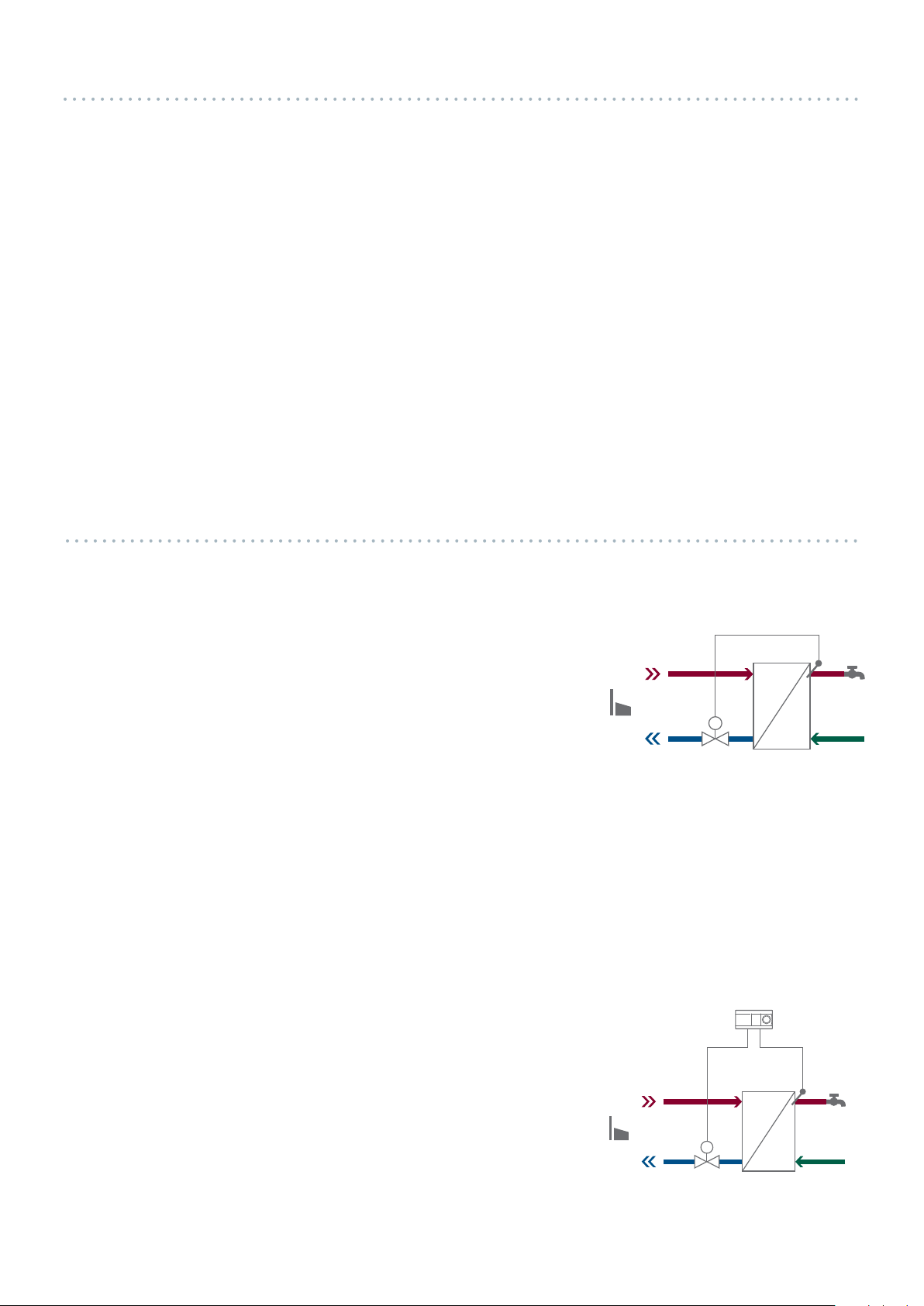
16
Hydraulischer Abgleich
Regelfunktionen
Selbsttätige und elektronische
Temperaturregelung
Zur Regelung der Vorlauftemperatur auf
der Sekundärseite sind verschiedene
Optionen verfügbar. Die Auswahl der
passenden Regelung hängt vor
allem von den Parametern des
Fernwärmenetzes ab. Zur optimalen
Vorlaufregelung der Temperatur auf
der Sekundärseite wird ein umso
komplexerer Regler benötigt,
je mehr die Parameter variieren.
In kleineren Systemen werden
üblicherweise selbsttätige Regler
verwendet. Elektronische Regler
Thermostatische Temperaturregelung
(Heizung + TWW)
Ein thermostatischer Temperaturregler wird in FW-Systemen verwendet, die
mäßigen Schwankungen der Vorlauftemperatur und des Dierenzdrucks im
System unterliegen und in denen ein Komfortregler für den Standby-Betrieb
gewünscht wird. Von einer geringfügigen Temperaturabweichung der Heizund TWW-Temperatur ist auszugehen.
kommen dagegen in größeren
Systemen zum Einsatz bzw. wenn eine
Witterungsführung erforderlich ist.
Funktionsprinzip
Der Zweck eines Temperaturreglers besteht darin, für eine konstante
Temperatur in der HE/TWW-Applikation zu sorgen.
Wenn der Regler eine Temperaturänderung feststellt, önet oder schließt er
das Regelventil, abhängig davon, ob die Abweichung (Vergleich von SollTemperatur und Ist-Temperatur) positiv oder negativ ist.
Elektronischer Regler (Heizung + TWW)
Ein elektronischer Regler mit witterungsgeführter Vorlauf-Temperaturregelung
stellt eine weitere Option dar. Die Lösungen reichen von einer schlichten
Benutzeroberäche bis hin zu komplexeren Ausführungen mit einer Vielzahl
an wählbaren Funktionen und Optionen. Zu Letzteren zählen standardisierte
Datenübertragungsmodule sowie automatische Regelparameter zur Einstellung
der TWW-/HE-Temperaturregelung. Die elektronischen Regler lassen sich an
eine Vielzahl unterschiedlicher HE-/TWW-Applikationen anpassen.
Ein elektronischer Regler ermittelt die gewünschte Vorlauftemperatur und
verändert den Volumenstrom durch das System (z.B. durch den Wärmeübertrager), indem er ein Motorregelventil schrittweise önet oder schließt.
Page 17
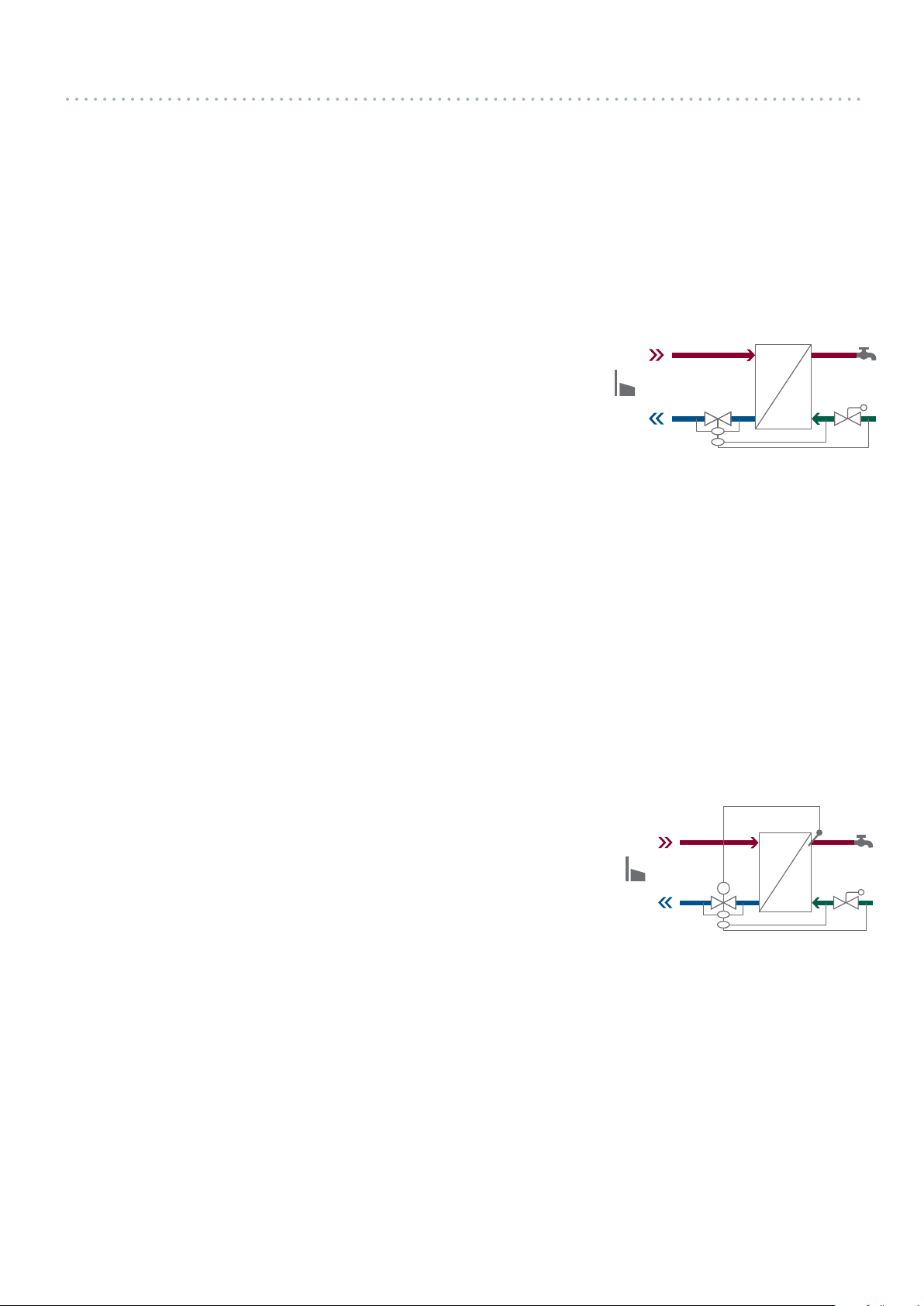
Regelfunktionen 17
Kombinierte proportionale Volumenstromund Dierenzdruckregelung (TWW)
Ein proportionaler Volumenstrom- und Dierenzdruckregler wird in FW-Systemen
mit geringen Schwankungen der Vorlauftemperatur sowie mit variierendem
oder hohem System-Dierenzdruck verwendet. Wenn kein Dierenzdruckregler
installiert ist, schlagen sich die Schwankungen des Dierenzdrucks in großen
Schwankungen der TWW-Temperatur nieder.
Funktionsprinzip
Das Funktionsprinzip des proportionalen Volumenstrom- und
Dierenzdruckreglers besteht darin, ein proportionales Verhältnis zwischen
Sekundär- und Primärkonstante TWW-Temperatur
Dierenzdruck konstant sind.
Wenn der Regler einen Durchuss auf der Sekundärseite feststellt, önet er
das Primärventil proportional zum Sekundär-Volumenstrom. Der integrierte
Dierenzdruckregler sorgt für einen konstanten Dierenzdruck über dem
integrierten Regelventil, wodurch eine präzise Durchussregelung erzielt wird.
Volumenstrom herzustellen. Auf diese Weise wird eine
erzielt, wenn die Primär-Vorlauftemperatur und der
Kombinierte proportionale Volumenstrom-,
Temperatur- /Dierenzdruckregelung (TWW)
Ein proportionaler Volumenstrom-, Temperatur- und Dierenzdruckregler
FW-Systemen mit schwankender Vorlauftemperatur sowie mit hohem und
variierendem Dierenzdruck verwendet.
Funktionsprinzip
Das Funktionsprinzip des proportionalen Volumenstromreglers besteht darin,
ein proportionales Verhältnis zwischen Sekundär- und Primär-Volumenstrom
herzustellen. Auf diese Weise wird eine konstante TWW-Temperatur erzielt,
wenn die Primär-Vorlauftemperatur und der Dierenzdruck konstant sind.
Wenn der Regler einen Durchuss auf der Sekundärseite feststellt, önet er das
Primärventil proportional zum Sekundär-Volumenstrom. Der Temperaturregler
begrenzt den Primär-Volumenstrom, wenn der Durchussanteil des Proportionalreglers
im Vergleich zum gewünschten Temperatur-Sollwert zu hoch ist. Der Dierenzd ruckregler sorgt für einen konstanten Dierenzdruck über dem integrierten
Regelventil, wodurch eine präzise Durchussregelung erzielt wird.
wird in
Page 18
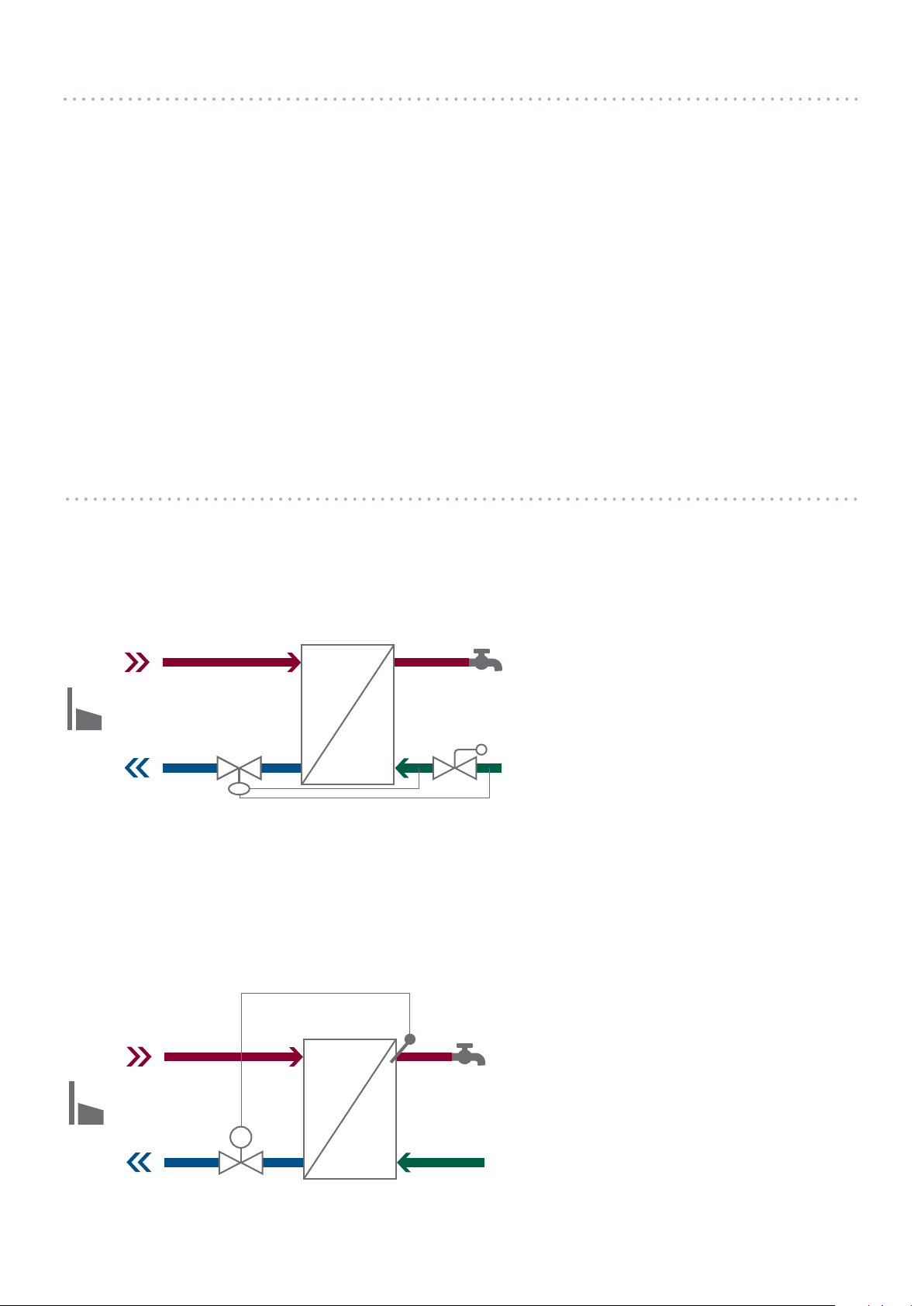
Hydraulischer Abgleich18
Leerlauunktionen
für die TWW-Temperaturregelung
Die allgemeine Komfort-Anforderung bei der TWW-Bereitung in
Einfamilienhäusern oder Wohnungen besteht z.B. darin, dass die gewünschte
Temperatur ohne Verzögerung erreicht werden sollte. Zu diesem Zweck werden
Leerlauunktionen verwendet, um die Vorlaueitungen und/oder den
Wärmeübertrager in Perioden ohne Warmwasserentnahme warm zu halten.
Das wird erreicht, indem ein geringer Volumenstrom entweder den
Wärmeübertrager umießen darf oder durch den Wärmeübertrager strömt,
wenn länger keine Warmwasserentnahme erfolgt. Je nach gewünschtem
Komfort-Niveau können verschiedene Leerlaufmethoden verwendet werden.
a) Proportionalregler
b) Temperaturregler
Während des Leerlaufs sind
Wärmeübertrager und Vorlauf kalt.
Während des Leerlaufs sind
Wärmeübertrager und Vorlauf warm.
Page 19

Leerlauunktionen
c) Leerlaufregler als Vorlauf-Bypass
19
Während des Leerlaufs ist der
Wärmeübertrager kalt und der Vorlauf
warm; die Temperatur lässt sich je
nach Bedarf anpassen.
d) Leerlaufregler als Bypass des Regelventils
Während des Leerlaufs sind
Wärmeübertrager und Vorlauf warm
und die Temperatur lässt sich je nach
Bedarf anpassen.
e) Regelventil mit reduzierter Temperatur während des Leerlaufs
Während des Leerlaufs sind
Wärmeübertrager und Vorlauf warm.
Page 20

Page 21
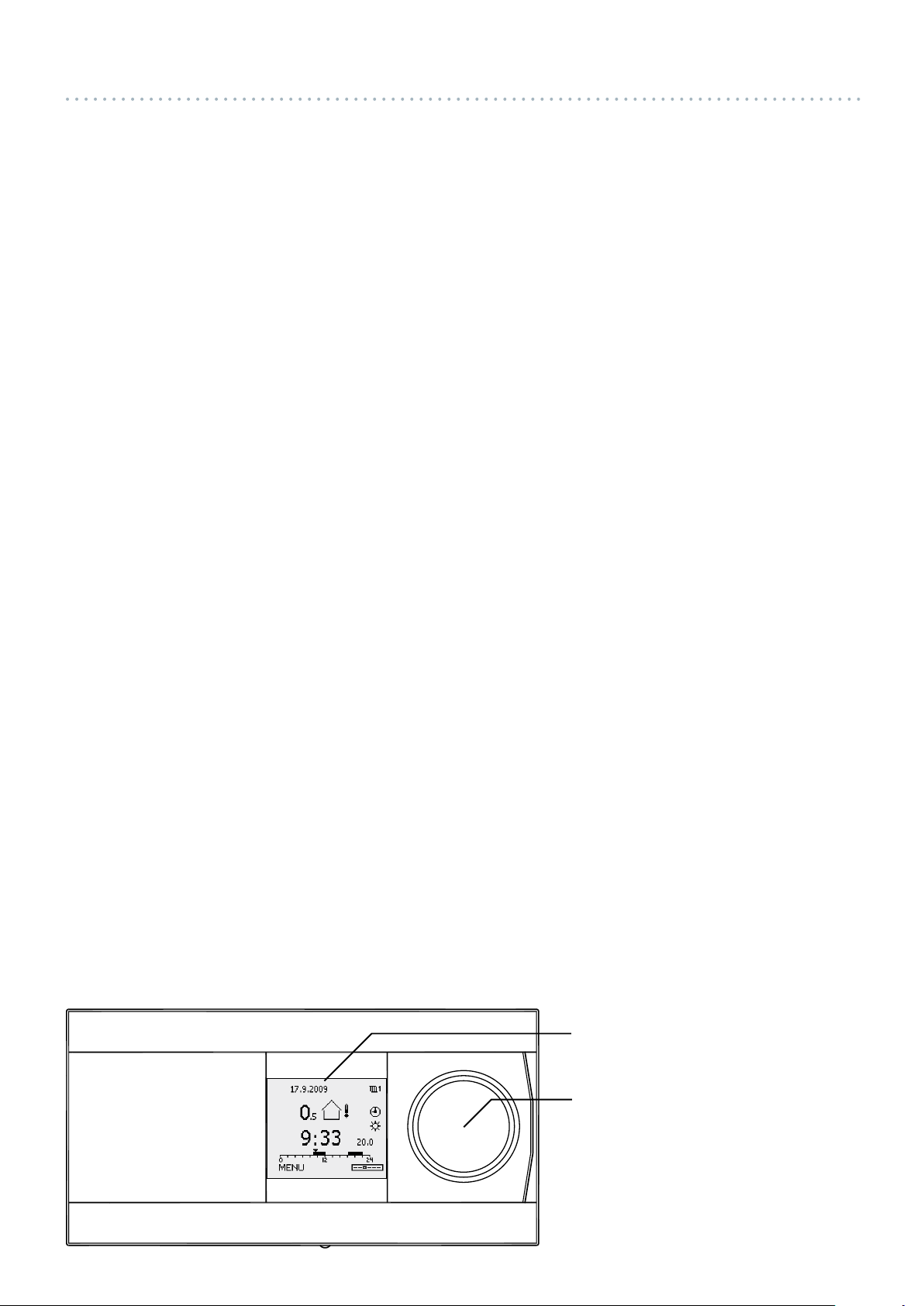
Witterungsführung 21
Witterungs-
führung
Das Wetter hat den größten Einuss auf den Wärmebedarf von
Gebäuden. In Kälteperioden muss
das Gebäude stärker beheizt werden,
bei warmen Wetter weniger.
Analog zum Wetter, das sich
ständig ändert, variiert auch die
erforderliche Wärmelast, um das
Gebäude zu heizen. Der Ausgleich
dieser Witterungseinüsse –
durch eine witterungsgeführte
Heizung– erweist sich folglich als
eine vernünftige Maßnahme, um
Energie zu sparen.
Ein Gebäude ist dann optimal
Wärme versorgt, wenn der
mit
Heizbedarf
Wärme gedeckt ist. Ein
intelligenter elektronischer
Regler zur witterungsgeführten
Vorlauf-Temperaturregelung eines
Heizsystems kann die Wärmeversorgung proaktiv anpassen, um
genau das zu erreichen - indem
er die Änderungen der draußen
herrschenden Witterungsbedingungen erkennt. Ein Heizsystem
ohne witterungsgeführten Temperaturregler orientiert sich nur an
der aktuellen Innentemperatur
und tendiert folglich dazu,
erst mit einiger Verzögerung
auf die draußen auftretenden
Veränderungen zu reagieren.
ohne überschüssige
Dieses Phänomen wirkt sich
negativ auf den Wohnkomfort und
die Energieezienz aus.
Der witterungsgeführte
raturregler empfängt ein Signal
vom Außentemperaturfühler
der Nordseite des Gebäudes.
Außentemperaturfühler misst die
Ist-Temperatur und bei Bedarf
passt der elektronische Regler die
Wärmeversorgung (Vorlauftemperatur) an, um auf die neuen
Bedingungen zu reagieren. Der
Regler passt darüber hinaus die
Wärmeversorgung der Heizkörper
an und stellt sicher, dass die
Raumtemperaturen konstant
gehalten werden. Die Hausbewohner bemerken nicht einmal,
dass sich das Wetter draußen
geändert hat, und genießen
jederzeit dasselbe Temperaturund Komfortniveau.
Laut einem Bericht von COWI (einem
führenden Beratungsunternehmen
aus Nordeuropa) betragen die
geschätzten Energieeinsparungen
bei Verwendung witterungsgeführter elektronischer Regler
in Einfamili enhäusern ca. 10%
– mitunter sogar bis zu 40%.
Diesem Bericht zufolge erzielen
Einfamilienhäuser mit hohem
Wärmeverbrauch nach der
Tempe-
auf
Der
Installation elektronischer Regler
mit Witterungsführung besonders
schnelle Renditen.
Darüber hinaus schreiben die
gesetzlichen Verord nungen
für Mehrfamilienhäuser und
Gewerbebauten witterungsgeführte Temperaturregler vor. In
immer mehr Ländern gilt dies auch
für Einfamilienhäuser.
Ein Heizsystem mit witterungsgeführtem elektronischem Regler
kann mit zusätzlichen Regelfunktionen ausgestattet werden,
wie zum Beispiel:
• Durchuss- und
Leistungsbegrenzung
• Temperaturbegrenzung
– möglich für die PrimärRücklauftemperatur und/oder
die Sekundär-Vorlauftemperatur
• Einrichtung einer
Sicherheitsfunktion
• Periodische Rückstellung des
Systems
• Möglichkeit der
Datenkommunikation – bspw.
mit einem SCADA-System bzw.
per Web-Portal
• Protokollierung der
Energieverbrauchsdaten
Witterungsgeführte Systeme werden
häug für Radiatoren- oder Fußbo
denheizungsanlagen eingesetzt.
-
Auf der graschen Anzeige (A) können
A
alle Temperaturwerte und Statusinformationen abgelesen werden.
Darüber hinaus werden dort sämtliche
Regelparameter eingestellt.
B
Die Navigation und Suche in den
Menüs sowie die Auswahl des
gewünschten Menüpunkts erfolgt
mithilfe des Einradnavigators (B).
Page 22

Page 23

Seite 23 – 25 23
Empfohlene Applikationen
Empfohlene Lösungen
für die wichtigsten Typen von Fernwärmesystemen
Page 24
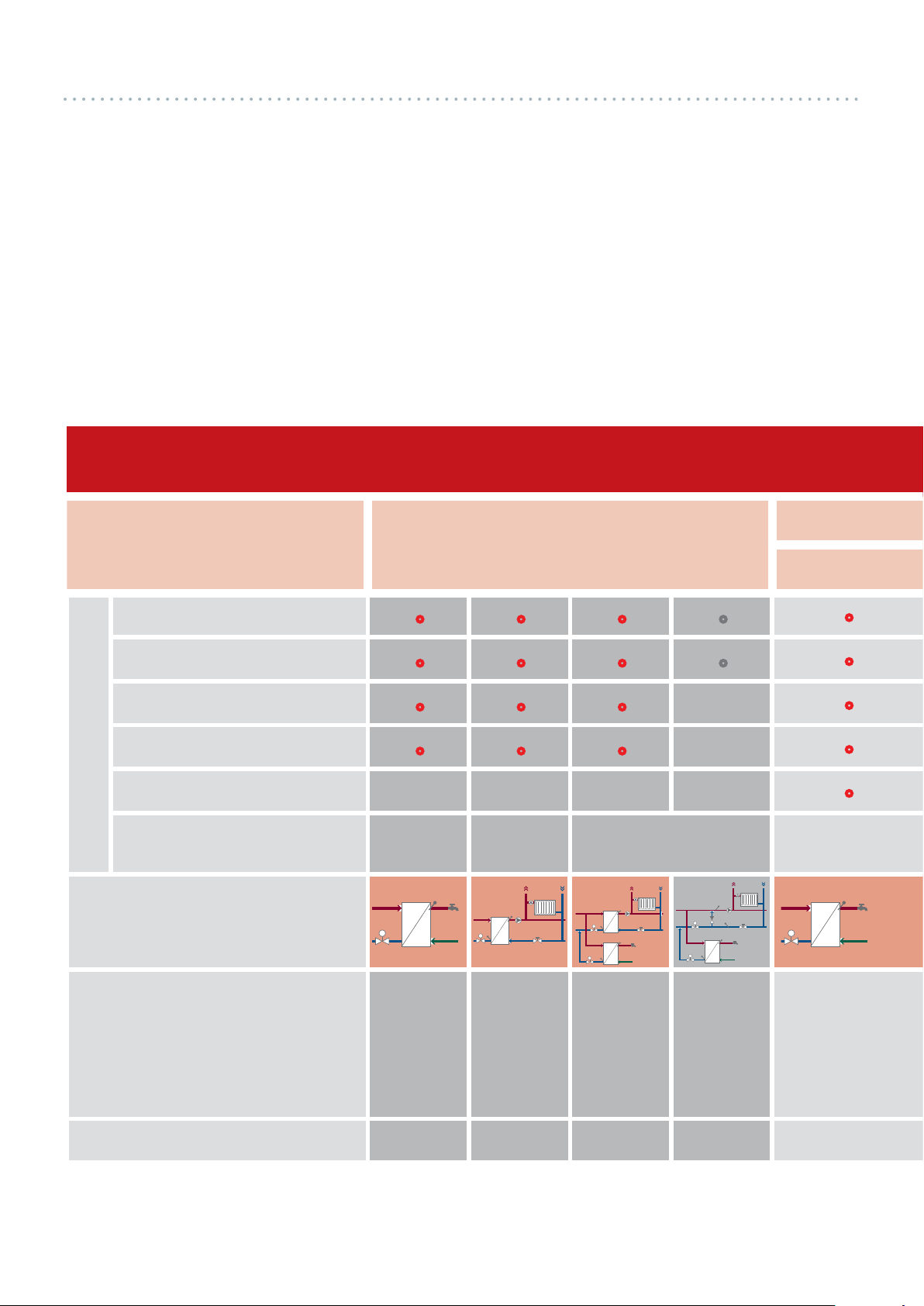
Applikations-Auswahl24
Orientierungshilfe
empfohlener Applikationen
und ihre Alternativen
Applikations-Auswahl
Niedertemperatursystem: T ≥ 60 °C
(
) = nur bei PN 10 bar
•
PN 10 bar/T ≤ 90 °C
PN 10 bar & 16 bar/T ≤ 110 °C
PN 16 bar/T ≥ 110 °C
PN 25 bar/T ≥ 110 °C
Systemeigenschaften
Applikationskategorie
Von Danfoss empfohlene Systeme
Applikationstyp
Systemindex
Einfamilienhäuser
• • • (•)
• • • •
• • •
• • •
TWW-
Applikation
TWWApplikation
(Durchflussprinzip)
0.1 1.0 1.1 2.1
HE-
Applikation
Indirekt an
geschlossene
Raumheizung
-
Kombinierte HE- & TWW-
Applikationen
Direkt und
indirekt angeschlossene
Raumheizung sowie
Trinkwassererwärmung
im Durchflussprinzip
Direkt angeschlossene
Raumheizung
mit Mischkreis
und Trinkwassererwärmung
im Durchflussprinzip
• • (•) • (•)
• • • • •
• • • •
• • • •
• • • •
TWW-
Applikation
TWWApplikation
(Durchflussprinzip)
0.1
Page 25
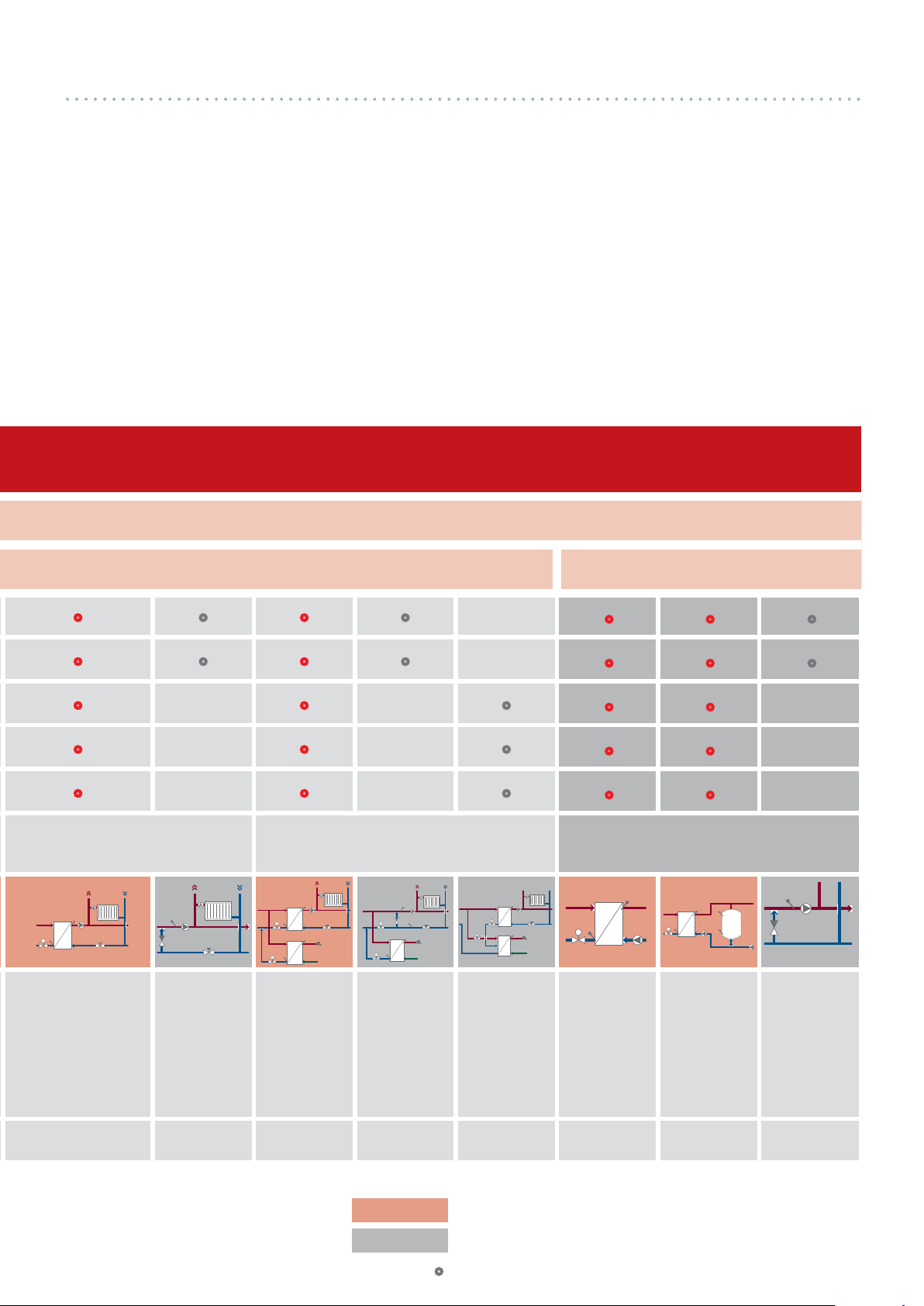
Applikations-Auswahl 25
Bei der Auswahl der Applikation müssen unbedingt die Parameter des
Fernwärmenetzes bekannt sein, an das die Applikation angeschlossen
werden soll. Anhand dieser Netzparameter lässt sich aus der ApplikationsAuswahltabelle leicht ersehen, welche Applikationen für das fragliche
Fernwärmenetz geeignet sind.
Analog zur Tabelle mit den Applikationstypen lässt sich auch in der ApplikationsAuswahltabelle an den Farbmarkierungen erkennen, welche Lösungen von
Danfoss empfohlen werden. Die Applikations-Auswahltabelle dient Ihnen als
Orientierungshilfe bei der Auswahl der besten Applikationen für die jeweiligen
Bedingungen.
Zum Beispiel: Die von Danfoss empfohlene Lösung für ein zu Heizungszwecken
und zur TWW-Bereitung an ein Fernwärmenetz mit einer Vorlauftemperatur von
90°C und mit einem Nenndruck (PN) von 16 bar angeschlossenes
Einfamilienhaus ist die Applikation 1.1.
Mehrfamilienhäuser
Applikation
Indirekt
angeschlossene
Raumheizung
Zentrale Systeme Systeme mit Wohnungsstationen
• • (•)
• • •
• •
• •
• •
HE-
Direkt angeschlossene
Raumheizung
mit Mischkreis
Kombinierte HE- & TWW-
Indirekt angeschlossene
Raumheizung
und Trinkwassererwärmung
im Durchflussprinzip
Applikationen
Direkt angeschlossene
Raumheizung
mit Mischkreis
und Trinkwassererwärmung
im Durchflussprinzip
Indirekt angeschlossene
zweistufige
Heizung und
Trinkwassererwärmung
im Durchflussprinzip
Zentralversorgung der Wohnungsstation
(für HE- & TWW-Versorgung mittels
Wohnungsstationen)
Indirekt angeschlossene
Applikation
zur Versorgung von
Wohnungsstationen
Indirekt angeschlossene
Applikation
mit Pufferspeicher zur Versorgung von
Wohnungsstationen
Direkt angeschlossene
Applikation
mit Mischkreis
zur Versorgung von
Wohnungsstationen
1.0 2.0 1.1 2.1 1.1.1 1.F 2.F 3.F
Von Danfoss empfohlene Applikation
Primäre Alternative zu der von Danfoss empfohlenen Applikation
nur für PN = 10 bar
(•)
Page 26

Page 27
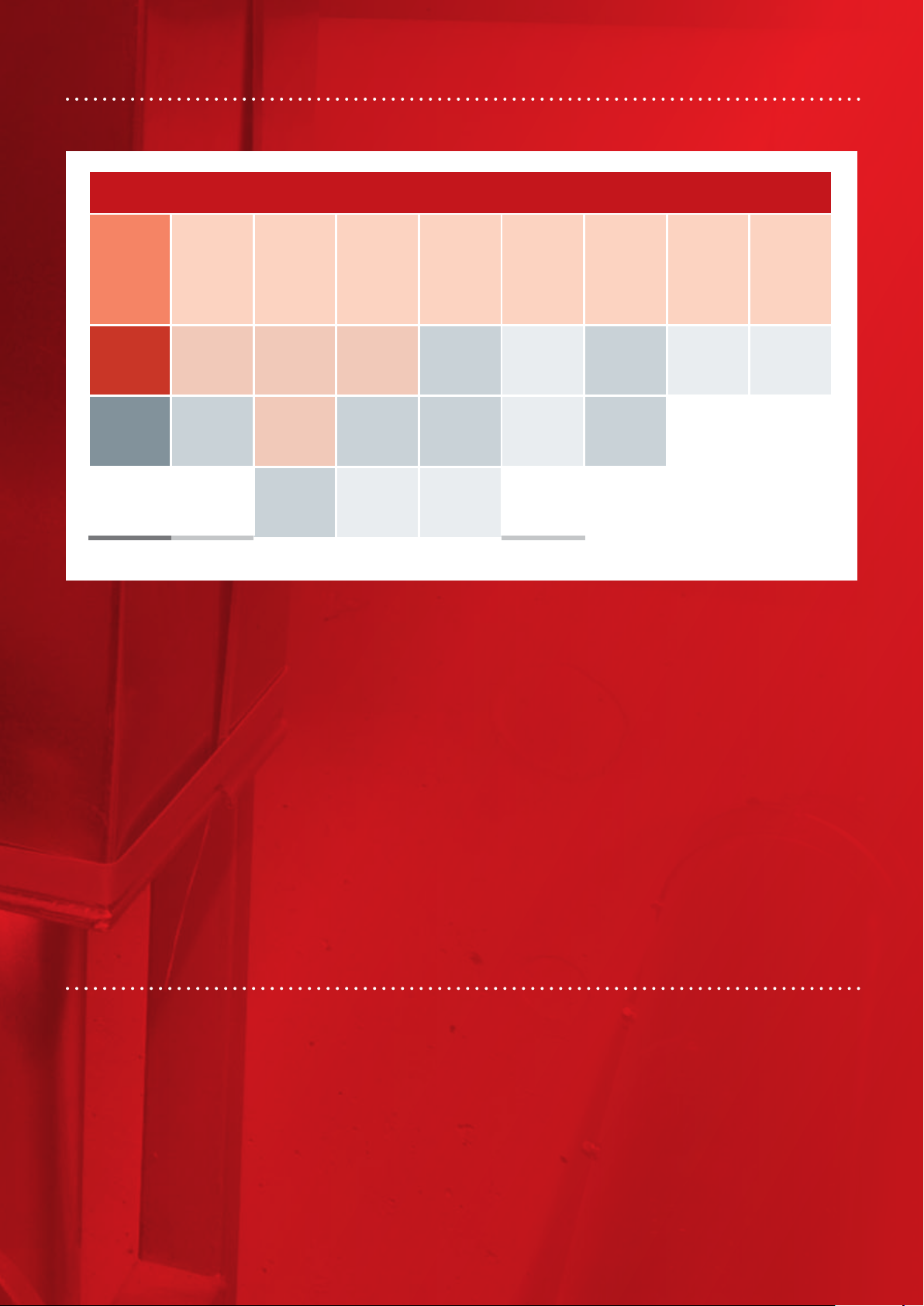
Seite 27 – 33
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.1 1.0 1.F 1.1 1.2 1.3 1.1.1 S.1.2 S.1.3
0.2 2.0 2.F 2.1 2.2 2.3 1.1.2
0.3 3.0 3.F 3.1 3.2 3.3
27
Übersicht
1. Anwendungen der
Trinkwassererwärmung
Die meisten Fernwärmenetze werden als geschlossene Systeme
betrieben, die eine eziente Methode zur Erwärmung des
Trinkwassers erfordern.
Heutzutage wird das Trinkwarmwasser entweder bei
konkretem Bedarf im Durchussprinzip mit einem
Wärmeübertrager in der Nähe der Entnahmestelle bereitet
oder durch Reduzierung des
Wärmeübertrager erwärmt und gebrauchsfertig
Ladespeicher bevorratet.
0.1
Trinkwassererwärmung im Durchussprinzip
Volumenstroms per
in einem
0.2 Trinkwassererwärmung mittels Speicherladesystem
0.3
Trinkwassererwärmung mittels SWE (Registerspeicher)
Page 28

1. 0.1 Applikation 0.1
TWW-Applikation (Durchussprinzip)
TWW-Applikation
zum Anschluss an ein FW-Netz.
Die Trinkwassererwärmung im
Durchflussprinzip erfolgt normalerweise
mit einer Heizungsapplikation kombiniert
Funktionsprinzip
Das Trinkwasser wird über einen
Wärmeübertrager erwärmt. Durch
diesen Wärmeübertrager sind TWW
und FW-Wasser physisch voneinander
getrennt.
Die Applikation kann eine unbegrenzte
Menge an Warmwasser bei konstanter
Temperatur liefern. Dieses TWW wird bei
Bedarf in der Nähe der Zapfstelle bereitet,
wodurch das Risiko der Vermehrung von
Legionellen oder anderen Bakterien
reduziert wird.
Je nach dem gewünschten TWW-Komfort
und dem verwendeten TWW-Regler können
der Wärmeübertrager und der Vorlauf
warm oder kalt gehalten werden.
1
*
1
*
Anwendungsabhängig auch als Kombiventil möglich
Anwendungsbereiche:
Einfamilienhäuser
Mehrfamilienhäuser
Gewerbebauten
Typen von FW-Systemen:
PN 10 & 16 bar T ≤ 60 °C
PN 10 bar T ≤ 90 °C
PN 10 & 16 bar T ≤ 110 °C
PN 16 bar T ≤ 110 °C
PN 25 bar T ≤ 110 °C
Typische Märkte:
Nahezu alle Märkte
Page 29

Von Danfoss empfohlene
Applikation 29
Regelungsoptionen
Elektronische Regelung
Die elektronische Regelung der TWW-Bereitung lässt sich mit unterschiedlichen
Funktionen konfigurieren.
Selbsttätige Regelung
Die selbsttätige Regelung lässt sich durch Temperatur-, Durchfluss- oder
Differenzdruckregelung bzw. durch eine Kombination dieser Regelungsarten erzielen.
Generell gilt, dass der elektronische Regler in größeren TWW-Systemen zum Einsatz
kommt, während selbsttätige Regler in den TWW-Systemen von Einfamilienhäusern
oder Wohnungen verwendet werden.
In Systemen mit selbsttätigen Reglern wird üblicherweise eine Kombination aus
Durchfluss- und Temperaturreglern eingesetzt.
Je nach den Anforderungen kann der Wärmeübertrager und/oder der Vorlauf warm oder
kalt gehalten werden.
Beispiel für eine elektronische Regelung
*
Istanbul (Türkei): Mehrfamilienhäuser und
Gewerbebauten mit TWW-Bereitung per
Durchflusserwärmung
1
1
*
Anwendungsabhängig auch als Kombiventil möglich
Beispiel für selbsttätige Regelungen
Page 30

1. 0.1 TWW-Durchusssystem
Wesentliche Vorteile der Applikation
Niedrige Gesamtsystemkosten
Kürzere Auslegungs- und Planungszeiten für Planer
Reduzierte Wartungskosten
Kompaktes und hocheffizientes System
Niedrige Rücklauftemperatur und geringer Wärmeverlust in der Station
Eignung für Niedertemperatursysteme
Geringerer Platzbedarf im Vergleich zu den alternativen Applikationen
Unbegrenzte TWW-Menge – dank bedarfsgerechter Durchflusserwärmung
Minimales Risiko von Bakterienvermehrung
Reduzierte hydraulische Last im Netz für eine Gruppe von Verbrauchern
Empfehlungen
0.1
Applikationstyp
TWW
Durchussprinzip
0.2
TWW
Speicherladesystem
0.3
SWE
(Registerspeicher)
Einsparung von Investitionskosten
Einsparungen bei der Installationszeit
Einsparungen beim Platzbedarf
Einsparungen bei Service-/Wartungsarbeiten
Energieezienz
Sicherer Systembetrieb
Verbraucherkomfort
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • • •
Page 31

Von Danfoss empfohlene
Applikation 31
Belegte Vorteile
Einsparung von Investitionskosten:
Die Applikation erfordert weniger Ausrüstung. Im Vergleich zu Applikationen mit
Speicherladesystem – inklusive Ladespeicher, Pumpe und Fühler – werden die Einsparungen
auf ca. 1.000 EUR geschätzt. In Mehrfamilienhäusern lassen sich noch höhere Einsparungen
erzielen. Literaturverweis [2].
Einsparungen beim Platzbedarf:
Die kompakte Applikation benötigt weniger Platz. Im Vergleich zu Applikationen mit
Speicherladesystem oder SWE (Registerspeicher) wird der eingesparte Platz auf 0,24 m2
geschätzt. Bei einem Preis von 1.500 EUR/m
In Mehrfamilienhäusern lassen sich noch höhere Einsparungen erzielen. Literaturverweis [3].
Einsparungen bei der Installationszeit:
Kürzere Installationszeit. Im Vergleich zu Applikationen mit Speicherladesystem lässt sich die
Installationszeit schätzungsweise um 3 Stunden verkürzen. Die geschätzten Einsparungen
belaufen sich auf 150 EUR (60 EUR/h). In Mehrfamilienhäusern lassen sich noch höhere
Einsparungen erzielen. Literaturverweis [3].
2
belaufen sich die Einsparungen auf 360 EUR.
Einsparungen bei Service-/Wartungsarbeiten:
Geringere Systemwartungskosten. Im Vergleich zu Applikationen mit Speicherladesystem und
SWE (Registerspeicher)
verkürzen. Die geschätzten Einsparungen belaufen sich auf 120 EUR (60 EUR/h).
Mehrfamilienhäusern lassen sich noch höhere Einsparungen erzielen. Literaturverweis [2].
Energieeffizienz:
Geringerer Wärmeverlust. Im Vergleich zu Applikationen mit Speicherladesystem und SWE
(Registerspeicher) wird der Wärmeverlust halbiert. Ein um 75 W reduzierter Wärmeverlust
bedeutet eine Ersparnis von 36EUR/Jahr (55 EUR/MWh). In Mehrfamilienhäusern lassen
sich noch höhere Einsparungen erzielen. Literaturverweis [3].
Sicherer Systembetrieb:
Hinsichtlich der Bakterienvermehrung gestattet ein geringes Wasservolumen (weniger
als 3 Liter zwischen Wärmeübertrager und Wasserhahn) niedrigere Vorlauf- und
TWW-Temperaturen, was sich in einem geringeren Wärmeverlust im Fernwärme-Netz
niederschlägt. Literaturverweis [4].
lassen sich die Servicearbeiten schätzungsweise um 2 Stunden
In
Einschränkungen der Applikation
• Keine TWW-Versorgung bei Unterbrechung der FW-Versorgung
• Die Auslegungsleistung (m
Applikationen mit Speicherladesystem und SWE (Registerspeicher).
3
/h) pro Verbraucher auf der FW-Seite ist höher als bei
Page 32

1. 0.2 Primäre Alternative zur Applikation 0.1
TWW-Applikation mit Speicherladesystem
Die TWW-Applikation mit Speicherladesystem eignet sich nicht nur für alle
Zentralheizungen mit Kessel sondern auch
für den Anschluss an ein FW-System.
1
Die Trinkwassererwärmung erfolgt
üblicherweise in Kombination mit der
Heizung.
*
1
*
Anwendungsabhängig auch als Kombiventil möglich
Funktionsprinzip
Das Trinkwasser wird in einem
Wärmeübertrager
Ladespeicher geleitet. Nach dem Verbrauch
des TWW wird Zeit benötigt, um diesen
Speicher wieder zu laden.
Der Ladespeicher eignet sich vor allem
für spezielle Applikationen – so z.B.
für
Gewerbebauten mit hoher TWWSpitzenlast.
Rücklaufleitung so im Ladespeicher
platziert werden, dass die
Temperaturschichtung beibehalten
bleibt. So lässt sich eine hohe
Rücklauftemperatur vermeiden.
erwärmt und in einen
Bei TWW-Zirkulation sollte die
Bei einer kurzzeitigen Unterbrechung der
FW-Versorgung kann der Ladespeicher die
verbliebene TWW-Kapazität bereitstellen.
In großvolumigen Ladespeichern besteht
jedoch das Risiko verstärkter Bakterienver
mehrung. Hinsichtlich der Reinigungs
intervalle müssen die landesspezifischen
Wartungsvorschriften beachtet werden.
-
Einschränkungen der Applikation
• Höherer Systempreis im Vergleich zur Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip durch
die Kosten für Ladespeicher, Pumpe und Fühler.
• Begrenzte Kapazität
• Größeres Risiko verstärkter Bakterienvermehrung im Vergleich zur TWE im
Durchflussprinzip.
• Großer Platzbedarf
• Hoher Wärmeverlust durch die Installation
• Nicht geeignet für Niedertemperatursysteme
• Regelmäßige Wartung und Reinigung ist zwingend notwendig
• Hohe Primär-Rücklauftemperatur im Vergleich zur Applikation mit TWW-Bereitung
im Durchflussprinzip, allerdings eine niedrigere Primär-Rücklauftemperatur als die
TWW-Applikation mit SWE (Registerspeicher)
Anwendungsbereiche:
Einfamilienhäuser
Mehrfamilienhäuser
Gewerbebauten
-
Typen von FW-Systemen:
PN 10 bar T ≤ 90 °C
PN 10 & 16 bar T ≤ 110 °C
PN 16 bar T ≤ 110 °C
PN 25 bar T ≤ 110 °C
Typische Märkte:
Mittel-, Süd- und Osteuropa
Page 33

1. 0.3 Von Danfoss nicht empfohlene Applikation
TWW-Applikation mit
SWE (Registerspeicher)
33
Der SWE (Registerspeicher)
Einfamilienhäusern und kleineren
Mehrfamilienhäusern zum Einsatz,
doch seine Ladeleistung ist im
zum Speicherladesystem begrenzt.
Die TWW-Applikation mit SWE
(Registerspeicher) eignet
alle Kessel-Applikationen
den Anschluss an ein FW-System.
Die Trinkwassererwärmung erfolgt
üblicherweise in Kombination mit der
Heizung.
kommt in
Vergleich
sich nicht nur für
sondern auch für
Funktionsprinzip
Das Trinkwasser wird in einem SWE
(Registerspeicher)
Verbrauch der TWW-Kapazität wird Zeit
benötigt, um diesen wieder zu laden.
Bei TWW-Zirkulation sollte die
Rücklaufleitung so im Speicher platziert
werden, dass die Temperaturschichtung
aufrechterhalten bleibt.
erwärmt.
Nach dem
großvolumigen
besteht jedoch das Risiko verstärkter
Bakterienvermehrung.
Reinigungsintervalle müssen
landesspezifischen Wartungsvorschriften
beachtet werden.
SWE (Registerspeicher)
Hinsichtlich der
die
Anwendungsbereiche:
Einfamilienhäuser
Mehrfamilienhäuser
Typen von FW-Systemen:
PN 10 bar T ≤ 90 °C
PN 10 & 16 bar T ≤ 110 °C
PN 16 bar T ≤ 110 °C
Bei einer kurzzeitigen Unterbrechung der
FW-Versorgung kann der SWE
(Registerspeicher) die verbliebene
TWW-Kapazität bereitstellen. In
Einschränkungen der Applikation
• Höherer Systempreis im Vergleich zur Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip durch
die Kosten für SWE (Registerspeicher) und Fühler
• Ineffektives Laden
• Begrenzte Kapazität
• Größeres Risiko verstärkter Bakterienvermehrung im Vergleich zur Trinkwassererwärmung
im Durchflussprinzip
• Großer Platzbedarf
• Hoher Wärmeverlust durch die Installation
• Nicht geeignet für Niedertemperatursysteme
• Regelmäßige Wartung und Reinigung ist zwingend notwendig
• Sehr hohe Primär-Rücklauftemperatur im Vergleich zur Trinkwassererwärmung
im Durchflussprinzip und zur Trinkwassererwärmung mittels Speicherladesystem
Typische Märkte:
Deutschland, Italien, Österreich und
Großbritannien
Page 34

Page 35

Seite 35 – 41
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.1 1.0 1.F 1.1 1.2 1.3 1.1.1 S.1. 2 S.1. 3
0.2 2.0 2.F 2.1 2.2 2.3 1.1.2
0.3 3.0 3.F 3.1 3.2 3.3
35
Übersicht
2. Indirekt und direkt angeschlossene
Raumheizungsanwendungen
Die Prinzipien der Raumheizung haben sich im Lauf der Zeit
kaum geändert – es gibt entweder direkt oder indirekt
angeschlossene Heizungsanwendungen.
Die indirekt angeschlossene Heizungsanwendung regelt die
sekundärseitige Vorlauftemperatur und trennt die Sekundärseite
per Wärmeübertrager vom Fernwärmenetz.
In einer direkt angeschlossenen Heizungsanwendung
kann die Temperatur auf der Sekundärseite entweder über
einen Mischkreis geregelt werden, oder sie entspricht der
Vorlauftemperatur (d.h. sie lässt sich nicht regeln).
1.0 Indirekt angeschlossen
2.0 Direkt angeschlossen mit Mischkreis
3.0 Direkt angeschlossen
Page 36

2. 1.0
Applikation
Indirekt angeschlossene
Raumheizungsanwendung
1
*
Indirekt angeschlossene Heizungsanwendung
Fußbodenheizungen und Klimaanlagen.
für Heizkörpersysteme,
Funktionsprinzip
Das Fernwärmenetz und der Heizkreis
durch den Wärmeübertrager physisch
voneinander getrennt.
Die Applikation minimiert das Risiko
einer Kontaminierung des FW-Wassers
sowie die Risiken und Folgen von Leckagen
in Wohnungen. Die Sekundär-Vorlauftemperatur wird an den Wärmebedarf des
Gebäudes angepasst.
Die Applikation wird üblicherweise
elektronisch
ist jedoch auch eine selbsttätige Regelung
möglich. Aus Komfort- und Energiesparg ründen wird für Fußbodenheizungen
und
Regler mit witterungsgeführter
Temperaturre gelung empfohlen.
geregelt, in Einfamilienhäusern
Heizkörpersysteme ein elektronischer
sind
1
*
Anwendungsabhängig auch als Kombiventil möglich
Anwendungsbereiche:
Einfamilienhäuser
Mehrfamilienhäuser
Gewerbebauten
Typen von FW-Systemen:
PN 10 & 16 bar T ≤ 60 °C
PN 10 bar T ≤ 90 °C
PN 10 & 16 bar T ≤ 110 °C
PN 16 bar T ≤ 110 °C
PN 25 bar T ≤ 110 °C
Typische Märkte:
Alle Märkte außer Dänemark und
den Niederlanden
Page 37

Von Danfoss empfohlene
1.0 - a
1.0 - b
Applikation 37
Regelungsoptionen
Elektronische Regelung
Ein elektronischer Regler kommt vor allem in Heizkörperanlagen und Fußbodenheizungen
zum Einsatz. Die primären Aufgaben dieses Reglers sind die witterungsgeführte
Regelung der Vorlauftemperatur, die periodische Rückstellung (Tag/Nacht) sowie die
Pumpensteuerung. Zu den typischen zusätzlichen Funktionen zählen die max. und min.
Begrenzung der Vorlauftemperatur und maximale Begrenzung der
Rücklauftemperaturen.
Selbsttätige Regelung
Die selbsttätige Regelung lässt sich durch Temperatur-, Durchfluss- oder Differenzdruckregelung
bzw. durch eine Kombination dieser Regelungsarten erzielen. Lösungen mit selbsttätiger
Regelung werden vor allem in kleinen dezentralen Fußbodenheizungen oder Klimaanlagen
verwendet.
1
*
Anwendungsabhängig auch als Kombiventil möglich
Beispiel für eine elektronische Regelung
*
London (Großbritannien): Mehrfamilienhäuser und
Gewerbebauten mit Trinkwassererwärmung im
Durchflussprinzip
1
Beispiel für eine selbsttätige Regelung
1
*
Page 38

Indirekt angeschlossene
2. 1.0
Raumheizungsanwendung
Wesentliche Vorteile der Applikation
Anpassung der Temperatur des Sekundärkreises an die Heizlast des Gebäudes
Leicht einzurichtende sicherheitstechnische Ausrüstung bei Hochtemperatur-
Fernwärmenetzen
Geringere Auswirkung von Leckagen im Gebäude: Die Leckage beschränkt sich
auf den Heizkreis.
Größeres Energiesparpotenzial wegen niedrigerer Oberflächentemperaturen der
Heizkörper und einheitlicherer Raumtemperaturen.
Minimiertes Risiko einer Kontaminierung des FW-Vorlaufwassers, weil es durch
den Wärmeübertrager vom Gebäudesystem getrennt ist.
Große Flexibilität hinsichtlich des Nenndrucks (PN) im Vorlauf des Fernwärme-
netzes.
Geeignet für den Einsatz eines witterungsgeführten elektronischen Temperaturreglers
Empfehlungen
1.0
Applikationstyp
Indirekt angeschlossene
Raumheizungs-
anwendung
Direkt angeschlossene
Raumheizungsanwen-
dung mit Mischkreis
2.0
Direkt angeschlossene
3.0
Raumheizungs-
anwendung
Einsparung von Investitionskosten
Einsparungen bei der Installationszeit
Einsparungen beim Platzbedarf
Einsparungen bei Service-/Wartungsarbeiten
Energieezienz
Sicherer Systembetrieb
Verbraucherkomfort
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • •
• • • • • • •
Page 39

Von Danfoss empfohlene
Applikation 39
Belegte Vorteile
Für den Betreiber des Fernwärmenetzes
Energieeffizienz:
Geringerer Wärmeverlust. Bei Installation von elektronischen Reglern mit witterungsgeführter
Temperaturregelung bedeutet jedes Grad, um das die Vorlauf- oder Rücklauftemperatur
gesenkt werden kann, eine Ersparnis von ca. 0,9% des Nettowärmeverlusts im Fernwärmenetz. Akkumulierte jährliche Einsparungen von bis zu 6% wurden in einem FW-System
dokumentiert.
Literaturhinweis [1].
Für den Gebäudeeigentümer und Endverbraucher
Energieeffizienz:
Energieeinsparungen. In einem Heizsystem mit elektronischem Regler und witterungsgeführter
Temperaturregelung konnten Energieeinsparungen von 11 bis 15% (und in einigen Fällen
sogar mehr) in Einfamilienhäusern nachgewiesen werden.
Verbraucherkomfort:
Erhöhter Komfort wegen der niedrigeren Oberflächentemperatur der Heizkörper und den
konstanten Raumtemperaturen.
Literaturhinweis [1].
Literaturhinweis [1].
Einschränkungen der Applikation
Selbsttätige Regelung
• Keine periodische Rückstellung (zwischem Komfort- und Sparbetrieb)
• Großer Systemwärmeverlust, wenn die Vorlauftemperatur höher als der tatsächliche
Bedarf ist.
• Kann nicht zusätzlich die Pumpe ansteuern
Page 40

2. 2.0 Primäre Alternative zur Applikation 1.0
Direkt angeschlossene
Raumheizungsanwendung
mit Mischkreis
Direkt angeschlossene
Raumheizungsanwendung mit
Mischkreis für Heizkörpersysteme,
Fußbodenheizungen und Klimaanlagen.
Funktionsprinzip
Die Applikation ist direkt an das
Fernwärmenetz angeschlossen. Durch direkt
angeschlossene Applikationen erhöht sich
das Risiko einer Kontaminierung des
FW-
Wassers sowie das Risiko und die Folgen
einer Leckage in Gebäuden.
Die Sekundär-Vorlauftemperatur wird mithilfe
eines Mischkreises an den Wärmebedarf des
Gebäudes angepasst. Zur Vermeidung eines
„Rückflusses“ wird ein Rückschlagventil
Mischkreis installiert. Darüber hinaus
wird ein Differenzdruckregler eingesetzt
um den Differenzdruck über die
Heizkörperthermostatventile zu
begrenzen.
Die Applikation wird üblicherweise
selbsttätig geregelt. In einem
Einfamilienhaus können selbsttätige
Regler
Aus Komfort- und Energiespargründen
wird
für Fußbodenheizungen und
Heizkörperanwendungen ein elektronischer
Regler mit witterungsgeführter
Temperaturregelung empfohlen.
im
1
*
verwendet werden.
1
*
Anwendungsabhängig auch als Kombiventil möglich
Anwendungsbereiche:
Einfamilienhäuser
Mehrfamilienhäuser
Gewerbebauten
Typen von FW-Systemen:
PN 10 bar T ≤ 60 °C
PN 10 bar T ≤ 90 °C
Typische Märkte:
Dänemark, Niederlande und alle
Märkte für Sekundärsysteme
Einschränkungen der Applikation
• Keine Trennung von Hausanlage und Fernwärmenetz
• Wenn das Primärwasser nicht richtig aufbereitet ist, besteht das Risiko von Korrosion
in der Hausanlage.
• Risiko der Verunreinigung des FW-Wassers durch die Hausanlage
• Potenzielles Risiko von Leckagen und des Austritts von FW-Wasser aus der Hausanlage
• Wenn die Wartung der Sekundärseite nicht ganz klar definiert ist, kann dieses System
nicht empfohlen werden.
• Keine klare Definition der Leistungsbegrenzung, wenn kein Volumenstromregler
installiert ist.
Selbsttätige Regelung
• Keine periodische Rückstellung (zwischem Komfort- und Sparbetrieb)
• Großer Systemwärmeverlust, wenn die Vorlauftemperatur höher als der tatsächliche
Bedarf ist.
• Kann nicht zusätzlich die Pumpen ansteuern
Page 41

2. 3.0 Applikation wird nicht empfohlen
Direkt angeschlossene
Raumheizungsanwendung
Direkt angeschlossene
Raumheizungsanwendung für
Heizkörpersysteme, Fußbodenheizungen
und Klimaanlagen.
41
Funktionsprinzip
Die Applikation ist direkt an das
Fernwärmenetz angeschlossen. Durch direkt
angeschlossene Applikationen erhöht sich
das Risiko einer Kontaminierung des
FW-Wassers sowie das Risiko und die Folgen
einer Leckage in Gebäuden.
Die Regelung der Raumtemperatur
erfolgt mittels Heizkörperthermostat,
Rücklauftemperaturbegrenzer oder
Raumthermostat (der ein Zonenventil
steuert).
Darüber hinaus wird ein Differenzdruckregler
eingesetzt
Heizkörperthermostatventile zu begrenzen.
Die Applikation wird selbsttätig geregelt.
um den Differenzdruck über
die
Einschränkungen der Applikation
• Eine Rücklauftemperaturbegrenzung ist nur mithilfe eines selbsttätigen
Rücklauftemperaturbegrenzers möglich.
• Keine Möglichkeit, die Vorlauftemperaturen für das Gebäude zu verändern
• Wenn das FW-Wasser nicht richtig aufbereitet ist, besteht das Risiko von Korrosion in
der Hausanlage.
• Risiko der Verunreinigung des FW-Wassers durch die Hausanlage
• Potenzielles Risiko von Leckagen und des Austritts von FW-Wasser aus der Hausanlage
• Wenn die Wartung der Sekundärseite nicht ganz klar definiert ist, kann dieses System
nicht empfohlen werden.
• Keine klare Definition der Leistungsbegrenzung, wenn kein Volumenstromregler
installiert ist.
• Keine periodische Rückstellung (zwischem Komfort- und Sparbetrieb)
• Großer Systemwärmeverlust, wenn die Vorlauftemperatur höher als der tatsächliche
Bedarf ist.
Anwendungsbereiche:
Einfamilienhäuser
Typen von FW-Systemen:
PN 10 bar T ≤ 60 °C
PN 10 bar T ≤ 90 °C
Typische Märkte:
Dänemark, Niederlande und alle
Märkte für Sekundärsysteme
Page 42

Page 43

Seite 43 – 50
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.1 1.0 1.F 1.1 1.2 1.3 1.1.1 S.1. 2 S.1. 3
0.2 2.0 2.F 2.1 2.2 2.3 1.1.2
0.3 3.0 3.F 3.1 3.2 3.3
43
Übersicht
3.
Versorgungssysteme für
Wohnungsstationen
In Mehrfamilienhäusern bendet sich üblicherweise eine
Fernwärmehausstation im Keller, die bei Bedarf die Wohnungen
mit Wärme versorgt. Für die Wärmeversorgung sind drei
Applikationen verfügbar:
1. Hausstation mit einem Wärmeübertrager, der die gebäudeseitige
Vorlauftemperatur
Fernwärmenetz
2. Hausstation mit einem Puerspeicher, der von einem
Wärmeübertrager geladen wird, der wiederum das
Fernwärmenetz
verfügbare Wärmequellen voneinander trennt. Das Heizwasser
im Puerspeicher wird für die Versorgung der Wohnungen im
Gebäude benutzt.
3. Eine direkt angeschlossene Hausstation, die die
Vorlauftemperatur des Gebäudes per Mischkreis regelt.
regelt und der das Gebäudesystem vom
trennt.
sowie das Gebäudesystem
und/oder sonstige
1.F Indirekt angeschlossen
2.F
Indirekt angeschlossen mit Puerspeicher
3.F Direkt angeschlossen mit Mischkreis
Page 44

Dezentrale Wärmeverteilung44
Dezentrale Wärmeverteilung und Trinkwassererwärmung
mit Wohnungsstationen
Bei der dezentralen Wärmeverteilung wird
jede Wohnungsstation mit Heizwasser aus
einer oder mehreren zentralen
Energiequellen über Pufferspeicher mit
Eine
Wärme versorgt.
beinhaltet normalerweise
Plattenwärmeübertrager, der bei Bedarf im
Durchflussprinzip Trinkwasser erwärmt,
sowie einen Differenzdruck
Differenzdruck des
regelt, mit dem die Heizkörper und
Fußbodenheizungen in der jeweiligen
Wohnung
versorgt
Wohnungsstation
einen kompakten
regler, der den
Heizvolumen stroms
werden.
Das Grundprinzip der dezentralen
Wärmeverteilung
Prozesse von der zentralen Hausstation in
die einzelnen Wohnungen zu verlagern.
Um eine optimale Leistung der
Wohnungsstation sicherzustellen, müssen
das System
unbedingt richtig bemessen und ausgelegt
werden.
besteht darin, bestimmte
und die zentrale Übergabestation
Dezentrale Systeme können mit sämtlichen
Energiequellen betrieben werden. Am
gebräuchlichsten sind entweder indirekt
angeschlossene FW-Hausstationen oder
sonstige direkt angeschlossenen
Hausstationen bzw. Kesselsysteme. Alle
Installationen lassen sich mit örtlichen
Energiequellen wie z.B. Solarheizungen
(thermischen Solaranlagen) über
Pufferspeicher kombinieren.
1
*
1. F Indirekt angeschlossene Hausstation 2.F Indirekt angeschlossene
In Systemen mit Wohnungs stationen
wird das TWW in der Nähe der
Entnahmestelle bereitet, wodurch die
Vermehrung von Legionellen oder anderen
Bakterien vermieden wird. Da
Heizwasser für die Raumheizung durch
die
Wohnungsstation fließt, wird nur ein
Energiezähler benötigt, um den Energieverbrauch in der Wohnung zu messen.
auch das
1
*
Hausstation mit Pufferspeicher
1
*
3.F Direkt angeschlossene
Hausstation mit Mischkreis
1
*
Anwendungsabhängig auch als Kombiventil möglich
Page 45

Wohnungsstationen 45
Wesentliche Vorteile der Applikation
(im Vergleich zu herkömmlichen Systemen)
Präzise individuelle Energiemessung und -abrechnung
Reduzierte Wartungskosten dank einfacher und zuverlässiger Technik
Höhere Energieeffizienz durch einen verbesserten Systembetrieb und niedrige
Betriebstemperaturen; Eignung für Niedertemperatursysteme
Besserer hydraulischer Abgleich im System
Geringer Platzbedarf und einfache Montage
Kompakte und leichte Konstruktion
Benutzerfreundliche, einfache und moderne Bauweise
Geringeres Risiko von Bakterienvermehrung
Die individuelle Einstellung der Raumtemperatur und die Bereitung von TWW in
der benötigten Menge, sorgen für maximalen Komfort.
Unabhängigkeit von externen Energiequellen
Belegte Vorteile
Einsparung von Investitionskosten:
Schnellerer Verkauf von Wohnungen. Mit einem dezentralen System lassen sich bis zu
735 EUR/Wohnung einsparen – und zwar durch den schnelleren Verkauf der Wohnungen
im Vergleich zu Wohnungen mit anderen Heizlösungen.
Annahmen:
Es dauert 22 Wochen, um ein fünfgeschossiges Gebäude fertigzustellen. Wenn es jedoch
möglich ist, nacheinander jedes Geschoss einzeln fertig zu stellen und trocknen zu lassen
(und nicht erst darauf warten zu müssen, bis das ganze Gebäude fertig ist) verkürzt sich
die Bauzeit auf 10 Wochen. 70% der Investition sind durch ein Darlehen gedeckt, 10% Zinsen,
900 EUR/m
Energieeffizienz:
Geringerer Wärmeverlust. Im Vergleich zu einem 5-Rohr-System ist der Wärmeverlust durch
die Zirkulation in einem dezentralen System mit Wohnungsstationen um 33% geringer.
2
Investitionskosten, 100 Wohnungen, durchschnittliche Wohnungsgröße 70 m2.
Annahmen:
22 Wohnungen, Länge des Rohrnetzes 242 m, Wärmeverlust-Koeffizient 0,2 W/mK,
Vorlauftemperatur 60 °C, Rücklaufleitung (5-Rohr-System) 55°C, Rücklaufleitung
(Wohnungsstation) 30 °C, Umgebungstemperatur 20 °C.
Energieeffizienz:
Energieeinsparungen. Bei der Installation eines dezentralen Systems mit Wohnungsstationen
anstelle eines herkömmlichen Systems im Rahmen eines Renovierungsprojekts konnten jährliche
Energieeinsparungen von 30% pro Wohnung nachgewiesen werden. Literaturhinweis [6].
Trinkwasser-Hygiene:
In einigen Ländern (Deutschland) sind für Systeme zur Trinkwasser-Erwärmung in vermietetem
Wohnraum unter bestimmten Umständen regelmäßige Legionellen-Prüfungen vorgeschrieben, auf
die bei dezentraler Trinkwasser-Erwärmung verzichtet werden kann.
Literaturhinweis [5].
Page 46

Indirekt angeschlossene Hausstation zur
1.F
1. x.x 3. 1.F
Versorgung von Wohnungsstationen
Indirekt angeschlossene
Hausstation zur Versorgung
von Wohnungsstationen
Indirekt angeschlossene Hausstation mit
Wärmeübertrager zur Versorgung aller
Wohnungsstationen mit Heizwasser.
1
*
Funktionsprinzip
Das Fernwärmenetz und der sekundärseitige
Heizkreis sind durch den
physisch voneinander
Bei der TWW-Bereitung sollte die
Vorlauftemperatur aus dem Wärmeüber
trager 50 bis 55°C nicht unterschreiten.
Diese Applikation kann eine unbegrenzte
Warmwassermenge mit konstanter
Temperatur liefern – und zwar bei
Wärmeübertrager
getrennt.
-
Druckbedingungen, die für die verwendeten
Wohnungsstationen geeignet
Aus Komfort- und Energiespargründen wird
für Fußbodenheizungen und Heizkörperanwendungen ein elektronischer Regler mit
witterungsgeführter Temperaturregelung
empfohlen.
sind.
Anwendungsbereiche:
Mehrfamilienhäuser
Typen von FW-Systemen:
PN 10 & 16 bar T ≤ 60 °C
PN 10 bar T ≤ 90 °C
PN 10 & 16 bar T ≤ 110 °C
PN 16 bar T ≤ 110 °C
PN 25 bar T ≤ 110 °C
Typische Märkte:
Skandinavien, Mittel- und
Südeuropa
HafenCity Hamburg (Deutschland)
– Mehrfamilienhäuser und Gewerbebauten mit FW-Heizung
Page 47

Von Danfoss empfohlene
Applikation
Regelungsoptionen
Elektronische Regelung
Die primären Aufgaben
sind die witterungsgeführte
Vorlauftemperatur sowie die Pumpensteuerung. Zu den typischen zusätzlichen
Funktionen zählen die max. und min.
Begrenzung der Vorlauftemperatur und
die max. Begrenzung der Rücklauftemperaturen.
dieses Reglers
Regelung der
47
1
*
Beispiel für eine elektronische Regelung
* Anwendungsabhängig auch als Kombiventil möglich
Wesentliche Vorteile der Applikation
Niedrigere Wartungskosten im Vergleich zu Systemen mit Pufferspeicher
Kompaktes und hocheffizientes Heizsystem
Niedrige Rücklauftemperatur und geringer Wärmeverlust des zentralen Systems
und den Rohrleitungen
Eignung für Niedertemperatursysteme
Geringerer Platzbedarf der Installation im Vergleich zu zentralen Systemen mit
Pufferspeicher
Geringerer Platzbedarf der Installation im Vergleich zu zentralen Systemen mit
Pufferspeicher
Einschränkungen der Applikation
• Langsamere dynamische Reaktion der Wohnungsstationen auf hohe TWW-Spitzenlasten
im Vergleich zum Pufferspeicher
• Bei Kombination mit örtlichen Energiequellen wie z.B. Solarheizungen (thermischen
• Langsamere dynamische Reaktion der Wohnungsstationen auf hohe TWWSolaranlagen) muss ein Pufferspeicher zum System hinzugefügt werden.
Spitzenlasten im Vergleich zum Wärmespeicher
• Bei Kombination mit örtlichen Energiequellen wie z.B. Solarheizungen (thermischen
Solaranlagen) muss ein Wärmespeicher zum System hinzugefügt werden.
1
*
Anwendungsabhängig auch als Kombiventil möglich
Page 48

3. 2.F Applikation
Indirekt angeschlossene
Hausstation
mit Puerspeicher zur Versorgung
von Wohnungsstationen
Indirekt angeschlossene Hausstation
mit Pufferspeicher (der von einem
Wärmeüber rager geladen wird) zur
Versorgung aller Wohnungsstationen
mit Wärme.
1
*
Typische Applikation für multivalente
Kombi-Systeme
(thermischer Solaranlage).
mit Solarheizung
Funktionsprinzip
Das Fernwärmenetz und der sekundärseitige Heizkreis sind durch den
übertrager,
physisch voneinander getrennt.
Das System liefert Heizwasser mit
konstanter Temperatur – und zwar bei
Druckbedingungen, die für die verwendeten
Bei der TWW-Bereitung sollte die
Vorlauftemperatur aus dem Pufferspeicher
50 bis 55°C nicht unterschreiten.
der den Pufferspeicher lädt,
Wohnungsstationen geeignet sind.
Wärme-
Bei kurzzeitiger Unterbrechung der
FW-Versorgung kann der Pufferspeicher
sein
verbleibendes Volumen an die
Wohnungsstationen abgeben.
Aus Komfort- und Energiespargründen wird
für Fußbodenheizungen und
systeme ein elektronischer Regler
witterungsgeführter Temperatur regelung
empfohlen.
1
*
Heizkörper-
mit
Anwendungsabhängig auch als Kombiventil möglich
Anwendungsbereiche:
Mehrfamilienhäuser
Typen von FW-Systemen:
PN 10 & 16 bar T ≤ 60 °C
PN 10 bar T ≤ 90 °C
PN 10 & 16 bar T ≤ 110 °C
PN 16 bar T ≤ 110 °C
PN 25 bar T ≤ 110 °C
Typische Märkte:
Skandinavien, Mittel- und
Südeuropa
Zagreb (Kroatien)
– Mehrfamilienhäuser und Gewerbebauten mit FW-Applikation
Page 49

Von Danfoss empfohlene
Applikation
Regelungsoptionen
Elektronische Regelung
Die elektronische Regelung lässt sich mit
unterschiedlichen Funktionen verwenden.
In der Abbildung lässt die Pumpe 1 das
Heizwasser im Pufferspeicher zirkulieren.
Das Regelventil auf der Primärseite regelt
die Ladetemperatur. Die Pumpe 2 sorgt
für die nötige Förderhöhe, um das
Heizwasser durch das Verteilersystem zu
den Wohnungsstationen zirkulieren zu
lassen.
49
49
1
Beispiel für eine elektronische Regelung
Wesentliche Vorteile der Applikation
Reduziert die Spitzenlast des FW-Vorlaufs mittels Pufferspeicher
Optimale Auslegung des Systems auf die Spitzenlast in kleinvolumigen Installationen
Überragende Reaktionszeit der Versorgung bei plötzlicher TWW-Spitzenlast
(im Vergleich zu Systemen mit Wärmeübertrager sowie zu direkt angeschlossenen
Systemen)
Beste Kompatibilität mit örtlichen Energiequellen wie z.B. Solarheizungen
(thermischen Solaranlagen)
2
Einschränkungen der Applikation
• Für großvolumige Installationen mit mehr als 30 bis 50 Wohnungen, in denen
ausschließlich die FW-Versorgung genutzt wird, empfehlen wir eine Applikation ohne
Pufferspeicher.
• Bei leerem Pufferspeicher ist eine sofortige Versorgung der Wohnungsstationen mit
einer großen Warmwassermenge nicht möglich.
• Größerer Wärmeverlust der Installation (Hausstation und Pufferspeicher).
• Größerer Platzbedarf im Vergleich zu einer Applikation mit reinem Wärmeübertrager
und zu einer direkt angeschlossenen Applikation.
• Höherer Systempreis im Vergleich zu einem System mit reinem Wärmeübertrager
wegen der zusätzlichen Komponenten (Pufferspeicher, Pumpe und Fühler)
Page 50

1. x.x
3. 3.F Primäre Alternative zu den Applikationen 1.F und 2.F
Direkt angeschlossene Hausstation
mit Mischkreis zur Versorgung von
Wohnungsstationen
1
Direkt angeschlossene Hausstation
mit Mischkreis zur Versorgung aller
Wohnungsstationen mit Heizwasser.
*
1
*
Anwendungsabhängig auch als Kombiventil möglich
50
Funktionsprinzip
Die Hausstation ist direkt an das Fernwärmenetz angeschlossen.
Bei der TWW-Bereitung sollte die
Vorlauftemperatur
unterschreiten.
Die Sekundär-Vorlauftemperatur wird
mithilfe eines Mischkreises an den
Wärmebedarf des Gebäudes angepasst.
50 bis 55°C nicht
Zur Vermeidung eines „Rückflusses“ wird
ein Rückschlagventil im Mischkreis installiert.
Die Applikation wird üblicherweise
selbsttätig geregelt.
Aus Komfort- und Energiespargründen wird
für Fußbodenheizungen und Heizkörperan wendungen ein elektronischer Regler
mit witterungsgeführter Temperaturregelung empfohlen.
Einschränkungen der Applikation
Einschränkungen der Applikation
• Langsamere dynamische Reaktion der Hausstation auf hohe TWW-Spitzenlasten
Vergleich zum Pufferspeicher
• Das FW-Wasser wird nicht von Heizwasser in der Hausanlage getrennt.
Anwendungsbereiche:
Mehrfamilienhäuser
Typen von FW-Systemen:
PN 10 & 16 bar T ≤ 60 °C
PN 10 bar T ≤ 90 °C
Typische Märkte:
Dänemark und die Niederlande
im
• Wenn das FW-Wasser nicht richtig aufbereitet ist, besteht das Risiko von Korrosion in
der Hausanlage.
• Risiko der Verunreinigung des FW-Wassers durch die Hausanlage
• Potenzielles Risiko von Leckagen und des Austritts von FW-Wasser aus der Hausanlage
• Bei Kombination mit örtlichen Energiequellen wie z.B. Solarheizungen (thermischen
Solaranlagen) sollte einem System mit Pufferspeicher der Vorzug gegeben werden.
Page 51

spart 30%
der Heizkosten
Die Einsparungen bei den
Stromkosten belaufen sich ein
Jahr nach der Entfernung der
Umwälzpumpen aus allen drei
Wohnblöcken auf 3.220 EUR.
Sonderborg (Dänemark)
Projektbeispiel
Niedrigere Rücklauftemperatur
Niedrigere Ausgaben
Mit einem neuen Heiz- und Warmwassersystem in 324 Wohnungen von SAB,
einer Wohnungsgenossenschaft in der süddänischen Stadt Sønderborg, konnten
im Durchschnitt pro Wohnung jährliche Energieeinsparungen von ca. 30% (Schätzwert)
erzielt werden.
Dieser Erfolg beruht vor allem auf der Installation eines 2-Rohr-Systems mit Wohnungsstationen
von Danfoss für die Nutzung von Fernwärme. In dem ursprünglichen 1-Rohr-Heizsystem
des Wohnblocks aus dem Jahr 1964 wurde das Trinkwasser in zentralen Übergabe-
stationen
Trinkwasser dagegen
Bewohner können in ihrer Wohnung den eigenen Energieverbrauch exakt ablesen.
Die Kenntnis des eigenen Verbrauchs trägt zu den Einsparungen bei.
Vor den Modernisierungsmaßnahmen kannte keiner der Bewohner seinen eigenen Verbrauch.
Heute ist in jeder Wohnung ein Zähler zur Messung der Heizleistung und des TWW-Verbrauchs
an der Wohnungsstation angeschlossen. Das hat zu einem beträchtlich verbesserten
Bewusstsein für den eigenen Verbrauch geführt.
erwärmt, die sich in einem Kesselraum im Keller befanden. Heute wird das
direkt vor Ort in den Wohnungsstationen erwärmt und die
Befriedigung der Nachfrage nach eigenen Zählern
Håndværkergården ist für die Installation des neuen Heiz- und Warmwassersystems
verantwortlich und laut Projektleiter Henning Christensen waren auch alternative
Systemlösungen in Betracht gezogen worden. Bei diesem Projekt haben sich die
Wohnungsstationen jedoch als die beste Lösung erwiesen, um dem Wunsch nach
eigenen Zählern und individueller Zahlung für den Energieverbrauch nachzukommen.
Niedrigere Rücklauftemperatur – niedrigere Ausgaben
Ein wesentlicher Vorteil des 2-Rohr-Systems ist sein Beitrag zur Senkung der Rücklauftemperatur
des Fernwärmenetzes von Sønderborg. Im Winter liegt die Vorlauftemperatur bei ca. 80°C
und die Rücklauftemperatur beträgt ca. 40°C. Vor den Modernisierungsmaßnahmen lag die
Rücklauftemperatur bei 65°C.
FAKTEN:
Die Fernwärmeversorgungsgesell-
schaft von Sønderborg ist eine
Genossenschaft im Besitz ihrer
8.000 Mitglieder. Mehr als 90% der
von der Versorgungsgesellschaft
verteilten Wärme werden in dem
örtlichen KWK-Kraftwerk erzeugt.
65% dieser Wärmeenergie stammen
aus CO2-neutraler Müllverbrennung.
Page 52

Page 53

Seite 53 – 61
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.1 1.0 1.F 1.1 1.2 1.3 1.1.1 S.1. 2 S.1. 3
0.2 2.0 2.F 2.1 2.2 2.3 1.1.2
0.3 3.0 3.F 3.1 3.2 3.3
53
Übersicht
4. Direkt und indirekt angeschlossene
Raumhei zung sowie Trinkwassererwärmung
im Durch ussprinzip
Unabhängig von der Größe des angeschlossenen Gebäudes
stellt die kontinuierliche Wärmeversorgung zum Zwecke der
Raumheizung und der TWW-Bereitstellung die wesentliche
Aufgabe der meisten Fernwärmeversorger dar.
Die Auslegung der Applikation erfolgt exibel gemäß den
Netzeigenschaften. Zudem kann die Applikation
direkt – mit oder ohne Mischkreis – ausgerüstet
1.1 Indirekt angeschlossene Heizung und Trinkwassererwärmung
im Durchussprinzip mittels Wärmeübertrager
indirekt oder
werden.
2.1 Direkt angeschlossene Heizung mit Mischkreis und Trinkwasser-
erwärmung im Durchussprinzip mittels Wärmeübertrager
3.1 Direkt angeschlossene Heizung und Trinkwassererwärmung im
Durchussprinzip
mittels Wärmeübertrager
Page 54

4. 1.1 Applikation
1.1
Indirekt angeschlossene Raumheizung
sowie Trinkwas sererwärmung im
Durchussprinzip
Indirekt angeschlossene Heizungsanwendung für Heizkörpersysteme,
Fußbodenheizungen und Klimaanlagen.
Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip mittels Wärmeübertrager.
Funktionsprinzip
Das Fernwärmenetz und der Heizkreis
sind durch den Wärmeübertrager physisch
voneinander getrennt. Die Applikation
minimiert das Risiko einer Kontaminierung
des FW-Wassers sowie die Risiken und
Folgen von Leckagen in Wohnungen. Die
Sekundär-Vorlauftemperatur wird an den
Wärmebedarf des Gebäudes angepasst.
Die Durchflusserwärmung des Trinkwassers
erfolgt mittels Wärmeübertrager. Durch den
Wärmeübertrager sind TWW und FW-Wasser
physisch voneinander getrennt.
Die Applikation kann eine unbegrenzte
Warmwassermenge mit konstanter
Temperatur liefern. Dieses TWW wird bei
Bedarf in der Nähe der Zapfstelle bereitet,
wodurch das Risiko einer Vermehrung von
Legionellen oder sonstigen Bakterien
reduziert wird.
Je nach gewünschtem TWW-Komfort und
dem verwendeten TWW-Regler können der
Wärmeübertrager und der Vorlauf
gehalten werden.
Die Regelung des Heizsystems erfolgt für
gewöhnlich durch einen elektronischen
Regler mit witterungsgeführter Temperaturregelung. Das TWW-System lässt sich
elektronisch oder selbsttätig regeln. Kleinere
Systeme werden üblicherweise selbsttätig
geregelt.
warm
Anwendungsbereiche:
Einfamilienhäuser
Mehrfamilienhäuser
Gewerbebauten
Typen von FW-Systemen:
PN 10 & 16 bar T ≤ 60 °C
PN 10 bar T ≤ 90 °C
PN 10 & 16 bar T ≤ 110 °C
PN 16 bar T ≤ 110 °C
PN 25 bar T ≤ 110 °C
Typische Märkte:
Nahezu alle Märkte
Page 55

Von Danfoss empfohlene
1.1 - b
Applikation 55
Regelungsoptionen
Elektronische Regelung
Ein elektronischer Regler kommt vor allem in Heizkörperanlagen und Fußbodenheizungen
zum Einsatz. Die primären Aufgaben dieses Reglers sind die witterungsgeführte
Regelung der Vorlauftemperatur, die periodische Rückstellung (Tag/Nacht) sowie die
Pumpensteuerung. Zu den typischen zusätzlichen Funktionen zählen die max. und min.
Begrenzung der Vorlauf- und Rücklauf-Temperaturen.
Selbsttätige Regelung
In kleinen TWW-Systemen kann man eine selbsttätige Regelung durch Temperatur-,
Durchfluss- oder Differenzdruckregelung bzw. durch eine Kombination dieser
Regelungsarten einsetzen.
Auch der Heizkreis lässt sich mit einer selbsttätigen Regelung durch Temperaturregler
ausrüsten.
Lösungen mit selbsttätiger Regelung werden vor allem in kleinen dezentralen
Fußbodenheizungen oder Klimaanlagen verwendet.
Beispiel für eine elektronische Regelung
Beispiel für eine selbsttätige Regelung
Page 56

Indirekt angeschlossene Raumheizung sowie
4. 1.1
Trinkwassererwärmung im Durchussprinzip
Wesentliche Vorteile der Applikation
Heizkreis
Eignung für Niedertemperatursysteme
Anpassung der Temperatur des Sekundärkreises an die Heizlast des Gebäudes
Leicht einzurichtende sicherheitstechnische Ausrüstung bei Hochtemperatur-
Fernwärmenetzen
Geringere Auswirkung von Leckagen im Gebäude: Die Leckage beschränkt sich
auf die Sekundärseite
Größeres Energiesparpotenzial wegen niedrigerer Oberflächentemperaturen der
Heizkörper und einheitlicherer Raumtemperaturen.
Minimiertes Risiko einer Kontaminierung des FW-Vorlaufwassers, weil es durch den
Wärmeübertrager vom Gebäudesystem getrennt ist.
Große Flexibilität hinsichtlich des Nenndrucks (PN) im Vorlauf des Fernwärmenetzes
Geeignet für den Einsatz von witterungsgeführten
TWW-Kreis
Niedrige TWW-Systemkosten
Kürzere Auslegungs- und Planungszeiten für Planer
Reduzierte Wartungskosten
Kompaktes und hocheffizientes Heizsystem
Niedrige Rücklauftemperatur und geringer Wärmeverlust in der Station
Eignung für Niedertemperatursysteme
Geringerer Platzbedarf im Vergleich zu den alternativen Applikationen
Unbegrenzte TWW-Menge – dank bedarfsgerechter Durchflusswassererwärmung
Geringeres Risiko von Bakterienvermehrung
elektronischen Reglern
.
Reduzierte hydraulische Last im Netz (für eine Gruppe von Verbrauchern)
Page 57

Von Danfoss empfohlene
Applikation
TWW- und Raumheizungsapplikationen
57
Heizung
Einsparung von Investitionskosten
Einsparungen bei der Installationszeit
Einsparungen beim Platzbedarf
Einsparungen bei Service-/Wartungsarbeiten
Energieezienz
Sicherer Systembetrieb
Verbraucherkomfort
1.1
Indirekt angeschlos-
sene Raumheizung
sowie TWW-
Bereitung im
Durchussprinzip
Indirekt
angeschlossene
Raumheizung
• • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • •
• • • • • • •
2.1
Direkt angeschlos-
sene Raumheizung
mit Mischkreis und
TWW-Bereitung im
Durchussprinzip
Direkt angeschlossene Raumheizung mit
Mischkreis
3.1
Direkt angeschlossene
Heizung und
TWW-Bereitung im
Durchussprinzip
Direkt
angeschlossene
Raumheizung
Trinkwarmwasser
Einsparung von Investitionskosten
Einsparungen bei der Installationszeit
Einsparungen beim Platzbedarf
Einsparungen bei Service-/Wartungsarbeiten
Energieezienz
Sicherer Systembetrieb
Verbraucherkomfort
TWW
Durchussprinzip
TWW-
Speicherladesystem
• • • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • •
• • • • • •
• • • • •
• • • • • • •
SWE
(Registerspeicher)
Page 58

Indirekt angeschlossene Raumheizung sowie
4. 1.1
Trinkwassererwärmung im Durchussprinzip
Belegte Vorteile
Heizkreis
Für den Betreiber des Fernwärmenetzes
Energieeffizienz:
Geringerer Wärmeverlust. Bei Installation von elektronischen Reglern mit witterungsgeführter
Temperaturregelung bedeutet jedes Grad, um das die Vorlauf- oder Rücklauftemperatur
gesenkt werden kann, eine Ersparnis von ca. 0,9% des Nettowärmeverlusts im Fernwärmenetz. Akkumulierte jährliche Einsparungen von bis zu 6% wurden in einem FW-System
dokumentiert.
Für den Gebäudeeigentümer und Endverbraucher
Energieeffizienz:
Energieeinsparungen. In einem Heizsystem mit elektronischem Regler und witterungsgeführter Temperaturregelung konnten Energieeinsparungen von 11 bis 15% (und in
einigen Fällen sogar mehr) in Einfamilienhäusern nachgewiesen werden. Literaturhinweis [1].
Literaturhinweis [1].
Verbraucherkomfort:
Erhöhter Komfort wegen der niedrigeren Oberflächentemperatur der Heizkörper und
wegen der konstanten Raumtemperaturen.
Literaturhinweis [1].
TWW-Kreis
Einsparung von Investitionskosten:
Die Applikation erfordert weniger Material. Im Vergleich zu Applikationen mit
Speicherladesystem – inklusive Ladespeicher, Pumpe und Fühler – werden die
Einsp arungen auf ca. 1.000 EUR geschätzt. In Mehrfamilienhäusern lassen sich noch
höhere Einsparungen erzielen.
Einsparungen beim Platzbedarf:
Kompakte Applikationen benötigen weniger Platz. Im Vergleich zu Applikationen
mit Speicherladesystem oder SWE (Registerspeicher) wird der eingesparte Platz auf 0,24
2
m
geschätzt. Bei einem Preis von 1.500 EUR/m2 belaufen sich die Einsparungen auf 360
EUR.
In Mehrfam ilienhäusern lassen sich noch höhere Einsparungen erzielen.
Literaturhinweis [3].
Einsparungen bei der Installationszeit:
Kürzere Installationszeit. Im Vergleich zu Applikationen mit Speicherladesystem lässt sich
die Installationszeit um ca. 3 Stunden verkürzen. Die geschätzten Einsparungen
sich auf 150 EUR (60 EUR/h). In Mehrfamilienhäusern lassen sich noch höhere
Einsparungen erzielen.
Einsparungen bei Service-/Wartungsarbeiten:
Geringere Systemwartungskosten. Im Vergleich zu Applikationen mit Speicherladesystem
und SWE (Registerspeicher) lassen sich die Servicearbeiten schätzungsweise um 2 Stunden
verkürzen.
Mehrfamilienhäusern lassen sich noch höhere Einsparungen erzielen. Literaturhinweis [2].
Die geschätzten Einsparungen belaufen sich auf 120 EUR (60 EUR/h).
Literaturhinweis [3].
Literaturhinweis [2].
belaufen
In
Energieeffizienz:
Geringerer Wärmeverlust. Im Vergleich zu Applikationen mit Speicherladesystem und SWE
(Registerspeicher) wird der Wärmeverlust halbiert. Ein um 75 W reduzierter Wärmeverlust
bedeutet eine Ersparnis von 36EUR/Jahr (55 EUR/MWh). In Mehrfamilienhäusern lassen
sich noch höhere Einsparungen erzielen.
Sicherer Systembetrieb:
Hinsichtlich der Bakterienvermehrung gestattet ein geringes Wasservolumen (weniger
als 3 Liter zwischen Wärmeübertrager und Wasserhahn) niedrigere Vorlauftemperaturen
und TWW-Temperaturen, was sich in einem geringeren Wärmeverlust im Fernwärmenetz niederschlägt.
Literaturhinweis [4].
Literaturhinweis [3].
Page 59

Von Danfoss empfohlene
Applikation 59
Salzburg (Österreich) – Mehrfamilienhäuser mit Fernwärme-Applikation
Einschränkungen der Applikation
Selbsttätige Regelung
• Keine periodische Rückstellung (zwischen Komfort- und Sparbetrieb)
• Großer Systemwärmeverlust, wenn die Vorlauftemperatur höher als der tatsächliche Bedarf ist.
• Kann nicht zusätzlich als Pumpensteuerung dienen
Heizkreis
• Teures Heizsystem
• Das Sekundärsystem erfordert ein Ausdehnungsgefäß.
TWW-Kreis
• Keine TWW-Versorgung bei Unterbrechung der FW-Versorgung
• Die Auslegungsleistung (m
mit Speicherladesystem und SWE (Registerspeicher). Für eine Gruppe von Verbrauchern
(typischerweise 10 bis
TWW-Bereitung im Durchflussprinzip
3
/h) pro Verbraucher auf der FW-Seite ist höher als bei Applikationen
30 Verbraucher) ist die Auslegungsleistung bei einer Applikation mit
jedoch geringer.
Page 60

4. 2.1 Primäre Alternative zur Applikation 1.1
2.1
Direkt angeschlossene
Raumheizung mit Mischkreis und
TWW Durchusssystem
Direkt angeschlossene Raumheizungsanwendung mit Mischkreis für Heizkörpersysteme, Fußbodenheizungen und
Klimaanlagen.
Trinkwassererwärmung im Durchflussprinzip mittels Wärmeübertrager.
Funktionsprinzip
Das Heizsystem ist per Mischkreis direkt an
das Fernwärmenetz angeschlossen.
direkt angeschlossene Applikationen
erhöht sich das Risiko einer Kontaminierung
des FW-Wassers sowie das Risiko einer
enormen Leckage in Gebäuden.
Die Sekundär-Vorlauftemperatur wird mithilfe
eines Mischkreises an den Wärmebedarf des
Gebäudes angepasst. Zur Vermeidung eines
„Rückflusses“ wird ein Rückschlagventil im
Mischkreis installiert. Darüber hinaus wird
ein Differenzdruckregler eingesetzt um den
Differenzdruck über die Heizkörperthermostatventile
Die Durchflusserwärmung des Trinkwassers
erfolgt mittels Wärmeübertrager. Durch
den
FW-Wasser
zu begrenzen.
Wärmeübertrager sind TWW und
physisch voneinander getrennt.
Durch
Die Applikation kann eine unbegrenzte
Warmwassermenge mit konstanter
Temperatur liefern. Dieses TWW wird
bei Bedarf in der Nähe der Zapfstelle
bereitet, wodurch das Risiko einer
Vermehrung von Legionellen oder
sonstigen Bakterien reduziert wird.
Je nach der gewünschten TWW-Komfortstufe
und dem verwendeten TWW-Regler können
der Wärmeübertrager und der Vorlauf
warm oder kalt gehalten werden.
Die Regelung des Heizsystems erfolgt für
gewöhnlich durch einen elektronischen Regler
mit witterungsgeführter Temperaturregelung.
Das TWW-System lässt sich elektronisch
oder selbsttätig regeln. Kleinere Systeme
werden üblicherweise selbsttätig geregelt.
Anwendungsbereiche:
Einfamilienhäuser
Mehrfamilienhäuser
Gewerbebauten
Typen von FW-Systemen:
PN 10 bar T ≤ 60 °C
PN 10 bar T ≤ 90 °C
Typische Märkte:
Dänemark, Niederlande und alle
Märkte für Sekundärsysteme
Einschränkungen der Applikation
Selbsttätige Regelung
• Keine periodische Rückstellung (zwischen Komfort- und Sparbetrieb)
• Großer Systemwärmeverlust, wenn die Vorlauftemperatur höher als der tatsächliche Bedarf ist.
• Kann nicht zusätzlich als Pumpensteuerung dienen
Heizkreis
• Das FW-Wasser wird nicht von dem Haussystem getrennt.
• Wenn das Primärwasser nicht richtig aufbereitet ist, besteht das Risiko von Korrosion im Haussystem.
• Risiko der Verunreinigung des FW-Wassers durch das Haussystem
• Potenzielles Risiko enormer Leckagen und des Austritts von FW-Wasser aus dem Haussystem
• Wenn die Wartung der Sekundärseite nicht ganz klar definiert ist, wird dieses System nicht empfohlen.
• Keine klare Definition der Leistungsbegrenzung, wenn kein Durchflussregler installiert ist.
TWW-Kreis
• Keine TWW-Versorgung bei Unterbrechung der FW-Versorgung
• Die Auslegungsleistung (m
(Registerspeicher).
3
/h) pro Verbraucher auf der FW-Seite ist höher als bei Applikationen mit Speicherladesystem und SWE
Page 61

61
4. 3.1 Sekundäre Alternative zur Applikation 1.1
3.1
Direkt angeschlossene
Raumheizung und TWWDurchusssystem
61
Direkt angeschlossene Heizungsanwendung
für Heizkörpersysteme, Fußbodenheizungen
und Klimaanlagen.
Trinkwassererwärmung im DurchflussPrinzip mittels Wärmeübertrager
Funktionsprinzip
Das Heizsystem ist direkt an das
Fernwärmenetz angeschlossen.
direkt angeschlossene Systeme erhöht
das Risiko einer Kontaminierung des
FW-Wassers sowie das Risiko einer enormen
Leckage in Gebäuden.
Die Durchflussregelung der HE-Temperatur
erfolgt mittels Heizkörperthermostat,
Rücklauf-Temperaturbegrenzer oder
Raumthermostat (das ein Zonenventil
steuert). Darüber hinaus wird ein
Differenzdruckregler eingesetzt um
den Differenzdruck über den Heizkörperthermostatventilen zu begrenzen.
Die Durchflusserwärmung des Trinkwassers
erfolgt
mittels Wärmeübertrager. Durch
den
Wärmeübertrager sind TWW und
Durch
sich
FW-Wasser
getrennt. Die Applikation kann eine
unbegrenzte Warmwassermenge mit
konstanter Temperatur liefern. Dieses
TWW wird bei Bedarf in der Nähe der
Zapfstelle bereitet, wodurch das Risiko
einer Vermehrung von Legionellen oder
sonstigen Bakterien reduziert wird.
Je nach der gewünschten TWW-Komfortstufe
und dem verwendeten TWW-Regler können
der Wärmeübertrager und der Vorlauf
warm oder kalt gehalten werden.
Das Heizsystem lässt sich nur selbsttätig
regeln. Die Regelung des TWW-Systems
erfolgt üblicherweise selbsttätig, lässt sich
aber auch elektronisch bewerkstelligen.
physisch voneinander
Anwendungsbereiche:
Einfamilienhäuser
Typen von FW-Systemen:
PN 10 bar T ≤ 60 °C
PN 10 bar T ≤ 90 °C
Typische Märkte:
Dänemark, Niederlande und alle
Märkte für Sekundärsysteme
Einschränkungen der Applikation
Heizkreis
• Eine Rücklauf-Temperaturbegrenzung ist nur mithilfe eines selbsttätigen Rücklauf-Temperaturbegrenzers möglich.
• Keine Möglichkeit, die Vorlauftemperaturen für das Gebäude zu verändern
• Wenn das FW-Wasser nicht gut aufbereitet ist, besteht das Risiko von Korrosion im Gebäudesystem.
• Risiko der Verunreinigung des FW-Wassers durch das Gebäudesystem
• Potenzielles Risiko einer enormen Leckage im Gebäude
• Wenn die Wartung der Sekundärseite nicht ganz klar definiert ist, wird dieses System nicht empfohlen.
• Keine klare Definition der Leistungsbegrenzung, wenn kein Durchflussregler installiert ist.
• Keine periodische Rückstellung (zwischen Komfort- und Sparbetrieb)
• Großer Systemwärmeverlust, wenn die Vorlauftemperatur höher als der tatsächliche Bedarf ist.
TWW-Kreis
• Keine TWW-Versorgung bei Unterbrechung der FW-Versorgung.
• Die Auslegungsleistung (m
(Registerspeicher).
3
/h) pro Verbraucher auf der FW-Seite ist höher als bei Applikationen mit Speicherladesystem und SWE
Page 62

Page 63

Seite 63 – 69
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.1 1.0 1.F 1.1 1.2 1.3 1.1.1 S.1. 2 S.1. 3
0.2 2.0 2.F 2.1 2.2 2.3 1.1.2
0.3 3.0 3.F 3.1 3.2 3.3
63
Übersicht
5. Direkt und indirekt angeschlossene
Raumheizung sowie TWW-Bereitung
mittels Speicherladesystem
Raumheizung und die TWW-Bereitung mittels
Speicherladesystem lassen sich kombinieren, indem sie
entweder indirekt oder direkt an das Fernwärmenetz
angeschlossen werden. Der direkte Anschluss kann mit oder
ohne Mischkreis vorgenommen werden.
1.2
Indirekt angeschlossene Heizung und Trinkwassererwärmung
mittels Speicherladesystem
2.2
Direkt angeschlossene Heizung mit Mischkreis und
Trinkwassererwärmung mittels Speicherladesystem
3.2 Direkt angeschlossene Heizung und Trinkwassererwärmung
mittels Speicherladesystem
Page 64

5. 1.2 Primäre Alternative
1.2
Indirekt angeschlossene
Heizung und Trinkwassererwärmung mittels
Speicherladesystem
Indirekt angeschlossene Heizungsanwendung für Heizkörpersysteme, Fußbodenheizungen und Klimaanlagen.
Die TWW-Applikation mit
Speicherladesystem eignet sich für
Applikationen mit zentralem Kessel oder
einem FW-Anschluss.
Funktionsprinzip
Das Fernwärmenetz und der Heizkreis
durch den Wärmeübertrager physisch
voneinander getrennt. Die Applikation
minimiert das Risiko einer Kontaminierung
des FW-Wassers sowie die Risiken und
Folgen von Leckagen in Wohnungen.
Die Sekundär-Vorlauftemperatur wird
an
den Wärmebedarf des Gebäudes
angepasst.
Wärmeübertrager
Speicherladesystem geleitet. Nach dem
Verbrauch der TWW-Kapazität wird Zeit
benötigt, um dieses wieder zu laden.
Bei einer kurzzeitigen Unterbrechung der
FW-Versorgung kann das Speicherladesystem
Das Trinkwasser wird in einem
erwärmt und in ein
sind
die verbliebene TWW-Kapazität bereitstellen.
Allerdings besteht in einem Ladespeicher
mit großem Fassungsvermögen das Risiko
einer verstärkten Bakterienvermehrung.
Hinsichtlich der Reinigungsintervalle müssen
die landesspezifischen Wartungsvorschriften
beachtet werden. Die Regelung des
Systems erfolgt für gewöhnlich durch
einen elektronischen Regler mit
witterungsgeführter Temperaturregelung.
Anwendungsbereiche:
Mehrfamilienhäuser
Gewerbebauten
Typen von FW-Systemen:
PN 10 & 16 bar T ≤ 110 °C
PN 16 bar T ≤ 110 °C
PN 25 bar T ≤ 110 °C
Typische Märkte:
Mitteleuropa
Page 65

Indirekt angeschlossene Heizung und Trinkwassererwärmung
mittels Speicherladesystem
65
London (Großbritannien): Mehrfamilienhäuser mit Heizung und TWW-Bereitung im Durchflussprinzip
Einschränkungen der Applikation
Heizkreis
• Teures System
• Das Sekundärsystem erfordert ein Ausdehnungsgefäß.
TWW-Kreis
• Höherer Systempreis im Vergleich zur TWW-Bereitung im Durchflussprinzip durch
die Kosten für Ladespeicher, Pumpe und Fühler.
• Begrenzte Kapazität
• Größeres Risiko verstärkter Bakterienvermehrung im Vergleich zur TWW-Bereitung
im Durchflussprinzip.
• Großer Platzbedarf
• Hoher Wärmeverlust durch die Installation
• Nicht geeignet für Niedertemperatursysteme
• Regelmäßige Wartung und Reinigung ist zwingend notwendig
• Höhere Primär-Rücklauftemperatur im Vergleich zur Applikation mit TWW-Bereitung
im Durchflussprinzip, allerdings eine niedrigere Primär-Rücklauftemperatur als die
TWW-Applikation mit SWE (Registerspeicher).
Page 66

5. 2.2 Primary alternative
5. 2.2
Direkt angeschlossene
Heizung mit Mischkreis
u. Trinkwassererwärmung
mittels Speicherladesystem
Direkt angeschlossene Raumheizung mit
Mischkreis für Heizkörpersysteme,
Fußbodenheizungen und Klimaanlagen.
Die TWW-Applikation mit Speicherladesystem eignet sich für Applikationen mit
zentralem Kessel oder einem FWAnschluss.
Funktionsprinzip
Das Heizsystem ist per Mischkreis direkt
an das Fernwärmenetz angeschlossen.
Durch direkt angeschlossene Applikationen
erhöht sich das Risiko einer Kontaminierung
des FW-Wassers sowie das Risiko einer
enormen Leckage in Gebäuden.
Die Sekundär-Vorlauftemperatur wird
mithilfe eines Mischkreises an den
Wärmebedarf des Gebäudes angepasst.
Zur Vermeidung eines „Rückflusses“
wird ein Rückschlagventil im Mischkreis
installiert. Darüber hinaus wird ein
Differenzdruckregler eingesetzt um
Differenzdruck über die Heizkörperthermostatventile
Das Trinkwasser wird in einem
Wärmeübertrager
Speicherladesystem geleitet.
zu begrenzen.
erwärmt und in ein
den
Nach dem Verbrauch der TWW-Kapazität
wird Zeit benötigt, um dieses wieder
laden.
Bei einer kurzzeitigen Unterbrechung der
FW-Versorgung kann das Speicherladesystem
die verbliebene TWW-Kapazität bereitstellen.
Allerdings besteht in einem Ladespeicher
mit
großem Fassungsvermögen das Risiko
einer
erhöhten Bakterienvermehrung.
Hinsichtlich
müssen die landesspezifischen
Wartungsvorschriften beachtet werden.
Die Regelung des Systems erfolgt
für gewöhnlich durch einen
witterungsgeführten elektronischen
Regler.
der Reinigungsintervalle
zu
Anwendungsbereiche:
Mehrfamilienhäuser
Gewerbebauten
Typen von FW-Systemen:
PN 10 bar T ≤ 90 °C
Typische Märkte:
Dänemark
Page 67

Direkt angeschlossene Heizung mit Mischkreis und
Trinkwassererwärmung mittels Speicherladesystem
67
Moskau (Russland) – Mehrfamilienhäuser mit Fernwärme-Applikation
Einschränkungen der Applikation
Heizkreis
• Das FW-Wasser wird nicht von dem Haussystem getrennt.
• Wenn das Primärwasser nicht richtig aufbereitet ist, besteht das Risiko von Korrosion
im Haussystem.
• Risiko der Verunreinigung des FW-Wassers durch das Haussystem
• Potenzielles Risiko enormer Leckagen und des Austritts von FW-Wasser aus dem
Haussystem
• Wenn die Wartung der Sekundärseite nicht ganz klar definiert ist, wird dieses System
nicht empfohlen.
• Keine klare Definition der Leistungsbegrenzung, wenn kein Durchflussregler
installiert ist.
TWW-Kreis
• Höherer Systempreis im Vergleich zur TWW-Bereitung im Durchflussprinzip durch
die Kosten für Ladespeicher, Pumpe und Fühler.
• Begrenzte Kapazität
• Größeres Risiko verstärkter Bakterienvermehrung im Vergleich zur TWW-Bereitung
im Durchflussprinzip.
• Großer Platzbedarf
• Hoher Wärmeverlust durch die Installation
• Nicht geeignet für Niedertemperatursysteme
• Regelmäßige Wartung und Reinigung ist zwingend notwendig
• Höhere Primär-Rücklauftemperatur im Vergleich zur Applikation mit TWW-Bereitung
im Durchflussprinzip, allerdings eine niedrigere Primär-Rücklauftemperatur als die
TWW-Applikation mit SWE (Registerspeicher).
Page 68

5. 3.2 Sekundäre Alternative
3.2
Direkt angeschlossene Heizung
und TWW-Applikation mit
Ladespeicher
Direkt angeschlossene Heizungsanwendung
für Heizkörpersysteme, Fußbodenheizungen
und Klimaanlagen.
Die TWW-Applikation mit Speicherladesystem eignet sich für Applikationen mit
zentralem Kessel oder einem FWAnschluss.
Funktionsprinzip
Das Heizsystem ist direkt an das
Fernwärmenetz angeschlossen. Durch
direkt angeschlossene Applikationen erhöht
sich das Risiko einer Kontaminierung des
FW-Wassers sowie das Risiko einer enormen
Leckage in Gebäuden.
Die Durchflussregelung der HE-Temperatur
erfolgt mittels Heizkörperthermostat,
Rücklauf-Temperaturbegrenzer oder
Raumthermostat (das ein Zonenventil
steuert). Darüber hinaus wird ein
Differenzdruckregler eingesetzt um
den Differenzdruck über die Heizkörperthermostatventile zu begrenzen.
Das Trinkwasser wird in einem
Wärmeübertrager erwärmt und in ein
Speicherladesystem geleitet. Nach dem
Verbrauch der TWW-Kapazität wird Zeit
benötigt, um dieses wieder zu laden.
Bei einer kurzzeitigen Unterbrechung
der FW-Versorgung kann das Speicherladesystem die verbliebene TWWKapazität bereitstellen.
Allerdings besteht in einem Ladespeicher
mit
großem Fassungsvermögen das Risiko
einer
erhöhten Bakterienvermehrung.
Hinsichtlich
müssen die landesspezifischen
Wartungsvorschriften beachtet werden.
Das Heizsystem lässt sich nur selbsttätig
regeln. Das TWW-System wird üblicherweise
selbsttätig geregelt.
der Reinigungsintervalle
Anwendungsbereiche:
Mehrfamilienhäuser
Gewerbebauten
Typen von FW-Systemen:
PN 10 bar T ≤ 90 °C
Typische Märkte:
Dänemark
Page 69

Tuzla (Bosnien & Herzegowina) – Mehrfamilienhäuser mit Fernwärme-Applikation
69Direkt angeschlossene Heizung und TWW-Applikation mit Ladespeicher
Einschränkungen der Applikation
Heizkreis
• Eine Rücklauf-Temperaturbegrenzung ist nur mithilfe eines selbsttätigen RücklaufTemperaturbegrenzers möglich.
• Keine Möglichkeit, die Vorlauftemperaturen für das Gebäude zu verändern
• Wenn das FW-Wasser nicht gut aufbereitet ist, besteht das Risiko von Korrosion im
Gebäudesystem.
• Risiko der Verunreinigung des FW-Wassers durch das Gebäudesystem
• Potenzielles Risiko einer enormen Leckage im Gebäude
• Wenn die Wartung der Sekundärseite nicht ganz klar definiert ist, wird dieses System
nicht empfohlen.
• Keine klare Definition der Leistungsbegrenzung, wenn kein Durchflussregler
installiert ist.
• Keine periodische Rückstellung (zwischen Komfort- und Sparbetrieb)
• Großer Systemwärmeverlust, wenn die Vorlauftemperatur höher als der tatsächliche
Bedarf ist.
TWW-Kreis
• Höherer Systempreis im Vergleich zur TWW-Bereitung im Durchflussprinzip durch
die Kosten für Ladespeicher, Pumpe und Fühler.
• Begrenzte Kapazität
• Größeres Risiko verstärkter Bakterienvermehrung im Vergleich zur TWW-Bereitung
im Durchflussprinzip.
• Großer Platzbedarf
• Hoher Wärmeverlust durch die Installation
• Nicht geeignet für Niedertemperatursysteme
• Regelmäßige Wartung und Reinigung ist zwingend notwendig
• Höhere Primär-Rücklauftemperatur im Vergleich zur Applikation mit
TWW-Erzeugung per Durchflusserwärmung, allerdings eine niedrigere
Primär-Rücklauftemperatur als die TWW-Applikation mit SWE (Registerspeicher).
Page 70

Page 71

Seite 71 – 77
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.1 1.0 1.F 1.1 1.2 1.3 1.1.1 S.1. 2 S.1. 3
0.2 2.0 2.F 2.1 2.2 2.3 1.1.2
0.3 3.0 3.F 3.1 3.2 3.3
71
Übersicht
6. Direkt und indirekt angeschlossene
Raumheizungen und Trinkwasserer wärmung mittels SWE (Registerspeicher)
Raumheizung und die TWW-Bereitung in einem
innenliegender Heizäche lassen sich kombinieren, indem sie
entweder indirekt oder direkt an das Fernwärmenetz
angeschlossen werden. Der direkte Anschluss kann mit oder
ohne Mischkreis vorgenommen werden.
1.3 Indirekt angeschlossene Heizung und TWW-Bereitung mittels
SWE (Registerspeicher)
Speicher mit
2.3
Direkt angeschlossene Heizung mit Mischkreis und TWW-
Bereitung mittels SWE (Registerspeicher)
3.3 Direkt angeschlossene Heizung und TWW-Bereitung mittels
SWE (Registerspeicher)
Page 72

6. 1.3 Sekundäre Alternative
Indirekt angeschlossene
Heizung und TWWApplikation mittels
SWE (Registerspeicher)
Indirekt angeschlossene Heizungsanwendung für Heizkörpersysteme, Fußbodenheizungen und Klimaanlagen.
Die TWW-Applikation mit
SWE (Registerspeicher) eignet sich für
Applikationen mit zentralem Kessel oder
einem FW-Anschluss.
Funktionsprinzip
Das Fernwärmenetz und der Heizkreis
durch den Wärmeübertrager physisch
voneinander getrennt.
Die Applikation minimiert das Risiko
einer Kontaminierung des FW-Wassers
sowie die Risiken und Folgen von
Leckagen in Wohnungen. Die SekundärVorlauftemperatur wird an den
Wärmebedarf des Gebäudes angepasst.
Das Trinkwasser wird in einem Speicher
durch eine innenliegende Heizfläche
erwärmt. Nach Verbrauch der TWWKapazität wird Zeit benötigt, um diesen
wieder zu laden.
Bei einer kurzzeitigen Unterbrechung der
FW-Versorgung kann der SWE
(Registerspeicher) die verbliebene
sind
TWW-Kapazität bereitstellen. Allerdings
besteht in einem SWE (Registerspeicher)
mit großem Fassungsvermögen das Risiko
einer verstärkten Bakterienvermehrung.
Hinsichtlich der Reinigungsintervalle
müssen die landesspezifischen
Wartungsvorschriften beachtet werden.
Diese Applikation wird üblicherweise
elektronisch geregelt, in Einfamilienhäusern
ist jedoch auch eine selbsttätige Regelung
möglich. Das TWW-System lässt sich
elektronisch oder selbsttätig regeln. Kleinere
Systeme werden üblicherweise selbsttätig
geregelt.
Anwendungsbereiche:
Einfamilienhäuser
Mehrfamilienhäuser
Gewerbebauten
Typen von FW-Systemen:
PN 10 bar T ≤ 90 °C
PN 10 & 16 bar T ≤ 110 °C
PN 16 bar T ≤ 110 °C
Typische Märkte:
Deutschland, Italien und Österreich
Page 73

Indirekt angeschlossene Heizung und TWW-Applikation mittels
SWE (Registerspeicher)
73
Linz (Österreich) – Mehrfamilienhäuser mit Fernwärmeversorgung
Einschränkungen der Applikation
Selbsttätige Regelung
• Keine periodische Rückstellung (zwischen Komfort- und Sparbetrieb)
• Großer Systemwärmeverlust, wenn die Vorlauftemperatur höher als der tatsächliche
Bedarf ist.
• Kann nicht zusätzlich als Pumpensteuerung dienen
Heizkreis
• Teures System
• Das Sekundärsystem erfordert ein Ausdehnungsgefäß.
TWW-Kreis
• Höherer Systempreis im Vergleich zur TWW-Bereitung im Durchflussprinzip durch die
Kosten für SWE (Registerspeicher) und Fühler
• Ineffektives Laden
• Begrenzte Kapazität
• Größeres Risiko verstärkter Bakterienvermehrung im Vergleich zur TWW-Bereitung im
Durchflussprinzip.
• Großer Platzbedarf
• Hoher Wärmeverlust durch die Installation
• Nicht geeignet für Niedertemperatursysteme
• Regelmäßige Wartung und Reinigung ist zwingend notwendig
• Sehr hohe Primär-Rücklauftemperatur im Vergleich zur Applikation mit
TWW-Bereitung im Durchflussprinzip und zur TWW-Applikation mit Speicherladesystem
Page 74

6. 2.3 Sekundäre Alternative
Direkt angeschlossene
Heizung
mit Mischkreis und
TWW-Applikation mittels
SWE (Registerspeicher)
Direkt angeschlossene
Raumheizungsanwendung mit
Mischkreis für Heizkörpersysteme,
Fußbodenheizungen und Klimaanlagen.
Die TWW-Applikation mit
SWE (Registerspeicher) eignet sich für
Applikationen mit zentralem Kessel oder
einem FW-Anschluss.
Funktionsprinzip
Das Heizsystem ist per Mischkreis direkt
an das Fernwärmenetz angeschlossen.
Durch direkt angeschlossene Applikationen
erhöht sich das Risiko einer Kontaminierung
des FW-Wassers sowie das Risiko einer
enormen Leckage in Gebäuden.
Die Sekundär-Vorlauftemperatur wird
mithilfe eines Mischkreises an den
Wärmebedarf des Gebäudes angepasst.
Zur Vermeidung eines „Rückflusses“ wird
ein Rückschlagventil im Mischkreis installiert.
Darüber hinaus wird ein Differenzdruckregler
eingesetzt um
Heizkörperthermostatventile zu begrenzen.
Das Trinkwasser wird in einem Speicher
durch eine innenliegende Heizfläche
erwärmt. Nach Verbrauch der TWW-
den Differenzdruck über
Kapazität wird Zeit
wieder zu laden.
Unterbrechung der FW-Versorgung kann
der SWE (Registerspeicher) die
verbliebene TWW-Kapazität bereitstellen.
Allerdings besteht in einem SWE
(Registerspeicher) mit großem
Fassungsvermögen das Risiko einer
verstärkten Bakterienvermehrung.
Hinsichtlich der Reinigungsintervalle müssen
die landesspezifischen Wartungsvorschriften
beachtet werden.
Diese Applikation wird üblicherweise
die
elektronisch geregelt, in Einfamilienhäusern
ist jedoch auch eine selbsttätige Regelung
möglich. Das TWW-System lässt sich
elektronisch oder selbsttätig regeln.
benötigt, um diesen
Bei einer kurzzeitigen
Anwendungsbereiche:
Einfamilienhäuser
Mehrfamilienhäuser
Gewerbebauten
Typen von FW-Systemen:
PN 10 bar T ≤ 90 °C
Typische Märkte:
Dänemark und alle Märkte für
Sekundärsysteme
Page 75

Direkt angeschlossene Heizung mit Mischkreis und
TWW-Applikation mittels SWE (Registerspeicher)
75
Bukarest (Rumänien) – Mehrfamilienhäuser und Gewerbebauten mit Fernwärmeversorgung
Einschränkungen der Applikation
Selbsttätige Regelung
• Keine periodische Rückstellung (zwischen Komfort- und Sparbetrieb)
• Großer Systemwärmeverlust, wenn die Vorlauftemperatur höher als der tatsächliche
Bedarf ist.
• Kann nicht zusätzlich als Pumpensteuerung dienen
Heizkreis
• Das FW-Wasser wird nicht von dem Haussystem getrennt.
• Wenn das Primärwasser nicht richtig aufbereitet ist, besteht das Risiko von Korrosion im
Haussystem.
• Risiko der Verunreinigung des FW-Wassers durch das Haussystem
• Potenzielles Risiko enormer Leckagen und des Austritts von FW-Wasser aus dem
Haussystem
• Wenn die Wartung der Sekundärseite nicht ganz klar definiert ist, wird dieses System
nicht empfohlen.
• Keine klare Definition der Leistungsbegrenzung, wenn kein Durchflussregler installiert
ist.
TWW-Kreis
• Höherer Systempreis im Vergleich zur TWW-Bereitung im Durchflussprinzip durch die
Kosten für SWE (Registerspeicher) und Fühler
• Ineffektives Laden
• Begrenzte Kapazität
• Größeres Risiko verstärkter Bakterienvermehrung im Vergleich zur TWW-Bereitung im
Durchflussprinzip.
• Großer Platzbedarf
• Hoher Wärmeverlust durch die Installation
• Nicht geeignet für Niedertemperatursysteme
• Regelmäßige Wartung und Reinigung ist zwingend notwendig
• Sehr hohe Primär-Rücklauftemperatur im Vergleich zur Applikation mit
TWW-Bereitung im Durchflussprinzip und zur TWW-Applikation mit Speicherladesystem
Page 76

6. 3.3 Applikation wird nicht empfohlen
3.3
Direkt angeschlossene
Heizung und TWWApplikation mittels
SWE (Registerspeicher)
Direkt angeschlossene Heizungsanwendung
für Heizkörpersysteme, Fußbodenheizungen
und Klimaanlagen.
Die TWW-Applikation mit
SWE (Registerspeicher) eignet sich für
Applikationen mit zentralem Kessel
oder einem FW-Anschluss.
Funktionsprinzip
Das Heizsystem ist direkt an das
Fernwärmenetz
direkt angeschlossene Applikationen erhöht
sich das Risiko einer Kontaminierung des
FW-Wassers sowie das Risiko einer enormen
Leckage in Gebäuden.
Die Durchflussregelung der HE-Temperatur
erfolgt mittels Heizkörperthermostat,
Rücklauf-Temperaturbegrenzer oder
Raumthermostat (das ein Zonenventil
steuert). Darüber hinaus wird ein
Differenzdruckregler zur Begrenzung des
Differenzdrucks über den Temperaturreglern
an den Heizkörpern benötigt.
Das Trinkwasser wird in einem Speicher
durch eine innenliegende Heizfläche
erwärmt. Nach Verbrauch der TWW-
angeschlossen. Durch
Kapazität wird Zeit benötigt, um diesen
wieder zu laden.
Bei einer kurzzeitigen Unterbrechung der
FW-Versorgung kann der SWE
(Registerspeicher) die verbliebene
TWW-Kapazität bereitstellen. Allerdings
besteht in einem SWE (Registerspeicher)
mit großem Fassungsvermögen das Risiko
einer verstärkten Bakterienvermehrung.
Hinsichtlich der Reinigungsintervalle
müssen die landesspezifischen
Wartungsvorschriften beachtet werden.
Das Heizsystem lässt sich nur selbsttätig
regeln. Das TWW-System wird üblicherweise
selbsttätig geregelt, lässt sich aber auch
elektronisch regeln.
Anwendungsbereiche:
Einfamilienhäuser
Typen von FW-Systemen:
PN 10 bar T ≤ 90 °C
Typische Märkte:
Dänemark und alle Märkte für
Sekundärsysteme
Page 77
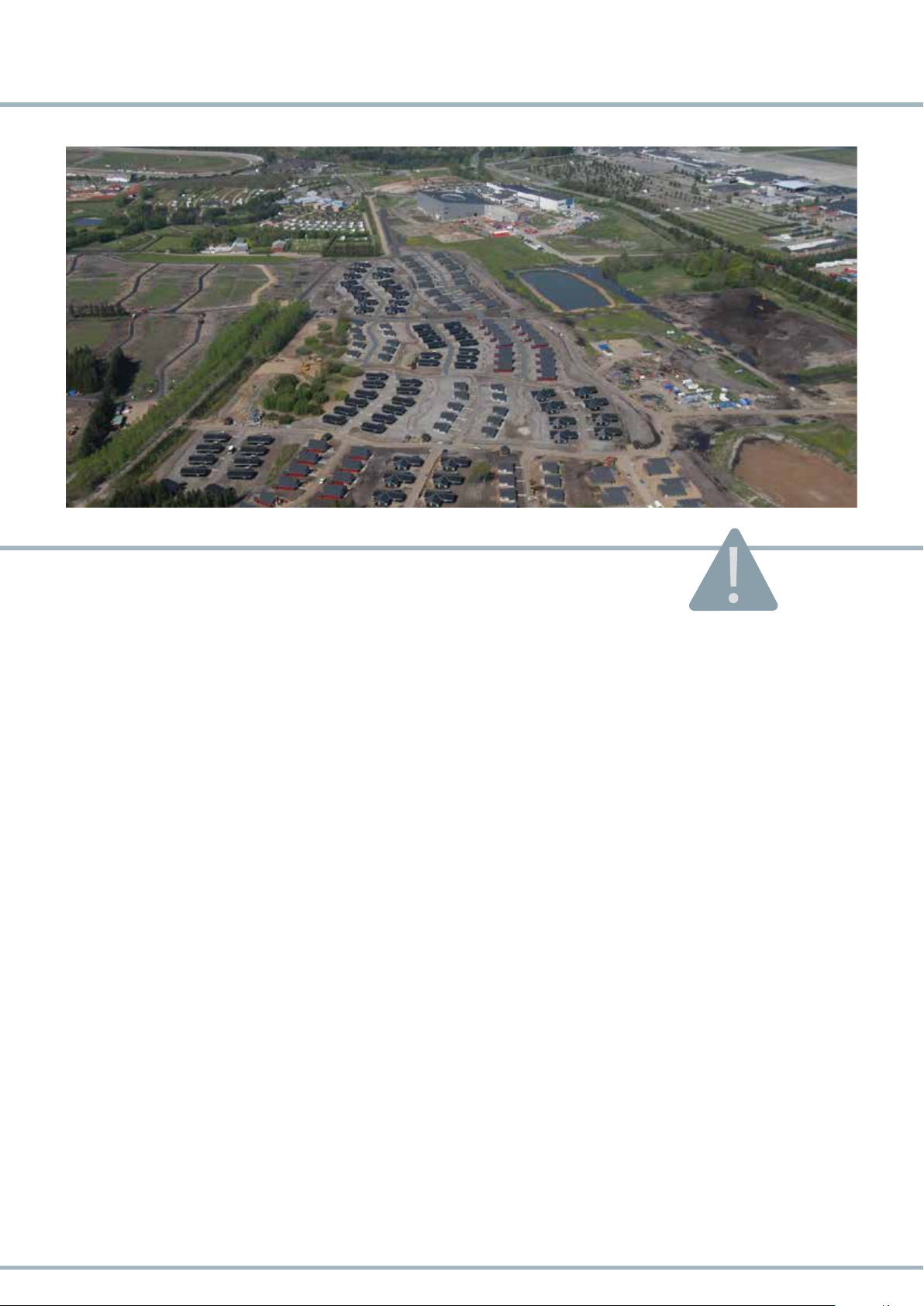
Direkt angeschlossene Heizung und TWW-Applikation mittels
SWE (Registerspeicher)
77
Billund (Dänemark) – Einfamilienhäuser mit Fernwärmeversorgung
Einschränkungen der Applikation
Heizkreis
• Eine Rücklauf-Temperaturbegrenzung ist nur mithilfe eines selbsttätigen Rücklauf-
Temperaturbegrenzers möglich.
• Keine Möglichkeit, die Vorlauftemperaturen für das Gebäude zu verändern
• Wenn das FW-Wasser nicht richtig aufbereitet ist, besteht das Risiko von Korrosion im
Gebäudesystem.
• Risiko der Verunreinigung des FW-Wassers durch das Gebäudesystem
• Potenzielles Risiko einer enormen Leckage im Gebäude
• Wenn die Wartung der Sekundärseite nicht ganz klar definiert ist, wird dieses System
nicht empfohlen.
• Keine klare Definition der Leistungsbegrenzung, wenn kein Durchflussregler installiert
ist.
• Keine periodische Rückstellung (zwischen Komfort- und Sparbetrieb)
• Großer Systemwärmeverlust, wenn die Vorlauftemperatur höher als der tatsächliche
Bedarf ist.
TWW-Kreis
• Höherer Systempreis im Vergleich zur TWW-Bereitung im Durchflussprinzip durch die
Kosten für SWE (Registerspeicher) und Fühler
• Ineffektives Laden
• Begrenzte Kapazität
• Größeres Risiko verstärkter Bakterienvermehrung im Vergleich zur TWW-Bereitung im
Durchflussprinzip
• Großer Platzbedarf
• Hoher Wärmeverlust durch die Installation
• Nicht geeignet für Niedertemperatursysteme
• Regelmäßige Wartung und Reinigung ist zwingend notwendig
• Sehr hohe Primär-Rücklauftemperatur im Vergleich zur Applikation mit
TWW-Bereitung im Durchflussprinzip und zur TWW-Applikation mit Speicherladesystem
Page 78

Page 79

Seite 79 – 83
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.1 1.0 1.F 1.1 1.2 1.3 1.1.1 S.1. 2 S.1. 3
0.2 2.0 2.F 2.1 2.2 2.3 1.1.2
0.3 3.0 3.F 3.1 3.2 3.3
79
Übersicht
7. Zweistuge Applikationen
Der Unterschied zwischen zweistugen Applikationen und
den vorherigen Applikationen besteht darin, dass bei der
TWW-Bereitung das Trinkkaltwasser vom Fernwärmerücklauf
vorgewärmt wird, bevor es vom Fernwärmevorlauf
vollständig erwärmt wird. Darüber hinaus kann das TWW
im Durchussprinzip bereitet oder in einen Ladespeicher
geladen werden.
1.1.1 Indirekt angeschlossene Heizung und Trinkwassererwärmung im
Durchussprinzip
1.1.2 Indirekt angeschlossene Heizung und Trinkwassererwärmung
im Durchussprinzip und Speicherladesystem
Page 80

7. 1.1.1 Primäre Alternative
Indirekt angeschlossene
zweistuge Heizung und
Trinkwassererwärmung im
Durchussprinzip
Indirekt angeschlossene zweistufige
Heizungsanwendung für Heizkörpersysteme,
Fußbodenheizungen und Klimaanlagen.
TWW-Bereitung im Durchflussprinzip
mittels Wärmeübertrager.
Funktionsprinzip
Das Fernwärmenetz und der Heizkreis
durch den Wärmeübertrager physisch
voneinander getrennt. Die Applikation
minimiert das Risiko einer Konta mi nierung des FW-Wassers sowie die Risiken
und Folgen von Leckagen in Wohnungen.
Die Sekundär-Vorlauf temperatur wird an
den Wärmebedarf des Gebäudes
angepasst.
Das TWW wird mit einem zweistufigen
Wärmeübertrager bereitet. Im ersten
Abschnitt des Wärmeübertragers wird der
Rücklauf aus dem HE-Wärmeübertrager
zur Vorwärmung des Trinkkaltwassers
(TKW) sowie zur weiteren Absenkung der
Rücklauftemperatur verwendet.
Im zweiten Teil wird ein FW-Vorlaufvolumen
strom verwendet, um die für das Erreichen
der gewünschten TWW-Temperatur
erforderliche Wärmemenge zuzuführen.
Um eine stabile TWW-Temperatur bei Teillast
zu gewährleisten, muss das System
sind
unbedingt mit einem Differenzdruckregler
ausgestattet werden.
Das TWW-Volumen ist im Vergleich zu
Applikationen mit Speicherladesystem
oder SWE (Registerspeicher) begrenzt.
2-stufige Systeme sind nur im Winter von
Vorteil, wenn das TKW auf ein Niveau
zwischen 35 und 40°C vorgewärmt werden
kann. Dann muss der zweite Teil des
Wärmeübertragers die TWW-Temperatur
nur von diesem Niveau auf die gewünschte
TWW-Temperatur erhöhen.
Das System wird elektronisch geregelt.
Aus Komfort- und Energiespargründen
wird für Fußbodenheizungen und
-
Heizkörperanwendungen ein elektronischer
Regler mit witterungsgeführter
Temperaturregelung empfohlen.
Anwendungsbereiche:
Mehrfamilienhäuser
Gewerbebauten
Typen von FW-Systemen:
PN 10 & 16 bar T ≤ 110 °C
PN 16 bar T ≤ 110 °C
PN 25 bar T ≤ 110 °C
Typische Märkte:
Schweden, Finnland, Mittel- und
Osteuropa
Page 81

Indirekt angeschlossene zweistuge Heizung und
Trinkwassererwärmung im Durchussprinzip
81
Changchun (China) – Mehrfamilienhäuser und Gewerbebauten mit FW-Versorgung
Einschränkungen der Applikation
• Im Jahresdurchschnitt lassen sich mit zweistufigen Systemen um 1 bis 2°C niedrigere
mittlere Rücklauftemperaturen erzielen als mit einstufigen Parallelsystemen, was
darauf hindeutet, dass es wichtiger sein könnte, das Heizsystem eines Gebäudes
zu optimieren, anstatt den teureren zweistufigen Systemen den Vorzug zu geben.
Literaturverweis [6].
• Die typische Auslegungs-Rücklauftemperatur sollte mindestens 50°C betragen, aus
Gründen der TWW-Sicherheit jedoch nicht mehr als 65°C.
• Das typische Leistungsverhältnis zwischen TWW und HE – Q(TWW)/Q(HE) – sollte im
Bereich zwischen 1:1 und 1:3 liegen und zudem von den Temperaturen abhängig sein.
• Hoher Systempreis
Heizkreis
• Das Sekundärsystem erfordert ein Ausdehnungsgefäß.
TWW-Kreis
• Keine TWW-Versorgung bei Unterbrechung der FW-Versorgung.
• Die Auslegungsleistung (m
Applikationen mit Speicherladesystem und SWE (Registerspeicher).
• Risiko von Temperaturschwankungen bei geringer Last wegen Betätigung des
Regelventils bei niedrigen Öffnungsgraden
• Es ist für den Regler schwierig, eine konstante TWW-Temperatur zu halten – und zwar
wegen des Einflusses der TWW-Last und wegen der Rücklauf- und Vorlauftemperatur
des Heizkreises.
3
/h) pro Verbraucher auf der FW-Seite ist höher als bei
Page 82

7. 1.1.2 Primäre Alternative
Indirekt angeschlossene
zweistuge Heizung
und TWW-Applikation
mit Speicherladesystem
Indirekt angeschlossene zweistufige
Heizung und TWW-Applikation mit
Speicherladesystem
Funktionsprinzip
Das Fernwärmenetz und der Heizkreis
durch den Wärmeübertrager physisch
voneinander getrennt. Die Applikation
minimiert das Risiko einer Kontaminierung des FW-Wassers sowie die Risiken
und Folgen von Leckagen in Wohnungen.
Die Sekundär-Vorlauf temperatur wird an
den Wärmebedarf des Gebäudes
angepasst.
Das TWW wird mit einem zweistufigen
Wärmeübertrager bereitet. Im ersten
Abschnitt des Wärmeübertragers wird der
Rücklauf aus dem HE-Wärmeübertrager
zur Vorwärmung des Trinkkaltwassers
(TKW) sowie zur weiteren Absenkung der
Rücklauftemperatur verwendet.
Im zweiten Teil wird ein FW-Vorlaufvolumenstrom verwendet, um
die für das Erreichen der gewünschten
TWW-Temperatur im Speicherladesystem
erforderliche Wärmemenge zuzuführen.
Nach dem Verbrauch der TWW-Kapazität
wird Zeit benötigt, um dieses wieder zu
laden.
sind
die verbliebene TWW-Kapazität bereitstellen.
Allerdings besteht in einem Ladespeicher
mit
großem Fassungsvermögen das Risiko
einer
erhöhten Bakterienvermehrung.
Hinsichtlich
müssen die landesspezifischen
Wartungsvorschriften beachtet werden.
Um eine stabile TWW-Temperatur bei
Teillast zu gewährleisten, muss das System
unbedingt mit einem Differenzdruckregler
ausgestattet werden. 2-stufige Systeme
sind nur im Winter von Vorteil, wenn das
TKW auf ein Niveau zwischen 35 und 40°C
vorgewärmt werden kann. Dann muss
der zweite Teil des Wärmeübertragers die
TWW-Temperatur nur von diesem Niveau
auf die gewünschte TWW-Temperatur
erhöhen.
Das System wird selbsttätig geregelt.
Aus Komfort- und Energiespargründen
wird für Fußbodenheizungen und
Heizkörperanwendungen ein witterungsgeführter elektronischer
empfohlen.
der Reinigungsintervalle
Regler
Anwendungsbereiche:
Mehrfamilienhäuser
Gewerbebauten
Typen von FW-Systemen:
PN 10 & 16 bar T ≤ 110 °C
PN 16 bar T ≤ 110 °C
PN 25 bar T ≤ 110 °C
Typische Märkte:
Mitteleuropa
Bei einer kurzzeitigen Unterbrechung der
FW-Versorgung kann das Speicherladesystem
Page 83
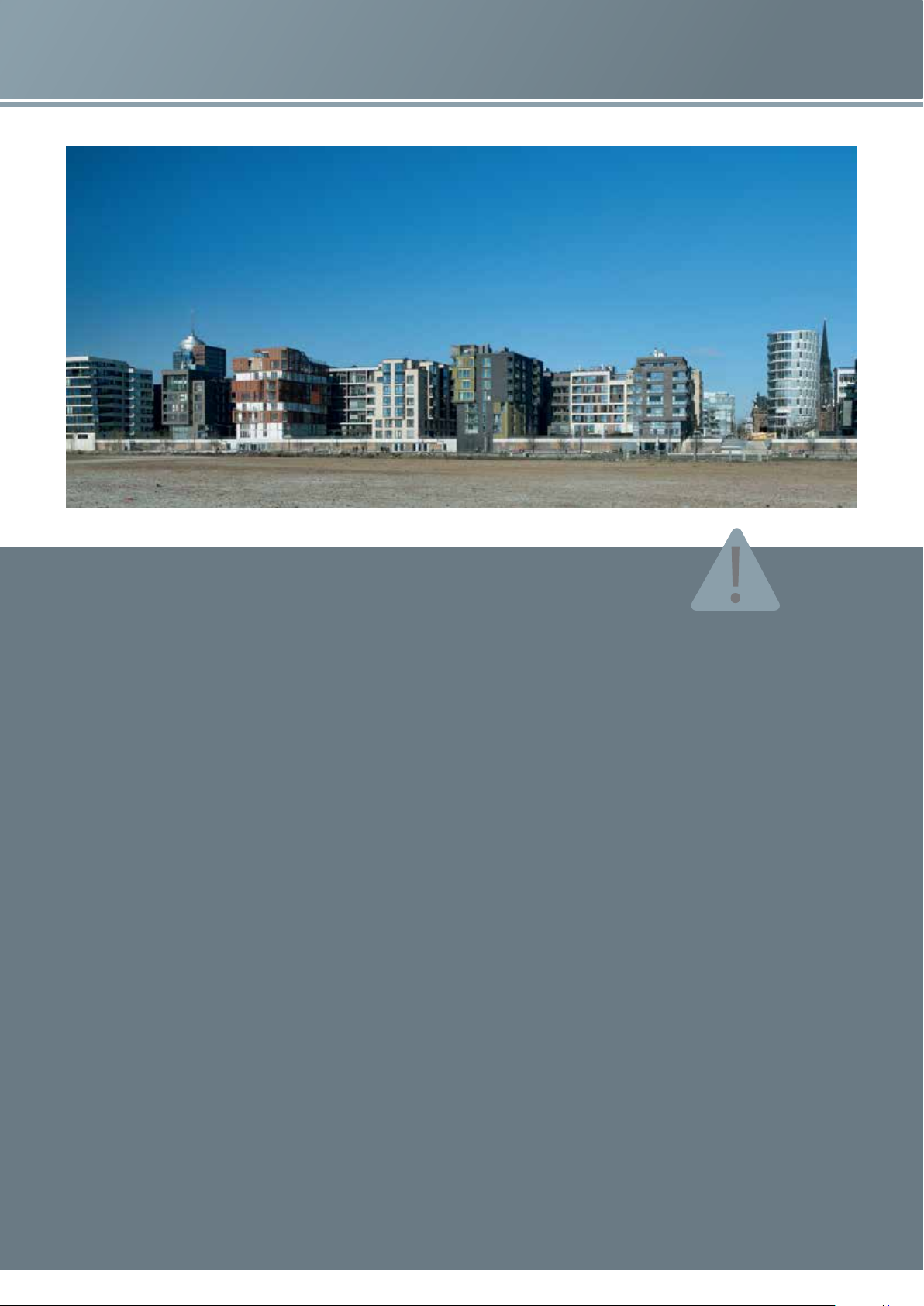
Indirekt angeschlossene zweistuge Heizung und
TWW-Applikation mit Speicherladesystem
83
Hamburg (Deutschland) – Mehrfamilienhäuser und Gewerbebauten mit Heizung und TWW-Bereitung im Durchflussprinzip
Einschränkungen der Applikation
• Die mittlere jährliche Rücklauftemperatur eines zweistufigen Systems mit
Speicherladesystem ist sogar noch niedriger als ohne Speicherladesystem. Allerdings
könnten die Kosten für Ladespeicher, Pumpe und Fühler sowie die allgemeinen
Servicekosten die Vorteile des reduzierten Wärmeverlusts aufwiegen. Das deutet
daraufhin, dass es wichtiger sein könnte, das Heizsystem zu optimieren, anstatt dem
teureren 2-stufigen System den Vorzug zu geben.
• Die typische Auslegungs-Rücklauftemperatur sollte mindestens 50°C betragen, aus
Sicherheitsgründen jedoch nicht mehr als 65°C.
• Das typische Leistungsverhältnis zwischen TWW und HE – Q(TWW)/Q(HE)
Bereich zwischen 1:1 und 1:3 liegen, ist aber auch von den Temperaturen abhängig.
• Hoher Systempreis
Heizkreis
• Das Sekundärsystem erfordert ein Ausdehnungsgefäß.
TWW-Kreis
• Hoher Differenzdruck (ΔP) über dem Trinkwasser-Wärmeübertrager
• Risiko von TWW-Temperaturschwankungen bei geringer Last wegen Betätigung des
Regelventils bei niedrigen Öffnungsgraden
• Es ist für den Regler schwierig, eine konstante TWW-Temperatur zu halten und zwar
wegen des Einflusses der TWW-Last und wegen der Rücklauf- und Vorlauftemperatur
des Heizkreises.
• Höherer Systempreis im Vergleich zur TWW-Erzeugung per Durchflusserwärmung
durch die Kosten für Ladespeicher, Pumpe und Fühler.
• Begrenzte Kapazität
• Größeres Risiko verstärkter Bakterienvermehrung im Vergleich zur TWW-Bereitung
im Durchflussprinzip
• Großer Platzbedarf
• Hoher Wärmeverlust durch die Installation
• Nicht geeignet für Niedertemperatursysteme
• Regelmäßige Wartung und Reinigung sind zwingend notwendig.
• Hohe Primär-Rücklauftemperatur im Vergleich zur Applikation mit TWW-Bereitung
im Durchflussprinzip, allerdings eine niedrigere Primär-Rücklauftemperatur als die
TWW-Applikation mit SWE (Registerspeicher)
– sollte im
Page 84

Page 85

Seite 85 – 87
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.1 1.0 1.F 1.1 1.2 1.3 1.1.1 S.1. 2 S.1. 3
0.2 2.0 2.F 2.1 2.2 2.3 1.1.2
0.3 3.0 3.F 3.1 3.2 3.3
85
Übersicht
8. Indirekt angeschlossene Raumheizung mit
sekundärseitig angeschlossenem
Speicherladesystem (Applikation S.1.2)
Bei der indirekt angeschlossenen Raumheizung mit
sekundärseitig angeschlossenem TWW-Speicherladesystem
handelt es sich um eine Variante der direkt angeschlossenen
Raumheizung mit TWW-Ladespeicher (Applikation 5.1.2) – nur
dass in diesem Fall das Gebäude durch einen Wärmeübertrager
vom FW-Netz getrennt ist und dass die TWW-Bereitung auf
der Sekundärseite erfolgt.
Diese Applikation kommt üblicherweise zum Einsatz, wenn
eine doppelte Trennung zwischen dem Fernwärmewasser
und dem Trinkwarmwasser erforderlich ist.
Page 86

8. S.1.2 Sekundäre Alternative
S.1.2
Indirekt angeschlossene
Heizung und sekundärseitig
angeschlossenes TWWSpeicherladesystem
*
Indirekt angeschlossene Heizungsanwendung für Heizkörpersysteme, Fußbodenheizungen und Klimaanlagen.
Die (sekundärseitig angeschlossene)
TWW-Applikation mit Speicherladesystem
eignet sich für Applikationen mit zentralem
Kessel oder einem FW-Anschluss.
1
1
*
Anwendungsabhängig auch als Kombiventil möglich
Funktionsprinzip
Das Fernwärmenetz und der Heizkreis
durch den Wärmeübertrager physisch
voneinander getrennt.
Die Applikation minimiert das Risiko
einer Kontaminierung des FW-Wassers
sowie die Risiken und Folgen von
Leckagen in Wohnungen. Die SekundärVorlauftemperatur wird an den Wärmebedarf des Gebäudes angepasst.
Dennoch muss eine minimale Vorlauftemperatur für das Speicherladesystem
bereitgestellt werden.
Das Trinkwasser wird im Sekundärkreis mit
einem
Wärmeübertrager erwärmt und in
ein Speicherladesystem geleitet. Nach
dem Verbrauch der TWW-Kapazität wird
Zeit benötigt, um dieses wieder zu laden.
Bei einer kurzzeitigen Unterbrechung der
FW-Versorgung kann das Speicherladesystem
die verbliebene TWW-Kapazität bereitstellen.
Allerdings besteht in einem Ladespeicher
mit
großem Fassungsvermögen das Risiko
einer
erhöhten Bakterienvermehrung.
Hinsichtlich
der Reinigungsintervalle
sind
müssen die landesspezifischen
Wartungsvorschriften beachtet werden.
Eine Warmwasserpriorität lässt sich mit
unterschiedlichen Regeloptionen erzielen,
bspw. durch Pumpen oder einem
3-Wege- Ventil (Ein/Aus-Ventil).
Dieses System wird im Allgemeinen
verwendet, wenn die Heizkostenumlegung
von der für das jeweilige Heizsystem
erforderlichen Leistung abhängig ist.
Dieses System lässt sich nur elektronisch
regeln. Aus Komfort- und Energiespargründen wird für Fußbodenheizungen und
Heizkörperanwendungen ein witterungsgeführter elektronischer
Diese Applikation kommt üblicherweise zum
Einsatz, wenn Sicherheitsthermostate
benötigt werden. Sie kann aber auch
verwendet werden, wenn eine doppelte
Trennung von FW-Wasser und TWW
erforderlich ist.
Regler
empfohlen.
Anwendungsbereiche:
Mehrfamilienhäuser
Gewerbebauten
Typen von FW-Systemen:
PN 16 bar T ≤ 110 °C
PN 25 bar T ≤ 110 °C
Typische Märkte:
Deutschland, Italien und Österreich
Page 87

Indirekt angeschlossene Heizung und sekundärseitig
angeschlossenes TWW-Speicherladesystem
87
München (Deutschland) – Gewerbebau mit Heizung und TWW-Bereitung
Einschränkungen der Applikation
• Hoher Systempreis, wenn keine Priorität zwischen TWW und HE festgelegt wird.
Heizkreis
• Das Sekundärsystem erfordert ein Ausdehnungsgefäß.
TWW-Kreis
• Höherer Systempreis im Vergleich zur TWW-Bereitung im Durchflussprinzip durch
die Kosten für Ladespeicher, Pumpe und Fühler.
• Begrenzte Kapazität
• Größeres Risiko verstärkter Bakterienvermehrung im Vergleich zur TWW-Bereitung
im Durchflussprinzip.
• Großer Platzbedarf
• Hoher Wärmeverlust durch die Installation
• Nicht geeignet für Niedertemperatursysteme
• Regelmäßige Wartung und Reinigung sind zwingend notwendig.
• Höhere Primär-Rücklauftemperatur im Vergleich zur Applikation mit TWW-Bereitung
im Durchflussprinzip, allerdings eine niedrigere Primär-Rücklauftemperatur als bei
der TWW-Applikation mit SWE (Registerspeicher)
• Wegen der Wärmeübertragung durch die beiden Wärmeübertrager wird die
Rücklauftemperatur des TWW-Systems im Vergleich zum Parallelsystem höher sein.
Page 88

Page 89

Seite 89 – 91
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0.1 1.0 1.F 1.1 1.2 1.3 1.1.1 S.1. 2 S.1. 3
0.2 2.0 2.F 2.1 2.2 2.3 1.1.2
0.3 3.0 3.F 3.1 3.2 3.3
89
Übersicht
9. Indirekt angeschlossene Raumheizung
mit sekundärseitig angeschlossenem
SWE (Registerspeicher) (Applikation S.1.3)
Bei der indirekt angeschlossenen Raumheizung mit
sekundärseitig angeschlossenem SWE (Registerspeicher)
handelt es
Raumheizung
– nur dass in diesem Fall das Gebäude durch einen
Wärmeübertrager vom FW-Netz
TWW-Bereitung auf der Sekundärseite
Diese Applikation kommt üblicherweise zum Einsatz, wenn
eine doppelte Trennung zwischen dem Fernwärmewasser und
dem Trinkwarmwasser erforderlich ist.
sich um eine Variante der direkt angeschlossenen
mit SWE (Registerspeicher) (Applikation 6.1.3)
getrennt ist und dass die
erfolgt.
Page 90

9. S.1.3 Sekundäre Alternative
S.1.3
Indirekt angeschlossene
Heizung und sekundärseitig
angeschlossenem
SWE (Registerspeicher)
Indirekt angeschlossene Heizungsanwendung für Heizkörpersysteme, Fußbodenheizungen und Klimaanlagen.
Die (sekundärseitig angeschlossene)
TWW-Applikation mit SWE (Registerspeicher)
wird in der Regel für Kesselsysteme
verwendet, kann
angeschlossen
aber auch an ein FW-System
werden.
Funktionsprinzip
Das Fernwärmenetz und der Heizkreis
durch den Wärmeübertrager physisch
voneinander getrennt. Die Applikation
minimiert das Risiko einer Kontaminie
rung des FW-Wassers sowie die Risiken
und Folgen von Leckagen in Wohnungen.
Die Sekundär-Vorlauftemperatur wird an
den Wärmebedarf des Gebäudes
angepasst. Dennoch muss eine minimale
Vorlauftemperatur für den SWE (Register
speicher) bereitgestellt werden.
Das Trinkwasser wird im Sekundärkreis in
einem Speicher durch eine innenliegende
Heizfläche erwärmt. Nach dem Verbrauch
der TWW-Kapazität wird Zeit benötigt,
um diesen wieder zu laden. Bei einer
kurzzeitigen Unterbrechung der FWVersorgung kann der SWE
(Registerspeicher) die verbliebene
TWW-Kapazität bereitstellen. Allerdings
besteht in einem SWE (Registerspeicher)
mit großem Fassungsvermögen das Risiko
einer verstärkten Bakterienvermehrung.
sind
-
Hinsichtlich der Reinigungsintervalle müssen
die landesspezifischen Wartungsvorschriften
beachtet werden. Eine Warmwasserpriorität
lässt sich mit unterschiedlichen Regeloptionen erzielen, bspw. durch Pumpen
oder ein 3-Wege-Ventil (Ein/Aus-Ventil).
Dieses System wird im Allgemeinen
verwendet,
von der für das System erforderlichen
Leistung abhängig ist.
Dieses System lässt sich nur elektronisch
regeln. Aus Komfort- und Energiespargründen wird für Fußbodenheizungen
und Heizkörperanwendungen ein elektronischer Regler mit witterungsgeführter
Temperaturregelung empfohlen. Diese
Applikation kommt üblicherweise zum
Einsatz, wenn Sicherheitsthermostate
benötigt werden. Sie kann aber auch
verwendet werden, wenn eine doppelte
Trennung von FW-Wasser und TWW
erforderlich ist.
1
*
1
*
Anwendungsabhängig auch als Kombiventil möglich
wenn die Heizkostenumlegung
Anwendungsbereiche:
Mehrfamilienhäuser
Gewerbebauten
Typen von FW-Systemen:
PN 16 bar T ≤ 110 °C
PN 25 bar T ≤ 110 °C
Typische Märkte:
Deutschland, Italien und Österreich
Page 91

Indirekt angeschlossene Heizung und sekundärseitig
angeschlossenem SWE (Registerspeicher)
91
Walz (Österreich) – Mehrfamilienhäuser mit Fernwärme-Applikation
Einschränkungen der Applikation
• Hoher Systempreis, wenn keine Priorität zwischen TWW und HE festgelegt wird.
Heizkreis
• Das Sekundärsystem erfordert ein Ausdehnungsgefäß.
TWW-Kreis
• Höherer Systempreis im Vergleich zur TWW-Bereitung im Durchflussprinzip durch
die Kosten für SWE (Registerspeicher) und Fühler
• Ineffektives Laden
• Begrenzte Kapazität
• Größeres Risiko verstärkter Bakterienvermehrung im Vergleich zur TWW-Bereitung
im Durchflussprinzip
• Großer Platzbedarf
• Hoher Wärmeverlust durch die Installation
• Nicht geeignet für Niedertemperatursysteme
• Regelmäßige Wartung und Reinigung sind zwingend notwendig.
• Höhere Primär-Rücklauftemperatur im Vergleich zur Applikation mit TWW-Bereitung
im Durchflussprinzip und zur TWW-Applikation mit Speicherladesystem
• Wegen der Wärmeübertragung durch zwei Wärmeübertrager (Wärmeübertrager
und Speicher mit innenliegender Heizfläche) wird die Rücklauftemperatur des TWWSystems im Vergleich zum Parallelsystem höher sein.
Page 92

Page 93

Seite 93 – 95 93
Über Danfoss District Energy
Page 94

Über Danfoss District Energy94
Wir kümmern uns um Ihr Geschäft
Die Marke Danfoss steht nicht nur für
Energieeffizienz bei der Trinkwassererwärmung und Heizung. Wir blicken
auf eine jahrzehntelange
zurück, die wir durch Innovationen
weiter ausbauen und kontinuierliche
erweitern. Dabei konzentrieren wir
uns sowohl auf die Entwicklung neuer
Komponenten als auch auf Systeme,
Erfahrung
die wir in enger Zusammenarbeit mit
unseren Kunden, ihren Anforderungen
entsprechend, gestalten.
Komplettanbieter versorgt
Kunden in aller Welt mit einem
umfangreichen Programm selbsttätiger Regler, hocheffizienter Wärmeübertrager, Trinkwarmwassersysteme
und Übergabestationen, die für eine
Als führender
Danfoss
energieeffiziente Wärmeerzeugung,
-verteilung und -nutzung sorgen.
Diese Qualitätsprodukte, die den
Komfort steigern, den Energieverbrauch
senken und unsere Umwelt entlasten,
zeichnen sich aus durch höchste
Zuverlässigkeit bei minimalem
Serviceaufwand.
Vor Ort gebaut – Bauteile
Ob Sie Fernwärmestationen zur
Wärmeübertragung bauen oder sich
mit der Auslegung eines Heizsystems
beschäftigen, Danfoss kann Ihnen die
nötigen Bauteile und das dazugehörige
Know-how zur Verfügung stellen, damit
Sie die jeweilige Gesamtlösung optimieren
können und die aktuellen und künftigen
Herausforderungen meistern.
Richten Sie Ihr Augenmerk auf
die Leistung.
Indem Sie bei der Konstruktion Ihres
Heizsystems die äußerst leistungsfähigen
Komponenten von Danfoss verwenden,
können Sie sich
trieren, die Leistung
tems zu verbessern und auf diese Weise
überlegene Lösungen für
Ihre Kunden zu erschaffen.
ganz darauf konzen-
des
Gesamtsys-
sich selbst und
Ein vollständiges
Produktspektrum:
» Elektronische Regler
» Motorregelventile
» Selbsttätige Druck-, Durchfluss-
und Temperaturregler
» Kugelhähne
» Energiezähler
» Plattenwärmeübertrager
Page 95

Über Danfoss District Energy 95
– und um Ihre Applikationen
Wer mit Danfoss Geschäfte macht,
erhält Zugang zu folgenden
branchenführenden Angeboten:
» Breites Produktspektrum für
Fernwärme und Fernkälte
» Beratung und Kundenorientierung
» Innovationen, technische
Optimierungen und Leistung
» Sicherheit und Zuverlässigkeit
bei der Kooperation
» Globale Reichweite mit starker
lokaler Präsenz und vor Ort
verfügbarem Know-how
Folglich ist Danfoss genau der
richtige Ansprechpartner, wenn
Fernwärme- oder Fernkühlsysteme
geplant, installiert oder modernisiert
werden.
Für den Ort gebaut – vordenierte Applikationen
Halten Sie nach neuer Wärmeübertragungstechnologie und besserer Energieeffizienz Ausschau? Möchten Sie die
Nutzung und das Erscheinungsbild Ihres
Heizungsraums optimieren? Wünschen Sie
sich höchste Leistung und mehr Zeit für
andere Projekte?
Danfoss ermöglicht es Ihnen, komplette
Fernwärmestationen zu liefern, die dank
ausgereifter Bauteile optimal auf eine hohe
Wärmeübertragungsleistung ausgelegt sind.
Die Fernwärmestationen von Danfoss lassen
sich schnell konzipieren, konfigurieren und
fertigen. Sie werden vor der Lieferung
getestet, um eine unkomplizierte Installation
und einen passgenauen Einbau in die
Versorgungssysteme des Gebäudes zu
gewährleisten.
Somit können Sie und Ihre Kunden vernünftig
arbeiten, Zeit und Geld sparen und den
Platzbedarf Ihres Heizsystems reduzieren.
Ein vollständiges
Produktspektrum:
»
Vorgefertigte
Fernwärmestationen
(15 kW – 400 kW)
»
Geschweißte
Fernwärmestationen und
Mischkreise (15 kW – 4 MW)
» Trinkwarmwassersysteme
Page 96

Seite 96 – 99
Anlagen
Page 97

Anlagen 97
Überlegungen zur TWW-Bereitung in
Gewerbe- und Industriebauten
Freizeit- und Gesundheitseinrichtungen, Industrie und sonstige Spezialsektoren
Nicht nur der Wohnungsmarkt sondern auch Freizeit- und Gesundheitseinrichtungen,
Industriebauten und sonstige Spezialsektoren können von FW-Lösungen profitieren.
Ein Unterschied zwischen dem Wohnungssektor und anderen Sektoren könnte in dem
TWW-Entnahmeprofil und der benötigten TWW-Kapazität im Vergleich zur HE-Leistung
bestehen. Bei hoher TWW-Spitzenlast im Vergleich zur HE-Last könnte es sich lohnen,
eine Applikation in Kombination mit einem Speicherladesystem in Betracht zu ziehen.
Generell gilt: Wenn das TWW-Entnahmeprofil auf stochastischen Ereignissen basiert,
wie es im Wohnungssektor der Fall ist, wo es in einer Gruppe von Verbrauchern keine
systematische TWW-Zapfungsspitze gibt, entnehmen Sie die empfohlene Applikation
aus den Systemauswahl-Übersichten.
Bei systematischen TWW-Zapfungen, bspw. in Sporteinrichtungen, wo durch gleichzeitige
TWW-Zapfungen hohe Spitzenlasten auftreten, empfehlen sich Kombinationen mit
Speicherladesystemen. Auf diese Weise lässt sich die FW-Leistung im Vergleich zur
TWW-Bereitung im Durchflussprinzip mittels Wärmeübertrager beträchtlich reduzieren.
Das wirkt sich positiv auf die Auslegung der FW-Abzweigrohre und folglich auch auf die
Wärmeverluste bei der FW-Verteilung aus.
Zu den Sektoren, für die Kombinationen mit Speicherladesystemen empfohlen werden,
zählen:
• Freizeitsektor: Sporteinrichtungen, Schwimmbäder, Wellness-Einrichtungen
und Hotels
• Gesundheitssektor: Krankenhäuser
• Industrie: Fabrikanlagen
• Spezialsektoren: Militärische Einrichtungen
Für diese Sektoren empfiehlt sich eine individuelle Analyse, welche Applikation, welches
Speicherladesystem oder welcher Durchfluss-Wärmeübertrager jeweils die beste Option
darstellt.
Page 98
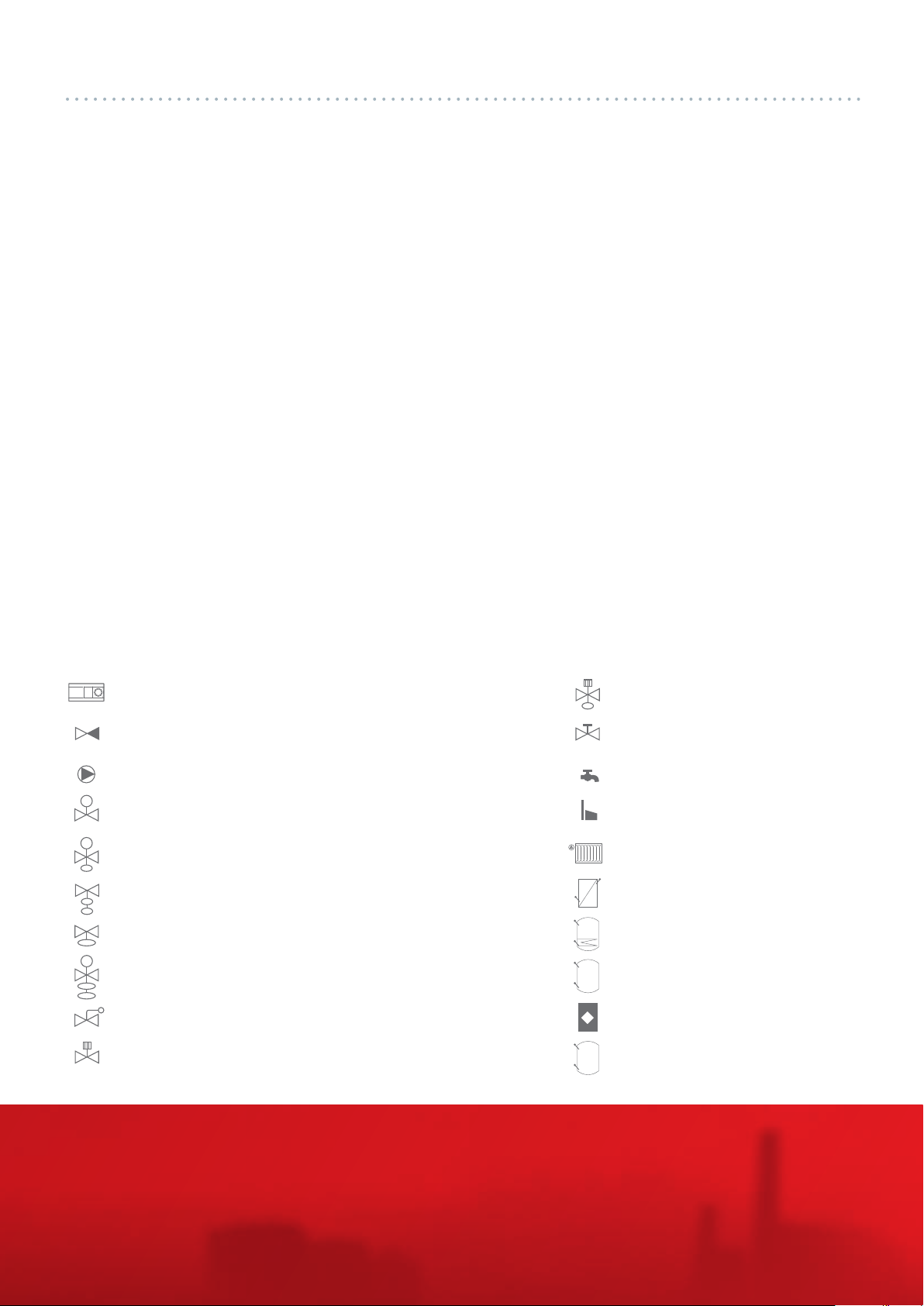
Abkürzungen
(in nicht priorisierter Reihenfolge bzw. unter
anderer Unterüberschrift)
Anlagen98
AC Air Conditioning
(Klimaanlage)
TKW Trinkkaltwasser
FW Fernwärme
TWW Trinkwarmwasser
dP Dierenzdruck
FH Fußbodenheizung
HE Raumheizung
PN Nenndruck [bar, kPa]
SCADA System Control
And Data Acquisition
T Temperatur
Q(TW W) Durchuss Trinkwarmwasser
Q(HE) Durchuss Raumheizung
SWE Speicherwassererwärmer
Applikationssymbole
ECL Comfort 210/310
Rückschlagventil
Magnetventil mit Überströmregler
Drosselventil
Umwälzpumpe
Durchgangsventil mit Stellantrieb
Volumenstrom- und Temperaturregler
Kombinierter Dierenzdruck- und Volumenstromregler
Dierenzdruckregler mit Volumenstrombegrenzung
Dierenzdruck-, Volumenstrom- und Temperaturregler
Absperrventil (Kugelhahn)
Magnetventil
Warmwasser
Fernheizwerk
Heizkörper (Heizstrahler)
Wärmeübertrager
SWE (Registerspeicher)
TWW-Ladespeicher
Wohnungsstation
Puerspeicher
Page 99

Anlagen 99
Literaturhinweise
[1] Bericht der Beratungsfirma COWI A/S. „Energibesparelser ved vejrkomensering.“ März 2010, Dänemark.
[2] Danfoss A/S Preisliste. April 2012, Dänemark.
[3] Jan Eric Thorsen und Halldor Kristjansson. „Cost Considerations on Storage Tank versus Heat Exchanger for Hot Water Preparation.“ Im Rahmen des:
10. Internationalen Symposiums für Fernwärme und Fernkühlung, Hannover, Deutschland, 3. bis 5. September 2006.
[4] DVGW-Regel, Deutschland, Arbeitsblatt W551, April 2004
[5] Jan Eric Thorsen. „Analysis on flat station concept.“ Im Rahmen des: 12. Internationalen Symposiums für Fernwärme und Fernkühlung, Tallinn,
Estland, 5. bis 7. September, 2010.
[6] Fallbeispiel: „Danflat leads to huge energy savings in housing association.“ http://heating.danfoss.com/xxNewsx/e29ab581-336d-400c-983d-
f92e9b987c72.html
[7] Håkon Waltetun, ZW Energiteknik AB. „Teknisk och ekonomisk jämförelse mellan 1- och 2-stegskopplade fjärrvärmecentraler“, Svenska
Fjärrvärmeföreningens Service AB, 2002, ISSN 1402-5191
Sonstige relevante Literatur:
Regler
[8] Herman Boysen. „Differential pressure controllers as a tool for optimization of heating systems.“ Veröffentlicht in: Euro Heat & Power 1/2003.
[9] Herman Boysen. „Hydronic balance in a district cooling system.“ Veröffentlicht in: Hot & Cool, Internationale Fachzeitschrift für Fernwärme und
Fernkälte, 4/2003.
[10] Herman Boysen und Jan Eric Thorsen. „Hydronic balance in a district heating system.“ Veröffentlicht in: Euro Heat & Power 4/2007.
Fernwärmestationen
[11] Herman Boysen. „District heating house substations.“ Veröffentlicht in: News from DBDH, 2/1999.
[12] Herman Boysen. „Selection of DH house stations.“ Veröffentlicht in: Euro Heat & Power 3/2004.
[13] Herman Boysen und Jan Eric Thorsen. „Control concepts for district heating compact stations.“ Veröffentlicht in: Euro Heat & Power 4/2004.
[14] Jan Eric Thorsen. „Dynamic simulation of DH House stations.“ Veröffentlicht in: Euro Heat & Power 6/2003.
Systeme
[15] Halldor Kristjansson und Benny Bøhem. „Optimum Design of Distribution and service Pipes.“ Im Rahmen des: 10. Internationalen Symposiums für
Fernwärme und Fernkühlung, Hannover, Deutschland, 3. bis 5. September 2006.
[16] Herman Boysen und Jan Eric Thorsen. „How to avoid pressure oscillations in district heating systems.“ Veröffentlicht in: Euro Heat & Power 2/2003.
Trinkwarmwasser
[17] Jan Eric Thorsen und Halldor Kristjansson. „Cost Considerations on Storage Tank versus Heat Exchanger for Hot Water Preparation.“ Im Rahmen
des: 10. Internationalen Symposiums für Fernwärme und Fernkühlung, Hannover, Deutschland, 3. bis 5. September 2006.
[18] Herman Boysen. „Auto tuning and motor protection.“ Veröffentlicht in: News from DBDH, 3/2000.
[19] Atli Benonysson und Herman Boysen. „Optimum control of heat exchangers.“ Im Rahmen des: 5th International Symposium on Automation and
of District Heating Systems, Finnland, August, 1995.
[20] Atli Benonysson und Herman Boysen. „Valve characteristics for motorized valves.“ Veröffentlicht in: Euro Heat & Power 7-8/1999.
Wohnungsstationen
[21] Halldor Kristjansson. „Distribution Systems in Apartment Buildings.“ Im Rahmen des: 11th International Symposium on Automation and of District
Heating Systems, Reykjavik, Island, 31. August bis 2. September 2008.
[22] Halldor Kristjansson. „Controls Providing Flexibility for the Consumer Increase Comfort and Save Energy.“ Veröffentlicht in: Hot & Cool,
Internationale Fachzeitschrift für Fernwärme und Fernkälte, 1/2008.
[23] Jan Eric Thorsen, Henning Christensen und Herman Boysen. „Trend for heating system renovation.“ Danfoss A/S Technical Paper. http://heating.
danfoss.com/PCMPDF/VFHED102_trend_for_renovation.pdf
Sonstige relevante Literatur:
[24] Herman Boysen. „Kv factor.“ Danfoss A/S Technical Paper. http://heating.danfoss.com/PCMPDF/VFHBG102_Kv.pdf
Page 100

Wir kümmern uns um Ihr Geschäft
Danfoss GmbH, Fernwärme- und Regelungstechnik, Carl-Legien-Str. 8, D-63073 Oenbach
Tel.: +49 (0)69 / 8902-960, Fax: +49 (0)69 / 8902 466-948, anfrage-fw@danfoss.com, www.fernwaerme.danfoss.de
Danfoss GmbH, Danfoss-Straße 8, A-2353 Guntramsdorf
Tel.: +43 (0)2236 5040, Fax: +43 (0)2236 5040-33, fernwaerme.at@danfoss.com, www.fernwaerme.danfoss.at
Danfoss AG, Parkstraße 6, CH-4402 Frenkendorf
Tel.: +41 (0)61 906 11 11, Fax: +41 (0)61 906 11 21, info@danfoss.ch, www.danfoss.ch
VG.HZ.A2 .03
 Loading...
Loading...