Page 1
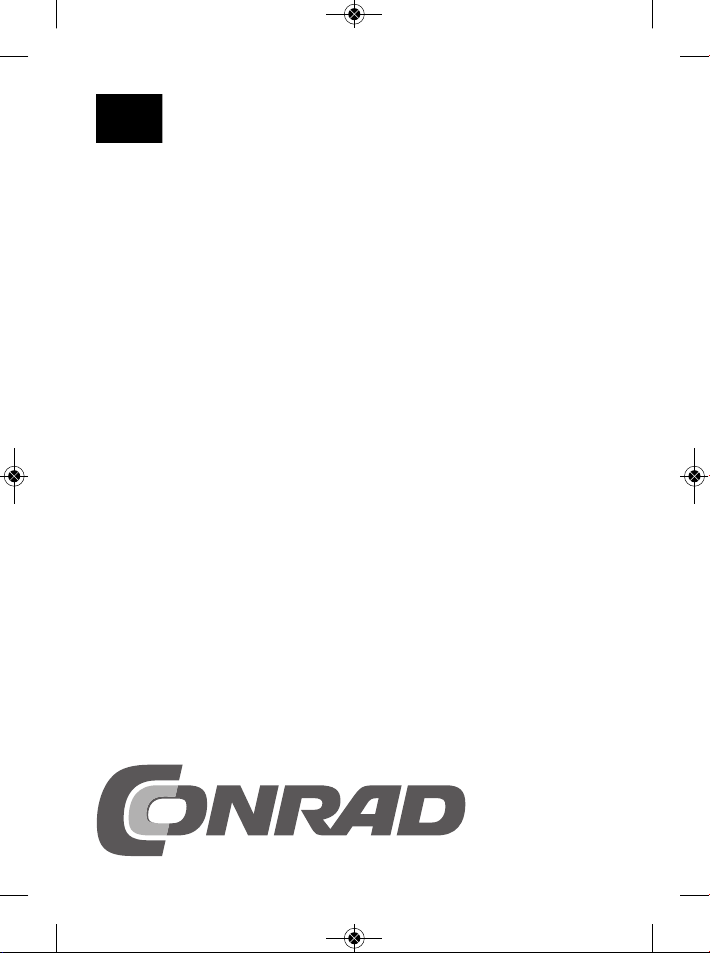
10127-1 Booklet+Impressum 11.11.13 09:22 Seite 1
Page 2
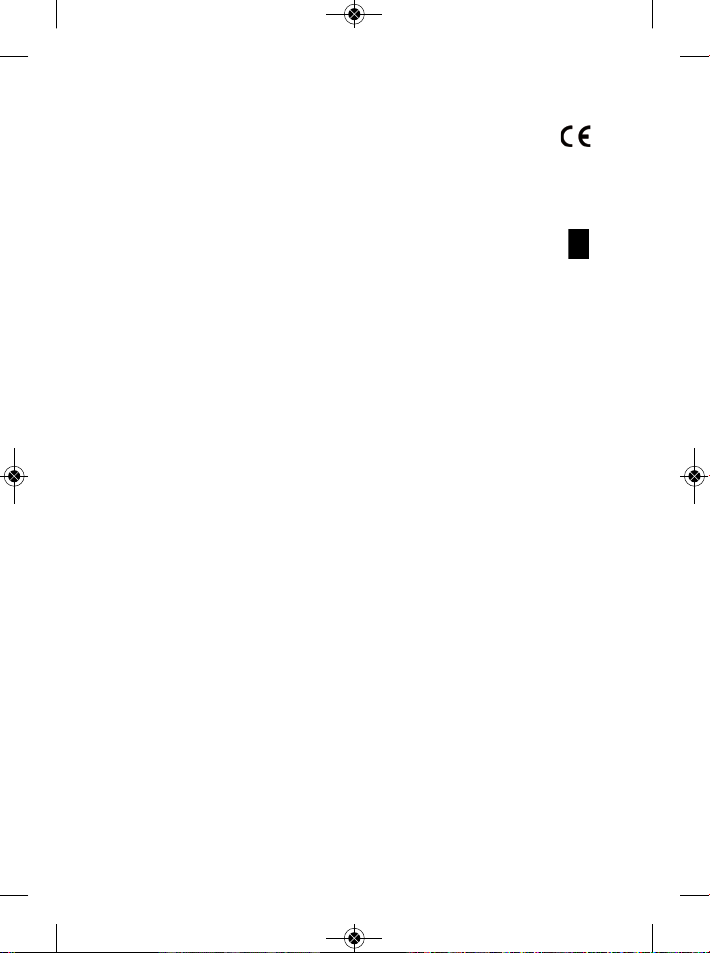
Liebe Kunden!
Dieses Produkt wurde in Übereinstimmung mit den geltenden europäischen Richtlinien
hergestellt und trägt daher das CE-Zeichen. Der bestimmungsgemäße Gebrauch ist in der
beiliegenden Anleitung beschrieben.
Bei jeder anderen Nutzung oder Veränderung des Produktes sind allein Sie für die Einhaltung der
geltenden Regeln verantwortlich. Bauen Sie die Schaltungen deshalb genau so auf, wie es in der
Anleitung beschrieben wird. Das Produkt darf nur zusammen mit dieser Anleitung weitergegeben
werden.
Das Symbol der durchkreuzten Mülltonne bedeutet, dass dieses Produkt getrennt vom Hausmüll
als Elektroschrott dem Recycling zugeführt werden muss. Wo Sie die nächstgelegene kostenlose
Annahmestelle finden, sagt Ihnen Ihre kommunale Verwaltung.
Achtung! Augenschutz und LEDs:
Blicken Sie nicht aus geringer Entfernung direkt in eine LED, denn ein direkter Blick kann Netzhautschäden
verursachen! Dies gilt besonders für helle LEDs im klaren Gehäuse sowie in besonderem Maße für
Power-LEDs. Bei weißen, blauen, violetten und ultravioletten LEDs gibt die scheinbare Helligkeit einen
falschen Eindruck von der tatsächlichen Gefahr für Ihre Augen. Besondere Vorsicht ist bei der Verwendung
von Sammellinsen geboten. Betreiben Sie die LEDs so wie in der Anleitung vorgesehen, nicht aber mit
größeren Strömen.
Achtung! Richtiger Umgang mit Akkus:
Akkus niemals kurzschließen, gewaltsam öffnen oder ins Feuer werfen. Nicht wiederaufladbare Batterien
dürfen nicht ans Ladegerät angeschlossen werden. Bleiben Sie in der Nähe, während Sie Akkus laden.
Bei unsachgemäßer Handhabung von Akkus besteht Explosionsgefahr!
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
Alle in diesem Buch vorgestellten Schaltungen und Programme wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt
entwickelt, geprüft und getestet. Trotzdem können Fehler im Buch und in der Software nicht vollständig
ausgeschlossen werden. Verlag und Autor haften in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit nach
den gesetzlichen Bestimmungen. Im Übrigen haften Verlag und Autor nur nach dem Produkthaftungsgesetz
wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der schuldhaften Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
ist auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht ein Fall der zwingenden
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz gegeben ist.
Impressum
© 2013 Franzis Verlag GmbH, Richard-Reitzner-Allee 2, 85540 Haar bei München
www.franzis.de
Autor: Ulrich Stempel
Art & Design, Satz: www.ideehoch2.de
ISBN 978-3-645-10127-1
Produziert im Auftrag der Firma Conrad Electronic SE, Klaus-Conrad-Str. 1, 92240 Hirschau
10127-1 Booklet+Impressum 11.11.13 09:22 Seite 2
Page 3

Inhaltsverzeichnis
1 Vertraut machen mit den Komponenten
des Lernpakets ................................................................. 5
1.1 Das Experimentierbrett............................................... 6
1.2 USB-Anschlusskabel.....................................................7
1.3 Solarmodul ................................................................. 8
1.4 Dioden......................................................................... 9
1.5 Leuchtdioden ..............................................................11
1.6 Transistoren............................................................... 12
1.7 Widerstände............................................................... 13
1.8 Elektrolytkondensatoren............................................ 15
1.9 Akkuhalter.................................................................. 15
1.10 Experimentierkabel.................................................... 16
1.11 Schaltdraht................................................................. 17
2 Verwendung des USB-Kabels............................................ 17
2.1 USB-Kabel am Steckbrett anschließen ......................18
3 Energie speichern ........................................................... 20
3.1 Energiespeicherung mit dem Elko............................. 21
4 Vertraut machen mit den Akkutypen................................22
5 Erster Schritt mit dem Solarmodul ...................................23
6 Akkus mit der USB-Quelle laden.......................................26
7 NiMH- und NiCd-Akkus laden.......................................... 28
8 Konstantstromladen......................................................... 31
9 Impulsladen.....................................................................35
3
Page 4

10 Nickel-Zink-Zelle laden ....................................................38
11 Lithium-Akku Laden.........................................................42
12 Laden überwachen ......................................................... 48
12.1 Akkutankanzeige....................................................... 48
13 Akkus testen................................................................... 50
13.1 Test mit niedrigem Strom ......................................... 52
13.2 Test mit hohem Strom .............................................. 54
14 Akku und Solarmodul ...................................................... 57
14.1 Akkus mit Solarenergie laden.................................... 61
14.2 Solarlader – was es zu beachten gilt ........................ 63
15 Rückstromsperre verwenden ...........................................65
16 Laderegler einsetzen....................................................... 68
17 Solare Ladeüberwachung des Lithium-
Akkus ..............................................................................70
18 Kombilader, Laden und Ladung erhalten.......................... 72
19 Solarnachtlicht.................................................................75
20 Erhalt der Leistungsfähigkeit von Akkus ...........................79
20.1 Akku-Notfallrettung....................................................79
20.2 Akkupflege .................................................................81
4
Page 5
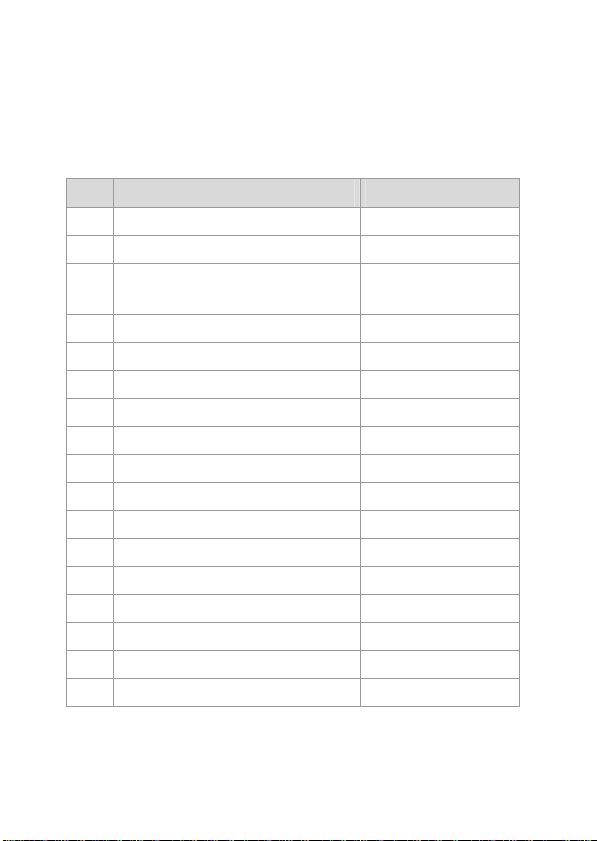
1 Vertraut machen mit den Komponenten
des Lernpakets
Stück Komponente Spezifikation
1 Steckbrett SYB 46, 270 Kontakte
1 Solarmodul
USB-Stecker mit Kabel und Enden
1
fürs Steckbrett
1 Transistor 2N3904
1 Transistor 2N3906
1 Schottky-Diode, blau BAT 42
2 Siliziumdioden 1N4001
1 LED, rot 5 mm
1 LED, orange 5 mm
1 Blink-LED, rot 5 mm
1 Kohlewiderstand 1 W
8 Kohlewiderstände ¼ W
1 Elektrolytkondensator 1.000 µF, 10 V
1 Batteriehalter mit Kabel Mignon, AA
4 Steckstifte
2 Krokodilkabel, rot und schwarz
1 Schaltdraht 1,0 m
5
Page 6

1.1 Das Experimentierbrett
Mit dem Experimentierbrett, auch als
Steckbrett
nur
aufgebaut werden. Es besteht im Inneren aus Kontaktfedern, die in
einem Reihensystem miteinander verbunden sind. Die elektronischen
Bauteile und Verbindungsdrähte können wiederholt in die Kontakte
eingesteckt werden und ermöglichen somit einen Schaltungsaufbau
ohne Löten oder Schrauben. Schräg mit dem Seitenschneider abgezwickte Anschlussdrähte lassen sich am leichtesten einstecken.
Das dem Lernpaket beigelegte Steckbrett hat insgesamt 270
Kontakte im 2,54-mm-Raster. Die 230 Kontakte im mittleren Bereich
sind jeweils durch vertikale Streifen in 5er-Reihen verbunden.
An den Rändern der breiten Seite gibt es je eine Reihe mit 20 Kontaktpunkten, die horizontal mit einer Schiene verbunden sind.
Diese »obere« und »untere« Reihe eignen sich gut als Stromversorgungsschienen.
bezeichnet, können die Experimente ohne Lötkolben
Laborsteckbrett
oder einfach
Abb. 001: Das Steckbrett – oben und unten die Stromversorgungsschienen
6
Page 7

1.2 USB-Anschlusskabel
Das USB-Anschlusskabel des Lernpakets hat auf der einen Seite
einen USB-A-Stecker und auf der anderen Seite einen Stiftstecker
für das Steckbrett. Damit ist es möglich, die 5 V (Volt) Stromversorgung einer USB-Quelle (USB-Netzteilstecker) mit dem Steckbrett zu
verbinden.
Wichtig!
Beim Anschluss des Stiftsteckers an das Steckbrett unbedingt
auf die Polarität achten! Das rote Kabel zum Stiftstecker ist der
Pluspol, der schwarze der Minuspol.
Abb. 002: USB-Anschlusskabel, Anschlussbelegung des Steckers: 1) = -5 V,
2) = D+, 3) = D-, 4) = +5 V
Wichtiger Hinweis zur Nutzung der USB-Stromversorgung
Es wird dringend empfohlen, für die nachfolgenden Experimente
ein einfaches USB-Netzteil (z. B. für ein Mobiltelefon) mit 5 V
Spannung und mindestens 500 mA (Milliampere) Leistungsabgabe zu verwenden.
Die USB-Stromversorgung für die Experimente könnte zwar von
der Computer-USB-Buchse kommen, davon wird aber dringend
abgeraten!
7
Page 8

Der Grund: Im Prinzip dürfen High power Devices an der
Computer-USB-Buchse einen Stromverbrauch von 500 mA
haben, Low power Devices maximal 100 mA. Leider sind nicht
alle USB-Buchsen (abhängig vom Computertyp) kurzschlussfest!
Oft ist nur eine Sicherung an der Buchse eingelötet, manchmal
auch ein entsprechender Widerstand. Bei einigen Geräten gibt
es eine Sicherung, die sich von selbst zurückstellt, bei anderen
Geräten muss sie nach einem Kurzschluss ausgetauscht werden.
Es gibt auch mobile Computersysteme, bei denen die USBBuchse eine reduzierte Spannung und einen reduzierten Strom
abgibt.
1.3 Solarmodul
Das beiliegende Solarmodul besteht aus mehreren polykristallinen
Solarzellen. Das Siliziummaterial, zusammengesetzt aus mehreren
Kristallen, wird durch absichtliche Dotierungen so verunreinigt,
dass dadurch eine negative und eine positive Schicht entstehen.
Oben ist die N-Schicht (negativ dotiert), zur besseren Absorption
des Lichts dunkelblau beschichtet. Die untere Schicht ist die PSchicht. Durch auftreffendes Licht kommen die Elektronen in Bewegung und es entsteht eine Spannung zwischen den beiden beschriebenen Schichten. Diese Spannung und den fließenden Strom
können wir verwenden. Eine einzige kristalline Siliziumsolarzelle
kommt auf ca. 0,5 V pro Zelle. Der Strom ist abhängig von der
Zellengröße.
8
Page 9
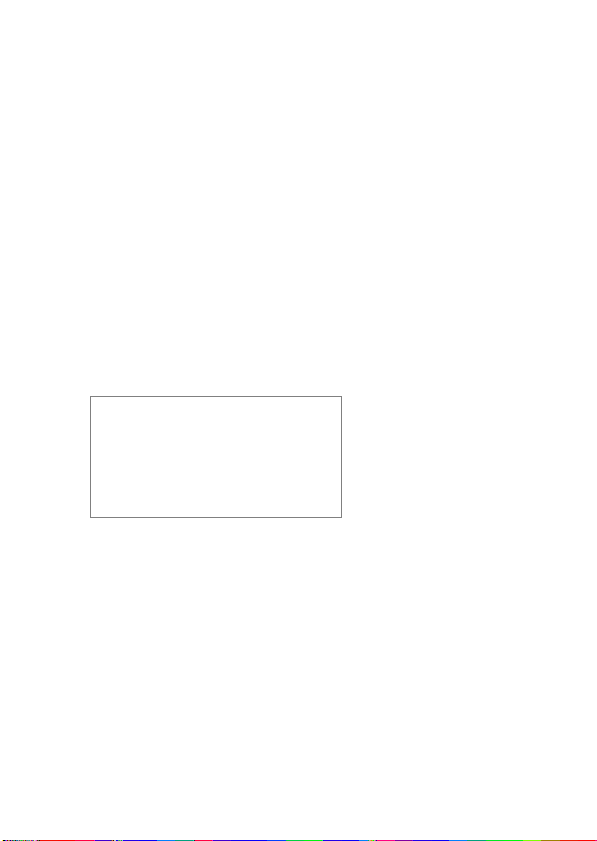
a)
Abb. 003:
a) Solarmodul mit Schutzfolie,
b)
b) Schaltsymbol
1.4 Dioden
Dioden lassen den Strom nur in eine Richtung durch. Sie werden
deshalb unter anderem zum Gleichrichten von Wechselspannungen
und zur Abblockung unerwünschter Polarität bei Gleichspannung
eingesetzt. Die Funktion einer Diode können Sie sich im Normalbetrieb am einfachsten sinnbildlich als Rückschlagventil (Wasserinstallation) vorstellen.
9
Page 10
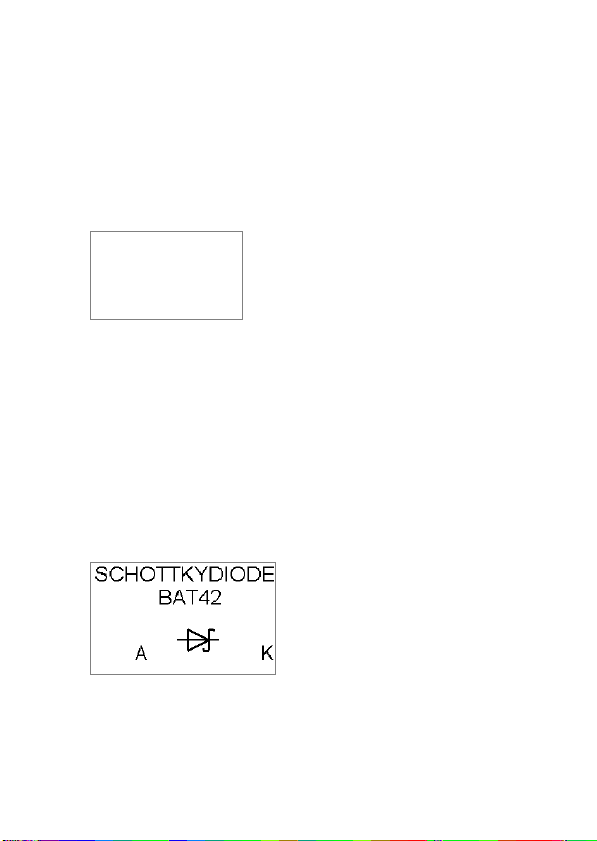
a)
Abb. 004: a) Siliziumdiode Typ 1N 4001; die
Kathode der Diode ist an dem aufgedruckten
Strich zu erkennen, der andere Anschlussdraht
ist die Anode. Die technische Stromrichtung geht
von der Anode zur Kathode. b) Schaltsymbol der
b)
Diode
In Durchlassrichtung (Schaltsymbol Pfeil) beginnt bei der Siliziumdiode wie z. B. der 1N 4001 erst ab einer Spannung von ca. 0,6–
0,7 V oder 700 mV (Millivolt) nennenswert Strom zu fließen.
a)
b)
Abb. 005: a) Schottky-Diode,
b) ihr Schaltbild
In Photovoltaik-Anlagen werden verlustarme Schottky-Dioden in der
Regel auf zwei Arten genutzt: als Sperrdioden und als Bypass-Dioden.
Die Sperrdioden verhindern, dass sich der Akku durch die Photovol-
10
Page 11
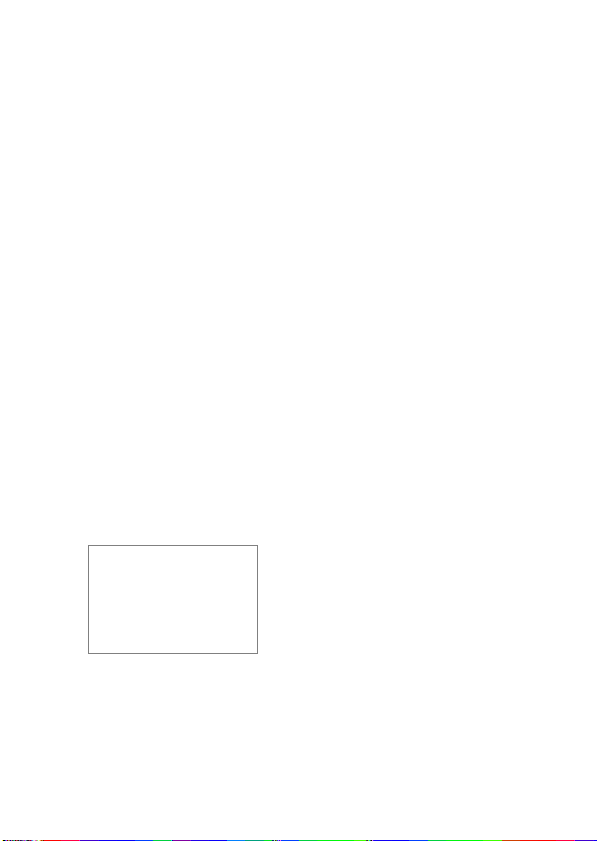
taik-Module bei fehlendem Sonnenlicht entlädt. Die Bypass-Dioden
schützen Solarzellen und das Paneel vor möglichen Schäden, die
durch partielle Verschattungen verursacht werden könnten.
1.5 Leuchtdioden
Die LED (light emitting diode = Licht emittierende Diode) hat neben
den Eigenschaften einer normalen Diode noch eine weitere Eigenschaft: Sie leuchtet, wenn Spannung angelegt wird. LEDs sollten
normalerweise immer mit einem Vorwiderstand zur Strombegrenzung betrieben werden. Rote LEDs benötigen die geringste
Spannung (1,8 V). Danach folgen die gelben, grünen, blauen und
zuletzt die weißen LEDs mit der höchsten Spannung (bis zu 3,6 V).
a)
c)
b)
Abb. 006: a) Anschlussbelegung der Leuchtdioden: die Anode (+) mit dem längeren
Anschlussdraht (links) und die Kathode (–),
b) zusätzlich durch eine Abflachung am
Gehäuse markiert. c) Das Schaltsymbol der
LED
Neben den »normalen« LEDs gibt es auch Spezialausführungen wie
z. B. eine blinkende LED. Die Blink-LED erkennen Sie an dem
kleinen schwarzen Punkt innerhalb des roten Gehäuses. Dieser
Punkt beinhaltet eine winzig kleine Elektronik in Form eines inte-
11
Page 12

grierten Schaltkreises, der die LED – sobald die richtige Spannung
angelegt wird – zum Blinken bringt.
1.6 Transistoren
Transistoren sind aktive Bauelemente, die in elektronischen
Anwendungen zum Schalten und Verstärken von Strom und Spannung eingesetzt werden.
Die dem Lernpaket beigelegten bipolaren Transistoren haben die
Typenbezeichnung 2N 3904 und 2N 3906. Es handelt sich dabei um
komplementäre Kleinleistungstransistoren, die für eine maximale
Betriebsspannung von 30 V und einen Strom von maximal 200 mA
geeignet sind. Komplementär bedeutet, dass es sich um ein zueinander passendes Transistorpaar aus einem NPN- und einem PNPTransistor handelt. Die Bezeichnungen »N« und »P« stehen für die
negativen und positiven Halbleiterschichten im Transistor. Für den
Fall, das Ihnen diese Begriffe noch nicht viel sagen, können Sie die
Funktionen später anhand der Experimente praktisch nachvollziehen.
Abb. 007:
Transistoranschlüsse.
E = Emitter, B = Basis,
C = Kollektor
12
Page 13
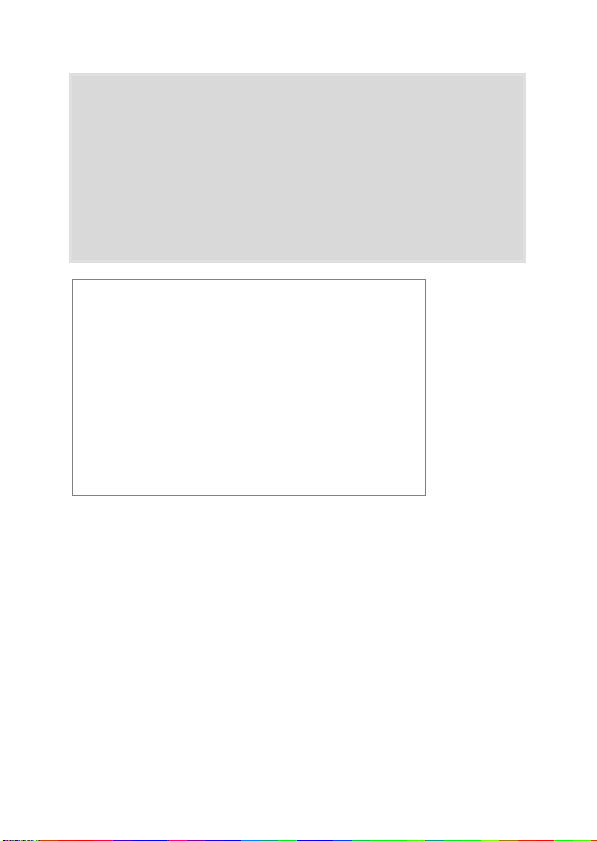
So funktioniert der Transistor
Ein kleiner an der Basis-Emitter-Strecke angelegter Strom kann
einen großen Strom auf der Kollektor-Emitter-Strecke steuern.
D. h., fließt ein geringer Basisstrom (bei NPN-Transistoren
positiv, bei PNP-Transistoren negativ), leitet der Transistor den
Strom vom Kollektor zum Emitter, bzw. umgekehrt. Fließt über
die Basis kein Strom oder ist der Basisanschluss auf negativem
(NPN) bzw. positivem Potenzial (PNP), sperrt der Transistor.
Abb. 008: Schaltsymbole für NPN- und PNP-Transistor.
1.7 Widerstände
Ein Widerstand ist ein passives Bauelement in elektrischen und
elektronischen Schaltungen. Seine Hauptaufgabe ist die Reduzierung des fließenden Stroms auf sinnvolle Werte (siehe auch Kapitel
»Leuchtdioden«).
Die bekannteste Widerstandsbauform ist der zylindrische keramische Träger mit axialen Anschlussdrähten.
13
Page 14
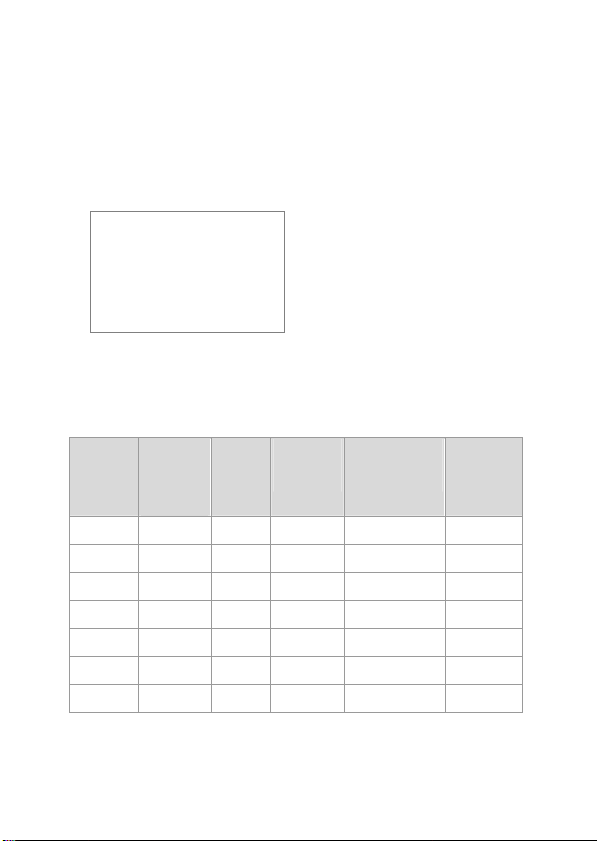
a)
Abb. 009: a) Widerstand,
b)
b) Schaltsymbol
Die Widerstandswerte sind codiert und in Form von farbigen Ringen
aufgedruckt. Im Lernpaket befinden sich Kohleschichtwiderstände
mit folgenden, in der Tabelle angegebenen Werten und Farbringen:
Anzahl Wider-
stands-
1. Ring
1. Ziffer
2. Ring
2. Ziffer
3. Ring
Multiplikator
4. Ring
Toleranz
wert
1 1,2 Ω Braun Rot Gold Gold
1 1,5 Ω Braun Grün Gold Gold
1 10 Ω Braun Schwarz Schwarz Gold
1 100 Ω Braun Schwarz Braun Gold
3 1 kΩ Braun Schwarz Rot Gold
1 2,2 kΩ Rot Rot Rot Gold
1 100 kΩ Braun Schwarz Gelb Gold
14
Page 15

1.8 Elektrolytkondensatoren
Elektrolytkondensatoren (Elkos) haben im Vergleich zu normalen
Kondensatoren eine hohe Kapazität. Aufgrund des Elektrolyts ist ein
Elko polungsabhängig, und die Anschlüsse sind mit einem Pluspol
und einem Minuspol bezeichnet. Wird das Bauteil über längere Zeit
»falsch herum« angeschlossen, wird dadurch der Elektrolyt des
Kondensators zerstört. Die aufgedruckte maximale Spannungsangabe sollte nicht überschritten werden. Andernfalls kann die
Isolierschicht zerstört werden.
µ
ist immer der millionste Teil der Grundeinheit. µF steht für
Mikrofarad.
a) b)
Abb. 010: a) Elektrolytkondensator. Der Minuspol ist am Gehäuse durch einen
hellen Strich gekennzeichnet. b) Das Schaltsymbol des Elkos
1.9 Akkuhalter
Der Akkuhalter dient der Aufnahme von Akkus des Formats AAMignon. Der Akkuhalter kann auch für das Format AAA-Mikro
verwendet werden, wenn die Feder am Minuspolanschluss etwas in
die Länge gezogen wird.
15
Page 16
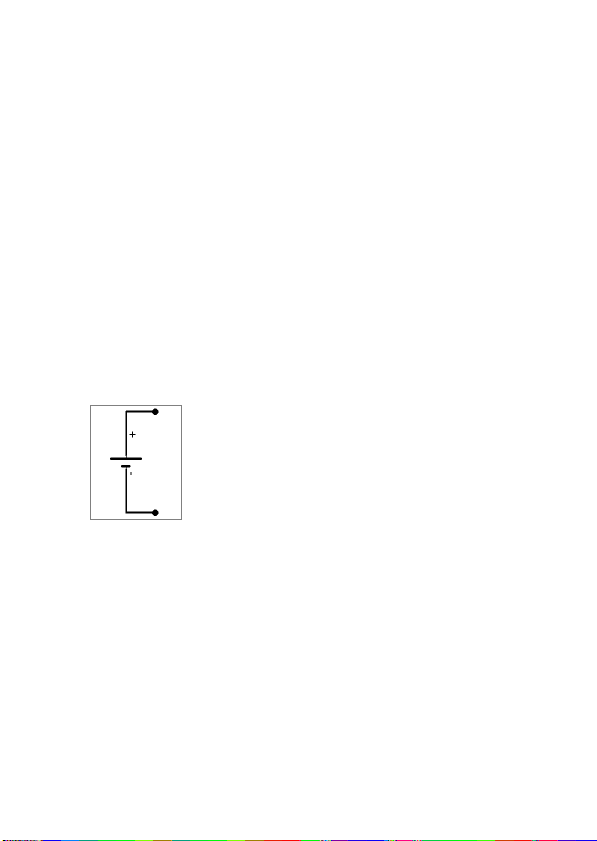
a)
b)
Abb. 011: a) Akkuhalter; b) Schaltsymbol des Akkus
1.10 Experimentierkabel
Mit den roten und schwarzen Experimentierkabeln, an deren Enden
jeweils Krokodilklemmen angeschlossen sind, können Sie schnell
und einfach einzelne Teile elektrisch anschließen und verbinden –
ohne Lötkolben und ohne Schraubendreher. Sinnvoll ist, die roten
Anschlusskabel für den Pluspol und die schwarzen für den
Minuspol zu verwenden.
16
Page 17

Abb. 012: Experimentierkabel mit Krokodilklemmen
1.11 Schaltdraht
Drahtbrücken können Sie mit dem beiliegenden Schaltdraht herstellen. Dazu ist die ungefähre Länge der Drahtbrücke abzuschätzen
oder abzumessen (zuzüglich der Länge für die Drahtenden, die in
die Steckkontakte eingesteckt werden sollen). Die Enden sind dann
ca. 8 mm lang abzuisolieren. Schräg mit dem Seitenschneider
abgezwickte Anschlussdrähte lassen sich leichter stecken. Die
einmal hergestellten Drahtbrücken können immer wieder
verwendet werden.
2 Verwendung des USB-Kabels
Das beiliegende USB-Kabel sollte an ein 5-V-USB-Steckernetzteil
angeschlossen werden, wie es zum Laden von Mobiltelefonen
verwendet wird. Prinzipiell ist der Anschluss am USB-Ausgang eines
PCs möglich, davon wird aber abgeraten. Der Grund: Bei einem
versehentlichen Kurzschluss beim Schaltungsaufbau kann die im
Computer eingebaute Strombegrenzung (meist in Form eines
Widerstands) zerstört werden.
17
Page 18

2.1 USB-Kabel am Steckbrett anschließen
Versuchsaufbau: Steckbrett, Kabel mit USB-A-Stecker und Pins,
Widerstand 1 k, Widerstand 1,5 Ω, rote LED
Für die folgenden Ladeexperimente kann das USB-Kabel am
Steckbrett angeschlossen bleiben.
Den Stiftstecker des USB-Kabels in die Kontakte des Steckbretts
stecken. Darauf achten, dass der Pluspol des Stiftsteckers zur
oberen Stromversorgungsschiene führt. Dann mit dem beiliegenden
Schaltdraht den mit dem roten Kabel verbundenen Stift mit der
Pluspolleiste und den Stift des schwarzen Kabels mit der Minuspolleiste verbinden (siehe Abbildung). Der Schutzwiderstand mit
1,5 Ω dient als Kurzschlussschutz für alle Fälle.
a)
b)
18
Page 19

c)
Abb. 013: a) und b): Stiftstecker mit dem Steckbrett verbinden; an den Pluspol den
1,5-Ω-Schutzwiderstand stecken. c): Die LED und den 1-k-Widerstand hinzufügen.
Im nächsten Schritt die rote LED stecken. Hier ist zu beachten, dass
der längere Anschlussdraht zum Pluspol kommt. Zusätzlich den
Widerstand 1 k in das Steckbrett stecken. Wenn nun der USBStecker mit der USB-Stromquelle verbunden wird, sollte die LED
leuchten.
19
Page 20
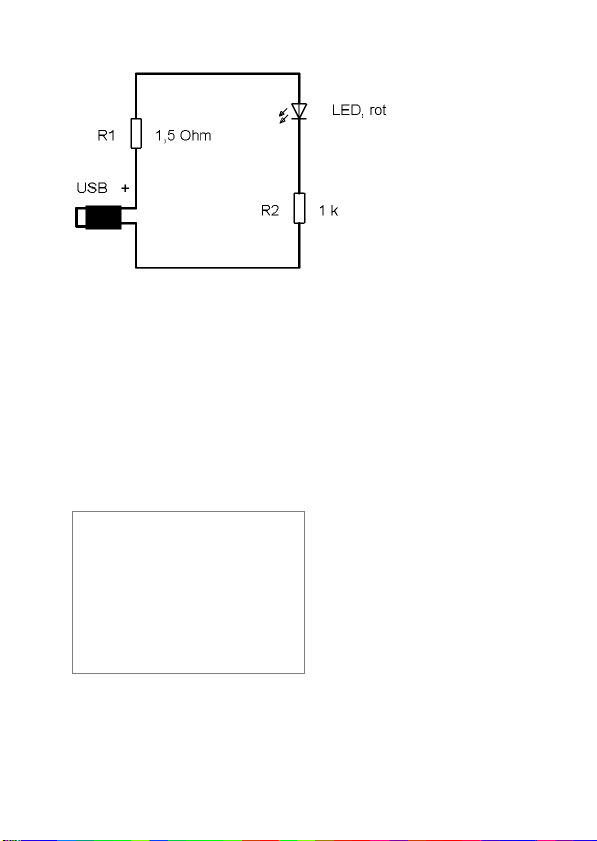
Abb. 014: Schaltbild mit USB-Anschluss und roter LED
3 Energie speichern
Das mit unseren Sinnen nicht wahrnehmbare Prinzip der
Energiespeicherung mit elektrischem Strom lässt sich mit einem
Prinzip, das wir beim Wasser beobachten können, vergleichen und
erklären: Über einen Wasserhahn wird ein Wasserbehälter mit
Wasser gefüllt. Das Wasser kann zu einem späteren Zeitpunkt
wieder entnommen werden.
Abb. 015: Prinzip der Energiespeicherung, verdeutlicht anhand
eines Wasserbehälters
20
Page 21

Der »Energiespeicher« hat in der elektronischen Welt unterschiedliche Ausbildungsformen. Dem Lernpaket liegt ein Elektrolytkondensator bei. Die Speicherwirkung kann man damit gut nachvollziehen. Der Vorteil des Kondensatorspeichers liegt darin, dass er
eine sehr lange Lebensdauer hat. Im Vergleich zum Akku ist die
Speicherkapazität aber nur gering, was für die Experimente den
Vorteil hat, dass das Prinzip der Speicherung in einer überschaubar
kurzen Zeitspanne abläuft. Vergleich: Der Wasserhahn füllt nur
einen kleinen Becher. Das geht dann natürlich auch viel schneller
als bei einem großen Becken.
3.1 Energiespeicherung mit dem Elko
Versuchsaufbau: Steckbrett, Kabel mit USB-A-Stecker und Pins,
Widerstand 1 k, rote LED, Elko 1.000 µF
Der vorhergehende Aufbau wird um den Elko erweitert. Die Anschlussdrähte des Elkos zeigen mit dem Pluspol zur Pluspolschiene
des Steckbretts. Wenn der Elko korrekt gesteckt ist, den USB-Stecker
in das USB-Steckernetzteil einstecken. Die LED leuchtet. Den USBStecker von der USB-Quelle trennen, und die rote LED leuchtet noch
kurze Zeit weiter, obwohl die Stromversorgung unterbrochen wurde.
Die Energie wurde im Elko zwischengespeichert.
21
Page 22
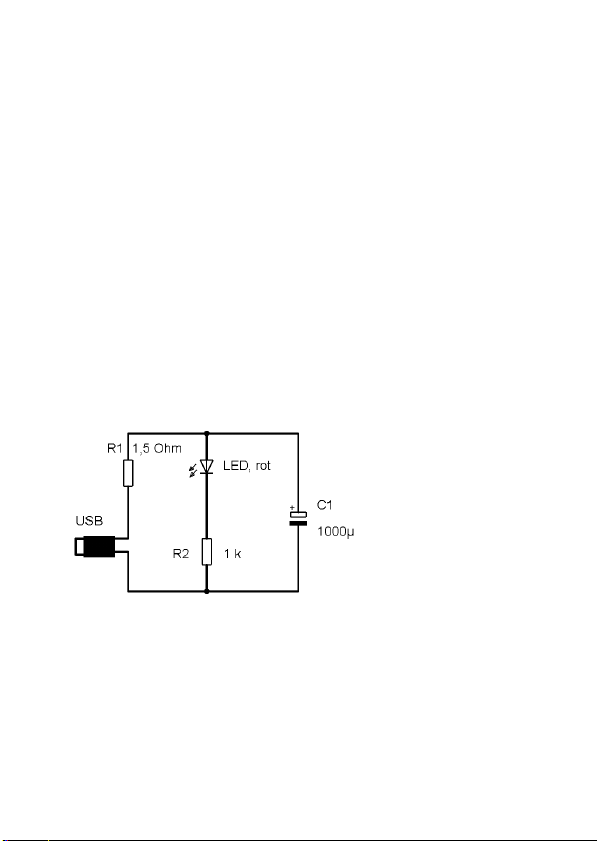
Abb. 016: Steckbrett mit Speicherelko
Abb. 017: Schaltbild
4 Vertraut machen mit den Akkutypen
Die gebräuchlichsten und im Alltag verwendeten Akkutypen:
1. Bleiakkus (Bleisäure, Bleigel), z. B. Starterbatterie im Kfz.
22
Page 23

2. Nickel-Kadmium (NiCa; nicht mehr im Handel), oft in
Akkuschraubern verwendet.
3. Nickel-Metallhydrid (NiMH)
4. Nickel-Zink (NiZn; neu auf dem Markt)
5. Lithium (Li) in unterschiedlichsten Ausführungen
Den Bleiakku kennt man vom Auto als sog. »Starterbatterie«. Dieser
Akkutyp ist preiswert, langzeitstabil und sehr robust, aber schwer.
Er hat, bezogen auf das Gewicht, nur einen geringen Energiegehalt.
Blei ist ein Schwermetall. Alte Akkus müssen zurückgegeben
werden und werden dann recycelt.
Die Akkutypen 2 bis 5 sind Gegenstand der nachfolgenden Experimente. Obwohl der Nickel-Kadmium-Akku nicht mehr im Handel
ist, gibt es dank der Langlebigkeit dieses Akkutyps immer noch
zahlreiche Akkus in der Nutzung.
Bei den Experimenten kann man die unterschiedlichen Ladeverfahren, und was es zu beachten gibt, praktisch erfahren.
5 Erster Schritt mit dem Solarmodul
Experimentieraufbau: Solarmodul, Krokodilklemmen, 2 rote LEDs
Im Lernpaket gibt es zwei rote LEDs, die sich äußerlich kaum unterscheiden lassen. Um herauszufinden, welches die Blink-LED und
welches die »normale« LED ist, kann man folgendes einfache
Experiment mit den Krokodilkabeln und dem Solarmodul machen:
Die Krokodilkabel und Klemmen an die Anschlussdrähte des
Solarmoduls anschließen, Rot an Rot und Schwarz an Schwarz.
Dann die rote Krokodilklemme mit dem längeren Anschlussdraht
23
Page 24

einer der roten LEDs und die schwarze mit dem kürzeren
Anschlussdraht verbinden. Wenn etwas Licht auf das Solarmodul
fällt, kann man sehen, dass die angeschlossene LED entweder
blinkt oder mit Dauerlicht leuchtet.
Abb. 018: Experimentieraufbau mit Krokodilklemmen
24
Page 25
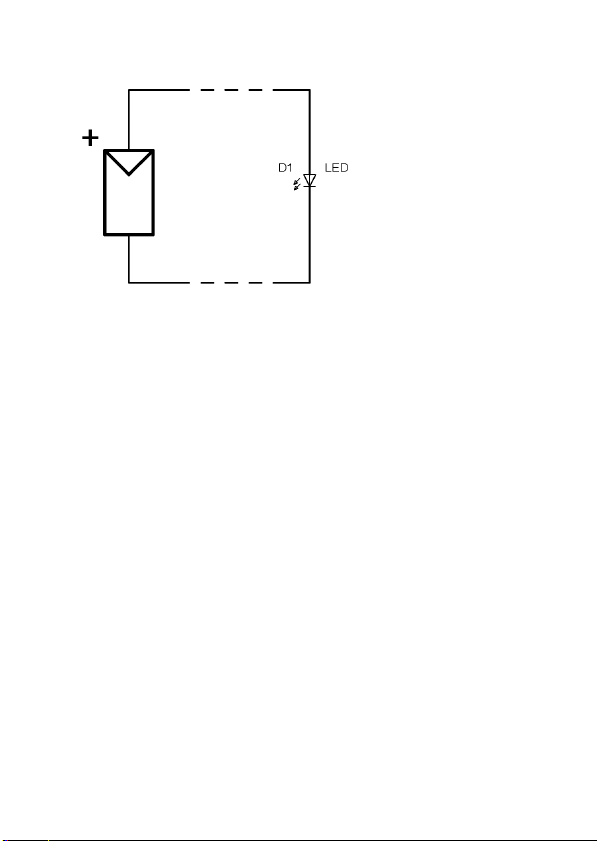
Abb. 019: Schaltbild, links
das Symbol für das
Solarmodul
Normalerweise sollten LEDs mit einem Vorwiderstand betrieben
werden. Da das Solarmodul nur einen begrenzten Strom liefert und es
sich hier um ein Kurzzeitexperiment handelt, kann man eine Ausnahme machen, um herauszufinden, welches die dauerhaft
leuchtende LED und welches die Blink-LED ist. Die Blink-LED dann
mit einem Stück Klebeband für die weiteren Experimente markieren.
Abb. 020: Markierte Blink-LED
25
Page 26

6 Akkus mit der USB-Quelle laden
USB ist im Computerbereich Standard und ist weit verbreitet.
Elektronische Geräte, Computerzubehör wie z. B. externe Festplatten, aber auch kleine Lampen, Ventilatoren usw. können damit
betrieben werden.
Die meisten Mobiltelefonanbieter bieten inzwischen Mikro-USB als
Standardgerätebuchse für den Ladekontakt des Mobiltelefons an.
Der USB-Standard beim Computer ist so eingerichtet, dass Geräte
zunächst im
Low Power-Mode
bei höherem Strombedarf diesen erst anfordern, bevor sie den
normalen Modus schalten.
Durch die unterschiedlichen Anwendungen sind Netzteile mit einer
5-V-USB-Stromquelle weit verbreitet. Der vom Netzteil gelieferte
Strom liegt meist bei 500 bis 2.000 mA. Ein solches USB-Netzteil ist
gut für die weiteren Ladeexperimente geeignet.
(100 mA oder 150 mA) starten und
Abb. 021: USB-Netzteil
26
Page 27

Die USB-Quelle eignet sich hervorragend für Ladeexperimente mit
kleineren Akkuzellen. Die Nutzung setzt aber Elektronikschaltungen
voraus, die das spezielle Ladeverhalten der jeweiligen Akkutypen
berücksichtigen.
Abb. 022: USB-Cell-NiMH, Mignonzelle mit eingebautem USB-Adapter
Abb. 023: Kompakter USB-Lader für AA- und AAA-Akkus der Typen NiMH und
NiCd
27
Page 28

7 NiMH- und NiCd-Akkus laden
Versuchsaufbau: Steckbrett, Kabel mit USB-A-Stecker, Widerstand
100 Ω, LED orangefarben, Akkuhalter, Akku AA oder AAA, wenn
vorhanden: Multimeter
Die Akkus wie z. B. die NiMH-Akkus und die NiCd-Akkus sind
Alternativen zu Einwegbatterien. Der zuletzt aufgeführte Akkutyp
wird nicht mehr verkauft.
Nickel-Metallhydrid-Akkus sind derzeit der häufigste Akkutyp und
in mehreren Formaten erhältlich. Hier wiederum dürften die am
häufigsten verwendeten Formate Mignon (AA) und Mikro (AAA)
sein. Beide können in den Batteriehalter aus dem Lernpaket
eingelegt und verwendet werden.
Die Akkutypen sind ladetechnisch und in der Anwendung weitgehend unproblematisch. Was in der praktischen Anwendung
manchmal störend ist, ist die niedrige Zellenspannung von 1,2 V im
Vergleich zur Systemspannung der Einwegbatterien mit 1,5 V.
Obwohl der Akkutyp Nickel-Kadmium nicht mehr im Handel ist,
sind noch viele dieser Akkus in Benutzung. Kadmium ist giftig, und
deshalb wurde der Vertrieb dieses Akkutyps verboten und eingestellt. Gleichzeitig sind die NiCd-Akkus sehr robust und funktionieren über lange Zeit problemlos, wenn sie richtig geladen und
genutzt werden.
Nachfolgend wird eine einfache Dauerladeschaltung (Ladeerhaltung) von der USB-Quelle für NiMH und NiCd-Akkuzellen aufgezeigt.
Die LED zeigt die Ladefunktion an und reguliert gleichzeitig den
Ladestrom auf ca. 20 mA (wenn der Akku leer ist). Je »voller« der
Akku geladen wird, desto geringer wird der Ladestrom und desto
weniger leuchtet die LED.
28
Page 29

Abb. 024: Aufbau Steckbrett; geladen wird ein Mignonakku.
Abb. 025: Schaltplan
Zusatzversuch (wenn ein Multimeter vorhanden ist): Multimeter im
Bereich Milliampere in Reihe zum Akku verdrahten. Dann kann
man den aktuellen Ladestrom ablesen.
29
Page 30

Abb. 026: Messaufbau
Abb. 027: Schaltbild
Mit einem Multimeter kann man den Ladestrom überprüfen und
natürlich auch die Akkuspannung messen. Zum Messen der Akkuspannung sind die Kabel des Multimeters direkt an den Akkuhalter
anzuschließen (parallel zum Akku).
30
Page 31

8 Konstantstromladen
Versuchsaufbau: USB-Kabel, Steckbrett, 1 Widerstand 1,5 Ω, 2
Widerstände 1 k, 1 Widerstand 1,2 Ω, LED orangefarben, SchottkyDiode BAT 42, Akkuhalter, Akku Mignon AA oder Mikro AAA
Konstantstromladen ist bei einfachen Ladegeräten eine verbreitete
Möglichkeit, Akkus zu laden. Abhängig von der Akkukapazität wird
mit einem konstanten Strom der leere Akku eine definierte Zeit lang
aufgeladen.
Abb. 028: Ladeempfehlung auf einem Akku: Konstantstromladung
Die auf dem Akku abgedruckte Ladeempfehlung gibt an, über
welchen Zeitraum und mit welcher Stromstärke geladen werden
soll. Bei der einfachen Konstantstromladung eines Akkus ist es die
übliche Praxis, ihn mit 1/10 des Stroms der Kapazitätsangabe 14
Stunden lang aufzuladen.
31
Page 32

Beispiel
Akkukapazität: 800 mAh, Ladestrom: 80 mA, Ladezeit: 14 Stunden. Sind die 14 Stunden Ladezeit vorbei, besteht die Möglichkeit, dass eine zeitgesteuerte Elektronik auf Erhaltungsladung
umschaltet. Die Ladeerhaltung kann mit 1/20 der Akkukapazität
oder weniger erfolgen, dementsprechend mit gleich oder weniger 40 mA.
Auch gibt es Ladegeräte mit einer thermischen Überwachung und
Abschaltung (z. B. bei Akkus von preiswerten Akkuschraubern).
Dies funktioniert vor allem bei NiCd-Akkus sehr gut, da diese, wenn
sie vollgeladen sind, die aus dem Ladegerät nachfließende Energie
in Wärme umwandeln. Somit ist für die Elektronik damit nachvollziehbar, dass der Akku nun vollgeladen ist.
Die Ladestrombegrenzung der Konstantstromladung wird bei einfachen Netzladegeräten durch einen Widerstand realisiert, der zwischen Netzteil und Akku eingefügt ist und den Ladestrom regelt.
Der Widerstand R1 wird mit der Formel: R = U/I berechnet. R ist der
Widerstand in Ohm, U die Spannung in Volt und I der Strom in
R1 sollte so dimensioniert sein, dass der Ladestrom für den
Ampere.
Akku geeignet ist.
Abb. 029: Prinzipschaltbild Konstantstromlader; R1 ist der für den Ladestrom
zuständige Widerstand.
32
Page 33

Die Lademethode mit Konstantstrom ist zwar sehr einfach, hat aber
auch einige Nachteile: Der Akku sollte vor dem Ladevorgang vollständig entladen sein, und der Ladestrom sollte in etwa von C/10
der Akkukapazität sein, um Ungenauigkeiten durch leichtes, aber
schadloses Überladen auszugleichen. Wenn der Akku schnellladefähig ist, kann der Ladestrom bei entsprechend kürzerer Ladezeit
auch höher sein.
Bei den älteren NiCd-Akkus kann, wenn der Akku nicht vollständig
entladen wurde, der sog. Memory-Effekt auftreten.
Memory-Effekt
Wird beim Entladen des Akkus nicht die ganze Kapazität genutzt
und der Akku nur zum Teil entladen und dann wieder aufgeladen, »merkt« sich der Akku diesen Zustand und gibt beim
nächsten Entladen nur noch diesen Teil an den Verbraucher ab.
Der geladene Akku verliert damit im Lauf der Lebensdauer
immer mehr an nutzbarer Kapazität, denn an der aus Kadmium
bestehenden Kathode werden Kristalle gebildet, die die Leistung
des Akkus reduzieren.
Der Memory-Effekt kann durch eine absichtliche Tiefentladung
»gelöscht« werden. In modernen Akkus zeigt er sich nur noch
selten.
33
Page 34

Abb. 030: Steckbrettaufbau: Laden mit Konstantstrom
Den Spannungsteiler, bestehend aus R2 und D2, sowie den Basiswiderstand R4 kann man auch verändern. Dadurch wird sich der
konstante Ladestrom verändern. So kann man zunächst mit R4
experimentieren, d. h. den 1-k-Widerstand (R4) durch den 2,2-kWiderstand des Lernpakets austauschen, und erhält damit einen
geringeren Ladestrom zum Akku.
34
Page 35

Abb. 031: Schaltbild des Konstantstromladers
9 Impulsladen
Versuchsaufbau: USB-Kabel, Steckbrett, Blink-LED, LED orangefarben, Diode 1N 4001, Transistor T1 2N3904, Transistor T2 N3906,
Widerstand 10 Ω, 2 Widerstände 1 k, Akkuhalter, Akku AA Mignon
oder AAA Mikro
Durch die Impulsladung wird der Memoryeffekt auch bei älteren
Akkuzellen weitgehend verhindert. Kurze Stromstöße laden die
Akkuzelle. Der Akku wird je nach Beschaltung schneller oder langsamer aufgeladen, und es lassen sich teilweise auch ältere Akkus
regenerieren.
35
Page 36

Abb. 032: Versuchsaufbau für die Impulsladung; beide Transistoren sind so
eingesteckt, dass die Typenbezeichnung vom Betrachter aus gesehen lesbar ist.
Der obere Transistor ist T2 (2N3906), die linke LED ist die Blink-LED.
Die Blink-LED bildet zusammen mit dem Widerstand R2 einen
Spannungsteiler und gibt die Impulse an die Basis von Transistor
T1. T1 steuert über die Kollektor-Emitter-Strecke den Basiseingang
des Transistors T2. Dieser gibt als Längstransistor den Stromfluss
zum Akku frei. Die orangefarbene LED zeigt durch ihre blinkende
Helligkeit an, ob und wie viel Strom zum Akku fließt.
36
Page 37

Abb. 033: Schaltbild Impulsladung
Wenn ein Multimeter zur Hand ist, kann man die pulsierende und
ansteigende Akkuspannung beobachten. Wird die Diode D2 überbrückt, geht der Ladevorgang schneller (mehr Ladestrom), allerdings auf Kosten der Lebensdauer der orangefarbenen LED.
37
Page 38

Abb. 034: Anordnung zum Messen der Impulsladung mit einem Multimeter
10 Nickel-Zink-Zelle laden
Versuchsaufbau: USB-Kabel, Steckbrett, rote LED, orangefarbene
LED, Widerstand 100 Ω, Akkuhalter, Akku AA Mignon oder AAA
Mikro.
Eine ganz alte und gleichzeitig neuere Entwicklung auf dem Akkumarkt ist die Nickel-Zink-Zelle (NiZn). Der Vorteil dieses Zellentyps
ist eine höhere Zellspannung von ca. 1,6 V. Somit ist sie als Ersatz
von Einwegbatterien (1,5 V) besser nutzbar. Gerade bei Elektronikgeräten, die für nur eine oder zwei Batteriezellen vorgesehen sind,
sind die NiMh-Zellen oft zu schnell unterhalb der erforderlichen
Betriebsspannung. Dadurch kann die Kapazität nicht vollständig
genutzt werden.
38
Page 39

Interessant ist, dass die Kapazität beim NiZn-Akku nicht mehr in
Milliampere, sondern in Milliwattstunde angegeben wird.
Die Spannung einer frisch geladenen NiZn-Zelle liegt bei ca. 1,8 V
und die Entladeschlussspannung, je nach Strombelastung, bei etwa
1,2 V. Da die Zellenart noch jung ist, gibt es bisher wenig Erfahrungen mit der Zyklenzahl.
Akkuzyklen
entladen werden kann, bevor sie unbrauchbar ist.
Abb. 035: Profi-Ladegerät Nickel-Zink, für AA und AAA-Zellen
bedeutet, wie oft die Akkuzelle vollständig be- und
39
Page 40

Die erforderliche Ladetechnik für die NiZn-Akkus ist im Prinzip
einfach und ähnelt der Ladetechnik von Bleiakkus. Prozessorgesteuerte Ladegeräte bieten einen höheren Sicherheitsstandard und
einen bessern Ladewirkungsgrad mit mehr Möglichkeiten bei der
Lade- und Entladetechnik.
Das Ladeprinzip
Es wird mit einer Strombegrenzung geladen, die etwa das 0,5bis 1-fache der Akkukapazität beträgt (0,7 A bis 1,5 A beim AATyp). Die Ladeschlussspannung, d. h. die Spannung, wenn der
Akku voll ist, beträgt ca. 1,9 V. Gleichzeitig geht der Ladestrom
beim Ladeende auf unter 0,05 C (bei der AA-Zelle 75 mA)
zurück.
Die spezifische Energiedichte beträgt ca. 50 Wh/kg, das ist in
etwa gleich wie bei den NiCd-Akkus, aber geringer als beim
NiMh- und dem Li-Akku.
C
steht dabei für die Kapazität des Akkus, normalerweise in
Milliamperestunden (mAh).
Ein einfaches Experimentier-USB-Ladegerät, mit dem die NiZnAkkuzelle geladen werden kann, zeigt Abb. 036 als Steckbrettaufbau. Als Akkuzelle wird der kleinere AAA-Mikro-Akku mit 550 mAh
verwendet.
Wichtig beim Schaltungsaufbau für ein einfaches Ladegerät ist, dass
die Ladeendspannung auf max. 1,9 V stabilisiert/begrenzt wird.
Wenn der zum Laden verwendete Strom niedriger ist, ist dies
unproblematisch, der Ladevorgang dauert lediglich länger. Bei
vielen Akkutypen ist eine sanftere Ladung (mit geringerem Strom)
eher von Vorteil und trägt zu mehr Ladezyklen bei. Schnellladegeräte laden Akkus in möglichst kurzer Zeit.
40
Page 41

Auf den Akkuverpackungen und dem Akkugehäuse der NiZn-Akkus
gibt es die Ladeempfehlung:
AA Mignon: 12–15 Stunden mit 150 mA, schnellladefähig
AAA Mikro: 12–15 Stunden mit 55 mA, schnellladefähig
Bei der vorgestellten Ladeschaltung wird die Ladeendspannung
durch die orangefarbene LED realisiert. Diese LED zeigt gleichzeitig
auch den Ladezustand an. Wenn der Akku leer ist, leuchtet die LED
nicht, wenn er mehr Ladung hat, leuchtet sie hell. Der Strom wird
durch den Widerstand R1 und die rote LED geregelt.
Abb. 036: Steckbrettaufbau, Ladeschaltung NiZn-Akku
41
Page 42

Abb. 037: Schaltbild
Die Selbstentladung der NiZn-Zellen findet abhängig von der Umgebungstemperatur statt, erfahrungsgemäß im Bereich von ca. 5–7 %.
11 Lithium-Akku Laden
Versuchsaufbau: USB-Kabel, Steckbrett, rote LED, 2 Dioden 1N 4001,
Widerstand 1 k, Kabel mit Krokodilklemmen rot und schwarz,
Lithium-Akku.
Die meisten Mobiltelefone und Smartphones, Notebooks und
Tablet-PCs arbeiten mit Lithium-Polymer(LiPo)- oder LithiumIonen(Li-Ion)-Akkus.
Dieser Akkutyp hat bei geringem Gewicht eine hohe Energiedichte.
Die Akkus sind auswechselbar oder fest eingebaut (eingelötet). Ein
Problem ist, dass es bei dieser Akkuform viele unterschiedliche
Ausbildungsformen gibt (flach, rund, eckig usw.), keinen einheitlichen Standard wie bei den Einwegbatterien (z. B. Mignon- und
Mikrozellen).
Die Energiedichte liegt bei 95–400 Wh/l, je nach den verwendeten
Materialien und Nutzung. Wird der Akku nur zum Teil ge- und dann
42
Page 43

wieder teilweise entladen, wird die Anzahl der möglichen Ladezyklen stark erhöht. Gleichzeitig sinkt dadurch die nutzbare Energiedichte.
Die Ladungsart ist weniger kompliziert als oft angenommen und
sieht im Prinzip wie folgt aus: Wenn der Akku sehr tief entladen
wurde, sollte mit einem sehr niedrigen Ladestrom begonnen werden. Im normalen Ladevorgang kann die Zelle aber mit konstantem
maximalen Strom im Bereich von 0,5–1 C geladen werden.
Die Ladeschlussspannung beträgt je nach Typ 4,1–4,2 V und sollte
auf gar keinen Fall überschritten werden. Es dient der Langlebigkeit
des Akkus, wenn die Ladeschlussspannung eher etwas niedriger
gehalten wird. Sinnvoll sind 3,9–4,0 V (je nach Akkutyp).
Natürlich können LiPo- und Li-Ion-Akkus auch mit einem geringeren
Ladestrom geladen werden. Auch dadurch erhöht sich die erreichbare Zyklenzahl (die Anzahl der Lade- und Entladevorgänge).
Vollständig geladen (voll) ist der Akku bei einer Ladeschlussspannung von 4,1–4,2 V, gleichzeitig sinkt dann der Ladestrom bis auf
etwa C/10. Das ist auch die technische Messauswertung für automatische Ladegeräte, die Ladung zu beenden.
Hinweis zur Entladung
Die Entladeschlussspannung darf auf gar keinen Fall unter 2,5 V
gehen, andernfalls wird die Akkuzelle zerstört. Das meist im
Akku eingebaute Akkumanagement schaltet deshalb in der
Regel bei 3,0 V ab.
Es ist empfehlenswert, Lithium-Akkus »sanft« zu (ent-)laden
(nur bis ca. 30 %), da sich ihre Lebensdauer so verlängert.
43
Page 44

Will man ein Ladegerät selbst bauen, ist die exakte Regelung der
Ladeendspannung zwingend erforderlich. Eine stabilisierte Spannungsversorgung wird man normalerweise mit Festspannungsreglern aufbauen. Gleichzeitig gibt es auf dem Markt fertige Lade-ICs
zur komfortablen und sicherheitstechnisch guten Ladung der
Lithium-Akkus.
Wichtig
Für die folgenden Ladeexperimente wird dringend empfohlen,
ausschließlich Lithium-Akkus mit integrierter Schutzelektronik
zu verwenden. Das sind herausnehmbare Akkus, wie sie in
Mobiltelefonen, Kameras usw. verwendet werden.
Abb. 038: Geeigneter Akku mit integrierter Sicherheits-/Schutzelektronik
Die integrierte Sicherheitselektronik sorgt dafür, dass der Akku
weder überladen wird noch beim Entladen in Unterspannung
kommt, und schaltet notfalls die Verbindung zu den Akkukontakten ab.
44
Page 45

So kann man mit Akkus aus Mobiltelefonen problemlos experimentieren, solange die obere und untere Temperaturgrenze und
der Maximalladestrom (1C) nicht überschritten werden.
Die Ladeschaltung zum Laden eines Lithium-Akkus mit der USBQuelle wird mit einfachsten Komponenten auf dem Steckbrett
aufgebaut. Es gilt, die Spannung, die durch die USB-Quelle auf 5 V
stabilisiert ist, auf eine verträgliche Ladeendspannung von knapp
4 V zu reduzieren. Die LED sorgt mit einem geringen Stromverbrauch dafür, dass auch die Leerlaufspannung (ohne Akku) am
Ausgang nicht über 4 V geht. Der Ladestrom wird ebenfalls durch
die Komponenten geregelt und geht mit zunehmender Ladung/
Akkuspannung zurück. Auch wenn diese einfache Ladeschaltung
funktioniert, handelt es sich hier um ein Ladeexperiment, und man
darf dabei keinen Komfortlader erwarten.
Die Kontakte des Lithium-Akkus kann man mit den Krokodilklemmen anschließen. Je nach Akkutyp funktioniert das gut oder weniger gut. Am zuverlässigsten wäre es natürlich, zwei Kabel an die
Goldkontakte anzulöten, sofern eine Lötausrüstung zur Verfügung
steht. Andernfalls kann man auch den oberen Bereich des Akkus,
da, wo die Kontakte sind, etwas vom Akkukörper abheben, sodass
die Klemmen zwischen Kontaktleiste und Akkukörper Halt finden.
45
Page 46

Abb. 039: Klemmverbindung mit den Akkukontakten
Abb. 040: Schaltbild einfacher Lithiumlader
Wenn ein Multimeter zur Hand ist, kann man entweder die steigende Akkuspannung oder den Ladestrom messen.
46
Page 47

a)
b)
Abb. 041: a) Akkuladung und Überwachung durch das Multimeter.
b) Der Schaltplan dazu
47
Page 48

12 Laden überwachen
Es gibt mehrere Möglichkeiten, die Leistungswerte rund um den zu
ladenden Akku feststellen:
Anzeige mit LEDs
Messungen mit einem Multimeter
LCD-Anzeigen
Messung und Auswertung mit dem PC
Mit Leuchtdioden lassen sich einfache Messaufgaben (z. B. die
Polaritätsanzeige) oder grundsätzliche Funktionsanzeigen (z. B. ob
Ladestrom fließt oder nicht) gut erledigen. Wenn detaillierte Messangaben erwünscht sind, ist ein Multimeter eine gute Hilfe. Im
Lernpaket werden einfache Messungen und Funktionsanzeigen mit
LEDs realisiert. Wer ein Multimeter zur Hand hat, kann dieses
zusätzlich nutzen.
12.1 Akkutankanzeige
Versuchsaufbau: Steckbrett, USB-Kabel, Blink-LED, LED orangefarben, Diode 1N4001, Widerstand 1 k, Lithium-Akku
Ist der Energiespeicher nun leer, halb voll oder voll? Dazu brauchen
wir eine Anzeige, ähnlich wie beim Kfz die Tankanzeige, nur dass
eine aussagekräftige Tankanzeige für den Ladezustand des Akkus
sehr viel komplizierter ist. Der Ladezustand ist von vielen Faktoren
wie Ladeart und Entladeart, Kapazität usw. abhängig. Es gibt aber
noch eine ganze Reihe weiterer Faktoren wie z. B. Betriebstemperatur, Alter des Akkus (Lebenszeit) und einige mehr, die den Ladezustand weiter beeinflussen können.
Um alle Faktoren in den Griff zu bekommen, gibt es raffinierte
Überwachungselektroniken mit Mikroprozessoren und aufwendiger
Software.
48
Page 49

Mit den Teilen Ihres Lernpakets können Sie eine einfache Ladezustandsanzeige aufbauen, um das Grundprinzip zu erfahren.
In Abb. 042 sehen Sie den Versuchsaufbau einer sehr einfachen
Ladezustandsanzeige. Nach dem Aufbau der Komponenten zuerst
den Lithium-Akku mit den Krokodilklemmen an das Steckbrett
anschließen. Dann leuchtet die orangefarbene LED. Sobald der USBStecker in das USB-Netzgerät gesteckt wird, wird der Akku mit ca.
200 mA geladen. Kurze Zeit später beginnt die Blink-LED zu blinken
und zeigt an, dass der Akku die Spannung um die 4 V erreicht hat.
Die Blink-LED blinkt zuerst langsamer und dann schneller. Das ist
das Zeichen, die Ladung sofort zu beenden. Ein komfortables Ladegerät würde dies dann automatisch machen.
Abb. 042: Versuchsaufbau einer einfachen Ladezustandsanzeige
49
Page 50

Abb. 043: Schaltbild der Ladezustandsanzeige
Die einfache Akkutankanzeige wird nach wie vor über die Spannungsmessung des Akkus realisiert. Ein Fortschritt wäre, die Spannungsmessung unter Last (Stromentnahme aus dem Akku) durchzuführen. Die Last sollte dabei einen Stromverbrauch von etwa 10 %
der Kapazität des Akkus haben und könnte im Moment der Messung durch einen Taster aktiviert werden.
13 Akkus testen
Jeder kennt das: Man hat Akkus für die verschiedensten Anwendungen in der Schublade liegen, und nun ist die Frage, wie viel noch
drin ist. Das ist vor allen dann wichtig, wenn mehrere Akkus
verwendet werden, denn ein elektronisches Gerät funktioniert nur
dann, wenn alle Akkus ausreichend geladen sind. Nur die
Spannung zu messen, sagt zu wenig über die »Belastungsfähigkeit«
des Akkus aus.
Abb. 044 zeigt einen einfachen Akkuprüfer mit Drehspulinstrument
und einer Glühbirne (1,5 V) als Belastungswiderstand – der Vorteil
der Glühbirne ist ein gutes visuelles Signal, das die Leistungsfähigkeit des Akkus zeigt.
50
Page 51

Als Alternative zur Glühbirne kann auch ein Belastungswiderstand
von 10 Ω verwendet werden. Der Belastungsstrom für den Akku
beträgt dann ca. 150 mA.
Abb. 044: Einfacher Akkuprüfer (Selbstbautestgerät) für AA- und
AAA-Akkuzellen mit Drehspulinstrument und Glühbirne (1,5 V) als
Belastungswiderstand
Nachfolgend werden Akkuzustands-Testschaltungen für Nickel-ZinkZellen vorgestellt.
51
Page 52

13.1 Test mit niedrigem Strom
Versuchsaufbau: Steckbrett, rote LED, Widerstand 100 Ω, Akkuhalter, NiZn-Akku, Mikro AAA.
Die Tests können auch mit anderen Akkutypen durchgeführt
werden, sofern ein Multimeter zur Hand ist, mit dem die Akkuspannung unter Last angezeigt werden kann.
Der Test mit niedriger Strombelastung ist auch für ältere Akkus, die
frisch aufgeladen wurden, meist kein großes Problem. Als Tastschalter für den Akkutest wird ein Stück Draht abisoliert und, wie
in der Abbildung zu sehen ist, in die Kontakte des Steckbretts
montiert.
52
Page 53

Abb. 045: Steckbrettaufbau für den Akkutest
53
Page 54

Abb. 046: Schaltbild
Den Akku in den Batteriehalter einlegen; wenn die Akkuzelle voll
geladen ist, leuchtet die LED. Nun den Taster drücken. Die LED wird
geringfügig dunkler. Mit dem 100-Ω-Widerstand fließen etwa 15 mA
Belastungsstrom. Das ist für den Akku mit Leichtigkeit zu leisten,
daher sinkt die Akkuspannung auch nur geringfügig.
13.2 Test mit hohem Strom
Versuchsaufbau: Steckbrett, rote LED, Widerstand 1,2 Ω, Akkuhalter, Akku
Die Tests können auch mit anderen Akkutypen durchgeführt
werden, sofern ein Multimeter zur Hand ist, mit dem die Akkuspannung unter Last angezeigt werden kann.
Der Test mit höherem Stromfluss stellt für den Akku eine höhere
Herausforderung dar. Dabei ist darauf zu achten, mit welchem
Entladestrom der Akku maximal belastet werden darf, ohne dass er
Schaden nimmt. Bei Lithium-Akkus ist es meist ein Strom in Höhe
der doppelten Kapazität, bei Nickel-Zink-Akkus lautet die Empfehlung: nicht tiefer als bis zur Spannung von 1,2 V entladen und
maximal mit 1C entladen. Das bedeutet für den AA-Mignon-Akku
54
Page 55

einen maximalen Strom von 1,5 A und für die kleinere AAA-Zelle
etwa 550 mA maximalen Entladestrom.
Nun wird der Widerstand R1 ausgetauscht. Anstatt des 100-Ω-
Widerstands kommt nun der 1,2-Ω-Widerstand in das Steckbrett.
Wenn jetzt der Draht-Taster gedrückt wird, geht die LED aus. Der
Belastungsstrom beträgt, wenn man ihn mit der Formel R = U / I
errechnet, ca. 1 A und mit dem Multimeter gemessen um die 0,5 A.
Das praktische Messergebnis kann von vom errechneten Wert
abweichen. Das liegt an den Steckbrettkontakten, Akkuhalterkontakten, Kabeln, Innenwiderstand des Akkus usw.
Wenn der Taster wieder losgelassen wird und der Akku gut geladen
war, leuchtet die LED wieder wie zuvor. Wenn nicht, ist es gut, den
Akku zu laden. Dann hat er den Belastungstest nicht bestanden.
Mit dem Multimeter kann man es nachmessen: Ohne Belastung hat
die NiZn-Akkuzelle z. B. 1,75 V, unter Belastung sinkt die Spannung
auf 1,3 V.
55
Page 56

Abb. 047: Steckbrettaufbau
56
Abb. 048: Schaltbild
Page 57

Abb. 049: Messaufbau mit Multimeter
Akkuwirkungsgrade
Der Akkuwirkungsgrad sagt aus, wie viel reingeladen wurde und
wie viel davon man wieder aus dem Akku entnehmen kann.
Die Wirkungsgrade der unterschiedlichen Akkutypen schwanken
stark im Bereich von ca. 70–90 %.
14 Akku und Solarmodul
Versuchsaufbau: Solarmodul, Steckbrett, Steckstifte, Widerstand
100 Ω, rote LED
Die Vorderseite des ungebrauchten Solarmoduls ist mit einer Folie
geschützt. Diese zuerst abziehen.
57
Page 58

Auf der Rückseite des Moduls befinden sich zwei Lötanschlüsse mit
angelöteten Kabeln. Das Modul liefert Gleichstrom. Somit gibt es
wie bei einer Batterie ein rotes Kabel, den Pluspol, und ein schwarzes Kabel, den Minuspol. Schieben Sie die Kabel durch die Bohrungen des Steckbretts (Zugentlastung) und schließen Sie dann das
schwarze und das rote Kabel an das Steckbrett an. Es wird empfohlen, in die untere Schiene den schwarzen Anschluss und die
obere Schiene den roten Anschluss einzustecken.
Das Solarmodul kann für die nachfolgenden Experimente angeschlossen bleiben.
a)
58
Page 59

b)
Abb. 050: a) Die Anschlussleitungen des Solarmoduls an das Steckbrett
anschließen. b) Mit den Steckstiften können die Kabel zusätzlich gesichert werden.
Positionieren Sie das Solarmodul so, dass ausreichend helles Licht,
bevorzugt Sonnenlicht, darauffällt.
Für den Fall, dass während der Experimente die Sonne nicht
scheint, geht als Ersatz eine helle Schreibtischleuchte z. B. mit
einer Halogenbirne (mindestens 30 W). Energiesparlampen und
LED-Lampen sind nicht geeignet.
Nun stecken Sie die Anschlüsse der roten LED und den Vorwiderstand 100 Ω ins Steckbrett. Der längere Anschluss der Leuchtdiode
ist mit der +-»Seite« zu verbinden. Je nach Bestrahlungsintensität
leuchtet die Leuchtdiode mehr oder weniger hell. Wenn die LED
nicht leuchtet, ist entweder zu wenig »Lichtenergie« vorhanden
oder die LED wurde mit falscher Polungsrichtung angeschlossen.
59
Page 60

Blinkt die Leuchtdiode, haben Sie versehentlich die blinkende LED
verwendet.
Abb. 051: Steckbrettaufbau; einfacher Funktionstest mit der roten Leuchtdiode
Abb. 052: Schaltbild
60
Page 61

Diesen Versuch können Sie mit unterschiedlichen Lichtquellen
durchführen, z. B. mit der direkten Sonne, einer Halogenlampe,
einer Glühlampe, einer Taschenlampe, einer Energiesparlampe,
einer Leuchtstofflampe usw. Man kann an der Helligkeit, in der die
LED leuchtet, erkennen, dass es geeignete und weniger geeignete
Lichtquellen gibt. Dieses Experiment ist wichtig, damit Sie für die
nachfolgenden Experimente über die geeignete Beleuchtung
Bescheid wissen.
14.1 Akkus mit Solarenergie laden
Versuchsaufbau: Solarmodule, Steckbrett, LED rot, Akkuhalter,
Akku
Wenn ausreichend Sonnenschein zur Verfügung steht, macht es viel
Freude, mit dieser Energie Akkus zu laden. Der Strom ist kostenfrei,
und man ist unabhängig von einer Steckdose.
Mit dem Solarmodul des Lernpakets können alle bisher beschriebenen Akkutypen, wie NiMh, NiCd, NiZn, Li-Ion und LiPo aufgeladen werden.
Das Solarmodul hat auch einen großen technischen Vorteil. Sowohl
für die Strombegrenzung als auch für die maximale Ladespannung
braucht es in der Regel keine weiteren Bauteile, sofern das Solarmodul auf die Leistungsbedingungen des Akkus abgestimmt wurde.
So kann das Solarmodul aus dem Lernpaket – das bei vollem Sonnenschein ca. 35 mA Strom und eine maximale Spannung von 4,5 V
liefert, gefahrlos die aufgeführten Akkutypen laden und auch dafür
sorgen, dass eine eventuelle Selbstentladung automatisch ausgeglichen wird (Ladungserhaltung).
61
Page 62

Die Verhältnismäßigkeit von Solarmodul und Akku ändert sich
bei »größeren« (leistungsfähigeren) Solarmodulen, die mehr
Strom und höhere Spannung liefern können. Dann ist eine
Ladestrombegrenzung und/oder eine Ladeelektronik dringend
erforderlich, andernfalls wird der Akku geschädigt oder zerstört.
Abb. 053: Steckbrettaufbau: einfacher Solarlader mit LED als Ladeanzeige
62
Page 63

Abb. 054: Schaltplan; Ladestromanzeige mit einer LED
Im Ladestromkreis kann sowohl die rote als auch die orangefarbene
LED verwendet werden. Bei der orangefarbenen LED ist der Ladestrom etwas höher.
14.2 Solarlader – was es zu beachten gilt
Versuchsaufbau (wie zuvor): Solarmodule, Steckbrett, LED, Akkuhalter, Akku
Je nach Akkutyp gibt es eine Reihe von Möglichkeiten, die Solarmodule so zu konfektionieren, dass der Akku optimal geladen wird.
Durch die Anzahl der Solarzellen in Reihe ergibt sich die maximale
obere Ladespannung. Durch die Größe und die Qualität der Solarzellen wird der maximale Ladestrom bestimmt. Natürlich ist der
Ladestrom auch abhängig von der Strahlungsenergie der Sonne.
63
Page 64

Bei kleineren NiCd- und NiMH-Akkus ist es eine einfache Möglichkeit, dies über den maximalen vom Solarmodul kommenden Ladestrom zu regeln.
Bleisäure- und Bleigelakkus hingegen werden in einfachster Variante über die Höhe der Ladeendspannung geregelt.
Ein »großer« Solarbleiakku mit 12 V Akkuspannung kann somit
ohne Probleme an einem Solarmodul mit einer maximalen Zellenspannung (Leerlaufspannung) von 15 V geladen werden. Die Ladekurve regelt sich dann von selbst. Je höher die Ladespannung des
zu ladenden Akkus ansteigt, desto geringer wird der Ladestrom, den
das Solarmodul liefert (automatische Anpassung). Diese Ladeart ist
zwar praktikabel, aber nicht optimal für die vollständige Nutzbarkeit und die Lebensdauer der Akkus.
Beim Solarmodul ist die Ausrichtung entscheidend. Nehmen Sie das
Solarmodul zwischen Daumen und Zeigefinger (ohne die Oberfläche zu beschatten) und richten Sie die Oberfläche des Moduls
möglichst rechtwinkelig zur Lichtquelle (Sonne) aus. Wann leuchtet
die LED heller? Variieren Sie nun durch Hin- und Herbewegen des
Solarmoduls die Ausrichtung zur Lichtquelle und beobachten Sie
die LED. Je heller sie leuchtet, desto mehr Ladestrom fließt vom
Modul in den Akku.
Je senkrechter die Lichtstrahlen auf das Solarmodul auftreffen,
desto mehr Lichtenergie können die Solarzellen in elektrischen
Strom umwandeln und desto mehr Ladestrom fließt vom Modul
in den Akku.
64
Page 65

Abb. 055: Experiment mit der Ausrichtung des Moduls zur Lichtquelle
15 Rückstromsperre verwenden
Experimentieraufbau: Solarmodul, Steckbrett, Elko 1.000 µF,
Schottky-Diode, Widerstand 100 Ω, LED rot
Beim solaren Laden eines Akkus würde sich ohne Schutzdiode die
Ladung nachts wieder über das Solarmodul »rückwärts« entladen.
Daher muss eine Rückstromsperre in Form einer Diode eingefügt wer-
65
Page 66

den. Die Diode funktioniert wie ein Ventil, das den Energiestrom nur
in die eine Richtung zulässt und in die andere Richtung verhindert.
Um das Prinzip verdeutlichen, machen Sie das Experiment mit dem
Elko 1.000 µF (den Akku dazu aus der Halterung entnehmen).
Zusätzlich zum Stromspeicher Elko stecken Sie eine LED und einen
Vorwiderstand in das Steckbrett. So kann man den Speichereffekt
abhängig von der Rückstromdiode erforschen.
Abb. 056: Prinzip der Schaltung mit Sperrdiode
Drehen Sie einmal die Diode im Steckbrett herum – was passiert?
Die LED leuchtet nicht mehr, da der vom Solarmodul kommende
Strom gesperrt wird.
66
Page 67

Sperrdioden verhindern die Entladung des Energiespeichers
über die unbeleuchtete Solarzelle.
a)
b)
Abb. 057: a) Steckbrettaufbau, b) Detail. Die Sperrdiode
ist rechts im Bild zu erkennen (Pfeil)
67
Page 68

16 Laderegler einsetzen
Versuchsaufbau: Solarmodul, Steckbrett, rote LED, Elko 1.000 µF,
Transistor T1 2N3906, Widerstand 2,2 k, Tastschalter, Akkuhalter,
Akku
Bei Photovoltaik-Inselanlagen wird die gesamte Stromversorgung
regenerativ gewonnen. Mithilfe des Akkuspeichers wird diese
Energie für die spätere Nutzung aufbewahrt. Wichtig bei der Akkuladung ist ein Laderegler, der dafür sorgt, dass der Akku so voll wie
möglich ge-, aber nicht überladen wird.
Abb. 058: Versuchsaufbau des Ladereglers auf dem Steckbrett
Die Steuerelektronik wird im Versuchsaufbau durch einen Drahttaster ersetzt, den Sie von Hand bedienen können. Der Längstransistor
T1 wird über dessen Basis angesteuert und regelt über die KollektorEmitter-Strecke Ladestrom und Spannung. Die rote LED zeigt an,
wenn Ladestrom fließt, und blitzt kurz auf, wenn der Taster gedrückt wird und Energie in den Akku fließt.
68
Page 69

Abb. 059: Schaltbild
Laderegler
Mit dem auf dem Steckbrett aufgebauten Laderegler können Sie das
Prinzip des seriellen Shunt-Reglers (Längsregler) nachvollziehen.
Der für die Ladereglung verwendete Längstransistor regelt den vom
Solarmodul zum Akku fließenden Strom und die Spannung. Die
Regelung wird im Versuchsaufbau durch manuelles Takten (von
Hand) des zugeführten Stroms (Taktlänge und Frequenz) mit dem
Schalter S1 erreicht. Bei den automatischen Reglern findet dieses
Takten elektronisch statt. Dann fließt mehr Strom, wenn die Pausen
von einem Takt zum anderen kürzer werden und die Taktfrequenz
erhöht wird. Während des Ladevorgangs erhält der Akku somit
kurzzeitige Stromimpulse, die, je nach Ladespannungshöhe, kürzer
oder länger sind (Pulsweitenmodulation). Die Regelung des Ladestroms wird beim Längsregler in Abhängigkeit von der Ladespannung des Akkus elektronisch gesteuert.
Ein weiterer Vorteil des Längstransistors ist, dass er verhindert, dass
sich der geladene Akku nachts über das Solarmodul wieder »rückwärts« entlädt.
69
Page 70

17 Solare Ladeüberwachung des Lithium-
Akkus
Versuchsaufbau: Solarmodul, Steckbrett, Blink-LED, rote LED,
orangefarbene LED, Schottky-Diode BAT 42, Elko 1.000 µF, Widerstand 1 k, Krokodilklemmen, Lithium-Akku
In Abb. 060 sehen Sie den Versuchsaufbau einer einfachen Ladeüberwachung beim solaren Laden des Lithium-Akkus. Die obere
rote LED zeigt den fließenden Ladestrom an und leuchtet, solange
der Lithium-Akku geladen wird. Die mittlere Blink-LED (»B«) in
Verbindung mit der Diode und der orangefarbenen LED beginnt
dann zu leuchten und zeigt somit an, wenn der Akku halb voll oder
voll geladen ist.
sind, blinkt die LED erst ab einer Spannung von ca. 3,8 V.
Da D1, D5 und die rote LED in Reihe geschaltet
Abb. 060: Versuchsaufbau auf dem Steckbrett
70
Page 71

LED, rot
Abb. 061: Schaltbild der Ladezustandsanzeige
Die einfache Akkuladeüberwachung wird durch die Spannungsmessung des Akkus realisiert.
71
Page 72

Abb. 062: Detail des
Steckbrettaufbaus, mit den
Krokokabeln ist der
Lithium-Akku
angeschlossen
18 Kombilader, Laden und Ladung erhalten
Versuchsaufbau: Solarmodul, Steckbrett, USB-Kabel, Blink-LED, rote
LED, orangefarbene LED, Diode 1N 4001, Widerstand 1,5 Ω, Widerstand 1,2 Ω, 2 Widerstände 1 k, Transistor 2N3904, Akkuhalter,
NiZn-Akku
Je nach Akkutyp gibt es eine mehr oder weniger hohe Selbstentladung. Wurde der Akku voll geladen, dann zwischengelagert und
wird dann dringend gebraucht, ist es ärgerlich, wenn man ihn erst
wieder aufladen muss.
Nachfolgend wird eine Kombination aus einem USB-Netzladegerät
zum zügigen Aufladen der Akkuzelle und einem Solarmodul (mit
72
Page 73

kostenlosem Strom) für die sanfte Ladung oder auch die alternative
solare Dauerladung aufgezeigt.
a)
73
Page 74

b)
c)
Abb. 063: a) Steckbrettaufbau, b) praktische Anwendung und c) Detail
74
Page 75

Funktion: Wird der USB-Stecker mit der USB-Quelle verbunden,
leuchtet die orangefarbene LED. Der Akku wird mit einem konstanten Strom von ca. 70–80 mA geladen. Ab einer Akkuspannung
von ca. 1,7 V beginnt die Blink-LED zu blinken und signalisiert
damit, dass die Akkuzelle bald geladen ist. Zusätzlich leuchtet die
rote LED, wenn der Akku auch mit Solarenergie durch das angeschlossene Solarmodul geladen wird – unabhängig davon, ob der
Akku mit USB geladen wird oder nicht.
Abb. 064: Schaltbild
Diesen Schaltungsaufbau finden Sie auch in farbiger Darstellung auf
dem Cover des Lernpakets.
19 Solarnachtlicht
Versuchsaufbau: Solarmodul, Steckbrett, orangefarbene LED,
Transistor T1 2N3904, Diode D1 1N4001, Widerstand R1 100 K, Elko
75
Page 76

1.000 µF, Krokodilkabel- und Klemmen, Lithium- oder alter
Mobiltelefonakku
Im nachfolgenden Experiment wird ein Energiespeicher tagsüber
geladen. Bei Dunkelheit gibt er die Energie wieder ab – im Experimentieraufbau hier über eine Leuchtdiode. Die Energieabgabe
findet so lange statt, bis die gespeicherte Energie aufgebraucht ist.
Das Experiment kann sowohl mit einem Akku als auch mit dem
Elko (1.000 µF) durchgeführt werden. Der kleine Kondensatorspeicher hat den Vorteil, dass das Funktionsprinzip ohne lange
Ladezeit leicht nachvollziehbar wird.
Abb. 066: Versuchsaufbau des Nachtlichts
76
Page 77

Abb. 067: Schaltbild für das Solarnachtlicht
Sobald es dunkel wird (z. B. bei abgedecktem Solarmodul), leuchtet
die LED auf. Sie erlischt, sobald das Solarmodul wieder Licht erhält.
Der Strom, der von den beleuchteten Solarmodulen kommt, sperrt
über die Basis von T1 dessen Kollektor-Emitter-Strecke. Der Akku
wird über die Diode D1 geladen. Wenn kein Licht mehr auf das
Solarmodul fällt, bleibt der Basisstrom aus, die Kollektor-EmitterStrecke lässt den Stromfluss vom Akku über die LED fließen, die
LED leuchtet.
Ein Lithium-Akku, der sich für das Mobiltelefon nicht mehr eignet,
kann so noch sinnvoll genutzt werden. In der praktischen Anwendung wird tagsüber der Akku geladen und bei Dunkelheit gibt
dieser die Energie wieder ab – im Experimentieraufbau hier über
eine orangefarbene Leuchtdiode. Je nach Akkukapazität und
Ladedauer brennt die LED die ganze Nacht. Ideal für den Betrieb
sind z. B. Kerzen-LEDs in einer selbst gebastelten Laterne. Das
Gehäuse der Laterne kann man z. B. einfach aus einem leeren
Tetrapack anfertigen.
77
Page 78

Abb. 068: Kerzenlichtlaterne nach dem oben beschriebenen Prinzip
Für ein Langzeitexperiment können ein rotes und ein schwarzes
Kabel an die Goldkontakte des alten Mobiltelefonakkus angelötet
oder die Kontakte mit den Krokodilklemmen angeschlossen werden.
78
Page 79

Abb. 069: Bereits durch das Abdecken eines Moduls wird das Nachtlicht aktiviert.
20 Erhalt der Leistungsfähigkeit von Akkus
20.1 Akku-Notfallrettung
Versuchsaufbau: Lithium-Akku, Krokodilkabel, Akkuzelle (tief
entladen)
Akkus, die lange ungebraucht aufbewahrt wurden oder an einem
Dauerstromverbraucher (z. B. einer elektrischen Uhr) angeschlossen
waren, erleiden oft einen Kollaps. Betroffen davon sind NiCd- wie
auch NiMh-Akkuzellen, die dann eine so niedrige Betriebsspannung
haben, dass sie von automatischen Akkuladegeräten weder erkannt
noch wieder aufgeladen werden können.
Abhilfe schaffen kurze, heftige Stromimpulse mit höherer Spannung, z. B. aus einem Lithium- oder einem 12-V-Autoakku.
79
Page 80

Abb. 065: Anwendung mit Lithium-Akku und Krokodilkabel
Bleibatterien, die längere Zeit ungenutzt lagern, bilden eine Isolierschicht auf den Plattenoberflächen, werden dadurch
hochohmig und lassen sich nicht mehr laden.
Abhilfe schafft hier, dem Akku wechselseitig Spannungen zuführen. Eine von der Polarität her »falsch« angelegte Spannung
kann helfen, die inneren Isolierschichten wieder abzubauen.
Zur Vorsorge gibt es sog. Akku-Refresher. Der Akku wird laufend
mit kurzen Impulsen im Millisekundenbereich »befeuert«. Die
Energie dafür wird aus dem Akku entnommen und ist geringer
als die ohnehin stattfindende Selbstentladung.
80
Page 81

20.2 Akkupflege
Versuchsaufbau: Akku über Tage und Monate gelagert
Akkus zum Betreiben von elektrischen und elektronischen Geräten,
die oft auch als Ersatz für teure Einwegbatterien eingesetzt werden,
sind in der Anschaffung nicht ganz billig. Sie sollten deshalb ihren
Dienst so lange wie möglich tun. Je nachdem, mit welchem technischen Verfahren der Akku geladen wird, variiert die mögliche Ladeund Entlademenge (Kapazität) und vor allem die Lebensdauer (die
Zyklen) des Akkus.
Es gibt inzwischen so viele Empfehlungen zur Akkupflege, dass die
Unsicherheit groß ist. Wie soll man welchen Akkutyp behandeln?
Wichtig ist, nicht alle Akkutypen über einen Kamm zu scheren.
Akkutypen, wie sie im Lernpaket vorgestellt werden, sind sog.
chemische Energiespeicher. In der Akkutechnologie gibt es unterschiedliche Modelle, die sich in der Hauptsache durch die chemischen Komponenten und den inneren Aufbau unterscheiden. Das
konnte man schon an den Kürzeln wie z. B. NiZn, NiMh usw. sehen.
Diese Verbindungen haben zusätzlich spezielle Eigenschaften. So
haben NiMh-Akkus eine hohe, Lithium-Akkus dagegen eine extrem
geringe Selbstentladung. Gleichzeitig gibt es aber auch einige grundsätzliche Eigenarten und Eigenschaften, die zu beachten sind:
Chemische Reaktionen werden durch die Umgebungstempera-
tur beeinflusst. Zu hohe und zu tiefe Temperaturen sind schädlich. Der Akku hält am besten, wenn die Temperatur gleichmäßig im Bereich von ca. 10–15 °C liegt. Der Kühlschrank ist zu
kalt.
Je höher die Zellenspannung ist, desto schneller altern die
Akkus, wenn sie gelagert werden. Deshalb sollten Akkus am
besten nur mit halber Ladung gelagert werden.
81
Page 82

Hohe Entladeströme stressen den Akku. Wenn der Akku mit
einem niedrigeren Strom als angeben entladen wird, hält er
länger. Alte Mobiltelefonakkus können problemlos noch lange
Zeit z. B. für sparsame LED-Taschenlampen verwendet werden.
Zu tief entladene und dann gelagerte Akkus altern schneller
oder lassen sich nicht mehr verwenden. Daher ist bei längerem
Lagern der Ladezustand zu überwachen und gegebenenfalls
nachzuladen.
82
 Loading...
Loading...