Page 1

3-KANAL-SCHALTSTUFE, Bausatz/Baustein
W I C H T I G E R
3-KANAL-SCHALTSTUFE, Bausatz/Baustein
H I N W E I S
UPGRADE
Stand: 10/02
Best.-Nr. 11 50 45 / 11 50 29
Wichtige Sicherheitshinweise!
- Netzspannungsleitungen und Verbraucherstrom-
kreise mit Spannung größer 35 Volt dürfen nur vom
Fachmann unter Einhaltung der VDEBestimmungen installiert werden.
- Eine Inbetriebnahme der Baugruppe darf nur in
einem isolierten Gehäuse und nur bei fest
geschlossenem Gehäusedeckel erfolgen.
- Bei Installations- und Wartungsarbeiten muss die
Baugruppe Stromlos geschaltet werden.
Page 2
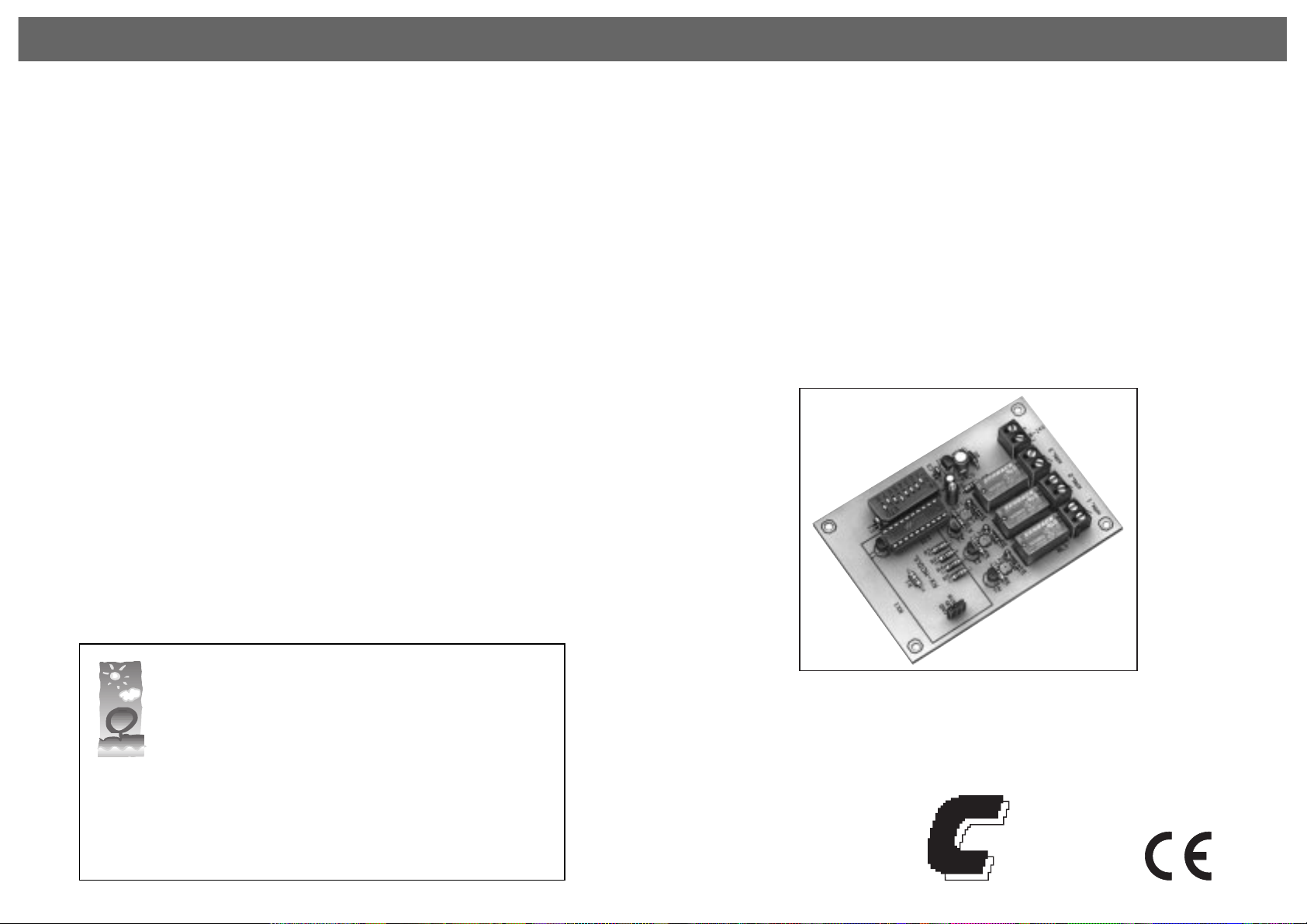
Impressum
Diese Bedienungsanleitung ist eine Publikation der Conrad Electronic GmbH,
Klaus-Conrad-Straße 1, D-92240 Hirschau.
Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten.Reproduktionen jeder Art,
z.B .Fotokopie,Mikroverfilmung, oder die Erfassung in EDV-Anlagen,bedürfen
der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.
Nachdruck, auch auszugsweise,verboten.
Diese Bedienungsanleitung entspricht dem technischen Stand bei Druckle-
gung. Änderung in Technik und Ausstattung vorbehalten.
Nachdruck mit freundlicher Genehmigung des ELECTRONIC ACTUELL Magazins.
©
Copyright 1997 by Conrad Electronic GmbH.Printed in Germany.
*356-02-99/05-KS
100%
Recyclingpapier.
Chlorfrei
gebleicht.
BEDIENUNGSANLEITUNG
3-Kanal-Schaltstufe
❏ Best.-Nr.: 11 50 45, Bausatz
❏ Best.-Nr.: 11 50 29, Baustein
Page 3

3
Derjenige, der einen Bausatz fertigstellt oder eine Baugruppe
durch Erweiterung bzw. Gehäuseeinbau betriebsbereit macht,
gilt nach DIN VDE 0869 als Hersteller und ist verpflichtet, bei der
Weitergabe des Gerätes alle Begleitpapiere mitzuliefern und
auch seinen Namen und seine Anschrift anzugeben. Geräte, die
aus Bausätzen selbst zusammengestellt werden, sind sicherheitstechnisch wie ein industrielles Produkt zu betrachten.
Hinweis (Fertigbaustein)
Dieses Gerät hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem
Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muß der Anwender die Sicherheitshinweise und Warnvermerke, die in dieser Anleitung enthalten sind, beachten!
Betriebsbedingungen
• Der Betrieb der Baugruppe darf nur an der dafür vorgeschriebenen Spannung erfolgen.
• Bei Geräten mit einer Betriebsspannung ≥ 35 Volt darf die
Endmontage nur vom Fachmann unter Einhaltung der VDE-Bestimmungen vorgenommen werden.
• Die Betriebslage des Gerätes ist beliebig.
• Es ist unbedingt auf die Einhaltung, der in dieser Anleitung angegebenen technischen Daten zu achten. Das Überschreiten
dieser Wertekann zu Schäden am Gerät oder Verbraucher führen.
• Bei der Installation des Gerätes ist auf ausreichenden Kabelquerschnitt der Anschlußleitungen zu achten!
• Die angeschlossenen Verbraucher sind entsprechend den VDEVorschriften zu verbinden.
2
Wichtig! Un bedingt lesen!
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Bei Schäden, die durch
Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung entstehen, erlischt der
Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die daraus resultieren,
übernehmen wir keine Haftung.
Inhaltsverzeichnis
Seite
Betriebsbedingungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Bestimmungsgemäße Verwendung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Sicherheitshinweis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Produktbeschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Schaltungsbeschreibung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Technische Daten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Allgemeiner Hinweis zum Aufbau einer Schaltung . . . . . . . . 16
Lötanleitung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1. Baustufe I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Schaltplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Bestückungsplan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2. Baustufe II . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Checkliste zur Fehlersuche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Störung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Garantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Hinweis (Bausatz)
Der Bausatz darf nur von einer mit der Materie vertrauten Fachkraft aufgebaut und in Betrieb genommen werden!
Page 4

5
• Betreiben Sie die Baugruppe nicht in einer Umgebung, in welcher brennbare Gase, Dämpfe oder Stäube vorhanden sind
oder vorhanden sein können.
• Falls das Gerät einmal repariert werden muß, dürfen nur
Original-Ersatzteile verwendet werden! Die Verwendung abweichender Ersatzteile kann zu ernsthaften Sach- und Personenschäden führen!
• Eine Reparatur des Gerätes darf nur vom Fachmann durchgeführt werden!
• Das Gerät ist nach Gebrauch stets von der Versorgungsspannung zu trennen!
• Dringt irgendeine Flüssigkeit in das Gerät ein, so könnte es dadurch beschädigt werden. Sollten Sie irgendwelche Flüssigkeiten in, oder über die Baugruppe verschüttet haben, so muß das
Gerät von einem qualifizierten Fachmann überprüft werden.
Bestimmungsgemäße Verwendung
Der bestimmungsgemäße Einsatz des Gerätes ist das Fernschalten von elektrischen Verbrauchern, in Verbindung mit einem
UHF-Empfangsmodul (Best.-Nr. 19 26 35) und einem UHF-3-KanalSender (Best.-Nr. 19 24 81).
- Ein anderer Einsatz als vorgegeben ist nicht zulässig!
Sicherheitshinweis
Beim Umgang mit Produkten, die mit elektrischer Spannung in
Berührung kommen, müssen die gültigen VDE-Vorschriften beachtet werden, insbesondere VDE 0100, VDE 0550/0551, VDE 0700,
VDE 0711 und VDE 0860.
4
• Die zulässige Umgebungstemperatur (Raumtemperatur) darf
während des Betriebes 0°C und 40°C nicht unter-, bzw. überschreiten.
• Das Gerät ist für den Gebrauch in trockenen und sauberen
Räumen bestimmt.
• Bei Bildung von Kondenswasser muß eine Akklimatisierungszeit von bis zu 2 Stunden abgewartet werden.
• Ein Betrieb des Gerätes im Freien bzw. in Feuchträumen ist unzulässig!
• Es ist ratsam, falls der Baustein starken Erschütterungen oder
Vibrationen ausgesetzt werden soll, diesen entsprechend gut
zu polstern. Achten Sie aber unbedingt darauf, daß sich Bauteile auf der Platine erhitzen können und somit Brandgefahr
besteht, wenn brennbares Polstermaterial verwendet wird.
• Das Gerät ist von Blumenvasen, Badewannen, Waschtischen
und allen Flüssigkeiten fernzuhalten.
• Schützen Sie diesen Baustein vor Feuchtigkeit, Spritzwasser
und Hitzeeinwirkung!
• Das Gerät darf nicht in Verbindung mit leicht entflammbaren
und brennbaren Flüssigkeiten verwendet werden!
• Baugruppen und Bauteile gehören nicht in Kinderhände!
• Die Baugruppen dürfen nur unter Aufsicht eines fachkundigen
Erwachsenen oder eines Fachmannes in Betrieb genommen
werden!
• In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhütungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften für elektrische Anlagen und Betriebsmittel zu beachten.
• In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hobby- und Selbsthilfewerkstätten ist das Betreiben von Baugruppen durch geschultes Personal verantwortlich zu überwachen.
Page 5

7
dungsfall, für den es verwendet werden soll, geeignet ist!
Im Zweifelsfalle sind unbedingt Rückfragen bei Fachleuten,
Sachverständigen oder den Herstellern der verwendeten Baugruppen notwendig!
• Bitte beachten Sie, daß Bedien- und Anschlußfehler außerhalb
unseres Einflußbereiches liegen. Verständlicherweise können
wir für Schäden, die daraus entstehen, keinerlei Haftung übernehmen.
• Bausätze sollten bei Nichtfunktion mit einer genauen Fehlerbeschreibung (Angabe dessen, was nicht funktioniert... denn
nur eine exakte Fehlerbeschreibung ermöglicht eine einwandfreie Reparatur!) und der zugehörigen Bauanleitung sowie
ohne Gehäuse zurückgesandt werden. Zeitaufwendige Montagen oder Demontagen von Gehäusen müssen wir aus verständlichen Gründen zusätzlich berechnen. Bereits aufgebaute
Bausätze sind vom Umtausch ausgeschlossen. Bei Installationen und beim Umgang mit Netzspannung sind unbedingt die
VDE-Vorschriften zu beachten.
• Geräte, die an einer Spannung ≥ 35 V betrieben werden, dürfen nur vom Fachmann angeschlossen werden.
• In jedem Fall ist zu prüfen, ob der Bausatz für den jeweiligen
Anwendungsfall und Einsatzort geeignet ist bzw. eingesetzt
werden kann.
• Die Inbetriebnahme darf grundsätzlich nur erfolgen, wenn die
Schaltung absolut berührungssicher in ein Gehäuse eingebaut ist.
• Sind Messungen bei geöffnetem Gehäuse unumgänglich, so
muß aus Sicherheitsgründen ein Trenntrafo zwischengeschaltet werden, oder, wie bereits erwähnt, die Spannung über ein
geeignetes Netzteil, (das den Sicherheitsbestimmungen entspricht) zugeführt werden.
6
• Vor Öffnen eines Gerätes stets den Netzstecker ziehen oder sicherstellen, daß das Gerät stromlos ist.
• Bauteile, Baugruppen oder Geräte dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn sie vorher berührungssicher in ein
Gehäuse eingebaut wurden. Während des Einbaus müssen sie
stromlos sein.
• Werkzeuge dürfen an Geräten, Bauteilen oder Baugruppen
nur benutzt werden, wenn sichergestellt ist, daß die Geräte
von der Versorgungsspannung getrennt sind und elektrische
Ladungen, die in den im Gerät befindlichen Bauteilen gespeichert sind, vorher entladen wurden.
• Spannungsführende Kabel oder Leitungen, mit denen das
Gerät, das Bauteil oder die Baugruppe verbunden ist, müssen
stets auf Isolationsfehler oder Bruchstellen untersucht werden.
Bei Feststellen eines Fehlers in der Zuleitung muß das Gerät
unverzüglich aus dem Betrieb genommen werden, bis die
defekte Leitung ausgewechselt worden ist.
• Bei Einsatz von Bauelementen oder Baugruppen muß stets auf
die strikte Einhaltung der in der zugehörigen Beschreibung
genannten Kenndaten für elektrische Größen hingewiesen
werden.
• Wenn aus einer vorliegenden Beschreibung für den nichtgewerblichen Endverbraucher nicht eindeutig hervorgeht, welche elektrischen Kennwerte für ein Bauteil oder eine Baugruppe gelten, wie eine externe Beschaltung durchzuführen
ist oder welche externen Bauteile oder Zusatzgeräte angeschlossen werden dürfen und welche Anschlußwerte diese
externen Komponenten haben dürfen, so muß stets ein
Fachmann um Auskunft ersucht werden.
• Es ist vor der Inbetriebnahme eines Gerätes generell zu prüfen,
ob dieses Gerät oder Baugruppe grundsätzlich für den Anwen-
Page 6

9
Modegag, sondern in diese Rundung schmiegt sich die gewendelte Antenne, die dadurch etwas richtungsunabhängiger wird.
Der Elektronikaufwand läßt sich nur deshalb auf dem kleinen
Platinenformat unterbringen, weil die gesamte Rückseite eng
mit SMDs bestückt ist. Dort steckt im wesentlichen derjenige
Schaltungsteil, der für die Sicherung der Datenübertragung zuständig ist.
Denn bei einer solchen drahtlosen Fernsteuerung will man ja
nicht nur vor versehentlichen Falschauslösungen sicher sein, sondern auch vor möglichen Manipulationen.
Aus diesem Grund sind Sender und Empfänger mit je einem Kodierer/Dekodierer bestückt (HT-600/HT-614), der für ein hohes
Maß an Übertragungssicherheit sorgt. Der Anwender hat die
Möglichkeit, aus insgesamt 6561 Kodierungsmöglichkeiten seinen persönlichen Geheimkode auszuwählen.
Und auf der Empfängerseite werden die drei möglichen Schaltkanäle nur dann aktiviert, wenn dort der richtige Geheimkode
ankommt. Zusammen mit dem verwendeten Übertragungsverfahren einer speziellen Pulsweitenmodulation dürfte damit jeder
Zufall oder Mißbrauch ausgeschlossen sein.
Dieses Verfahren der Datensicherung sieht folgendermaßen aus:
Der Sender überträgt drei Datenbits D1…D3, die die eigentliche
Nutzinformation darstellen (ein viertes Datenbit D0 bleibt hier
unbenutzt). Pro Datenbit ist ein Drucktaster vorgesehen.
Zusätzlich wird ein 10stelliges Kodewort mit den Bits A0…A9 ausgesendet, von dem der Anwender die Pegel an den acht unteren
Bits A0…A7 vorgeben kann; die Einstellung dieses Geheimkodes
erfolgt über einen DIP-Schalter.
Am Sender und Empfänger muß die Einstellung dieser acht DIP-
8
• Alle Verdrahtungsarbeiten dürfen nur im spannungslosen Zustand ausgeführt werden.
Produktbeschreibung
Passende 3-Kanal-Schaltstufe für 3-Kanal-Sender Best.-Nr . 19 24 81.
Zum Fernschalten beliebiger Verbraucher, z. B. Garagen-, Hofund Gartentore, Geräte, Licht usw. Bei Betätigung zieht das
jeweilige Relais für die Dauer der Betätigung an.
Dieser Artikel wurde nach dem EMVG (EG-Richtlinie 89/336/EWG/
Elektromagnetische V erträglichkeit) geprüft, und es wurde das entsprechende CE-Prüfzeichen zugeteilt.
Eine jede Änderung der Schaltung bzw. Verwendung anderer,
als angegebener Bauteile, läßt diese Zulassung erlöschen!
Schaltungsbeschreibung
Herzstück dieses Fernschalters ist ein UHF-Sender mit passendem
Empfänger-Modul, die beide fertig aufgebaut und abgeglichen
sind und für den Funkkontakt sorgen. Es versteht sich, daß dieses
Sender/Empfänger-Pärchen postzugelassen ist. Die Sendefrequenz
ist übrigens dafür reserviert:
„Der Frequenzbereich 433,05… 434,79 MHz (Mittenfrequenz
433,92 MHz) ist für HF-Geräte für industrielle, wissenschaftliche,
medizinische, häusliche oder ähnliche Zwecke, Funkanlagen für
gewerbliche und industrielle Fernsteuerungs- und Fernmeßzwecke und Funkanlagen zur Fernsteuerung von Modellen vorgesehen.“ (Zitat aus der Frequenzbereichs-Zuweisung unserer
Telekom).
Der Sender läßt sich mit etwas gutem Willen noch mit ans Schlüsselbund hängen. Die geschwungene Stirnseite ist übrigens kein
Page 7

11
auch der „eigene“ Sender ist. Das zu überprüfen und daraus die
eigentlichen Schaltfunktionen abzuleiten, ist Aufgabe der nachfolgenden Baugruppe.
Wie Sie auf dem Schaltplan erkennen, ist das Empfänger-Modul
eine vollkommen eigenständige Einheit. An ihrem Ausgang liefert sie einen digitalen Datenstrom, den Transistor T1 invertiert;
damit wird nur die auf der Senderseite erfolgte Invertierung wieder rückgängig gemacht.
Die Informationen gelangen dann in den Dateneingang DIn des
Dekodierers HT -614, der alles, was an seinem Anschluß 7 passiert,
kritisch untersucht. Denkbar wäre ja, daß sich das EmpfängerModul irgendeinen anderen HF-T räger eingefangen hat (z.B. von
einer Modellbau-Fernsteuerung). Derartige Störer haben aber
keinerlei Chance, in die Auswertung einzugehen.
Wenn aber die Bitfolge in den Zeitrahmen des HT-614 paßt, beginnt die nähere Untersuchung des Datenstroms. Dazu gehört
nicht nur die Prüfung der Zeitbedingungen für die 0-, X- oder 1Bits, sondern auch die Form des Telegramms. Bei den vier Datenbits kann beispielsweise nie ein ’X’ vorkommen.
Beim geringsten Fehler wird die Auswertung abgebrochen, und
das IC wartet auf das nächste gültige T elegramm. Erst wenn zwei
aufeinanderfolgende Telegramme inhaltlich übereinstimmend
und fehlerfrei vorliegen, geht es an den endgültigen Test:
Dabei stellt der Dekodierer fest, ob das im empfangenen Telegramm enthaltene Kodewort dasselbe ist wie das an seinen Eingängen A0…A7 eingestellte. Ist das der Fall, werden die empfangenen Datenbits zu T2…T4 durchgeschaltet.
Es ist also eine regelrechte Zeremonie, die sich bei einer solchen
Übertragung abspielt. Nach menschlichem Ermessen ist damit
eine gewollte oder zufällige Störung ausgeschlossen, zumal man
10
Schalter exakt übereinstimmen, weil sonst jegliche Übertragung
ausgeschlossen ist!
An den Kodierungseingängen kann man nämlich nicht nur 1 (=
HIGH) und 0 (= LOW) einstellen, sondern man kann diese Eingänge auch offen lassen (= X). Damit ergeben sich deutlich mehr
Kodierungsmöglichkeiten als bei der Lo/Hi-Beschaltung:
Bei acht Bits (A0…A7) mit je drei Zuständen (0, X und 1) hat man
nämlich 38= 6561 Möglichkeiten, während es bei acht Bits mit
zwei Zuständen nur 28= 256 Möglichkeiten gibt!
Bei jedem senderseitigen Knopfdruck wird also der Zustand der
vier Datenbits (von denen D0 offen bleibt) zusammen mit den 10
Kodierungseingängen übertragen (bei denen A8 und A9 offen
bleiben). Diese 4 + 10 Bits bilden ein sogenanntes Datenwort
oder auch Telegramm, das sicherheitshalber dreimal nacheinander ausgesendet wird.
Jedes Bit in diesem Telegramm besteht aus 6 Taktperioden des
Datentaktes, und der wiederum hat 1/33 der Oszillatorfrequenz
von 100 kHz. Bei 10 µs Grundtakt und 330 µs Datentakt dauert
jedes Bit demnach rund 2 ms, so daß drei Telegramme mit je 14
Bits zusammen über 100 ms Übertragungszeit in Anspruch nehmen; das ist eine Reaktionszeit, die man im Betrieb wahrnimmt.
Das passende Empfängermodul ist fest auf den Sender abgestimmt. Seine Aufgabe ist es, Signale aus dem 433-MHz-Band
aufzunehmen und die darin enthaltene Frequenzmodulation zu
demodulieren.
Der Ausgang dieses Moduls liefert also einen seriellen Strom
digitaler Daten im 5-V-Pegel, bei dem sich unterschiedlich lange
HIGH- und LOW-Zustände abwechseln. Das sind aber gewissermaßen erst die Rohdaten, von denen noch niemand weiß, ob sie
von einem passenden Fernschalt-Sender stammen und ob dies
Page 8

13
Messen Sie sicherheitshalber nach, ob der Festspannungsregler
IC2 seine 5 V abliefert, denn davon „lebt“ später der DekodierSchaltkreis IC2. So ein Stabi hat eine Toleranz von ±5%, d.h. er
erfüllt seine Aufgabe auch dann noch, wenn er 4,75 V oder 5,25
V erzeugt. Als nächstes löten Sie die drei Schaltstufen ein, angefangen bei den drei Basis-Vorwiderständen R4…R6 bis hin zu den
Relais mit den Schraubklemmen.
Jede dieser Schaltstufen läßt sich nun für sich testen, was Sie
auch konsequent tun sollten. Dazu muß die extern zugeführte
Spannung im Bereich von 10…14 V liegen; für den Spannungsregler ist das weniger wichtig als vielmehr für die Relais. Da wir
12-V-Typen einsetzen, muß die Betriebsspannung ungefähr in
diesem Bereich liegen. Sie braucht aber keineswegs stabilisiert zu
sein, so daß Sie ohne weiteres ein kleines Steckernetzteil verwenden können.
Nehmen Sie dann eine Prüfschnur mit kleinen Krokodilklemmen
und suchen Sie sich +5 V auf der Platine (z.B. an dem Bein von R2,
das am äußeren Platinenrand liegt). Dort klemmen Sie Ihre Prüfschnur an und tippen mit dem freien Ende nacheinander an die
Widerstände R4…R6 (an die zum Platinenrand zeigenden, freien
Enden).
Bei jedem Tippkontakt muß das zugehörige Relais anziehen, was
Sie nicht nur am leisen Klicken wahrnehmen, sondern auch am
Aufleuchten der parallel liegenden LED. Erst wenn das der Fall
ist, geht es weiter.
Natürlich würde dieser Test auch dann funktionieren, wenn Sie
die Prüfklemme an +12 V anschließen; aber das entspricht nicht
dem späteren Betrieb, bei dem die T ransistoren ja von IC1 aus mit
5-V-Pegel angesteuert werden.
Wenn die Funktionen wie beschrieben ablaufen, dann haben Sie
zumindest in diesem Bereich keinen Fehler gemacht; das gibt
12
ja die drei Relais-Ausgänge auch noch miteinander verknüpfen
kann.
Die Relais ziehen so lange an, wie die zugehörige Taste am Sender betätigt wird (Tastfunktion). Das hat den Vorteil, daß man
den jeweils aktivierten Kanal nicht ausdrücklich wieder ausschalten muß.
Natürlich kann man auch zwei oder drei Relais gleichzeitig betätigen, ohne daß der Sender dadurch mehr belastet wird; ihm
ist es egal, ob er für die D-Bits ein HIGH oder LOW sendet.
Was bei dem ganzen Prüfaufwand herauskommt, sind die Logikpegel der Datenbits. Von den vier übertragenen nutzen wir in
dieser Schaltung nur drei (D1…D3, D0 bleibt offen), weil wir auf
einen fertigen Handsender zurückgreifen, der bloß drei Tasten
hat.
Es ist leicht nachzuvollziehen, daß die an D1…D3 angeschlossenen Transistoren immer dann durchschalten, wenn das zugehörige Bit auf HIGH geht. Das im Kollektorkreis liegende Relais zieht
dann an und löst mit seinem Kontakt eine Schaltfunktion aus.
Die zu den Relais parallel liegenden Leuchtdioden erlauben eine
einfache optische Kontrolle, ob die Übertragung wie gewünscht
funktioniert.
Da man an dieser Schaltung nur sehr wenig testen kann, muß
man beim Nachbau besonders aufpassen, sonst kann hier eine
Fehlersuche schnell zur planlosen Stocherei ausarten.
Wir empfehlen daher folgende Bauabschnitte: Löten Sie zunächst
alle zur Stromversorgung benötigten Bauteile ein. Das beginnt
bei der Anschlußklemme für die Spannungszuführung und
schließt IC2 mit D2, R7 und LD1 ebenso ein wie alle fünf Kondensatoren. Wenn Sie dann eine externe Spannung von ca. 8…15 V
anlegen, muß sofort die grüne LED aufleuchten.
Page 9

15
dazu notiert er/sie den jeweiligen Standort. Am Empfangsort
brauchen Sie nur noch festzuhalten, wann der letzte Kontakt
erfolgt ist. Beim Nachlesen des „Sendeprotokolls“ wissen Sie
dann, wo die Verbindung abgerissen ist. Bitte bedenken Sie, daß
in bebauter Umgebung eine deutliche Reichweiten-Abnahme
eintritt!
Technische Daten
Betriebsspannung . . . .: 12 V = (10 - 14 V)
Stromaufnahme . . . . .: 15 mA (Ruhe)
35 mA (bei betätigtem Relais)
Relais-Ausgänge . . . . .: drei (Schließer) potentialfrei
Schaltspannung . . . . .: max 250 V~
Dauerstrom . . . . . . . . .: max. 6 A
Codiermöglichkeiten . .: 6561 (über Codierschalter einstellbar)
Abmessungen . . . . . . .: 100 x 70 mm
Lieferung erfolgt ohne Empfänger-Modul, Best.-Nr. 19 26 35.
Achtung!
Bevor Sie mit dem Nachbau beginnen, lesen Sie diese Bauanleitung erst einmal bis zum Ende in Ruhe durch, bevor Sie den
Bausatz oder das Gerät in Betrieb nehmen (besonders den Abschnitt über die Fehlermöglichkeiten und deren Beseitigung!)
und natürlich die Sicherheitshinweise. Sie wissen dann, worauf es
ankommt und was Sie beachten müssen und vermeiden dadurch
von vornherein Fehler, die manchmal nur mit viel Aufwand wieder zu beheben sind!
Führen Sie die Lötungen und Verdrahtungen absolut sauber und
gewissenhaft aus, verwenden Sie kein säurehaltiges Lötzinn, Löt-
14
Ihnen für die restlichen Arbeiten ein gutes Gefühl, denn da
haben Sie keine so einfache Prüfmöglichkeit mehr.
Löten Sie nun die Fassung für das IC ein, und zwar mit der Markierungskerbe zum Transistor T1 hin. Funktionell ist die Einbaulage für die Fassung beliebig, aber im Eifer des Gefechts passiert
es immer wieder, daß man sich beim Einsetzen des ICs an der
Markierung der Fassung orientiert und nicht am Bestückungsplan. Und deshalb sorgt man da von vornherein für klare Verhältnisse.
Auch zum Anschluß des Empfänger-Moduls ist eine kleine Steckfassung vorgesehen, in die die dreipolige Pfostenleiste eingeführt wird; dort ist natürlich jede Verwechslungsgefahr ausgeschlossen.
Beim Achtfach-DIP-Schalter passen Sie aber bitte wieder auf, daß
die Numerierung von 1…8 so zu lesen ist wie auf dem Bestükkungsplan; denn diese Schalterstellung muß mit der im Sender
übereinstimmen, und beim Übertragen Ihres Kodeworts müssen
daher auch die Adreßeingänge A0…A7 gleichlautend beziffert
sein. Nach dem Einsetzen von IC1 sollten Sie alles noch einmal
sorgfältig kontrollieren.
Zum Schluß kommt das Empfänger-Modul an seinen Platz, wobei
Sie die ca. 15 cm lange Antenne (einfacher Klingeldraht) frei herumhängen lassen.
Nachdem Sie die DIP-Schalter im Sender und Empfänger gleich
eingestellt haben, kommt der spannende Moment der endgültigen Inbetriebnahme. Dazu brauchen Sie nur die Sendetasten zu
drücken und sich am Anziehen des entsprechenden Relais zu
erfreuen!
Einen Reichweitentest nehmen Sie am besten mit einem Partner
vor. Nach Uhrenvergleich marschiert der/die mit dem Sender los
und drückt im Abstand von einer Minute eine der Sendetasten;
Page 10

17
sung stecken. Es passiert sehr leicht, daß sich eines beim Einstecken umbiegt. Ein kleiner Druck, und das IC muß fast von
selbst in die Fassung springen. Tut es das nicht, ist sehr wahrscheinlich ein Beinchen verbogen.
Stimmt hier alles, dann ist als nächstes eventuell die Schuld bei
einer kalten Lötstelle zu suchen. Diese unangenehmen Begleiter
des Bastlerlebens treten dann auf, wenn entweder die Lötstelle
nicht richtig erwärmt wurde, so daß das Zinn mit den Leitungen
keinen richtigen Kontakt hat, oder wenn man beim Abkühlen
die Verbindung gerade im Moment des Erstarrens bewegt hat.
Derartige Fehler erkennt man meistens am matten Aussehen der
Oberfläche der Lötstelle. Einzige Abhilfe ist, die Lötstelle nochmals nachzulöten.
Bei 90 % der reklamierten Bausätze handelt es sich um Lötfehler,
kalte Lötstellen, falsches Lötzinn usw.. So manches zurückgesandte “Meisterstück” zeugte von nicht fachgerechtem Löten.
Verwenden Sie deshalb beim Löten nur Elektronik-Lötzinn mit
der Bezeichnung “SN 60 Pb” (60 % Zinn und 40 % Blei). Dieses
Lötzinn hat eine Kolophoniumseele, welche als Flußmittel dient,
um die Lötstelle während des Lötens vor dem Oxydieren zu
schützen. Andere Flußmittel wie Lötfett, Lötpaste oder Lötwasser dürfen auf keinen Fall verwendet werden, da sie säurehaltig sind. Diese Mittel können die Leiterplatte und ElektronikBauteile zerstören, außerdem leiten sie den Strom und verursachen dadurch Kriechströme und Kurzschlüsse.
Ist bis hierher alles in Ordnung und läuft die Sache trotzdem
noch nicht, dann ist wahrscheinlich ein Bauelement defekt.
Wenn Sie Elektronik-Anfänger sind, ist es in diesem Fall das
Beste, Sie ziehen einen Bekannten zu Rate, der in Elektronik ein
bißchen versiert ist und eventuell nötige Meßgeräte besitzt.
Sollten Sie diese Möglichkeit nicht haben, so schicken Sie den
16
fett o. ä. Vergewissern Sie sich, daß keine kalte Lötstelle vorhanden ist. Denn eine unsaubere Lötung oder schlechte Lötstelle, ein
Wackelkontakt oder schlechter Aufbau bedeuten eine aufwendige und zeitraubende Fehlersuche und unter Umständen eine
Zerstörung von Bauelementen, was oft eine Kettenreaktion nach
sich zieht und der komplette Bausatz zerstört wird.
Beachten Sie auch, daß Bausätze, die mit säurehaltigem Lötzinn,
Lötfett o. ä. gelötet wurden, von uns nicht repariert werden.
Beim Nachbau elektronischer Schaltungen werden Grundkenntnisse über die Behandlung der Bauteile, Löten und der Umgang
mit elektronischen bzw. elektrischen Bauteilen vorausgesetzt.
Allgemeiner Hinweis zum Aufbau einer Schaltung
Die Möglichkeit, daß nach dem Zusammenbau etwas nicht funktioniert, läßt sich durch einen gewissenhaften und sauberen
Aufbau drastisch verringern. Kontrollieren Sie jeden Schritt, jede
Lötstelle zweimal, bevor Sie weitergehen! Halten Sie sich an die
Bauanleitung! Machen Sie den dort beschriebenen Schritt nicht
anders und überspringen Sie nichts! Haken Sie jeden Schritt doppelt ab: einmal fürs Bauen, einmal fürs Prüfen.
Nehmen Sie sich auf jeden Fall Zeit: Basteln ist keine Akkordarbeit, denn die hier aufgewendete Zeit ist um das dreifache
geringer als jene bei der Fehlersuche.
Eine häufige Ursache für eine Nichtfunktion ist ein Bestückungsfehler, z. B. verkehrt eingesetzte Bauteile wie ICs, Dioden und
Elkos. Beachten Sie auch unbedingt die Farbringe der Widerstände, da manche leicht verwechselbare Farbringe haben.
Achten Sie auch auf die Kondensator-Werte z. B. n 10 = 100 pF
(nicht 10 nF). Dagegen hilft doppeltes und dreifaches Prüfen.
Achten Sie auch darauf, daß alle IC-Beinchen wirklich in der Fas-
Page 11

19
1. Verwenden Sie beim Löten von elektronischen Schaltungen
grundsätzlich nie Lötwasser oder Lötfett. Diese enthalten
eine Säure, die Bauteile und Leiterbahnen zerstört.
2. Als Lötmaterial darf nur Elektronikzinn SN 60 Pb (d. h. 60 % Zinn,
40 % Blei) mit einer Kolophoniumseele verwendet werden,
die zugleich als Flußmittel dient.
3. Verwenden Sie einen kleinen Lötkolben mit max. 30 Watt
Heizleistung. Die Lötspitze sollte zunderfrei sein, damit die
Wärme gut abgeleitet werden kann. Das heißt: Die Wärme
vom Lötkolben muß gut an die zu lötende Stelle geleitet
werden.
4. Die Lötung selbst soll zügig vorgenommen werden, denn
durch zu langes Löten werden Bauteile zerstört. Ebenso führt
es zum Ablösen der Lötaugen oder Kupferbahnen.
5. Zum Löten wird die gut verzinnte Lötspitze so auf die Löt-
stelle gehalten, daß zugleich Bauteildraht und Leiterbahn
berührt werden.
Gleichzeitig wird (nicht zuviel) Lötzinn zugeführt, das mit
aufgeheizt wird. Sobald das Lötzinn zu fließen beginnt, nehmen Sie es von der Lötstelle fort. Dann warten Sie noch einen
Augenblick, bis das zurückgebliebene Lot gut verlaufen ist
und nehmen dann den Lötkolben von der Lötstelle ab.
6. Achten Sie darauf, daß das soeben gelötete Bauteil, nach-
dem Sie den Kolben abgenommen haben, ca. 5 Sek. nicht
bewegt wird. Zurück bleibt dann eine silbrig glänzende, einwandfreie Lötstelle.
7. Voraussetzung für eine einwandfreie Lötstelle und gutes
Löten ist eine saubere, nicht oxydierte Lötspitze. Denn mit
einer schmutzigen Lötspitze ist es absolut unmöglich, sauber
zu löten. Nehmen Sie daher nach jedem Löten überflüssiges
18
Bausatz bei Nichtfunktion gut verpackt und mit einer genauen
Fehlerbeschreibung, sowie der zugehörigen Bauanleitung an
unsere Service-Abteilung ein (nur eine exakte Fehlerangabe ermöglicht eine einwandfreie Reparatur!). Eine genaue Fehlerbeschreibung ist wichtig, da der Fehler ja auch bei Ihrem Netzgerät
oder Ihrer Außenbeschaltung sein kann.
Hinweis
Dieser Bausatz wurde, bevor er in Produktion ging, viele Male als
Prototyp aufgebaut und getestet. Erst wenn eine optimale Qualität hinsichtlich Funktion und Betriebssicherheit erreicht ist, wird
er für die Serie freigegeben.
Um eine gewisse Funktionssicherheit beim Bau der Anlage zu erreichen, wurde der gesamte Aufbau in 2 Baustufen aufgegliedert:
1. Baustufe I : Montage der Bauelemente auf der Platine
2. Baustufe II : Stückprüfung/Anschluß/Inbetriebnahme
Achten Sie beim Einlöten der Bauelemente darauf, daß diese
(falls nicht Gegenteiliges vermerkt) ohne Abstand zur Platine
eingelötet werden. Alle überstehenden Anschlußdrähte werden
direkt über der Lötstelle abgeschnitten.
Da es sich bei diesem Bausatz teilweise um sehr kleine, bzw. eng
beieinanderliegende Lötpunkte handelt (Lötbrückengefahr),
darf hier nur mit einem Lötkolben mit kleiner Lötspitze gelötet
werden. Führen Sie die Lötvorgänge und den Aufbau sorgfältig
aus.
Lötanleitung
Wenn Sie im Löten noch nicht so geübt sind, lesen Sie bitte zuerst
diese Lötanleitung, bevor Sie zum Lötkolben greifen. Denn Löten
will gelernt sein.
Page 12

21
Anschließend werden die überstehenden Drähte abgeschnitten.
Die hier in diesem Bausatz verwendeten Widerstände sind Kohleschicht-Widerstände. Diese haben eine T oleranz von 5% und sind
durch einen goldfarbigen „Toleranz-Ring“ gekennzeichnet.
Kohleschicht-Widerstände besitzen normalerweise 4 Farbringe.
Zum Ablesen des Farbcodes wird der Widerstand so gehalten,
daß sich der goldfarbige Toleranzring auf der rechten Seite des
Widerstandskörpers befindet. Die Farbringe werden dann von
links nach rechts abgelesen!
R 1 = 47 k gelb, violett, orange
R 2 = 47 k gelb, violett, orange
R 3 =470 k gelb, violett, gelb
R 4 = 10 k braun, schwarz, orange
R 5 = 10 k braun, schwarz, orange
R 6 = 10 k braun, schwarz, orange
R 7 = 4 k7 gelb, violett, rot
R 8 = 4 k7 gelb, violett, rot
R 9 = 4 k7 gelb, violett, rot
R 10= 4 k7 gelb, violett, rot
1.2 Dioden
Nun werden die Anschlußdrähte der Dioden entsprechend dem
Rastermaß rechtwinklig abgebogen und in die vorgesehenen
Bohrungen (lt. Bestückungsdruck) gesteckt. Achten Sie hierbei
unbedingt darauf, daß die Dioden richtig gepolt (Lage des
Kathodenstriches) eingebaut werden!
Damit die Dioden beim Umdrehen der Platine nicht herausfallen
können, biegen Sie die Anschlußdrähte ca. 45° auseinander, und
verlöten diese bei kurzer Lötzeit mit den Leiterbahnen. Dann
werden die überstehenden Drähte abgeschnitten.
20
Lötzinn und Schmutz mit einem feuchten Schwamm oder
einem Silikon-Abstreifer ab.
8. Nach dem Löten werden die Anschlußdrähte direkt über der
Lötstelle mit einem Seitenschneider abgeschnitten.
9. Beim Einlöten von Halbleitern, LEDs und ICs ist besonders
darauf zu achten, daß eine Lötzeit von ca. 5 Sek. nicht überschritten wird, da sonst das Bauteil zerstört wird. Ebenso ist
bei diesen Bauteilen auf richtige Polung zu achten.
10. Nach dem Bestücken kontrollieren Sie grundsätzlich jede
Schaltung noch einmal darauf hin, ob alle Bauteile richtig
eingesetzt und gepolt sind. Prüfen Sie auch, ob nicht versehentlich Anschlüsse oder Leiterbahnen mit Zinn überbrückt
wurden. Das kann nicht nur zur Fehlfunktion, sondern auch
zur Zerstörung von teuren Bauteilen führen.
11. Beachten Sie bitte, daß unsachgemäße Lötstellen, falsche
Anschlüsse, Fehlbedienung und Bestückungsfehler außerhalb unseres Einflußbereiches liegen.
1. Baustufe I:
Montage der Bauelemente auf der Platine
1.1 Widerstände
Zuerst werden die Anschlußdrähte der Widerstände entsprechend dem Rastermaß rechtwinklig abgebogen und in die vorgesehenen Bohrungen (lt. Bestückungsplan) gesteckt. Damit die
Bauteile beim Umdrehen der Platine nicht herausfallen können,
biegen Sie die Anschlußdrähte der Widerstände ca. 45° auseinander, und verlöten diese dann sorgfältig mit den Leiterbahnen
auf der Rückseite der Platine.
Page 13

23
1.4 IC-Fassungen
Stecken Sie die Fassung für den integrierten Schaltkreis (IC) in die
entsprechende Position auf der Bestückungsseite der Platine.
Achtung!
Beachten Sie die Einkerbung oder eine sonstige Kennzeichnung
an einer Stirnseite der Fassung. Dies ist die Markierung (Anschluß 1) für das IC, welches später einzusetzen ist. Die Fassung
muß so eingesetzt werden, daß diese Markierung mit der Markierung am Bestückungsaufdruck übereinstimmt!
Um zu verhindern, daß beim Umdrehen der Platine (zum Löten)
die Fassung wieder herausfällt, werden zwei schräg gegenüberliegende Pins der Fassung umgebogen und danach alle Anschlußbeinchen verlötet.
1 x Fassung 20-pol.
1.5 Transistoren
In diesem Arbeitsgang werden die Transistoren dem Bestükkungsaufdruck entsprechend eingesetzt und auf der Leiterbahnseite verlötet.
Beachten Sie dabei die Lage: Die Gehäuse-Umrisse der Transistoren müssen mit denen des Bestückungsaufdruckes übereinstim-
22
D 1 = 1 N 4148 Silizium-Universaldiode
D 2 = 1 N 4002 o. ä. Silizium-Leistungsdiode
D 3 = 1 N 4148 Silizium-Universaldiode
D 4 = 1 N 4148 Silizium-Universaldiode
1.3 Kondensatoren
Stecken Sie die Kondensatoren in die entsprechend gekennzeichneten Bohrungen, biegen Sie die Drähte etwas auseinander und
verlöten diese sauber mit den Leiterbahnen. Bei den ElektrolytKondensatoren (Elkos) ist auf richtige Polarität zu achten (+ -).
Achtung!
Je nach Fabrikat weisen Elektrolyt-Kondensatoren verschiedene
Polaritätskennzeichnungen auf. Einige Hersteller kennzeichnen
„+“, andere aber „-“. Maßgeblich ist die Polaritätsangabe, die
vom Hersteller auf den Elkos aufgedruckt ist.
C 1 = 0,1 µF = 100 nF = 100 000 pF = 104Keramik-Kondensator
C 2 = 10 µF 16 Volt Elko
C 3 = 0,1 µF = 100 nF = 100 000 pF = 104Keramik-Kondensator
C 4 =100 µF 16 Volt Elko
C 5 = 0,1 µF = 100 nF = 100 000 pF = 104Keramik-Kondensator
-
+
-
Page 14

25
Die hier in diesem Bausatz verwendeten Leuchtdioden sind
„LOW CURRENT-LEDs“, d. h. LEDs, die ihre volle Leuchtkraft bereits bei einer Stromaufnahme von 2 mA (grün 4 mA) erreichen.
LD 1 = grün Ø 3 mm Low Current
LD 2 = rot Ø 3 mm Low Current
LD 3 = rot Ø 3 mm Low Current
LD 4 = rot Ø 3 mm Low Current
Fehlt eine eindeutige Kennzeichnung einer LED oder sind Sie
sich mit der Polarität in Zweifel (da manche Hersteller unterschiedliche Kennzeichnungsmerkmale benutzen), so kann diese
auch durch Probieren ermittelt werden. Dazu gehen Sie wie
folgt vor:
Man schließt die LED über einen Widerstand von ca. 270 R (bei
Low-Current-LED 4 k 7) an eine Betriebsspannung von ca. 5 V (4,5 V
oder 9 V-Batterie) an.
Leuchtet dabei die LED, so ist die „Kathode“ der LED richtigerweise mit Minus verbunden. Leuchtet die LED nicht, so ist diese
in Sperrichtung angeschlossen (Kathode an Plus) und muß umgepolt werden.
4,5 V
270 Ω
R
v
LED
LED wird in Sperrichtung angeschlossen und leuchtet demzufolge nicht. (Kathode an "+")
+
-
4,5 V
270 Ω
R
v
LED
LED mit Vorwiderstand in
Durchlaßrichtung angeschlossen,
sie leuchtet (Kathode an "-")
+
-
A
K
A
K
24
men. Orientieren Sie sich hierbei an der abgeflachten Seite der
T ransistorgehäuse. Die Anschlußbeine dürfen sich auf keinen Fall
kreuzen außerdem sollten die Bauteile mit ca. 5 mm Abstand zur
Platine eingelötet werden.
Achten Sie auf kurze Lötzeit, damit die Transistoren nicht durch
Überhitzung zerstört werden.
T 1 = BC 547, 548, 549 A, B oder C Kleinleistungs-Transistor
T 2 = BC 547, 548, 549 A, B oder C Kleinleistungs-Transistor
T 3 = BC 547, 548, 549 A, B oder C Kleinleistungs-Transistor
T 4 = BC 547, 548, 549 A, B oder C Kleinleistungs-Transistor
1.6 Leuchtdioden (LEDs)
Jetzt löten Sie die 3 mm-LEDs polungsrichtig in die Schaltung ein.
Die kürzeren Anschlußbeinchen kennzeichnen die Kathoden.
Betrachtet man eine Leuchtdiode gegen das Licht, so erkennt
man die Kathode an der größeren Elektrode im Inneren der LED.
Am Bestückungsaufdruck wird die Lage der Kathode durch einen
dicken Strich im Gehäuseumriß der Leuchtdiode dargestellt.
Zur Montage werden die Anschlußbeinchen der LEDs zuerst durch
die beiliegenden Abstandsröllchen und dann durch die Bohrungen der Platine gesteckt.
Löten Sie zunächst nur ein Anschlußbeinchen der Dioden fest,
damit diese noch exakt ausgerichtet werden können. Ist dies
geschehen, so wird jeweils der zweite Anschluß verlötet.
Ansicht von unten
E
B
C
ca. 5 mm
Page 15

27
Beachten Sie die Lage von IC 2!
Die Gehäuse-Umrisse des ICs müssen mit denen des Bestückungsaufdruckes übereinstimmen. Orientieren Sie sich hierbei an der
abgeflachten Seite des IC-Gehäuses. Die Anschlußbeine dürfen
sich auf keinen Fall kreuzen, außerdem soll das Bauteil ca. 5 mm
Abstand zur Platine haben.
Achten Sie dabei auf kurze Lötzeit, damit der integrierte Spannungsregler nicht durch Überhitzung zerstört wird.
IC 2 = 78 L 05 5 V-Festspannungsregler
1.10 Buchsenleiste
Bestücken Sie jetzt die Platine mit der 3-pol. Buchsenleiste, in die
später das Empfänger-Modul gesteckt wird. Verlöten Sie die Anschlußstifte der Buchsenleiste auf der Leiterbahnseite der Platine.
1 x Buchsenleiste 3-pol.
Ausgang Masse
Eingang
26
1.7 Anschlußklemmen
Nun stecken Sie die Schraubklemmen in die entsprechenden Positionen auf der Platine und verlöten die Anschlußstifte sauber
auf der Leiterbahnseite.
Bedingt durch die größere Massefläche von Leiterbahn und Anschlußklemme, muß hier die Lötstelle etwas länger als sonst
aufgeheizt werden, bis das Zinn gut fließt und eine saubere Lötstelle bildet.
4 x Anschlußklemme 2-polig
1.8 Miniatur-Relais
Bestücken Sie die Platine mit den drei 12 V Relais und verlöten
die Anschlußstifte auf der Leiterbahnseite.
RL 1 = Rel. 12 V 1 x Schließer
RL 2 = Rel. 12 V 1 X Schließer
RL 3 = Rel. 12 V 1 X Schließer
1.9 Spannungsregler
Nun wird der integrierte Spannungsregler in die vorgesehenen
Bohrungen gesteckt und die Anschlußbeinchen auf der Lötseite
verlötet.
Page 16

29
IC 1 = HT 614 DECODER-IC
(Kerbe oder Punkt muß zu T 1 zeigen)
28
1.11 DIP-Schalter
Nun stecken Sie den DIP-Schiebeschalter in die entsprechenden
Bohrungen und verlöten die Anschlüsse auf der Leiterbahnseite.
Achten Sie auf die richtige Lage der Schalter!
Vergleichen Sie den Bestückungsaufdruck der Platine mit dem
Aufdruck auf dem DIP-Schalter!
S 1 = DIP-Schiebeschalter 8 pol.- Tristate
1.12 Integrierte Schaltungen (ICs)
Zum Schluß wird der integrierte Schaltkreis polungsrichtig in die
vorgesehene Fassung gesteckt.
Achtung!
Integrierte Schaltungen sind sehr empfindlich gegen falsche Polung! Achten Sie deshalb auf die entsprechende Kennzeichnung
des ICs (Kerbe oder Punkt).
Integrierte Schaltungen dürfen grundsätzlich nicht bei anliegender Betriebsspannung gewechselt oder in die Fassung gesteckt
werden!
1
2
3
4
5
6
7
8
Page 17

31
Bestückungsplan
30
Schaltplan
Page 18

33
führen zur Beschädigung von Bauteilen bzw. zur Nichtfunktion der Baugruppe.
Lebensgefahr!
Verwenden Sie ein Netzgerät als Spannungsquelle, so muß
dies unbedingt den VDE-Vorschriften entsprechen!
Dieser Bausatz kann nur zusammen mit dem EmpfängerModul, Best.-Nr. 19 26 35 und dem dazugehörigem UHF-Sender, Best. Nr. 19 24 81 betrieben werden.
2.3 Stecken Sie die drei Anschlußstifte des Empfänger-Moduls in
die Buchsenleiste auf der Bausatzplatine. Achten Sie auf die
aufgedruckten Umrisse des Empfänger-Moduls auf der Platine.
2.4 Bringen Sie alle Codierschalter vom Dip-Schalter S 1 in
Stellung „0“!
2.5 Öffnen Sie den Sender (zwei Schrauben auf der Gehäuseunterseite ausdrehen) und bringen alle Codierschalter des
Senders ebenfalls in Stellung „0“!
Es gilt generell: Die Codierschalter des Senders müssen mit
der Schalterstellung der Empfängerschaltstufe exakt übereinstimmen!
2.6 An die mit „10 - 14 V“ bezeichnete Anschlußklemme wird
jetzt die Betriebsspannung (Gleichspannung), die im Bereich
zwischen 10 und 14 V liegen kann, polungsrichtig angeschlossen.
2.7 Die grüne Leuchtdiode LD 1 muß nun aufleuchten.
- Betätigen Sie nun eine beliebe Taste am Sender.
32
2. Baustufe II:
Stückprüfung/Anschluß/Inbetriebnahme
2.1 Stückprüfung durch denjenigen, der das Gerät fertiggestellt
hat!
Nach Fertigstellung des Gerätes muß als erstes eine Stückprüfung durchgeführt werden. Sinn dieser Stückprüfung ist
es, Gefahren durch Materialschäden und durch unsachgemäßen Zusammenbau z u erkennen.
Sichtprüfung
Bei der Sichtprüfung darf das Gerät nicht mit seiner Stromversorgung verbunden sein.
Kontrollieren Sie nochmal, ob alle Bauteile richtig eingesetzt
und gepolt sind. Sehen Sie auf der Lötseite (Leiterbahnseite)
nach, ob durch Lötzinnreste Leiterbahnen überbrückt wurden, da dies zu Kurzschlüssen und zur Zerstörung von Bauteilen führen kann.
Ferner ist zu kontrollieren, ob abgeschnittene Drahtenden
auf oder unter der Platine liegen, da dies ebenfalls zu Kurzschlüssen führen kann.
Etwaige Mängel sind zu beseitigen!
Anschluß/Inbetriebnahme
2.2 Nachdem die Stückprüfung durchgeführt wurde, kann ein
erster Funktionstest durchgeführt werden.
Beachten Sie, daß dieser Bausatz nur mit gesiebter Gleichspannung aus einem Netzgerät oder mit einer Batterie/
Akku versorgt werden darf, das bzw. die auch den nötigen
Strom liefern kann. Autoladegeräte oder Spielzeugeisenbahntrafos sind als Spannungsquelle nicht geeignet und
Page 19

35
❑ Sind die Dioden richtig gepolt eingelötet? Stimmt der auf
den Dioden angebrachte Kathodenring mit dem Bestükkungsaufdruck auf der Platine überein?
Der Kathodenring von D 1 muß von D 3 weg zeigen.
Der Kathodenring von D 2 muß zu RL 3 zeigen.
Der Kathodenring von D 3 muß zu D 1 zeigen.
Der Kathodenring von D 4 muß zu D 3 zeigen.
❑ Sind die LEDs richtig gepolt eingelötet?
Betrachtet man eine Leuchtdiode gegen das Licht, so erkennt
man die Kathode an der größeren Elektrode im Inneren der
LED. Am Bestückungsaufdruck wird die Lage der Kathode
durch einen dickeren Strich am Gehäuseumriß der Leuchtdiode dargestellt.
Die Kathode der LED LD 1 muß in Richtung IC 1 zeigen.
Die Kathoden der LEDs LD 2..LD 4 müssen von LD 1 weg zeigen.
❑ Sind die Transistoren T 1 - T 4 richtig herum eingelötet?
Überkreuzen sich ihre Anschlußbeinchen? Stimmt der Bestükkungsaufdruck mit den Umrissen der Transistoren überein?
❑ Ist das IC 2 richtig herum eingelötet? Überkreuzen sich seine
Anschlußbeinchen? Stimmt der Bestückungsaufdruck mit den
Umrissen des ICs überein?
❑ Ist das IC 2 (typenmäßig) richtig eingelötet und nicht mit
einem Transistor vertauscht (da gleiche Gehäuse) ?
❑ Sind die Elektrolyt-Kondensatoren richtig gepolt?
Vergleichen Sie die auf den Elkos aufgedruckte Polaritätsangabe noch einmal mit dem auf der Platine aufgebrachten
Bestückungsaufdruck bzw. mit dem Bestückungsplan in der
Bauanleitung. Beachten Sie, daß je nach Fabrikat der Elkos
„+“ oder „-“ auf den Bauteilen gekennzeichnet sein kann!
34
Je nach T aste, muß RL 1, RL 2 oder RL 3 (Kanal 1, 2 oder 3) anziehen, solange die jeweilige Taste gedrückt ist!
2.8 Ist bis hierher alles in Ordnung, so überspringen Sie die nach-
folgende Fehler-Checkliste.
2.9 Sollten die Relais wider Erwarten nicht oder ständig anziehen,
oder sonst eine Fehlfunktion zu erkennen sein, so schalten
Sie sofort die Betriebsspannung ab und prüfen die komplette
Platine noch einmal nach folgender Checkliste.
Checkliste zur Fehlersuche
Haken Sie jeden Prüfungsschritt ab!
❑ Ist die Betriebsspannung richtig gepolt?
❑ Ist die Betriebsspannung an den richtigen Anschlußklemmen
angeschlossen?
❑ Liegt die Betriebsspannung bei eingeschaltetem Gerät noch
im Bereich von 10 - 14 Volt?
❑ Betriebsspannung wieder ausschalten.
❑ Stimmt die Codierung am Sender mit der Codierung auf der
Empfängerschaltstufe (Schalter S 1) genau überein?
❑ Steckt das RX-Modul (Empfänger-Modul) richtig herum auf
der Platine?
❑ Sind die Widerstände wertmäßig richtig eingelötet?
Überprüfen Sie die Werte noch einmal nach 1.1 der Bauanleitung.
Page 20

37
Desweiteren erlischt bei Bausätzen, die mit säurehaltigem
Lötzinn, mit Lötfett oder ähnlichen Flußmitteln gelötet wurden die Garantie, bzw. diese Bausätze werden von uns nicht
repariert oder ersetzt.
2.10Sind diese Punkte überprüft und eventuelle Fehler korrigiert
worden, so ist nach Baustufe 2.1 erneut die Stückprüfung
durchzuführen. Erst danach darf die Baugruppe wieder in
Betrieb genommen werden! Ist durch einen eventuell vorhandenen Fehler kein Bauteil in Mitleidenschaft gezogen
worden, muß die Schaltung nun funktionieren.
Die vorliegende Schaltung kann nun nach erfolgtem Funktionstest in ein entsprechendes Gehäuse eingebaut, und für den vorgesehenen Zweck in Betrieb genommen werden.
Störung
Ist anzunehmen, daß ein gefahrloser Betrieb nicht mehr möglich
ist, so ist das Gerät außer Betrieb zu setzen und gegen unbeabsichtigten Betrieb zu sichern.
Das trifft zu:
• wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist
• wenn das Gerät nicht mehr funktionsfähig ist
• wenn Teile des Gerätes lose oder locker sind
• wenn die Verbindungsleitungen sichtbare Schäden aufweisen.
Falls das Gerät repariert werden muß, dürfen nur OriginalErsatzteile verwendet werden! Die Verwendung abweichender
Ersatzteile kann zu ernsthaften Sach- und Personenschäden
führen!
36
❑ Ist der integrierte Schaltkreis polungsrichtig in der Fassung?
Kerbe oder Punkt von IC 1 muß zu T 1 zeigen.
❑ Sind alle IC-Beinchen wirklich in der Fassung? Es passiert sehr
leicht, daß sich eines beim Einstecken umbiegt oder an der
Fassung vorbei mogelt.
❑ Befindet sich eine Lötbrücke oder ein Kurzschluß auf der Löt-
seite?
Vergleichen Sie Leiterbahnverbindungen, die eventuell wie
eine ungewollte Lötbrücke aussehen mit dem Leiterbahnbild
(Raster) des Bestückungsaufdrucks und dem Schaltplan in der
Anleitung, bevor Sie eine Leiterbahnverbindung (vermeintliche Lötbrücke) unterbrechen!
❑ Prüfen Sie auch, ob jeder Lötpunkt gelötet ist; oft kommt es
vor, daß Lötstellen beim Löten übersehen werden.
Um Leiterbahnverbindungen oder -unterbrechungen leichter
feststellen zu können, halten Sie die gelötete Printplatte
gegen das Licht und suchen von der Lötseite her nach diesen
unangenehmen Begleiterscheinungen.
❑ Ist eine kalte Lötstelle vorhanden?
Prüfen Sie bitte jede Lötstelle gründlich!
Prüfen Sie mit einer Pinzette, ob Bauteile wackeln!
Kommt Ihnen eine Lötstelle verdächtig vor, dann löten Sie sie
sicherheitshalber noch einmal nach!
❑ Prüfen Sie auch, ob jeder Lötpunkt gelötet ist; oft kommt es
vor, daß Lötstellen beim Löten übersehen werden.
❑ Denken Sie auch daran, daß eine mit Lötwasser, Lötfett oder
ähnlichen Flußmitteln oder mit ungeeignetem Lötzinn gelötete Platine nicht funktionieren kann. Diese Mittel sind leitend
und verursachen dadurch Kriechströme und Kurzschlüsse.
Page 21

39
Das gleiche gilt auch
• bei Veränderung und Reparaturversuchen am Gerät
• bei eigenmächtiger Abänderung der Schaltung
• bei der Konstruktion nicht vorgesehene, unsachgemäße Aus-
lagerung von Bauteilen, Freiverdrahtung von Bauteilen wie
Schalter, Potis, Buchsen usw.
• Verwendung anderer, nicht original zum Bausatz gehörender
Bauteile
• bei Zerstörung von Leiterbahnen oder Lötaugen
• bei falscher Bestückung und den sich daraus ergebenden Fol-
geschäden
• Überlastung der Baugruppe
• bei Schäden durch Eingriffe fremder Personen
• bei Schäden durch Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
und des Anschlußplanes
• bei Anschluß an eine falsche Spannung oder Stromart
• bei Falschpolung der Baugruppe
• bei Fehlbedienung oder Schäden durch fahrlässige Behand-
lung oder Mißbrauch
• bei Defekten, die durch überbrückte Sicherungen oder durch
Einsatz falscher Sicherungen entstehen
In all diesen Fällen erfolgt die Rücksendung des Bausatzes zu
Ihren Lasten.
38
Eine Reparatur des Gerätes darf nur vom Fachmann durchgeführt werden!
Garantie
Auf dieses Gerät gewähren wir 1 Jahr Garantie. Die Garantie umfaßt die kostenlose Behebung der Mängel, die nachweisbar auf
die Verwendung nicht einwandfreien Materials oder Fabrikationsfehler zurückzuführen sind.
Da wir keinen Einfluß auf den richtigen und sachgemäßen Aufbau haben, können wir aus verständlichen Gründen bei Bausätzen nur die Gewähr der Vollständigkeit und einwandfreien
Beschaffenheit der Bauteile übernehmen.
Garantiert wird eine den Kennwerten entsprechende Funktion
der Bauelemente im uneingebautem Zustand und die Einhaltung
der technischen Daten der Schaltung bei entsprechend der Lötvorschrift, fachgerechter Verarbeitung und vorgeschriebener
Inbetriebnahme und Betriebsweise.
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Wir übernehmen weder eine Gewähr noch irgendwelche Haftung für Schäden oder Folgeschäden im Zusammenhang mit diesem Produkt. Wir behalten uns eine Reparatur, Nachbesserung,
Ersatzteillieferung oder Rückerstattung des Kaufpreises vor.
Bei folgenden Kriterien erfolgt keine Reparatur bzw. es erlischt
der Garantieanspruch:
• wenn zum Löten säurehaltiges Lötzinn, Lötfett oder säurehaltiges Flußmittel u. ä. verwendet wurde,
• wenn der Bausatz unsachgemäß gelötet und aufgebaut wurde.
 Loading...
Loading...