Page 1
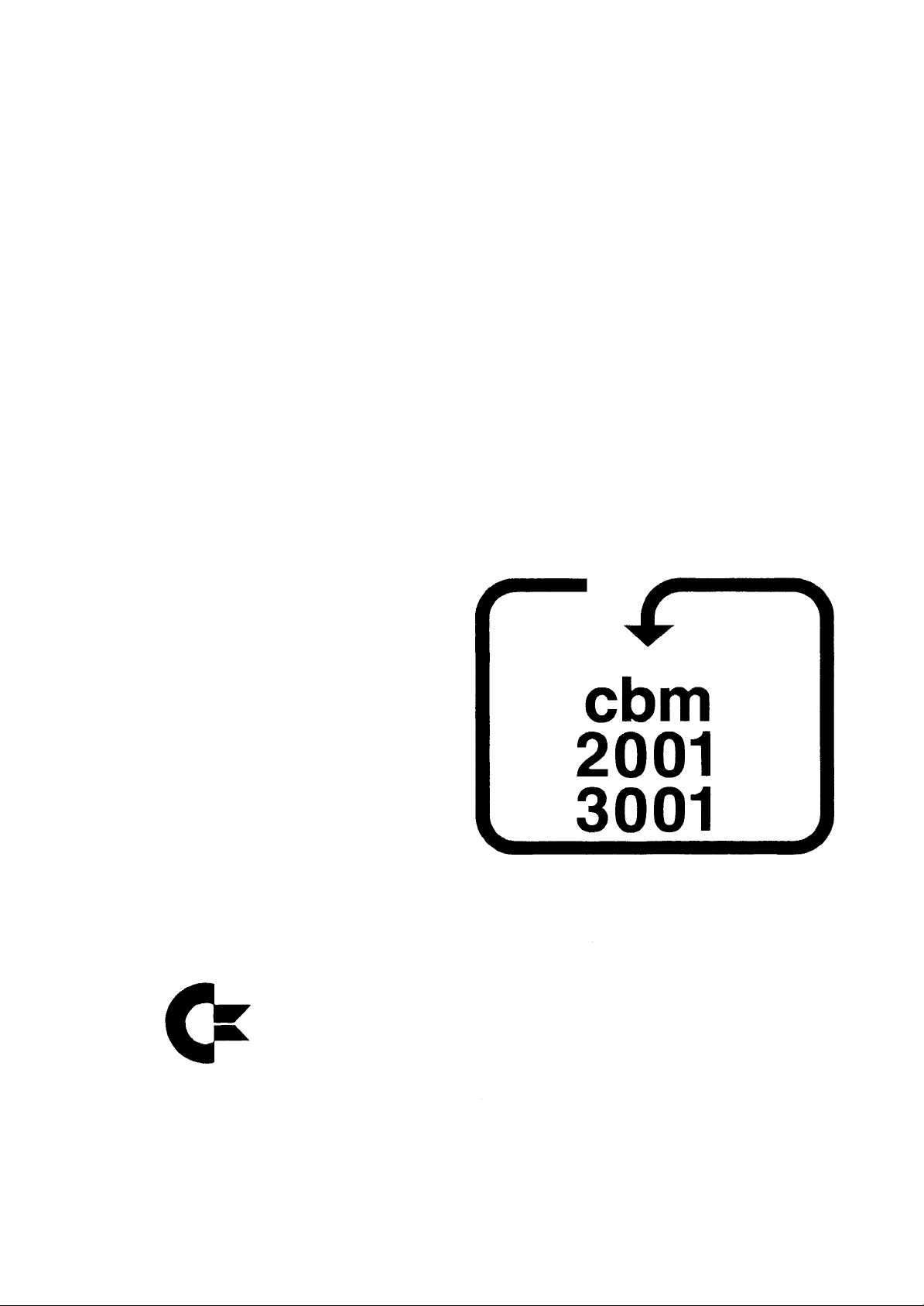
commodore -
Bedienungshandbuch
Computer
Page 2

Dieses Handbuch wurde gescannt, bearbeitet und ins PDF-Format konvertiert von
Rüdiger Schuldes
schuldes@itsm.uni-stuttgart.de
(c) 2003
Page 3

Einleitung
Diese Einleitung befaßt sich mit dem grundsätzlichen Kennenlernen Ihres Computers.
Sollten Sie mit dessen Bedienung schon etwas vertraut sein, so dürfte diese Anleitung für Sie kaum etwas
Neues bieten. Wir halten es jedoch für unerläßlich, Sie mit der Grundbedienung vertraut zu machen. Meist
ist es ja so, daß der Neuling an Kleinigkeiten verzweifelt, die dem Erfahrenen nur ein müdes Lächeln
abringen.
Stecken Sie also den Schukostecker in die Steckdose und schalten das Gerät einmal ein. Der Einschalter
befindet sich auf der Rückseite des Rechners links unten. Nach kurzer Zeit haben Sie ersten Kontakt; der
Rechner meldet sich auf dem Bildschirm mit der Meldung:
# # # COMMODORE BASIC # # #
7167 BYTES FREE
READY.
Die Zahl 7167 (oder 15359 bei den Geräten der Serie 3016 bzw. 31743 beim 3032) sagt Ihnen übrigens,
wie groß der Schreib-Lese-Speicher Ihres Computers ist.
Die Meldung # # # COMMODORE BASIC# # # sagt Ihnen, in welcher Sprache der Rechner program
miert werden kann. Auf die Sprache BASIC kommen wir ausführlich in Kapitel 1 zu sprechen.
Sollte wider Erwarten der Einschaltvorgang nicht korrekt ablaufen, so versuchen Sie bitte folgendes:
1. Drehen Sie den Helligkeitsregler für den Bildschirm entgegen dem Uhrzeigersinn bis zum Anschlag.
Sollte die Meldung des Rechners jetzt sichtbar sein, so drehen Sie den Regler wieder soweit zurück,
bis die Schrift normal hell sichtbar ist.
2. Schalten Sie den Rechner wieder aus. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
Überprüfen Sie die Sicherung, die Sie mit einem Schraubenzieher herausdrehen können (die Siche
rung befindet sich direkt neben dem Einschalter). Sollte die Sicherung noch in Ordnung sein, so bleibt
Ihnen nichts anderes übrig, als Ihren Fachhändler aufzusuchen.
Nachdem Sie nun den Rechner eingeschaltet haben, wollen wir kurz einmal den Begriff der Dialogfähig
keit des Rechners erläutern. Die Dialogfähigkeit des Rechners besagt nichts anderes, als daß:
1. Sowohl eine Eingabemöglichkeit, als auch eine Ausgabemöglichkeit des Rechners in Sicht- und Griff
weite des Bedieners sein müssen (bei Ihrem Gerät sind das der Bildschirm und die Tastatur).
2. Daß sowohl der Rechner fragen kann und Sie antworten als auch Sie Fragen oder Aufgaben stellen
können und der Rechner antwortet.
3. Der Rechner Ihnen offensichtliche Fehler, die Sie bei der Programmierung gemacht haben, möglichst
genau lokalisiert, so daß eine Korrektur leicht und schnell möglich ist.
Alle diese Möglichkeiten bietet Ihnen der Computer. Er kann somit ohne Einschränkungen als dialogfähig
bezeichnet werden.
Sehen wir uns einmal die Tastatur genauer an. Grundsätzlich gliedert sich die Tastatur in sieben Unter
gruppen:
1. Die alphabetischen Tasten
Drücken Sie einmal leicht auf die Taste Q. Wie zu erwarten, erscheint auf dem Bildschirm an der Stelle,
wo sich das blinkende Quadrat gerade noch befand, ein Q und das Quadrat wandert eine Stelle weiter
nach rechts (es nennt sich übrigens CURSOR).
Der Computer reagiert natürlich auf alle Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen genauso, wie auf dasQ.
2. Die numerischen Tasten
An sich ist eine Trennung dieser Tasten von den anderen nicht nötig. Da in einem Computer sehr oft
Zahlen eingegeben werden, ist es aber sinnvoll, die Zifferntasten zusammenfassen, damit Sie ohne
große Handbewegung schnell hintereinander erreichbar sind.
Erstaunen mag Sie als EDV-Neuling wohl, was der Punkt in diesem Block zu suchen hat, während das
Komma, bei jeder Zahl mit Nachkommastellen unerläßlich, ganz wo anders angebracht ist.
Doch das ist schnell erklärt.
Page 4
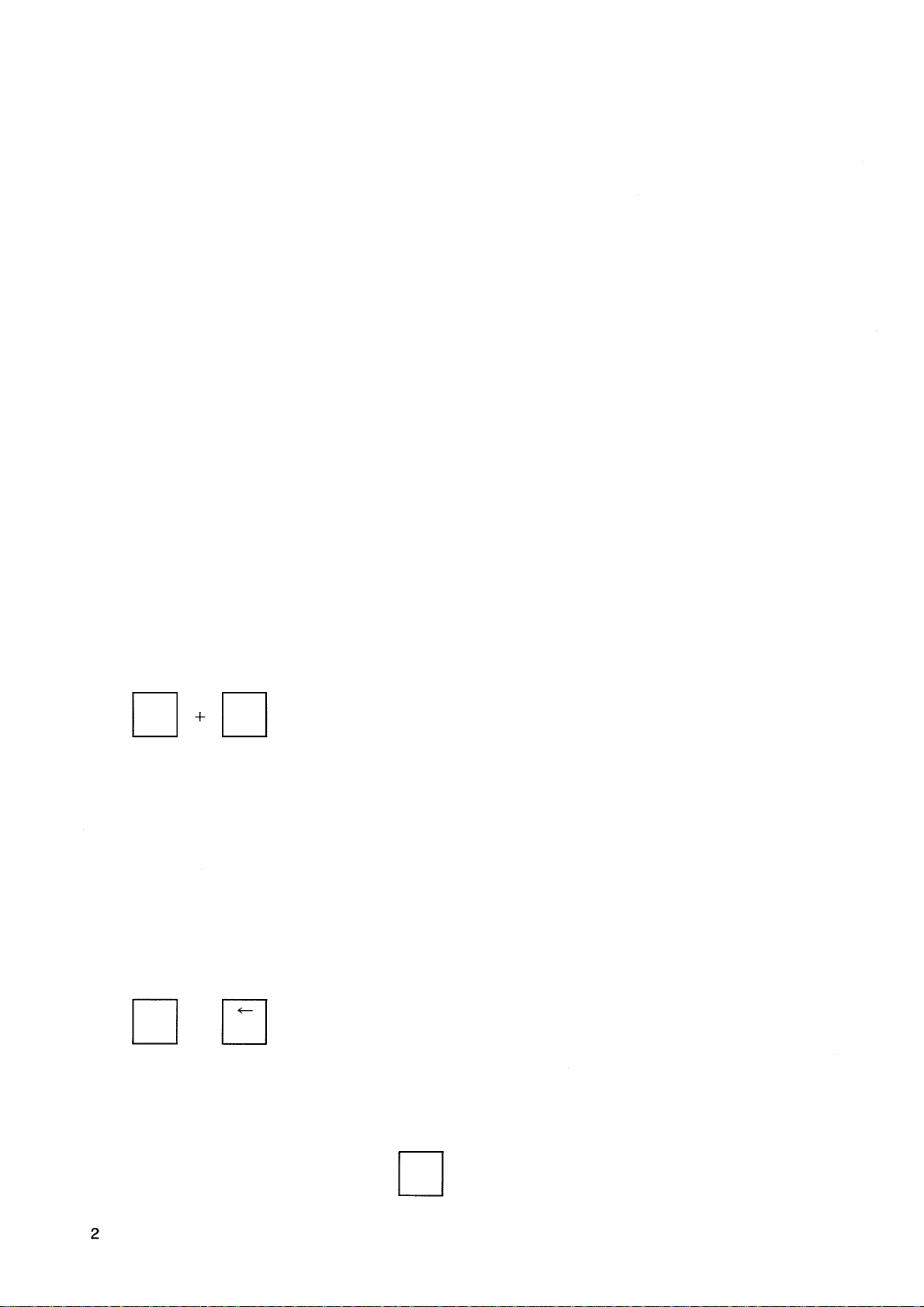
In den U.S. A., wo auch Ihr Computer herkommt, gibt es kein Dezimalkomma, sondern ein Punkt trennt
Vor- und Nachkommastellen. Wenn Sie sich diese Besonderheit schon jetzt einprägen, werden Sie
später viele Eingabefehler an Ihrem Rechner umgehen können.
3. Die grafischen Zeichen (Siehe Anhang VIII für die -2-Tastatur)
Bestimmt haben Sie die seltsamen Hieroglyphen auf der Tastatur schon verwundert. Das sind gra
fische Zeichen, mit denen man z. B. Tabellen oder einfache Bilder herstellen kann. Um diese Zeichen
auf dem Bildschirm darzustellen, machen Sie folgendes:
A) Drücken Sie eine der beiden SHIFT-Tasten (im alphabetischen Tastenblock untere Reihe links und
rechts).
B) Halten Sie diese Taste gedrückt und drücken Sie gleichzeitig beispielsweise die Taste Q. Auf dem
Bildschirm erscheint das zugehörige Sonderzeichen (statt eines Q beispielsweise ein weißer Kreis).
Siehe auch 1.2.36.
4. Die CURSOR-Steuertasten
Was der Cursor (sprich Körser) ist, haben wir bereits einmal kurz angesprochen. Wir wollen an dieser
Stelle jedoch einmal genauer darauf eingehen.
Prinzipiell hat der Cursor 2 Funktionen:
Erstens teilt der Computer Ihnen dadurch mit, daß er auf eine Eingabe per Tastatur von Ihnen wartet.
Zweitens zeigt er Ihnen an, wo auf dem Bildschirm diese Eingabe angezeigt wird. Das durch die Ta
statur gewählte Zeichen erscheint genau an der Stelle, wo sich der Cursor gerade befindet.
Nun ist es oftmals nötig, den Cursor zu bewegen, ohne daß ein Zeichen geschrieben wird, oder Sie
haben sich verschrieben und wollen ein Zeichen nachträglich einfügen, ändern oder löschen. Dazu
dienen die Cursor-Steuertasten.
Diese befinden sich in der oberen Reihe des numerischen Tastaturblocks.
Sehen wir uns ein Beispiel an:
Drücken Sie gleichzeitig
SHIFT
CLR
HOME
Der gesamte Bildschirminhalt wird gelöscht und der Cursor steht in der oberen Zeile links.
Geben Sie nun einen beliebigen Text ein, z. B.:
DER cbm IST EIN COMPUTER
Nach jedem Buchstaben bewegt sich der Cursor eine Stelle weiter nach rechts und steht zum
Schluß hinter dem R von Computer.
Wir wollen nun den Text ändern, daß er zum Schluß heißt:
DER cbm - MEIN COMPUTER
Zuerst löschen wir das IST und ersetzen es durch -.
Drücken Sie dazu die Tasten
SHIFT
CRSR
—»
Wie Sie sehen, bewegt sich der Cursor um eine Stelle nach links. Er steht jetzt auf dem R von Com
puter. Wiederholen Sie den Vorgang, bis der Cursor auf dem T von IST steht.
Nun drücken Sie zweimal die Taste
INST
DEL
Page 5
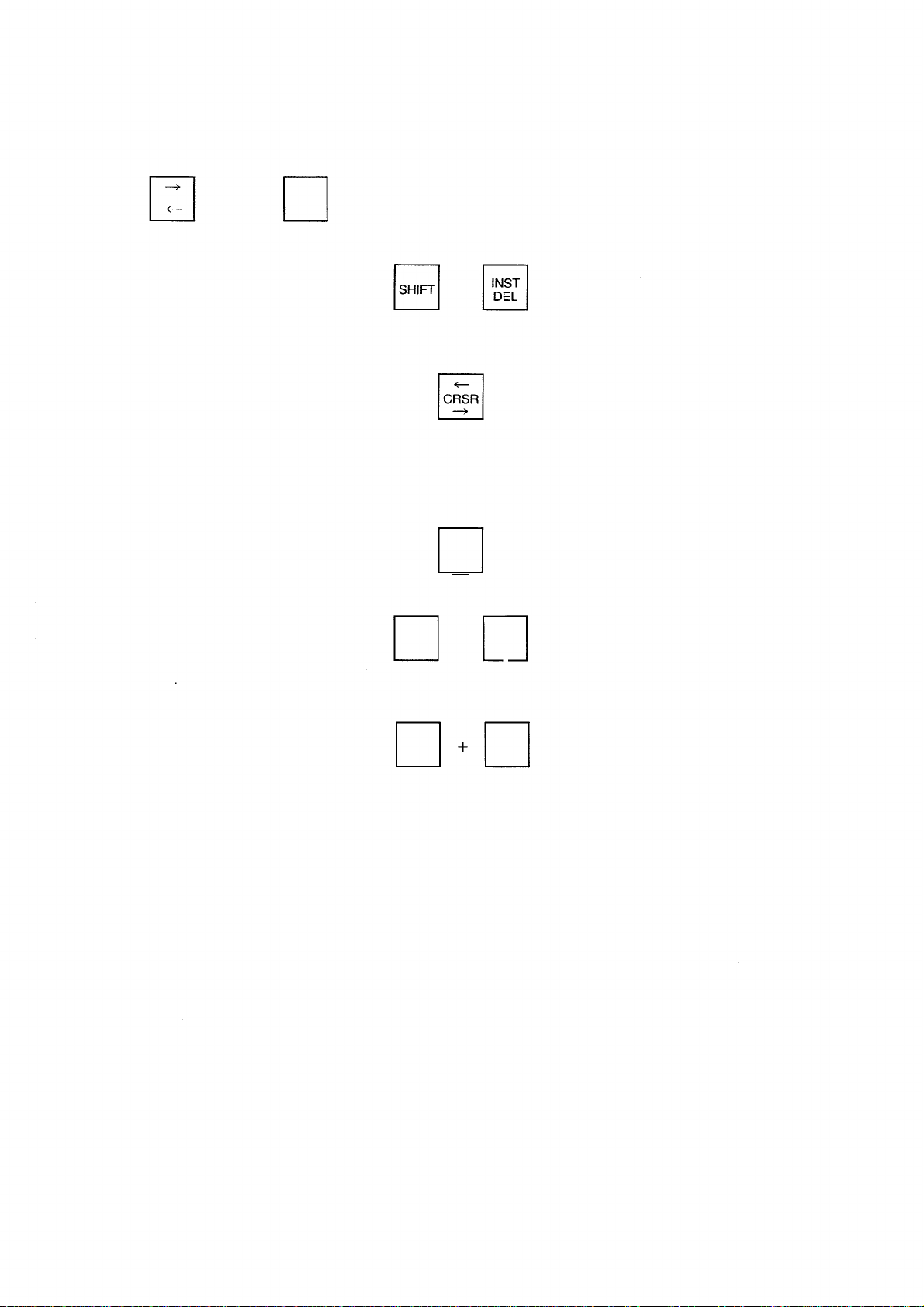
Nach jedem Tastendruck verschwindet das sich jeweils links neben dem Cursor befindliche Zei
chen und der Rest der Zeile wird, einschließlich dem Cursor, um eine Stelle nach links nachgeführt.
Geben Sie jetzt einfach das Zeichen - ein; es überschreibt das vom IST übrig gebliebene T. Mit der Taste
CRSR (aber ohne SHIFT
Mit den Tasten
) bewegen Sie jetzt den Cursor auf das E von EIN.
+
machen Sie nun Platz für das noch fehlende M. Dabei wird der Rest der Zeile ab dem Cursor um eine
Stelle nach rechts verschoben. Zum Schluß gehen Sie mit der Taste
wieder an das Ende des Satzes.
In diesem Beispiel haben wir den Cursor in einer Zeile hin- und her bewegt. Genauso leicht ist es aber
auch möglich, in die darunter liegende Zeile
Î
CRSR
T
oder darüber liegende Zeile
SHIFT +
î
CRSR
1
zu springen.
Zwei Besonderheiten an dieser Stelle noch zu dem Bildschirm: wenn beim Einfügen mit den Tasten
SHIFT
der Rest der Eingabe das Ende der Zeile erreicht hat, so wird er in die nächste tiefere Zeile schreibrich
tig übertragen. Über mehr als eine Zeile ist das aber nicht möglich. Das Einfügen von Zeichen wird
dann blockiert. Das geschieht aus folgendem Grund:
In seinem Speicher behandelt der Rechner zwei Bildschirmzeilen â 40 Zeichen wie eine Zeile â 80 Zei
chen. Mehr als 80 Zeichen können also nicht gleichzeitig behandelt werden. Die zweite Besonderheit
stellen Sie fest, wenn Sie mit dem Cursor in die unterste Zeile »fahren«. An sich müßte der Cursor jetzt
bei weiteren Versuchen, noch tiefer zu fahren, stehen bleiben. Z. B. am oberen Rand, wenn Sie noch
höher fahren wollen. Das geschieht zwar auch, der Bildschirminhalt wird um eine Zeile nach oben ge
schoben und die oberste Zeile des Bildes verschwindet. Man nennt das »der Bildschirm rollt« oder
auch
ROLL MODE
im Gegensatz zum stehenden Bild, das man
BLOCK MODE
nennt.
Die verschwundene Zeile ist endgültig gelöscht, da der Roll Mode nur in einer Richtung arbeitet und
zwar nur von unten nach oben.
Sie selber haben gesehen, welche Vorteile die Cursor-Steuertasten haben. Ihr Gebrauch wird Ihnen
schnell zur Gewohnheit werden.
INST
DEL
3
Page 6
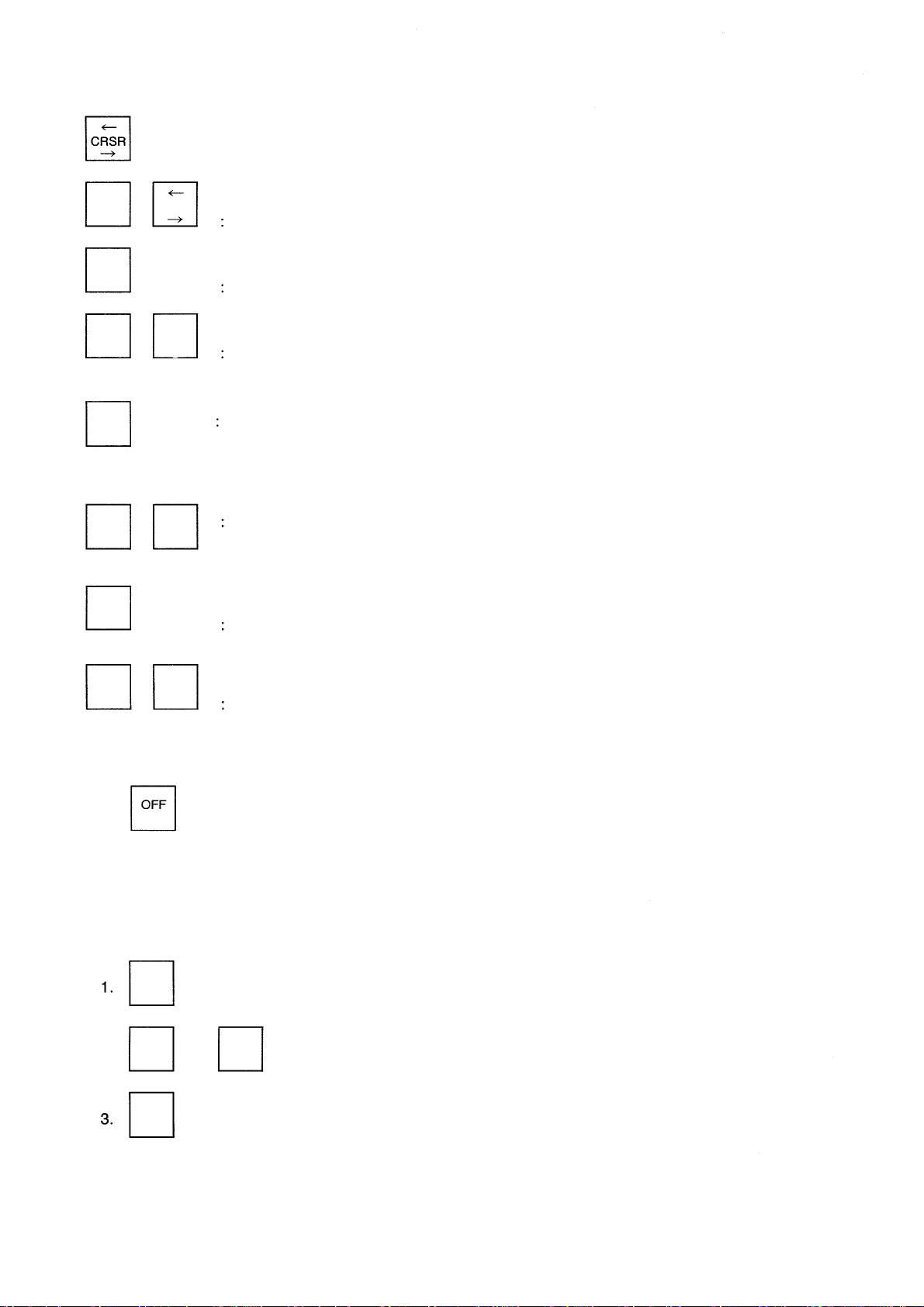
Daher noch einmal eine Zusammenfassung
CURSOR RIGHT (Cursor nach rechts)
: Der Cursor bewegt sich eine Stelle nach rechts;
SHIFT CRSR
Î
CRSR
1
SHIFT
INST
DEL
SHIFT
CLR
HOME
Î
CRSR
1
INST
DEL
CURSOR LEFT (Cursor nach links)
Der Cursor bewegt sich eine Stelle nach links;
CURSOR DOWN (Cursor nach unten)
Der Cursor bewegt sich um eine Zeile nach unten;
CURSOR UP (Cursor nach oben)
Der Cursor bewegt sich um eine Zeile nach oben;
DELETE (Zeichen löschen)
Das links von dem Cursor befindliche Zeichen wird gelöscht. Gleichzeitig wird der
gesamte rechte Teil der Zeile zusammen mit dem Cursor um ein Zeichen nach links
versetzt.
INSERT (Zeichen einfügen)
Ab der Position des Cursors wird der rechte Teil der Zeile um eine Stelle nach rechts
verschoben. Der Cursor bleibt an der gleichen Stelle stehen, wo sich nun ein Leer
zeichen befindet.
HOME (Cursor in Grundstellung)
Der Cursor wird in seine Grundstellung nach links oben versetzt.
SHIFT
CLR
HOME
CLEAR (löschen des Bildschirms)
Zusätzlich zu der Home-Funktion wird der gesamte Bildschirminhalt gelöscht.
5. Die RVS-Taste
(Reverse = umgekehrt)
RVS
Mit dieser Taste können Sie alle Zeichen auf dem Bildschirm dunkel auf hellem Untergrund stellen. Man
nennt das
INVERSE VIDEO (umgekehrter Bildschirm)
Diese Darsteilungsart wird bevorzugt, um besonders wichtige Meldungen auf dem Bildschirm hervor
zuheben. Die RVS-Taste hat drei Bedeutungen:
OFF
RVS
SHIFT
2.
OFF
RVS
OFF
+
RVS
Nach Drücken dieser Taste erscheinen alle folgenden Zeichen invertiert,
bis die Funktion ausgeschaltet, oder die Taste »RETURN« gedrückt wird.
Nach Drücken dieser Taste wird inverse video wieder abgeschaltet und
alle weiteren Zeichen erscheinen wieder normal.
Sollten Sie einmal Informationen auf dem Bildschirm nicht lesen kön
nen, weil im Roll-Mode die Zeilen zu schnell »vorbeilaufen«, so kann
durch Drücken der Taste »OFF RVS« die Ausgabe so weit verlangsamt
werden, daß ein Lesen in Ruhe erfolgen kann.
4
Page 7
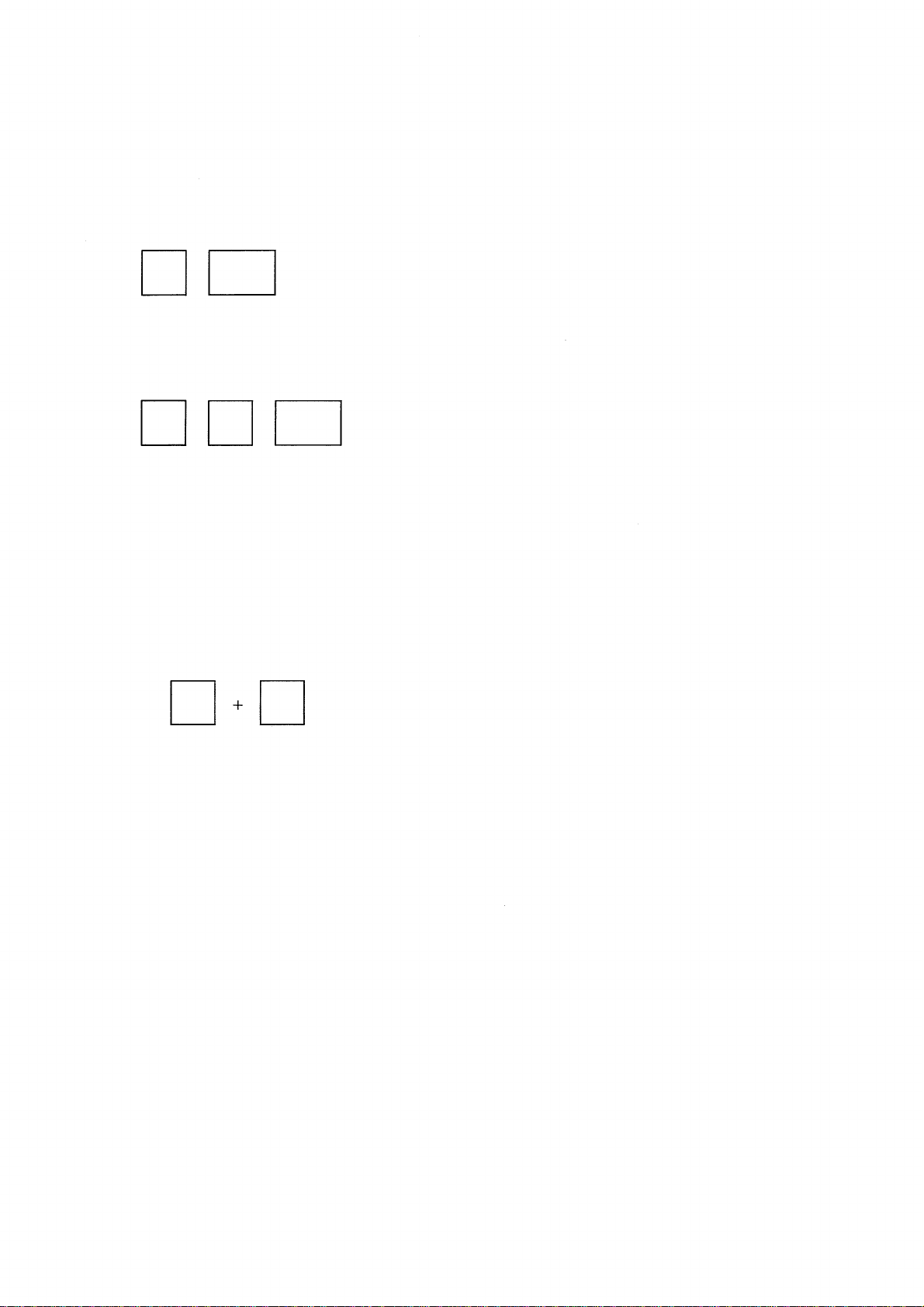
6. Die RETURN-Taste
Diese Taste (Alpha -Tastenblock, 2. + 3. Zeile rechts, rot) beendet eine Eingabe in den Rechner (nicht
zu verwechseln mit dem Bildschirm, der ist nur ein Teil des Rechners). Ihr Computer kann nämlich nicht
ahnen, wann die Information (man sagt in Fachkreisen dazu DATEN; auch wir werden uns jetzt daran
halten) vollständig sind. Wenn Sie z. B. eine 1 eingegeben haben, weiß der Rechner nicht, ob vielleicht
noch eine 6 folgt. Dazu beenden Sie alle Dateneingaben mit der Taste RETURN:
Z.B.:
1 RETURN
(Eingabe der Zahl 1).
1
6
RETURN
(Eingabe der Zahl 16).
7. Die RUN/STOP-Taste
Auch die RUN/STOP-Taste hat zwei Bedeutungen. Zum einen können Sie mit dieser Taste ein laufen
des Programm an jeder beliebigen Stelle abbrechen. Das ist dann sinnvoll, wenn Sie in einem laufenden
Programm gewisse Daten überprüfen wollen, die nicht von selber ausgegeben werden. Beispiele dafür
geben wir Ihnen später.
Zum anderen können Sie auf einer Kassette gespeichertes Programm mit
SHIFT
RUN
STOP
in den Speicher des Computers einladen und automatisch starten.
1. DER COMPUTER UND SEINE SPRACHE
BASIC, die Sprache in der Ihr Computer arbeitet, ist eine leicht erlernbare, zum Teil aus englischen
Worten, zum Teil aus mathematischen Zeichen bestehende Folge von Befehlen. Obwohl es eine der
leichtesten Programmiersprachen ist, ist sie ungeheuer vielseitig und flexibel. Ursprünglich an der
Dartmouth University entwickelt um Studenten die Möglichkeit zu geben, schnell und leicht Pro
bleme an einem Computer zu bearbeiten, breitete sich diese Sprache sehr schnell in der ganzen
Welt aus. Heute existiert BASIC in unzähligen Versionen auf fast jedem größeren Computer.
Bei unserem COMMODORE-BASIC stand auch das DARTMOUTH-BASIC Pate; gleichzeitig ist
das COMMODORE-BASIC größer und leistungsfähiger geworden.
1.1. Die Komponenten der BASIC-Programmiersprache
Bevor wir uns mit der eigentlichen Sprache BASIC befassen, müssen wir uns zuvor über einige
Schreibregeln einigen. Nachfolgend eine Liste der Konventionen und Ausdrücke, die wir in diesem
Buch zu unserer und Ihrer Erleichterung einführen:
Eckige Klammern [ ] - Ausdrücke in eckigen Klammern können, müssen aber nicht angegeben
werden.
Zeichen - Ein Buchstabe, eine Zahl oder ein beliebiges Sonderzeichen.
Konstante - Eine Zahl innerhalb der Rechengrenzen Ihres Computers (siehe 1.1.1 ).
Formel - Eine Konstante, eine Variable oder ein Ausdruck, bestehend aus Konstanten
und /oder Variabaien (z. B. 8 + 3* %).
5
Page 8
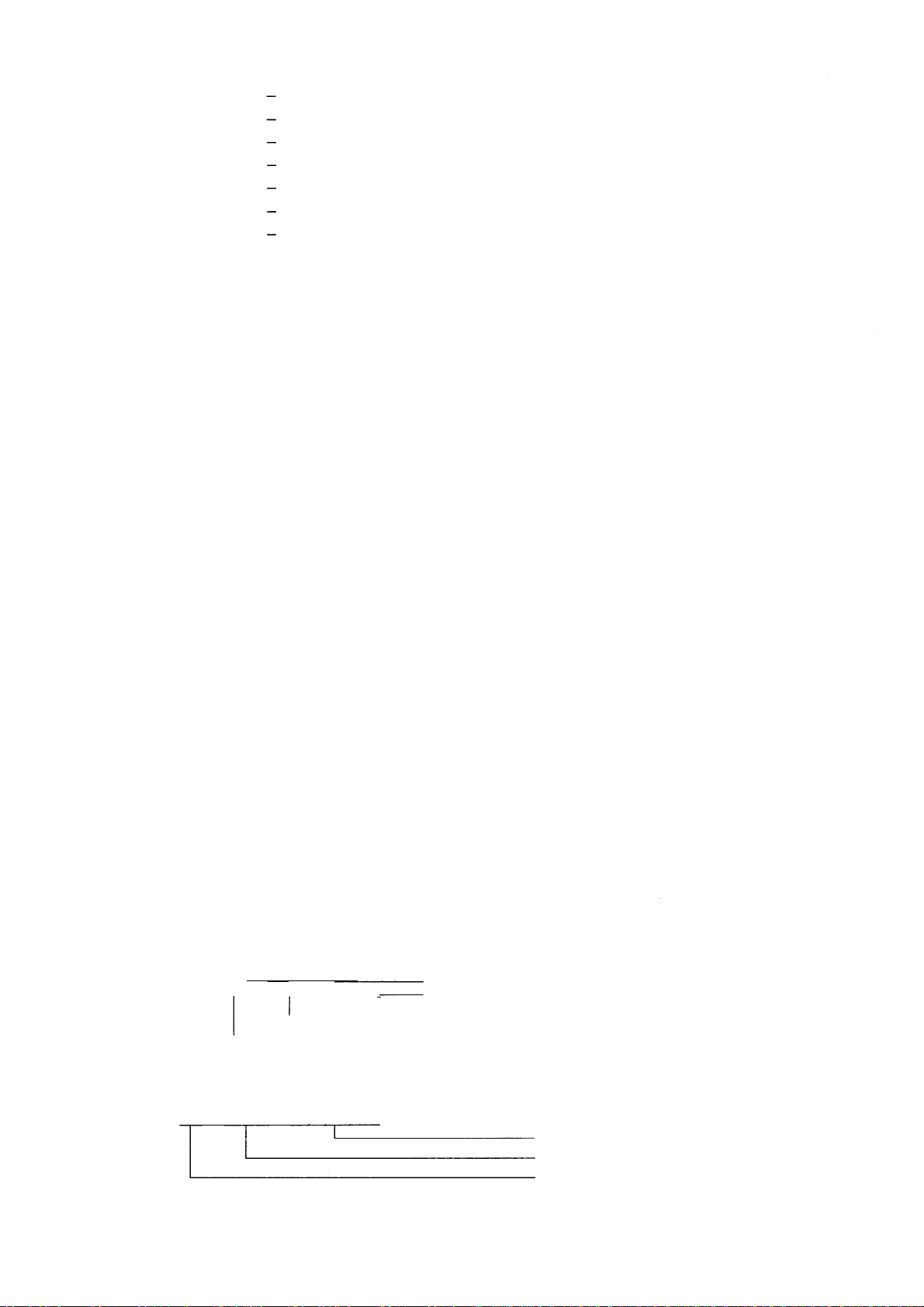
Buchstabe
Zeilennummer
Text
Variable
Integer
Byte
Geschweifte Klammer O
Ein alphabetisches Zeichen von A - Z.
Eine ganze Zahl von 0 bis 63999.
Eine Folge von 0 bis 255 beliebigen Zeichen.
Siehe 1.1.2.
Eine ganzzahlige Konstante oder Variable im Bereich von - 32768 bis 32767.
Eine ganzzahlige Konstante oder Variable im Bereich von 0 bis 255.
Genau einer der in geschweiften Klammern angegebenen Ausdrücke muß
benutzt werden.
1.1.1 Die Konstanten
Die Grundform einer Konstanten ist eine Dezimalzahl zwischen 1.7*1038 und 2.93*1 CT39.
Bis zu 9 Stellen einer Zahl können gespeichert werden und es kann damit gerechnet werden.
Beispiele für Konstanten:
25,15.75, -87, 0, 3255, 45E7.14.2E-6,13.12345678
In zwei der Konstanten tauchte der Buchstabe E auf. Der Buchstabe E besagt, daß die nach
folgenden Zahlen den Exponenten zur Basis 10 darstellen.
1.5E3 bedeutet 1.5*103=1.5*10*10*10 = 1.5*1000 = 1500
1.27E-2 bedeutet 1.27*10“2 = 1.27/10/10 = 1.27/100 = 0.0127.
Das Vorzeichen wird nur bei negativen Zahlen geschrieben.
Konstanten werden verwendet, um feste Werte zu fixieren.
Da der Computer nicht nur numerische Werte verarbeiten kann, sondern auch Textverarbeitung
zuläßt, gibt es genauso wie numerische Konstanten auch Textkonstanten:
”A”, ’’PETER IST LIEB”, ’’ICH BIN EIN CBM”, ”125 LAMPEN”.
Die Textkonstanten erkennt man daran, daß sie in Anführungszeichen eingebettet sind. Die Anfüh
rungszeichen selber gehören jedoch nicht zur eigentlichen Textkonstante.
1.1.2. Die Variablen
Eine Variable ist ein Symbol, dessen Wert sich ändern kann. Der Name einer Variablen besteht aus
entweder einem Buchstaben z. B.: A, G, Z
oder einem Buchstaben und einer Zahl z. B.: A1, F6,V9
oder zwei Buchstaben z. B.: AX, PE, UT, UX
plus (wahlweise) der Kennzeichnung % oder $.
Eine Variable kann aus mehr als zwei Zeichen bestehen, es werden aber nicht mehr als zwei Zei
chen abgefragt. Wenn Sie zum Beispiel zwei Variablen HANS und HABEL nennen, so werden diese
wie eine Variable behandelt, da beide mit HA anfangen.
Die Variable kann innerhalb eines BASIC-Programms verschiedene Funktionen annehmen:
- Variablen repräsentieren numerische Werte
z. B.: A=10 , A5=-5.6E-3 , XY=3.14
- Variablen können in den Rechner eingegeben werden
z. B. 10 INPUT A,B,C1,XY
~T~ P- I
___________________________________________
____________________________________________________ Zeilennummer
- Variablen können gleich gesetzt werden
z. B. A = B, A5= XY, XY = B (A wird gleich B gesetzt, usw.)
_____________________________
Variablenliste
Eingabebefehl
Variablen können ausgedruckt werden
Z. B. 20 PRINT A. B. C1.XY
6
Variablenliste
Ausgabebefehl
Zeilennummer
Page 9

Es gibt drei Arten von Variablen:
1. Fließkommavariablen
Diese Variablen können jeden beliebigen Wert innerhalb der Rechengrenzen des Computers an
nehmen.
Jede Variable, deren Name das Kennzeichen % oder$ nicht enthält, ist eine Fließkommavariable.
Beispiel: A = 7
B8 = 1.5E3
ZY = 9E9
X1 =-0.52187
2. Festkommavariablen
Diese Variablen können als Wert ganze Zahlen zwischen (einschließlich) -32767 und +32767 an
nehmen. Sie haben am Ende des Namens das Zeichen % stehen.
Beispiel: A% = 7
L1 % = 4528
X0% =0
3. Stringvariablen (Strings, Textvariablen)
Diese Variablen haben als Wert einen beliebigen Text aus 0 bis 255 Zeichen. Sie werden mit ange
hängtem $ gekennzeichnet.
Beispiel: A$ = ’’TEXT”
B$ = ”55”
C$ = ’’DIES IST EIN STRING”
X1 $ = ’’COMPUTER 3001 ”
N$ = ” ” (Bemerkung: dieser String besteht aus keinem Zeichen.)
Alle drei Variablenarten können noch indiziert werden. Man spricht dann von dimensionierten
Variablen, Matrizen, Feldern oder Arrays. Siehe 1.2.18.
1.1.3. Arithmetische Operationen
Zu den arithmetischen Operationen gehören zunächst einmal die vier Grundrechenarten, die
auf dem Computer eine etwas andere Darstellungsform besitzen als Sie es vielleicht von anderen
Geräten oder Beschreibungen her kennen.
Nachfolgend die Darstellung dieser Zeichen:
Addition +
Subraktion Multiplikation *
Division /
Darüberhinaus existieren eine Vielzahl von mathematischen Funktionen, die standardmäßig vor
handen sind.
Betrachten wir diese Funktionen im einzelnen.
• SGN Die SIGNUM (Vorzeichen)-Funktion.
Der Funktionswert ist:
für negative Zahlen -1
für positive Zahlen +1
für Null 0
Syntax: SGN ({Variable, Konstante, arithm. Ausdruck })
Beispiel: A = SGN (B)
PRINT SGN (-45)
PRINT SGN (A + 7T *2)
Den Wert in der Klammer bezeichnet man als Argument.
Anstelle von PRINT kann auch das Fragezeichen gesetzt werden.
7
Page 10

Anwendung:
Auf sehr einfache Weise bestimmen, ob eine Zahl negativ, positiv oder 0 ist.
• INT Die INTEGER-Funktion
Sie bildet bei positiven Zahlen die kleinste ganze Zahl, d.h. alle Nachkommastellen
werden zu 0 gesetzt.
Bei negativen Zahlen bildet sie die kleinste negative Zahl, d. h. alle Nachkommastellen werden bis
zur nächsten ganzen Zahl abgerundet.
Syntax: INT ({Variable, Konstante arithm. Ausdruck })
Beispiel: A = INT (B)
? INT (B) ? INT (-2.5) ?INT(X-Y)
Anwendungsbeispiel:
Auf- oder Abrunden eines Ergebnisses, wenn nur eine ganzzahlige Größe erlaubt ist, z. B. bei der
rechnerischen Ermittlung einer Zahl von Schrauben in einem Behälter.
• ABS Die ABSOLUTWERT-Funktion
Sie schneidet das Vorzeichen ab und bildet nur den absoluten Wert.
Syntax: ABS ({Variable, Konstante, arithm. Ausdruck })
Beispiel: A = ABS (B)
? ABS (-145)
Anwendungsbeispiel:
Berechnung einer Wurzel aus einer unbekannten Zahl. Da es mathematisch nicht möglich ist, aus
einer negativen Zahl eine Wurzel zu ziehen, kann man zuvor den Absolutwert bilden.
• SQR Die SQUARE ROOT (Quadratwurzel)-Funktion
Sie bildet die Quadratwurzel aus dem Argument.
Syntax: SQR ({Variable, Konstante, arithm. Ausdruck })
Beispiel: A = SQR (B) ? SQR (16)
Anwendung:
Im Bereich der Mathematik.
• SIN Die SINUS-Funktion
Sie berechnet den Sinuswert des Arguments im Bogenmaß. (Die mathematische Be
deutung der trigonometrischen Funktionen wird als bekannt vorausgesetzt.)
Syntax: SIN ({Variable, Konstante, arithm. Ausdruck })
Beispiel: A = SIN (B)
? SIN (30)
Anwendung:
Im Bereich der Mathematik.
Ist das Argument in GRAD gegeben, muß es durch eine Umrechnung modifiziert werden.
Beispiel: A = SIN (30 * 7r /180)
Ist das Argument in NEUGRAD gegeben, so lautet die Umrechnung:
Beispiel: A = SIN (30 * tt / 200)
8
Page 11
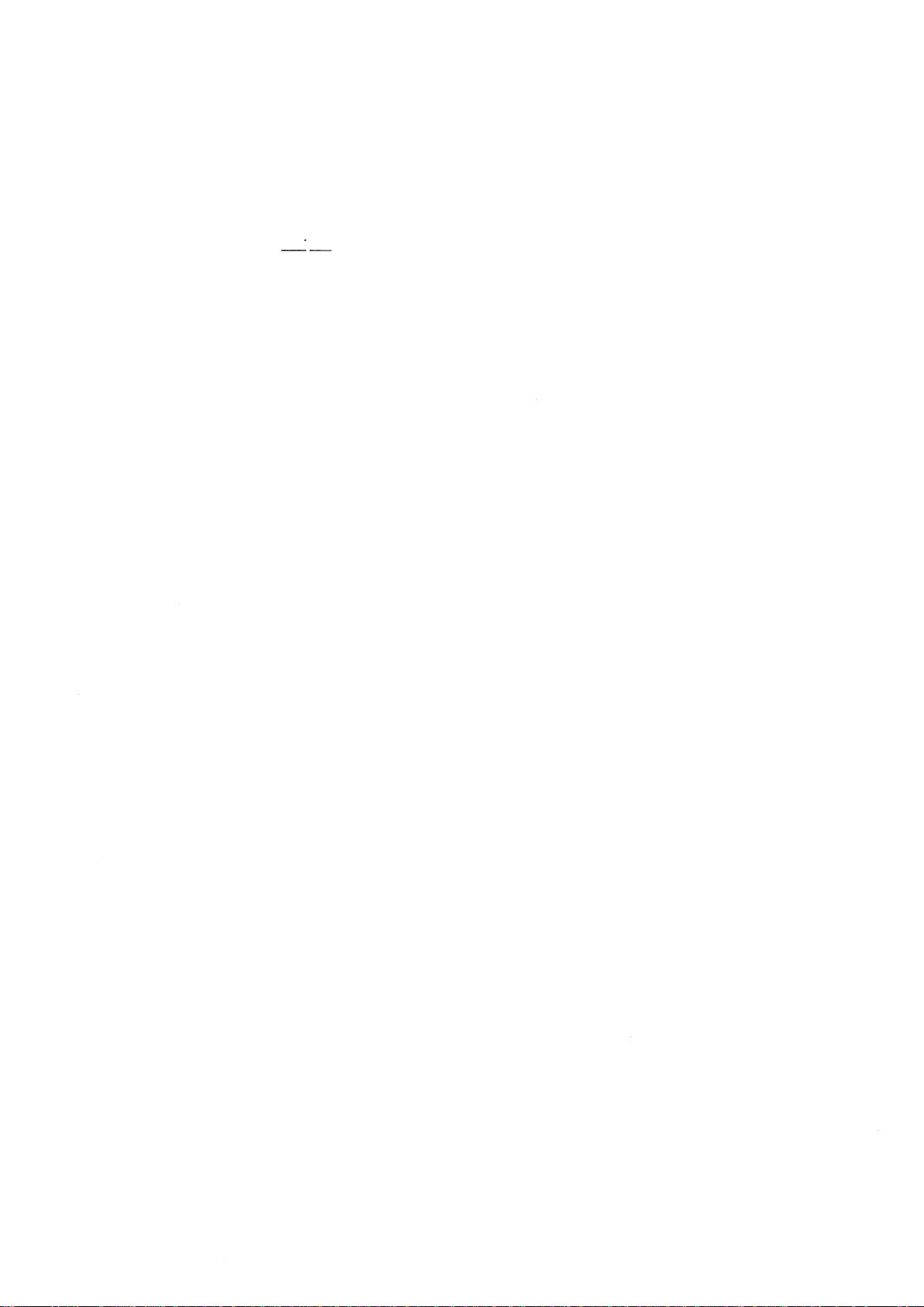
• COS Die COSINUS-Funktion
Sie wird genauso behandelt wie die SIN-Funktion.
• TAN DieTANGENS-Funktion
Sie wird behandelt wie die SIN-Funktion.
Die COTANGENS-Funktion existiert bei Ihrem Rechner nicht, da sie sehr einfach durch dieTANFunktion gebildet werden kann. Die Beziehung lautet:
COT (X) =
TAh
S (X)
Beispiel: Y = 1 / TAN (X)
Von den Umkehrfunktionen zu den bisher behandelten trigonometrischen Funktionen existiert
lediglich die
• ATN ARCUSTANGENS-Funktion.
Sie bildet die Umkehr-Funktion des TANGENS.
Syntax: ATN ({Variable, Konstante, arithm. Ausdruck })
Beispiel: Y = ATN (X)
Anwendung:
Im Bereich der Mathematik.
Die Umkehrfunktionen zum SIN und COS lassen sich leicht mit dem ATN berechnen.
Die Beziehungen lauten:
ARC SIN (X) = ATN (X / SQR (1 - X f 2))
ARC COS (X) = ATN (SQR (1 - X | 2) / X)
• LOG der NATÜRLICHE LOGARITHMUS ermittelt die Logarithmen zur BASIS e = 2,7182818
Syntax: LOG ({Variable, Konstante, arithm. Ausdruck })
Beispiel: Y = LOG (X)
• EXP der EXPONENT zur natürlichen Basis e ermittelt den Wert der Funktion y = e
Syntax: EXP ({Variable, Konstante, arithm. Ausdruck })
Beispiel: Y = EXP (X)
0 I die Potenzierung zu einer beliebigen Basis mit beliebigen Exponenten.
Syntax: {Variable, Konstante, arithm. Ausdruck} { {Variable, Konstante, arithm. Ausdruck}
Beispiel: Y = A { X
? 2 } 3
• RND die RANDOMIZE (Zufalls)-Funktion
Sie bildet Pseudo-Zufallszahlen zwischen 0 und 1.
Syntax: RND ({ Variable, Konstante, arithm. Ausdruck })
Beispiel: ? RND (X)
a) X negativ
RND mit negativem Argument ergibt immer den gleichen Funktionswert. Dies kann
beispielsweise für Fehlersuche oder während der Programmentwicklung nützlich sein.
b) X = 0
ergibt einen Wert, der nur von der Zeit seit dem Einschalten des Computers abhängt.
c) X positiv
liefert von der Zeit und von X abhängige Zufallsvariablen.
x
9
Page 12
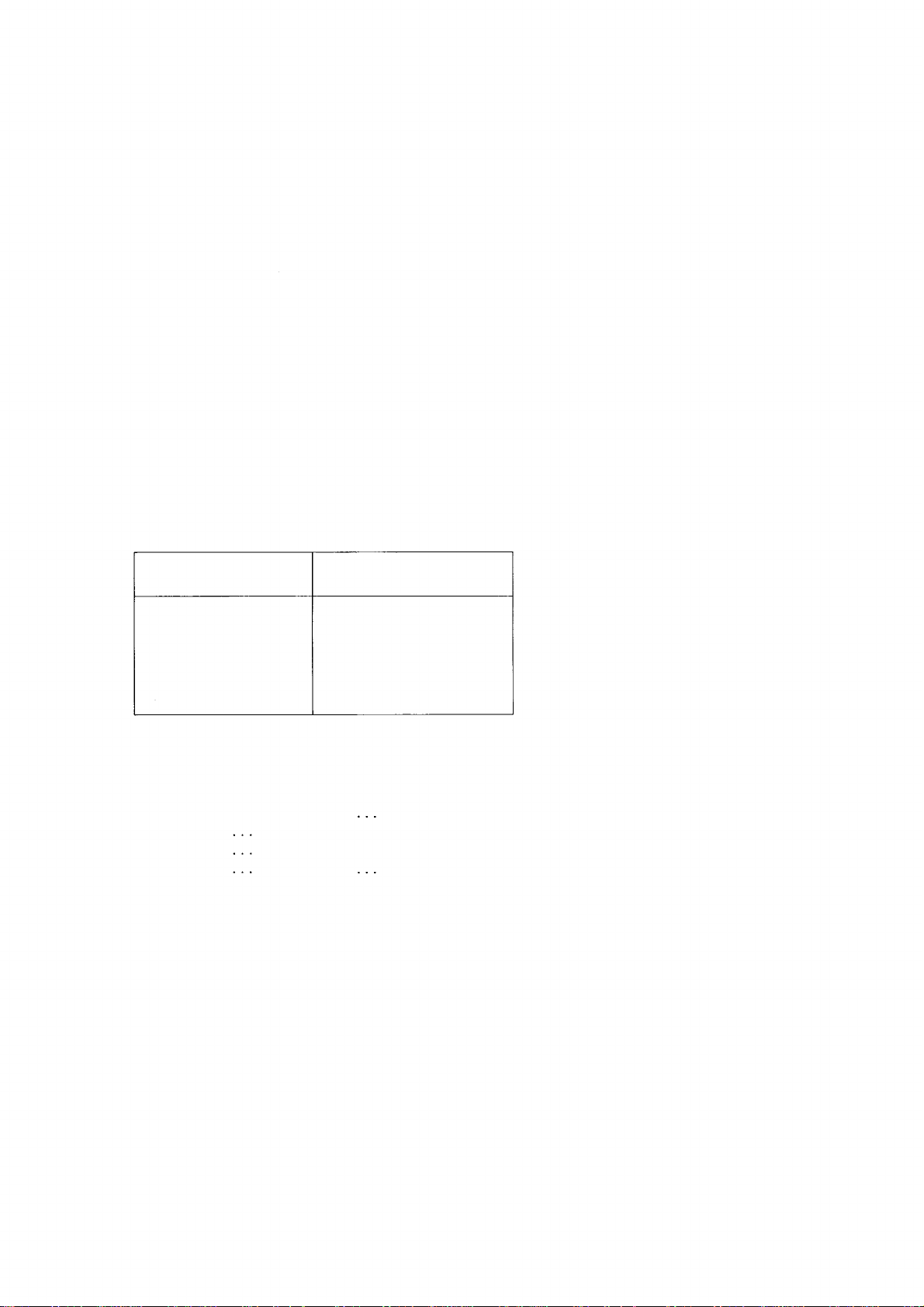
Beispiel: Es soll ein Würfel simuliert werden.
10 W = RND(-TI)
20 W = INT (6 * RND (1) + 1)
30? W
• is die Zahl PI.
Sie ist fest gespeichert, tt = 3.14159265
1.1.4 OPERATOREN
zu den Operatoren zählen:
a) die Vergleichsoperatoren
b) die logischen Operatoren
Vergleichsoperatoren
Sie dienen dazu, Zahlenwerte zu vergleichen. Dies bildet einen sehr wichtigen Bestandteil bei der
Behandlung und Untersuchung von Zahlen.
Wenn z. B. aus einer Zahlenfolge alle Zahlen ermittelt werden sollen, die einen bestimmten Grenz
wert überschreiten, wird ein Vergleichsoperator angewendet.
Die Frage lautet:
- Welcher Wert ist größer als der Grenzwert, bzw.
- Welcher Wert ist kleiner oder gleich dem Grenzwert.
Die mathematische Darstellungsform dieser Vergleichsoperatoren zeigt nachfolgende Tabelle:
BASIC
SCHREIBWEISE BEDEUTUNG
< kleiner als
> größer als
= < gleich oder kleiner als
= > gleich oder größer als
<> oder ><
=
Einige Beispiele mögen die Anwendung und Bedeutung der Vergleichsoperatoren hervorheben.
Dabei benutzen wir schon jetzt die im Rechner gebräuchliche Schreibweise.
IF A < B THEN ? A
IF
A > B THEN ? B
IF
A < > B (oder: IF A >< B)
IF A >= B
IF A <= B
IF
A = B THEN ? ”A =
nicht gleich
Gleichheit
wenn A kleiner als B, dann drucke A
Wenn A größer gleich B, dann ...
B” wenn A gleich B, dann drucke: A = B
LOGISCHE OPERATOREN
Sie sind der Booleschen Algebra entlehnt und finden unter anderem in der elektronischen Digital
technik (also die Technik, in der der Rechner arbeitet) Anwendung.
In den Programmiersprachen haben sie ebenfalls eine sehr große Bedeutung. Man kann mit Ihnen
komplizierte Abfragen aufbauen.
Der Rechner kennt drei logische Operatoren, nämlich
AND (und -Bedingung)
OR (oder-Bedingung)
NOT (nicht- Bedingung)
10
Diese Operatoren können angewendet werden auf beliebige Variablen.
Page 13
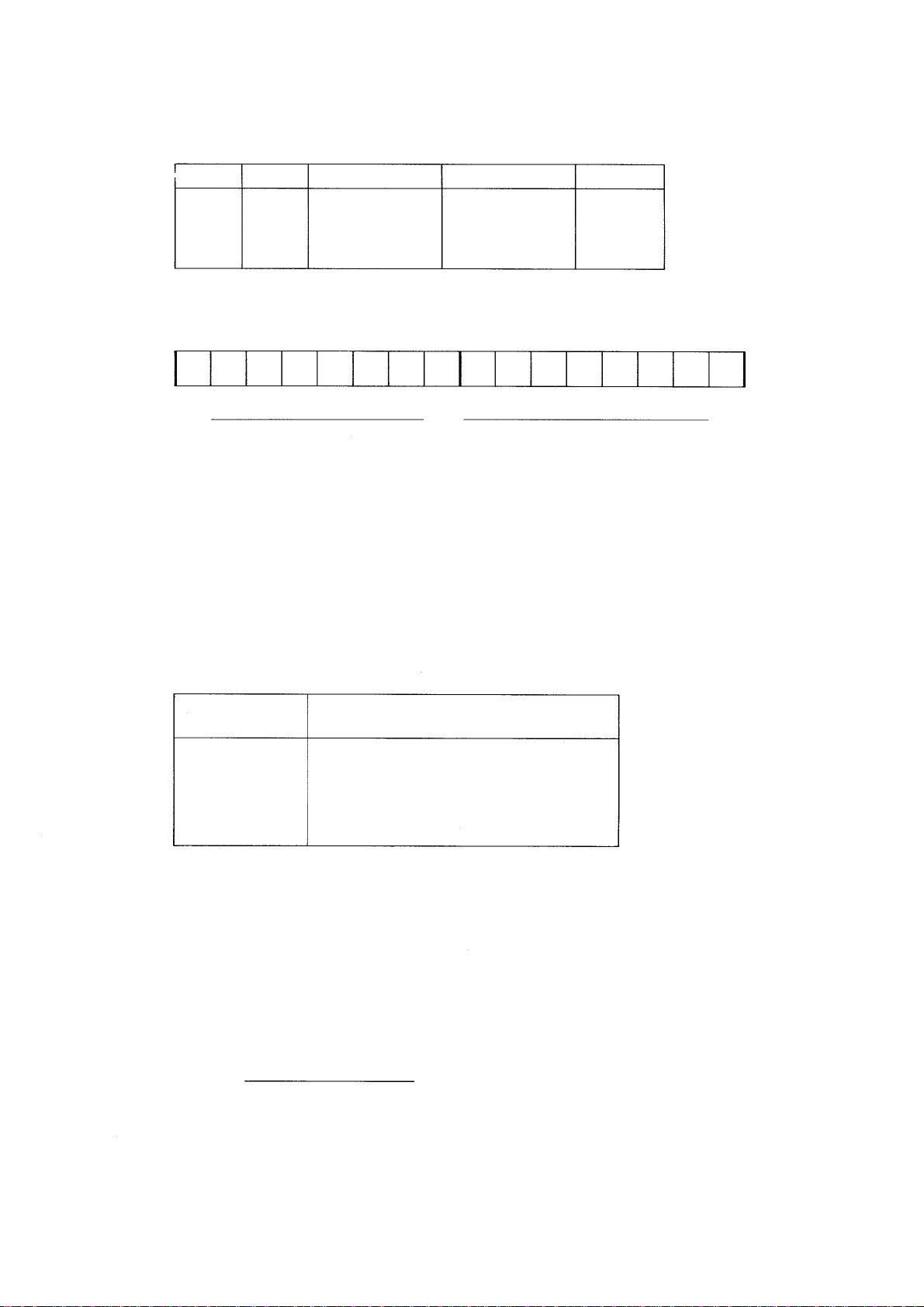
1. AND, OR und NOT bei Festkommavariablen:
Bei ganzen Zahlen zwischen — 32767 und 32767 arbeiten diese Funktionen bitweise in der folgen
den Art:
X
0 0 0
0 1
1
1 1 1
Alle Festkommazahlen (Integerzahlen) sind im Computer binär verschlüsselt. Sie bestehen aus
16 Bits, die jeweils den Zustand 0 oderl annehmen können.
X X X X X
14
15
I
____
Daraus folgt, daß 216 = 65536 verschiedene Integerzahlen darstellbar sind.
Da wir aber bei ganzen Zahlen auch negative Zahlen darstellen wollen, wird Bit 15 als Vorzeichen
benutzt. Wenn dieses Bit Null ist, so ist die Zahl positiv, ist Bit 15 gleich Eins, so ist die Zahl negativ.
Es bleiben damit 215 -1 = 32767 verschiedene Möglichkeiten, positiv oder negativ.
Positive Zahlen sind in der Weise codiert, daß Bit n der Wert 2n zugewiesen wird, wenn dieses Bit
gleich 1 ist. Ansonsten hat Bit n den Wert 0. Die Werte aller Bits werden addiert, um die Zahl zu er
halten.
Die Bitdarstellung einer negativen Zahl erhält man folgendermaßen:
Man bildet die entsprechende positive Zahl in Binärdarstellung invertiert dann alle Bits und addiert 1.
Y XANDY
X OR Y NOT X
0 1
0 1
0 0 1
1
X X X X
12 11
13
Byte 2 Byte 1
10
9 8
_____
I
X X X X X
7
6 5
I
4
1
0
0
3 2 1
X X
_____
0
I
Beispiel:
Integer
- 1
- 2
- 100 1111 1111
- 119 1111 1111
- 127 1111
AND, OR und NOT bilden aus den Argumenten die neuen Werte durch bitweises Vorgehen ent
sprechend der Wahrheitstabelle.
1111 1111
1111 1111
Beispiel: ? 5000 AND -127
? 5000 OR -127
? NOT 5000
wegen
00010011 10001000 ( 5000)
11111111 10000001 (-127)
00010011 10000000
11111111 10001001
11101100 01110111
1111
Binär
1111 1111
1111
1001
1000 1001
1000 0001
ergibt 4992
ergibt- 119
ergibt -5001
5000 AND -127
5000 OR -127
NOT 5000
1110
1100
11
Page 14
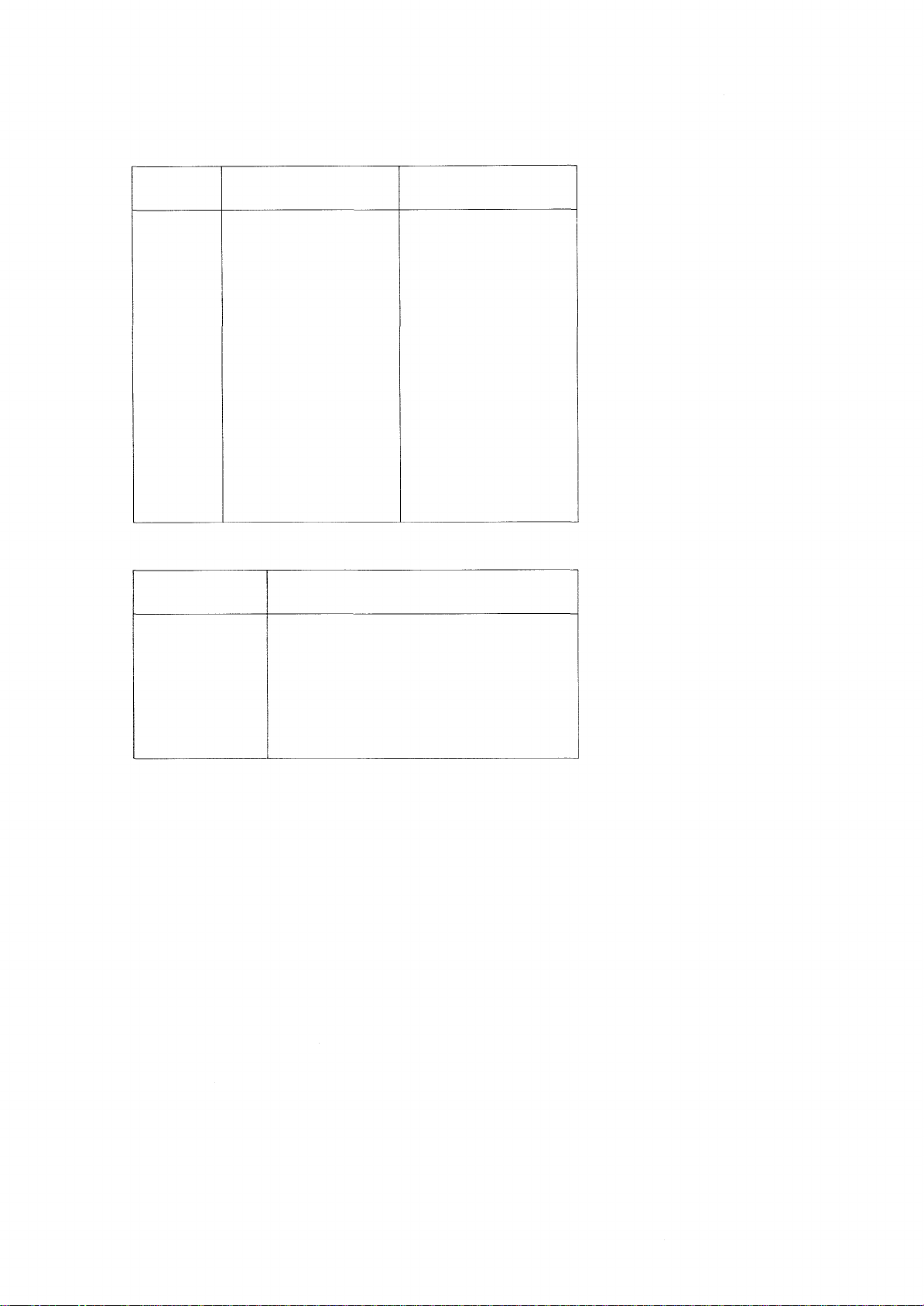
2. „Wahr“ und „Falsch“
Jeder Aussage wird vom Computer ein Wert zugeordnet, und zwar der Wert -1 (alle Bits = 1), wenn
die Aussage trifft, und der Wert 0 (alle Bits = 0), wenn die Aussage nicht zutrifft.
Bit 15
Bit 14
13
12 4096
11
10
Beispiel:
Integer
10000
32767
Wert, wenn Bit = 1
negativ
16384
8192 0
2048
1024 0
9
8
7 128
6
5
4
3
512 0
256
64 0
32 0
16
2
1
0
0
0000
1 0000
8
4 0
2
1 0
0000
0000
Wert, wenn Bit = 0
Binär
100 0000 0000 0110
1000
5000
0000
0010
0111
0001
0011
0111
1111
0011
positiv
0
0
0
0
0
0
0
0
0000 0000
0000
0001
0100
1110
0001
1000
0000
1111 1111
1000
1000
Beispiel: A$ = "AMEN” : ? A$ = ’’AMEN” : ? A$ = ’’AMENDE”
Hier wird der Variable A$ der String AMEN zugeordnet, dann soll der „Wert“ zweier Aussagen
gedruckt werden. Da die erste Aussage „wahr“ und die zweite Aussage „falsch“ ist, erhält man
als Antwort: -1 und0.
Beispiel: ? A = NOTB
? X > Y
? X$ = A$ + ”X”
3
usw.
3. AND, OR und NOT bei Aussagen
Die AND-Funktion ist dann wahr, wenn alle Einzelbedingungen wahr sind.
Beispiel: IF A = 1 AND B = 2 AND C = 3 THEN PRINT ’’FERTIG”
Der Computer wird das Wort FERTIG nur dann ausgeben, wenn die Variablen A, B und C die Werte
1, 2 bzw. 3 haben.
Beispiel: IF A$ = ”J” THEN ? ”JA”
Die OR-Funktion ist dann wahr, wenn mindestens eine der Einzelbedingungen wahr ist.
Beispiel: IF A$ = ”J” OR A$ = ”Y” THEN ? ”JA”
Der Computer wird nur dann JA ausgeben, wenn A$ vorher den String ”J” oder den String ”Y”
zugewiesen erhielt.
12
Page 15
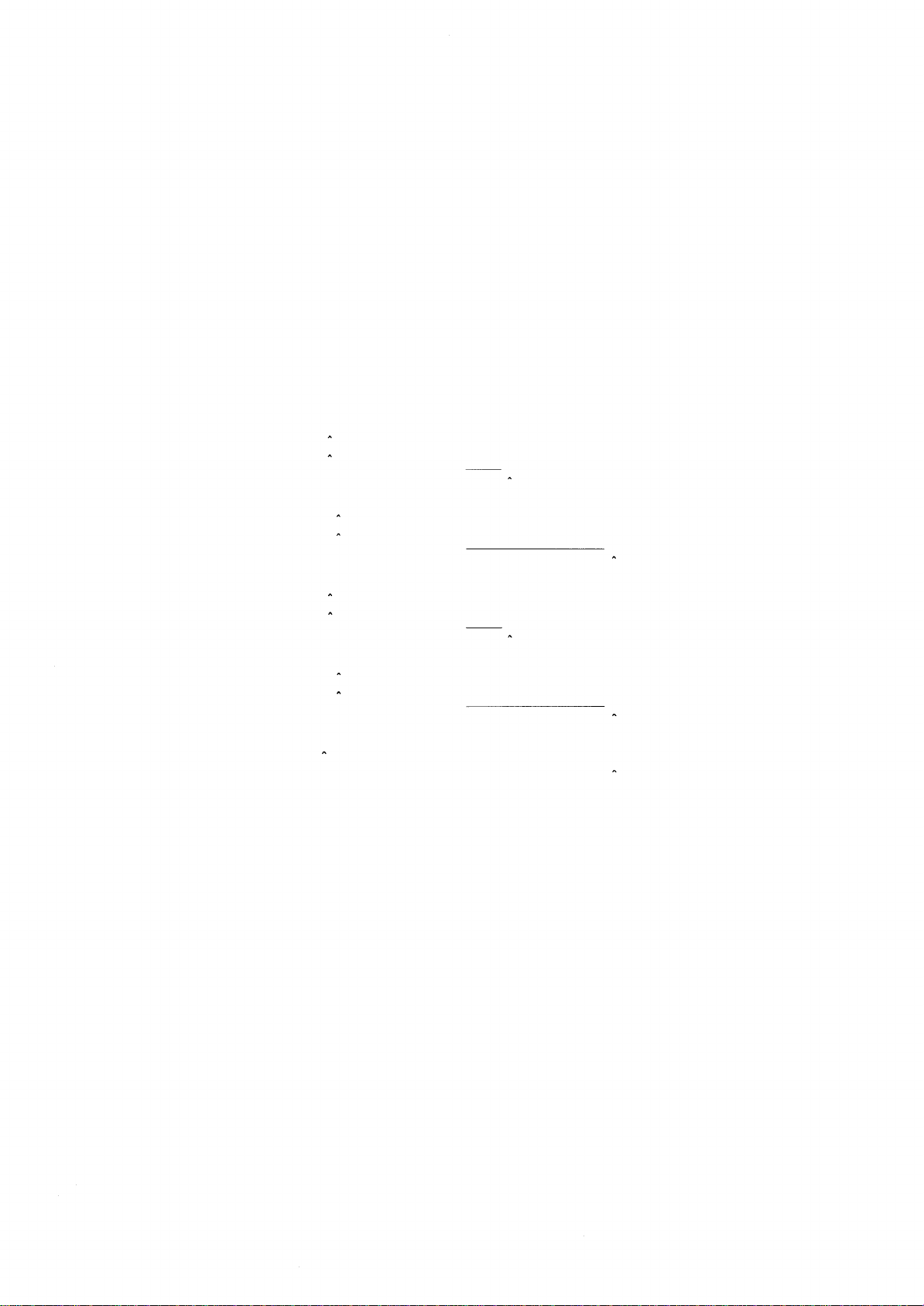
Die NOT Funktion kann nicht auf Strings angewendet werden, sondern nur auf Festkomma
variabien, ist das Argument eine Dezimalzahl, so werden die Nachkommastellen nicht beachtet.
Liegt das Argument nicht innerhalb der Grenzen für eine Integerzahl, so erhält man eine ent
sprechende Fehlermeldung (? ILLEGAL QUANTITY ERROR).
Beispiel: A = - 3 : B = -3.54 : ? NOTA, NOTB
ergibt: 2 2
A = - 5 : ? NOTA, NOT NOTA
ergibt: 4 - 5
A = 123456 : ? NOTA
ergibt: ? ILLEGAL QUANTITY ERROR (Argument zu groß)
BEISPIELE FÜR BOOLESCHE OPERATIONEN
63 AND 16 = 16 Da die binäre Schreibform von 63
111111, und von 16 10000 ist,
ergibt sich nach der AND-Verknüpfung
10000 oder 16.
15 AND 14 = 14 15 =
14 =
Resultat
-1 AND 8 = 8
-1 =
8 =
Resultat
10 OR 10 = 10
10 =
10 =
Resultat
-1 OR -2 = -1
-1 = 1111111111111111
-2 =
Resultat
NOT 0= -1
0 =
Komplement davon 1111111111111111 = —1
1111
1110
1110 =14
1111111111111111
0000000000001000
0000000000001000 = 8
1010
1010
1010 = 10
1111111111111110
1111111111111111 = -1
0000000000000000
1.1.5 PRIORITÄTEN bei Formeln
Da in der Rechnerschreibweise Formeln und Anweisungen in einer Zeile geschrieben werden,
muß der Rechner ein Schema besitzen, diese Formeln der Reihe nach abzuarbeiten.
Diese PRIORITÄT zur Abarbeitung mathematischer Formeln kann man sehr einfach darstellen.
Oberste Priorität haben immer die mathematischen Operatoren, gefolgt von den Vergleichs
operatoren und den logischen Operatoren.
Im einzelnen läßt sich das wie folgt darstellen:
13
Page 16
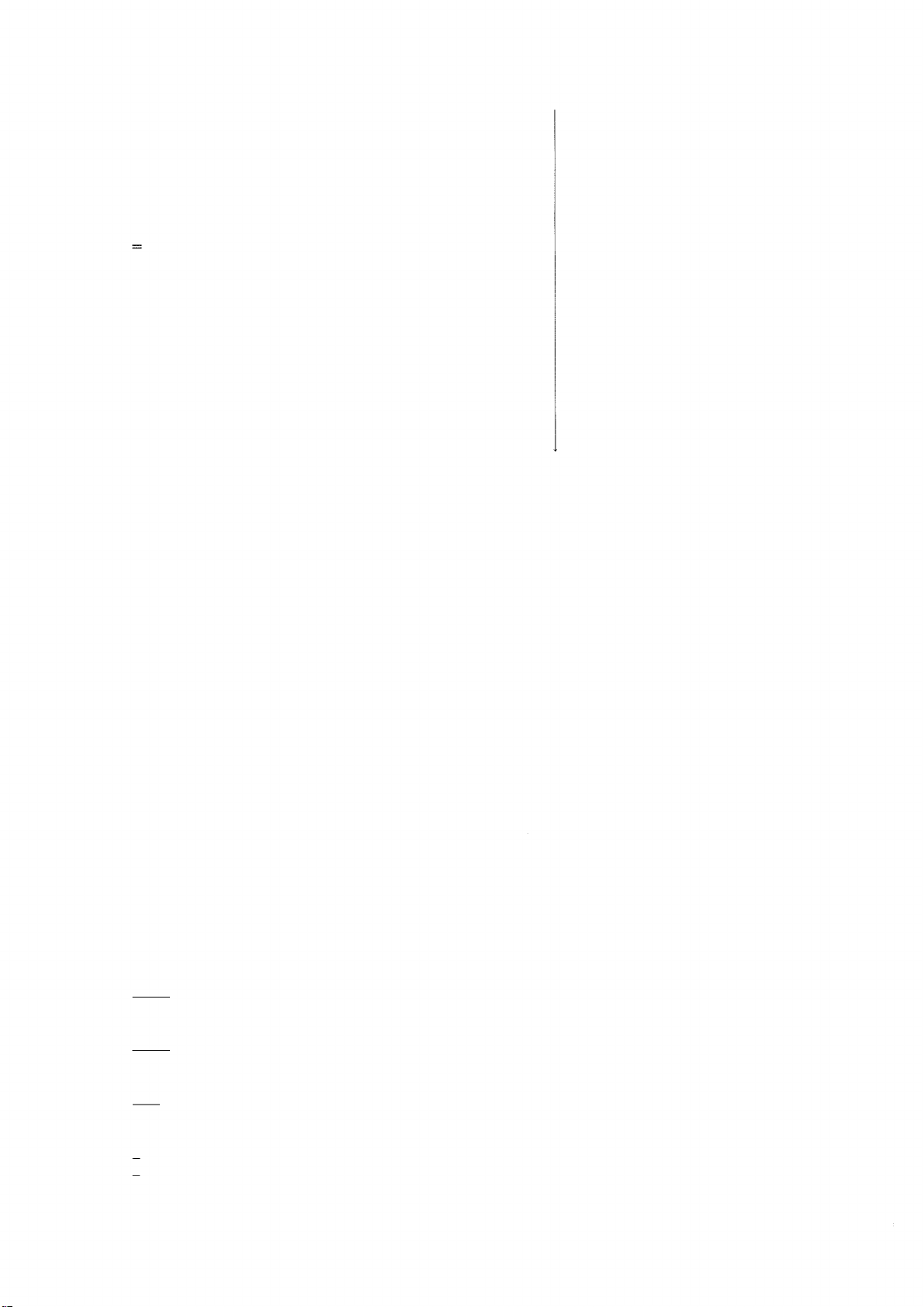
Mathem. Operatoren Höchste Priorität
Funktionen
Î
*/
+ -
VERGLEICHSOPERATOREN
<> (oder ><)
>
<
> =
< =
LOGISCHE OPERATOREN
NOT
AND
OR Niedrigste Priorität
Beispiel: ? 2 j 3 + 6 ergibt 14, weil 2 | 3 zuerst berechnet wird.
1.1.6 Besonderheiten des Gleichheitszeichens
Das Gleichheitszeichen hat in der EDV-Terminologie eine von der Algebra abweichende Bedeutung.
Es bedeutet:
„Ist der Wert von“
und ist nicht zu verwechseln mit der algebraischen Bedeutung:
„Ist gleich“
Die Rechenanweisung
X = X + 1
wäre in der Algebra falsch, da sie auf den Widerspruch 0 = 1 führt.
In der Programmiersprache BASIC ist diese Anweisung jedoch korrekt, sie besagt nämlich:
X „ist der Wert von“ alter Wert von X plus 1
oder
X = X * B X „ist der Wert von“ alter Wert von X mal dem Wert von B.
1.1.7 MATHEMATISCHE FORMELN ALS BEISPIEL FÜR RECHENANWEISUNGEN
Mathematische Formeln werden in BASIC etwas anders geschrieben als in der herkömmlichen
Schreibweise.
Den besten Vergleich erhält man, wenn man diese unterschiedlichen Schreibweisen anhand von
Beispielen einander gegenüber stellt.
ALGEBRAISCH
a + b
c + d
a + b
c
a • b
c
a
b
c
BASIC
(A + B) / (C + D)
(A + B) / C
A * B / C
A/B/C
14
Page 17
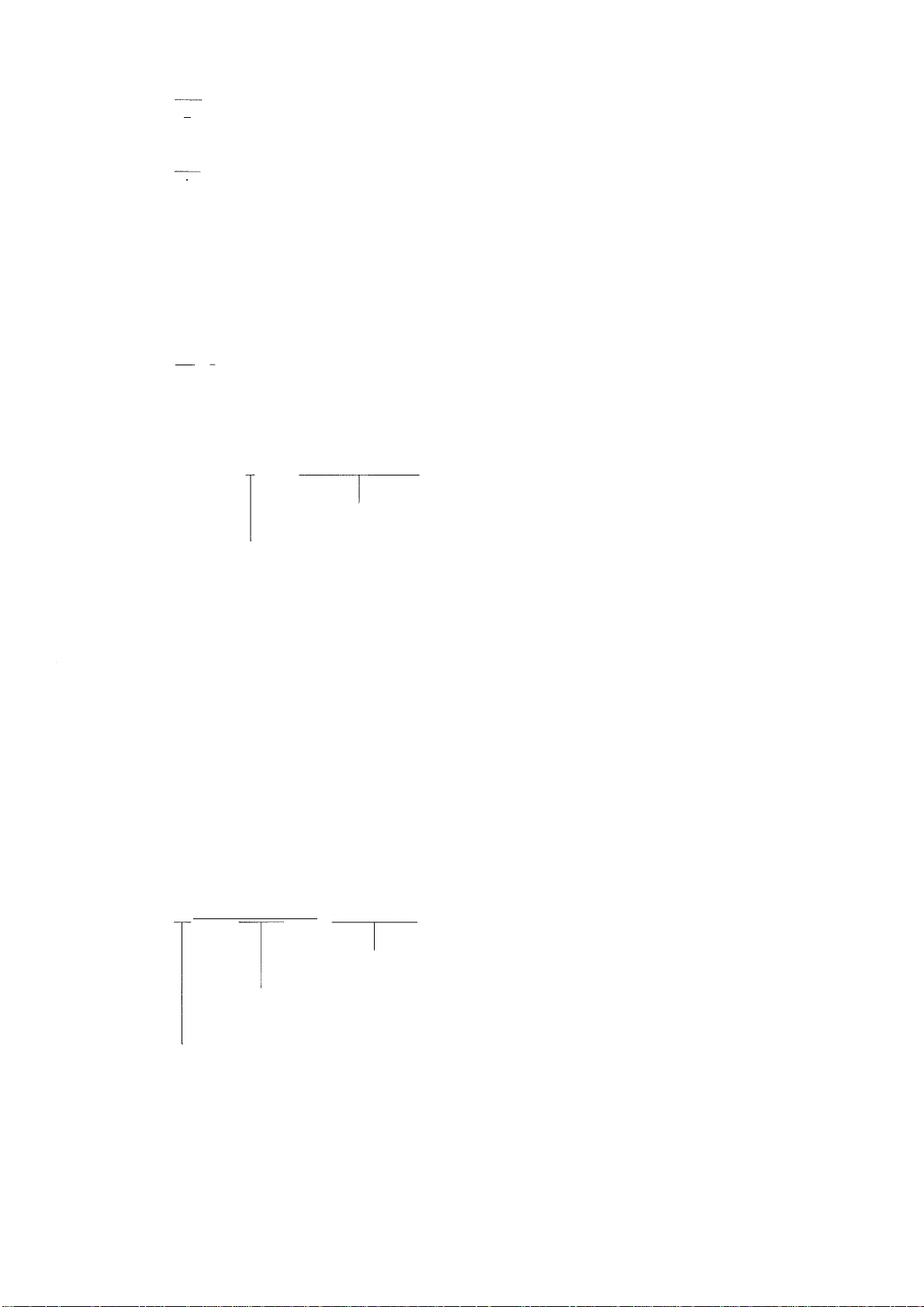
a
b
c
A / (B / C)
a
bc
(ab)N C
a
+ i
b
ba +1
5v^3
1
vV
Die Rechenanweisung wird nun gebildet durch das Gleichheitszeichen, auf dessen Besonderheit
bereits hingewiesen wurde.
Die Darstellung einer Rechenanweisung erfolgt genauso wie in der Algebra.
z.B. X = A + B + C
-----------------------
-----------------------------------------------Eine Variable, der das
Diese Darstellungsform muß immer eingehalten werden und darf nicht verändert werden. So ist
z. B. vorgeschrieben, daß links vom Gleichheitszeichen immer eine Variable stehen muß, während
rechts entweder eine Variable oder eine mathematische Formel stehen muß. Es darf links kein
mathematischer Ausdruck stehen.
A / (B * C)
(A * B) î N * C
B t (A + 1)
B f A + 1
A f 0.6 [| = 0.6]
A t (—0.5) [|=0.5]
mathem. Formel
Rechenergebnis zugewiesen wird.
1.1.8 Der Aufbau eines Programms in BASIC
Um ein Programm in BASIC zu erstellen, benutzt man die nachfolgend beschriebenen BASICAnweisungen.
Auch hierbei muß man sich an eine bestimmte Ordnung halten, ähnlich wie bei den Rechen
anweisungen.
Eine BASIC-Programmzeile besteht immer aus einer bestimmten Zeilennummer, die man auch
als Adresse bezeichnen könnte, der BASIC-Anweisung selbst, sowie (sofern vorhanden) der
Variablenliste. Die Programmzeile kann maximal 80 Zeichen lang werden.
Eine einfache Anweisung, nämlich die Werte von 5 Variablen auszudrucken, sieht recht übersicht
lich aus.
10 PRINT A, B, C, D, E
-------------------
---------------------------------------------
--------------------------------------------------------------Zeilennummer
Die Zeilennummer ist sozusagen der Fingerabdruck der BASIC-Anweisung. Sie gibt es nur einmal
und ist daher unverwechselbar. Anhand dieser Zeilennummer finden wir die Anweisung immer
wieder.
Sie ist immer ganzzahlig, in aufsteigender Reihenfolge und kann von
0 bis 63999
definiert sein.
Variablenliste
BASIC-Anweisung
(Befehlswort)
15
Page 18
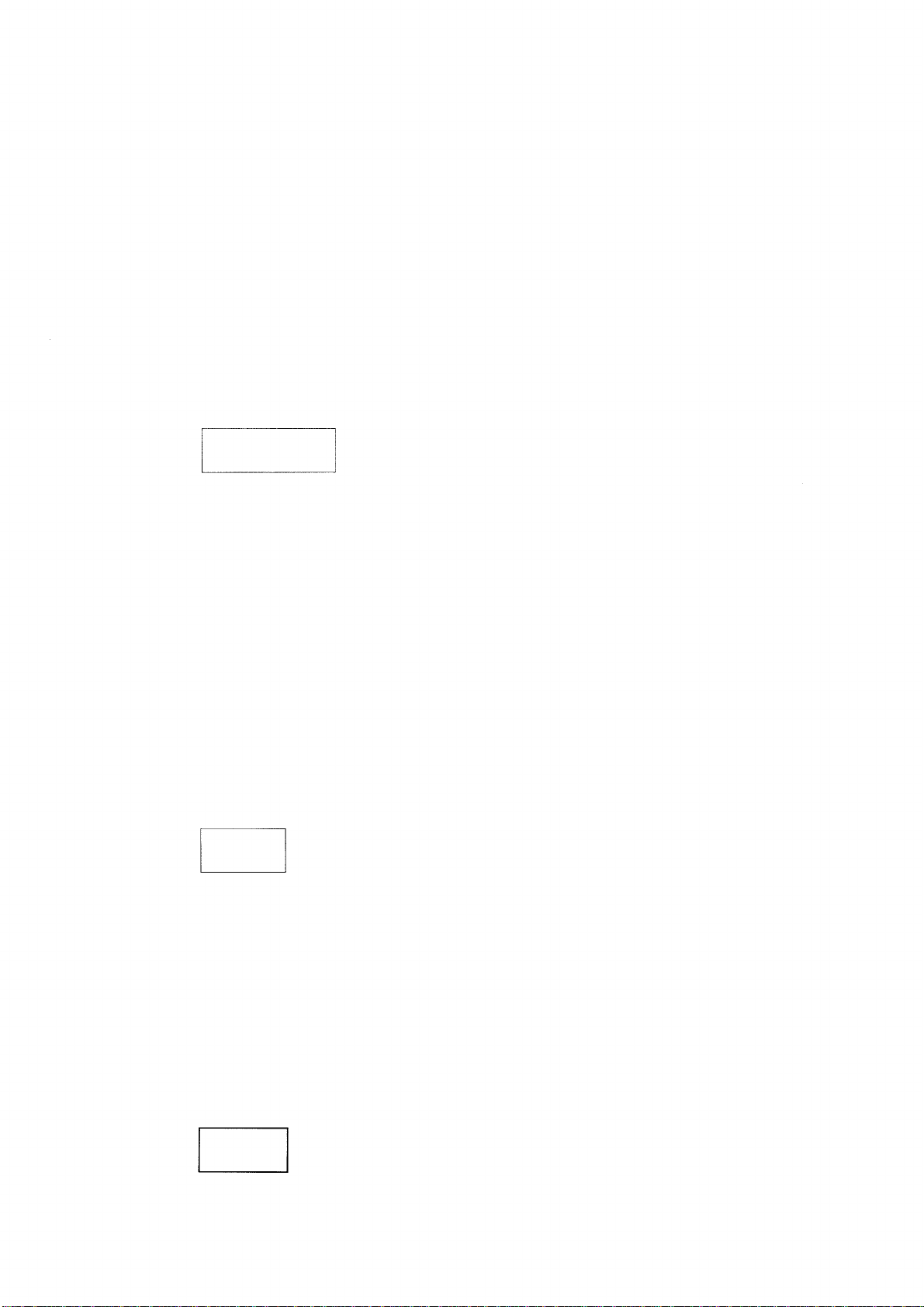
Die Anweisung selbst sagt aus, was mit der nachfolgenden Variablenliste, die im Übrigen aus
verschiedenen Informationen bestehen kann, passieren soll.
Möglich sind Texte, Konstanten und Variablen.
Das normale Standard-BASIC sieht vor, daß mit diesen Informationen eine Programmzeile be
endet ist. Eine neue Zeile sollte beginnen.
Bei Ihrem Computer ist es jedoch möglich, mehrere BASIC-Anweisungen getrennt durch einen
Doppelpunkt, in eine Zeile zu schreiben. Maximal kann diese Zeile 80 Zeichen aufnehmen.
Bedingt durch die Begrenzung von 40 Zeichen pro Zeile auf dem Bildschirm, bildet sich der
Rechner automatisch eine Doppelzeile.
Beispiel: 10 PRINT A, B, C, D, E: PRINT Y: GOTO 100
1.2.1 Der REM Befehl
Wichtig ohne etwas zu tun ...
Sobald die Probleme, die Sie mit Ihrem Rechner lösen, komplexer werden, wird Ihr Programm
natürlich länger und damit meist unübersichtlicher. Ein gutes Hilfsmittel, um ein Programm gut
überschaubar zu machen, ist der REMARK-Befehl:
n REM TEXT
Die REM-Anweisung ist eine Mitteilung an den Rechner, die nachfolgenden Ausführungen,
Anweisungen oder Bemerkungen beim Rechenvorgang nicht zu berücksichtigen. Sie hat auf den
Programmablauf keinen Einfluß, sondern wird nur beim Auflisten des Programms ausgegeben,
um dem Programmierer die Arbeit zu erleichtern. Zu beachten ist, daß die REM-Anweisung
Speicherplatz benötigt und der nachfolgende Text nicht länger ist, als es die Programmzeile erlaubt
(insgesamt 80 Zeichen).
Wird REM gemeinsam mit anderen Befehlen in einer Zeile verwendet, so muß REM der letzte
Befehl der Zeile sein, da Befehle nach REM nicht ausgeführt werden.
n = Zeilennummer des Befehls
Text - beliebige Informationen
Bei- 100 REM Beginn des Unterprogramms
spiele: 5810 REM Schachprogramm
12 PRINT A: REM ERGEBNIS
1.2.2 Der END Befehl
Jetzt hört’s auf...
Auch wenn das Programmieren noch soviel Spaß macht, einmal ist jedes Programm zu Ende.
Um das logische Ende des Programms zu kennzeichnen, benutzen wir den Befehl:
n END n = Zeilennummer des Befehls
Der Befehl END kann mehrmals in einem Programm benutzt werden, was vor allem bei Programm
verzweigungen sinnvoll sein kann. Dieser Befehl bewirkt das Anhalten des Programms, ohne
irgendwelche Daten zu verändern. Das Programm kann nach dem END durch den Befehl CONT
(siehe 1.3.2) fortgesetzt werden.
Beispiel: 10 END
1.2.3 Der STOP Befehl
Das Programm kann verschnaufen ...
Es soll ja Vorkommen, daß ein Programm nicht gleich so arbeitet wie sein Schöpfer gern hätte.
Dann sind oft einige Testläufe nötig. Bei diesen Tests kann man den Befehl
n STOP
n = Zeilennummer des Befehls
16
Page 19
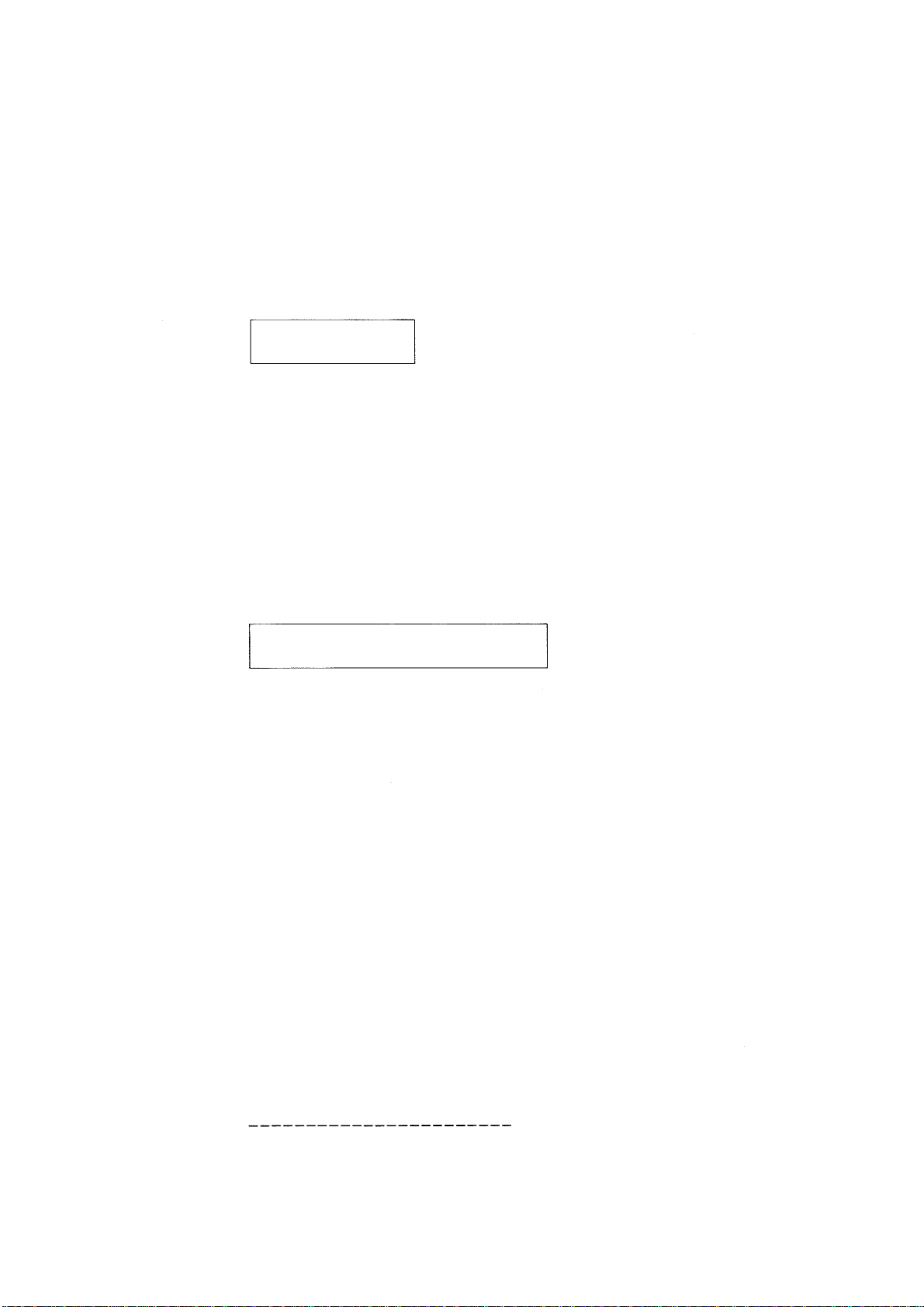
benutzen um das Programm anzuhalten und den Wert einiger Variablen zu erfragen. Der STOP-
Befehl unterscheidet sich vom END-Befehl dadurch, daß beim Beenden des Programms die
Meldung: BREAK IN ... (Zeilennummer) ausgegeben wird.
Auch nach dieser Unterbrechung kann das Programm mit CONT (siehe 1.3.2) fortgesetzt werden.
Beispiel: 120 STOP
1.2.4 Der LET Befehl
Man kann ihn auch vergessen ...
Bei Ihrem Rechner ist es genauso wie bei uns Menschen, seine Sprache ist älter als er. Bei älteren
Rechnertypen war der Befehl
n LET Zuweisung
nötig um Werte einer Variablen zuzuordnen. Unseren Rechner stört diese Anweisung nicht, sie ist
aber auch nicht nötig und man sollte sie möglichst fortlassen, da sie 1 Byte unseres Speicher
platzes belegt.
n = Zeilennummer des Befehls
Beispiel: 130LETA = 10*B
besser 130A = 10*B
1.2.5 Der PRINT Befehl
So unterhalte ich mich ...
Soll der Rechner seinen Benutzer während des Programmlaufs ansprechen, ihm Daten angeben
oder einen guten Morgen wünschen, benutzen wir den Befehl:
n { PRINT / ? } {Text / Variablenliste }
n = Zeilennummer des Befehls
Der PRINT-Befehl bewirkt das Ausgehen einer nachfolgenenden Text- und/oder Variablenliste.
Das Fragezeichen ist gleichbedeutend mit dem Wort PRINT und wird vom Rechner beim Listen des
Programms durch PRINT ersetzt. Auszugebender Text muß in Anführungszeichen gesetzt werden.
Bei- 110 PRINT ’’LISTE-NR.”, A ; D $
spiele: 20 ? ’’PROGRAMMANFANG”, C $
Nach einem PRINT-Befehl erfolgt ein Wagenrücklauf und ein Zeilenvorschub, so daß jeder PRINTBefehl am Anfang einer neuen Zeile ausgeführt wird. Mit dem bloßen PRINT-Befehl erzeugt man
also eine Leerzeile auf dem Ausgabegerät.
Der Computer läßt verschiedene Formatierungsarten zu; dabei ist zu beachten, daß ein String
genausoviel an Platz belegt, wie er Zeichen hat. Eine Zahl belegt soviele Plätze, wie sie Ziffern
hat, plus eine Spalte für das Vorzeichen.
Das Komma:
Jede zehnte Druckposition ist intern im Computer vortabuliert. Das Komma in einem PRINT-
Befehl bewirkt, daß das folgende Zeichen in die nächste vortabulierte Position geschrieben wird.
Zeilenvorschub und Wagenrücklauf werden unterdrückt.
Beispiel: ? , ”XY”, ”XY”
XY
Î
1
Î t
11
XY
21
17
Page 20

Beispiel: A = 3 : : B = - 4 : ?
3
Î Î
- 4
2 11
Das Semikolon:
Das Semikolon in einem PRINT-Befehl bewirkt, daß Zeilenvorschub und Wagenrücklauf unter
drückt werden (Ausgabe ohne Zwischenraum).
Beispiel: ? ”COM”; : ? ’’PUTER”
COMPUJIR
Beispiel: A = -3:B = -4:?A;B; ’’TEXT”; A
= 3_:4_IEXJ-3
Der SPC-Befehl:
Der SPC(n) bewirkt den Ausdruck von n Leerzeilen, n kann zwischen 0 und 255 liegen,
n kann auch eine Variable oder ein berechneter Ausdruck sein.
Nachkommastellen bleiben unbeachtet.
Beispiel: ? SPC(3) ’’DREI” SPC(1) ’’FUENF”
DREI FUENF
Beispiel: ? SPC(^) ’’DREI”
DREI
Siehe Anmerkung zum TAB-Befehl.
Der TAB-Befehl:
Er hat das Format TAB(n), wobei n eine Zahl oder ein berechneter Ausdruck zwischen 0 und
255 sein kann. Stellt n keine ganze Zahl dar, so werden die Nachkommastellen nicht beachtet.
Der Befehl TAB(n) bewirkt den Ausdruck des folgenden Zeichens n Freistellen vom linken
Bildschirmrand (oder Papierrand) entfernt.
Beispiel: ? TAB (4) 4; TAB (8) ”X”
4 X
Ist die durch den TAB-Befehl spezifizierte Druckposition bereits belegt, so wird in die nächste freie
Position geschrieben.
Beispiel: ? TAB(4) ”X” TAB(3) ”Y”
XY
Anmerkung: Bei der Verwendung von TAB und SPC dürfen die Daten nur durch Semikolon ge
trennt werden, da das Komma eine höhere Priorität besitzt als die Befehle TAB und SPC.
18
Page 21
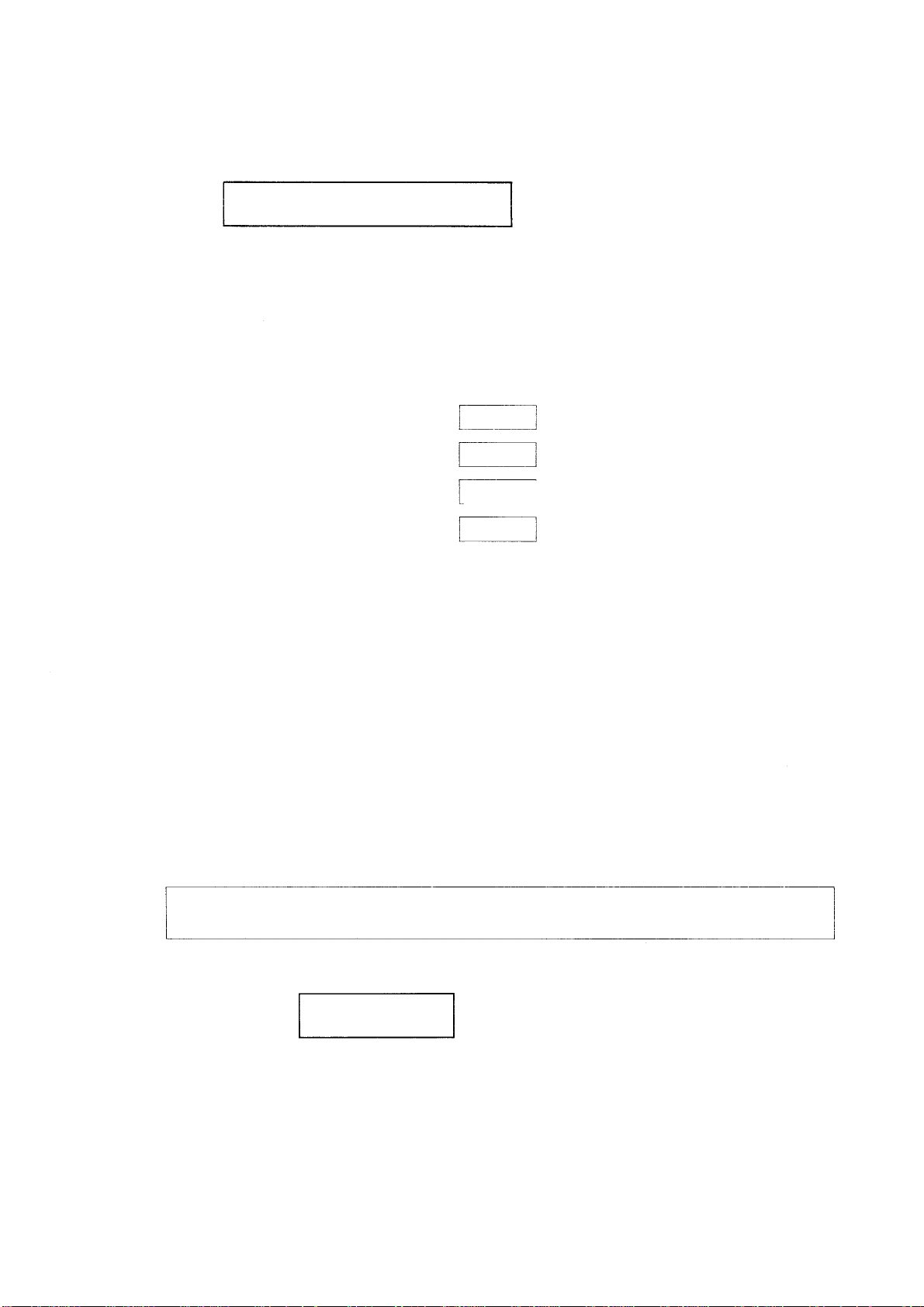
1.2.6. Der INPUT-Befehl
Und so verstehe ich Sie ...
Um die Dialogfähigkeit des cbm zu verwirklichen, reicht der PRINT-Befehl nicht, wir benötigen
auch ein offenes Ohr, den INPUT-Befehl:
n INPUT [’TEXT” ;] Variablenliste
(n = Zeilennummer des Befehls)
Der INPUT-Befehl bewirkt einen Stop des Programms und ermöglicht eine Dateneingabe für die
Variablen, die hinter dem INPUT aufgeführt werden.
Stehen mehrere Variablen hinter dem INPUT, so müssen entweder alle Daten durch Komma
getrennt werden und abschließend muß die RETURN-Taste gedrückt werden oder nach jeder
einzelnen Eingabe muß die RETURN-Taste betätigt werden.
Beispiel: 20 INPUT A, C $, D
Eingabe : 2, KARO, 3
RETURN
oder : 2
KARO
3 RETURN
Das Programm zeigt die Bereitschaft zur Eingabe durch ein Fragezeichen oder durch Drucken des
Textes, den wir hinter dem INPUT in Anführungszeichen vermerkt haben, plus Fragezeichen an.
RETURN
RETURN
__________
i
I
Beispiel: 30 INPUT A
Ausdruck: ?
40 INPUT ’’GEBEN SIE A EIN”; A
Ausdruck: GEBEN SIE A EIN?
Als Variable können selbstverständlich auch Ganzzahl- und Textvariablen verwendet werden.
Beispiel: 10 INPUT ’’TEXTEINGABE”; B $
Geben Sie mehr als 80 Zeichen bei einem INPUT-Befehl ein, so ignoriert der Computer die ersten
80 Zeichen und speichert nur die nachfolgenden Zeichen ab.
Weiter darf während der Eingabe für eine numerische Variable kein Komma oder Doppelpunkt
benutzt werden, da der Computer diese Zeichen als Eingabeende interpretiert.
Soll ein String eingegeben werden, der Komma oder Doppelpunkt enthält, so muß dieser String
in Anführungszeichen geschrieben werden.
1.2.7 Der GET Befehl
Für Leute die nicht mehr warten wollen ...
Der n GET Variable
Befehl ist ebenfalls ein Eingabebefehl.
Im Gegensatz zum INPUT hält das Programm bei einem GET nicht an und es kann nur eine Variable
eingegeben werden. Es können Variablen oder Textvariablen eingegeben werden. Es wird nur ein
Zeichen bzw. eine Ziffer übernommen.
n = Zeilennummer des Befehls
19
Page 22
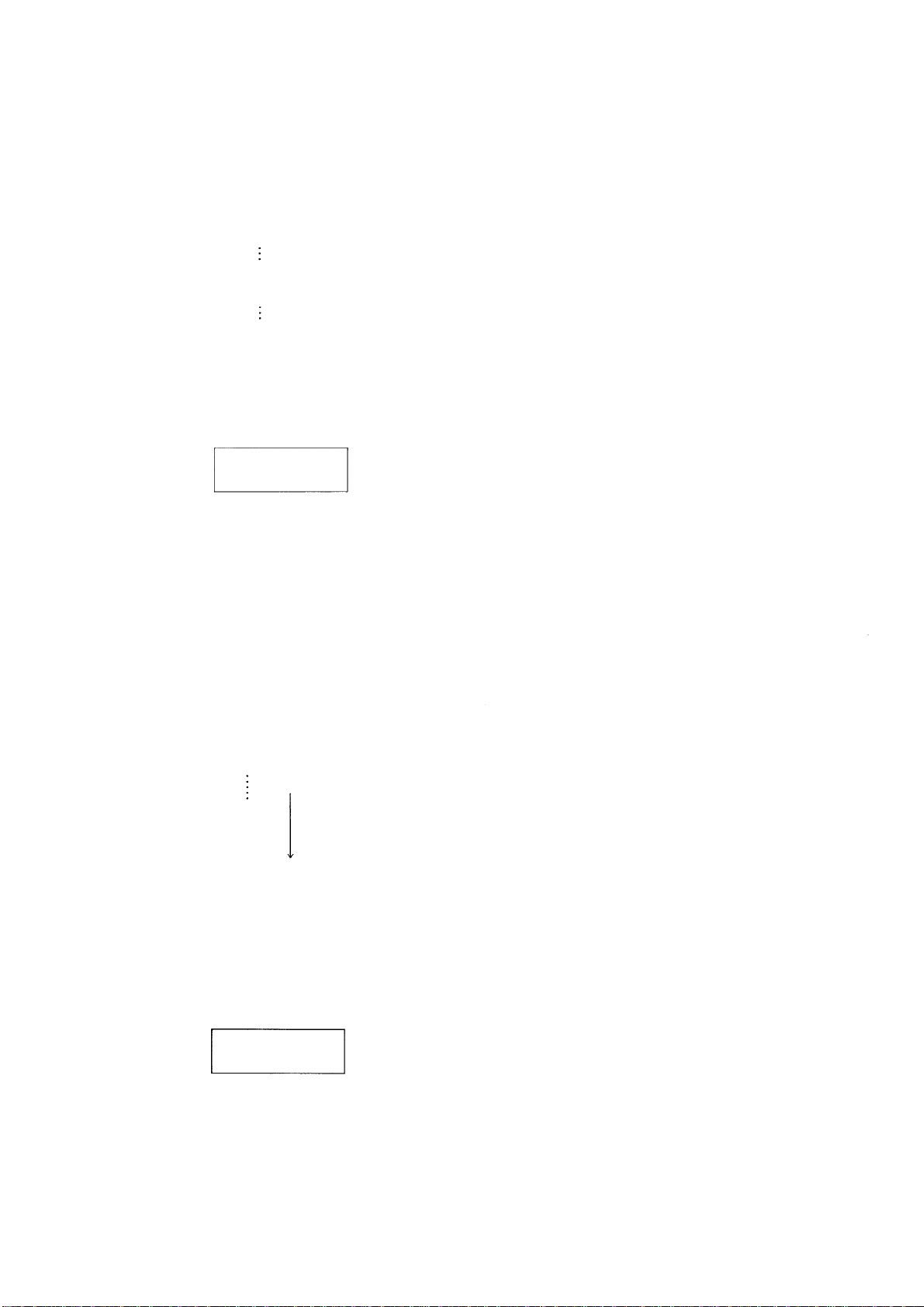
Beispiel: 10 GET C
30 GET B $
Da der Rechner in der Lage ist, bis zu 9 Tastenbetätigungen zu speichern, wird dasjenige Zeichen
übernommen, das während des Programmlaufes vor Erreichen des GET-Befehls gedrückt wurde.
Soll der Rechner auf Eingabe eines Zeichens warten, so kann das mit einer Warteschleife erreicht
werden. (Siehe 1.2.15).
Beispiel:
20 GET A $
30 IF A $ = “ “ THEN 20
1.2.8 Der DATA Befehl
Mein Grundwissen ...
Nun lernen wir einen Befehl kennen, mit dem man Daten speichern kann, auf die der Rechner im
Bedarfsfälle zurückgreift. Es ist der Befehl:
n DATA Liste n = Zeilennummer des Befehls
Die Daten werden hierbei an beliebiger Stelle im Programm hinter DATA aufgereiht und später der
Reihe nach von links nach rechts mittels READ gelesen, (siehe 1.2.9) Die Daten werden unter
einander durch Kommas getrennt und dürfen daher weder Komma noch Doppelpunkt enthalten.
Sollen diese beiden Zeichen oder führende Leerzeichen mittels DATA in eine Textvariable gebracht
werden, so muß dieser Text in der DATA-Anweisung in Anführungszeichen stehen, was ansonsten
bei Texten hinter DATA nicht der Fall ist.
Beispiel: 100 DATA 15,3.7, 9,12
150 DATA "DER:”, COMPUTER
Die Daten hinter einem DATA können von verschiedenen READ-Anweisungen gelesen werden,
da sich ein Pointer (Zeiger) „merkt“, ab welchem Wert mit dem READ Befehl weiter gelesen wird.
Beispiel: 10 READ A, B, C
Pointer (READ noch nicht durchgelaufen)
Pointer (READ 1 x durchgelaufen)
| Pointer (READ 2 x durchlaufen)
100 DATA 4, 5, 7, 3.1,7, 9 I
1.2.9 Falls ich es vergessen habe
..........
DER RESTORE BEFEHL
Beim DATA-Befehl haben wir erfahren, daß der Computer die Daten hinter dem DATA der Reihe
nach liest. Sollen, nachdem bereits Daten gelesen wurden, nicht die nachfolgenden, sondern die
ersten Daten gelesen werden, so benutzen wir den
n RESTORE
n = Zeilennummer des Befehls
Befehl.
Mit anderen Worten, dieser Befehl setzt den Pointer vor das 1. Zeichen der Daten.
Beispiel: 30 RESTORE
20
Page 23
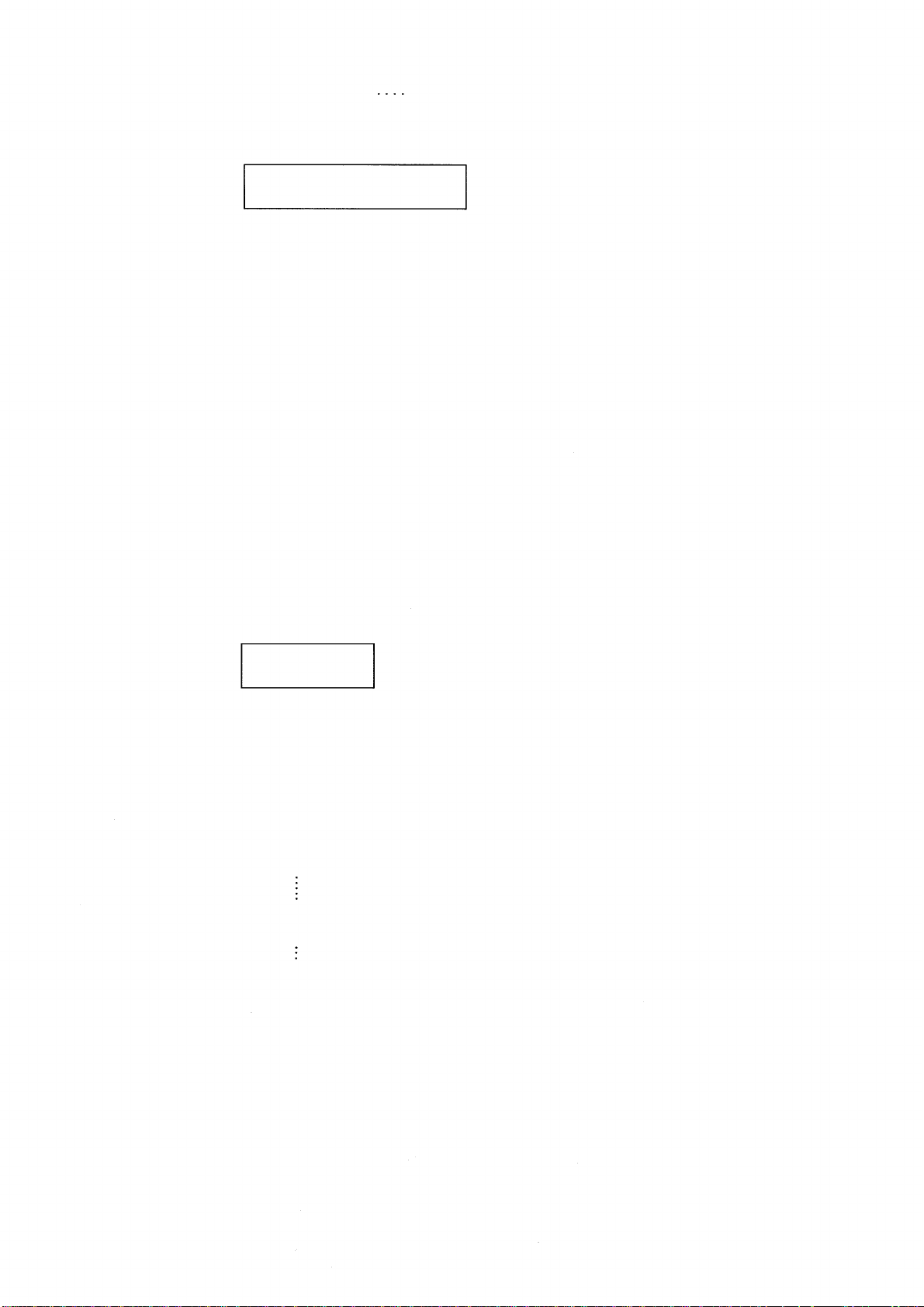
1.2.10
------
und so komme ich daran
DER READ BEFEHL
Der
n READ Variablenliste
Befehl bezieht sich auf die DATA-An Weisung und kommt ohne diese nicht aus. Der READ-Befehl
liest die Daten in der vorgegebenen Reihenfolge und ordnet sie den Variablen, die hinter ihm auf
geführt sind, in der gleichen Reihenfolge zu.
n = Zeilennummer des Befehls
Beispiel: 10 READ A, B
20 DATA 102, 3, 5, 6
Wird der READ-Befehl zum ersten Mal durchlaufen so ist A = 102, B = 3;
beim zweiten Durchlauf von READ ist A = 5, B = 6.
Natürlich können auch Textvariablen gelesen werden. Falls der Pointer hinter dem letzten Zeichen
der DATA-Anweisung steht und ein READ erfolgt, erscheint die Fehlermeldung:
?OUT OF DATA ERROR IN . ..
(Sie wissen natürlich schon, daß man diese Fehlermeldung mit RESTORE (siehe 1.2.9) umgehen
kann).
1.2.11 Ich kann auch springen
.........
DER GOTO BEFEHL
Dieser Sprungbefehl wird als unbedingter Sprungbefehl bezeichnet, da er immer ausgeführt wird,
sobald das Programm auf einen derartigen Befehl stößt, oder sobald ein GOTO direkt eingegeben
wird.
n GOTO m
n = Zeilennummer in der der Befehl steht
m = Zeilennummer in die gesprungen wird
Dieses GOTO bewirkt, daß nicht der Befehl mit der nach n folgenden Zeilennummer bearbeitet wird,
sondern daß das Programm seine Arbeit in der Zeilennummer m fortsetzt.
Beispiel: 10 PRINT’’ANFANG”
20 GOT0150
30 PRINT ’’ENDE”
150 PRINT ’’SPRUNG”
Eingabe von RUN (siehe 1.3.1) bewirkt folgende Ausgabe:
ANFANG
SPRUNG
Die Zeilennummer m muß vorhanden sein, sonst erfolgt eine Fehlermeldung. Variablen oder andere
Zeichen als ganzzahlige positive Zahlen dürfen nicht benutzt werden.
Stehen in einer Programmzeile weitere Befehle hinter einer GOTO-Anweisung, so werden sie
nicht ausgeführt.
21
Page 24
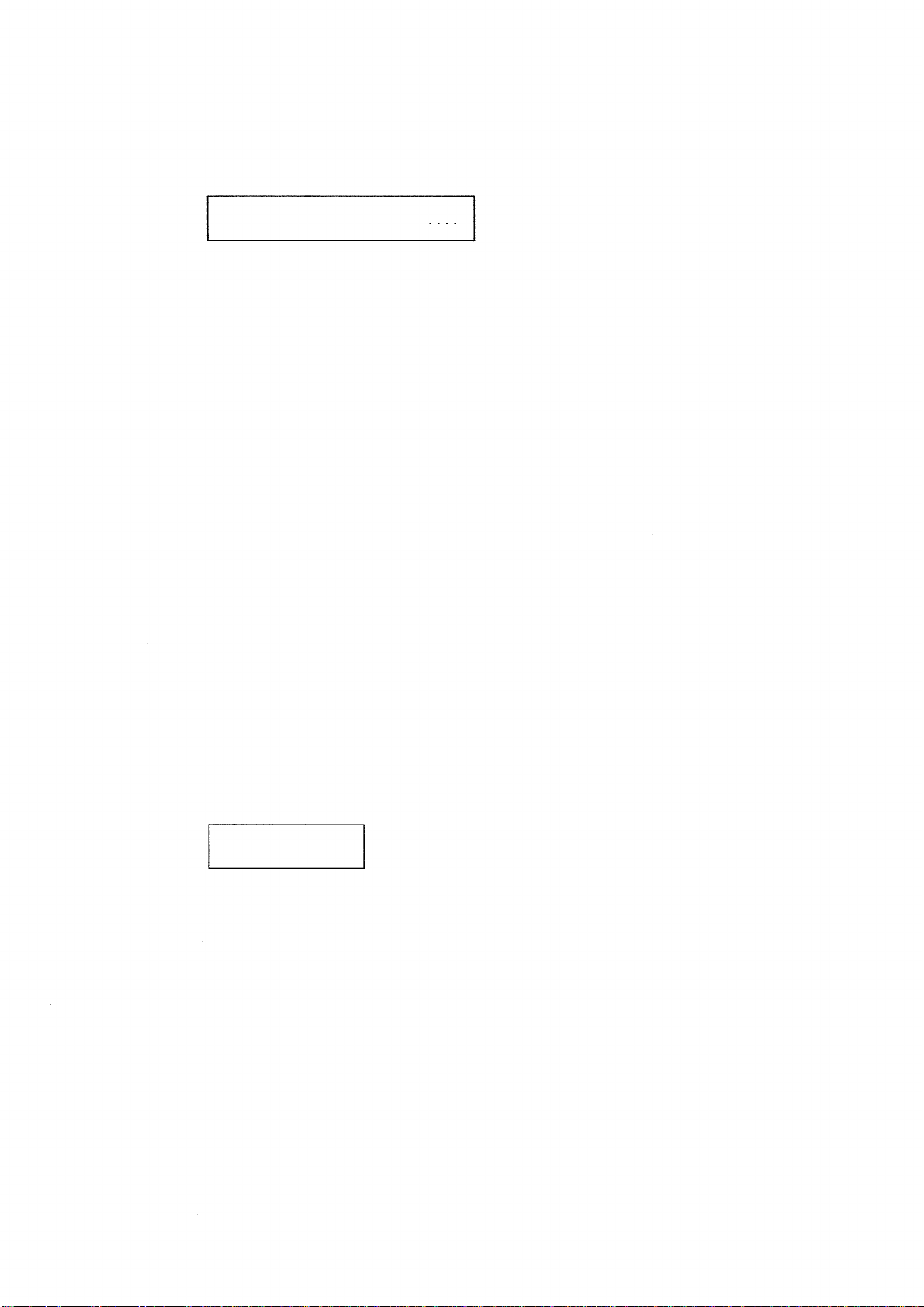
1.2.12 Gewußt wohin
........
DER ON ... GOTO BEFEHL
Hatte das Programm beim GOTO nur eine Möglichkeit zu springen, so kann beim ON ... GOTO
Befehl der Sprung vom Wert einer Variablen abhängig gemacht werden.
n ON v GOTO m1, m2,
n = Zeilennummer des Befehls
v = Formel, die den Sprung bestimmt
m1, m2 = Zeilennummern zu denen gesprungen werden soll
Beispiel: 10 ON F GOTO 50,100, 300
Ist F < 1 erfolgt kein Sprung
Ist F = 1 erfolgt Sprung nach 50
Ist F = 2 erfolgt Sprung nach 100
Ist F = 3 erfolgt Sprung nach 300
Ist F > 3 erfolgt kein Sprung
Anstelle der Variablen kann auch ein mathematischer Ausdruck stehen. Das Ergebnis des er-
rechneten Ausdrucks wird vom Rechner zu einer ganzzahligen Größe umgewandelt, d. h. Nach
kommastellen werden ignoriert.
Beispiel: 50 ON (A+B) - (C+D) GOTO 1000, 300, 700
Die Anzahl der Sprungadressen ist durch die maximale Zahl von 80 Zeichen pro Zeile begrenzt.
Als Alternative bei sehr umfangreichen ON ... GOTO-Befehlen bieten sich daher mehrere ON ...
GOTO’s an, bei denen die Variable im zweiten Befehl dem Programm entsprechend berechnet wird.
Beispiel: 10 ON K GOTO 100, 200, 300, 400
30 ON K-4 GOTO 500, 600, 700, 800
1.2.13 Jetzt geht es in die Unterwelt
.........
DER GOSUB BEFEHL
Der folgende Befehl sollte für die Programmteile benutzt werden, die wiederholt, auch von ver
schiedenen Stellen des Programms aus, durchlaufen werden müssen. Diese Programmteile nennt
man Unterprogramm oder auch Subroutine. Sie können an beliebiger Stelle im Programm stehen
und werden mit dem Befehl
n GOSUB m
aufgerufen.
Nach Bearbeitung des Unterprogramms kehrt der Rechner zu dem Befehl zurück, der hinter dem
GOSUB folgt, (siehe RETURN 1.2.16).
n = Zeilennummer des Befehls
m = 1. Zeilennummer des Unterprogramms
Beispiel: 10 GOSUB 100
20 PRINT ’’HAUPTPROGRAMM”
50 END: REM ENDE DES HAUPTPROGRAMMS
100 PRINT ’’UNTERPROGRAMM”
110 RETURN: REM ENDE DES UNTERPROGRAMMS
Die Eingabe von RUN bewirkt die
Ausgabe: UNTERPROGRAMM
HAUPTPROGRAMM
Ein Unterprogramm kann wiederum ein anderes Unterprogramm aufrufen, und dieses dann das
nächste
..........
Insgesamt können bis zu 26 Unterprogramme ineinander verschachtelt werden.
22
Page 25
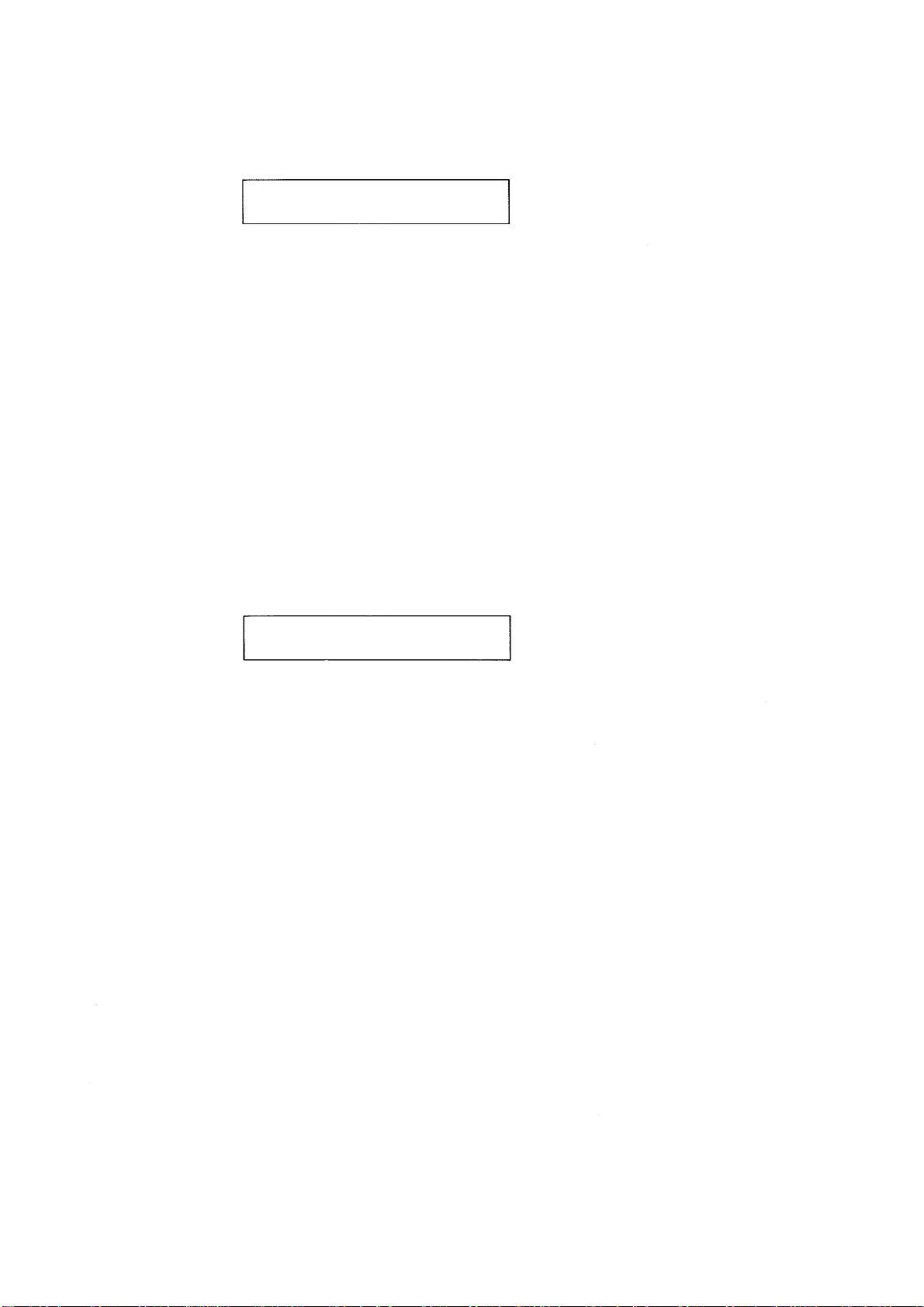
1.2.14 Verteiler für die Unterwelt
........
DER ON ... GOSUB BEFEHL
Der Befehl
n ON v GOSUB m1,m2...
n = Zeilennummer des Befehls
v = Formel, die den Sprung bestimmt
m1,m2... = Zeilennummern, zu denen gesprungen werden soll
entspricht dem ON . . . GOTO (siehe 1.2.12), nit dem Unterschied, daß hier keine einfachen
Sprünge stattfinden, sondern zu Unterprogrammen verzweigt wird (siehe 1.2.13).
Beispiel: 10 ON Z GOSUB 1000,1500, 2000
20 STOP
Der Sprung erfolgt abhängig von der Variablen Z in eines der 3 Unterprogramme, die natürlich mit
RETURN abgeschlossen werden müssen. Nach Abarbeitung des betreffenden Unterprogramms
wird die Zeile 20 ausgeführt.
1.2.15 Nun fällt die Entscheidung ...
DER IF... THEN BEFEHL
Um abhängig von einer logischen oder mathematischen Aufgabe eine Entscheidung zu fällen, gibt
es die Befehlsgruppe IF ... THEN.
n IF Vergleich THEN {m, Befehl}
n = Zeilennummer des Befehls
Vergleich = Vergleich einer oder mehrerer Variablen oder Formeln
m = Zeilennummer deren Befehl ausgeführt werden soll
Befehl = Befehl der ausgeführt werden soll
Beim Vergleich können Variablen (Auch Textvariablen), Konstanten oder Formeln untereinander
verglichen werden.
Beispiel: IF A = 1 ... / IF A$ = ”JA” ... / IF CC = 3 ...
IF 3> B*C + 3.../IFA <> C . .. /
IF D% > E % . . .
Ist die Vergleichsbedingung erfüllt, so wird der Befehl hinter dem THEN ausgeführt oder nach der
dort stehenden Zeilennummer verzweigt, ansonsten fährt das Programm mit der nächsten Zeilen
nummer fort.
Beispiel: 10 IF A + B < = 150 THEN 30
20 PRINT ”A + B > 150”: GOTO 100
30 PRINT ”A + B < = 150”: GOTO 100
eleganter: 10 IF A + B < = 150 THEN PRINT ”A + B < = 150”: GOTO 100
20 PRINT ”A + B > 150”: GOTO 100
Wie in diesem Beispiel das PRINT, so können auch andere Befehle hinter dem THEN stehen.
Als Besonderheit läßt das COMMODORE-BASIC mehrere IF-Abfragen in einer Zeile zu.
Beispiel: 10 IF A = C THEN IF A = 5 * B THEN ....
23
Page 26
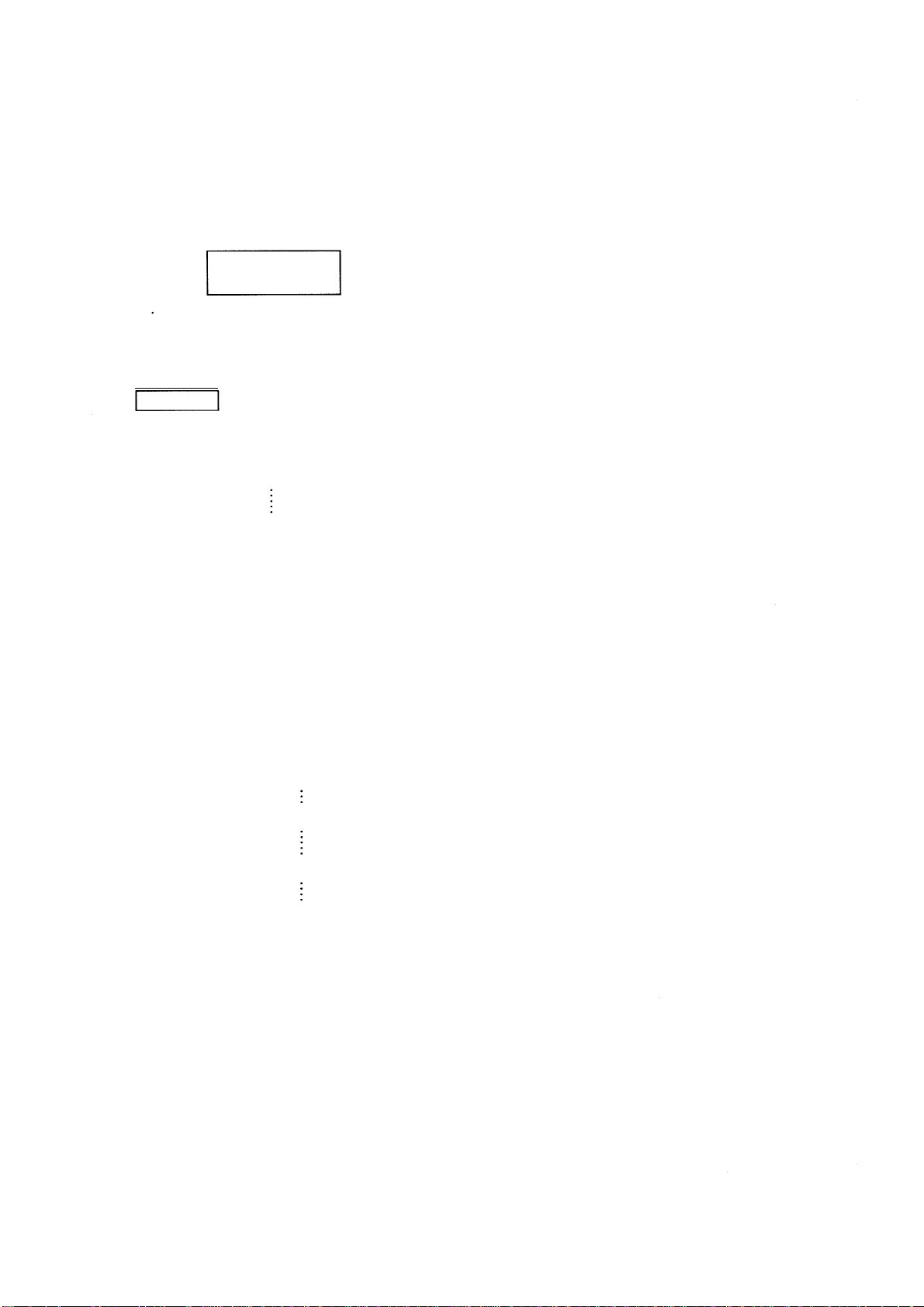
Ist hierbei bereits die erste Abfrage nicht erfüllt, wird sofort die nächst höhere Programmzeile aus
geführt.
1.2.16 Zurück geht’s immer leichter
DER RETURN BEFEHL
Wir haben mit GOSUB, ON . . . GOSUB die Möglichkeit kennengelernt ein Unterprogramm auf
zurufen. Um nun wieder ins Hauptprogramm zurückzukehren, muß der letzte Befehl jedes Unter
programms:
n RETURN
sein.
Diese Anweisung bewirkt, daß der dem Aufrufbefehl (GOSUB oder ON ... GOSUB) folgende Be
fehl als nächster ausgeführt wird (siehe 1.2.13,1.2.14).
Der Befehl RETURN muß Buchstabe für Buchstabe eingegeben werden und darf nicht mit derTaste
RETURN verwechselt werden.
Beispiel: 40 A = 5 : B = 10
50 GOSUB 1000
60 PRINT ’’ERGEBNIS” U
1000 REM UNTERPROGRAMM
1010 U = (A+B) * 3
1020 RETURN
READY
RUN
ERGEBNIS 45
Solange die Unterprogrammtechnik für uns noch ungewohnt ist, werden wir vielleicht die Fehler
meldung: 7RETURN WITHOUT GOSUB ERROR erhalten. Sie tritt auf, falls ein RETURN erreicht
wird, ohne daß ein GOSUB durchlaufen wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn in ein Unter
programm mit einer GOTO-Anweisung gesprungen wurde. Auch dann, wenn ein Unterprogramm
ans Ende des Hauptprogramms geschrieben wird und am Ende des Hauptprogramms kein STOP
oder END steht.
------
n = Zeilennummer des Befehls
Beispiel: 10 REM HAUPTPROGRAMM
50 GOSUB 1000
1000 REM UNTERPROGRAMM
1100 RETURN
Bei diesem Beispiel durchläuft das Programm die Subroutine nicht nur nach dem Befehl GOSUB
1000 sondern auch nach Ende des Hauptprogramms. Der Befehl:
990 END (etwa 10 Leerzeichen) verhindert diesen Fehler.
1.2.17 Immer wieder das Gleiche
DIE BEFEHLSGRUPPE - FOR NEXT STEP
Wollen Sie eine Schleife programmieren, d. h. eine Routine, die mehrmals mit einer veränderten
Variablen durchlaufen wird, so benutzen Sie die Befehlsgruppe:
n, FOR {Laufvariable = Anfangswert} TO {Endwert} STEP {Schrittweite}
n2 NEXT {Laufvariable}
n^ n2 = Zeilennummern der Befehle
.........
24
Page 27
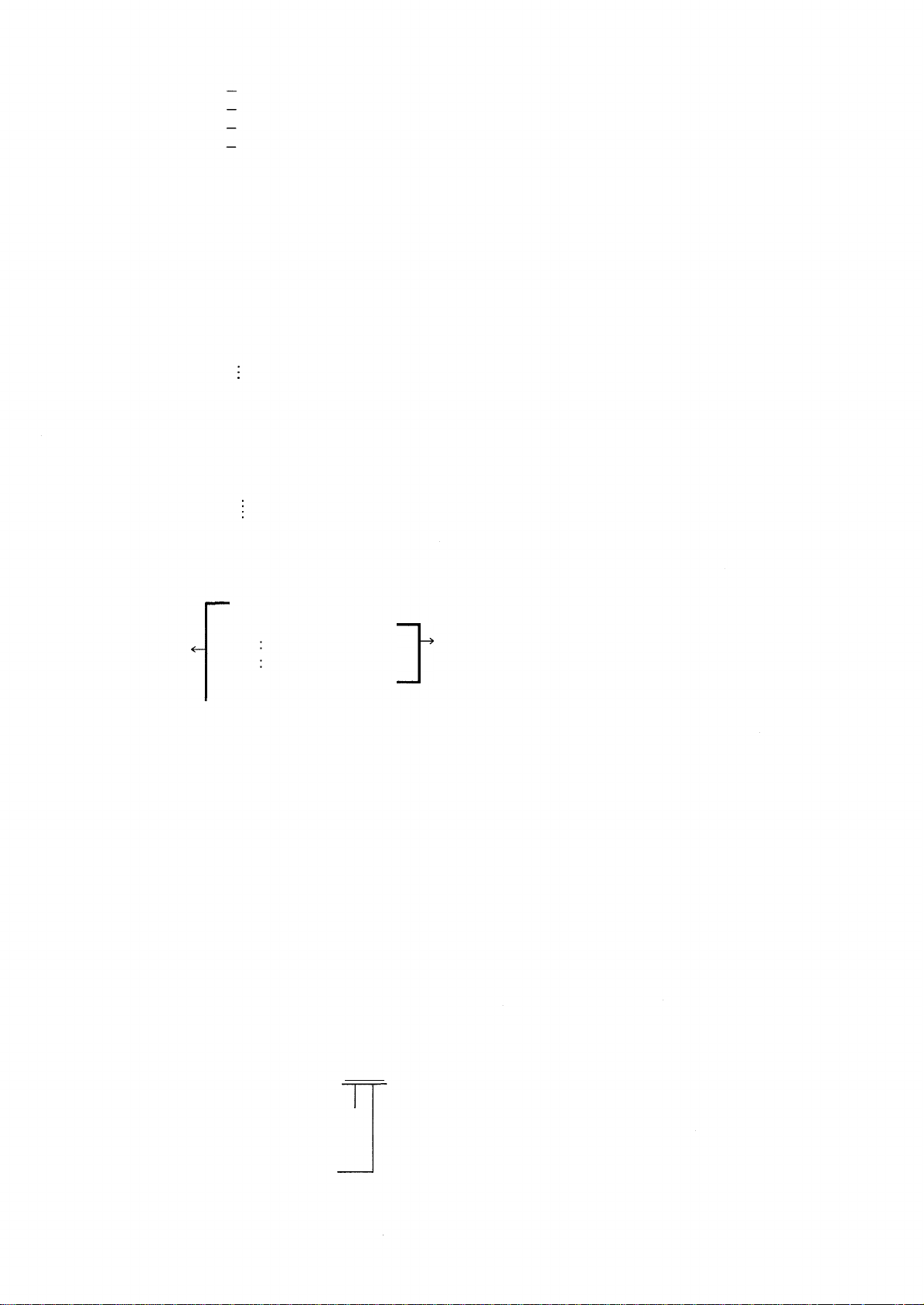
Laufvariable
Anfangswert
Endwert
Schrittweite
Die FOR-NEXT Befehlsfolge bewirkt, daß der Programmteil zwischen n, und n2 solange durch
laufen wird bis die Laufvariable größer als der Endwert ist. Hiernach wird die Anweisung nach n2 be
arbeitet. Bei jedem Durchlauf des NEXT wird die Laufvariable, die zuerst gleich dem Anfangswert
ist, um die Schrittweite erhöht und das Programm bearbeitet die Befehle zwischen n, und n2.
muß eine Fließkommavariable sein (darf keine Integervariable sein)
kann eine Konstante, eine Variable oder ein mathematischer Ausdruck sein
kann eine Konstante, eine Variable oder ein mathematischer Ausdruck sein
kann eine Konstante, eine Variable oder ein mathematischer Ausdruck sein.
Unterbleibt die Angabe für die Schrittweite, so ist diese automatisch +1.
Beispiel: 10 FOR A = 1 TO 10 STEP 0.5
20 PRINT A
30 NEXT A
10 FOR K = 3*B TO C/5 STEP -1
100 NEXT K
Die Laufvariable muß beim Rechner nicht im NEXT-Befehl angegeben werden. Also ist folgende
Befehlsfolge auch korrekt:
100 FOR J = 5 TO 100
200 NEXT
FOR-NEXT Schleifen können auch verschachtelt angeordnet werden.
Beispiel:
äußere
Schleife
Die Verschachtelung muß symmetrisch sein, d. h. die zuletzt eröffnete Schleife muß als erste wieder
geschlossen werden. Die Befehle 100 und 110 können zu einem Befehl:
10 FOR A = 1 TO 100
20 FOR B = 1 TO 10
innere Schleife
100 NEXT B
—110 NEXT A
100 NEXT B,A zusammengefaßt werden.
Bei verschachtelten Schleifen müssen unterschiedliche Laufvariablen benutzt werden.
1.2.18 Wieviel soils denn sein ...
DER DIM-BEFEHL
Im Kapitel 1.1.2 haben Sie drei Formen von Variablen (A, A%, A$) kennengelernt. Es gibt nun eine
Möglichkeit Gruppen einer dieser 3 Variablensorten zu einem „Feld“ (Matrix, Array) zusammenzu
fassen. Ein solches Feld besteht dann aus mehreren Variablen einer Sorte (z. B. Textvariable), die
indizierte Variablen genannt werden. Indizierte Variable, weil zu der normalen Variablen ein Index
tritt. Während eine gewöhnliche Variable nur einen Speicherplatz repräsentiert, kennzeichnet man
ein ganzes Feld von Speicherplätzen mit einer Variablen und unterscheidet die einzelnen Elemente
durch Indizes. Das heißt indizierte Variablen aus einem Feld haben die gleiche Variable und unter
scheiden sich nur durch ihren Index.
Beispiel: Indizierte Variablen aus einem Feld
A$(1), A$(9), A$(12), A$(21)
Variable, die das
Feld kennzeichnet
Index, nach dem die
Elemente eines Feldes
unterschieden werden
__________
25
Page 28
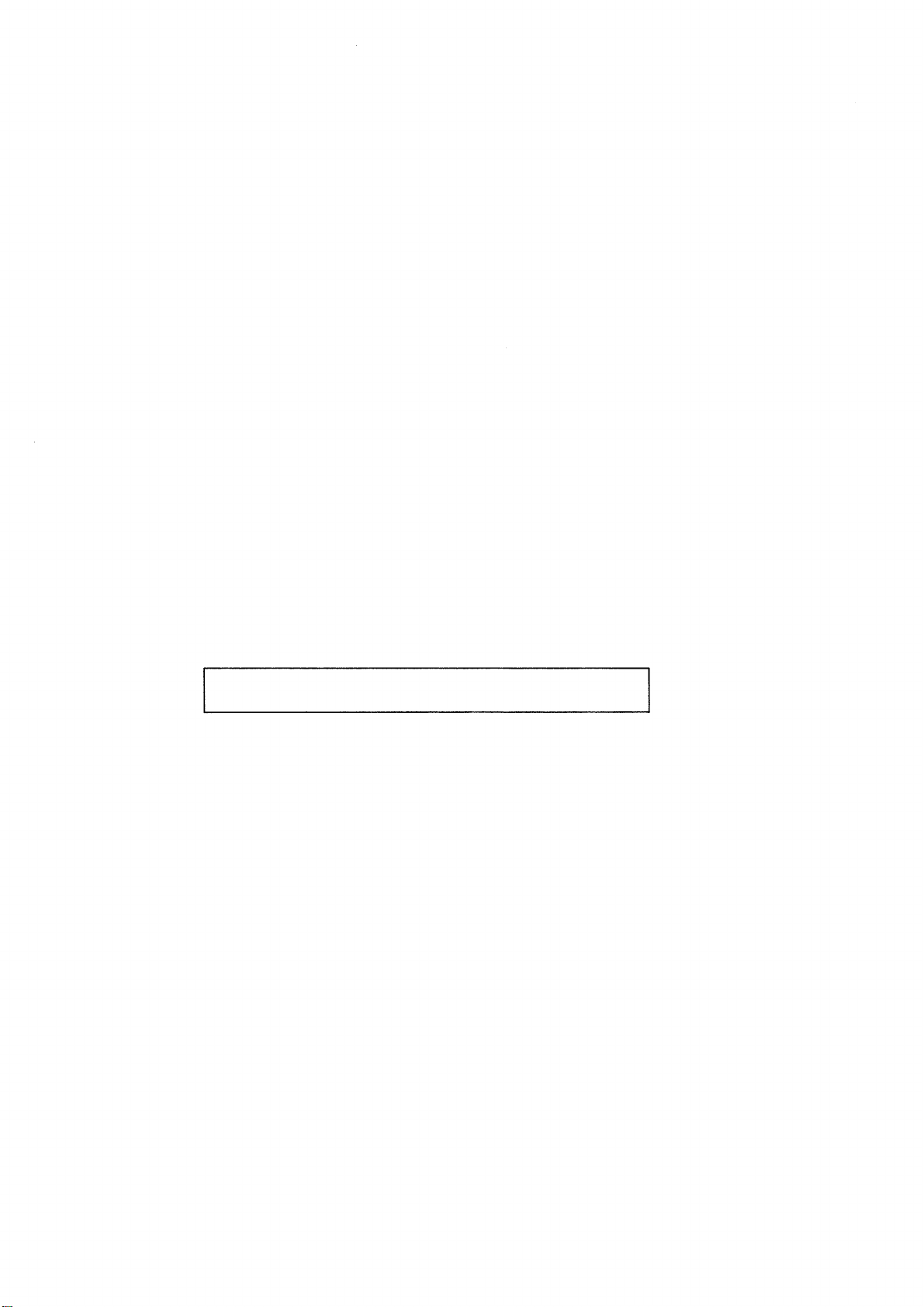
Indizierte Variablen aus verschiedenen Feldern:
B1$(3), C%(5), A(12), A3(5), D3%(2)
Die im Beispiel gezeigten Variablen haben alle nur einen Index, deshalb nennt man diese Felder
„eindimensionale Felder“. Im COMMODORE-BASIC können aber auch mehrdimensionale Felder
aufgebaut werden, d. h. Felder deren Elemente mehr als einen Index haben.
Diese Indizes werden innerhalb der Klammern durch Kommata getrennt.
Beispiel: Z%(1,0,2) X$(1,2) ZA(3,2,0,1)
Es kann auch jede Variable oder Formel deren Wert 3= 0 ist als Index benutzt werden. (Nachkomma
stellen werden ignoriert!).
Beispiel: Y$(N,1) K%(A+2,B*3,0) KA(N|3)
Hierdurch erreicht man eine indirekte Adressierung von Variablen, die durch ein Beispiel veran
schaulicht werden soll:
10 FORI = 0 TO 2
20 FOR J = 0 TO 2
40 FOR K = 0 TO 3
50 A(I,J,K) = RND (5)
60 NEXT K,J,I
70 STOP
Im Normalfall reserviert der Rechner pro Feld einen Speicherplatz für 11 indizierte Variablen pro
Index. D.h., daß er für das im Beispiel benutzte dreidimensionale Feld Speicherplatz für
11 *11 *11 = 1331 Variablen reserviert. Das entspricht 6655 Bytes.
Diese Reservierung können wir jedoch mit dem folgenden Befehl ändern:
n DIM Name 1 (Zahl, Zahl,... ), Name2 (Zahl, Zahl,... )
n = Zeilennummer des Befehls
Name = Variable durch die das Feld bezeichnet wird
Zahl = höchster Index, der benutzt wird (kann Variable oder Formel sein).
Für unser letztes Beispiel lautet der Befehl:
5 DIM A (2,2,3)
Er bewirkt, daß nur Speicherplatz für 3*3*4* = 36 Variablen reserviert wird.
Es ist auch möglich, mehr als 11 Speicherplätze zu reservieren:
Beispiel: 10 DIM A$(29)
Mit diesem Befehl wird ein Feld für 30 Textvariablen dimensioniert.
Weitere Beispiele:
DIM A% (2,N)
DIM B (2,J+3,K*2)
DIM C$ (1,BA,K|3)
26
Page 29
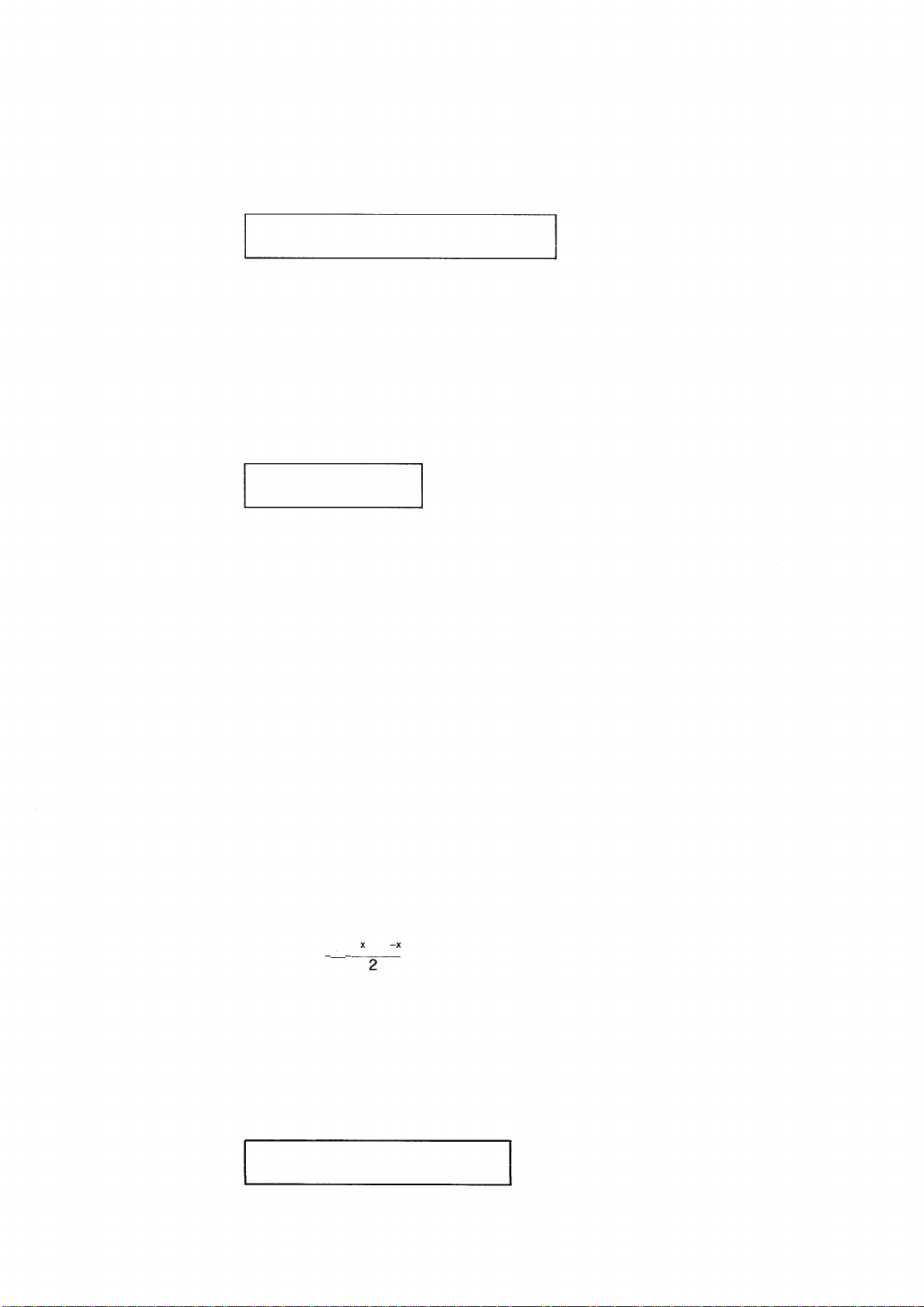
1.2.19 Einmal gewußt - immer gewußt...
DIE BEFEHLSGRUPPE DEF FN. ( )
FN.( )
Soll eine bestimmte Berechnung mehrmals für verschiedene Zahlenwerte durchgeführt werden, so
definieren wir eine Funktion durch den Befehl:
ni DEF FN Name (Variable) = Formel
n! = Zeilennummer des Befehls
Name = eine Variable fungiert als Name der Funktion
Variable = die Variable, die bei jedem Funktionsaufruf
angegeben wird.
Formel = mathematischer Ausdruck.
Diese Funktion kann, nachdem sie definiert ist, beliebig oft direkt oder von verschiedenen Stellen
des Programms durch den Befehl:
n2 FN Name (Variable)
aufgerufen werden.
n2 = Zeilennummer des Befehls (muß immer größer als ^ sein)
Name = die Variable, die beim DEF-Befehl als Name gewählt wurde
Variable = die Variable oder die Konstante für die die Formel berechnet
werden soll.
Beispiel: 10 DEF FNQ (Y) = Y f 0.2
50 Z = FNQ (A)
Durch diese Befehle wird der Wert für die 5. Wurzel aus A im Speicherplatz Z abgespeichert.
Beispiel:
Soll in einem Programm mehrmals der Hyperbelsinus von verschiedenen Zahlen (X) berechnet
werden, so definieren wir die Funktion mit dem Namen „H“:
10 DEF FNH (X) = (EXP (X) - EXP (-X)) / 2
Wollen wir nun den Hyperbol-Sinus für 3 ausrechnen und ausdrucken so schreiben wir:
PRINT FNH (3)
Anmerkung: sinh (x) = e ~
e
1.2.20 Der Schlüssel nach draußen ...
DER OPEN BEFEHL
Wie sie vielleicht wissen, können sie an Ihrem Rechner die verschiedenartigsten „Peripherie
geräte“ anschließen. Zum Beispiel einen Ausgabedrucker oder ein Floppy-Disk-Laufwerk.
Um diese Geräte ansprechen zu können, müssen Sie ein sogenanntes logisches FILE, d.h. eine
DATEI eröffnen, in die Daten geschrieben oder aus der Daten gelesen werden. Sie eröffnen eine
DATEI durch den Befehl:
OPEN m,, [m2, m3, ’’Name”]
27
Page 30

rri! = die logische Datei-Nr., ganze Zahl zwischen 1 und 255.
m2 = Geräte-Nr. des anzusprechenden Gerätes
(wird 1 gesetzt, falls Angabe fehlt)
0 = Tastatur
1 = # 1 Recorder
2 = # 2 Recorder
3 = Bildschirm
4-15 = externe Geräte
m3 = Art der Datenbewegung (wird 0 gesetzt, falls Angabe fehlt)
0 = lesen
1 = schreiben
2 = schreiben mit zusätzlichem END OF TAPE-Zeichen.
Name = kann angegeben werden um Dateien mit einem Namen direkt
anzusprechen. Der Name darf aus höchstens 16 Zeichen bestehen
und darf nicht in anderen Namen enthalten sein.
Es dürfen höchstens 10 Dateien gleichzeitig geöffnet sein! Wird diese Zahl überschritten, erfolgt die
Fehlermeldung: ?TOO MANY FILES ERROR.
Beispiele:
30 OPEN 1,2,1, ’’DAT 1”
Der Befehl bewirkt das öffnen der Datei 1 um auf der 2. Kassette Daten unter dem Namen DAT 1
abzuspeichern.
40 OPEN 2,1,0
Dieser Befehl öffnet Datei 2 zum Lesen vom Recorder # 1.
Kürzer: 40 OPEN 2
1.2.21 und so schließe ich ab ...
DER CLOSE BEFEHL
um zu verhindern, daß die maximale Anzahl der geöffneten Dateien (Files) überschritten wird, sollte
jede Datei geschlossen werden, sobald die Lese- oder Schreiboperationen ausgeführt sind.
Dies geschieht durch:
n CLOSE rr^
n = Zeilennummer des Befehls
nri! = die logische Datei-Nr. derzu schließenden Datei (ganzeZahl zwischen 1 und 255)
Beispiel: 100 CLOSE 2
Der Befehl bewirkt das Schließen der Datei-Nr. 2.
1.2.22 Ein Programm wird gespeichert...
DER SAVE BEFEHL
Das einmal in den Rechner eingegebene Programm kann auf einfache Weise gespeichert werden.
Die einfachste Möglichkeit hierzu ist das Abspeichern des Programms mittels des Kassettenre
corders.
28
Page 31

Sie beginnen den Vorgang mit dem Befehl:
SAVE [’’Name”]
Name = höchstens 255 Zeichen können als Bezeichnung des Programms angegeben
werden. (Sinnvoll beim Speichern mehrerer Programme auf einer Kassette).
Beispiel: SAVE ’’ABRECHNUNG”
Nach der Eingabe des SAVE-Befehls erscheint der Satz:
PRESS PLAY & RECORD ON TAPE # 1 auf dem Bildschirm des Rechners. Sie werden hierdurch
aufgefordert die Tasten
RECORD
des Kassettenrecorders gleichzeitig zu drücken. Sind die Tasten eingerastet, so erscheint
OK WRITING gegebenenfalls die ersten 16 Zeichen des Namens des Programms. Nach Beendi
gung der Aufzeichnung erscheint READY und der Kassettenrecorder hält an.
Bei der Namensgebung eines Programmes ist zu beachten, daß ein Name nicht bereits im Namen
eines anderen Programmes enthalten sein sollte (z.B. PROG und PROG 1), um Verwechslungen
auszuschließen.
und PLAY
1.2.23 ... und ein anderes geladen ...
DER LOAD BEFEHL
Es gibt zwei Möglichkeiten ein auf der Kassette gespeichertes Programm in den Rechner zu laden.
Hier die erste:
Sie drücken gleichzeitig die Tasten:
SHIFT
und auf dem Bildschirm erscheint LOAD, PRESS PLAY ON TAPE # 1. Kommt man der Aufforde
rung die Taste
RUN
STOP
PLAY
zu drücken nach, so kann man auf dem Bildschirm OK SEARCHING lesen. Sobald der Rechner den
ersten Programmanfang nach der augenblicklichen Bandposition gefunden hat, zeigt der Bild
schirm: FOUND bzw. FOUND Name, falls das gefundene Programm unter einem Namen abge
speichert wurde, (siehe 1.2.22). Nach Beendigung des Ladens wird das Programm automatisch
gestartet.
Die zweite Möglichkeit
Sie geben Buchstabe für Buchstabe den Befehl:
LOAD [’’Name”]
29
Page 32

Name = muß nur eingegeben werden, falls sie ein bestimmtes Programm suchen.
Werden auf der Suche nach diesen Programmen andere Programme ge
funden, so werden diese auf dem Bildschirm durch „FOUND Name“ registriert,
jedoch nicht geladen.
Der Rechner beantwortet den LOAD-Befehl mit PRESS PLAY ON TAPE # 1 und dann das Drücken
der Taste
PLAY
mit OK SEARCHING bzw. OK SEARCHING FOR Name. Hat er entweder das Programm mit dem
gesuchten Namen oder, falls kein Name eingegeben wurde, den ersten Programmanfang ge
funden, so erscheint: „FOUND Name“, „LOADING“ auf dem Bildschirm. Nach Beendigung des
Ladevorganges erfolgt die Meldung „READY“ auf dem Bildschirm und das Programm kann durch
den Befehl: „RUN“ (als Einzelbuchstaben) gestartet werden.
1.2.24 ... geprüft und für gut befunden ...
DER VERIFY-BEFEHL
Um zu kontrollieren, ob das Programm im Rechner mit dem abgespeicherten Programm identisch
ist, dient der Befehl
VERIFY [’’Name”]
Name = Name des abgespeicherten Programms (Falls Programm unter einem Namen
abgespeichert ist).
Nach Drücken der Taste
PLAY
(siehe 1.2.23) meldet der Rechner entweder „OK“, d.h. das Programm ist identisch oder aber
„7VERIFY ERROR“, d.h. das Programm ist nicht richtig abgespeichert und der Befehl SAVE muß
wiederholt werden.
Soll ein Programm auf eine Kassette überspielt werden, die zum Beispiel schon zwei Programme
enthält, kann man folgendermaßen vorgehen: Kassette zurückspulen
VERIFY (es erscheint ? VERIFY ERROR)
nochmals VERIFY (es erscheint ? VERIFY ERROR)
Nun steht der Aufnahmekopf hinter dem 2. Programm und es kann ein 3. Programm dahinter ge
speichert werden.
1.2.25 Mein Wissen wird zum Teil gelöscht...
DER CLR-BEFEHL
Der Befehl
CLR
löscht sämtliche Variablen einschließlich Dimensionierung (siehe 1.2.18) und beinhaltet den
RESTORE-Befehl (siehe 1.2.9). Weiter werden auch die Zähler der FOR-NEXT Schleifen und der
GOSUB auf Ausgangsstellung gesetzt.
Beispiel: 120 CLR
30
Page 33

1.2.26 Die Länge wird geprüft...
DER LEN ( )-BEFEHL
Der folgende Befehl dient dazu die Länge einer Textvariablen (z. B. A$) zu errechnen.
LEN ({Textvariable, ’’Text”})
Textvariable = hier muß die Textvariable stehen, deren Länge errechnet werden soll,
oder der Text selbst (in Anführungszeichen).
Bei der Berechnung der Länge werden auch Leerzeichen (Blanks) mitgezählt.
Beispiel: 10 A$ = ’’COMPUTER”
20 PRINT LEN (A$)
READY
RUN
8
READY
Die Länge einer Textvariablen kann als Zahlvariable benutzt werden, d. h. es sind folgende Befehle
denkbar:
A = LEN (A$) *3
10 FORK = 1 TO LEN (A$).. .
1.2.27 Mit Texten kann man nicht rechnen ...
DER VAL ( )-BEFEHL
Wie die Überschrift schon besagt, kann man mit Textvariablen nicht rechnen, auch wenn sie Ziffern
enthalten. Mit dem Befehl:
VAL ({Textvariable, ’’Text”})
können die führenden Ziffern einer Textvariable in eine Zahl umgeformt werden, falls ihre ersten
Zeichen +, -, Dezimalpunkt oder Ziffern sind. Beginnt die Textvariable mit nichtnumerischen
Zeichen, so ist VAL (Textvariable) = 0.
Beispiele:
? VAL (”1357 COMPUTER”)
Anzeige: 1357
B$ = 1.5E + 2DM”
? VAL (B$)
Anzeige: -150
C$ = ’’COMPUTER 12”
? VAL (C$)
Anzeige: 0
Nur die Ziffern, die als erste Zeichen der Textvariablen stehen, werden umgeformt.
1.2.28 Verwandeln kann man auch ...
DER STR$ ( )-BEFEHL
Wollen sie eine Zahl oder eine Variable in eineTextvariable umwandeln, so benutzen Sie den Befehl:
STR$ ({Variable, Zahl})
Beispiele: 10 A$ = STR$ (B)
20 C$ = STR$ (12.5)
31
Page 34

1.2.29 So sieht ein ASCII-CODE aus ...
DER ASC ( )-BEFEHL
Da der Rechner intern nur Zahlen verarbeiten kann, ist jedem Zeichen ein Zahlenwert zugeordnet.
Diese Zuordnung geschieht nach dem ASCII (American Standard Code for Information Inter
change), siehe Tabelle in 2.1.
Wollen wir kontrollieren welche Zahl dem ersten Zeichen einer Textvariablen im ASCII entspricht,
so benutzen wir den Befehl:
ASC ({Textvariable, ’’Zeichen”})
Beispiel: 10A$ = ’’ASCII”
20 ?ASC (A$)
READY
RUN
65
READY
Das obige Beispiel zeigt, daß dem Zeichen A die Zahl 65 im ASCII zugeordnet ist.
Beispiel: ?ASC(”3”)
1.2.30 ... die passende Umkehrung ...
DER CHR$ ( )-BEFEHL
Der CHR$-Befehl stellt die Umkehrung des ASC ( ) Befehls dar. Mit seiner Hilfe lassen sich aus den
Zahlen 0 - 255 die dazugehörigen Zeichen ermitteln:
CHR$ ({Variable, Zahl})
Der CHR$ ( ) Befehl kann sich auf eine Zahl oder eine Variable beziehen.
Beispiel: A$ = CHR$ (65)
Das zum ASCII 65 gehörende Zeichen (A) wird ermittelt und in A$ gespeichert.
Mittels dieses Befehls können sie sich leicht eine ASCII Tabelle selbst erstellen:
10 FOR I = 0 TO 255
20 IF I = 147 THEN PRINT: GOTO 40
30 PRINT CHR $ (I), I
40 NEXT I
Merke: Die ersten 32 Zeichen sind Sonderzeichen die vom Rechner nicht angezeigt werden. Das
Zeichen mit dem Code 147 entspricht Bildschirm löschen, es wird daher im obigen Programm
übergangen.
1.2.31 Hätten Sie es gern links...
DER LEFT $ ( )-BEFEHL
Warum BASIC für seine leichte Textverarbeitung so gelobt wird, werden sie bei den folgenden vier
Befehlen schnell erkennen.
Der erste Befehl
LEFT$ (Textvariable, Anzahl)
bewirkt, daß die im Befehl angegebene Anzahl von Zeichen, von links beginnend, abgespalten wird.
32
Page 35

Die Ausgangstextvariable bleibt von diesem Befehl unberührt.
Textvariable = Textvariable, auf die LEFT angewandt wird.
Anzahl = Variable, Formel oder Konstante, die die Zahl der zu übernehmenden Zeichen
angibt. Hat die Textvariable weniger Zeichen als angegeben, so wird sie ganz
übernommen.
Beispiel: 10 A$ = ’’COMPUTER”
20 B$ = LEFT$ (A$,3)
30 ? B$
READY
RUN
COM
READY
weitere Beispiele:
30 B$ = LEFTS (DA$,3*C)
50 PRINT LEFTS (B$,2)
1.2.32 ... oder bevorzugen Sie rechts ...
DER RIGHTS ( )-BEFEHL
Der Befehl...
RIGHTS (Textvariable, Anzahl)
Textvariable = Textvariable auf die RIGHT angewandt wird.
Anzahl = Variable, Formel oder Konstante, welche die Zahl der zu übernehmenden Zeichen
angibt. Hat die Textvariable weniger Zeichen als angegeben, so wird sie ganz
übernommen.
... bewirkt, daß die im Befehl angegebene Anzahl von Zeichen, von rechts beginnend abgespalten
wird. Die Ausgangstextvariable bleibt von diesem Befehl unberührt.
Beispiel: 10 A$ = ’’COMPUTER”
20 B$ = RIGHTS (AS,5)
30 ? B$
READY
RUN
PUTER
READY
1.2.33 ... und für Unentschlossene die ... Mitte ...
DER MIDS ( )-BEFEHL
Der Befehl...
MID $ (Textvariable, Zeichennr., Anzahl)
Textvariable = Textvariable, auf die MID angewandt wird.
Zeichennr. = Variable, Formel oder Konstante als Zeiger
Anzahl = Variable, Formel oder Konstante, die die Zahl der zu übernehmenden Zeichen
angibt.
... bewirkt, daß von einem gewissen Zeichen an (Zeichennr.) eine bestimmte Anzahl von Zeichen
(Anzahl) übernommen wird.
33
Page 36

Beispiele: 1 A$ = ’’COMPUTER”
2 B$ = MID$ (A$,4,4)
3 ?B$
READY
RUN
PUTER
READY
10 D$ = MID$ (C$,I+2,D*3)
Eine kleine Spielerei:
10 A$ = ’’COMPUTER”
20 FOR I = 1 TO 8
30 PRINT MID$ (A$,1,l), I
40 NEXT
1.2.34 Der Schlüssel zur Maschinensprache,
der SYS ( )-Befehl
Der SYS-Befehl dient dazu, innerhalb eines BASIC-Programmes Unterprogramme aufzurufen, die
in der Maschinensprache geschrieben werden.
SYS (Startadresse)
Beispiel: 10 SYS (65490)
Hierbei ist die Zahl 65490 die Dezimaladresse des Speicherplatzes, zu dem die Programmaus
führung verzweigt. Die Startadresse muß eine positive Zahl und darf nicht größer als 65535 sein.
Ab dieser Adresse wird der Inhalt als Maschinenprogramm verstanden und auch ausgeführt.
Das Maschinenprogramm wird beendet, sobald der Maschinenbefehl RTS gelesen wird.
Die Programmausführung verzweigt wieder zurück zum BASIC-Programm, und zwar zu dem
Befehl, der hinter dem SYS-Befehl folgt. Die Logik ist also die gleiche, wie bei dem Aufruf von
BASIC-Unterprogrammen mit dem Befehl GOSUB.
Um nun Programme in der Maschinensprache zu erstellen, ist es notwendig, die Befehle des Mikro
prozessors 6502 zu kennen. Hier sei als Literatur die Programmierfibel zum 6502 empfohlen (er
hältlich über Ihren Commodore-Vertragshändler).
1.2.35 So geben Sie noch Daten mit... Der USR ( )-Befehl
Der USR-Befehl ist eine Erweiterung des SYS-Befehls. Er dient ebenfalls dazu, Unterprogramme
aufzurufen, die in der Maschinensprache geschrieben sind. Als Erweiterung ist es mit dem USRBefehl jedoch möglich, eine beliebige Variable an das Unterprogramm zu übergeben.
USR (Variable)
Beispiel: A = USR (A)
Beispiel: 10 ON USR (SIN(X) / SQR(Y)) GOTO 100, 200,300
Bevor der USR-Befehl aufgerufen wird, sind jedoch einige Punkte unbedingt zu beachten.
1. Da aus dem USR-Befehl selbst nicht hervorgeht, wo das Unterprogramm steht, muß die Pro
grammanfangsadresse in die Speicherstelle 1 und 2 geschrieben werden.
Beispiel: Das Unterprogramm beginnt bei der Speicherstelle 7000. Die Speicherstellen 1 und 2
müssen daher zuerst wie folgt mit POKE belegt werden:
34
Page 37

POKE 2, INT (7000/256) Höherwertiges Byte
POKE 1,7000 AND 255 Niederwertiges Byte
A = USR (10)
I
--------------
-------------------------------------Ergebnis vom Unterprogramm
2. Der Übergabebereich der Variablen liegt an den Speicherstellen 176 bis 183. Das ist nur wichtig
für das Maschinenprogramm. Siehe Beschreibung des TIM-Monitorprogramms im Anhang.
3. Sind die Speicherstellen 1 und 2 einmal belegt worden, so brauchen sie nicht vor jedem weiteren
USR-Befehl erneuert werden.
4. Grundsätzlich sollten Sie sehr vorsichtig mit den SYS- und USR-Befehlen umgehen, da ein
falscher Sprung in ein Unterprogramm den Rechner zu nicht beeinflußbaren Operationen ver
anlaßt.
Danach können Sie nur durch Aus- und Einschalten den Normalzustand erreichen.
Variable für das Unterprogramm
1.2.36 Ein Elixier für Starprogrammierer,
die Befehlsgruppe POKE, PEEK ()
Die Befehle PEEK und POKE zählen zu den Sonderbefehlen, mit denen über das herkömmliche
BASIC hinaus Speicherplatzoperationen durchgeführt werden können.
POKE - ermöglicht es, direkt in eine bestimmte Speicherstelle einen Wert hineinzuschreiben.
POKE Speicherstelle, Wert
Beispiel: POKE 59468,12
In die Speicherstelle (dezimal) 59468 wird hier der Zahlenwert 12 eingeschrieben. Dieses Beispiel
ist gleichzeitig der Befehl für die Umschaltung von Grafikzeichen auf Kleinbuchstaben; d. h. die
Shift-Funktion der Tastatur erzeugt jetzt in Verbindung mit einer Taste den zugehörigen Kleinbuch
staben, siehe Anhang VIII für die -2-Tastatur.
Dieser Zustand bleibt erhalten, bis entweder das Gerät ausgeschaltet wird oder bis der Umschalt
befehl
POKE 59468,14 folgt.
PEEK - Liest den Inhalt einer Speicherstelle, die dezimal angegeben wird.
PEEK (Speicherstelle)
Beispiel: ? PEEK (59468) Anzeige: 14
35
Page 38

1.3 DIE AUSFÜHRUNGSBEFEHLE
Diese Befehle kann man als Steuerbefehle für ein Programm auffassen; wir bestimmen damit,
was mit dem Programm geschehen soll, ob es
- mit RUN gestartet werden soll,
- mit STOP gestoppt werden soll,
- ob es mit LIST ausgedruckt bzw. am Bildschirm dargestellt werden soll,
- mit NEW gelöscht werden soll,
- mit CONT (CONTINUE) nach einem STOP-Befehl
weitergestartet werden soll oder mit
- GOTO ab einer bestimmten Adresse gestartet werden soll, oder ob mit
- CLR alle Variablen gelöscht werden sollen.
Um diese Befehle kennenzulernen, müssen wir ein kleines Beispielprogramm in den Rechner
eingeben.
Geben Sie bitte nachfolgendes Programm Zeile für Zeile in den Rechner ein. Nach jeder Zeile be
tätigen Sie die RETURN-Taste. Mit dieser RETURN-Taste wird die Programmzeile, die ja zunächst
nur im Bildschirm steht, in den Arbeitsspeicher gebracht, wo sie später zur Ausführung gebracht
werden kann.
10 INPUT A,B,C
20 PRINT A,B,C
30 STOP
40 PRINT „BEISPIEL“
50 END
1.3.1 Das Programm wird gestartet
Mit dem Befehl
RUN (RETURN)
wird das gesamte Programm gestartet. In dem Beispielprogramm erkennt man das daran, daß im
Bildschirm ein Fragezeichen erscheint. Dieses Fragezeichen ist typisch für die Input-Anweisung
der Zeile 10.
Nach Eingabe von 3 numerischen Werten
z.B. 1 (RETURN)
2 (RETURN)
3 (RETURN)
setzt das Programm automatisch den Ablauf fort.
MERKE: Mit dem RUN-Befehl werden alle bereits im Rechner befindlichen Variablen gelöscht!
Der RUN-Befehl kann auch modifiziert angewendet werden; z. B. wird mit
RUN Zeilennummer
das Programm ab der angegebenen Zeilennummer gestartet.
In dem Beispiel läßt sich dieses mit
RUN 40
testen.
1.3.2 Die Verschnaufpause wird beendet
Wird der Ablauf eines BASIC-Programms durch einen Stop-Befehl unterbrochen, so läßt sich das
Programm sehr einfach ab dieser Stelle fortsetzen durch
CONT (RETURN)
MERKE: Der CONT-Befehl verändert keine Variablen oder Werte eines Programms.
1.3.3 Und so sieht Ihr Programm aus
Möchten Sie sich das im Rechner befindliche BASIC-Programm einmal in seiner Gesamtheit an-
sehen, benutzen Sie die Befehlsfolge
LIST (RETURN)
Auf dem Bildschirm erscheint nun das gesamte BASIC-Programm, sortiert nach aufsteigenden
Zeilennummern.
..........
____
36
Page 39

Selbstverständlich lassen sich auch Teilbereiche des Programms ausgeben.
LIST 40 (RETURN) listet nur Zeile 40
LIST -30 (RETURN) listet bis Zeile 30
LIST 30- (RETURN) listet ab Zeile 30
LIST 20-30 (RETURN) listet von Zeile 20 bis 30
LIST 40-40 (RETURN) listet nur Zeile 40
1.3.4 Man muß nicht immer am Anfang starten
Sollte der Ablauf eines Programms einmal ab einer bestimmten Zeilennummer fortgesetzt werden
____
ohne die im Rechner befindlichen Werte zu löschen bzw. ohne die Anweisung STOP zu benutzen,
bietet sich die GOTO-Anweisung an.
Syntax: GOTO Zeilennummer
Beispiel: GOTO 40 (RETURN)
MERKE: Die GOTO-Anweisung verändert keine Variablen oder Werte.
1.3.5 So kann man altes vergessen.........
Soll der Rechner in den sogenannten Einschaltzustand gebracht werden, benutzt man die Befehls
folge
NEW (RETURN)
d.h. das gesamte Programm und sämtliche im Rechner befindlichen Variablen werden gelöscht.
Die in 1.3. aufgeführten Ausführungsbefehle sind außer CONT auch programmierbar. Sie können
also wie normale Befehle ins Programm geschrieben werden.
2.
DIE BESONDERHEITEN DES 2001 UND DER 3001 -COMPUTER
2.1
Die graphischen Symbole (siehe Anhang VIII für die -2-Tastatur.)
Neben den großen Buchstaben auf der Tastatur existieren noch eine Vielzahl von Sonderzeichen,
nämlich die graphischen Symbole.
Diese Symbole werden dargestellt, wenn gleichzeitig die SHIFT-Taste und eine weitere Taste mit
den dargestellten Sonderzeichen betätigt wird.
Zusätzlich ist es möglich, auch in Kleinschrift zu schreiben.
Der Rechner besitzt 3 sogenannte Zeichensätze:
1. Großschrift und Sonderzeichen
2. Graphische Symbole
3. Kleinschrift
Wobei 1. immer vorhanden ist und 2. oder 3. wahlweise einschaltbar sind.
Der Befehl zum Umschalten zwischen 2. und 3. Zeichensatz lautet:
POKE 59468,12 (Kleinschrift gewählt)
POKE 59468,14 (Graphische Symbole gewählt)
Bei der Umschaltung ist zu beachten, daß der gesamte Bildschirminhalt umgeschaltet wird.
Beispiel: 10
Nachfolgende Tabelle gibt den Zusammenhang zwischen Dezimal, Hexa-Dezimal, ASCII und
Bildschirmcode wieder.
FOR I = 1 TO 255
IF I = 147 THEN PRINT: GOTO 40
20
PRINT CHR$(I);
30
40
NEXT
POKE 59468,14: FOR I = 1 TO 999: NEXT
50
POKE 59468,12: FOR I = 1 TO 999: NEXT: GOTO 50
37
Page 40

32 20
[
CD
~n
c
co
o
Tl
CO
—X
X.
o
m
r~
Tl
CD
oao
o
DD
IU
O
Tl
Tl
roCDfO
CO
_X
o
m
6
3D
o
CO
CO
N)
sj
oo
DD
o
ESC
Tl
CO
ru
05
—X
>
SUB
N)
Ulru-p>
00
CO
CAN
m
S
ruCOru
_k
Si
ETB
ru
O)
SYC
ro
IU
Ul *>. CO ru o
NAK
o
aoD
CO 00
O
C4
Si
a
D
o
O
ro
O) Ul
DLE
o
DD
5
_X
O CD
o
O
CDo00
>
r~
X
•n
H
00
DD
CO
Si
O
s|
03
r~
05
Ul CO ru
O05oUlo
ENQ
ACK
p>.oCOoru
EOT
ETX
STX
-m X
O o
HOS
o
o
NULL
DEZIMAL
HEXA
DEZIMAL
ASCII
[
a>
Ul
>
♦
CD
00
o>
ru
er
D
t
->
O)
O)
-p>
CO
CO
■p>.
o
TI
■o
©
•o
1
COSJCDo>CD
<J>
05
o
03
B
□
—
05
ro
CO
m
V
V
CJ1
cnTIUl
Î
a
's.
O) 05
CODCO
II
II
CD CD
m
-
a
127
si
Tl
DEL
B
— N
OUlCO
OCODO
A
A
CD
UlOUl
—
S
126
simsi
l
H
k:
en00ai-gai
CO
>
CO(UCD CD
UlDDUl
o
—
-
æ
B
125
124
S|
O
O
-
H
□
X
g
O)enen
CO00COsiCO05CO
CO
CO
CO 00
CO
CD
00
CO
O
ai
CD
>
N
-< X
♦
□
123
122
Si
si
U
>
N
-
□
E
C
<
Ul
■p>.
-sJ
o>
sJ
05 Ul
000000sJ000500Ul00 00
cn
UlsiUl05UlUlUl
00
?
+
Ö
120
ru
siCO-Ni
00sisi
X
a
E
H
UlCOUl
Ul
cn
<
E
119
s
a
CO
ru
COaCO
-P^ CO
c
E □
118
si05si
< C
Q B
DD
Ul
CO
CD
•fc.
H
117
Ul
*0
O
Ul
o
CO
ru
ro
ru
CO
UlCOcnN)cn Ul
C0
«
116 ;
I
S|
-
n
o
-P00
CO
CO COoru
_x
o
o
-
00
00
X
N)
M
DD
o
m
D
115
114
si
COSiru
—»
en
æ
B
Z
<z
•P*si■fc.
05
IU
Tl
m
-
-
00osi
CD
■fc.
o
n
Tl
O
n S 0
□
I 113
112
si
O05Tl
_Q TD
m
Q
I“
-P.
-PUl
-P>-
IUDru
O
I - +
-
I
si
si
Si
00
P».o•P*
-P>.
m
z
s
110
05
m
3
O
B
D
C-
—
P*COP>
ru
ruDDru
>
* —
+
*
si05siUlsi
DD
O
r~
X
Q
D
I 108
109
O)
Da>O
—
3
D
H
Tl
X o
P-oCOcoCO
__x
ruCOruoorusiru05rocnru
—
—
—
siCOsi
■P».
■p.
ê
>
c_
—
a S B
107
106
05DD05
>
TT
—
S
a
m
O O
CO
Si
00
p°
s|
B
104
3" CO
E
sO
o'-
0
si
o S
O)
Tl
E
103
05
si
□
- e°
'
ru
-P-00pksi-P*.
X o
I 105
a>
CD0500
—
H
s
DD
CO03CDenco
-p^ruco
11-
m
050005
-N
P>.
-P*
Ul
m
D o
Q
□
102
o
05Ul05
en
O)
CD
-
n
m
> f9
co
co
Pl.
ro
ru
ru
;
—
—
'
o>
si
O)
-P».
CD
ru
DD
B
m
100
CD
co
O)
CD
p>
Q. o
□
□ BILDSCHIRM
BILDSCHIRM
DEZIMAL
HEXA
DEZIMAL
ASCII
BILDSCHIRM
DEZIMAL
HEXA
DEZIMAL
ASCII
BILDSCHIRM
DEZIMAL
HEXA
DEZIMAL
ASCII
IN HEXADEZIMAL; ASCII & BILDSCHIRMCODE
Page 41

2.2. DIE EINGEBAUTE UHR .... ein Leckerbissen
Jeder Computer braucht, um seine Befehle auszuführen, einenTaktgenerator, der die Geschwindig
keit der Befehlsausführung bestimmt. Um die Genauigkeit des Generators zu erhöhen, verwenden
manche Computerhersteller dazu Quarze, wie sie auch in Uhren verwendet werden. Bei Ihrem
Rechner wird dieser Taktgenerator gleichzeitig als Uhr mit verwendet.
Diese Uhr kann in 2 Formen abgerufen werden.
Geben Sie folgendes ein:
PRINT Tl$ (RETURN)
Die Antwort sind 6 Ziffern die Ihnen die Zeit seit Einschalten des Rechners angeben.
Die Ziffern bedeuten:
Ziffer 1+2: Stunden
Ziffer 3 + 4: Minuten
Ziffer 5 + 6: Sekunden
Geben Sie ein:
PRINT TI
Die Antwort ist eine Zahl, die Ihnen die Anzahl von 1/60 Sekunden seit Einschalten des Rechners
angibt.
Wenn Sie die Uhr auf eine bestimmte Zeit stellen wollen, so verändern Sie die Variable Tl$.
Beispiel: Tl$ = ”143000” (Die Uhr wird auf 14h.30 gestellt.)
Tl$ = ”080530” (Die Uhr wird auf 8h.05 u. 30 Sekunden gestellt.)
Ein Verändern der Variablen TI ist nicht möglich.
Der Anwendungsbereich der Uhr ist sehr leicht erklärt:
Zeitgenaue Meßwerterfassung
Terminkalender für den Tag
Abbrechen von Programmen nach einer bestimmten Zeit
Überprüfung von Zeitabläufen
Ein kleines Beispiel soll eine der Anwendungen der Uhr veranschaulichen.
100 INPUT ’’WIE SPÄT IST ES”; A$
110 IF LEN (A$)< 6 THEN 100
120 B$ = ””
130 FOR I = 1 TO LEN (A$)
140 IF MID$ (A$,l,1) <”0” or MID$ (A$,l,1)
> ”9”THEN 160
150 B$ = B$ + MID$(A$,I,1)
160 NEXT I
170 IF LEN (l$) <>6 THEN 100
180 Tl$ = B$
190 PRINT ’’DRÜCKEN SIE [RETURN], WENN SIE”
200 PRINT ’’WISSEN WOLLEN, WIE SPÄT ES IST.”
210 GET IN$: IF IN$ = ” ’’THEN 210
220 IF ASC (IN$) >< 13 THEN 210
230 PRINT ”ES IST JETZT:”;
240 B$ = Tl$
250 A$ = LEFTS (B$,2) + ”UHR”, + MID$ (B$,3,2)
+ ”MIN” + RIGHTS (B$,2) + ”SEK”
260 PRINT A$
270 GOTO 210
39
Page 42

2.4 Die Möglichkeiten Peripherie anzuschließen
Das nachfolgende Bild illustriert die Anschlußmöglichkeiten für externe Geräte.
Abb. 1 : Rückseite des Computers
1 = Anschluß für externen Recorder
2 = 8 Bit Parallel-Schnittstelle
3 = IEC-Bus-Schnittstelle
4 = Seriennummer
5 = 0,6 Amperé-Sicherung
6 = Netzkabel
7 = Netzschalter
2.4.1 DER RECORDER
Der externe Recorder wird über den vorhandenen Steckerkontakt auf der Rückseite des Rechners
angeschlossen.
Die logische Behandlung des Kassettengerätes geschieht mittels der Anweisungen:
OPEN Kapitel 1.2.20
CLOSE
SAVE
LOAD
VERIFY
PRINT #
INPUT #
Soll ein Programm auf dem Recorder gespeichert werden, so lautet die Befehlsfolge
SAVE ’’NAME”,
oder
’’SAVE”,
Entsprechend:
LOAD ’’NAME”,
bzw.
’’LOAD”,
Der 2. Recorder wird innerhalb des Gerätes an der Platine angeschlossen. Beim Zugriff auf diesen
Recorder muß beim öffnen der Datei der Gerätenummer 2 angesprochen werden; desgleichen
beim Laden und beim Lesen.
bis
40
Page 43

Sollen Daten auf den Recorder geschrieben oder vom Band gelesen werden, so verwendet man
PRINT# bzw. INPUT# .
Beispiel: 10 OPEN 5,1,1 (Siehe Kapitel 1.2.20)
20 FOR K = 1 TO 50
30 PRINT # 5,K
40 NEXT K
50 CLOSE 5
Für den Lesevorgang sieht das Beispiel geringfügig anders aus.
Beispiel: 5 DIM A (50)
10 OPEN 5,1,0
20 FOR K = 1 TO 50
30 INPUT#5,A(K)
40 NEXT K
50 CLOSE 5
Anmerkung: Beim 2001-Computer ist es notwendig, vor jedem OPEN-Befehl, der sich auf einen
Recorder bezieht, folgende 2 Befehle einzufügen:
POKE 243,122: POKE 244,2 vor OPEN für Recorder # 1
bzw. POKE 243,58: POKE 244,3 vor OPEN für Recorder # 2
Bei den Geräten der 3001-Serie dürfen diese Befehle nicht verwendet werden.
2.4.2 Der 8 Bit Parallelanschluß
Der Parallelanschluß, (Abb. 1, Pkt. 3), auch User-Port genannt, besteht aus 12 Doppelkontakten
(Abstand Kontakt zu Kontakt: 0,156 inch) für die verschiedensten Möglichkeiten des Sendens und
Empfangens von Informationen.
Die unteren Kontakte des Parallelanschlusses (CA1, PA0-7, CB2) sind direkt auf einen InterfaceAdapter VIA 6522 geführt und können hexadezimal ab $E840 bzw. dezimal ab 59456 ange
sprochen werden.
Näheres siehe Anhang S (Schnittstellenbeschreibung).
Trägermaterial
(Isolierung)
Abb. 2 8 Bit Parallelanschluß
Sicht auf Rückseite Computer.
2.5. DATEIVERWALTUNGEN
Im Zusammenhang mit dem IEC-Bus ist die Behandlung von Dateien und das Wissen darüber
unentbehrlich.
Dateien werden benutzt, um Daten oder Informationen abzuspeichem und/oder wiederzube
schaffen. Das geschieht beispielsweise auch mit Programmen auf der Kassette. Eine Erweiterung
dieser Erklärung ist es, jede Vorrichtung, die Daten empfangen oder erzeugen kann, als logische
Datei zu benennen. Zum Beispiel kann ein Digitalvoltmeter auf Anfrage des Rechners seine Infor
mationen über den IEC-Bus senden. Da aber verschiedene Geräte wie Kassette, Bildschirm,
Tastatur, Voltmeter u. a. völlig verschieden aufgebaut sind, unterscheidet man bei diesen zwischen
einer physikalischen und einer logischen Adresse dieses Gerätes.
41
Page 44

a) Die physikalische Adresse eines Gerätes ist unabänderlich und vom Hersteller festgelegt. Bei
Ihrem Modell kann die physikalische Adresse von 0-15 gehen. Folgende Adressen sind bereits
belegt:
physikalische Adresse
0
1
2
3
Als Geräte 4-15 sind lEC-Bus-Geräte nach Belieben anschließbar.
b) Die logische Adresse einer Datei ist von 1 bis 255 von Ihnen frei definierbar. Sie legen die Zu
weisung einer logischen Adresse beim Eröffnen dieser Datei fest. Diese Verknüpfung hat für
Sie den Vorteil, daß Sie beim Ändern eines physikalischen Gerätes nur angeben, um welches
Gerät es sich handelt. In dem folgenden Beispiel sehen Sie, daß eine Tabelle, von dem selben
Unterprogramm generiert, einmal auf dem Bildschirm ausgegeben wird und das zweite Mal
auf der Kassette:
10 OPEN 1,3,1: REM Bildschirm
11 GOSUB 100: REM Sprung ins Unterprogramm
12 CLOSE 1
13 Open 1,1,1: REM Recorder
14 GOSUB 100
15 CLOSE 1
16 END
100 FOR I = TO 25: REM Unterprogramm
101 PRINT# 1,1; SQR(I)
102 NEXT I
103 RETURN
Gerät
Tastatur
Recorder # 1
Recorder #2
Bildschirm
Zusätzlich zu der physikalischen und logischen Adresse können Sie beim Eröffnen eines Gerätes
noch eine Zweitadresse angeben. Die Zweitadresse gibt einem intelligenten Peripheriegerät beim
Eröffnen zusätzlich noch an, in welcher Art es die Daten zu behandeln hat. Beim Drucker gibt es
beispielsweise 6 verschiedene Arten, die Daten zu drucken:
Zweitadresse Druckart
0 Normal drucken
1 Drucken unter Formatkontrolle
2 Übersetzen des Formates
3 Setzen variable Anzahl Zeilen/Seite
4 Benutzen der Fehlerdiagnose
5 Übertragen eines programmierbaren Zeichens
Bei der Kassettenstation gibt es 3 verschiedene Arten, Daten zu verwalten:
Zweitadresse Operation
0 Lesen von Daten
1 Schreiben von Daten
2 Schreiben von Daten und eine
Bandende-Kennung beim Schließen der Datei
Als letzte Information können Sie einen Dateinamen beim Eröffnen eines Gerätes mit angeben.
Das ist sinnvoll, wenn dieses Gerät verschiedene Dateien verwaltet. Bei Ihrer Kassette ist es bei
spielsweise so, daß Sie mehrere Dateien hintereinander ablegen können. Um nun eine bestimmte
Datei auf dieser Kassette abzuspeichern, können Sie diese mit einem Namen versehen. Dieser
Name kann bis zu 128 Zeichen umfassen, es werden allerdings beim späteren Suchen dieser
Datei nur die ersten 16 Zeichen abgefragt.
42
Page 45

2.5.1. KOMMUNIKATION
Um nun Daten mit einem peripheren Gerät auszutauschen, gibt es 6 spezielle Kommunikations
befehle. Diese sind zwar schon in Kapitel 2 beschrieben, sollen aber an dieser Stelle noch einmal
vertieft werden.
a) OPEN logische Adresse [Physikalische Adresse [Zweitadresse [’’Dateiname”]]]
b) CLOSE logische Adresse
c) PRINT # logische Adresse [Beliebige Daten]
d) GET # logische Adresse, Variable [Variable, Kostante, arith. Ausdruck]
e) INPUT # logische Adresse, Variable [Variable, Konstante, arithm. Ausdruck]
f) CMD logische Adresse
Um jedem die Möglichkeit zu geben, die nachfolgenden Prozeduren nachzuvollziehen, be
schränken wir uns dabei nur auf Kassette, Bildschirm und Tastatur. Es sei jedoch erwähnt, daß
jedes weitere an den IEC-Bus angeschlossene Gerät gleichartig arbeitet. Hierbei ist nur zu unter
scheiden, ob es sich um ein Eingabegerät (Tastatur), Ausgabegerät (Bildschirm) oder Mehrdatei
gerät (Kassette) handelt.
2.5.2. DATEIVERWALTUNG PER KASSETTE
Die Kassettenstation Ihres Rechners ist prinzipiell identisch mit einem normalen Kassettenrecorder.
Unterschiedlich ist lediglich das Sende-Empfangsteil für digitale Informationen und ein Schalter,
der die Stellungen der Bedienungstasten kontrolliert. So kann der Rechner feststellen, ob die
PLAY, REWIND oder FAST FORWARD-Taste gedrückt ist, er kann aber nicht feststellen, um welche
dieser drei Tasten es sich handelt.
Sobald dieTaste PLAY gedrückt ist, kann der Rechner den Motor ein- und ausschalten. Er nutzt dies
aus, um Dateien in einzelne Blöcke zu unterteilen.
Die Struktur einer Datei auf der Kassette sichert Ihnen ein Minimum an Platzverbrauch, kombiniert
mit einem Maximum an Schreibsicherheit. So werden beispielsweise alle Daten zweimal hinter
einandergeschrieben, um bei einer Bandschwäche defekte Daten rekonstruieren zu können.
Geschwindigkeitsschwankungen des Bandes werden durch eine spezielle Anpassungstechnik
ausgeglichen. So wird ein fester Ton zwischen jedem Datenblock und an den Anfang jeder Datei
geschrieben. Durch die Länge dieses Tones stellt der Rechner fest, ob es sich um einen Dateikopf
oder einen Dateiblock handelt.
Ein Dateikopf signalisiert dem Rechner, daß die Kassette an einem Dateianfang positioniert ist. Er
enthält neben dem Dateinamen auch die Information, ob es sich um eine Datei oder ein Programm
handelt.
Um nun den Zugriff auf die Information einer Datei zu beschleunigen, liest Ihr Rechner nicht nur die
gewünschte Information, sondern immer einen kompletten Block von insgesamt 192 Zeichen, da
das Starten und Stoppen des Kassettenmotors nach jeder einzelnen Information zu Zeitaufwendig
ist.
Dieser Block wird in einen Pufferbereich eingelesen und von dort je nach Bedarf in die gewünschten
Variablen gebracht. Beim Schreiben ist das Verfahren umgekehrt. Es werden die Informationen,
so lange in den Puffer gebracht, bis dieser voll ist. Der gesamte Puffer wird dann gemeinsam auf
das Band geschrieben.
Der Pufferbereich befindet sich für Kassette 1 an den Speicherstellen 634 - 825, für die 2. Kas
settenstation von 826 - 1017. Für Programme werden diese Pufferbereiche nicht benutzt, da
Programme nicht in mehreren Blöcken geschrieben werden. Nachfolgend ein Schema, daß Ihnen
zeigt, wie eine Datei und ein Programm auf Kassette aufgezeichnet werden.
43
Page 46

10 Sekunden Festton
192 Zeichen Dateikopf
2 Sekunden Festton
*
*
192 Zeichen Duplikat des Dateikopfes
2 Sekunden Festton
192 Zeichen 1. Datenblock
2 Sekunden Festton
192 Zeichen Duplikat 1. Datenblock
2 Sekunden Festton
192 Zeichen letzter Datenblock
2 Sekunden Festton
192 Zeichen Kopie des letzten
Datenblocks
10 Sekunden Festton
192 Zeichen Programmkopf
2 Sekunden Festton
192 Zeichen Kopie des
Programmkopfes
2 Sekunden Festton
10 - 32768 Byte Programm
* An diesen Stellen bleibt der Kassettenmotor stehen.
- Beispiel für eine Bandaufzeichnung -
2.5.3 EIN- AUSGABEOPERATIONEN BEI LOGISCHEN DATEIEN
Ein- Ausgaben teilen sich in 3 Schritte auf:
* Eröffnen der Datei - Mitteilung aller Informationen über diese physikalische und logische Datei
* Lesen oder
Schreiben der
Daten -
* Schließen der
Datei - Trennen der Verknüpfung von logischer und physikalischer Datei
44
Page 47

Die 3 Teile wollen wir im folgenden beschreiben:
* ERÖFFNEN DER DATEI
Die Eröffnung einer Datei dient dazu, dem Rechner alle Informationen über diese Datei mitzuteilen.
Der Rechner selbst speichert diese Informationen in speziell dafür vorgesehene Tabellen, errichtet
ggf. Pufferbereiche für diese Datei und sorgt dafür, daß diese Datei anhand der angegebenen lo
gischen Adresse zukünftig angesprochen werden kann. Gleichzeitig sendet er Test- und Infor
mationssignale an diese Datei, um ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen und um sie auf Empfangsbzw. Sendebereitschaft zu schalten.
Programmdateien, egal ob auf der Kassette oder auf anderen Geräten halten sich nicht an die
Ein- Ausgabeschritte 1 - 3.
Um ein Programm in den Rechner einzuladen oder vom Rechner wegzuspeichern brauchen Sie
jeweils nur einen einzigen Befehl,
zum Einladen:
LOAD ’’Programmname”, physikalische Adresse
zum Abspeichern:
SAVE ’’Programmname”, physikalische Adresse
* LESEN ODER SCHREIBEN
a) LESEN
Für das Lesen von Informationen einer Datei gibt es 2 Befehle:
INPUT # logische Adresse, Eingabevariable(n)
GET # logische Adresse, Eingabevariable
Der INPUT-Befehl veranlaßt den Rechner, solange zu warten, bis alle angegebenen Eingabe
variablen von der Datei gesandt worden sind.
Im Gegensatz dazu holt der GET-Befehl lediglich ein Zeichen. Sofern kein Zeichen gemeldet ist,
enthält die Eingabevariable eine 0 oder ein Null-Zeichen, je nachdem ob es sich um eine nu
merische oder eine Textvariable handelt. In jedem Fall wird das Programm ohne Pause fort
gesetzt.
b) SCHREIBEN
Das Schreiben von Daten vom Rechner in eine Datei geschieht mit folgendem Befehl:
PRINT Alogische Adresse, Variable(n)
Der PRINT-Befehl veranlaßt den Rechner, die angegebenen Variablen in der Reihenfolge ihres
Auftretens an die Datei zu senden. Der Rechner wartet nach jedem gesandten Zeichen auf eine
Fertigmeldung der Datei. Bleibt diese aus, z. B. durch Defekt des angesprochenen Gerätes, so
„hängt“ der Rechner an dieser Stelle. Nur durch Aus- Einschalten ist eine Reaktivierung möglich.
45
Page 48

Besonderheit für Ausgaben:
Durch
CMD logische Adresse
ist es möglich, fast alle Bildschirmausgaben zu einer anderen Datei zu senden. Ausnahmen
hierbei sind alle über Tastatur eingegebenen Zeichen, sowie Fehlermeldungen des Betriebs
systems. Diese werden nach wie vor auf dem Bildschirm dargestellt. Vorteilhaft ist der CMDBefehl beispielsweise für Programmlisten auf einem angeschlossenen Drucker:
OPEN 1, Druckeradresse (physikalisch)
CMD 1
LIST
PRINT #
CLOSE 1
(Durch den Befehl PRINT # log. Adresse wird ein vorhergehender CMD-Befehl wieder auf
gehoben.)
* SCHLIESSEN EINER DATEI
Geschlossen wird eine Datei durch den Befehl:
CLOSE logische Adresse
Der Pufferbereich des Rechners wird entleert und alle Tabelleneintragungen gelöscht. Die ange
sprochene Datei ist nach dem CLOSE-Befehl logisch getrennt, d.h. die Kabelverbindung existiert
zwar noch, alle Ein- Ausgabebefehle werden aber vom Betriebssystem verweigert.
2.5.4 FEHLERINFORMATION BEI EIN/AUSGABEN
Der Computer besitzt eine Variable ST, die nach einer Ein- Ausgabe eine Fehlerdiagnose bein
haltet. Durch Abfragen dieser Variablen ist es möglich, Fehler rechtzeitig zu entdecken.
Die Variable ST besitzt 8 Bit-Positionen. Jedes Bit beinhaltet eine getrennte Fehlermeldung. Durch
Verknüpfung ist eine Erkennung von mehreren Fehlern möglich.
Folgende Fehlerquellen sind bei angegebenem Gerät erkennbar:
ST
Bit
0 1
1 2
2 4 Zu kurzer Block
3 8 Zu langer Block
4
5 32
6 64
7
ST
Zahlenwert
16 nicht korrigierbarer
- 128
Recorder
-
-
eingelesen
eingelesen
Lesefehler
Prüfsummenfehler
Dateiende
erreicht
Bandende
erreicht
lEEE-Bus
Zeitüberschreitung
beim Schreiben
Zeitüberschreitung
beim Lesen
-
-
-
-
Eingabeende
Gerät nicht
angeschlossen
46
Page 49

Beispiel: Kassette: ST = 36 = 32 + 4
Es wurde ein zu kurzer Block eingelesen. Dadurch kam es zu einem Prüfsummenfehler.
Wie sie sehen, ist eine gleichzeitige Erkennung mehrerer Fehler möglich.
2.6. Der IEC-Bus (IEEE-BUS)
Der IEC-Bus besteht aus 8 Datenleitungen, 3 Steuerleitungen und 5 Informationsleitungen.
Die Datenleitungen übertragen die eigentliche Information. Die Handshake-Leitungen sind zur
Synchronisierung der Dateninformation zwischen Sender und Empfänger.
Der IEC-Bus benutzt ein Dreidraht-Handshake-Verfahren.
Der Ablauf geschieht folgendermaßen:
Nicht größer als 64 msek.
empfangsbereit
nicht empfangsbereit
Daten nicht gültig
Daten stehen an
Daten empfangen
Daten (noch) nicht empfangen
Bit (Wert = 0)
Hochohmig
Bit (Wert = 1 )
Der Sender steht permanent auf Sendebereitschaft. Meldet der Empfänger, daß er empfangsbereit
ist (1 ), so stellt der Sender die Daten auf dem Datenbus zur Verfügung (2). Er meldet diese Bereit
stellung durch die Meldung „Data valid“ (Daten gültig) (3).
Sobald der Empfänger das DAV-Signal empfängt, nimmt er die Daten-Empfangsbereitschaft weg
und meldet damit dem Sender, daß er vorläufig noch keine neuen Daten gebrauchen kann (4). Nach
einer kurzen Verzögerungszeit, die vom inneren Aufbau des Empfängers abhängt, hat er diese
Daten übernommen und meldet über die NDAC-Leitung diese Tatsache (5) an den Sender zurück.
Daraufhin kann der Sender die Daten und das DAV-Signal vom Bus wegnehmen (6) (8). Wenn
das DAV-Signal verschwunden ist, nimmt der Empfängerauch das NDAC-Signal weg (7); damit ist
ein Übertragungszyklus beendet und der Bus ist in seinem Ruhestand.
Wenn der Empfänger jetzt die nächsten 8 bit aufnehmen kann, meldet er das über die NRFD-
Leitung und der nächste Zyklus kann beginnen.
Die 5 Informationsleitungen haben folgende Bedeutung:
- IFC-Interface clear
Über diese Leitung sendet Ihr Rechner beim Einschalten ein allgemeines Rücksetzsignal
(100 msec), mit dem sich alle angeschlossenen Geräte ebenfalls in den Einschaltezustand ver
setzen können.
- REN - Remote enable
Diese Leitung dient im allgemeinen dazu, Handbedienungen von angeschlossenen Geräten
zu verweigern. Bei Ihrem Computer ist diese Leitung gegen Masse kurzgeschlossen.
47
Page 50

- SRQ - Service Request
Über diese Leitungen können angeschlossene Geräte zu sendende Informationen anmelden.
Diese Leitung wird zwar vom Betriebssystem des Rechners nicht abgefragt, Sie jedoch können
mit dem Befehl
? (PEEK(59427)AND128)/128
diese Leitung auf 0 oder 1 abfragen.
- ATN - Attention
Der Rechner hält diese Leitung auf logisch 0, während er Adressen oder Befehl über die Daten
leitungen sendet. Ist diese Leitung logisch 1, so befinden sich Daten auf diesen Leitungen.
- EOI - End or Identify
Das EOl-Signal hat, wie der Name sagt, zwei Funktionen: 1. wird mit ihm das Ende einer Block
übertragung angezeigt und 2. wird es bei der Identifizierung von Geräten benutzt. Die letztere
Anwendung ist allerdings bei Ihrem Computer nicht eingebaut.
Das „Ende“-Signal wird vom Rechner zusammen mit dem letzten Zeichen eines Datenblocks über
tragen und dient dazu, eine Geräteadressierung wieder aufzuheben.
Folgende Kombinationen von ATN und EOI können auftreten:
ATN
Alle Daten-, Handshake- und Informationsleitungen haben TTL-Pegel.
EOI
0 0 Normale Datenübertragung
0
1
1 1
1
Letztes Datenbyte eines Blockes
0 Übertragung einer Geräteadresse oder eines Gerätebefehls
Aufforderung zur Identifizierung nach einer SRQ-Anfrage
(bei Ihrem Modell nicht verwendet)
3. Wieso versteht der Computer die Sprache BASIC
3.1 Die Sprache der Zentraleinheit
Die Zentraleinheit des Computers ist ein Mikroprozessor Typ 6502. Es ist einer der schnellsten zur
Zeit auf dem Markt befindlichen 8 Bit Prozessoren.
Der Befehlsvorrat dieses Prozessors ist jedoch nicht mit dem Befehlsvorrat von BASIC zu ver
wechseln. Eine BASIC-Zeile kann viele tausend Prozessorbefehle zur Folge haben.
BASIC nennt man eine höhere Programmiersprache. Zum Unterschied zur Maschinensprache
versteht fast jeder Rechner BASIC, während die Maschinensprache speziell auf den Prozessor zu
geschnitten ist. Der Computer interpretiert die BASIC-Befehle, er führt sie jedoch nicht direkt aus.
Ihr Rechner hat also einen BASIC-Interpreter. Zusätzlich ist es aber auch möglich, kleinere Pro
gramme direkt in der Maschinensprache zu schreiben. Wir wollen Ihnen nachfolgend ein kleines
Beispiel dazu zeigen, ohne jedoch tiefer auf die Maschinensprache einzugehen.
Unser Maschinenprogramm soll uns eine beliebige Integerzahl in eine Binärzahl, so wie sie im
Arbeitsspeicher steht, umwandeln und auf dem Bildschirm anzeigen.
48
Page 51

3.2. Der innere Aufbau des cbm
Nachfolgend sehen Sie ein Blockdiagramm Ihres Computers.
Alle Schnittstellen, auch für IEC-Bus, Kassette, Bildschirm, Tastatur sind mit dem Adressbus des
Prozessors verbunden.
Es ist tatsächlich so, daß alle Schnittstellen im Rechnerwie Speicherstellen behandelt werden, d. h.
der IEC-Bus ist nicht hardware - sondern softwaremäßig realisiert. Ebenso wird die Dekodierung
der Tastatur per Programm durchgeführt.
Zwar ist die Entwicklung des Betriebssystems für solch eine Lösung nicht gering, gleichzeitig ist
aber ein solches System sehr flexibel, da lediglich eine Änderung des Programmes nötig ist, um
z. B. eine völlig andere Tastatur an den Rechner anzuschließen.
49
Page 52

MICROPROZESSOR
6502
(CPU)
Adress- und Datenbus
.•>
' • '.'
ROM
RAM
'
BILDSCHIRM-
RAM
TASTATUR
•
PERIPHERIE
BAUSTEINE
USER-PORT
IEEE-488
3.3. Der logische Aufbau des Speichers
Aufgebaut ist der Adressbereich des Rechners in 256 Blöcke von je 256 Byte. Das sind insgesamt
64 KB, die der Prozessor 6502 addressieren kann.
Die Unterteilung in 256 Blöcke, sogenannte Pages (Seiten) entsteht dadurch, daß der Adressbus
in 2 getrennte Busse von je 8 bit aufgeteilt ist. Die Pages 0,1 und 255 nehmen in diesem Zusammen
hang eine Sonderstellung ein.
Page 0 dient hauptsächlich zur schnellen Verarbeitung und Speicherung von Daten. Zur Speiche
rung von Programmen ist sie weniger geeignet.
Page 1 ist prozessorbedingt zum Zwischenspeichern von Adressen und Registerdaten reserviert.
In diesen Bereich sollten keine Daten willkürlich geschrieben werden, da der Rechner diesen
Bereich permanent benötigt und verwaltet.
In Page 255 sind die letzten 6 Bytes als Sprungadressen für Unterbrechungen oder Einschalt
vorgänge reserviert. Da dieser Bereich jedoch ohnehin durch ein ROM belegt ist, haben Sie keiner
lei Einfluß auf diese Speicherstellen.
50
Page 53

1024
o
Betriebssystem und
Basic Interpreter
8192
16384
32767
32768
33792
34816
35840
36864
49152
59392
RAM
RAM 16K cbm
RAM 32K cbm
Basic Programm
_______________________
Variablen
Bildschirm
Images of TV RAM
Images of TV RAM
Images of TV RAM
12K ROM Erweiterung
ROM BASIC
61440
65536
I/O
ROM Betriebssystem
3.3.1 DER BILDSCHIRMBEREICH
Ab der Speicherstelle 32768 ist der Bildschirminhalt abgespeichert. Es gibt nun die verschiedensten
Möglichkeiten, eine Information anzuzeigen. Einige davon stellen wir Ihnen nachfolgend vor. Jede
Möglichkeit hat ihre Vor- und Nachteile. Sie sollten sich je nach Aufgabenstellung für die eine oder
andere Möglichkeit entscheiden, oder eine Kombination wählen.
51
Page 54

a) Relative Steuerung durch Print und Cursorsteuertasten sowie TAB ( ) und SPC ( ).
Die Befehle TAB ( ) und SPC ( ) sind in Kapitel 1.2.5 beschrieben. Zusätzlich haben Sie die
Möglichkeit, den Cursor per Programm genauso wie von Hand zu steuern.
Beispiel: 10 REM ” H ” = CURSOR CLR/HOME
12 REM ”Q ” = CURSOR NACH UNTEN
14 REM ”3 ” = CURSOR NACH RECHTS
16 PRINT QQJA”
18 END
Sie geben also nach dem Anführungszeichen die gleiche Tastenfolge vor wie von Hand und be
enden die Zeichenfolge mit einem 2. Anführungszeichen.
Bemerkung:
Alle Steuertasten mit Ausnahme der DELETE-Taste werden innerhalb von Anführungszeichen
nicht ausgeführt sondern für eine spätere Ausführung abgespeichert.
b) Absolute Cursorsteuerung über Unterprogramm
Mit Hilfe des nachstehend aufgeführten Unterprogramms haben Sie die Möglichkeit, eine be
stimmte Stelle im Bildschirm anzusteuern. Dazu geben Sie die Zeile invariablen Z und die Spalte
in der Variablen S an. Anschließend springen Sie mit GOSUB an den Anfang des Unterpro
grammes.
Unterprogramm:
100 REM UNTERPROGRAMM zur Cursor-Steuerung
110 POKE 198,S-1
120 POKE 215,Z-1
130 POKE 197, INT (40* (Z-1)/256) + 128
140 POKE 196, (40*(Z-1)) AND 255
150 RETURN
Beispiel: 10 PRINT
20 Z = 4 : S = 3 : GOSUB 100
30 PRINT ”A”
40 END
c) Direktes Schreiben in den Bildschirm
Die 1000 Plätze des Bildschirms entsprechen den RAM-Speicherplätzen 32768 (erstes
Zeichen) bis 33767 (1000. Zeichen).
Die restlichen 24 Plätze im RAM (33768 bis 33791) können vom Benutzer belegt werden, werden
aber mit CLR (Bildschirm löschen) jedesmal mitgelöscht.
Mit dem POKE-Befehl ist es möglich, eine bestimmte Stelle im Bildschirm zu beschreiben oder mit
dem PEEK-Befehl zu lesen.
Beispiel: POKE 33111,160
Beachten Sie jedoch, daß der Code im Bildschirm nicht mit dem ASCII-Code identisch ist. Siehe 2.1.
Zum Abschluß ein Vergleich der 3 aufgeführten Verfahren:
52
Page 55

Verfahren 1
PRINT/SPC/Cursor
Steuertasten
Verfahren 2
Unterprogramm
Vorgabe Z/S
Verfahren 3
POKE-Befehl
Geschwindigkeit
Bildschirmgüte
CODE
Steuer
geschwindigkeit
Ansprechen eines
best. Punktes
Anwendung:
mittel langsam
mittel gut
ASCII
langsam
langsam
Schreiben
ASCII + Zeile + Spalte
mittel
mittel
Einschreiben in
vorgegebene Formen
schnell
schlecht
Bildschirmcode
schnell
schnell
spez. Anwendungen
3.3.2 EIN- AUSGABEBEREICHE
Von Speicherstelle 59392 bis 61440 befinden sich die Ein-Ausgabebereiche für die Peripherie
(Tastatur, Kassette, IEC-Bus, 8 Bit-Port sowie Steuerteile des Bildschirms), wobei bei manchen
Bytes jedes Bit eine andere Funktion haben kann.
ACHTUNG:
Das willkürliche Beschreiben oder Lesen dieser Speicherstellen mit POKE oder PEEK kann un
kontrollierbare Erscheinungen des Rechners zur Folge haben. Dieser Zustand kann nur durch Ausund Einschalten beendet werden.
CHIP: 6520
CHIP: 6520
Registername
PIAL
PIAL1
PIAK
PIAS
Registername Hex. Adresse Dez. Adresse
IEEI $E820 59424
IEEIS
IEEO
IEEOS $E823
Hex. Adresse Dez. Adresse
$E810 59408
$E811 59409
$E812
$E813
$E821
$E822 59426
59410
59411
59425
59427
53
Page 56

CHIP: 6522
Registername Hex. Adresse Dez. Adresse
PIA
SYNC $E841
P2DB $E842
P2DA
TIL $E844
Tl H
TILL
TILH
T2L
T2H
SR $E84A
ACR $E84B 59467
PCR $E84C 59468
IFR
1ER $E84E 59470
SYNC1 $E84F
Näheres siehe: cbm 3016 und 3032 ASSEMBLER LISTING (erhältlich beim Commodore-Vertrags-
händler).
$E840 59456
59457
59458
$E843 59459
59460
$E845 59461
$E846 59462
$E847
$E848 59464
$E849
$E84D
59463
59465
59466
59469
59471
54
Page 57

3.3.3 DER BEREICH DES BETRIEBSSYSTEMS
Im Speicherbereich 61440—65535 befinden sich die Maschinensprachenprogramme für die
spezielle Bedienung Ihrer Rechnerkonfiguration wie z. B. Anzeigen eines Zeichens im Bildschirm
oder Empfangen eines Zeichens von der Tastatur.
Ebenfalls befinden sich in diesem Bereich gewisse Testroutinen, die die ordnungsgemäße Arbeit
Ihres Rechners überprüfen.
Beispiel: SYS (65490)
(Drucken eines Zeichens im Bildschirm)
Beispiel: SYS (65487)
(Eingabe von Zeichen über Tastatur und Drucken dieser Zeichen im Bildschirm bis
RETURN gedrückt wird.)
55
Page 58

3.3.4 DER BEREICH DES BASIC INTERPRETERS
Der Basic-Interpreter ist das A und O Ihrer ganzen Anlage. Durch ihn erst ist es möglich, daß Sie
einen Sinus berechnen können, oder bestimmte Werte abspeichern und jederzeit wiederfinden.
Die Programme dieses Interpreters befinden sich an den Speicherstellen 49152 bis 57343. Diesen
Bereich können Sie im Gegensatz zu dem restlichen Speicher mit PEEK nicht abfragen . . . ver
ständlich, da Erstellungszeit und Kosten immens waren. Das Copyright für diesen Interpreter liegt
bei der Firma Microsoft.
3.3.5 Dieser Interpreter braucht natürlich auch einen gewissen Bereich, wo er Daten und Informationen
Zwischenspeichern kann. Er benutzt dazu die Speicherstellen 0-1023. Dieser Bereich steht nicht
frei zur Verfügung. Aus diesem Grunde haben Sie bei Ihrem Modell cbm auch nicht 32768 Bytes
frei, sondern 32768 -1025 = 31743 Bytes.
Im folgenden finden Sie eine Liste der Belegung der Speicherstellen 0-1023.
cbm SPEICHERBELEGUNG: PAGE 0
(Nicht aufgeführte Adressen werden gebraucht, haben aber keine eindeutige Funktion.)
! VORLÄUFIGE SPEZIFIKATION - ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN!
0
1 2
3
5
Konstante $4C (JMP-Befehl in Maschinensprache)
Vektor für USR-Funktion L,H
Anfang-Trennungszeichen
Hilfszähler für BASIC
6
7
8
9
10
11
12
13
14 Aktiver I/O-Kanal
15 Zeilenlänge des Terminals
16
17
19
20 21
22
30 31
32 33
34 39
40
42 43
44 45
46
48
50 51
52
54
54 55 # der gerade ausgeführten Zeile; L,H
56 57 Zeilen# fürCONT; L,H
58 59 Zeiger auf den nächsten Befehl; L,H
60 61 # der DATA-Zeile bei ERROR; L,H
62
64 65 Herkunft des Input; L,H
66
68 69 Zeiger auf die laufenden Variablen; L,H
70 71
72
Flag für dimensionierte Variablen
Flag für Variablenart (0 = numerisch; 1 = String)
Flag für Integervariablen
Flag für ” und REM
Flag, ob Indizes erlaubt sind
Flag für INPUT oder READ
Flag für Vorzeichen von TAN
Flag, ob OUTPUT unterdrückt wird
Maximale Anzahl Zeichen pro BASIC-Zeile
Zeilen# (Zwischenspeicher)
18
Zeigt auf nächsten Descriptor
Zeiger auf den zuletzt benutzten String
Tabelle der Descriptoren für Variablen (je 2 Bytes)
29
Indirekter Index # 1 ,L,H
Indirekter Index # 2,L,H
Pseudoregister für Operanden von Funktionen
Zeiger auf den Beginn der BASIC-Befehle; L,H
41
Zeiger auf den Beginn der Variablentabelle; L,H
Zeiger auf den Beginn der Array-Tabelle; L,H
Zeiger auf das Ende der Variablentabelle; L,H
47
Zeiger auf Ende des letzten Strings; L,H
49
Zeiger auf den Beginn der Strings; L,H
Zeiger auf höchste RAM-Adresse; L,H
53
ist 2, wenn ein direkter Befehl ausgeführt wird
Zeiger auf nächstes DATA; L,H
63
67 Name der laufenden Variablen (1. und 2. Zeichen)
Zeiger auf die laufende FOR-NEXT-Variable; L,H
73 Zeiger auf den laufenden Operator; L,H
56
Page 59

74
75
77
79
80
81
82
84
90
92
94
100
101
102
108
109
110
112
118
119
136
141
144
146
148
150
151
152
153
155
157
158
159
160
167
168
169
170
171
174
175
176
177
178
186
187
189
190
193
194
195
196
198
199
201
203
205
206
209
210
Maske für laufenden Operator (>, = ,<)
76 Zeiger auf DEFFN; L,H
78 Zeiger auf den String-Descriptor; L,H
Länge des obigen Strings
Konstante
$2C (Konstante für INPUT)
83 Vektor für Funktionen; L,H
89 Fließkommaakkumulator #3
91 Zeiger #1 für Blocktransfer; L,H
93 Zeiger #2 für Blocktransfer; L,H
99 Fließkommaakkumulator #1 (u. a. für USR)
Vorzeichen der Mantisse aus Akku #1
Zählt die zum Normalisieren von Akku #1 nötigen Shifts
107 Fließkommaakkumulator #2
Overflowbytes des Arguments aus Akku #2
Vorzeichen der Mantisse aus Akku #2
111 Zeiger auf ASCII-Darstellung des Akku #2; L,H
135 CHRGET-Routine. Holt nächstes Zeichen des BASIC-Textes
Label CHRGOT
120 Zeiger auf nächstes Zeichen des BASIC-Textes
140 Nächste Zufallszahl
143 24h-Uhr in 1/60 Sekunden
145 IRQ-Vektor (interrupt request) für internen Interrupt
147 BRK-Vektor
149 NMI-Vektor (nicht maskierbarer Interrupt)
I/O-Status
Letzte Taste
Flag für SHIFT (1 bei gedrückter Taste, sonst 0)
154 Korrekturfaktor für die Uhr
156 *
Flag für VERIFY
Anzahl Bytes im Tastaturpuffer (ab 623)
RVS-Flag
166 *
Flag für Cursor ein/aus
Zähler für die Blinkdauer des Cursors
★
Zwischenspeicher für Zeichen während Blinken des Cursors
173 *
Zeiger in die Tabelle der logischen Files
Ersatzparameter (Geräte# für INPUT)
Ersatzparameter (Geräte# für OUTPUT)
Paritätsbyte für Band
185 *
Zur Synchronisation beim Lesen
188 Zeiger auf den aktiven Recorder
*
192 Fehlerkorrektur
*
Flag für Lesen von Kassette
Dauer der ’’shorts” vor dem Schreiben von Daten
197 Adresse der Position des Cursors
Cursorspalte
200 Startadresse für LOAD
202 Endadresse für LOAD
204 *
Flag für ”
208 *
Länge des laufenden Files
logische # des laufenden Files
57
Page 60

211
212
213
218 219
220 221
222
223
224
249
Sekundäradresse des laufenden Files
Primäradresse des laufenden Files
*
217
Adresse des laufenden Filenames
*
Blockzähler für Recorder (Lesen)
*
248
Tabelle der LSB’s der Zeilenanfänge (Bildschirm)
255
cbm PAGE 1
256-317 (dezimal) werden zur Fehlerkorrektur beim Lesen vom Band benutzt, sowie als Puffer
für Zeilenumwandlungen. Der Rest von Page 1 dient als Speicher im Zusammenhang mit GOSUB
und FOR-NEXT, sowie als Hardware-Stack.
cbm PAGE 2
(Nicht aufgeführte Adressen werden gebraucht, haben aber keine eindeutige Funktion).
! VORLÄUFIGE SPEZIFIKATION - ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN !
512 592 BASIC-Input-Puffer
512 513 Programmzähler des 6502
514 Statusregister des Prozessors
515 Akkumulatorinhalt
516
517 Y Register
518 Stapelzeiger
519 520
593 602 Tabelle der Filenummern
603 612 Tabelle der Gerätenummern
613 622 Tabelle der Sekundäradressen
623 633
634
826
1018 1023
X Register
IRQ-Vektor für externen Interrupt
Tastaturpuffer (Anzahl Zeichen steht in 158)
825 Puffer für Recorder# 1
1017
Puffer für Recorder#2
*
3.3.6 SPEICHERUNG VON PROGRAMMEN
Eine Programmzeile besteht aus Zeilennummer und Befehlen. Alle Programmzeilen werden in
Reihenfolge der Zeilennummer von 1024 an aufwärts folgendermaßen gespeichert (n ist die
Zeilennummer, (n + x) ist die auf n folgende Zeilennummer):
Das erste Byte ist Null. (An).
Es folgen 2 Bytes (Bn; Cn). Sie stellen die Verbindung zur nächsten Programmzeile her. Der Wert
Bn + 256 * Cn gibt die Adresse an, in der die Größe B
steht. Sind Bn und Cn beide Null, dann ist
n + x
n die letzte Zeilennummer des Programms.
Die nächsten zwei Bytes (Dn; En) geben die Zeilennummer an: Zeilennummer = Dn + 256 * En.
Es folgen die BASIC-Befehle (codiert in 1 Byte pro Befehl bzw. 1 Byte pro Zeichen. Die Codeliste
steht im Anhang unter Interpretercode).
58
Page 61

Beispiel: Das Programm
1000 PRINTX
2000 GOT01000
wird folgendermaßen gespeichert:
0 8
1024
A
1025
B
I
Verbindungsglied
4
1026
C
i
D
|
232
1027
Zeilen #
3 153 88
1028 1029
_E ,
PRINT X
1030
Inhalt
Speicherstelle
Übersetzung
1
0
1031
18
1032
A B C , D E
Verbindungsglied
4
208
7
1033 1034 1035
Zeilen #
137 49
1036 1037
GOTO
48 48
1038 1039
1
0 0 0
1
0 0 0
1041 1042 1043
ABC
3.3.7 Es stellt sich nun die Frage, wie der Rechner die Variablen verwaltet, die Sie eingeben.
Nehmen wir an, Sie haben den Rechner eingeschaltet und geben ein:
A$ = ’’ICH BIN DAS MODELL CBM”
Der Rechner meldet:
READY
Die Stelle, wo der Text „ICH BIN DAS MODELL CBM” steht, können Sie nun folgendermaßen
finden:
PRINT PEEK (42) + PEEK (43) *256 + 2
Antwort: 1029
An der Speicherstelle 1030 steht in diesem Fall, wie lang der eingegebene Text ist. Die beiden
nachfolgenden Speicherstellen geben an, wo der Text steht.
? PEEK (1029), PEEK (1030) + PEEK (1031) * 256
Antwort: 23 8169
Der Text ist also 23 Stellen lang und steht ab Speicherstelle 8169.
Geben Sie ein:
FOR I = 8169 TO 8169 + 22: PRINT CHR$ (PEEK(I));:NEXTI
Antwort: ICH BIN DAS MODELL CBM
Sie haben gesehen, welche Vorgänge der BASIC-Interpreter durchführt, um eine Variable wieder
zufinden.
In den Speicherstellen 124, 125 und 1031, 1032 stehen in unserem Beispiel sogenannte Pointer
(Zeiger).
Pointer sind Informationen, die angeben, wo eine gesuchte Information steht.
1-Byte-Pointer können Werte von 0-255 annehmen. Um beispielsweise auf die Speicherstelle 8169
zeigen zu können, benötigt man 2-Byte-Pointer. 2-Byte-Pointer sind wie folgt verschlüsselt:
Speicherstelle = X + 256 * (x + 1)
X und x + 1 sind die Inhalte zweier aufeinanderfolgender Speicherstellen.
Nachfolgend eine Tabelle des Speicherplatzes und dessen Aufteilung mit Angabe der Pointer für
diese Aufteilung.
48
1040
59
Page 62

RAM-ZUTEILUNG UND POINTER
oo
o
in
m
co
o>
CD
m
CM
co
Tf
Obergrenze
RAM
Beginn der
Strings
co
CO
ü)
c
"v—
CO
c
‘<D
CD
P
0
LL
C
0)
-Q
CO
CO
CD
cg
CO
o
o
f^.
CM
CO
in
N-
CO
CM
05
o
1
CM
co
CO
CD
LU
LU LU
CL CL
* +
CD
ID
CM
■X .
LU
o
Tj-
CO
c
0
CD
CO ®
< 0
CD CD
M—
3.4 WIE EIN PROGRAMM ABLAUFT
Sobald Sie RUN eingegeben haben, beginnt der Rechner die Abarbeitung der Befehle in auf
steigender Reihenfolge. Einen Befehl erkennt der Rechner an seiner Abkürzung als Zahl von 128
bis 202 (siehe Interpretercode). Findet er einen solchen Befehl, so führt er diesen Befehl aus. Wenn
er einen Befehl ausführen soll, so prüft er, ob weitere Informationen zu diesem Befehl nötig sind.
io
CM
o
0
I
0
'o_
CO
'0
CD
60
Page 63

Wenn ja, so holt er sich diese Informationen aus dem Speicher. Wenn nein, so führt er den ange
gebenen Befehl sofort aus. Sollte der Interpreter hierbei einen Fehler feststellen, so zeigt er diesen
an und beendet seine Arbeit.
Stellt nun der Interpreter eine Variable fest, so sucht er diese in seiner Variablenliste. Findet er sie
dabei nicht, so legt er sie neu an. Dabei verschiebt er mitunter seinen kompletten Speicher mehrere
hundert Mal. Hat er einmal eine Variable angelegt, so findet er sie immer wieder. Auch nach Be
endigung des Programms stehen die Variablen zur Verfügung, bis Sie entweder mit RUN das
Programm neu starten oder das Programm ändern.
4. TIM: MONITOR FÜR DIE MASCHINENSPRACHE
TIM (Terminal Interface Monitor) wurde für die Mikroprozessoren der Serie 65xx entwickelt.
TIM BEFEHLE
M display memory;
R display register;
G begin execution;
X exit to BASIC;
L load;
S save;
Anzeige des Speicherinhalts
Anzeige der Registerinhalte
Ausführung eines Programmes in Maschinensprache
Rückkehr zu BASIC
Laden eines Programms von Kassette
Überspielen eines Programms auf Kassette
TIM UNTERPROGRAMME
JSR
JSR
JSR
JSR
JSR
JSR
JSR
JSR
WRT
RDT
GET
CRLF
SPACE
WROB
RDOB
HEXIT
$FFD2 type a character; Ausgabe eines Zeichens
$FFCF input a character; Eingabe eines Zeichens
$FFE4
$FDD0
$FDCD
$E775
$E7B6
$E7E0 ASCII to hex in A;
get a character;
type a CR;
type a space;
type a byte;
read a byte;
Holen eines Zeichens
Schreibe CR = CHR$(13)
Schreibe Zwischenraum = CHR$(32)
Schreiben eines Bytes
Lesen eines Bytes
Umwandlung ASCII-Code nach hexadezimal
TIM ZAHLENSYSTEM
Generell hexadezimale Ein- und Ausgabe.
ANZEIGE DES SPEICHERINHALTS .M XXXX YYYY
Anfangsadresse (XXXX) und Endadresse (YYYY) müssen vollständig (als vierziffrige HexZahlen) angegeben werden.
Um den Inhalt einer Speicherzelle zu verändern, wird der Cursor an die entsprechende Stelle
bewegt, dann die Korrektur vorgenommen und mit der Taste RETURN bestätigt.
Beispiel: . M C000, C010
0
C000
C008 C5 CA DF
C010
1D
9C
1
2 3
C7 48 C6
CA 70
C7
9C
C8
4
5 6
CF
EF C7
23
35 CC
74 C7 1F
7
CB
C8
61
Page 64

ANZEIGE DER REGISTERINHALTE .R
Die Inhalte der Register der CPU (Central processing unit, 6502) werden angezeigt:
PC Programmzähler (program counter)
IRQ Interruptvektor
SR Statusregister des Prozessors
AC Akkumulator
XR Indexregister X
YR Indexregister Y
SP Stapelzeiger (stack pointer)
Beispiel: .R
PC IRQ SR AC XR YR SP
0401 E62E 32 04 5E 00 EE
Änderungen können wie bei . M mit Hilfe des Cursors und der Taste RETURN vorgenommen
werden. Bei jedem Eintritt (von BASIC nach TIM) werden die Registerinhalte gespeichert und bei
der Rückkehr (von TIM nach BASIC) wiederhergestellt.
PROGRAMMAUSFÜHRUNG .G XXXX
Der Go-Befehl bewirkt einen Sprung zu der durch XXXX angegebenen Adresse. Wird XXXX
nicht eingegeben, so dient der Inhalt des Programmzählers PC als Zieladresse.
Beispiel: . G C38B bewirkt Sprung nach C38B
EXIT-RÜCKKEHR ZU BASIC .X
. X bewirkt einen Rücksprung nach BASIC. Die Speicherinhalte bleiben dabei unverändert, und
BASIC befindet sich im selben Zustand wie vor dem Aufruf des Monitors.
LOAD - EINLESEN DES PROGRAMMS VON KASSETTE .L ’’NAME”, XX
XX steht für die Nummer des Peripheriegeräts, Gerätenummer und Filename müssen angegeben
werden. Das OS (Operating system) reagiert wie bei BASIC. Die mit dem SAVE-Befehl definierten
Speicheradressen werden geladen.
Unterprogramme in Maschinensprache können auch von BASIC geladen werden. Dabei ist aber
zu beachten, daß der Variablenpointer auf das zuletzt geladene Byte plus eins zeigt. Daher dürfen
BAS IC-Variablen nach LOAD nicht verwendet werden. Will man nach LOAD mit BASIC Weiter
arbeiten, so muß zuerst ein erneuter Sprung zum TIM erfolgen, dann eine ordnungsgemäße
Rückkehr (RUN, dann .X).
Beispiel: ,L”NAME”,01
PRESS PLAY ON TAPE # 1
OK
SEARCHING FOR NAME
FOUND NAME
LOADING
SAVE - SPEICHERN EINES PROGRAMMS .S ’’NAME”,XX, YYYY, ZZZZ
XX steht für die Nummer des Peripheriegeräts (siehe . L). YYYY ist die hexadezimale Anfangs
adresse des aufzunehmenden Programms und ZZZZ die Endadresse plus eins.
Beispiel: .S ’’NAME”, 01, 033A, 076B
PRESS PLAY & RECORD ON TAPE # 1
OK
WRITING NAME
076B ist Endadresse plus eins, das letzte Datenbyte befindet sich also in 076A.
62
Page 65

BREAK UND INTERRUPTS
Der Maschinenbefehl BRK ($00) bewirkt einen Software-Interrupt. Dies bedeutet, daß der Pro
zessor das gegenwärtige Programm unterbricht, (PC+2) und SR auf dem Stapel ablegt und dann
an eine Stelle verzweigt, die durch den Vektor in $021B und $021C gegeben ist. TIM initialisiert
diesen Vektor in der Weise, daß er auf TIM zeigt. Nach einem BRK-Befehl übernimmt TIM daher die
Kontrolle, druckt B* aus (entry via breakpoint - im Gegensatz zu C*, entry via call), zeigt die Re
gisterinhalte an und wartet auf Befehle vom Operator.
Der oben erwähnte Vektor kann auch verändert werden, etwa um auf eine spezielle Routine zu ver
zweigen.
Beachten Sie: 1 ) Nach einem BRK, der auf TIM verzweigt, zeigt der PC auf das dem BRK-Befehl
folgende Byte.
2) Bei einem BRK, der nicht auf TIM verzweigt, zeigt der PC nach der Rückkehr
(via RTI) auf das zweite Byte nach dem BRK-Befehl.
AUFRUF VON TIM
Nach dem Laden des Programms kann TIM entweder mit dem Befehl
SYS 64785
oder mit dem Befehl
SYS (1024)
aufgerufen werden. Der erste Fall stellt einen ’’entry by call” dar, der zweite einen ’’entry via break
point”. (Die Speicherzelle 1024 enthällt Null).
BEISPIEL:
Das folgende Programm mit dem Namen CHSET schreibt 64 ASCII-Zeichen auf dem Bildschirm.
Es soll im Puffer für Recorder # 2 gespeichert werden:
* = $33A
CRLF = $FD00
WRT = $FFD2
33A 20 00 FD CHSET
33D A2 20 LDX # $20
33 F 8A LOOP
20 D2 FF JSR WRT
340
343 E8
344 E0 60 CPX #$60
D0F7
346
348 00
349
4C 3A 03
Um dieses Programm einzugeben, werden mit dem Befehl
.M 033A, 034B
die betreffenden Speicherinhalte zur Anzeige gebracht und geändert. Schließlich erhält man die
Anzeige:
.M 033A, 034B
. : 033A 00 FD 04 A2 20 8A 20 D2
. : 0342 FF E8 E0 60 D0 F7 00 4C
.: 034A3A03
JSR CRLF
TXA
INX
BNELOOP
BRK
JMP CHSET
63
Page 66

Der Befehl:
. G 033A
bringt das Programm jetzt zur Ausführung:
!”H$%& ()|+,-. /0123456789 : ; <=>?§ABCDEFG
HIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[/]t<—!
Beachten Sie den Inhalt des Programmzählers (siehe BREAK und INTERRUPTS). Es ist jetzt
möglich, ohne Angabe der Anfangsadresse das Programm mit dem Befehl:
.G
nochmals zu starten.
Um CHSET von BASIC aus aufrufen zu können, ersetzt man zunächst die BRK-Anweisung in
$348 durch ein RTS (return from subroutine). $348 wird also von 00 auf 60 geändert.
CHSET kann nun von BASIC aus mit SYS826 aufgerufen werden.
Will man den Befehl USR verwenden, so ändert man den zugehörigen USR-Vektor in $1 und $2
dermaßen, daß er auf die Subroutine CHSET zeigt:
. M 0001, 0002
0 1 ....
0001 3A 03 ....
Nach der Rückkehr zu BASIC (. X) kann CHSET somit jederzeit mit SYS826 oder A = USR(0)
auf gerufen werden.
64
Page 67

RESIDENT
MONITOR......PAGE 0801
LINE • LOC
CODE
LINE
2514 FD 11 /COPYRIGHT 1928 BY
?M5 F D 1 1
2517 FD 1 1
2518
2519
2520
FD 1 1 A 9 43 CALLE LD A» ' C
F D 1 385 85
F D 1 5D 0 16
iCOMMODORE INTERNATIONAL LIMITED
NCMDS = 8
ST A
TMPC
BNE
83
252 1 FD 1 7 A 942 B R K E LD A* ' B
2522
FD 1 9 85 85
2523 FD 1 BD 8
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2538
FD1C 4 A
FD 1 D68
68
05 02
04
02
FD IE 8 D
F D 2 1
F D 2 28 D
F B 2 568
F D 2 68 D83 82
253 1 F D 2 968
2532
2533
2534
F D 2 A
F D 2 D68
FD2E 69
8 D
82
FF
82
2535 F D 3 08 D0 1 82
2536
2537 F D 3 4
2538
2539
2540
254 1
2542 F D 4 0
2543
2544
2545 F D 4 7
2546
2547
2548
2549
2550
255 1 FD 5 4
F D 3 368
FF
69
F D 3 68 Ds e
F D 3 9A 5
FD 3 B
8 D
82 STA
90
82
08
FD3E A 59 1
07 02 STA
8 D
F D 4 38 A
F D 4 48 E 06 02 S T XSP
58
F D 4 820 D 0
F D 4 BA 6B 5
FD 4 DA 9
F 0 4 F
F D 3 2
2 A
84 E 7 JS R
20
A 9
52 LDA # ' R ; DISPLAY REGISTERS COMMAND
D 0 1 A BNE
B 3
FT B5 JS RC RL F ; PRINT ENTRY DATA
STA
TMPC
CL D
LS RA
PLA
STA YR
PLA
STA XR
PLA
STA
ACC
PLA
STA
F L G S ; S AVE FLAGS
PLA
A D C1 $ F F
STA
PCL
PLA
AD C1 $F F
P CH
LDA C I H V ; S AV E C U U R E H T IRQ VECTOR
STA
LDA
I N V L
C I N V + 1
I N V H
TSX ; S A V E CURRENT STACK POINTER
CL I
LDX
LDA
TMPC
# ' *
y R T U 0
S 0
;CALL ENTRY
; BREAK ENTRY
;C SET FOR PC CORRECTION
; S A V E Y
/SAVE X
; S AVE ACCUMULATOR
; P C- 1 FOR BREAK
; CLEAR INTERRUPT DISABLE
; T Y P E OF ENTRY (B OR C>
; y R T T E '*C' OR '*B'
; S KIP TO INTERPRET COMMAND
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
F D 5 6
F D 5 885
FD5A A9
A 9
02
77
00
STRT LDA
STA TXTPTR
LDA te
#2
F D 5 C85DE STA y R a p
FD 5 EA 2 0 D
F D 6 0
FD 6 2 20
FD65
F D 6 8
FD6A F 0
A 9 2 E LDA » ' .
84 E 7
EB E7
20
2E CMP
C 9
F 9
FD6C C 920
FD6E F 0
F 5
STI
LDX
JS R
JSR
BEQ
CMP
BEQ
• CR
U R T U 0
R DOC
i' .
STI
• 420
STI
; U SE R COMMAND INPUT
; COMING FROM TEXT BUFFER
; A D D R y RAP AROUND FLAG
; START PROMPT NITH CRLF
; A PROMPTING ' '
iINPUT COMMAND LINE
; IGNORE PROMPTING ' '
/SPAN BLANKS
65
Page 68

RESIDENT MONITOR
...........
PAGE 0832
LINE
2566 F D ? 0
256?
2568 FD ? 5 D 0
2569
2 5 ? 0
2 5 ? 1
2572
2 5 ? 3F D 7 9
2574
2575
2576
257?
2578
2579 F D 8 3
2581
2583
2584
2585 FD8D
2586
258?
# LOC
A 2
F D 7 2DD
FD 7 7 86
FD 7 9
FD ? 9
FD ? 9
eD
FD7C 48
FD7D BD F 0
FD 8 0 48
F D 8 I
F D 8 2CA
FD 8 5 6 C
F D 8 8A 5
F D 8 A
FD 8 F
FD92
60
1 0 ED
8 D
A 5
8 D
60
CODE
07
E 0
FD
8 B
84
E 8
FD
FD
FA
03
FB
01
02
FC
80
02
LINE
S0 LDX
SI CMP
; I ND I RE CT
; PUSHING
; THEN RTS
S2 DEX
P U T P
BHE
STX
LDA
PHA
LDA
PHA
RTS
BPL
JM P
LDA
ST A
LDA
ST A
RTS
tNCHDS-1 iLOOKUP COMMAND
CHDS,X
S 2
SAYX ; INDEX OF COMMAND IN TABLE
JM P FROM TABLE BY
TARGET ADDRESS-l
ABRH,X
ADRL,X
SI /LOOP FOR ALL COMMANDS
CUSRCMD) ; ALLOW USER COMMANDS
T MP 0
PCL
TMP0+1
P CH
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2660
2601
2682
2683
2665
2686
268?
2608
2609
2610
261 I
2612
2613
2614
2615
2616
F D 9 3
F D 9 3
F D 9 3
FD 9 3
FD9 3
FD 9 5
FD 9 7
FD 3 AB 1
FD9C
FD9F
FD A 2C 6
FD A4
FDA6 60
FDA7
FDA7
FDA7
FDA A
FD AC
FDAE 81
FBB0
FDB2
FDB4
FDB5
FDB6
FDB9
FDBC
FDBE
66
85 B 5
A 0
00
20 CD
FB
20
75
20
D 5
BS
D 0F 1
20
B6
90
0 D
A 2
08
FB
Cl
FB
F 0
05
68
68
4 CF 7
20
D5 FD
C 6
B5
60
; D I S P L A Y MEM SUBR. SET
/ 0F MEMORY
; T MP 0
DM
FD
E 7
FD
E7
DM1
/READ
;NO STORE
BYTE
BY3
= ADR
JS R
JS R
RTS
AND
JS R
LDX
CMP
BYTES DISPLAYED
OF HEM DISPLAYED
ST A
TMPC
LD Y
«0
SPACE
LDA
( T H P 8 ) , Y
JS R
WROB
INCTMP
DEC
TMPC
BHE
DM!
STORE BYTE.
IF SPACE OR
RDOB
BCC
BY3
#0
STA
( « MP0. X>
C TMP0Z X)
BEQ
BY3
PLA
PLA
JH P
ERROPR
JSR
INCTMP
DEC
TMPC
RTS
AR=NUMBER
; UR N BYTES
; (TMP0)=A DR
TMPC = 0
; SPACE
i STORE BYTE
; VERIFY WRITE
; ERROR:CLEAR STACK
; INC TMP0 ADR
Page 69

RESIDENT MONITOR
PAGE 0003
LINE
2 618
2619
2628
2621
2622
2623
2625
2626
262?
2628
2629
2631
2632
2633
2634
2635
2636
263?
1 LOC
FDBF A 9
FDC1 85
FDC3
A 9
FDC5 85
FDC7 A 9
FDC9
FDCA
60
20
FD C DA 9
FDCF
FD D 8
2 C
A 9
FDD2 4 C D 2
FDD5
FDD5
FDD7
FDD9
FDDB
FDDD
FD DF
E 6 F 8
D 006
E 6 FC
D 8
E 6
60
CODE
02
F 8
02
FC
85
FD
CD
20
8 D
FF
82
DE
LINE
SE TR
LDA
ST A
LDA
ST A
LDA
RTS
SPAC2
SPACE
JS R
LDA
. BYT
CR LF
LDA
JM P
/INCREMENT
INCTMP
INC
BNE
INC
BNE
INC
SETUR
RTS
KFLGS
T MP 8
* >F LGS
THP0+1
«5
SPACE
t S 2 8
$2 C
#*D
$ FFD2
< TM P 0/
T MP 0
SETUR
TMP0+1
SETUR
URAP
;S ET TO ACCESS REGS
;L OU BYTE
; H IGH BYTE
2639
264 1
2642
264 3
264 4
2645
2646
2647
2648
2549
2653
265 1
2 65 2
2653
2654
2655
2656
285?
2658
2659
2663
266 1
2662
2663
2654
F D E 0
FDE0 3 A
F D E 13 B
F D E 252
F DE3
F D E 4
4 D
47
FDE5 58
F D E 6
4 C
FDE 7 53
F DE8
FDE 9
FD E A
F D E B
FE
FE
FE
-E
FDE C FE
F D £ DFF
F D E E
FF
F D E FFF
F D F 0B 8
FD F 1
96
F DF2 22
FDF 3 57
F D F 4
CE
F B F 586
FD F 6
F DF 7
1 0
10
/COMMAND AND
CM DS
.BYT
. 8 Y T
. BYT
. BYT
. BYT
. BYT
. BYT
. BYT
AD RH
.BYT
. BYT
. BYT
. BYT
. BYT
. BYT
. BYT
.BYT
ADRL
.BYT
. BYT
. BYT
. BYT
. BYT
. BYT
. 8 Y T
. BYT
ADDRESS TABLE
/ é 4
> . 4
4
' R '
' M '
' G '
' X '
' L '
7
' S
; MODIFY MEMORY
; ALTER REGISTERS
/DISPLAY REGS
; DISPLAY MEMORY
; START EXECUTION
;UARM START BASIC
/LOAD MEMORY
;SAVE MEMORY
>221
>222
>223
>224
>225
>226
>227
>228
<221
<222
<223
<224
<225
<226
<227
<228
67
Page 70

RESIDENT MONITOR.
. . PAGE 0004
LINE t LOC
2666
FD F 8 0 D
2666 FDF 9
266?F D F D
2669
2 6 ? 0
26? 1
FE 1 5
FE 1 6
FEI 7
2672 FE IA
FE 1 B
2673
2674FE 1 D
2675
FE 2 0
2677F E 2 3
2678FE 2 5 8 D
2679
2680
2681
2682
FE 28
FE 2 8 E 8
FE 2 C E 0 ID
FE 2 E
2683F E 3 0 A 0
2684
FE 3 2 20
2685FE 3 5
CODE
20 20
50
20
98
48
20 D 0
68
A 2
2 E
20
84
4 C
CA
A 2
80
F 8 FD
20 D 2FF
D 0F 5
38
1 5 FE
AD 00 82
2686FE 3 8 29 75
268?
FE 3B
AD
01
2688 FE 3E 28 75
2689
FE 4 1 20 CD
2690
FE 4 4
269 1
F E 4 7
2692
F £ 4 A
2693FE 4 D
07
AD
20 75
AD 08
20 75 E 7
2694 FE20 2*33F
2695 F £53
20
93
2696FE 5 6 F 0 39
FD
E 7
FD
E 7
02
E 7
FD
82
E 7
82
FD
FD
LINE
RE GK
ALTRIT
.BYT CR* '
TY A
PHA
JS R
PLA
LD X
JS R
JM P
D S P L Y R
D2
LDX • 0
LDA
JS R
I N X
CPX
BHE
LO Y
JS R
LDA P C H
JS R
LDA PCL
JS R
JS R
LDA
o S R
LDA
JS R
JS R
JS R
BEQ
BYT
'PC
C RL F
* ' .
WRT «0
S P A C 2
REGK'X
* FF D2
• 29
D 2
f ' ;
A L T R I T
U RO B
y ROB
SPACE
I NV H
y ROB
I N V L
y ROB
SET R
3 :i
SEBS 1
SR AC XR YR SP'
2698
2 69 9
2700
2791
2792
2 793
2704
2705
270?
2798
2 73 3
2710
271 1
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2713
2719
FE 3 3
F £ 5 B
F E 5 E 90 34
F E 6 0
■r E 6 3
F E 6 6 20 A 7
FE 69 98 29
FE 6 B
FE6E 20
FE 7 i
FE 7 3
FE ? 5
FE 7 7
FE 7 8
F E ? A
FE7C
FE 7 E
FE 3 0
FE 8 2
FE 8 4
Ff. 3 7
29 EB £7
20 A?
9
2 9
9?
E 8
E 7
E 7
E 7
E 7
20
97
E 7
8 1 F 3
F 3
1E
A 6
DE
39
1 A
38
A 5
FD
E 5
FB
A 5
PE
£ 5
FC
99
3F
AB
3 A
23
15
6 A
FE
E 7
2 3
DSPLYM
DSP 1
JS R
R DOC
J 3 R
R D 0 A
BCC
ERRS 1
Jn;
T 2 T 2
h A
JS t?
»\ V !.» O
JS R
R DO A
SCC ERRS 1
JS R
T 2 T 2
JS R
STOP 1
BEC
8 E S S 1
«RAP
LDX
8NE
8ESS1
SEC
LDA
T MP 2
SBC T MP 0
LDA
THP2+1
SBC ïMP 0 + 1
BCC 3F.BS1
LD Y
1 ' :
JS R
ALTRIT
JS R
N RO A
; READ START ADR
;E RR IF NO SA
;SA TO TMP2
; SKIP DELIMITER
; READ END ADR
; ERR IF NO EA
;SA TO TMP0, EA TO TMP
'TEST FOR STOP KEY
'DOUBLE BYTE COMPARE
;EA LESS THAN SA
Page 71

RESIDENT MONITOR
.............
PAGE 0335
LINE
2700
2721
« LOC
FE 8ft ft 9
FE 8 C
20 93
2722 FE 8 F F 0
2724
2726
FE 9 1
F E 9 4
4 C
4 C
2728 FF. 9 7
2730
273 1
2732
2733
2734 FE A2
2 73 5
2736
2737
2738
2739
2740
2 7 4 :
2 74 2
F E 9 7
FE 9 ft
FE 9 D
FE 9 F
20
2B A 7
98
20
20
FE ft 5
FE ft 8
FE AA
FE ft C
FE ft F
FE 8 1
20
90
A 5 F 8
8 D
A 5
8 D
F E 6 420
F E B 7D 0
CODE
08
FD
DD
56
F B
F 7
E 7
B 6E 7
E 7
03
88 FD
CF
FF
A 7
E 7
0 A
88
82
FC
87
02
FD
ßF
0 A
LINE
BE QS 1
ERRS 1
; ALTER
AL TR
AL 2
AL 3
LDA
JS R
BEQ
JH P
JHP
REG
ISTERS
J S R
J S R
BCC
JS R
J S R
JS R
BCC
LDA
STA
LDA
STA
JS R
8 N E
98
DH
DSP 1
S TR T
ERROPR
R DO B
R DO A
AL2
P U T P
* F F C F
R DO A
A L 3
T HP 0
I HVL
T HP 9 + 1
I NV H
SE IR
A4
; DISPLAY 8, INCR TH PB
; S K I P 2 SPACES
; C Y = 0 IF SP
; SPACE
; ALTER PC
; S E T TO ALTER R'S
2744
2 74 6
274 7
274 8
2 7 4 9
2750
2751
2752
2753
2 75 4
2755
2756
2 757
2 75 8
2759
2760
2 76 1
2 76 2
2763
2764
2765
2766
276 7
2768
2769
2779
277 1
2772
2773
2774
FEB9
F E ß 9
FEBC
F E 8 F
FECI
F E C 3
F E C 5
f E C 8
FE CO
20
B 6
20
A 7
90
D 3
A 9 88
3 5
B 5
20 E 8
20
A?
F 8
00
F F. CI) F 0 C 2
FECF
F ED 2 C 9
FE B4
FE D S
FE D8 D 0
FE D A
F £ 0 3
F E 5 F
Ft E 2
FEE5
FEE6
FE E 7
FE E A
FEEC
FEEF
FE F i
FEF 4
FE F 5
FE F 8
FEF9
28
CF
9 D
F 8
3 C
C 320
BA
23 A 7
98
83
20
88
AE 86
9 A
78
AD
07
9 1
85
AD 08
85 90
AD 99 92
48
AD
01 82 LDA
48
AD
82
E 7
E 7
; ALTER
AL TH
HE H OR Y - READ
JS R
J S R
BCC
LDA
E 7
FD
A4
A5
S f A
JS R
JSR
B N £
FF
A 9
CO
BEQ
JS R
cap
ßEQ
cap
9NE
E7
JS R
BCC
FD
02
G 1
JS RP U T P
LD XSP
TXS
SEI
02
LDA
STA
02
LDA
STA
LBA
PHA
PHA
02 LDA
R LO B
R DO A
ERRS I
40
f H?C
R DO C
BYTE
fi 5
BEÜS1
$FFCF
i$8D
G 1
#420
ERRS 1
R DO A
G 1
I NV H
CIHV+1
I N V L
C IH V
P CH
PCL
FLGS
ADR AND DATA
;SKIP 2 SPACES
;READ HEM ALTER ADR
; C Y=0, IF SPACE, ERR
; SET CNT = 8
; IF CR, EXIT
; IF NOT SPACE. ERR
;ORIG OR NEW SP VALUE
69
Page 72

RESIDENT MONITOR
. . PAGE
08 3
!
6
LINE
2 7 ? 5FEFC
2 7 7 6FEFB AD
2???
2 773
2 7 ? 9F F 0 6
2 73 1 F F 0 7
2732 FF 0 A
2783 F F 0 B
2785
2 78 7
2789
2791
2792 FF 1 3
2793 FF 1 5
2794
• LOC
CODE
48
83
FF 0 0 AE
F F 0 3AC
04
05
48
AE
86
9 A
4 C89 C 3
FF 0 E 4 CF 7 E 7
FF 1 1
FF i l
FF 1 1
A 0 01
84 D 4
88
FF 1 6 84
DI
2795 FF 1 8 84 9 D
2796 FF 1 A A 9
2797
2798
2799
2800
2801
2882
FF 1 C
FF 1 E
FF 20 85
FF 22
F F 2 5C 9
FF 27 F 0
2803 F F 2 9
2804
2805
FF 28
FF2D C 9 22
2806 FF 2 F
2807
FF 3 1
2808 FF 34
2809
2810
281 1
2812
2813
FF 3 6
FF 38
FF 3 A F 0
FF 3C 91
FF 3E
82
85
DB
A 9
07
DA
20 CF
20
F 9
C 90 D
F 8
1 A
D 0
DD
CF
20
C 9
22
F 0
24
C 90D
0 B
DA
E 6
DI
2814 FF 4 0 C8
2815
2816
2817
2818 FF 4 7
2819
2820 FF 4 B
2821
2822 FF 5 0
2823 FF 5 3
2824
2825 FF 57
2826
2827
2828
2829
FF 4 1
C0
FF 4 3 F 0
FF 4 5 D 0
A 5
F F 4 9C 9
D 0
FF 4D
20 22 F 3
20
A 5 96
FF 5 5
29
D 0
FF 59
FF 5C
FF 5F
FF 6 1
4 C
20
C 9
F 0
1 0
C 9
EA
84
86
E 2
E 6
10
F 2
56 FD
CF
0D
E 4
70
02
02
02
02
FF
FF
F 8
FF
LINE
PHA
LDA
ACC
LDX XR
LD YYR
RT I
EXIT
LDX
SP
TXS
J H P
READY
ER RL
ZZZ1
/rtrtwHlNE LANGUAGE LUAD
LD
JMP
E RR 0PR
= E'JF + 7
LD Y
« 1
STY
FA
ROUTINE
; DEFAULT DEVICE »1
DEY
STY
FNLEN
STY
VERCK
LDA
L1
ST A
LDA
STA
JS R
t>ZZZl
FNADR+1
#<ZZZ1
F NA DR
$ FF C F
; PLACE TO STORE NAME
CMP»'
L 2
L3
BEQ L 1
CMP
# CR
BEQ
L5
ÿ / «
CM P
BHE
E RR L
JS R
î FF C F
;SPAN BLANKS
; DEFAULT TO LOAD
;FILE NAME MUST BE NEXT
CMP* ' “
BEQ
CMP
L 8
• CR
;E ND OF NAME
/DEFAULT A LOAD
BEQ L 5
STA
(FHADR)Y
INC
FNLEN
I N Y
CP Y
»16
L4
BEQ
E RR L
/FILE NAME TOO LONG
BHE L 3
L5
L6
L?
L8
LDA
CMP
BHE
JS R
JS R
LDA
AND
BNE
JMP
JS R
CMP
BEQ
S AV X
«6
L 2
L D1 5
TUAIT
SATUS
»SPERR
L6
STRT
*FFCF
»CR
L 5
;NOT A LOAD
/LOAD ERROR
/•DEFUALT LOAD
sIT ÏO 3 R 3 I C U A R Î1 START
Page 73

RESIDENT MONITOR
PAGE 0807
LINE
2830
283 1 FF 6 5
2832
2833 F F 6 A29
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
284 1
284 2
284 3
284 4
284 5
2 84 6
284 7
284 8
284 3
2850 F F 9 1
285 1
2852 F F 9 5
2853 F F 9 7
2854
2 855
2856
2857
2858
2853
2860 FF A 7
286 1
2862
2863
# LOC
FF 6 3
FF 6?
F F 6 C
FF 6E
FF 70
FF 7 2
FF74
F F 7 7
FF 79
F F 7 B
FF ?B
FF 7F
F F 8 220 97
F F 8 520
F F 8 8C 9
FF 8 A D 0
F F 8 C
F F 8F
F F 9 3
FF 9A
F F 9 D
FF 9F
F F A 1
FF A3
FF A5
FF A9
FF AB
F F A E4 C
C 9
D 0
20
F 0
C 9
F 0
85
20
C 90 D
F 0
C 9
D 0
20 A 7
28
A 5 FB
85
A 5
85
20
20
C 9
F 0 F 9
C 9
D 0
A 5 B 4
C 9
D 0F 8
20
CODE
2 C
F 0
B 6
E 7
0F
D5
03
FA
D 4
CF
FF
CC
2 C
E6
E 7
E 7
CF FF
2 C
F 1
E 7
A 7
C 9
FC
CA
97
E 7
CF
FF
20
0 D
E 5
07
A4
F 6
56
FD
LINE
CMP I'.
L9 BNE L 7
JSR R DO8
AND tSF
L10 BEQ L4
CMP #3
LI 1 BEQ L 10
STA FA
JSR $ FF C F
CMP t CR
BEQ L 5
CMP #',
L 1 2 BNE L 9
JSR R DO A
JSR T2T2
JSR $FFCF
CMP #'.
L13 BNE L12
JSR R DO A
LDA T HP 0
STA EAL
LDA TMP0+1
STA E AH
JSR T2T2
L 2 0 JSR $ F F C F
CMP #$20
3EQ L 2 0
CMP # CR
L14 BNE L 1 3
LDA SAVX
CMP #7
BNE L14
JSR SV5
JMP S TR T
;BAD SYNTAX
; DEVICE 0
JDEVICE 3
;DEF AULT LOAD
; B A D SYNTAX
/MISSING END ADDR
/MISSING CR AT END
2865 FF B 1
2866 FF B 1
2867
2868
2869
2870
287 1
2872 FF B 1
FF B 1
F F B 1
FF B 1
FF 8 1
FF B 1
ZZ1 = ALTM- I
ZZ2 = ALTR- 1
ZZ3=DSPLYR-1
ZZ4=DSPLYM-1
ZZ5 = GO- 1
ZZ6=EXTT-1
ZZ 7 = L D-i
ZZ3 = L D- I
71
Page 74

NOTIZEN
72
Page 75

NOTIZEN
73
Page 76

NOTIZEN
74
Page 77

NOTIZEN
75
Page 78

NOTIZEN
Page 79

5. Programme, die Ihnen den Computer erklären
5.1. Übungs- und Beispielprogramme zu den Punkten 1.2.1-1.2.16
Der REM-Befehl
100 REM PROGRAMMANFANG
110 REM EINGABE VON 2 WERTEN
120 INPUT ’’GEBEN SIE WERT1 EIN” ; A
130 INPUT’’GEBEN SIE WERT 2 EIN” ;B
140 REM ADDITION DER BEIDEN WERTE
150 C = A + B
160 REM AUSGABE DES ERGEBNISSES AUF DEM BILDSCHIRM
170 PRINT ’’DAS ERGEBNIS IST” ; C: REM PROGRAMMENDE
Die hinter dem REM-Befehl stehenden Zeichen haben keinen Einfluß auf das Programm. Sie
dienen lediglich der besseren Übersicht beim Erstellen der Programme oder bei der Fehlersuche
in Programmen; siehe Zeile 100,110,140,160. Wird ein REM-Befehl mit anderen Befehlen in eine
Zeile geschrieben, so muß er immer als letzter stehen, (siehe Zeile 170) da die Befehle, die hinter
dem REM-Befehl stehen, nicht ausgeführt werden.
Die END-Anweisung
10 REM PROGRAMMANFANG
11 INPUT ’’ZAHL 1” ; A
12 INPUT ’’ZAHL 2” ; B
13 IF A > B THEN PRINT A ”IST GROSSER ALS” ; B
14 IF A < B THEN PRINT A ”IST KLEINER ALS” ; B
15 IF A = B THEN PRINT A ’’IST GLEICH” ; B
16 INPUT ’’WOLLEN SIE NOCH EINEN VERGLEICH DURCHFÜHREN”
; A$ : IFA$= ”JA” THEN 10
17 END
Die END-Anweisung in Zeile 17 beendet das Programm. Sie kann aber auch fortgelassen werden.
Eine END-Anweisung darf auch öfter im Programm verwendet werden. Sie beendet den Programm
ablauf ohne Meldung ’’BREAK IN . . .” wie bei der STOP-Anweisung. Stattdessen erscheint die
Meldung READY im Bildschirm.
Der STOP-Befehl
110 PRINT ’’VON WELCHER ZAHL WOLLEN SIE DIE WURZEL ZIEHEN?”
120 INPUT A
130 B = SQR (A)
140 PRINT ’’DIE WURZEL DER ZAHL ”A” IST ”B”
150 STOP
160 GOT0110
Der STOP-Befehl in Zeile 150 bewirkt das Anhalten des Programmes und die Meldung ’’BREAK
IN 110”. Es können auch mehrere STOP-Befehle in einem Programm verwendet werden. Nach
einem Programmhalt durch einen STOP-Befehl kann das Programm mittels ”CONT” fortgesetzt
werden.
Der LET-Befehl
11
INPUT ’’ZAHL 1 ”
12
INPUT ’’ZAHL 2”
13
INPUT ’’ZAHL 3”
14
LET D = A + B + C
15
PRINT ”A” PLUS ”B” PLUS ”C” IST GLEICH ”D”
A
B
C
Der LET-Befehl in Zeile 14 war bei früheren BASIC-Versionen als Zuordnung nötig. Er kann bei
Ihrem Computer weggelassen werden. Zeile 14 sähe dann so aus:
14 D = A + B + C. Ältere Programme, in denen noch ein LET-Befehl steht, brauchen nicht modifiziert
werden, da er keine Fehlermeldung hervorruft.
77
Page 80

PRINT
100 REM PROGRAMMANFANG
110 FOR I = 1 TO 10 : INPUTTEXT”;A$(I) : NEXT
120 PRINT : PRINT’WELCHE AUSGABE (0 BIS 4; 0=PROGRAMMENDE)”
130 INPUT A
135 PRINT
140 ON A+1 GOTO 300, 220, 240, 260, 280
200 PRINT "EINGABE UNZULAESSIG”
210 GOTO 130
220 FOR I = 1 TO 10 : PRINT A$(l) : NEXT
230 GOTO 120
240 FOR I = 1 TO 10 : PRINT A$(l),: NEXT
250 GOTO 120
260 FOR I = 1 TO 10 : PRINT A$(l);: NEXT
270 GOTO 120
280 FOR 1=1 TO 10 : PRINT A$(l)” ”;:NEXT
290 GOTO 120
300 PRINT "ENDE” : END
Die PRINT-Befehle in den Zeilen 220, 240, 260, 280 bewirken die Darstellung von Zeichen
auf dem Bildschirm. In Zeile 220 werden die eingegebenen Werte untereinander geschrieben.
Setzt man ein Komma oder ein Semikolon hinter den PRINT-Befehl (wie in den Zeilen 240, 260),
so werden die Werte nebeneinander geschrieben. Nur die Abstände zwischen den einzelnen
Werten ändern sich durch das Komma oder Semikolon. Man kann nun noch den Abstand ver
größern, indem man Leerstellen mit ausdrucken läßt (Zeile 280).
INPUT
100 INPUT A
110 INPUT "ZAHL 2”;B
120 INPUT A$
130 FOR I = 1 TO 10 : INPUT "GEBEN SIE NAECHSTEN WERT EIN”;A$(I) : NEXT
140 PRINT A
150 PRINT B
160 PRINTA$
170 FORI=1TO10:PRINTA$(I):NEXT
Der INPUT-Befehl ermöglicht die Eingabe von Werten über die Tastatur. Durch den INPUT-Befehl
in Zeile 100 können Sie eine Zahl eingeben. Der Rechner meldet sich nur mit einem Fragezeichen.
Für die Zeile 110 gilt das Gleiche wie für Zeile 100, außer daß der Rechner den Text innerhalb der
Anführungszeichen am Bildschirm darstellt. Es können neben Zahlen auch Buchstaben und gra
phische Zeichen eingegeben werden, wenn diese in einer Stringvariablen gespeichert werden
(Zeile 120,130). Für die Stringvariablen gilt die gleiche Vorschrift wie für einfache Variablen.
GET
10 PRINT-B LOESCHT DEN BILDSCHIRM,”
20 PRINT’V LOESCHT ALLE VARIABLEN,”
30 PRINT’N LOESCHT DAS PROGRAMM.”
40 PRINT:PRINT”EINGABE?”
50 GET C$ : IF C$=” ” THEN 50
60 IF C$ = ”B” THEN PRINT CHR$ (147) : END
70 IF C$ = ”V” THEN CLR : END
80 IFC$ = ”N” THEN NEW
90 GOTO 50
Durch einen GET-Befehl wird ein einzelnes Zeichen vom Tastenfeld eingelesen, jedoch ohne das
Programm anzuhalten, wie es beim INPUT-Befehl ist. Der GET-Befehl in Zeile 50 bewirkt das Ein
lesen des Zeichens und speichert dieses in C$. Im zweiten Teil der Zeile 50 wird abgefragt, ob
überhaupt ein Zeichen eingelesen wurde. Ist dies der Fall, so wird das Programm mit der Zeile 60
fortgesetzt, ansonsten wird Zeile 50 wiederholt. Dies ist also eine Schleife, die das Programm
solange anhält, bis ein Zeichen eingelesen wurde.
78
Page 81

DATA, READ und RESTORE
100 DATA ICH, DU, ER, SIE, ES, WIR, IHR, SIE, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
110 PRINT "DRÜCKEN SIE JETZT 1 ODER 2”
115 PRINT "(1 = READ, 2 = RESTORE UND READ)”
120 GETA$ : IFA$ = ”1” OR A$ = ”2” THEN 140
130 GOTO 120
140 IFA$ = ”1” THEN 170
150 IFA$ = ”2” THEN 160
160 RESTORE
170 READ A$
180 PRINT A$
190 IFA$= ”10” THEN 210
200 GOTO 120
210 RESTORE
220 GOTO 120
Die Daten, die hinter der DATA-Anweisung im Programm stehen (Zeile 100) können mittels eines
READ-Befehls (Zeile 120) nacheinander gelesen werden. Versucht man, mehr Daten, als unter
DATA stehen, zu lesen, so erfolgt eine Fehlermeldung. Nach einem RESTORE-Befehl (Zeile 160)
wird mit dem nächsten READ-Befehl wieder der erste Wert der DATA-Anweisung gelesen. So ist es
möglich, die Werte der Anweisung öfter zu benutzen.
GOTO, ON .. GOTO, IF ... THEN
10 REM TEXTAUSWAHL
15 PRINT
20 INPUT’WELCHES DER 5 TEXTMODULN”;X
30 IFX<1 OR X>5 THEN 160
40 ON X GOTO 60,80,100,120,140
50 GOTO 20
60 PRINT’FUER JEDES ’MODUL’ KOENNTE BELIEBIGER TEXT STEHEN”
70 GOTO 15
80 PRINT’’MODUL2”
90 GOTO 15
100 PRINT’’MODUL3”
110 GOTO 15
120 PRINT ’’MODUL4”
130 GOTO 15
140 PRINT’’MODUL5”
150 GOTO 15
160 PRINT”BITTE GEBEN SIE EINE ZAHL ZWISCHEN 1 UND 5 EIN!”
170 GOTO 15
Die Variable (oder Funktion) hinter ON .. gibt die Position in der nach GOTO folgenden Adressen
liste an. Die gefundene Adresse wird dann für den Sprungbefehl GOTO in der gleichen Zeile (40)
benutzt.
Ist bei ON ... GOTO die Variable 0, verzweigt der Programmablauf direkt zur nächsthöheren
Programmzeile.
GOSUB, ON... GOSUB
10 INPUT’WUENSCHEN SIE EINE ERKLAERUNG”;X$
20 IF X$=”JA”THEN GOSUB160
30 INPUT”IHRE ZAHL”;A
40 INPUT”IHREN CODE”;B:IFB<0ORB>3THEN10
50 ON B GOSUB70,100,130
60 GOTO30
70 REM UNTERPROGRAMM 1
80 PRINT’DIE WURZEL AUS IHRER ZAHL LAUTET”;SQR(A)
90 RETURN
100 REM UNTERPROGRAMM 2
110 PRINT’IHRE ZAHL ZUM QUADRAT LAUTET”;Af2
79
Page 82

120 RETURN
130 REM UNTERPROGRAMM 3
140 PRINT’DIE ZUFALLSZAHL AUS IHRER ZAHL LAUTET”;RND(A)
150 RETURN
160 REM ERKLAERUNG
170 PRINT’GEBEN SIE EINE BELIEBIGE ZAHL EIN”
180 PRINT’MIT EINER CODE-ZAHL BESTIMMEN SIE EINE VORPROGRAMMIERTE
RECHENOP.”
190 PRINTTAB(10)”1=QUADRATWURZEL”
200 PRINTTAB(10)”2=POTENZIERUNG MIT 2”
210 PRINT TAB(10)”3=ZUFALLSZAHL
220 RETURN
Mit GOSUB 160 in Zeile 20 wird ein Unterprogramm angesprungen und automatisch ausgeführt.
Hier wird nur eine Erklärung zum Programm ausgedruckt.
Mit ON .. GOSUB wird das gleiche Prinzip wie bei ON .. GOTO erfüllt. In Abhängigkeit von einer
Variablen wird eine bestimmte Adresse für einen Unterprogrammsprung verwendet.
Durch RETURN in den Unterprogrammen verzweigt das Programm wieder zurück zu dem Befehl,
der nach dem GOSUB-Befehl steht. Hier ist das immer der Befehl in der nächsten Zeile. Der nach
folgende Befehl kann jedoch in der gleichen Zeile stehen. Ist bei ON .. GOSUB die Variable=0, so
verzweigt das Programm direkt zur nächsthöheren Programmzeile.
5.2. Beispielprogramm zu 1.2.17
DIE BEFEHLSGRUPPE FOR, NEXT, STEP.
5 PRINT CHRS (147)
10 F0RI = 1T03
20 PRINT”VERSUCH”;J
30 NEXTI
40 PRINT
50 A=0:B=20:C=2
60 FORI=A TOB STEP C
70 PRINT”SCHRITT”;I
80 NEXT
85 PRINT” WARTESCHLEIFE”:FORI=1TO2000:NEXT
90 DIMA(3,8):PRINT” RANDOM GENERATOR
100 F0RI=1T03
110 FORJ=1T08
120 A(I,J)=RND(7t)
130 NEXTJ
140 NEXTI
150 END
In Zeile 10 und 30 wird ein einfacher Zähler gebildet, der von 1 bis 3 läuft, wobei die Schrittweite 1 ist,
da diese (mit STEP) nicht angegeben ist.
In Zeile 60 werden die Grenzwerte und die Schrittweite der Schleife in Form von einfachen Varia
blen (Zeile 50) vorgegeben. Hier wird eine Schrittweite von 2 vorgegeben.
In den Zeilen 100,110,130,140 wird eine „verschachtelte” FOR-NEXT-Schleife angegeben. Hier
ist darauf zu achten, daß die Verschachtelung symmetrisch ist, d.h. die Schleife muß mit der
Variablen beendet werden, mit der sie begonnen hat (Zeile 140 und 100).
Eine Besonderheit des Commodore-BASIC ist in Zeile 80 deutlich zu erkennen. In der NEXTAnweisung muß nicht zwingend die Laufvariable angegeben werden.
5.3. Beispielprogramm zu 1.2.18
10 DIMA(100),B(10,10),C(3,3,3),D%(100)
20 FORI=0TO100
30 A(I)=I:D%(I)=I|2
40 NEXTI
45 PRINT CHR$ (147)
80
Page 83

50 FORJ=0TO10
60 FORK=0TO10
70 B(J,K)=RND(tt)
80 NEXTK
90 NEXTJ
100 FORI=0TO3
110 FORJ=0TO3
120 FORK=0TO3
130 C(I,J,K)=I*J*K
135 PRINT”ELEMENTC(”I;J;K”)=”C(I,J,K)
140 NEXTK
150 NEXTJ
160 NEXTI
Der DIM-Befehl in Zeile 10 reserviert innerhalb des Speichers den notwendigen Platz für ein-, zwei-
oder mehrdimensionale Felder (Arrays). Wichtig ist, daß dieser Befehl vor Benutzung der Arrays
mindestens einmal durch Starten des Programms mit RUN durchlaufen wird. RUN löscht ja be
kanntlich alle Variablen und somit auch Arrays, die vorher vorhanden waren. Das Array D% (100)
ist ein INTEGER-Array; d.h. die Zahlenwerte dürfen nicht größer als 32768 und nicht kleiner als
-32767 sein.
Es ist darauf zu achten, daß Ihr Rechner mit der Basis-Null-Indizierung arbeitet; d.h. das erste
Element besitzt die Indizierung 0. Diese Besonderheit ist in den FOR Statements in Zeile 20,50,60,
100,110 und 120 Rechnung getragen. Die Laufvariablen beginnen dort mit0. Um die Darstellung
auf dem Bildschirm zu verlangsamen, kann die Taste RVS betätigt werden.
5.4. Beispielprogramme zu 1.2.19-1.2.24
DEFFN... und FN...
20 DEFFNY(X)=A+A1 *X+A2*X|2+A3*X|3
30 INPUT”A,A1 ,A2,A3,X”;A,A1 ,A2,A3,X
40 PRINT:PRINT”FNY(”X”)=”FNY(X)
50 PRINT:GOTO20
In der Zeile 20 wird eine mathematische Funktion definiert. Daher auch DEFINE FUNCTION als
Bezeichnung für dieses Statement.
Die einmal mit RUN durchlaufene Formel kann innerhalb eines Programmes beliebig oft mit FNY
aufgerufen werden.
Als Name für die Funktion (hier Y) können maximal 2 Zeichen (einfache Variablen, ausgenommen
INTEGER-Variablen) Verwendung finden.
OPEN, PRINT # , CLOSE und INPUT #
100 REM DATENEINGABE
110 FORI=1TO10
112 INPUT” ARTIKEL”;A$(I)
114 INPUT” PREIS”;B$(I)
116 NEXT
120 PRINT”BITTE DATENKASSETTE RUECKSPULEN, DANN ’S’ DRUECKEN!”
130 GETZ$:IFZ$O”S”THEN130
140 OPEN1,1,1
150 FORI=1TO10:PRINT#1,A$(I):NEXT
160 FORI=1TO10:PRINT# 1 ,B$(I):NEXT
170 CLOSE 1
180 CLR
190 PRINT”BITTE DATENKASSETTE RUECKSPULEN, DANN ’L’ DRUECKEN!”
200 GETZ$:IFZ$O”L”THEN200
210 OPEN3
220 FORI=1TO10:INPUT#3,A$(I):NEXT
230 FORI=1TO10:INPUT#3,B$(I):NEXT
240 CLOSE3
250 FORI=1 TOI0:PRINTA$(l)„B$(l):NEXT
260 END
81
Page 84

Zur Ausgabe von Daten auf das Kassettengerät oder ein anderes Peripheriegerät muß zunächst
ein logisches File eröffnet werden. Für das Kassettengerät steht dieser Befehl in Zeile 140. Danach
könnten Daten mit dem Befehl (PRINT # 1, Variable) auf Band geschrieben werden (Zeile 150,
160). Sind alle Daten auf Band gespeichert, so muß das eröffnete File geschlossen werden. Dieses
geschieht mit dem Befehl in Zeile 170 (CLOSE 1 ).
Wollen Sie nun Daten von der Kassette lesen, so müssen Sie wieder ein logisches File eröffnen,
beim Lesen der Kassette lautet der Befehl OPEN 3 (Zeile 210). Das eigentliche Einlesen geschieht
durch den Befehl ’’INPUT # 3, Variable” (Zeile 220,230). Genau wie beim Schreiben, so muß auch
nach dem Lesen der Daten das File wieder geschlossen werden. Dies geschieht durch CLOSE 3
(Zeile 240).
5.5. Beispielprogramme zu 1.2.25-1.2.36
DIE LEN-FUNKTION
10 INPUT’GEBEN SIE EINEN BELIEBIGEN TEXT EIN”;A$
20 PRINT”DIESER TEXT IST”LEN(A$)”ZEICHEN LANG”
30 FORI=1TOLEN(A$)
40 PRINTMID$(A$,I,1 )
45 F0RU=1T0555:NEXT:REM * WARTE *
50 NEXT
60 PRINT’TEXTLAENGE HOCH ZWEI IST”;LEN(A$)f2
Die Funktion LEN ( ) ermittelt die Länge (Anzahl der Zeichen) einer Stringvariablen (Zeile 20).
Sie kann darüber hinaus die Funktion einer normalen Variablen übernehmen (FOR-Statement in
Zeile 30). Mit ihr kann aber auch gerechnet werden (Zeile 60).
STR $ und VAL
10 INPUT”IRGENDEINE ZAHL”;A
20 A$=STR$(A)
30 PRINT”A=”A,”A$=”A$
40 B=VAL(A$)
50 PRINT”B=”B,”A$=”A$
60 PRINT:GOTO10
Mit STR$ ( ) läßt sich ein numerischer Wert in eine Stringvariable transferieren (Zeile 20).
Die Umkehrfunktion dazu, die VAL ( ) Funktion, ermöglicht es, aus einer Stringvariablen den
numerischen Teil (incl. Vorzeichen) zu lesen. Der Inhalt der Stringvariablen bleibt bei dieser Opera
tion unverändert.
Befindet sich im String hinter dem numerischen Wert ein E, so wird dies als Exponent verstanden,
und die nachfolgenden Zahlen werden als Exponent gelesen.
ASC und CHR$
10 PRINT” ASCII-TABELLE FUER A-P”:PRINT:PRINT
20 A$=”ABCDEFGHIJKLMNOP”
30 FORI=1T016
40 M$=MID$(A$,I,1)
50 PRINTM$” HAT CODE ”ASC(M$)
60 NEXT
70 PRINT’IRGENDEINE TASTE DRUECKEN-”
80 GETR$:IFR$=” "THEN80
90 INPUT’WELCHER CODE”;C
100 PRINT’ASC VON”C”= ”CHR$(C)
110 PRINT:GOTO90
Die ASC ( )-Funktion wandelt das in der Klammer angegebene Zeichen in den zugehörigen ASCII*
um (Zeile 50), während die CHR$ ()-Funktion aus einem ASCII-Zeichen wiederum das alphanu
merische Zeichen bildet. In Zeile 100 wird aus dem Code das zugehörige Zeichen gebildet.
82
ASCII = American Standard Code for Information Interchange
(standardisierter Code für Informationsaustausch)
Page 85

RIGHTS, MID$, LEFTS
100 INPUT’WIE SPAET IST ES JETZT - HHMMSS”;Z$
110 PRINT” ”:REM‘BILDSCHIRM LOESCHEN*
115 I FVAL(Z$) <0ORVAL(Z$) >240000THEN 100
116 TI$=Z$
120 A$=RIGHT$(TI$,2):REM *DIE BEIDEN RECHTEN ZEICHEN *
130 B$=MID$(TI$, 3,2):REM ‘DIE BEIDEN MITTLEREN ZEICHEN AB DEM DRITTEN*
140 C$=LEFT$(TI$,2):REM ‘DIE BEIDEN LINKEN ZEICHEN *
150 PRINT” QQQQQQQQ ES IST JETZT”:PRINTC$” UHR, ”B$” MINUTEN, ”A$” SEKUNDEN
160 GOTO 120
Durch den Befehl A$ = RIGHTS (Tl$,2) in Zeile 120 werden von dem String Tl$, das die Uhrzeit
HHMMSS enthält, von der rechten Seite an 2 Zeichen in A$ gespeichert. Durch den Befehl in
Zeile 130 werden aus der Mitte des Strings Tl$, vom 3. Zeichen beginnend, 2 Zeichen in B$ gespei
chert. Der Befehl in Zeile 140 bewirkt das Einlesen von 2 Zeichen von der linken Seite des Strings.
Sollen mehr Zeichen als das String hat eingelesen werden, so wird der gesamte String dargestellt.
Durch die Printanweisung in Zeile 150 wird erst „Cursor home” programmiert, dann 10 mal „Cursor
nach unten”. (Programmierte Cursorbewegungen erscheinen als Sonderzeichen auf dem Bild
schirm.)
POKE, PEEK, SYS
Nachfolgendes Assemblerprogramm addiert die Inhalte zweier Speicher und legt sie in einem
dritten Speicherplatz ab.
CLC
LDA
ADC
STA
RTS
Umgesetzt in die Maschinensprache erhält man
18
AD 47 03
6D 47 03 Hexadezimalcode
8D 47 03
60
Zunächst werden die Befehle nach Dezimal umgewandelt:
24
173 71 3
109 72 3
141 73 3
96
Mit einem BASIC-Programm wird dieses Programm in den Speicher geschrieben.
10 DATA 24,173, 71,3,109, 72, 3, 141,73, 3, 96
20 FOR M = 826 TO 836
30 READ A
40 POKE M, A
50 NEXT
Der Befehl SYS (826) kann dieses Maschinenprogramm aufrufen.
Zuvor kann mit NEW der Hauptspeicher gelöscht werden, da ab Adresse 826 der Pufferspeicher
der Kassette # 2 beginnt, der mit NEW nicht gelöscht wird.
10 INPUT”1.ZAHL”;Z1 :POKE839,Z1
20 INPUT”2.ZAHL”;Z2: POKE840,Z2
30 SYS(826)
40 PRINTZ1 ” + ”=”PEEK(841)
Mit POKE (Zeile 40) wurde der Code unseres Maschinenprogramms direkt in die Speicherstellen
826 bis 836 geschrieben.
Bei der Abarbeitung des Unterprogramms (Zeile 30) wurde das Ergebnis in den Speicher 841
gebracht. PEEK (841) in Zeile 40 liest diesen Wert und druckt ihn aus.
$0347 Lade-Akku mit Inhalt von 839
$0348 Addiere zum Akku den Inhalt von 840
$0349 Speichere das Ergebnis in 841
Clear Carry-Flag
Return (Rückkehr aus der Subroutine)
83
Page 86

Was tue ich, wenn der Computer mich nicht versteht?
6.
Im allgemeinen wird es nötig sein, Ihr Gerät zum Service zu bringen. Ihr Computer enthält hoch
komplexe Schaltungen, und wir empfehlen keinerlei Eingriffe, außer der unten ausdrücklich be
schriebenen.
Beachten Sie besonders, daß der Bildschirmteil mit Hochspannung (mehrere Tausend Volt) arbei
tet.
Trotzdem einige Fehlerhinweise für Hardware-Interessierte:
6.1. Der Bildschirm spinnt.
a) Der Bildschirmhintergrund ist zu hell.
Diagnose: Versuchen Sie, am Potentiometer (Regler) auf der Bildschirmrückseite das gesamte
Bild dunkler zu regeln. Sollte das keinen Erfolg haben, so ist der HF-Trafo im Bild
schirmteil defekt.
b) Der Bildschirm zeigt nach dem Einschalten ein festes Bild mit diversen Zeichen und reagiert
nicht auf die Tastatur.
Diagnose: Der Einschaltzyklus des Rechners ist nicht einwandfrei (power-on-reset).
c) Der Bildschirm zeigt nach dem Einschalten weniger als 31743 bzw. 15359 bzw. 7167 Bytes an.
Diagnose:Eines der RAM’s ist defekt, sofern dieser Fehler wiederholt auftritt. Sie können trotz
dem noch mit dem verbliebenen Speicherrest arbeiten, sollten aber das defekte RAM
irgendwann einmal austauschen lassen.
d) Im Bildschirm befindet sich eine Stelle, die nach ’’Clear Home” noch immer ein Zeichen beinhal
tet.
Diagnose: Eines der RAM für den Bildschirm ist defekt. Der Fehler ist nicht tragisch, sollte jedoch
behoben werden.
e) Gewisse Zeichen werden auf dem Bildschirm falsch angezeigt (z.B.: 7 anstatt A)
Diagnose: Der Zeichengenerator ist defekt.
f) Der Bildschirm ist vertikal gedrückt oder gedehnt.
Diagnose: Lassen Sie die Einstellung der Vertikalablenkung in einer Service-Werkstatt durch
führen.
g) Das Bild steht schräg.
Diagnose: Lassen Sie in Ihrer Werkstatt die Ablenkspulen justieren.
h) Die Zeichen sind verschwommen.
Diagnose:Lassen Sie die Fokussierung einstellen.
6.2. Die Tastatur reagiert nicht mehr.
a) Eine einzelne Taste funktioniert nicht.
Diagnose: Die Tastatur muß gereinigt werden. Durch normale Benutzung verunreinigen die Ta-
staturkontakte mit der Zeit. Die meisten Probleme treten bei den Tasten RETURN /
SHIFT / HOME auf, da diese Tasten auch am meisten benutzt werden.
Hinweis: Es ist möglich, einzelne Tasten vorsichtig mit einem Schraubenzieher abzuheben.
b) Eine Gruppe von Tasten reagiert nicht.
Diagnose: Eine Leitung an der Tastatur ist locker.
84
Page 87

6.3. Die Kassette will nicht so wie ich.
a) Beim Einladen eines Programmes von Kassette wird nichts gefunden, obwohl ein Programm
vorhanden ist.
Diagnose:Haben Sie die Kassette vor Programmbeginn zurückgespult?
Wenn ja, so kann der Tonkopf am Rekorder falsch stehen. Lassen Sie das über
prüfen.
b) Sie speichern ein Programm auf Kassette. Anschließend stellen Sie fest, daß die Kassette feh
lerhaft beschrieben wurde.
Diagnose: Reinigen Sie den Tonkopf des Rekorders mit einem handelsüblichen Tonkopfreini
ger. Sollte der Fehler danach wieder auftreten, so ist die Qualität der benutzten Kas
sette schlecht.
Übrigens: Sie sollten den Tonkopf ca. alle 10 Spielstunden reinigen.
c) Der Rechner reagiert nicht auf Tastenbenutzung am Kassettenrekorder, wenn Sie darauf lesen
oder schreiben wollen.
Diagnose:Es kann sich hierbei um einen Kontaktfehler im Rekorder handeln. Suchen Sie die
Werkstatt auf.
d) Der Kassettenrekorder leiert.
Diagnose: Lassen Sie die Zugrollen im Rekorder reinigen.
6.4. Es tut sich gar nichts.
Diagnose: Überprüfen Sie die Sicherung auf der Rechnerrückseite (ziehen Sie unbedingt vorher
den Netzstecker). Sollte diese in Ordnung sein, so kann der Bildschirmstecker auf der
Hauptplatine lose sein, oder der Einschaltzyklus des Rechners ist nicht einwandfrei. Ihre
Werkstatt wird in diesem Falle helfen können.
6.5. Der Computer meldet einen Fehler.
Grundsätzlich ist Ihr Computer so ausgelegt, daß er keinerlei Bauteildefekte lokalisieren kann.
Fehlbedienungen durch Ihre Programmierung kann der Rechner allerdings in weitem Rahmen fest
stellen, und meldet diese auch. Im Anhang finden Sie eine Anzahl von Meldungen, die auf dem Bild
schirm angezeigt werden, wenn ein Programmierfehler entdeckt wurde.
An dieser Stelle ist jedoch zu erwähnen, daß ein Fehler erst in dem Augenblick gemeldet wird, wenn
das Programm im Ablauf die Fehlerstelle erreicht hat. Sollte Ihr Programm umfangreicher sein, so
müssen Sie alle Eventualitäten beim Testen des Programmes berücksichtigen, um auch tatsäch
lich alle Fehler im Programm zu entdecken. So werden Sie bei dem Programm:
10 INPUT "GIB WERT A UND B”;A,B
20 PRINT "ERGEBNIS”; A/B
nur dann Fehler entdecken, wenn Sie folgendes eingeben:
a) für B den Wert 0. Der Rechner meldet dann DIVISION BY ZERO ERROR IN 20.
85
Page 88

b) für A = 1E30 und B = E-25. Der Rechner stellt dann ? OVERFLOW ERROR IN 20 fest, da das
Ergebnis 1E55 größer als die größte abzuspeichernde Zahl 1.5E38 ist.
c) Geben Sie durch Kommata getrennt 3 anstatt der verlangten 2 Variablen ein.
Der Rechner bemerkt dazu
? EXTRA IGNORED.
Da dieser Fehler aber nicht tragisch ist, setzt der Rechner anschließend seine Arbeit fort und
vergißt die 3. Zahl.
6.6. Was sonst noch so passieren kann.
Wir können Ihnen im Rahmen dieses Handbuches verständlicherweise nicht alle möglicherweise
auftretenden Fehler diagnostizieren.
Für diese Fälle haben wir ein Servicenetz in Deutschland aufgebaut, das sich sehen lassen kann.
Bei jedem COMMODORE-Händler befindet sich gleichzeitig eine Reparatur-Werkstatt, die durch
uns speziell auch für Ihren Rechnertyp geschulte Techniker hat. Dort wird man Ihre Probleme mit
dem Rechner schnell und sicher beseitigen können. Während der Garantiezeit sind die Reparatur-
und evtl. Ersatzteile natürlich kostenlos. (Es sei denn, der Techniker kommt zu Ihnen ins Haus.)
Aber auch danach wird für eine schnelle Instandsetzung gesorgt sein. Ein Verzeichnis unserer
Händler und Service-Werkstätten liegt diesem Handbuch bei.
7. Wie schnell ist eigentlich mein Rechner?
7.1. Die Geschwindigkeit des BASIC-Interpreters.
Ihnen eine Tabelle mit Zeiten für jeden Befehl zu geben, halten wir für unsinnig. Durch den jewei
ligen Aufbau des Programmes können sich nämlich erhebliche Geschwindigkeitsdifferenzen
ergeben. Wir wollen Ihnen lieber ein Programm zeigen, mit dem Sie die Geschwindigkeit eines
einzelnen Befehls genauso messen können wie die einer kompletten Programmroutine oder auch
eines ganzen Programmes.
Von Zeile 1 bis Zeile 63995 kann Ihr zu testendes Programm stehen. In diesem dürfen TU, TV und
TT nicht als Variablen Vorkommen. Starten Sie das komplette Programm mit RUN und warten Sie
mindestens 20 Sekunden.
0 TT=TI:FORTU=0TOTV
1 REM *** TESTANFANG ***
2 A=A
63996 REM *** TESTENDE
63997 NEXT:TT=TI—TT:IFTT(1000THENTV=TU*1000/TT:GOTO0
63998 PRINTINT(10000*(TT/(TU*60)))/10”MILLISEKUNDEN PRO DURCHLAUF”
63999 PRINT’GETESTET IN”TU”DURCHLAEUFEN”
7.2. Die Geschwindigkeit der Maschinensprache.
Die Taktfrequenz Ihres Rechners beträgt genau 1 MHz, die eigentlichen Maschinensprachen
befehle brauchen zwischen 2 und 7 Taktzyklen. Das bedeutet, daß 1 Maschinensprachenbefehl
2-7 ix sec braucht. Wenn man davon ausgeht, daß eine Addition zweier Integerzahlen mit ca. 20
Befehlen zu bewältigen ist, so dauert solch eine Addition im ungünstigsten Falle 140 fxsec.
7.3. Wie kommt es zu solchen Geschwindigkeitsdifferenzen ?
Wenn wir eine Integer-Addition in Basic programmieren und diese mit unserem Testprogramm zeit
lich erfassen, so erhalten wir eine Zeit von ca. 3 Millisekunden.
10 A% = A%+A%
Das vergleichbare Maschinenprogramm ist in diesem Falle rund 20 mal schneller.
Generell kann man sagen, daß Maschinenprogramme etwa zwanzig bis tausend mal schneller
sind als in Basic geschriebene Programme. Die Geschwindigkeitsdifferenz erklärt sich dadurch,
daß die Basicbefehle vom Rechner zusätzlich zur Ausführung noch interpretiert werden müssen.
Und das dauert halt seine Zeit. Für diejenigen unter Ihnen, die jetzt sagen: „Warum soll ich dann
nicht generell in der Maschinensprache programmieren?” sei erwähnt, daß Programme in Maschi
nensprache sich wesentlich schwerer programmieren lassen als in Basic und Ihnen keinerlei
Möglichkeiten geben, Befehle einzufügen oder zu listen.
86
Page 89

8. Wie schreibe ich ein Programm?
8.1 Am Anfang steht die Idee
Bevor Sie die Idee in die Tat umsetzen, sollten Sie sich natürlich einige Gedanken machen, ob der
Computer überhaupt in der Lage ist, Ihr Problem zu lösen.
Zunächst gilt es, den erforderlichen Speicherbedarf zumindest überschlägig zu ermitteln, denn
sehr oft ist dieses die kritischste Größe überhaupt. Die zu speichernden Daten werden meistens
in Tabellen (Arrays) innerhalb von DATA-Statements Ihres Programms abgelegt.
Hier kann sehr einfach auf exakte Art der erforderliche Platzbedarf ermittelt werden.
Beim Anlegen von Arrays gelten nachfolgende Speicherbedarf-Formeln:
Array mit voller Genauigkeit:
x = 5 + 2*Z + 5*7T (Zy + 1)
y = 1 • ■ ■ Z
Array mit Integer Genauigkeit:
x = 5 + 2*Z + 2*77 (Zy + 1)
y = 1...Z
Arrays mit String-Variablen:
x = 5 + 2*Z + 3*77 (Zy + 1)
y = 1...Z
dabei bedeuten:
x = gesamter Platzbedarf in Bytes
Z = Anzahl der Dimensionen
Zi bis Z
= Größe der einzelnen Dimensionen, wie in DIM-Befehl angegeben
u
7j- = Alle Summen werden miteinander multipliziert.
Beispiel:
DIM A (5,6): REM hier ist Z = 2
X = 5 + 2*2 + 5 * (5 + 1) * (6 + 1) = 219 Bytes
DIM A % (3,4)
x = 5 + 2*2 + 2*(3 + 1)*(4 + 1) = 49 Bytes
DIM A (10,10,10)
x = 5 + 2 * 3 + 5 * (10 + 1) * (10 + 1) * (10 + 1) = 6666 Bytes
DIM A$ (5,6)
x = 5 + 2 * 2 + 3 * (5 + 1) * (6 + 1) = 135 Bytes
Sollen eventuelle Daten oder Texte innerhalb eines Programms in DATA Statements abgelegt
werden, muß man wohl oder übel Zeichen für Zeichen zählen und so den erforderlichen Platz
bedarf ermitteln. Ein Zeichen entspricht dann einem Byte.
Ferner könnte man die Ein- und Ausgabe-Intensität des zukünftigen Programms berücksichtigen.
Ihr Rechner bietet sehr viel Komfort für den Dialog mit dem Benutzer, den man selbstverständlich
auch ausnutzen möchte. Dieser Komfort kostet andererseits auch viel Platz. Wenn man davon
ausgeht, daß im allgemeinen ca. 30 % eines vollbeschriebenen Bildschirms für eine gut gestaltete
Ein-/Ausgabemaske benötigt werden, so erzielt man auch hier sehr schnell, je nach Anzahl der
Masken, den erforderlichen Platzbedarf.
Sind die Speicherbedarf-Kriterien geklärt, kann man sich mit dem Ablaufschema befassen.
8.2 Ein Schema wird erdacht (Flußdiagramm)
Um ein Flußdiagramm erstellen zu können, ist es natürlich notwendig, die dazu verwendeten
Symbole kennenzulernen.
Auch hier gibt es eine Norm. Die nachfolgende Liste zeigt die nach DIN 66001 zulässigen Symbole.
87
Page 90

Symbole nach DIN 66001 für Programmablaufpläne
Eine allgemeine Operation, die etwas ausführt
(Handlung)
Eine Verzweigung, wahlweise in eine von zwei Richtungen
(identisch mit unserer Fragestellung)
Ein Unterprogramm
(Befehlsempfänger zur Durchführung einer bestimmten
Aufgabe)
\ Programmodifikation
Operation von Hand
(Operationen, die der Rechner nicht ausführen kann,
z. B. drücken einer Taste auf dem Kassettenrecorder)
Eingabe, Ausgabe
(wenn z. B. am Anfang eines Programms Werte für eine
Berechnung vorgegeben werden müssen)
Ablauflinie
Zusammenführung von Ablauflinien
*
Grenzstelle
(z. B. Beginn oder Ende eines Programms)
Übergangsstelle oder Schnittstelle
Bemerkungen zum Ablaufplan können neben diesem
Symbol vorgenommen werden
Im nachfolgenden Beispiel eines Ablaufplans wird ein einfacher Zähler, der bis zu einem bestimm
ten Grenzwert G laufen soll, dargestellt.
88
Page 91

Dieses Flußdiagramm in die Sprache BASIC umzusetzen, ist nicht weiter schwierig:
20 INPUT’’EINGABE G”; G
30 N = 0
40 IF N = G THEN END
50 N = N + 1
60 ? N
70 GOTO 40
Die Schwierigkeit bei der Umsetzung eines Flußdiagramms in die jeweilige Programmiersprache
besteht darin, daß Programm möglichst effektiv aufzubauen. Und da hilft Ihnen - leider - ein Fluß
diagramm kaum.
Das gleiche Programm sieht optimiert so aus:
20 INPUT’’EINGABE G”; G
30 FOR N = 0 TO G: ? N: NEXT: END
Bei solchen Umwandlungen ist nur noch Ihre Erfahrung maßgebend, und die kommt erst mit der
Zeit. Seien Sie nicht ungeduldig; irgendwann ist auch Ihre Programmierung schnell und kurz.
Für den Anfang jedoch reicht auch die 1. Lösung, denn Sie wollen schließlich die ersten Ergebnisse
sehen.
Und die Wirkung ist bei beiden Programmversionen gleich.
89
Page 92

Doch kommen wir zum Thema zurück.
Flußdiagramme sind heute bei der Programmierung kaum wegzudenken. In der Groß-EDV
dienen sie zur Dokumentation und Übersichtlichkeit der Programme, und Sie als Anfänger werden
rasch die Vorteile erkennen. Auf einem Blatt Papier kann man grafisch (und natürlich mit Bleistift
geschrieben, um Korrekturen zu vereinfachen) wesentlich mehr übersehen, als in einer Programm
liste.
Gleichzeitig ist ein Ablaufdiagramm sprachenunabhängig. Ob Sie es in Maschinensprache oder
BASIC oder sonst einer Programmiersprache ausführen, bleibt gleich.
Übrigens: Ob Sie sich an die genormten Symbole halten oder nicht:
Wichtig ist, daß Sie die Kästchen groß genug zeichnen, um alle Ausführungsbefehle
einzuschreiben.
Zeichnen Sie ebenso möglichst viele Richtungspfeile an die Verbindungslinien. Sie
geraten sonst leicht bei kompliziertem Aufbau auf den falschen „Pfad“. Lassen Sie
genug Platz zwischen den einzelnen Kästchen um gegebenenfalls später ein oder zwei
Symbole nachtragen zu können.
Gehen Sie genug ins Detail bei jedem Diagrammschritt. Es reicht nicht, wenn Sie nur
3 Symbole benutzen, wie z. B.:
Beispiel:
BERECHNUNG
FALSCH
ENDE
Verhaspeln Sie sich aber auch nicht, indem Sie versuchen, die Symbole den BASIC-
Befehlen gleichzustellen.
FALSCH
90
Page 93

Versuchen Sie in Ihrer Sprache, das Problem zu unterteilen. Benutzen Sie dabei ruhig
Begriffe, die eine für Sie geschlossene Einheit bilden, wie z. B.: EINGABE DER WERTE
A UND B UND PRÜFEN AUF RICHTIGKEIT
Schreiben Sie Formeln so, wie sie im Mathematikbuch stehen:
X1/2 = - 2 ± 3-9
P P
2
8.3 Das Programm entsteht
Nachdem Sie nun die Vorarbeit geleistet haben und wissen, was Sie programmieren wollen,
beginnt die eigentliche Arbeit am Rechner.
An dieser Stelle ein Tip, der Ihnen viel Ärger ersparen kann:
1. Geben Sie zu Beginn dem Programm einen Namen. Dieser Name sollte möglichst aus einem
Wort mit nicht mehr als 12 Buchstaben bestehen.
2. Nehmen Sie sich 3 leere Kassetten, die Sie mit diesem Namen beschriften (Bleistift).
3. Speichern Sie auch schon während der Programmierung Ihr bisher erstelltes Programmteil auf
jeweils die älteste Kassette ab (Reihenfolge: Kass 1, Kass 2, Kass 3, Kass 1, Kass 2 ...), so daß
Sie zumindest die letzten drei Arbeitsschritte nachvollziehen können, wenn Ihr Rechner durch
Stromausfall o.ä. ausfällt.
4. Speichern Sie das Programm(-teil) immer mit seinem Namen ab.
Schreiben Sie hinter diesem Namen ein Kennzeichen, daß Ihnen sagt, um welche Version Ihres
Programmes es sich handelt.
Wir empfehlen Ihnen folgende Kennzeichnung:
X YY
I I
Art Lfd. Nr. (00-99)
P = Programmteil
T = Testphase
R = Fertiges Programm
Beispiel: SAVE "HAUSHALT P01 ”
SAVE "HAUSHALT P02”
SAVE "HAUSHALT P03”
SAVE "HAUSHALT T01 ”
SAVE "HAUSHALT T02”
SAVE "HAUSHALT R01 ”
Diese oben angegebene Vorgehensweise hat sich als sehr vorteilhaft erwiesen. Zum Einen sind
Sie vor allen Defekten des Rechners gefeit, da Sie eine Kopie des letzten Programmschrittes
immer auf Kassette haben. Zum Anderen ist durch die Kennzeichnung des Programmnamens
gewährleistet, daß Sie mit den verschiedenen Kassetten (und das werden immer mehr) nicht
durcheinanderkommen.
Sobald Ihr Programm fehlerfrei läuft, speichern Sie es mindestens 2 Mal hintereinander auf der
gleichen Kassette ab. Benutzen Sie dazu folgenden Befehl:
FORI = 0TO1: SAVE “PROGRAMMNAME R01“: NEXT
Überprüfen Sie die korrekte Abspeicherung durch
VERIFY
Ist Ihr Programm fehlerfrei gespeichert, so löschen Sie alle vorherigen Versionen mit Pxx und Txx.
Sollten Sie zu einem späteren Zeitpunkt Ihr Programm noch ändern und sei es auch nur die
kleinste Modifikation, so erhöhen Sie in jedem Fall die laufende Nummer um 1.
(Programmteil 1 )
(Programmteil 1 + 2)
(Programmteil 1 +2 + 3)
(Fertiges Programm Test 1 )
(Fertiges Programm Test 2)
(Fertiges Programm getestet und o.k.)
Wenn Sie alle Punkte gewissenhaft beachten, wird Ihr Archiv stets auf dem neuesten Stand sein
und Sie werden wesentlich mehr Freude mit Ihrem Rechner haben.
91
Page 94

8.4 Da stimmt doch was nicht
(Fehlersuche und Beseitigung)
Sehr viel Zeit muß im allgemeinen in einem Testlauf investiert werden, nachdem das Programm,
oder auch das Teilprogramm erstellt wurde.
Ein auf Anhieb fehlerfrei funktionierendes Programm gibt es wohl nicht, sobald es auch nur etwas
komplizierter ist.
Bei der Testphase ist es dann angebracht, das Programm in Module (Teilprogramme) aufzuteilen
und diese separat zu testen. Durch ein vorübergehendes STOP oder END am Ende eines Modules
oder Unterprogramms läßt sich der Programmablauf teilen und die Ergebnisse können somit
leichter kontrolliert werden.
Bei rechenintensiven Programmen besteht oft Unsicherheit über die Richtigkeit der Ergebnisse.
Hier empfiehlt sich, auch wieder vorübergehend, einen PRINT-Befehl an der entscheidenden
Stelle des Programms einzuflechten und damit die sonst im verborgenen ablaufenden Rechen
werte sichtbar zu machen und zu kontrollieren.
Das gleiche gilt natürlich auch bei komplexeren Dateienbehandlungen, wenn mit vielen Indizes
gearbeitet wird.
Ein PRINT-Befehl zur Ausgabe der behandelten Elemente erhöht oft in starkem Maße die Über
sichtlichkeit über den Programmablauf und dessen Ergebnisse.
8.5 Wie mache ich es schneller
Allgemein gibt es drei Verfahren, ein Programm schneller zu machen:
1. Verbessern des Ablaufgeschehens und der Berechnungsart.
Hierbei können wir Ihnen keine Tips geben, da wir nicht wissen, welches Problem Sie lösen
wollen. Solche Verfahren können jedoch die meiste Zeit einsparen.
2. Vermeiden von Unterprogrammen, Schleifen und Sprüngen.
Grundsätzlich ist dieses Verfahren schneller. Seine Nachteile sind jedoch beträchtlich. Zum
Einen wird Ihr Programm unverhältnismäßig groß und sprengt leicht die Grenzen Ihres
Rechners. Zum Anderen verlieren Sie leicht die Übersicht über solche Programme. Auch sind
solche Programme nur durch immensen Zeitaufwand zu verändern.
3. Syntaktische und Speicherungstechnische, rechnerbezogene Verbesserungen.
Hierzu gehören eine Reihe von Punkten, die einzeln nicht sehr viel Zeit einsparen; summiert
aber doch eine Menge ausmachen
a) entfernen Sie alle unnötigen Leerstellen und REM-Befehle aus Ihrem Programm;
b) Verwenden Sie Variablen anstelle von Konstanten. Die Umwandlung einer Konstanten in das
rechnerinterne Format benötigt wesentlich mehr Zeit als der Zugriff auf den Wert einer Variablen.
c) Dimensionieren Sie Ihre Variablen und Felder stets als erstes im Programm. Gehen Sie dabei
in der Reihenfolge der Benutzungshäufigkeit vor.
d) Schreiben Sie NEXT ohne die Indexvariable.
e) Schreiben Sie möglichst viele Statements in einer Zeile.
Beispiel: 5
RESTORE
DATA 9,10
6
10
REM ungünstiges Beispiel
20
REM Berechnung der Kombination
30
GOT0100
40
P = 1
50
FORI = 1 TOX
60
P = P*l
70
NEXT I
80
RETURN
READ X
100
110
GOSUB 40
120
A = P
READ X
130
92
Page 95

140 GOSUB 40
150 B = P
160 PRINT B/A
Zeit ungefähr 170 m.sec.
5 RESTORE: DATA 9,10
40 READX: GOSUB 100: A = P: READX: GOSUB 100: PRINT P/A: GOTO 63997
100 P = 1 : FORI = 1TOX: P = P * I: NEXT: RETURN
Zeit ungefähr 150 m.sec.
93
Page 96

ANHANG I
LISTE der Befehle des COMMODORE-BASIC
Befehl
ABS
AND A = B AND C
ASC B = ASC(“Q“)
ATN A = ATN (B)
CHR$ B$ = CHR$ (49)
CLOSE
CMD CMD 3
COS
DATA
DEFFN
DIM DIM B%(9), C2$(3,3)
END END
EXP
FN
FOR . . . NEXT FORI = TO 100 STEP 2
FRE ?FRE(0)
GET
GET#
GOSUB
GOTO
IF. . .THEN
INPUT
INPUT # INPUT# 1, A 45
INT
LEFTS
LEN
LET LET A = 5 * 6
LOAD
LOG
MID$
NEXT
NOT
ON . ..GOSUB
ON . ..GOTO
OR
OPEN
PEEK
POKE
Beispiel
B = ABS (A)
IF A = B AND C = 3 THEN . .
CLOSE 1
B = COS (A)
DATA 9, “PETER“
DEFFNA(X) = SIN (X)/X
B = EXP(A)
B = FNC/(Z)
GET INS
GET # 3, INS
GOSUB 1000
GOTO 170
IF A = 5 THEN A = 6
INPUT “WERT“; A
B = INT (A)
AS = LEFTS (B$,3)
A = LEN (A$)
LOAD “KURVE“ 29
B = LOG (A)
A$ = MID$ (BS.2,2)
siehe FOR ... NEXT
B = NOT B
ON A-5 GOSUB 10, 20, 30
ON A-6 GOTO 20, 30
A = AORC
IF A = B OR C = 3 THEN . . .
OPEN 1,1,1, “DATEN“
A = PEEK (B)
POKE B, A
Erklärung Seite
10
10
32
32
28
46
20
27
25
16
27
24
19
45
21
32
31
33
10
23
22
10
23
27
35
35
8
9
9
9
22
10
19
8
17
9
PRINT PRINT A$; ”=”; B$
PRINT # PRINT # 5, AS; ”=”; B$
READ
REM
RESTORE
RETURN
RIGHTS
RND
SAVE
READ A, A$
REM ERKLAERUNG
RESTORE
RETURN
B$ = RIGHT$(A$,5)
B = RND (Tl)
SAVE “VERSUCH“, 2
94
17
19
20
16
20
24
33
9
28
Page 97

Befehl
Beispiel
Erklärung Seite
SGN
SIN
SQR
STEP
STOP
STR$
SYS
TAN
THEN
USR
VAL
VERIFY
WAIT
+
-
*
/
77 A = 77
?
î
B = SGN (A)
B = SIN (A)
B = SQR (A)
siehe FOR ... NEXT
STOP
A$ = STR$ (A)
SYS (64824)
A = TAN (B)
siehe IF ... THEN
A = USR (B)
A = VAL (A$)
VERIFY
WAIT A, B, C
A = A + B
A = A - B
A = A * B
A = A/B
? A
A = A 1 B
RESERVIERTE VARIABLEN
Tl interne Zeit in Sechzigstelsekunden
Tl$
ST Status
interne Zeit in Stunden, Minuten, Sekunden
7
8
8
16
31
34
9
10
34
31
30
133
14
14
14
14
14
17
14
39
39
122
95
Page 98

CO
N3
N>
O
>
SUB
rocnN3
co 00
m
Pkrocororo
vl
CAN
ETB
CO
o
*n
mao
DO03o
c
03
[
CDroviNS03
CO
o
ti
03
03
CD
ESC
I\3
N)
CO
03
SYC
ro ro
cn
NAK
o co
*>■
o
o
A
Vl
oo
co
ro
O
O
O
O
W
ro
O
O
CD CD
mmL
OOTl
DLE
-p» co
o
m
r~
CO
■n
oao
o
3 3
ro
o
03
O
Tl
Tl
3
CD 00
o
o
OCDo00OvlO03O
>
r~
i
T|
H
Vl
03
CD
r~
ACK
00
co
CD
cn
ENQ
Pk
o
Pk
EOT
co
ocoo
ETX
ro
ro
STX
-
o o
HOS
o
o
NULL
DEZIMAL
HEXA
DEZIMAL
ASCII
ANHANG II Umwandlungstabelle der Dezimalzahlen 1-127
[
a>
cn
>
♦
t O
CO
cd
IO
CT 0)
E
Î
O)PkCD
-r»
o
0
i
CO
Vj
O)
H
-
—
03
CO
ro
CO
TCOm
O
V
•O
V
toCDCOcnCO
cn
03
T!
O
«1
Î
-
a
□
X
CD a>o01cocn
CO
OCOO
II A -•
II
Pk
CD
maiO
*
127
vi
TI
DEL
M
—
A
CO
cocoro
—
B
126
m
I
□
N
co
CD
-•
cn
O
N.
B
125
VIaV|
-
H
-<
00
co
>
co co
CDCDcn
—
æ
124
O
a
X
?
cn
CD
vl
O)cncn
CO
co00co
co
00 ■Vl
co
oo
co
o00co
cncoCD00cnvjcn
>
N
-<
♦
□
123
122
vl
vl
03
>
-V N
□
E
< c
vl
vl
00
00
X
♦
ro
v|
covl00
v:
E
H
CDPkcncocnrocn CD
00O)co
CD
O)
cn
CD cn
00vj00
O)
0)
<
$
X Q □
D
120
119
vj
vj
X
s
a
a
CO 33
coPkcocoCOroco CO
Pk co
Pk co
00cn00
-N
cn
CD
Pk
cn
c H co
118
vl
vl
CDvlCD
c
<
Q
n
TJ
O
OPkCO
ro
-
ro
-
oo
00
co
ro
CD
cnrocn
co
3 3
«
O
116
115
vlPkvlcovl
C/3 -Q
-
s
n
z
o
Pk00Pk
vl
ro
O
TJ
O
-
o
00 00oVlCOV|00vl
CD
O
Tl
o
m
□
pl14
113
vl vl
ro
æ
EB
!
K
Pk
CD cnA■Pk
roOro
ro
m
i
i
-n
-fe
n
rn
z 1“ X
O
□
S
112
03
O
Tl
~o o
E ffl
El
X
O
-
- +
vl
-Pk
a
0
110
03
m
C_
—
-pk
co ro
ro
ro
co
>
*
+
*
■vl03Vlcnvl
■Pk
-Pk03•Pk
o
a a
O
109
108
CD
CD
O
O
—
3
El
ra
X
o
Pk
Pk
oCOco
roCDro00NO
—
—
—
—
vlCOvl
■Pk
co 00
>
c__
— X
107
106
O)03CD
>
X"
—
B
u
Tl
m
D O
CO
00covl
ro0)rocnro ro03ro
—I
e°
B°
vj
Pk
vl
o
B E
104
03
C O
Z T
E
V$
0s-
NP
O'
vl
O s
Pk
03
Tl
103
03
vl
ca
□
ro
105
O)
CD
-
'
0
—
H
co
0303cn
m
4*
cn
m
□
102
a>o03
■
03
> 0
coPkco
IO
;
n-
;
-H-
03
O)
vl
00
PkPkPk
CO
D O
m B
□
100
o
03
Pk
cn
Q_ O
CD
n
□ □ BILDSCHIRM
co
ro
—
—
03
03
Pk
IO
00
CD
CO
03
CO
BILDSCHIRM
DEZIMAL
HEXA
DEZIMAL
ASCII
BILDSCHIRM
DEZIMAL
HEXA
DEZIMAL
ASCII
BILDSCHIRM
DEZIMAL
HEXA
DEZIMAL
ASCII
in Hexadezimal; ASCII und Bildschirmcode
Page 99

ANHANG III. LISTE DER FEHLERMELDUNGEN
?BAD SUBSCRIPT
?BAD DATA
7CANT CONTINUE
7DIVISION BY ZERO Division durch 0 unzulässig.
7ILLEGAL DIRECT INPUT, GET und DEFFN kann nicht direkt, sondern nur im Pro
7NEXT WITHOUT FOR
70UT OF DATA
70UT OF MEMORY Vorhandener Speicherplatz reicht nicht aus.
70VERFL0W
Ansprache eines Matrix-Elementes, welches außerhalb der
Dimensionierung der Matrix liegt, z.B. LET A (1,1,1,) = Z wenn A
dimensioniert wurde: DIM A (2,29).
Versuch, Strings in normale Variable aus einem Peripherie-Gerät
einzulesen.
Nach einer Fehlermeldung oder einer Programmänderung ist
CONTINUE nicht möglich.
gramm ausgeführt werden.
Bei der Programmschleife fehlt das entscheidende FORSTATEMENT.
Mehr READ-Anweisungen als DATA-Anweisungen sind vor
handen.
Ergebnis oder Zwischenergebnis einer Rechnung war größer als
10|38. Bei Underflow erscheint ”0” ohne einen Fehlerhinweis.
Das Programm wird hierbei fortgesetzt.
7RETURN WITHOUT GOSUB Subroutine ohne GOSUB
?REDIM’D ARRAY
7STRING TO LONG
7SYNTAX
7TYPE MISMATCH
7UNDEFD STATEMENT
7UNDEFD FUNCTION
Fehlermeldung ohne Programmunterbrechung
7REDO FROM START
Ein Feld kann nicht zweimal dimensioniert werden.
Zeichenkette länger als 255 Zeichen.
SYNTAX-Fehler (der Befehl ist fehlerhaft oder existiert nicht).
Klammer, Buchstaben bzw. Zeichen fehlen in einer Programm
zeile.
Behandlung normaler Variablen als String oder umgekehrt.
GOTO, GOSUB oder THEN zu einer nicht existenten Zeilen
nummer.
Nicht definierte Funktion wurde aufgerufen.
Versuch, nichtnumerische Daten bei einer INPUT-Operation vom
Tastenfeld in eine normale Variable einzulesen. Diese Fehler
meldung fordert Sie auf, die Eingabe zu wiederholen.
97
Page 100

IV. Zeichenvorrat der Tastatur
V. Technische Daten des cbm
Höhe
Breite
Tiefe
Gewicht
Spannung
Verbrauch
Bildschirm
Diagonale
Zeilen
Spalten
Zeichenauflösung
Darstellungsart
Sonderzeichen
Programmierung
Sprache
Anzahl Befehle
Kapazität
Kassette
Aufzeichnungsformat
Anschlüsse
Prozessor
Taktfrequenz
ANHANG V
36 cm
42 cm
47 cm
20 kg
220V ±10%/50 Hz
250 W
: 22 cm
: 25
: 40
: 8 * 8 Punktmatrix vorprogrammiert
: Hell auf dunklem Grund
(programmierbar dunkel auf hellem Grund)
: 66 grafische Zeichen
: BASIC festgespeichert in 8 kB ROM
: 64, davon 19 mathematisch, 8 Textverarbeitung,
11 Peripheriebefehle
: 16 bzw. 32 kB
: Rekorder für Standard Musikkassetten
: Einspur-Frequenzmodulation nach eigenem Standard
(1 * IEC-Bus)
5(1* 8bit Parallel mit 2-Draht Handshake)
(1*1. Kassettenrekorder)
(1 * Speichererweiterungsausgang)
(1 * 2. Kassettenrekorder)
: 6502
: 1 MHz
98
 Loading...
Loading...